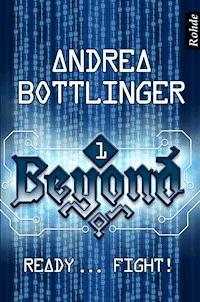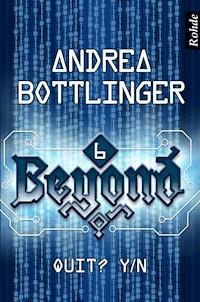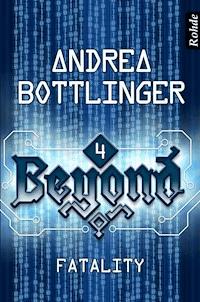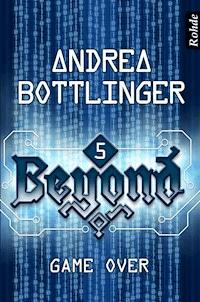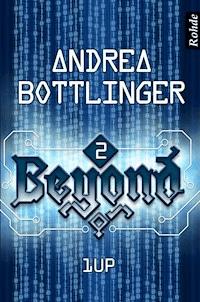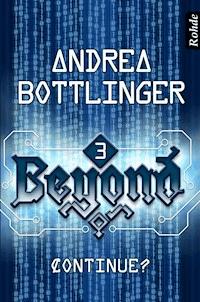8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau kämpft um ihr Glück.
Nürnberg, 1621: Annas großer Stolz ist die Papiermühle ihres Vaters: Doch nun steht sie kurz vor dem Bankrott. Ihr Vater ist resigniert, aber Anna will die Familientradition nicht aufgeben. Ein harter Kampf, der durch Bartholomäus, ihren ärgsten Konkurrenten, nur noch erschwert wird. Denn dieser versucht mit allen Mitteln, sie in den Ruin zu treiben. Dann taucht dessen Bruder Johann auf, er ist viel attraktiver, als Anna lieb ist, macht ihr den Hof und warnt sie vor Bartholomäus. Aber kann sie ihm trauen?
Historie, die lebendig wird: Liebe und Intrigen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Andrea Bottlinger
Andrea Bottlinger wurde 1985 in Karlsruhe geboren. Sie hat in Mainz Buchwissenschaften, Komparatistik und Ägyptologie studiert und lebt und arbeitet inzwischen als freie Lektorin und Autorin in Heilbronn.
Informationen zum Buch
Eine junge Frau kämpft um ihr Glück
Nürnberg, 1621: Annas großer Stolz ist die Papiermühle ihres Vaters: Doch nun steht sie kurz vor dem Bankrott. Ihr Vater ist resigniert, aber Anna will die Familientradition nicht aufgeben. Ein harter Kampf, der durch Bartholomäus, ihren ärgsten Konkurrenten, nur noch erschwert wird. Denn dieser versucht mit allen Mitteln, sie in den Ruin zu treiben. Dann taucht dessen Bruder Johann auf, er ist viel attraktiver, als Anna lieb ist, macht ihr den Hof und warnt sie vor Bartholomäus. Aber kann sie ihm trauen?
Historie, die lebendig wird: Liebe und Intrigen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Andrea Bottlinger
Das Geheimnis der Papiermacherin
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Über Andrea Bottlinger
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Danksagung
Leseprobe aus: Birgit Jasmund – Das Geheimnis der Porzellanmalerin
Impressum
Kapitel 1
Blut färbte den frisch gepressten Bogen Papier rosa. Wie sollte sie das bloß ihren Kunden erklären, fragte sich Anna, bevor ihr aufging, dass das wirklich nicht ihr erster Gedanke sein sollte. Ganz gleich, wie schwer die letzten Wochen gewesen waren. Schuldbewusst wandte sie ihre Aufmerksamkeit Kurt zu, der die blutige Hand fest an seine Brust presste. Sein Gesicht war kreidebleich, und er schwankte leicht. Anna fluchte auf eine Art, die ihre verstorbene Mutter sicher nicht gutgeheißen hätte.
Hinter der Presse, in der der halb fertige und nun blutbesudelte Papierbogen steckte, trat Heinrich hervor, der alte Mühlenbaumeister, den Annas Vater eingestellt hatte, als er noch ernsthaft am Erfolg seines Geschäfts interessiert gewesen war. Er musste die Stimme über das Geräusch der Stampfer erheben, die Tag und Nacht nicht stillstanden. »Es tut mir leid.« Sein Blick huschte immer nur kurz zu Kurts Hand. »Es ist meine Schuld, ich habe nicht aufgepasst.«
Anna war sich nicht ganz sicher, ob sich diese Worte an sie oder an Kurt richteten. Der Arbeiter schwankte stärker, und starrte mit geweiteten Augen auf seine zerquetschten Finger hinab, als könne er noch nicht ganz glauben, was eben geschehen war. Heinrich packte stützend seinen Ellenbogen, beinah wäre er gefallen.
Anna nickte müde. Sie waren alle abgelenkt. Drei Jahre waren seit dem Ständeaufstand 1618 in Böhmen vergangen. Seitdem beobachteten sie alle mit steigender Nervosität die Heere der Reste der Protestantischen Union, der Katholischen Liga und wer wusste inzwischen schon noch, wer sonst alles Interessen in diesem Krieg hatte, während sie mal näher und mal weiter entfernt an Nürnberg vorbeizogen. Nun hatten sich die Gefolgsleute des Grafen Ernst von Mansfeld, von dem es hieß, er habe bereits weite Landstriche in Hessen-Darmstadt verwüstet, um sein Heer zu ernähren, in Fürth einquartiert. Seitdem strömten Flüchtlinge in die Stadt. Die Lumpen und Stoffreste, die sie in der Papiermühle benötigten, um frische Bögen herzustellen, wurden jetzt für andere Dinge gebraucht. Was sie früher in die Faulgrube und dann unter die Stampfer geworfen hatten, wurde dieser Tage noch getragen, solange es irgendwie ging. Und danach nutzte man die Lumpen noch als Verbände für die vielen Kranken und Verwundeten, die der Krieg vor sich hertrieb. Keiner von ihnen wusste, wie lange sie noch Arbeit haben würden.
»Ihr bringt ihn besser zu einem Bader.« Anna blickte von Heinrich zu Kurt und den anderen Männern, die um die Presse herumstanden. Sie deutete auf den breit gebauten Jackel, der immer ein bisschen schuldbewusst dreinblickte, selbst wenn er nichts getan hatte. »Du gehst mit Kurt. Der Rest von euch kehrt an die Arbeit zurück! Mein Vater bezahlt euch nicht fürs Maulaffen feilhalten!«
Während Jackel Kurt aus der Mühle brachte, räusperte Heinrich sich. »Wenn Kurt und Jackel weg sind, fehlt uns ein Mann an den Bütten und einer an der Presse.«
Anna nickte. »Ich springe an den Bütten ein. An der Presse müsst ihr einfach härter arbeiten. Wir haben morgen eine Ladung Packpapier auszubringen. Das kann nicht warten.« Zumindest nicht, wenn Anna weiter darauf hinweisen wollte, dass ihr Vater die Männer für irgendetwas bezahlte.
»Und was machen wir mit dem versauten Bogen?«, fragte Heinrich.
Anna musterte den Fleck auf dem graubraunen Papier. Ein ganzer Bogen. Er hatte sie teure Lumpen gekostet. »Wir stellen hier kein Schreibpapier her«, entschied sie. »Niemand muss wissen, dass es Blut ist.«
Anna war in der Papiermühle ihres Vaters Josef Pecht aufgewachsen. Als Kind war das Geräusch der Stampfer, die Lumpen und Wasser zu einem Hadernbrei zerstießen, oft genug ihr Schlaflied gewesen. Die Bewegungen, mit denen sie das Sieb in die Bütte senkte, es schwenkte, den Hadernbrei herausschöpfte, all das hatte sich so tief in ihr Körpergedächtnis eingegraben, dass ihre Gedanken abschweifen konnten, während sie Bogen um Bogen schöpfte. Jeden davon reichte sie an einen der Männer weiter, der sie zur Presse trug, wo man sie glättete und das Wasser aus ihnen herausdrückte.
Wie so oft wanderten ihre Gedanken zu den Zahlen. Jedem Arbeiter schuldeten sie demnächst einen Gulden. Die Lumpensammler wollten insgesamt drei. Dann waren da noch neun Gulden Schulden, die ihr Vater hatte. Der Auftrag, den sie am morgigen Tag ausbringen musste, würde nicht reichen, um alles zu bezahlen. Aber es würde genügen, damit sie weitermachen konnten. Das war alles, was zählte.
Sie hörte die unsicheren Schritte ihres Vaters über das Geräusch der Stampfer erst, als er schon fast neben ihr stand. Er versuchte, sich am Rand der Bütte abzustützen, griff beinahe daneben, fing sich im letzten Moment. Der saure Geruch billigen Weins schlug Anna entgegen.
»Wasn hier los?«, nuschelte er. »Wo sind Kurt und Jackel? Warum stehst du an den Bütten, Anna?«
»Es gab einen Unfall.« Anna reichte das Sieb mit dem nächsten geschöpften Bogen an Heinrich weiter, dann drehte sie sich zu ihrem Vater um, wischte sich die feuchten Hände an ihrer Schürze ab und strich eine braune Haarsträhne unter ihre Haube zurück. »Wo warst du heute Nacht?«
Er grinste. »Meine Schulden zurückgewinnen.«
Oh nein …
»Hast du …« Anna schluckte. Sie wagte es kaum zu hoffen. »Hast du tatsächlich etwas gewonnen?«
Ihr Vater kratzte sich am Kopf, als könne er sich nicht so wirklich erinnern. Er tastete seine Taschen ab, zog schließlich einen zerknitterten Zettel hervor. Ein Schuldschein? Annas Herz klopfte schneller. Sie riss ihrem Vater den Zettel aus der Hand, glättete ihn am hölzernen Rand der Bütte.
Es war kein Schuldschein. Ihre Schultern sanken herab, während sie sich bemühte, die geschwungene Handschrift zu entziffern.
Hochverehrtes Fräulein Anna Pecht,
wir wissen, dass Ihr in der Vergangenheit dafür gesorgt habt, dass Euer Vater, Josef Pecht, seine Spielschulden zeitig und zuverlässig bezahlt. Allein deshalb sind wir bereit, auf die noch ausstehende Summe, die sich seit dem heutigen Abend um 4 weitere Gulden erhöht hat, einige weitere Wochen zu warten. Allerdings ist unsere Geduld nicht unbegrenzt. Wir erwarten, bald von Euch zu hören.
Untertänigst,
Wolfgang Gerber, Ludwig Krämer, Gerd Wagner
Man musste ihnen zugestehen, dass sie höflich waren, aber das war auch schon das einzig Gute, was Anna über die Männer zu sagen wusste, mit denen ihr Vater sich regelmäßig zum Karten- und Würfelspiel traf. Sie zerknüllte den Zettel in der Hand und atmete mehrmals tief durch, kämpfte gegen die Tränen an, die ihr in die Augen stiegen.
»Anna …«
Die Männer an der Presse hatten ihre Arbeit unterbrochen. Heinrich sah sie mitleidig an, die Blicke der anderen huschten hierhin und dorthin, als wüssten sie nicht genau, ob sie wirklich Zeuge dieses Vorfalls werden wollten.
Eilig wischte Anna sich mit dem Ärmel über die Augen. Sie hatte hart gearbeitet, um sich den Respekt dieser Männer zu verdienen. Sie würde nicht zulassen, dass ihr Vater auch das noch kaputt machte.
»Macht weiter«, befahl sie barsch. »Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Auch wenn sie nicht wusste, was das alles noch nützen sollte. Warum machte sie sich eigentlich etwas vor? Sie hatte diesen Kampf doch längst verloren.
Während Anna hinter dem Handwagen hertrottete, auf dem Jackel die neueste Ladung Packpapier durch die Straßen zog, starrte sie stur geradeaus. Nur keinen Blickkontakt zu den abgerissenen Gestalten rechts und links herstellen. Das sorgte lediglich dafür, dass die Bettler bittend die Hände in ihre Richtung ausstreckten oder gleich nach dem Karren griffen, als wollten sie ihn anhalten. Sie hatte nichts, das sie ihnen hätte geben können. Eher bestand die Möglichkeit, dass sie sich bald unter ihnen einreihen würde.
Anna merkte, wie Jackel seine Schritte beschleunigte, und bemühte sich, den Anschluss nicht zu verlieren. Sehr wahrscheinlich war es nicht, dass jemand Papier stehlen wollte, aber wer wusste schon, was die Leute in den Fässern auf dem Karren vermuteten. Besser, sie hatte ein Auge darauf. Zum Glück wurden die Straßen deutlich leerer, nachdem sie die spitzen Doppeltürme der Lorenzkirche hinter sich gelassen hatten.
Schließlich zog Jackel den Wagen in den Hof von Wolfgang Endters Druckerei. Der Herr des Hauses kam ihnen mit einem Lächeln entgegen, das meistens auf seinem breiten, freundlichen Gesicht wie festgeklebt schien. Er war nur sieben Jahre älter als Anna und hatte die Druckerei in diesem Jahr von seinem Vater übernommen.
»Fräulein Anna! Pünktlich wie immer!«
Anna ging um den Karren herum und erwiderte das Lächeln. »Ich bringe die gewünschte Lieferung.«
»Ich hoffe, sie ist besser als die letzte. Dein Packpapier wird immer dünner. Es nützt mir gar nichts, wenn es reißt und die Buchblöcke auf dem Weg zu den Kunden schmutzig werden.«
Das war nicht der Beginn, den sie sich für diese Verhandlungen gewünscht hatte. Anna bemühte sich um eine ausdruckslose Miene. »Wir geben unser Bestes, um trotz der schwierigen Umstände gute Ware zu liefern.«
Endter rümpfte die Nase. Wenn es ums Geschäftliche ging, war er immer ein zäher Brocken, aber diesmal kam es Anna so vor, als wäre seine Unzufriedenheit weniger gespielt als sonst. »Dieselbe Entschuldigung haben sie mir bereits in der Kleinweidenmühle gegeben, als sie schon wieder die Preise für das Druckpapier erhöht haben.«
Anna verzog das Gesicht. »Schon wieder?«
Die Kleinweidenmühle war die einzige Papiermühle mit dem Privileg, reinweiße Hadern zu sammeln, die man zur Herstellung von Schreib- und Druckpapier benötigte. Das erlaubte ihr, die Preise frei zu diktieren.
Endter nickte. »Hat mir gesagt, wenn es mir nicht passt, soll ich doch Papier aus Ravensburg liefern lassen. Kannst du dir das vorstellen? Liefern lassen! Während Soldaten und Räuber durch das ganze Umland streunen. Nicht, dass es zwischen denen einen großen Unterschied gäbe.«
Anna seufzte. »Wir müssen alle irgendwie für unser Auskommen sorgen.«
»Ja, ja. Lass mich die Ware mal sehen.«
Anna bedeutete Jackel, eines der Fässer aufzustemmen. Der Drucker zog einen Bogen Packpapier heraus und befühlte ihn mit Daumen und Zeigefinger. »Hm … ich erinnere mich an Zeiten, da war es doppelt so dick.«
»Jetzt übertreibst du! Wenn es doppelt so dick wäre, wäre es Pappe. Das ist gute Qualität. Es wird nicht reißen, wenn deine Männer ein wenig sorgsam damit umgehen. Aber es ist nun mal Papier. Du kannst keine Wunder erwarten.«
Das brachte Endter immerhin zum Lachen. Allerdings wurde er schnell wieder ernst. »Trotzdem, ich kann nicht den vollen Preis zahlen. Wenn es Druckpapier wäre … Druckpapier egal welcher Qualität wäre derzeit ein Segen, wenn ich es nicht von der Kleinweidenmühle kaufen müsste. Aber Packpapier, da habe ich noch drei andere Anbieter.«
Anna presste die Lippen aufeinander. Ja, wenn sie nur das Recht hätte, Schreib- und Druckpapier herzustellen, würden sich alle ihre Probleme in Luft auflösen.
Sie verhandelten noch eine Weile, und schließlich konnte Anna zumindest fast denselben Preis herausschlagen wie bei der letzten Lieferung.
Mehrere von Endters Leuten luden gemeinsam mit Jackel die Fässer vom Wagen, während Anna Wolfgang in seine Druckerei folgte. In der Nähe der Druckerpresse lagen mehrere Stapel mit Flugblättern, die gerade verschnürt wurden. Endter zog eines davon heraus und hielt es Anna hin. »Hast du die neusten Nachrichten schon gehört?«
Anna studierte das Flugblatt, auf dem oben in großen Lettern »Neue Zeitung« stand. »Ich nehme nicht an, dass du das zweiköpfige Kalb meinst, das in Wendelstein geboren wurde.« Sie tippte auf einen Holzschnitt, der eben jenes Tier zeigte.
Endter zuckte beinahe entschuldigend mit den Schultern. »Die Leute lieben solche Nachrichten.«
Ein Lachen blieb Anna im Halse stecken, als sie endlich die Nachricht entdeckte, die der Drucker meinen musste. »Ernst von Mansfeld hat Fürth verwüstet und geplündert zurückgelassen?«
Endter nickte. »Die ersten Überlebenden sind gestern angekommen. Ich habe mit ihnen gesprochen.«
Und ihnen würden wahrscheinlich viele weitere folgen. »Es wird nicht besser.«
»Ich habe das Gefühl, es wird lange nicht besser werden«, sagte der Drucker ernst. »Möge Gott uns alle behüten.«
Kapitel 2
Hörst du mir überhaupt zu, Johann?« Die mit mehreren schweren Ringen besetzte Hand seines Bruders drückte das Buch nach unten, in dem Johann las. Die lateinische Ausgabe von Homers Odyssee hatte ihm auf dem Schlachtfeld seinen Verstand bewahrt und einmal sogar einen Schwertstreich abgefangen, aber zu Hause war es ihm offensichtlich nicht vergönnt, sich darin zu vergraben. Mit einem Seufzer blickte er auf.
»Ich töte niemanden für dich, Bartholomäus.«
Bartholomäus von Treist, derzeitiger Leiter des Handelshauses von Treist samt all seiner legalen und illegalen Geschäfte, ballte die Hand zur Faust und trat einen Schritt zurück. »Er hat gedroht, mit allem, was er weiß, zum Rat zu gehen!«
Das war eine neue Information oder vielleicht hatte Johann dem Monolog seines Bruders vorhin wirklich kein sonderlich aufmerksames Ohr geschenkt. Er hatte nicht mehr zuhören wollen, als Bartholomäus angedeutet hatte, es gebe da jemanden, der ihm »im Weg« sei. Johann legte das Buch neben sich auf die breite Fensterbank des Erkers, in dem er sich mit mehreren Kissen eine Leseecke eingerichtet hatte.
»Stromer, oder? Der Tuchhändler?«
Bartholomäus nickte. Seine Hände zupften nervös an den Ärmeln seines Hemds.
Er hatte tatsächlich Angst. Johann konnte sich einer gewissen Schadenfreude nicht erwehren. Wie oft hatte er seinen Bruder vor diesem Tag gewarnt. Wenn man Schmuggel, Erpressung und den Betrieb mehrerer Bordelle zu seinem Geschäft machte, dann spürte man irgendwann den Atem des Henkers im Nacken.
Für einen Moment überlegte Johann, einfach mit den Schultern zu zucken, sich wieder dem Buch zu widmen und Bartholomäus seinen Sorgen zu überlassen. Aber sein Bruder blieb sein Bruder. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte er zu Bartholomäus aufgeschaut. Und als er versehrt aus dem Krieg heimgekommen war, hatte sein Bruder ihn mit offenen Armen empfangen. Johann wollte ihn nicht am Galgen baumeln sehen, so sehr er ihm den Schrecken auch gönnte, den die Drohung seines Geschäftsfreundes ihm eingejagt hatte.
»Was genau weiß er?«
»Er kennt die Namen einiger meiner Schmuggler. Wir verwenden sein Geschäft seit Jahren, um Waren unter den Augen des Zolls in die Stadt zu bringen.«
»Das heißt, er bringt sich selbst auf den Richtblock, wenn er dich verrät.«
Bartholomäus schnaubte. Er lief vor dem Kamin auf und ab. »Das kommt darauf an. Er hat Freunde im Rat.«
»Rede noch mal mit ihm. Schick ein paar Leute los, die ihm Angst einjagen sollen. Das machst du doch so gerne.«
»Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, Johann. Er will keine Geschäfte mehr mit mir machen. Er hat jetzt seine eigenen Leute.«
Daher wehte also der Wind. »Also willst du ihn doch vor allem deshalb loswerden, weil er ein Konkurrent ist?« Johann stand von seinem Platz am Fenster auf. Automatisch entlastete er sein linkes Bein, verlagerte das Gewicht nur vorsichtig darauf. Es tat seit ein paar Tagen nicht mehr weh, aber er hatte es so lange geschont, dass er sich erst wieder daran gewöhnen musste, es zu benutzen. »Wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass er dich verrät? Lüg mich nicht an, Bartholomäus!«
Sein Bruder schwieg für einen Moment mit aufeinandergepressten Lippen. »Die Möglichkeit bereitet mir allen Ernstes Sorgen.«
Johann schnaubte. Er kannte seinen Bruder lange genug. Es gab kaum etwas, das Bartholomäus keine Sorgen bereitete. Und es sah seinem Bruder ähnlich, die Situation zu übertreiben, damit Johann sich gezwungen fühlte, ihm zu helfen.
»Johann, hör mir zu …«
»Nein! Ich spiele nicht den gedungenen Mörder für dich.«
Er drückte die Odyssee an seine Brust, spürte unter den Fingerkuppen die Kerbe auf dem einfachen Ledereinband, und schob sich an seinem Bruder vorbei zur Tür.
»Du bist ein Söldner!«, rief Bartholomäus ihm hinterher. »Wie viele Kehlen hast du schon aufgeschlitzt? Du hast mir selbst von diesem Offizier erzählt, den du im Schlaf ermordet hast! Und jetzt wirst du plötzlich zimperlich?«
Bereits im Flur blieb Johann noch einmal stehen. Es gab kaum etwas, das er mehr bereute, als Bartholomäus diese Geschichte erzählt zu haben. »Ich war im Krieg! Aber Nürnberg ist kein Schlachtfeld. Nürnberg ist meine Heimat, und ich bringe den Krieg nicht mit hierher!«
Kapitel 3
Die Papiermühle von Annas Vater lag direkt am Ufer der Pegnitz. Ihr Rad wurde vom stetigen Strom des Flusses angetrieben, schon von Weitem hörte sie sein Klappern. In letzter Zeit war dieses Geräusch genau wie das der Stampfer zu einem Quell der Ruhe für sie geworden. Solange das Rad der Mühle noch lief, ging das Leben weiter. Der Beutel voller Gulden, den sie von Wolfgang Endter bekommen hatte, würde zumindest reichen, um die Arbeiter zu bezahlen. Die Schuldner ihres Vaters würden noch ein paar Wochen warten müssen, und dann musste sie eben mit ihnen reden. Und mit ihrem Vater. Auch wenn er ihr schon so oft versprochen hatte, mit dem Spielen aufzuhören.
»Anna!«
Während Anna noch dem von Jackel gezogenen Karren an der mannshohen Mauer entlang folgte, die die Mühle umgab, winkte ihr von der Hofeinfahrt ein Mädchen in einem zerschlissenen Kleid und einer schief sitzenden Haube zu. Wobei Mädchen wohl das falsche Wort war. Marie war gerade einmal ein Jahr jünger als Anna und damit achtzehn Jahre alt.
»Marie!« Anna beschleunigte ihre Schritte und überholte den Karren, um ihre Freundin zu begrüßen. »Ist dein Bruder auch hier?«
Marie nickte. »Der lässt mich mit unserer Beute immer noch nicht allein durch die Stadt fahren.«
»Ihr bringt neue Lumpen?« Das war die beste Nachricht, die Anna an diesem Tag bisher gehört hatte. Ihr Lager war fast leer. Sie brauchten dringend Nachschub.
Jackel stellte den Karren im Hof ab, und Anna und Marie folgten ihm durch die Einfahrt. Im Hof stand ein zweiter Karren. Auf seiner Ladefläche saß Maries Bruder Paul neben einem Haufen schmutziger Stofffetzen. Er nickte erst Jackel zu, lächelte dann, als er Anna sah. Allerdings war es nur ein kurzes, angespanntes Verziehen der Mundwinkel. Kein Wunder, der Haufen war nicht sonderlich groß, aber unglaublich schmutzig. Anna sah neben den üblichen Resten, die man von den Schneidern bekam, vor allem Stücke von etwas, was wohl einmal Getreidesäcke gewesen waren. Grober, kratziger Stoff, die schlechteste Lumpenqualität, die man finden konnte. Und irgendjemand hatte diese Säcke wohl eine Weile getragen, war vielleicht sogar darin gestorben. Es klebten Essensreste daran, und ein dunkler Fleck erinnerte Anna an das Blut auf dem Papierbogen vom gestrigen Tag.
Ein elendiger Gestank wehte von dem Haufen herüber, und sie hielt wohlweislich Abstand.
»Das ist alles?« Sie konnte nicht verhindern, dass Enttäuschung in ihrer Stimme mitschwang. Abgelenkt bedeutete sie Jackel, schon mal in die Mühle vorzugehen. Er verschwand stumm in dem Gebäude.
Paul sprang vom Wagen und hob in einer entschuldigenden Geste die Schultern. »Die Zeiten sind beschissen.«
Am Anfang, als sie immer mehr von den Geschäften ihres Vaters übernommen hatte, hatte die derbe Ausdrucksweise der Lumpensammler Anna schockiert. Ihre Mutter hatte sie dazu erzogen, irgendwann mal einen Kaufmannssohn zu heiraten, irgendeine gute Partie mit reichlich Geld. Aber nun fühlte sich Anna unter Leuten wie Paul und Marie mehr zu Hause als unter den Kaufmannstöchtern, die sie manchmal über die Nürnberger Märkte schlendern sah. Und die alle längst ihre gute Partie gemacht hatten.
Anna musterte den armseligen Lumpenhaufen erneut und versuchte abzuschätzen, wie viel Papier er hergeben würde. Zusammen mit dem, was noch in der Faulgrube lag und in diesem Moment unter den Stampfern zu Hadernbrei verarbeitet wurde, würde es auf jeden Fall reichen, um die nächste Bestellung ausliefern zu können. Ein Tuchhändler namens Stromer hatte eine nicht unbeträchtliche Menge Packpapier bei ihr bestellt.
Aber danach wären sämtliche Vorräte aufgebraucht.
»Willst du sie oder nicht?« Paul trat von einem Bein auf das andere. Er breitete entschuldigend die Arme aus. »Wenn nicht, bezahlt jemand anderes sicher gutes Geld dafür.«
»Ich will sie«, sagte Anna schnell. »Aber ich brauche mehr, und zwar bald.«
Marie biss sich auf die Unterlippe. »Tut mir leid, Anna. Wir tun, was wir können.«
Anna war klar, dass sie dieselbe Entschuldigung Endter gegenüber verwendet hatte, aber vielleicht konnte sie sie gerade deshalb langsam nicht mehr hören. Sie taten alle, was sie konnten, aber es war nicht genug.
»Ich weiß, ich weiß.«
Sie griff nach ihrem Geldbeutel, aber dabei entging ihr nicht, wie Marie sich näher an ihren Bruder heranschob und einen bedeutungsvollen Blick mit ihm wechselte. Paul zog eine Augenbraue in die Höhe, und Marie nickte nachdrücklich. Er dagegen wirkte unentschlossen.
Anna hielt darin inne, ein paar der Münzen, die sie von Endter bekommen hatte, aus dem Beutel zu fischen. »Was gibt es noch?«
Pauls Blick ruhte weiter auf seiner Schwester. »Bist du sicher?«
Noch einmal nickte Marie. »Wenn schon irgendwem, dann erzählen wir’s ihr.«
»Was erzählt ihr mir?« Annas Neugierde war nun auf jeden Fall geweckt.
Paul räusperte sich. »Wir haben einige interessante Gerüchte gehört.«
Marie grinste. »Viele Bauern in der Nähe von Fürth mussten ihre Höfe ziemlich schnell verlassen.«
Anna konnte sich denken, warum. Ernst von Mansfeld. »Ihr seid schneller als Wolfgang Endters Zeitung. Die wird gerade noch gedruckt.«
Paul winkte ab. »Das kommt davon, wenn man den Leuten auf der Straße zuhört, anstatt sich auf irgendwelche Tintenkleckser zu verlassen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Bauern nur mitgenommen haben, was sie tragen konnten.«
»Da ist ganz sicher einiges liegen geblieben«, ergänzte Marie. »Niemand packt seine Stoffreste ein, wenn er um sein Leben rennt.«
Anna verstand, worauf sie hinauswollten. Dennoch schüttelte sie den Kopf. »In Fürth dürfen wir nicht sammeln. Das ist nicht unser Gebiet.«
Diesmal war Paul derjenige, der grinste, und es wirkte mehr als nur ein wenig verschlagen. Er beugte sich vor und senkte die Stimme. »Das ist kein Problem, Anna. Wir kennen da jemanden, der weiß, wie man mit dem Zoll umzugehen hat.«
Auch Marie lehnte sich nun vor. »Wir brauchen einfach noch ein oder zwei Männer, die beim Tragen helfen, dann sind wir genug, damit sich so was lohnt. Du hast da welche in deiner Mühle, die sicher nichts gegen einen Ausflug hätten. Und wir machen dir dafür einen besonders guten Preis.«
Es klang fast zu gut, um wahr zu sein. Allerdings musste Anna nicht fragen, wo der Haken bei der Sache lag. Wenn sie erwischt wurden, wie sie Lumpen über Bezirksgrenzen schmuggelten, winkte ihnen eine lange Haft mit unbestimmtem Ende.
Wieder warf Anna einen Blick auf den mickrigen Haufen auf Pauls und Maries Wagen. Andererseits war es das Risiko vielleicht wert.
»Gut«, sagte sie schließlich. »Ich denke, Jackel hätte nichts gegen so eine Unternehmung einzuwenden.« Jackel war schweigsam und verlässlich. Er würde sicher nichts ausplaudern. »Aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Heinrich ist zu ehrlich.«
»Was ist mit Kurt?«, fragte Paul.
»Hat sich gestern die Hand verletzt.« Und sein Zustand war ein weiteres Gewicht auf Annas Schultern. Jackel zufolge hatte er angefangen, leicht zu fiebern.
»Verdammt!«
Marie biss sich auf die Unterlippe. »Drei sind kaum genug. Der Weg muss sich lohnen, und wir müssen schnell arbeiten.«
»Dann komme ich auch noch mit.« Anna war sicher, dass sie diese Entscheidung bald bereuen würde, aber nichts zu tun, würde sie auch nicht weiterbringen.
Paul musterte sie skeptisch. »Es wird gefährlich. Da draußen streunen Räuber herum. Und vielleicht sogar noch ein paar Soldaten.«
Anna stemmte die Hände in die Hüften. »Wenn du deine Schwester mitnimmst, kannst du mich auch mitnehmen.« Sie hoffte, dass sie entschlossener klang, als sie sich fühlte.
Nach einem Moment seufzte Paul und nickte. »Es wird ein paar Tage dauern, alles vorzubereiten. Rede mit Jackel. Wir melden uns bei dir.«
Anna redete nicht direkt mit Jackel. Zuerst machte sie sich auf die Suche nach ihrem Vater. Zu ihrer Erleichterung fand sie ihn an den Bütten. Mit geübten Bewegungen schwenkte er das Schöpfsieb durch den Hadernbrei. Dass seine Hände nicht zitterten, konnte nur bedeuten, dass er den Tag mit einem kräftigen Schluck Selbstgebranntem begonnen hatte, aber für den Moment war Anna einfach nur froh, dass er nicht schon wieder in der Stadt herumstreunte.
Er begrüßte sie mit einem unsicheren Lächeln, bevor er sich wieder seiner Arbeit zuwandte. Sie hasste dieses Lächeln. Es bedeutete, dass er sich nicht sicher war, ob er etwas getan hatte, das sie unglücklich machte, er aber bereits anfing, sich schuldig zu fühlen, weil er ahnte, dass es so war.
Annas Vater reichte den nächsten geschöpften Bogen an Heinrich weiter, der ihn stumm entgegennahm. Der Mühlenbaumeister warf einen Blick auf Annas ernste Miene, und beeilte sich dann, außer Hörweite zu kommen. Anna öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Was sollte sie sagen? Was hatte sie nicht schon zum hundertsten Mal gesagt?
»Du warst bei Endter?«, fragte ihr Vater schließlich, gerade laut genug, dass sie ihn über die Stampfer hinweg hören konnte.
Anna nickte. »Er hat sich über die Qualität des Papiers beschwert.«
Die Hände ihres Vaters verkrampften sich um die Griffe des Siebs. »Haben wir nicht genug Geld, um gute Lumpen zu kaufen?«
»Es gibt nicht genug gute Lumpen. Es herrscht Krieg, Vater.«
»Ich könnte …«
»Nein!« Das Wort kam deutlich schärfer über ihre Lippen, als Anna es beabsichtigt hatte, und Heinrich sah kurz zu ihnen hinüber, um sich dann aber schnell wieder abzuwenden. Anna senkte die Stimme wieder weit genug, dass nur ihr Vater sie hören konnte. »Ich weiß, dass du versuchst, deine Fehler wiedergutzumachen, Vater. Aber du hilfst mir mehr, wenn du einfach hierbleibst. Hilf in der Mühle, lass mich diese Angelegenheit regeln.«
Die Schultern ihres Vaters sackten sichtlich nach unten. »Ich bin also nutzlos.«
Und schon waren sie wieder an diesem Punkt. Egal, was Anna nun sagen würde, es würde alles nur noch schlimmer machen. »Nein«, sagte sie diesmal sanfter. »Du schöpfst gutes Papier.«
Das klang selbst in ihren eigenen Ohren schwach, und natürlich war es nicht das, was ihr Vater hören wollte.
»Ich schöpfe gutes …?« Mit einer plötzlichen Bewegung zog Annas Vater das Sieb aus der Bütte und knallte es auf deren Rand. Wasser tropfte auf den Boden. »Ich bin dein Vater, Anna! Ich sollte für dich sorgen! Stattdessen bereite ich dir nur Probleme.«
Das war der Punkt, an dem Anna ihn trösten musste, ihm sagen musste, dass es so schlimm nicht war, dass sie schon zurechtkommen würden, wenn sie nur zusammenarbeiteten und er sich ein wenig zusammenriss. So lief es immer. So konnten sie den Frieden wahren und er würde zumindest versuchen, nicht zu viel zu trinken und nicht zu viel zu spielen.
Aber Anna würde sich in ein paar Tagen Räubern stellen müssen und vielleicht in Turmhaft enden, um die Mühle überhaupt am Laufen zu halten. Sie hatte Paul gegenüber versucht, entschlossen zu wirken, aber sie hatte Angst. Richtig Angst. Und sie wollte nicht trösten und den Frieden wahren.
»Dann hör doch endlich damit auf!«
Diesmal drehten sich alle Arbeiter in der Mühle zu ihr um. Anna wirbelte herum und stürmte davon.
Kapitel 4
Die Frau, die Bartholomäus mitgebracht hatte, war mager, und tiefe Linien hatten sich in ihr Gesicht gegraben, obwohl ihre Augen gar nicht so alt wirkten. Sie saß vollkommen aufrecht auf ihrem Stuhl und hatte die Finger in den Stoff ihres Kleides verkrampft.
Bartholomäus lächelte. »Darf ich vorstellen, Johann? Das ist Sybille Stromer.«
Johanns Blick schoss zwischen seinem Bruder und der Frau hin und her. Stromer? Tuchhändler Stromer, der Bartholomäus angeblich an den Rat verraten wollte? Warum brachte Bartholomäus die Frau seines Konkurrenten in sein Haus? Die Miene seines Bruders verriet Johann gar nichts, sie war die übliche freundliche Maske, die er immer im Umgang mit Fremden zur Schau trug. Bartholomäus deutete mit einer ausladenden Geste auf Johann. »Das ist mein Bruder Johann, der vor ein paar Monaten aus dem Krieg zurückgekommen ist.«
Der Blick, mit dem Sybille Stromer ihn maß, war seltsam hoffnungsvoll.
Johann gab sich einen Ruck und trat vor. Was auch immer hier vorging, er würde es nicht erfahren, wenn er in der Tür stand und starrte. Er nickte Sybille Stromer freundlich zu. »Sehr erfreut.«
Dem unsicheren Blick der Frau nach zu urteilen, hörte man seiner Stimme an, wie wenig das der Wahrheit entsprach.
Bartholomäus räusperte sich. »Ich habe ihr gesagt, du kannst ihr eventuell helfen.«
Was für ein Spiel spielte sein Bruder hier? Hatte er es sich anders überlegt und wollte Stromer doch nicht mehr umbringen? Waren sie zu einer Einigung gekommen?
»Kann ich das?«, fragte Johann vorsichtig.
Bartholomäus’ Lächeln gewann etwas Wölfisches. »Erzähl ihm, was du mir erzählt hast, meine Liebe.«
Wieder verkrampften sich die Hände der Frau in ihr Kleid. Sie räusperte sich umständlich. »Mein Mann, er …«
»Keine Sorge, meine Liebe.« Bartholomäus schenkte ihr sein bestes Kaufmannslächeln, falsch und gierig. »Niemand hier wird schlecht über dich denken.«
Sybille schluckte und nickte. »Er schlägt unsere Kinder. Mein ältester Sohn wird seinetwegen nie wieder richtig laufen können.«
Johann ballte die Hände zu Fäusten. Er begann zu ahnen, was Bartholomäus’ mit diesem Treffen beabsichtigte. Er hätte nur nie gedacht, dass sein Bruder einmal so tief sinken würde. Zumal dieser Johanns düsteren Blick nun auch noch mit einem selbstzufriedenen Lächeln erwiderte. »Er schlägt nicht nur die Kinder, nicht wahr?«
Sybille Stromer sah zu Bartholomäus auf, und kurz glaubte Johann etwas von seinem eigenen Widerwillen in ihrer Miene zu sehen. »Das spielt keine Rolle.« Sie wandte sich Johann zu, blickte ihm direkt in die Augen. »Ich habe Angst, er wird es wieder tun. Ich habe Angst, er könnte irgendwann in seiner Wut eines der Kinder umbringen. Euer Bruder hat gesagt, Ihr könnt mir helfen.«
Für einen Moment war Johann versucht, Bartholomäus das selbstzufriedene Grinsen aus dem Gesicht zu schlagen. Er atmete tief durch. »Mir war nicht klar, dass mein Bruder so ein kaltherziger und berechnender Hurensohn ist. Hat er erwähnt, wie meine Hilfe seiner Vorstellung nach aussehen würde?«
»Johann …«, protestierte Bartholomäus.
Johann schnitt ihm mit einer schnellen Handbewegung das Wort ab, hielt den Blick auf Sybille Stromer gerichtet. Diese nickte langsam, und Johann wusste nicht, ob es das schlimmer oder besser machte.
»Ich glaube, ich sollte Euch nach Hause bringen.«
»Johann …«, begann Bartholomäus wieder.
Johann wirbelte zu ihm herum. »Dich will ich heute nicht mehr sehen!«
Zu seiner Überraschung machte sein Bruder tatsächlich einen Schritt nach hinten. Er nickte der Frau des Tuchhändlers zu, dann verließ er den Raum.
Sybille Stromer erhob sich. Johann erwartete fast, dass sie ihn genauso bedrängen würde wie Bartholomäus, aber sie schenkte ihm nur ein dünnes Lächeln. »Danke, dass Ihr mich angehört habt.«
Er nickte nur knapp und geleitete sie nach draußen. Sie schwiegen, bis die Tür von Johanns Elternhaus hinter ihnen zufiel und sie gemeinsam draußen auf der Straße standen. Fuhrwerke rumpelten vorbei und Menschen eilten an ihnen vorüber. Langsam setzten sie sich in Bewegung. Johann musste sie natürlich nicht nach Hause begleiten, aber irgendwie hatte er das Gefühl, er war ihr etwas schuldig, wenn er sie schon mit ihrer Situation alleine ließ. Und vielleicht, wenn sie in Ruhe miteinander sprechen konnten, ließ sich noch eine andere Lösung für ihr Problem finden. Auch wenn er nicht wusste, wie diese aussehen könnte.
»Ihr geht sehr gefasst mit all dem um«, sagte er schließlich.
Es dauerte einen Moment, bis Sybille antwortete. Sie machte einen Schritt zur Seite, um einem Jungen auszuweichen, der laut rufend Flugblätter feilbot. »Ich weiß selbst nicht genau, was ich über den Plan Eures Bruders denken soll. Ich weiß nur, dass ich nicht noch einmal eines meiner Kinder zu Schaden kommen lassen will.«
Johann nickte, während sein Magen sich zusammenkrampfte. Er verstand sie, verstand die schwierige Lage, in der sie stecken musste. Gleichzeitig wusste er, dass Bartholomäus auf sein Mitgefühl setzte und dass er sich in dem Netz verheddern würde, das sein Bruder für ihn spann, wenn er es zuließ.
»Was werdet Ihr jetzt tun?«, fragte er trotzdem.
»Ich weiß es nicht. Ich fürchte, wenn ich ihn vergifte, wird es zu viele Fragen geben.« Sie sprach leise genug, dass ihre Stimme fast vom Lärm in den Straßen verschluckt wurde.
Johann warf ihr einen langen Seitenblick zu. Vielleicht war gefasst nicht der richtige Ausdruck für Sybille Stromers Verhalten. Vielleicht war sie einfach an einem Punkt der Verzweiflung angekommen, an dem sie nichts mehr hatte als ihre Entschlossenheit und ein Ziel: die Sicherheit ihrer Kinder.
Wie hatte Bartholomäus wohl herausgefunden, was für ein gutes Werkzeug sie dabei sein konnte, Johann zu seinem Handlanger zu machen?
»Es würde so oder so Fragen geben.«
Nun warf die Frau des Tuchhändlers ihm ihrerseits von der Seite her einen Blick zu. »Euer Bruder sagte, wenn man ihn mit aufgeschlitzter Kehle in einer Gasse fände, würde niemand sich wundern bei all dem Gesindel, das in die Stadt strömt.«
Johann schnaubte. »Ja, das klingt nach Bartholomäus. Ganz offensichtlich hat er sich in der Zeit, in der ich weg war, nicht zum Besseren verändert.«
»Ihr wart im Krieg, ja?«
Johann nickte. Kurz überlegte er, ob er mehr verraten sollte. Nürnberg befand sich in der komplizierten Situation, dass es zwar kaisertreu, aber protestantisch war, und damit weder ganz auf der Seite der kaisertreuen katholischen Liga noch auf der der protestantischen Union stehen konnte. Aber sie hatten gerade über Mord gesprochen, insofern spielte es wahrscheinlich keine Rolle, ob Sybille Stromer ihn für die Seite verurteilte, für die er als Söldner gekämpft hatte. Und die Union war im vergangenen Jahr ohnehin zerfallen. Nun stand der Winterkönig Friedrich mit seinen Ambitionen auf den böhmischen Thron allein gegen die Liga. »Ich war Feldwebel in Tillys Heer.«
»Bei den Katholiken?«
»Bei den Kaisertreuen. Ich gebe nicht viel auf Konfessionszugehörigkeit.«
Sybille Stromer lächelte, und mit einem Mal wirkte sie genauso jung wie ihre Augen. »Die ganze Streiterei ist ein bisschen dumm, nicht wahr? Letztendlich sind wir alle Christen.«
Johann ertappte sich dabei, das Lächeln zu erwidern.
»Ich mag Euch deutlich mehr als Euren Bruder«, erklärte die Frau des Tuchhändlers nach einem Moment.
Johann lachte. »Obwohl ich Euch nicht helfen will?«
»Vielleicht gerade deshalb. Es ist eine schwierige Entscheidung, nicht wahr? Ich habe lange mit mir gerungen. Euer Bruder dagegen scheint keine Skrupel zu kennen.«
»Das ist einer der Gründe, warum ich in den Krieg gezogen bin. Möglichst weit weg von ihm.« Er machte einen Schritt um ein Fuhrwerk herum, das Weinfässer geladen hatte, und löste behutsam die Finger eines Bettlers von seinem Ärmel, als dieser nach ihm griff.
»Warum seid Ihr zurückgekommen?«
»Ich wurde verwundet und war nicht sicher, ob ich je wieder richtig würde laufen können.«
Erneut warf ihm Sybille Stromer einen Seitenblick zu. »Wie es scheint, hattet ihr Glück.«
»Ja, ich bin gesund genug, um einen weiteren Versuch zu unternehmen, mich auf dem Schlachtfeld umbringen zu lassen. Vielleicht wäre das der Gesellschaft daheim vorzuziehen.«
Sybille lachte wie ein kleines Mädchen, presste sich dann schnell eine Hand auf den Mund, als sich ein paar vorbeieilende Tagelöhner nach ihnen umsahen.
In der nächsten Straße blieb sie vor einem Haus stehen, dessen Fassade fast ebenso aufwendig verziert war wie die von Johanns Elternhaus. Die Vordertür wies einen Türklopfer aus Messing auf, der eine hässliche Fratze zog, und führte offensichtlich in ein Geschäft, dem Schild daneben nach zu urteilen. Sybille führte Johann durch einen Torbogen in einen Hinterhof und dort zu einem deutlich einfacher gestalteten Eingang. Mit der Hand an der Klinke blieb sie stehen. »Es tut mir leid, dass Euer Bruder mich dazu benutzt hat, Euch zu etwas zu überreden, das Ihr offensichtlich nicht tun wollt.«
»Dafür ist mein Bruder verantwortlich, nicht Ihr. Es tut mir leid, dass ich Euch nicht …«
Johann unterbrach sich. Die Frau des Tuchhändlers hatte die Tür einen Spalt weit aufgedrückt, halb in der Bewegung einzutreten. Durch den Spalt drang ein unterdrücktes Schluchzen heraus. Sie wurde blass. »Ihr solltet gehen.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, stieß sie die Tür ganz auf und eilte hinein. Dahinter lag die Küche, in der Feuerstelle leuchtete noch ein wenig Glut. Davor kniete ein Junge von vielleicht sechs Jahren auf dem Boden und sammelte blutige Scherben von etwas auf, das wohl einmal ein Tonbecher gewesen war. Seine Schultern zuckten, und wieder drang ein leiser Schluchzer über seine Lippen.
Johann wusste, dass sie recht hatte, dass er wirklich gehen sollte. Stattdessen stand er in der Tür und sah zu, wie Sybille sich vor ihren Sohn kniete. Stumm und mit geübter Hand tastete sie ihn ab. Er schluchzte wieder, als sie ihn aufstehen hieß. Johann sah Blutflecken an den Knien seiner Hose.
»Es tut mir leid …«, stammelte der Junge. »Es tut mir leid … Ich habe den Becher fallen lassen, Mutter.«
Und wie es aussah, hatte ihn irgendjemand dann in die Scherben gestoßen, damit er sie aufsammelte.
»Es ist gut«, sagte Sybille leise. »So etwas kommt vor. Wo ist er jetzt?«
Es bedurfte wohl keiner weiteren Erklärung, wer mit »er« gemeint war.
»Ein Kunde hat im Laden geläutet.«
»Gut. Sehr gut. Wir bringen das in Ordnung.«
Johann hielt es nicht länger aus. Er trat vollständig in die Küche und schloss die Tür hinter sich. »Ich kenne mich ein bisschen mit der Versorgung von Wunden aus.«
Der Blick des Jungen wurde ängstlich, als würde er Johann nun zum ersten Mal bemerken.
Sybille sah über die Schulter zu ihm zurück. »Warum seid Ihr noch hier?«
»Wahrscheinlich, weil ich ein Narr bin. Darf ich helfen?«
Für einen Moment starrte ihn die Tuchhändlersfrau mit ausdrucksloser Miene an, dann nickte sie knapp. »Er ist ein Freund«, flüsterte sie ihrem Sohn zu. »Geh zu ihm.«
Während sie mit einem Kehrblech die Scherben auffegte, säuberte und verband Johann mehrere tiefe Schnitte an den Knien des Jungen. Mehrmals musste er abbrechen, weil seine Hände dabei zitterten, vor Wut.
»Du bist sehr tapfer«, hörte er sich selbst sagen. »Ich habe schon Soldaten mehr jammern sehen wegen weniger.«
Der Junge schniefte und wischte sich mit dem Ärmel den Rotz aus dem Gesicht. Immerhin weinte er nicht mehr.
»Bist du der Älteste?«
Er schüttelte den Kopf.
»Mein Zweitältester«, sagte Sybille Stromer leise. »Markus.«
Schwere Schritte tiefer im Haus ließen sie zusammenfahren. »Ihr solltest jetzt wirklich gehen«, drängte sie.
Johann erhob sich, doch da wurde bereits eine Tür auf der anderen Seite des Raumes aufgestoßen. »Ich hoffe, du hast die Sauerei inzwischen beseitigt, du nichtsnutziger …«, der Tuchhändler hielt mitten im Satz inne und starrte Johann aus großen Augen an. Er war ein hagerer Mann mit einer riesigen, spitzen Nase und einem Zug um die Mundwinkel, der ihn selbst nun unglücklich wirken ließ, da sein Mund vor Überraschung halb offen stand. Seine Stirn legte sich in Falten. »Sybille, wer ist das?«
Johann setzte sein bestes Lächeln auf, obwohl in seinem Inneren kalter Zorn einen festen Klumpen formte. »Johann von Treist.« Er deutete eine knappe Verbeugung an. »Zu Diensten.«
»Du bringst einen von Treist in mein Haus?« Stromer machte einen Schritt auf seine Frau zu, aber Johann trat ihm in den Weg. Es war ein Fehler gewesen, zu bleiben, aber nun gab es kein Zurück mehr. Er konnte nicht mehr einfach gehen und so tun, als hätte er die Verletzungen des Jungen nicht gesehen und die Art, wie Sybille zusammengezuckt war, als der Blick ihres Mannes auf sie gefallen war.
»Sybille«, sagte er ruhig. »Vielleicht möchtet Ihr Euren Sohn nach draußen bringen.«
Er hörte geflüsterte Worte hinter sich, dann Schritte, eine Tür, die zuklappte. »Wie könnt Ihr es wagen?«, brauste Stromer auf. Er packte Johann an den Schultern, der gab jeden Versuch der Beschwichtigung auf. Er holte aus, und Schmerz schoss durch seine Fingerknöchel, als er den Tuchhändler genau am Kiefer traf. Dieser fiel wie ein Sack Mehl zu Boden.
Wenig später fand Johann Sybille allein auf der Stiege, die ins obere Stockwerk des Hauses führte. Sie starrte ihm ängstlich entgegen. »Ist er …?«
Johann schüttelte den Kopf, und blickte sie ernst an. »Aber wenn du dir immer noch sicher bist, musst du ihn nie wieder sehen.«
Sybille schluckte. Für einen Moment schloss sie die Augen, ihre Lippen bewegten sich wie in einem stummen Gebet, dann straffte sie die Schultern und sagte: »Ich denke nicht, dass es einen Weg zurück gibt, selbst wenn ich noch Zweifel hätte. Immer wenn sich jemand von außen einmischt, zahlen wir am Ende den Preis. Ich …« Sie stockte. »Ich will nicht wissen, was er nach dem heutigen Tag täte. Ich bin mir sicher.«
»Dann bin ich es auch. Du musst keine Angst mehr vor ihm haben. Er wird euch nichts mehr tun. Man wird ihn mit aufgeschlitzter Kehle und ohne Geld und ohne Schuhe in einer Gasse finden.«
Tränen rollten über Sybilles Wangen. »Danke … Johann. Falls ich je irgendetwas für dich tun kann …«
»Da gibt es etwas. Wenn mein Bruder in ein paar Wochen zu dir kommt, mit einem Angebot, das Geschäft aufzukaufen, mach es ihm so schwer wie möglich.«
Sybille lachte durch die Tränen. »Darauf kannst du dich verlassen.«
Bartholomäus stellte Johann gerne einen Wagen zur Verfügung, auf dem er den Tuchhändler unter viel Stroh verborgen durch die Stadt schieben konnte, ohne dass jemand etwas bemerkte. Er hielt sich dankenswerterweise mit jeglichen Kommentaren zurück. Als Johann allerdings mitten in der Nacht mit Blutflecken an den Ärmeln nach Hause zurückkehrte, wartete sein Bruder bereits mit zwei Bechern Wein auf ihn. Einen davon drückte er Johann in die Hände, und dieser stürzte ihn in einem Zug hinunter. Der Alkohol nahm dem schlechten Gewissen kaum den Biss.
»Du hast die richtige Entscheidung getroffen.«
Johann schnaubte. »Es gab keine richtige Entscheidung. Und du kannst froh sein, dass du mein Bruder bist.«
Bartholomäus lächelte nachsichtig. »Wie wäre es, wenn du morgen nach Regensburg reist und dort ein paar Geschäfte für mich abwickelst?«
Johann beäugte ihn misstrauisch. »Legale?«
»Vollkommen legal. Und du kannst die Hälfte der Einnahmen behalten, für deine Mühe.«
Johann war klar, dass Bartholomäus ihn aus der Stadt haben wollte, falls es doch Ärger geben sollte. Aber es war ihm nur recht, dann musste er das Gesicht seines Bruders für die nächsten Tage nicht sehen.
Er nickte.
Kapitel 5
Sie verließen Nürnberg gegen Mittag. Anna war übel. Sie hatte seit dem Morgen kaum einen Bissen herunterbekommen, und während sie an den gerüsteten und bewaffneten Wachen am Stadttor vorübergingen, hatte sie das Gefühl, die Männer müssten ihnen ansehen können, was sie vorhatten. Jeden Moment rechnete sie damit, dass ein Ruf ihre kleine Gruppe zurückhielt.
Sahen sie nicht verdächtig aus? Jeder von ihnen trug ein langes Messer am Gürtel – gut, alles andere wäre in diesen Zeiten wahrscheinlich dumm gewesen. Paul sowie sein Freund Matthias, der sich angeblich damit auskannte, wie man alle möglichen Arten von Waren schwärzte, zogen außerdem Handkarren, die aus irgendeinem Grund mit Feuerholz beladen waren. Matthias hatte angekündigt, das später noch zu erklären. Er war ein eher schlaksiger Mann mit einem Bart, der nicht richtig wachsen zu wollen schien, und einem ständigen Lächeln auf den Lippen, als würde er sich gerade über einen Witz amüsieren, den nur er kannte.
Anna, Marie und Jackel trotteten hinter den Karren her, und erst als das Stadttor außer Sicht geriet, atmete Anna erleichtert auf. Nach und nach konzentrierte sie sich weniger auf das, was vor ihnen lag, und mehr auf ihre eigentliche Umgebung.
So dicht bei der Stadt gab es keine Hinweise auf einen Krieg. Das Getreide war längt geerntet, aber noch standen goldene Stoppeln auf den Feldern. Ein Stück weiter waren magere Bauern damit beschäftigt, Steckrüben aus der Erde zu ziehen. Nur hin und wieder kamen ihnen Menschen entgegen, die große Säcke mit ihrer Habe oder erschöpfte, weinende Kinder auf den Schultern trugen. Der große Flüchtlingsstrom war offensichtlich bereits wieder dabei, zu versiegen. Fürs Erste zumindest.
Nach der ersten Meile drehte Matthias sich im Gehen zu ihnen um. »Langsam kommen wir in das Gebiet, in dem die Räuber sich etwas trauen. Aber keine Angst, meine Damen. Tut einfach, was ich sage, und euch wird nichts passieren.« Bei diesen Worten zwinkerte er Anna und Marie zu.
Anna runzelte die Stirn. In der Mühle tat jeder, was sie sagte, und ihre Kunden behandelten sie wie eine Gleichberechtigte. Es war lange her, dass jemand so von oben herab mit ihr gesprochen hatte. Für einen Moment vergaß sie ihre Nervosität und erwiderte Matthias’ Blick mit düsterer Miene. »Solange du nicht vergisst, dass dies meine Unternehmung ist und nicht deine.«
»Oh natürlich«, spottete Matthias. »Wenn wir Räubern begegnen, sagen wir ihnen einfach, dass wir in deinem Auftrag unterwegs sind. Dann rennen sie bestimmt mit eingezogenen Schwänzen davon.«
Anna presste die Lippen aufeinander und schwieg. Sie waren auf das Wissen und die Fähigkeiten dieses Mannes angewiesen, wenn die Unternehmung gelingen sollte. Wenn sie wütend auf ihn werden wollte, dann wartete sie damit besser, bis sie wieder sicher hinter den Stadtmauern waren. Nach einem Moment wandte sich Matthias mit einem Grinsen ab, für das sie ihn gerne getreten hätte, und setzte seinen Weg fort.
Es war ein halber Tagesmarsch nach Fürth, und je weiter der Tag fortschritt, desto mehr bereute Anna, kaum etwas gegessen zu haben. Sie versuchte, sich von ihrem knurrenden Magen abzulenken, indem sie sich darauf konzentrierte, sich über Matthias aufzuregen. Der Schmuggler redete praktisch ununterbrochen und lieferte ihr damit genügend Material. »Die Flüchtlinge sind schlecht fürs Geschäft«, beschwerte er sich. »Sind überall im Weg. Ein paar meiner besten Freunde sind Bettler, wisst ihr. Immer gut, wenn man wissen will, was vor sich geht. Auf jeden Fall, die sind ehrliche Bettler, wenn ihr versteht, was ich meine. Haben ihre festen Plätze, geben ihren Anteil an die richtigen Leute ab. Das alles. Aber jetzt? Diese Flüchtlinge meinen wirklich, man kann sich einfach an eine Straßenecke setzen und die Hände ausstrecken und sich Bettler nennen. Das wird noch Ärger geben, sage ich euch.«
»Er redet Unfug, oder?« flüsterte Anna Marie zu.
Ihre Freundin schüttelte den Kopf. »Du musst das Recht haben, an bestimmten Ecken zu betteln, sonst gibt es Ärger mit den falschen Leuten.«
Wahrscheinlich war es gut, das zu wissen, falls es sie demnächst betreffen sollte.
Sie war sich nicht sicher, ob es schlimmer oder besser war, als Matthias anfing, zu singen. Er hatte eine recht angenehme Stimme, allerdings gab er damit nur Lieder zum Besten, die wahrscheinlich selbst der einen oder anderen Hure die Röte in die Wangen getrieben hätte. In ihrer kleinen Gruppe war es vor allem Jackel, dessen Wangen sich rot färbten. Als Matthias das bemerkte, lehnte er sich im Gehen bewusst in die Richtung des anderen Mannes und sang ihm die unanständigsten Zeilen direkt ins Gesicht. Immerhin war er nicht wählerisch damit, wem er auf die Nerven ging.
Schließlich kamen im Licht der untergehenden Sonne die Dächer von Fürth in Sicht. Anna hatte halb damit gerechnet, die Stadt brennen zu sehen, aber zumindest aus der Ferne wirkte sie recht friedlich.
Dann fanden sie den Baum mit der Leiche.
Der Baum stand vor dem Haupthaus eines Bauernhofs. Zuerst streifte Annas Blick ihn nur, ganz auf die niedrigen Gebäude konzentriert, deren Türen schief in den Angeln hingen und deren Fensterläden herausgebrochen worden waren. Erst nach einem Moment befiel sie das Gefühl, etwas übersehen zu haben, und sie betrachtete den Baum genauer.
Der Mann hing an einem dicken Ast, ein Strick schnitt tief in seinen Hals, seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Er trug nichts als dreckige Lumpen und keine Schuhe mehr.
Anna öffnete den Mund, war sich halb der Tatsache bewusst, dass ein Laut über ihre Lippen drang, eine Mischung zwischen einem Würgen und einem entsetzten Ruf. Ihr ohnehin leerer Magen krampfte sich zusammen.
»Da werden wir wohl nicht mehr so viel finden«, stellte Paul ungerührt fest. »Wie es aussieht, sind Mansfelds Männer uns zuvorgekommen.«
Anna konnte den Blick nicht von dem Toten nehmen. Sie spürte, wie Marie ihre Hand drückte. »Er kann dir nichts mehr tun. Er ist tot.«
Wenn das beruhigend sein sollte, war es nicht sehr erfolgreich. Anna fragte sich, wie ihre Freundin so ruhig bleiben konnte. Dann fiel ihr ein, dass die meisten Lumpen ehemals von jemandem getragen worden waren. Marie sah wahrscheinlich viele Tote während ihrer Arbeit.
Matthias schritt zügig auf den Baum zu, zog dabei das lange Messer hinter seinem Gürtel hervor.
»Was hast du vor?«, fragte Anna mit schriller Stimme.
Matthias blieb stehen und drehte sich zu ihr um. »Du wolltest Lumpen, oder nicht? Ich schneide ihn runter.«
»Das …« Anna räusperte sich. Was hatte sie erwartet? Dass dieser Ausflug einfach und angenehm werden würde? Sie zwang sich zu einem Nicken. »Ein guter Gedanke.«
Sie ließ Maries Hand los, drückte die Schultern durch und wandte sich ihrer Freundin und Jackel zu. Vorhin hatte sie noch darauf bestanden, dass sie die Unternehmung anführte. Es wurde Zeit, dass sie sich entsprechend verhielt. »Wir sollten uns im Haus umsehen.«
Als sie zu dritt auf die herausgebrochene Tür des Bauernhauses zugingen, glaubte Anna die Blicke des Toten im Nacken zu spüren. Sie schauderte.
Drinnen fanden sie zerschlagene Möbel und eine geplünderte Speisekammer. Außerdem eine weitere Leiche, diesmal eine Frau mit aufgeschlitzter Kehle und zerrissener Kleidung. Anna presste die Hand auf den Mund, um sich nicht zu übergeben, starrte die Frau für einen Augenblick einfach nur an. Was hatte sie sich nur gedacht? Sie hatte natürlich gewusst, dass hier Menschen gestorben waren. Es hatte in Endters Flugblatt gestanden, und es war nun mal das, was im Krieg geschah. Und es war nicht so, als hätte sie noch nie einen Toten gesehen. Manchmal starb ein Bettler am Straßenrand, und es dauerte ein wenig, bis ein Leichenwagen kam, um ihn einzusammeln. Und da war ihre Mutter gewesen, auch wenn sie friedlich gewirkt hatte in ihrem Bett, als wäre der Tod nach ihrer langen Krankheit eine Erleichterung.
Aber das hier, das war nicht einfach nur der Tod. Das war das Versprechen, dass dasselbe ihr passieren konnte, wenn sie hier zu lange blieb. Vielleicht würde sie nie nach Nürnberg zurückkehren.