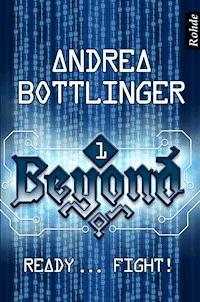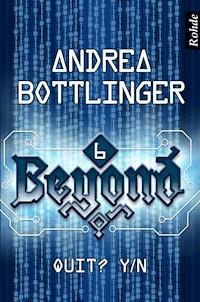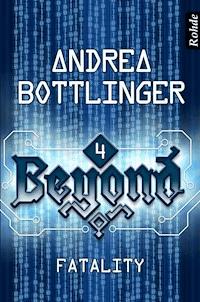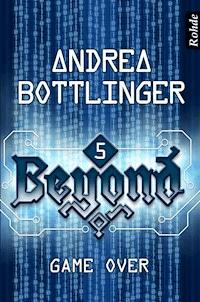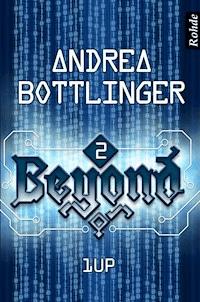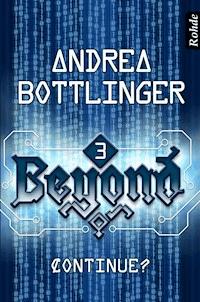8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau kämpft für ihre Überzeugung.
Augsburg, 1517: Felicitas verfolgt gebannt das Geschehen um Martin Luther und ist fasziniert von seinen Ideen. Doch ihre Versuche, Anschluss an den Augsburger Humanistenzirkel zu finden, scheitern. Erst als Felicitas unter männlichem Namen Briefkontakt mit den Anhängern Luthers aufnimmt, fühlt sie sich endlich ernst genommen. Sie lernt Gabriel, den Sohn eines Druckers, kennen. Zusammen verfassen sie kämpferische Flugschriften. Doch dann will er sie besuchen, und Felicitas’ Geheimnis droht aufzufliegen – und das könnte nicht nur ihr Leben zerstören ...
Authentisch und gut recherchiert: Eine junge Frau, die den Fortgang der Reformation beeinflussen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Als Tochter aus gutem Hause lernt Felicitas Latein und liest bevorzugt humanistische Schriften. Sie ist fasziniert von den Ideen Martin Luthers. Heimlich und unter dem Namen ihres Bruders Leopold, nimmt Felicitas Briefkontakt mit Anhängern des Reformators auf. Ein reger Austausch entsteht, und zum ersten Mal fühlt Felicitas sich ernstgenommen. Vor allem zwischen ihr und Gabriel entspinnt sich eine enge Freundschaft – allerdings unter falschem Namen. Als sie selbst beginnt, reformatorische Flugschriften zu verfassen, dringt Gabriel auf ein Treffen, er bietet ihr an, nachts Exemplare in der Druckerei seines Vaters zu drucken. Felicitas muss sich entscheiden: Gesteht sie dem jungen Mann, der ihr so wichtig geworden ist, ihre wahre Identität? Und dann droht ihrem Bruder der soziale Ruin, denn der Papst erlässt einen Kirchenbann für die Anhänger Luthers und Leopolds Name steht auf der Liste …
Über Andrea Bottlinger
Andrea Bottlinger wurde 1985 in Karlsruhe geboren. Sie hat in Mainz Buchwissenschaften, Komparatistik und Ägyptologie studiert und lebt und arbeitet inzwischen als freie Lektorin und Autorin in Frankfurt.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane „Das Geheimnis der Papiermacherin“ und „Die Kompassmacherin“ lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Andrea Bottlinger
Das Schicksal der Reformatorin
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1: Augsburg, 1519
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Nachwort
Impressum
Kapitel 1
Augsburg, 1519
Felicitas wollte nicht unbedingt an der Tür zur guten Stube lauschen. Nur allzu gern hätte sie sich wie die wohlerzogene junge Frau verhalten, die sie war. Und dazu gehörte auch, das wusste sie, nicht in kalten Fluren herumzustehen und das Ohr an das Holz einer verschlossenen Türe zu drücken. Allerdings hatte ihr Vater ihr schwerlich eine andere Wahl gelassen. Sie hatte ihn gebeten, dabei sein zu dürfen, während sein Freund Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden zu Besuch war. Er hatte abgelehnt.
Von Adelmannsfelden sei ein sehr einflussreicher und wichtiger Besucher, hatte ihr Vater gesagt. Domherr und Stiftspropst von St. Gertraud in Augsburg und zudem Stiftsherr von Ellwangen. Er hatte den Bischof von Eichstätt einmal auf einem Reichstag vertreten, und er war Mitglied der Sodalitas litteraria Augustana, des Humanistenzirkels um Konrad Peutinger.
Ganz sicher hatte er keine Zeit für junge Frauen, die sich ein bisschen zu sehr für Martin Luther begeisterten. Ja, er war dem Wittenberger einmal begegnet und sprach seitdem in hohen Tönen von ihm, aber deswegen wollte er noch lange nicht darüber mit nur halb verständigen Fragen gelöchert werden. Für diesen geselligen Abend wollten die Männer unter sich sein.
Davon, dass sie sich auch von der Tür fernhalten sollte, hatte er allerdings nichts gesagt.
»Habt Ihr den Bericht Melanchthons über die Disputationen zu Leipzig schon gelesen?«, drang Adelmanns Stimme durch das Holz. »Er zeichnet ein sehr gutes Bild.«
Felicitas hatte den Bericht gelesen, und alles in ihr drängte danach, die Tür aufzustoßen und ein paar Punkte anzusprechen, die sie seitdem beschäftigten. Melanchthon hatte in seinem Bulletin heftige Kritik am Disputationsstil von Luthers Gegner Johannes Eck geübt, aber ihrer Meinung nach war er noch nicht genügend ins Detail gegangen. An einigen Stellen hätte sie gern noch mehr über den tatsächlichen Verlauf des Gesprächs gewusst und stattdessen etwas weniger darüber, was für ein guter Christ Luther angeblich sei. Auch wenn er das ohne Zweifel war.
»Ich habe ihn gelesen, aber ich bin unschlüssig«, sagte ihr Vater stattdessen nur. »Ich möchte mir kein abschließendes Urteil bilden, bevor ich nicht die Texte der beiden Kontrahenten gelesen habe, die noch immer nicht veröffentlicht werden dürfen. Was man darüber hört, wie Luther den Ketzer Jan Hus verteidigt hat, finde ich bedenklich.«
Felicitas ballte die Fäuste. »Er hat ihn nicht im Ganzen verteidigt«, flüsterte sie. »Er hat nur …« Ach, wenn sie doch nur mitreden könnte.
»Er hat lediglich argumentiert, dass ein paar ausgewählte Sätze Hus’ durchaus christlich seien«, sagte von Adelmannsfelden. »Das lässt sich schwerlich damit gleichsetzen, den Mann als Ganzes in Schutz zu nehmen.«
Felicitas nickte eifrig. Von Adelmannsfelden schien wirklich ein sehr verständiger Mann zu sein. Ihre Hand wanderte ohne ihr Zutun zur Klinke, und sie zog sie schnell zurück, bevor sie etwas Dummes tun konnte.
Durch das Holz hörte sie das »Hm, hm« ihres Vaters. Das war ein Laut, den er immer machte, wenn er nicht ganz mit etwas einverstanden war, aber nicht direkt widersprechen wollte. »Wurde in Erfurt inzwischen eine Entscheidung darüber getroffen, wann die Texte veröffentlicht werden dürfen?«
Und nun lenkte er ab! Frustriert presste Felicitas die Lippen aufeinander.
»Nein, sie diskutieren immer noch, wer die Disputation gewonnen hat. Erst danach kann es zur Veröffentlichung kommen.«
Felicitas seufzte. Bis sich die gelehrten Herren auf irgendetwas geeinigt hatten, konnte es noch ewig dauern. Da ging ihre Hoffnung dahin, die gesamten Texte bald zu lesen.
»Felicitas, das gibt aber Ärger!«
Die Stimme ihres kleinen Bruders ließ sie herumfahren. Der zwölfjährige Markus stand auf der untersten Stufe der Treppe. Mist.
Einerseits war es gut, dass er sie erwischt hatte und nicht ihre Mutter. Andererseits musste sie sich nun irgendetwas einfallen lassen, wie sie ihn dazu bringen konnte, sie nicht zu verraten.
»Wolltest du nicht draußen spielen?«, fragte sie. Meistens kümmerte ihn doch sonst nichts anderes, als hinter dem Haus imaginäre Söldner herumzukommandieren.
Markus starrte zu Boden. »Das macht nicht mehr so viel Spaß, seit Leopold nach Padua zum Studieren gegangen ist.«
Dass Markus ihren älteren Bruder vermisste, war traurig, aber mit jedem verstreichenden Augenblick verpasste Felicitas mehr von dem, was hinter der Tür gesprochen wurde. Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen. »Leopold hat doch nie mit dir gespielt«, sagte sie. Meistens hatte er bis tief in den Tag hinein geschlafen und dann die Abende mit Freunden verbracht.
»Oh doch!«, behauptete Markus. »Ich habe Jerusalem für ihn erobert, und dann habe ich ihm Bericht erstattet, und er hat mir neue Befehle gegeben!«
Unter anderen Umständen hätte Felicitas das sicher herzallerliebst gefunden. Nun jedoch lenkten sie Geräusche hinter der Tür ab. Die Stimmen waren ein wenig lauter geworden. Verpasste sie gerade einen Disput? »Wenn du diesmal für mich auf Eroberungszug gehst, kannst du mir später Bericht erstatten«, bot sie an.
Markus verzog das Gesicht. »Man erstattet aber dem König Bericht, nicht der Königin.«
Als ob das für ein Spiel irgendeinen Unterschied machte. Felicitas musste an sich halten, um nicht die Augen zu verdrehen.
Gelächter drang durch die Tür. Also kein Disput. Von Adelmannsfelden hatte wohl gerade etwas Geistreiches gesagt.
»Wenn der König unpässlich ist, dann muss die Königin für ihn einspringen. Nun sei ein guter Söldner und …«
»Ich bin kein Söldner, ich bin ein Feldherr! Du weißt ja wirklich gar nichts über Krieg.«
Felicitas seufzte. »Markus, hör zu …«
In diesem Moment öffnete sich die Tür hinter ihr.
Und Felicitas wurde klar, dass sie vielleicht ihre Stimme etwas zu weit erhoben hatte.
»Was ist denn hier draußen los? Kann man in diesem Haus nicht einmal in Ruhe ein Gespräch führen?«
Nur langsam drehte sie sich zu ihrem Vater um, dessen massiger Körper den Türrahmen füllte. Hinter ihm konnte sie Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden an einem reichlich gedeckten Tisch sitzen sehen. »Verzeihung, Markus hat …«
»Felicitas hat gelauscht!«, krähte Markus.
Oh, warum hatte der Herr sie nur mit einem kleinen Bruder gestraft? »Das ist nicht wahr!«, behauptete sie, wobei sie dem Blick ihres Vaters auswich. Im nächsten Moment ärgerte sie sich über sich selbst. Das war ganz gewiss nicht der erste Eindruck, den sie bei von Adelmannsfelden hatte hinterlassen wollen.
Mit einem ähnlichen Seufzer wie dem, den Felicitas eben von sich gegeben hatte, kniff ihr Vater sich in den Nasenrücken. »Bitte, Felicitas. Du bist eine erwachsene Frau, benimm dich entsprechend.«
Ja, das sollte sie wahrscheinlich tatsächlich. Andererseits war sie anscheinend so oder so nicht erwachsen genug, um den wirklich wichtigen Gesprächen beizuwohnen.
»Ich hätte nicht gedacht, dass eine junge Dame sich so sehr für humanistische Diskurse interessieren könnte.« Der Gast war aufgestanden und kam mit einem gütigen Lächeln auf den Lippen näher.
Sofort richtete Felicitas sich gerade auf. War ihr Haar unordentlich? Hoffentlich nicht. Wenn sie jetzt nur einen guten Eindruck hinterlassen konnte …
»Ist das Eure Tochter, Johannes?«, wandte sich von Adelmannsfelden an ihren Vater.
Bevor dieser jedoch etwas erwidern konnte, ergriff Felicitas ihre Chance. »Mein Name ist Felicitas, Stiftsherr. Ich verfolge den humanistischen Diskurs, seit ich genügend Latein beherrsche, um die Schriften zu verstehen. Ich denke, Luther hat mit seinen Thesen über den Ablasshandel einige sehr wichtige …«
Von Adelmannsfelden lachte. »Entzückend!«, rief er aus. »Johannes, was für eine wahrlich entzückende Idee, Eure Tochter entsprechend zu bilden.«
»Nun …«, murmelte Felicitas’ Vater, sichtlich unsicher, was er zu dem unerwarteten Lob sagen sollte.
Das trug sicher dazu bei, dass er sich nicht mehr daran erinnern würde, sie beim Lauschen erwischt zu haben, aber andererseits fühlte Felicitas sich übergangen. Von Adelmannsfelden hatte sie nicht einmal ausreden lassen. Er benahm sich eher, als wäre sie ein Hund, der ein interessantes Kunststück vorgeführt hatte.
»Nun, junge Dame«, wandte sich von Adelmannsfelden da jedoch an sie. »Wenn du so wissbegierig bist, warum leistest du uns nicht beim Essen Gesellschaft?«
Endlich! Das war, was Felicitas hatte hören wollen. Sicher würde sie so eine Gelegenheit erhalten, zu beweisen, wie kundig sie war. Sie strahlte den Stiftsherrn an und mied gleichzeitig den Blick ihres Vaters, als könne ihn nicht anzusehen dafür sorgen, dass er es nicht verbieten würde. »Sehr gerne«, sagte sie.
»Nun denn«, stimmte ihr Vater zögerlich zu. »Ich schätze, schaden kann es nicht.«
Felicitas musste an sich halten, um keinen Freudensprung zu machen. Sie hatte es geschafft.
*
»Ich war so dumm.« Felicitas vergrub das Gesicht an der Schulter ihrer Mutter, die ihr Stickzeug zur Seite gelegt hatte, um sie in ihre Arme zu schließen. »Ich war so dumm.«
»Aber hast du nicht bekommen, was du wolltest?« Tröstend strich ihr ihre Mutter durch das Haar. »Du durftest dabei sein, während sie über all diese wichtigen Dinge redeten.«
Felicitas schniefte. »Aber ich wollte nicht einfach dabei sein, ich wollte auch etwas sagen.«
»Hast du das nicht? Dein Vater hat mir erzählt, du hast all die Fragen des Stiftsherrn vorbildlich beantwortet.«
Allein der Gedanke daran, wie Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden sie ausgefragt hatte, trieb Felicitas neue Tränen der Wut in die Augen. »Er hat Fakten abgefragt! Fakten! Als wäre ich ein dummes Schulmädchen! Er wollte nicht wissen, was ich über Luthers Thesen oder Melanchthons Flugschrift denke. Er wollte wissen, ob ich die Thesen auswendig kenne! Und dann hat er mich nicht ausreden lassen, wenn ich darüber hinaus etwas gesagt habe!«
»Ruhig, Felicitas, reg dich nicht auf.« Wieder strich ihre Mutter ihr über das Haar, aber diesmal fühlte es sich nicht tröstend an, sondern beengend. Am liebsten hätte sie die Hand weggeschlagen. Stattdessen richtete sie sich nur auf. Mit dem Ärmel ihres Kleides wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht. »Und er hat jedes einzelne lateinische Wort für mich übersetzt, das er verwendet hat. Auch nachdem ich mehrmals gesagt habe, dass ich Latein verstehe!«
»Das war doch sehr freundlich von ihm.« Felicitas’ Mutter lächelte. »Es klingt, als hättest du einen interessanten Abend verbracht.«
Felicitas seufzte, dann nickte sie. Was sollte sie auch sonst tun? Wie sollte sie erklären, dass sie sich nicht ernst genommen fühlte, dass sie nicht den Eindruck bekommen hatte, tatsächlich Teil eines Austausches über humanistische Werte und Ideen zu sein? Dabei war es das, was sie sich so sehr wünschte. Worüber sie so viel gelesen hatte. Im ganzen Reich waren Gelehrte in eine rege Diskussion vertieft, schrieben einander Briefe, sandten einander ihre Schriften zu, publizierten ihre Gedanken und brachten sie als Bücher und Flugschriften unter das Volk. Felicitas hatte all die Ergebnisse dieses Austausches genossen und sich ihre eigenen Gedanken dazu gemacht. Nun wollte sie auch dazugehören. War das denn wirklich zu viel verlangt?
»Ich weiß etwas, das dich aufmuntern wird.« Ihre Mutter erhob sich von der Bank, auf der sie gesessen hatten, und ging zu einer Truhe auf der anderen Seite des Raumes hinüber. »Ich habe auf dem Markt heute Morgen eine wunderschöne Borte gefunden, die sich sehr gut an einem Kleid für dich machen würde. Möchtest du sie sehen?«
Nein, Felicitas wollte keine noch so schön bestickte Borte sehen. Doch ihr fehlte die Kraft für einen Streit. Also schniefte sie noch einmal und hob dann die Schultern.
Das reichte. Ihre Mutter strahlte. »Wir werden das schönste Kleid in ganz Augsburg für dich machen. Das und dein kluger Kopf werden dir bald einen hoch angesehenen, gebildeten Ehemann einbringen. Dann wirst du jeden Abend mit ihm über all die Dinge reden können, über die ein Mann mit humanistischer Bildung gerne redet, und musst nicht mehr die Freunde deines Vaters belästigen.«
Belästigen. Felicitas zog die Nase kraus. »Und wer sagt mir, dass mein zukünftiger Ehemann nicht viel lieber auch mit anderen Männern redet als mit mir?«, fragte sie missmutig.
»Ach Kind.« Ihre Mutter kramte in der Truhe. »Dein Vater beschwert sich doch die ganze Zeit, dass ich keinen Sinn für derlei Dinge habe. Es gibt sicher viele Männer dort draußen, die eine Frau wie dich zu schätzen wissen.«
Ihr Vater hatte sie allerdings auch von dem Gespräch ausschließen wollen.
»Dein Vater hätte nicht all das Geld dafür ausgegeben, dich humanistisch bilden zu lassen, wenn er meinte, dass sich das für eine Frau nicht schickt.«
Das war durchaus ein guter Punkt. Felicitas schniefte noch einmal und wischte sich erneut die Tränen aus dem Gesicht. Vielleicht hatte ihr Vater gewusst, wie von Adelmannsfelden sich verhalten würde, und hatte versucht, ihr die Enttäuschung zu ersparen. Vielleicht gab es dort draußen Gelehrte, die durchaus mit ihr reden würden. Sie musste sie nur finden. Vielleicht war es ein Augsburger Problem, dass in der Sodalitas litteraria Augustana nur Männer zugelassen waren.
»Na, siehst du.« Die Stimme ihrer Mutter holte Felicitas aus ihren Gedanken. »So ist das doch schon besser.« Ihre Mutter kam mit einem in Papier eingewickelten Päckchen zu ihr zurück. »Nun schau, ich habe schon einen Plan für das Kleid.«
Vielleicht war es wirklich an der Zeit, die Freunde ihres Vaters nicht länger zu belästigen. Während Felicitas nickte und durch die ach so schöne Borte hindurchstarrte, die ihre Mutter ihr zeigte, schmiedete sie einen Plan.
Kapitel 2
Bist du sicher, das ist alles, was ihr an Papier braucht?« Papiermüller Hannes blickte zwischen Gabriel und den wenigen Kisten hin und her, die er und seine Leute im Hof der Kobler’schen Buchdruckerei abgeladen hatten. Es war kaum ein ganzer Wagen voll gewesen. Aber die Menge passte zu der leichten Börse, die Gabriels Vater ihm gegeben hatte, um die Lieferung zu bezahlen.
Gabriel hob die Schultern. »Ich schätze, irgendwann hat jede Familie in Augsburg mindestens eine Bibel.« Er bemühte sich, nicht bitter zu klingen, aber so ganz konnte er den Ärger nicht aus seiner Stimme heraushalten. Dem Buchdruckergewerbe ging es so gut wie nie. Allerdings hatte man das größtenteils den vielen Streitschriften und Thesenpapieren zu verdanken, die all die gelehrten Herrschaften im ganzen Land produzierten. Wenn man sich allerdings weigerte, besagte Streitschriften und Thesenpapiere zu drucken, dann blieb von dem Wohlstand, den andere Drucker genossen, nicht mehr allzu viel übrig.
Hannes jedoch lachte nur. »Gebetbüchlein braucht man für jede Kommunion.« Er klopfte Gabriel auf die Schulter. »Wart’s ab, das Geschäft läuft bald wieder besser. Spätestens wenn sie diesen Luther endlich auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Habe gehört, der soll ein echter Ketzer sein und nicht mal einen großen Hehl draus machen.«
Gabriel nickte nur. Was er gehört hatte, hatte nicht ansatzweise so dramatisch geklungen, aber er wollte keinen Streit vom Zaun brechen. Den hatte er schon oft genug mit seinem Vater.
»Ich für meinen Teil«, fuhr Hannes fort, offensichtlich nicht entmutigt von Gabriels Schweigen, »finde es sehr bewundernswert, dass die Druckerei Kobler ihren Prinzipien treu bleibt. Ich meine, Geschäft ist Geschäft, aber die anderen Drucker, denen ich Papier liefere …« Er beugte sich verschwörerisch vor. »Einige von denen werden auch noch auf dem Scheiterhaufen enden, das sage ich dir. Kaum noch gute Katholiken unter denen.«
»Wer kann’s ihnen verdenken?«, konnte Gabriel sich nun doch nicht verkneifen. »Hast du gehört, in Nürnberg soll sich ein Mann einen Ablassbrief für den Mord an seiner Frau haben ausstellen lassen, noch bevor er sie umgebracht hat.« Das konnte doch nicht der Wille des Herrn sein, oder? Dass die Menschen nicht die geringste Reue mehr für ihre Taten verspürten, weil sie einen Zettel besaßen, auf dem stand, dass ihnen vergeben wurde. Aber es war das, was der Papst als Wille des Herrn verkündete – während gleichzeitig all das Geld, das der Ablasshandel der Kirche einbrachte, in immer prunkvollere Bauten in Rom gesteckt wurde. Und eventuell auch für Kurtisanen ausgegeben wurde, wollte man den Flugschriften glauben. Gabriel war geneigt, das zu tun, auch wenn er sie heimlich lesen musste.
Hannes jedoch lachte nur. »Kluger Mann! Das muss ich mir merken.« Dann lehnte er sich noch ein weniger mehr vor und legte einen Arm um Gabriels Schulter. »Ganz im Ernst, diese neue Unart, öffentlich gegen die Kirche zu schimpfen … Das wird sich wieder legen. Irgendwann treiben sie es zu weit, dann greift Rom streng durch, und dann muss deine Konkurrenz zumachen. Haltet einfach die Ohren steif bis dahin. Wirst schon sehen.«
Wieder nickte Gabriel. Glauben allerdings konnte er Hannes’ Worte nicht so ganz. Und er wollte es auch nicht. Niemand hatte es verdient, auf dem Scheiterhaufen zu landen, nur weil er darauf hinwies, dass hohe Geistliche keine Kurtisanen haben sollten. Gott mochte unfehlbar sein, aber die Menschen, die ihm dienten, ganz sicher nicht.
Kapitel 3
Sie würde klein anfangen. Felicitas blätterte durch die Flugschrift, die sie vorhin auf dem Markt gekauft hatte. Sie war nicht allzu skandalös, was man schon allein daran erkennen konnte, dass der Autor sie unter seinem echten Namen abgefasst hatte. Er war ein gewisser Daniel Habermann, und der Junge, der ihr das Flugblatt verkauft hatte, sagte, er lebe in Köln. Er schrieb auf Deutsch, und viele der Formulierungen waren holprig. Die Argumente, die er zugunsten vorsichtiger Kirchenreformen vorbrachte, hatte sie größtenteils in ähnlicher Form schon anderswo gesehen. Aber genau deshalb würde er schwerlich auf sie herabsehen können, nicht wahr? Er war es nicht gewohnt, dass man ihm bewundernd lauschte, wie das bei von Adelmannsfelden wahrscheinlich der Fall war. Er freute sich womöglich noch über jede Zuschrift.
Daniel Habermann zu schreiben war sicher. Selbst wenn er herablassend reagierte, musste sie zumindest nicht mit der Herablassung einer Person umgehen, die sie wirklich bewunderte.
Also verfasste Felicitas einen kurzen Brief, in dem sie auf einige der Punkte in der Flugschrift einging. Gerade genug, um hoffentlich einen freundlichen Austausch anzustoßen. Als sie nur noch ihren Namen unter den Brief setzen musste, hielt ihre Hand mit der Schreibfeder jedoch wie von selbst inne.
Felicitas Schäffler, das war die junge Frau, der Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden nicht einmal zugetraut hatte, die simpelsten lateinischen Phrasen zu verstehen. Die Frau, der er ständig ins Wort gefallen war, um ihr zu erklären, was sie gerade selbst hatte sagen wollen.
Ein Klopfen an ihrer Tür schreckte Felicitas auf. Sie legte die Schreibfeder beiseite. »Ja?«
Die Tür öffnete sich langsam, und Markus lugte herein. Für einen Moment starrte er sie einfach nur missmutig an.
»Was kann ich für dich tun?«, fragte Felicitas schließlich.
»Du musst sagen: ›Tritt näher, mein Vasall, und berichte mir von deinen Schlachten.‹«
Oh, wollte er nun also doch der Königin Bericht erstatten? Felicitas lächelte in sich hinein. Manche Dinge brauchten wohl einfach nur etwas Zeit.
»Tritt näher, mein Vasall, und berichte mir von deinen Schlachten.« Felicitas drehte sich auf ihrem Stuhl um, so dass sie ganz der Tür zugewandt war.
Endlich schob sich Markus ganz ins Zimmer. Etwas zögerlich trat er auf sie zu, dann fiel er auf ein Knie, wie die Ritter in Gemälden und Holzschnitten es oft taten. »Meine Königin, die Sarazenen haben die Stadt zurückerobert, aber ich habe achthundert Mann, um die Mauern zu stürmen. Was sind Eure Befehle?«
Felicitas setzte sich etwas aufrechter hin. Eine Königin würde sicher auf ihre Haltung achten. Dann dachte sie nach. Den Befehl zum Angriff zu geben, wäre einfach, aber sie wollte Markus ein wenig mehr für sein Spiel bieten. Sie versuchte, sich an alles zu erinnern, was sie aus alten Geschichten und Theaterstücken über Taktik wusste.
»Nun, mein Feldherr«, begann sie schließlich, »die Mauern einer Stadt zu stürmen, wird viele Verluste kosten. Ich denke, es wäre klüger, einen Spion hinter die Mauern zu schicken, der die Tore von innen öffnet.«
Sie war ein wenig stolz auf diesen Einfall. Er würde doch sicher für ein spannendes Spiel sorgen. Markus allerdings verzog das Gesicht. »Einen so feigen Vorschlag hätte der König nie gemacht. Wie sollen meine Männer da Ruhm in der Schlacht erringen?«
Felicitas runzelte die Stirn. Sollte sie nachgeben oder nicht? Sie wusste nicht, wie das Spiel normalerweise zwischen Leopold und Markus ablief. Aber vielleicht war es am besten, einfach in der Rolle der Königin zu bleiben. Und die würde sich bestimmt nicht widersprechen lassen.
»Ich denke, der König wäre glücklich, wenn du seine Männer nicht in den Tod führen würdest, Feldherr.«
Markus schnaubte und erhob sich. »Das war eine dumme Idee. Du verstehst es einfach nicht.« Missmutig wandte er sich zur Tür. »Ich wünschte, Leopold wäre hier. Oder ich hätte noch einen Bruder.«
Bevor Felicitas etwas sagen konnte, war er aus dem Raum. Mit einem Seufzer sackte sie auf ihrem Stuhl zusammen. Sie war sich nicht ganz sicher, was sie falsch gemacht hatte. Gab es nicht viele Epen, in denen sich die Helden listenreich verhielten?
Nun, es brachte wohl nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Mit einem weiteren Seufzer wandte Felicitas sich wieder dem Brief zu, den sie geschrieben hatte. Sie streifte die nun halb trockene Tinte an der Schreibfeder an einem Tuch ab und tunkte sie erneut in das Tintenfass. Sie musste nur noch ihren Namen unter den Brief setzen.
Bevor sie auch nur einen Strich setzen konnte, stockte sie jedoch wieder. Markus’ Worte gingen ihr nicht aus dem Kopf.
Ich wünschte, ich hätte noch einen Bruder.
Wenn nicht einmal ihr jüngerer Bruder damit zufrieden war, dass sie eine Frau war, konnte Felicitas Schäffler für einen Reformationsschreiber je genug sein, selbst für einen eher unwichtigen?
Aber nun hatte sie den Brief schon geschrieben, also würde sie ihn auch abschicken. Felicitas presste die Lippen aufeinander. Dann senkte sie schließlich die Feder auf das Papier.
Für einen Moment starrte sie auf das, was sie geschrieben hatte. Dann nickte sie. Es machte sie nicht glücklich, aber so ginge es vielleicht:
Mit den herzlichsten Grüßen
Leopold Schäffler
Leopold würde es sicher nicht einmal merken.
Kapitel 4
Gabriel lehnte sich zur Seite, damit sein Vater ihm über die Schulter sehen konnte. Er hatte den halben Nachmittag damit verbracht, das Kassenbuch des Familienunternehmens auf den neuesten Stand zu bringen, und das Ergebnis war nicht gut. Es hatte ihn veranlasst, direkt nach dem Druckermeister zu rufen.
Gabriel musste dabei äußerst alarmiert geklungen haben. Sein Vater hielt noch einen Winkelhaken mit Lettern darauf in der Hand, hatte also gerade das Setzen einer Seite unterbrochen.
Der Druckermeister runzelte die Stirn, als er die Schuldensumme sah, mit roter Tinte dick unterstrichen. »Wo kommt das her? Wir waren letzten Monat noch in den schwarzen Zahlen.«
»Dazwischen haben wir eine Lieferung neuen Papiers bekommen.« Gabriel deutete auf einen Posten einige Zeilen über der Summe. »Das verschlingt jedes Mal Unsummen. Gerade jetzt im Winter, wo die Leute ihre Lumpen lieber noch tragen, als sie zur Papiermühle zu geben.«
»Kein Papier, kein Druck«, murrte Gabriels Vater. Die Finger seiner freien Hand spielten mit einem kleinen Zettel, wie die Setzer ihn oft verwendeten, um Lücken zwischen den Buchstaben zu stopfen. Schließlich riss er sich sichtlich zusammen, stopfte den Zettel in den Winkelhaken, da, wo die Letter mit dem st wackelte. »Was sollen wir tun? Die Produktion anzuhalten, macht uns auch nicht reicher.«
Gabriel nickte. »Aber Bibeln und Gebetbücher verbrauchen so viel Papier«, wandte er ein. »Überleg mal, mit reformatorischen Flugschriften machen wir pro Exemplar weniger, aber mehr pro Bogen – dem Franz reißen die Leute die Blätter aus der Hand, als wären es warme Semmeln.«
Friedrich seufzte. Er fingerte mit der wackelnden Letter herum, aber so ganz sorgte der Zettel nicht für die gewünschte Stabilität. »Der Franz? Der in diesem Haus wohnt, das der Fugger gestiftet hat? Wo er mit Frau und Kindern auf dem Boden schläft, zwischen Tagelöhnern und Tippelbrüdern? Er wäre besser bei Gebetbüchern geblieben, dann hätten sie sein Haus nicht gepfändet. Solange neue Christen geboren werden, verkaufen sich auch christliche Schriften. Was für ein Blödsinn, keine mehr zu drucken!«
Gabriel schlug das Buch zu. Wie konnte sein Vater nur so sehr die Augen vor der Realität verschließen? »Wir verkaufen jedes Jahr weniger. Seit drei Monaten liegen die neuesten Psalmensammlungen bei uns im Lager. Selbst auf der letzten Frankfurter Messe wollte sie kaum jemand haben.«
»Kein Wunder, wenn du versucht hast, sie gegen diesen holländischen Ketzerschund zu tauschen«, brummte der Meister. Er kämpfte weiter mit der st-Letter, doch seine Finger gehorchten ihm nicht mehr. Schließlich knallte er Haken samt Lettern auf den Tisch neben das Kassenbuch.
Obwohl er damit gerechnet hatte, zuckte Gabriel zusammen. Er verfluchte sich selbst innerlich. Er hätte es wissen müssen. So eine Diskussion machte seinen Vater nur wütend. Irgendetwas anderes würde er jetzt nicht mehr erreichen.
»›Lob der Torheit‹«, wetterte der Druckermeister. »Allein der Titel! Ich hätte ahnen müssen, dass du mit so was zurückkommst. Der Lehrling könnte Bücher besser aussuchen als du. Das Geld hättest du lieber einer Magd im Badehaus gegeben.« Er schnaubte.
Gabriel spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Sein Vater war bekannt und gefürchtet für seine Wutanfälle. Gleichzeitig regte sich aber auch Trotz. Er hatte versucht, auf der Buchmesse Werke zu ergattern, die sie hier in Augsburg gewinnbringend weiterverkaufen konnten. Und sie hatten Leben in die kleine Buchhandlung gebracht, die an die Druckerei angeschlossen war. Zugegeben waren es auch Texte, die Gabriel persönlich interessierten, aber was sprach dagegen, Gewinn und Freude zu verbinden? So oder so hatte er nach den besten Interessen des Betriebs gehandelt.
Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, atmete lang aus und versuchte es noch einmal mit rationalen Argumenten. Immer ruhig bleiben, den Zorn über sich hinwegspülen lassen. So hatte es seine verstorbene Mutter schon gemacht.
»Wir können nicht verhindern, dass die Leute Veränderung wollen.« Er ließ die Worte nachhallen und wartete. Sein Vater widersprach ihm nicht.
»Wir müssen ja nicht die radikalsten Texte verkaufen und drucken, aber wir müssen mit der Zeit gehen. Wir könnten zumindest mal die alten Holzschnitte, an denen du so hängst, durch Kupferstiche ersetzen. Bilder, wie der Dürer sie macht.«
Der Druckermeister wischte seine schwarz verschmierten Hände am Latz ab und griff wieder nach dem Winkelhaken. Er stopfte das Stück Papier noch einmal etwas fester zwischen die Lettern.
»Ich weiß, wir können uns Dürer nicht leisten, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache Kupferstich. Der ist modern …«
Der Druckermeister zog bei dem Wort die Augenbrauen zusammen. Da aber keine Lettern umherflogen, traute sich Gabriel etwas mehr.
»Die anderen Drucker machen das auch so. Und was die Leute lesen wollen, sind kritische Fragen. Es liegt so vieles im Argen …«
Die st-Letter flog davon, als der Druckermeister plötzlich eine heftige Bewegung machte. Er starrte Gabriel wütend an. »Wie oft muss ich es noch sagen? Man stellt dem Papst keine kritischen Fragen. Wenn Gott persönlich auf die Erde käme, um die Heilsbotschaft zu verkünden, würdest du dich dann auch hinstellen und mit ihm über die Gebote der Kirche diskutieren? Nein, das würdest du nicht!« Je mehr er redete, desto lauter wurde seine Stimme. »Und warum nicht? Weil.« Er hob den Winkelhaken. »Es.« Der Winkelhaken stieß so heftig in Gabriels Richtung, dass dieser sich nach hinten lehnte. »Häresie.« Ein weiterer Stoß. »Wäre!«
Beschwichtigend hob Gabriel die Hände. »Es geht doch nicht um Gott. In den höheren Rängen der Kirche sitzen auch nur Menschen.«
»Häresie! Ich brenn lieber meine Presse nieder, als dieses gottlose Zeug zu verlegen!«
»Ich wollte doch nur …«
»Raus hier!« Gabriels Vater hob wieder drohend den Winkelhaken.
Für einen Moment noch zögerte Gabriel. Dann sah er das Weiß um die Knöchel des alten Druckermeisters. Er würde wirklich werfen, nicht wahr? Sein Vater war bekannt für sein Temperament, aber dass Gabriel ihn zuletzt so gesehen hatte, war lange her. Es weckte Erinnerungen an seine Kindheit, die Gabriel lieber vergessen hätte.
»So viel dazu, dass wir das Geschäft gemeinsam führen.«
»Solange du häretische Schriften verbreiten willst, wirst du es nicht mal erben! Raus jetzt, ich will dich heute nicht mehr sehen.«
Noch einmal holte Gabriel tief Luft, um es mit Vernunft zu versuchen.
»RAUS!«
Es hatte keinen Zweck, nicht jetzt. Gabriel ballte die Hände zu Fäusten, aber dann stand er von seinem Stuhl auf und marschierte zur Tür. Es war keine Flucht, dafür war er viel zu wütend. Doch als er die Tür der kleinen Schreibstube hinter sich zuschlug, prallte kurz darauf auf der anderen Seite etwas gegen das Holz. Scheppernd fiel es zu Boden, und Gabriel konnte nicht anders als erleichtert zu sein, dass es ihn nicht getroffen hatte.
Nun nur nicht stehen bleiben, sonst würden die Arbeiter an der Druckerpresse Fragen stellen. Zügigen Schrittes durchquerte er die Werkstatt, bis er schließlich in der schmalen Gasse hinter der Druckerei stand.
Dort holte er tief Luft. Es roch nach Schnee.
Verdammter Narr. Doch Gabriel war sich nicht einmal sicher, ob er sich selbst oder seinen Vater damit meinte. Er hätte ahnen müssen, wie das Gespräch ausgehen würde. Warum hatte er es überhaupt versucht?
Nun würde sein Vater ihn wieder weniger an den alltäglichen Geschäften beteiligen, ihn spüren lassen, wie sehr Gabriel von ihm abhängig war, wollte er etwas lernen, wollte er irgendwann die Druckerei erben.
Die Januarkälte kroch Gabriel die Waden hinauf. Der Vater wollte ihn also für den Rest des Tages nicht mehr sehen? Gut, Gabriel wusste schon, wo er hingehen würde. Wieder entschlossen stapfte er durch den Schneematsch in der Gasse.
Kapitel 5
Leopold hat einen Brief bekommen.« Felicitas’ Mutter klang verwundert. Sie sah durch, was die Magd Erna gerade nach oben gebracht hatte. Ein Junge von der Augsburger Botenanstalt war eben vorbeigekommen, Felicitas hatte ihn klopfen gehört, hatte gehört, wie Erna die Tür geöffnet hatte. Seitdem saß sie wie auf glühenden Kohlen. Sie wusste, sie durfte sich nicht zu auffällig verhalten. Sie hatte keinen guten Grund, an Leopolds Post interessiert zu sein. Und wenn herauskam, was sie getan hatte, bekäme sie Ärger.
»Von wem ist er?«, fragte sie gespielt gelangweilt. Sie wagte es nicht, dabei von der Näharbeit aufzuschauen, die ihre Mutter ihr aufgezwungen hatte. Gleichzeitig allerdings nahm sie den Stoff in ihren Händen kaum wahr.
Die Mutter drehte den Brief hin und her, und nun hob Felicitas doch den Blick. Das gefaltete Papier war eher schmal und schmutzig, war wahrscheinlich durch viele Hände gegangen. Zusammengehalten wurde er von einem einfachen Tropfen Wachs ohne Siegel.
Schließlich reichte ihre Mutter den Brief an Felicitas weiter. »Sieh du es dir an, ich kann die Schrift nicht entziffern.«
Viel wahrscheinlicher war, dass die hingekritzelten Lettern das Lesevermögen ihrer Mutter überstiegen, aber Felicitas war froh, den Brief in die Hände zu bekommen. Ihr Herz klopfte heftig, als ihre Finger das Papier berührten.
»Er ist aus Köln.« Darauf hatte sie gehofft, und wahrscheinlich klang ihre Stimme ein wenig belegt.
»Köln? Ich wusste nicht, dass Leopold dort Freunde hat, aber wir sollten den Brief wohl nach Padua weiterleiten.«
Das war ihre Chance! »Das kann ich übernehmen«, bot Felicitas an. »Ich wollte ohnehin nachher noch zum Bäcker gehen. Sonst bringt Erna wieder das verbrannte Brot mit.«
»Du solltest solche Botengänge nicht erledigen müssen«, wandte ihre Mutter ein.
»Es macht mir nichts aus, und den Brief sollte jemand abschicken, der lesen und schreiben kann.«
»Nun gut.«
Felicitas musste all ihre Willenskraft aufwenden, um ihre Miene gelangweilt zu halten. Sie schob den Brief in die Tasche ihres Rocks und beugte sich dann wieder über ihre Näharbeit. Die Mutter würde sie nicht gehen lassen, solange sie nicht diese eine Naht beendet hatte. Was sie vor sich liegen hatte, war der Ärmel des Kleides, das ihr angeblich einen guten Ehemann einbringen sollte. Felicitas presste die Lippen aufeinander und nähte, so schnell sie konnte, gerade noch gründlich genug, dass sie nicht alles noch mal auftrennen musste, sobald ihre Mutter es sah.