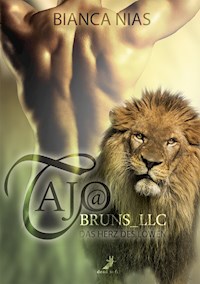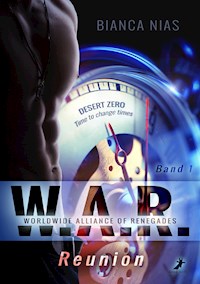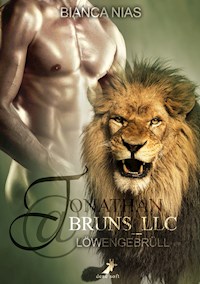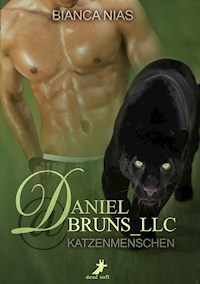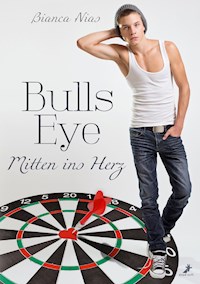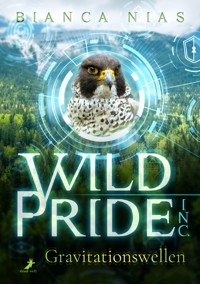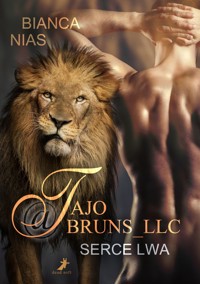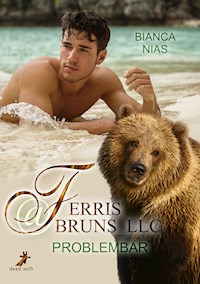5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein fürstliches Schloss im Westerwald, das auf einem mächtigen Basaltfelsen über der Stadt Westerburg thront. Der Geist eines Grafen, der an die Burgfeste gebunden ist und über seine Untertanen wacht. Und nicht zuletzt ein sagenhafter Schatz, der unter dem siebten Hund verborgen ist … Sebastian ist neun Jahre alt, als es ihn auf Schloss Westerburg verschlägt und er den Grafen Peter kennenlernt, der dort seit fast achthundert Jahren sein Dasein als Geist fristet. Eine innige Freundschaft entwickelt sich zwischen dem umherspukenden Ritter und dem schüchternen Jungen, die sich über die Jahre hinweg verfestigt. Als unsichtbarer bester Freund ist Graf Peter auch mit Rat und Tat an Sebastians Seite, als dieser sich mit sechzehn zum ersten Mal verliebt: ausgerechnet in Felix, den coolen Konditorlehrling. Gleichzeitig wächst die Sorge um den Erhalt der Westerburg, die nur durch eine schwerwiegende Entscheidung ihres Schlossgeistes gerettet werden kann … Queeres Jugendbuch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Ähnliche
Bianca Nias
Das Geheimnis des siebten Hundes
Ein queeres Jugendbuch, basierend auf der Legende
Impressum
© dead soft verlag, Mettingen 2024
http://www.deadsoft.de
© the author
Cover: Irene Repp
http://www.daylinart.webnode.com
Bildrechte:
© Val Thoermer – stock.adobe.com
1. Auflage
ISBN 978-3-96089-731-6
ISBN 978-3-96089-732-3 (ebook)
Klappentext
Ein fürstliches Schloss im Westerwald, das auf einem
mächtigen Basaltfelsen über der Stadt Westerburg thront.
Der Geist eines Grafen, der an die Burgfeste gebunden ist und über seine Untertanen wacht.
Und nicht zuletzt ein sagenhafter Schatz, der unter dem siebten Hund verborgen ist …
Teil 1: PETER
Prolog
Geister gibt es nicht.
Das sind bloß Hirngespinste von einfältigen Leuten, die versuchen, irgendwelche merkwürdigen Phänomene zu erklären, obwohl diese eines völlig natürlichen Ursprungs sind.
Ja, das dachte ich auch. Zumindest so lange, bis ich selbst zu einem Geist geworden bin.
Wie das passiert ist? Nun, aus heutiger Sicht muss ich zugeben, dass es wohl nicht ganz unverdient war. Vielleicht lag es daran, dass ich ein kompletter Arsch gewesen bin. So hat es mein Freund Sebastian jedenfalls bezeichnet, also kann das stimmen. Man selbst hat natürlich immer einen guten Grund für sein Verhalten, wobei dieser den Außenstehenden viel zu oft verborgen bleibt. Daher mag es mein Wunsch nach Rehabilitation, nach einer Wiederherstellung meines guten Rufs sein, der mich veranlasst, dieses Buch zu schreiben. Es stimmt, mein Ansehen ist mir äußerst wichtig, schließlich ist es alles, was bleibt, wenn man selbst nicht mehr unter den Lebenden weilt.
Hinzu kommt, dass vermutlich niemand weiß, wie man sich als Geist tatsächlich fühlt. Woher denn auch? Hat sich jemals irgendeiner die Mühe gemacht, das zu erforschen? Wahrlich, da gibt es Bücher zu diesem Thema, die von den größten Schriftstellern verfasst worden sind und zur Weltliteratur zählen, aber kaum einer kümmert sich darin um die Gedanken und Gefühle einer Seele, die zu einer immerwährenden, körperlosen Existenz verdammt ist.
Ich für meinen Teil hätte beispielsweise nie vermutet, dass man dann permanent kalte Füße hat. Ihr könnt mir glauben, das Gefühl dieser Eisklötze an den Beinen nervt gewaltig. Und nicht nur das. Zu allem Überfluss wird man selbst als Geist von sämtlichen Emotionen heimgesucht und gequält, die einem bereits das irdische Dasein zur Hölle gemacht haben.
Zorn, Neid, Hass, Eifersucht, aber auch Freude, Glück, Mitleid, Freundschaft – und Liebe.
Gerade die Liebe ist etwas, die in ihrer schlichten, aber so überwältigenden Präsenz manchmal völlig überraschend daherkommt und dann das Leben desjenigen, der von Amors Pfeil getroffen wird, gehörig durcheinanderwirbelt.
Doch der Reihe nach. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen, bevor ich euch meine Geschichte erzähle.
Mein Name ist Graf Peter Ferdinand Walfried von Westerburg. Ihr dürft gerne Graf Peter zu mir sagen.
Und jeder, der mich nach meinem Ableben als das Petermännchen bezeichnet hat, soll auf ewig mit kalten Füßen gestraft sein!
Nein, ehrlich, diese Herabwürdigung habe ich nicht verdient. Vielleicht war ich zu Lebzeiten nicht der weltbeste Ehemann und Vater, doch zumindest meine Lehnsmänner hatten keinen Grund zur Klage. Zwar führten meine Untergebenen ein einfaches, karges Leben, aber ich bot ihnen Schutz und eine sichere Heimat. Nicht umsonst war ich über die Landesgrenzen meiner Grafschaft hinaus bekannt und berüchtigt, mein Ruf als kampferprobter Ritter war in aller Munde. Mir und der Lage meiner Burg, die einen bedeutsamen Teil der Handelsrouten des dreizehnten Jahrhunderts schützte, war es zu verdanken, dass Pilger, Händler und Kaufleute zwischen Frankfurt und Köln gefahrlos den Westerwald durchqueren konnten. Zugegeben, die sichere Passage durch meine Ländereien habe ich mir fürstlich bezahlen lassen und ein beträchtliches Vermögen angehäuft.
Doch ausgerechnet dieser Schatz, den ich zusammengetragen, gehortet und unter den mächtigen Mauern meines Schlosses gut versteckt habe, ist mir zum Verhängnis geworden.
Aber vielleicht sollte ich mit meiner Geschichte eher von vorne beginnen. Ich kann mich noch sehr gut an alles erinnern.
Mir zumindest ist, als wäre es erst gestern gewesen, als das Unheil seinen Anfang nahm ...
Kapitel 1
Westerburg, im Juno des Jahres 1206
»Der Teufel soll Euch holen!«
Hildegund rafft ihre Röcke und stürmt wutschnaubend aus dem Saal. Fast wäre sie dabei mit dem Pagen zusammengeprallt, der dienstbeflissen aufgesprungen ist, um ihr den Türflügel zu öffnen. Gerade noch rechtzeitig hält sie inne, wirft den Kopf mit dem geflochtenen Haardutt in den Nacken und mir einen bitterbösen Blick zu, der jedoch wirkungslos an mir abprallt.
Ich halte es eher wie mein treuer Jagdhund Pollux, der mir zu Füßen liegt, den Kopf auf die Pfoten gebettet hat und gelangweilt gähnt, während die Dame des Hauses verärgert davonrauscht.
Soll sie doch. Weder interessiert mich ihr weibisches Gezänke noch werde ich von meinem Entschluss abrücken.
»Herr Graf, die Kutsche ist vorgefahren«, informiert mich derweil Gunther, der Verwalter meines Schlosses.
Ich nicke ihm zu, sehe jedoch, wie er zögert, als hätte er dem etwas hinzuzufügen.
»Was ist?«, blaffe ich ihn ungeduldig an.
»Herr, ich weiß, es steht mir nicht zu, aber ...«, beginnt er verhalten, unterbricht sich jedoch auf der Stelle.
Ich messe ihn mit zornigem Blick.
»In jenem Belang vermag ich dir recht zu geben. Es steht dir nicht zu«, erinnere ich ihn kühl.
»Das Kloster wird dem Jungen keine gute Heimstatt sein«, versucht es Gunther dennoch. »Er ist nicht kräftig genug, in den Mauern der Abtei ist es zugig und kalt, die Mönche sind …«
»Die Mönche werden ihm eine angemessene Erziehung angedeihen lassen.« Ich erhebe mich von meinem Thron, wohl wissend, wie einschüchternd meine imposante Gestalt wirkt, mit der ich nahezu jeden um eine Kopflänge überrage. »Und damit ist das letzte Wort gesprochen.«
Mit einem knappen Wink entlasse ich ihn für diesen Moment.
»Jawohl, Herr.«
Gunther verbeugt sich eilig. Dann tippelt er ein paar Schritte zurück, bevor er sich abwendet und lautlos meinem Sichtfeld entschwindet.
Vom Schlosshof her schallen Stimmen zu mir in den Festsaal hinauf, den ich gleichzeitig für Audienzen nutze. Neugierig gehe ich zum Fenster hinüber, Pollux erhebt sich sogleich und folgt mir auf dem Fuße.
Die Stallburschen verladen gerade vier große Kisten auf den Pferdewagen und zurren sie fest. Ich runzele verärgert die Stirn. Was soll der Junge im Kloster mit all den vielen Sachen anfangen?
In diesem Moment tritt Hildegund aus dem Hauptportal, unseren Sohn in ihren Armen. Der Kleine weint und klammert sich an sie, während seine Mutter auf ihn einredet. Sie schenkt ihm dabei ein Lächeln, das meinem Spross wohl Zuversicht vermitteln soll.
Emotionslos betrachte ich das zarte Kind. Friedrich ist mein einziger Sohn, aber zu meinem Bedauern schlägt er ganz nach seiner Mutter. Ich wusste bislang nie, was ich mit ihm anfangen soll. Mit seinen sieben Jahren ist der dürre Blondschopf zwar noch inmitten seiner Entwicklung, doch bereits jetzt vermute ich, dass er eines Tages kein stattlicher Ritter zu sein vermag, der die Grenzen unserer Ländereien gegen Wegelagerer und die Truppen der gierigen Nachbarn verteidigen wird.
Ich seufze ungehalten.
Friedrich ist ein stilles, oftmals kränkelndes Kind, das am Rockzipfel der Mutter hängt. Durch die Aufnahme im Kloster, die sich der Abt hat teuer bezahlen lassen, will ich nicht nur seine Ausbildung in fähige Hände legen, sondern ihn auch Hildegunds Einfluss entziehen. Meiner Ansicht nach erdrückt sie den Jungen mit ihrer mütterlichen Fürsorge, was seiner recht anfälligen Gesundheit erst recht abträglich zu sein scheint.
Kurz überlege ich, mich von dem Kind zu verabschieden, das gerade von der Mutter in die Kutsche gesetzt wird, verwerfe den Gedanken aber sogleich. Nein, ich muss zugeben, dass ich nicht einmal weiß, was ich ihm bei dieser Gelegenheit sagen sollte, also lasse ich es von vornherein bleiben. Nur die Zeit wird zeigen, ob vielleicht doch etwas von meiner Stärke und Tapferkeit in ihm vorhanden ist. Bestenfalls entwickelt er noch jene Tugenden, die man als Oberhaupt dieser Grafschaft an den Tag legen muss.
Mit leisem Bedauern wende ich mich ab, um meinen üblichen Tagesgeschäften nachzugehen. Spätestens zur Mittagszeit werde ich mit mehreren Reitern aufbrechen und an der südlichen Landesgrenze nach dem Rechten sehen. Die Bauern berichteten in letzter Zeit von mehreren Überfällen, für die sich Gaugraf Leopold verantwortlich zeichnen mag.
Dieser Lump würde es nie wagen, meine Burg offen anzugreifen, um sich meine Ländereien anzueignen, doch so kurz vor der Ernte genügen ein paar kleinere Angriffe und das Abbrennen einiger Felder, um die Erträge zu gefährden. Letzteres würde meine Bauern im Winter hungern lassen, weshalb ich es unbedingt verhindern muss.
Im Vorbeigehen streiche ich dem Hund über den Kopf, der mir treu und brav zur Seite steht.
»Komm, Pollux, lassen wir die Pferde satteln. Ein anstrengender Ritt steht uns bevor.«
~~~
Am Abend herrscht an der Tafel eisiges Schweigen. Hildegunds gerötete Augen verraten mir, dass sie geweint haben mag, doch ich sage nichts dazu. Sie wird sich daran gewöhnen, unseren Sprössling für die nächsten Jahre nur selten zu Gesicht zu bekommen.
Zu meinem Leidwesen hat sie mir bislang keine weiteren Nachkommen geschenkt, nach Friedrich gab es lediglich zwei Frühgeburten, die nicht überlebt haben. Abermals bedauere ich, dem Drängen meines Vaters, Gott habe ihn selig, nachgegeben zu haben, sie zur Frau zu nehmen. Ihr zänkisches Wesen hat mich oft genug verärgert, selbst das Bett teilt sie recht selten mit mir, und wenn, dann nur widerwillig. Was allerdings auf Gegenseitigkeit beruht, auch ich verspürte seit unserer Vermählung vor knapp zehn Jahren kaum jemals Lust, ihre Gemächer aufzusuchen.
Die Heirat mit ihr sollte jedoch den Frieden zum Grafen des Oberlahngaus sichern, aus dessen Hause sie stammt. Eine recht unnütze politische Verbindung, wie sich alsbald herausgestellt hatte, der Oberlahngau ist mittlerweile fest in der Hand des Landgrafen vom Hessengau, der seine Macht immer weiter ausweitet.
Kurzentschlossen wische ich mir die Finger am bereitliegenden Tuch ab, erhebe mich und nehme wortlos meinen Kelch Wein mit nach draußen. Es ist ein lauer Sommerabend, die Grillen zirpen. Am wolkenlosen Himmelszelt verströmt der Vollmond ein mildes, farbloses Licht.
Pollux ist mir wie üblich gefolgt, doch jetzt geht er voran, weil er den Weg genau kennt, den ich abends gerne beschreite. Zum Schlosshof hinaus, jedoch nicht über die steinerne Brücke, sondern zur Felsklippe an den rückwärtigen Schlossmauern hinüber, von der aus man den schönsten Blick über das Tal hat.
Die Wachen am Tor salutieren gewissenhaft, ich erwidere den Gruß mit einem angedeuteten Nicken. Nach den Anstrengungen des Tages tut es gut, für eine Weile allein zu sein und die Gedanken schweifen lassen zu können.
Entspannt schlendere ich an der hohen Steinmauer des zweiten Treppenturms vorbei, den ausgetretenen Pfad entlang. Linkerhand geht es gut dreißig Meter in die Tiefe. Die Burganlage steht auf einem nach drei Seiten steil abfallenden Basaltrücken, ich habe sie in nur wenigen Jahren Bauzeit auf dem Plateau des Felsens errichten lassen. Jedes Mal, wenn ich von meinen Ausritten zurückkomme, hebt sich mein Gemüt und klopft mein Herz vor Stolz, sobald ich die Westerburg erblicke, wie sie hoch oben über der Stadt thront. Die schlichten Mauern sind ebenfalls aus Basalt, doch die weißgekalkten Wehrtürme mit den Zinnen aus rotem Sandstein sind weithin sichtbar. Sie strahlen Stärke und Macht aus, ihre Grundfeste wird nichts so schnell erschüttern.
Pollux trottet gemütlich vorweg, doch plötzlich hebt er den Kopf, merkt sichtlich auf und bleibt stehen.
Ich lächele milde. Sicherlich schleicht irgendwo eine Katze umher, die er gewittert hat. Mit den Mäusefängern steht er auf Kriegsfuß, er jagt sie bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit vom Hof.
Von dem urplötzlichen Stoß in meinen Rücken werde ich vollkommen überrascht. Ich strauchele, versuche, mich irgendwo festzuhalten, doch meine Hand greift ins Leere und ich verliere den Boden unter meinen Füßen.
Das Letzte, was ich vernehme, ist das erschrockene Heulen meines Hundes und den warmen Sommerwind im Gesicht, während ich in die Tiefe stürze …
Verrückterweise gehen mir dabei die seltsamsten Dinge durch den Kopf.
Bestimmt hat sich jeder schon einmal gefragt, wie es ist, zu sterben. Als Ritter legt man die Gedanken darüber weitestgehend ab, man ist sich allenfalls einig darüber, dass man lieber auf dem Schlachtfeld sein Ende finden möchte als auf einer weichen Bettstatt. Keinesfalls will man hinterrücks gemeuchelt und am Fuß einer Klippe zerschmettert werden.
Während des sekundenlangen Falls durchströmt mich demzufolge nichts als blanke, heiß glühende Wut auf den niederträchtigen Mörder, der mich um einen ansehnlichen, standesgemäßen Tod gebracht hat. Im selben Moment gebe ich mir selbst einen bitterernsten, aus tiefstem Herzen kommenden Schwur, es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Ich verspüre keinen Aufprall, sondern mit einem Mal einen seltsamen Sog, der mich packt. Er fühlt sich wie der warme Sommerwind an und hebt mich unwiderstehlich in die Lüfte. Die Welt verliert urplötzlich ihre Farben und Gerüche, der Erdboden scheint mich nicht länger zu sich ziehen zu wollen.
Und so schwebe ich eine Zeit lang irgendwo in der Dunkelheit, kein Ziel vor Augen, aber noch immer vom unsäglichen Zorn durchflutet. Das Einzige, was ich höre, ist Pollux’ Winseln. Seine schiere, herzergreifende Verzweiflung, nicht an meine Seite zurückfinden zu können.
Dies ist mein Antrieb. Ich muss zu ihm!
Schlagartig verstärke ich meine Anstrengungen, irgendetwas um mich herum wahrzunehmen, damit ich Pollux finden kann. Das schwebende Gefühl lässt zwar nicht nach, doch ich merke, dass ich es irgendwie zu steuern vermag, dass ich mich an den Klagelauten meines Hundes orientieren, mich ihm nähern und so zu ihm gelangen kann.
Schneller als erwartet lichtet sich die Dunkelheit. Ich finde Pollux auf dem Boden sitzend vor, er wedelt zur Begrüßung schwach mit dem Schwanz. Dann duckt er den Kopf und sieht mich aus seinen dunklen Knopfaugen wie um Verzeihung bittend an. Neben ihm entdecke ich zwei dunkle Schemen, einen großen und einen kleineren.
»He, mein Freund, alles wird gut.«
Ich beuge mich zu ihm, um seinen Kopf zu streicheln und ihn zu beschwichtigen – doch dabei stelle ich fest, dass mir dies nicht möglich ist. Meine Hand kann ich zwar sehen, doch sie gleitet einfach durch Pollux hindurch. Kein Wunder, denn mein Körper liegt neben den Pfoten meines Hundes, mit grotesk verdrehten Gliedmaßen.
Oh ja, kein Zweifel. Ich bin tot und durch eine ungeheuerliche Fügung nur noch im Geiste vorhanden. Oder als Geist, besser gesagt.
Seltsamerweise bleibt ein Schock darüber aus, ich nehme es eher gleichmütig zur Kenntnis. Viel mehr bestürzt mich, dass ich Pollux’ schmalen, zerschmetterten Körper direkt neben dem meinem entdecke.
Sie haben sogar den Hund von der Klippe geworfen und ermordet? Oder ist er mir aus freien Stücken hinterhergesprungen?
Mein Blick gleitet zurück zu der kleinen, durchscheinenden Gestalt, die schwanzwedelnd neben mir sitzt und offenkundig wartet, was ich als Nächstes tun werde.
Keine Frage, ich kann den Hund sehen, ich spüre sogar seine Anwesenheit. Sein braun-weiß geschecktes Fell erscheint mir in farblosen Grautönen, doch äußerlich betrachtet ist er unversehrt. Jedenfalls, solange ich beiseitelasse, dass ich durch ihn hindurchsehen und die Felsen hinter ihm klar erkennen kann, genau so, wie ich durch meine eigene Hand schaue, wenn ich sie mir vor Augen halte. Doch der warme, mir offen zugewandte Blick aus den klugen, getreuen Hundeaugen ist unverändert. Irgendwie beruhigt mich das und es hilft, einen klaren Entschluss zu fassen.
»Wir werden das demjenigen heimzahlen, wer auch immer sich dafür verantwortlich zeichnen mag«, raune ich meinem treuen Begleiter zu, der mir bis in den Tod und sogar darüber hinaus gefolgt ist.
»Wuff.«
Pollux schaut mich seltsam wissend an, springt auf und trottet voran. Direkt auf den Felsen zu, den man uns hinabgestürzt hat. An dessen Fuße angekommen, beginnt er zu schweben, er gleitet im fahlen Licht des Mondscheins in die Höhe und strebt der Burg zu.
Es bedarf nur eines Gedankens von mir und ich folge ihm. Die Klippe ist binnen Sekunden überwunden, gleich darauf steuert Pollux den Schlosshof an.
Dort ist alles ruhig.
Doch nein, nicht ganz. Ich vernehme ein Wispern, ein hektisch anmutendes Getuschel, das aus der Nähe des Brunnens zu stammen scheint.
Neugierig gehe ich dem nach, besser gesagt, ich schwebe langsam zum Brunnenschacht hinüber. Es überrascht mich seltsamerweise wenig, dort meinen Verwalter im Gespräch mit meiner Gattin vorzufinden. Hildegund wirkt verstört, sie weint und schluchzt unterdrückt, doch mir stößt sofort auf, wie vertraulich Gunther seinen Arm um ihre schmalen Schultern gelegt hat.
»Es ist nicht nötig, jetzt bereits einen Suchtrupp loszuschicken«, redet er leise auf sie ein. »Wir werden morgen früh nach ihm suchen lassen, wenn er bis dahin nicht bereits zufällig gefunden worden ist.«
»Ich muss mir doch seinen Leib nicht noch einmal anschauen?«, flüstert Hildegund erstickt.
»Nein, das wird nicht nötig sein.« Gunther lächelt milde, hebt eine Hand und wischt die Tränenspur auf ihren Wangen fort. »Unser Plan hat bestens funktioniert, niemand hat davon etwas mitbekommen. Die Wachen am Tor haben auf der Brücke patrouilliert, so blieb ich unentdeckt. Ich habe mich sogar des Hundes entledigt, damit er keinen Alarm schlägt.« Er hält inne, doch dann greift er nach Hildegunds Hand und drückt sie sanft. »Ihr seid jetzt die Herrin auf Schloss Westerburg, jedenfalls so lange, bis Euer Sohn zum Manne gereift ist.«
»Ich werde gleich Morgen Friedrichs Heimkehr anordnen«, stößt Hildegund hervor, dann strafft sie sich unversehens, entzieht ihm ihre Hand und wehrt auch den Arm um ihre Schultern ab. »Das war die Sache allemal wert.«
Die Sache? So bezeichnet diese Schlange also das Komplott um meine Ermordung? DIE SACHE?
Wütend fahre ich zwischen die beiden, will das treulose, hinterhältige Eheweib packen, sie schütteln, sie …
Doch nichts dergleichen geschieht. Weder kann ich Hildegund berühren noch vermag sie meine Anwesenheit wahrzunehmen. Instinktiv will ich nach ihr greifen, doch meine Hand, die ich ja selbst vor Augen habe, gleitet bar jeglichen Widerstands durch sie hindurch.
»Verdammt seist du«, knurre ich mit zusammengebissenen Zähnen und versuche abermals, mich bemerkbar zu machen.
Wenn ich schon körperlich nichts mehr ausrichten kann, so will ich ihr wenigstens einen gehörigen Schrecken einjagen, damit sie gewiss ist, dass ich noch immer alles hören und sehen kann, was sie treibt.
Vielleicht ist dazu mehr Konzentration vonnöten?
Ich lasse von meinem nutzlosen Bestreben ab, sie berühren zu wollen, atme tief durch und versuche, all meinen Zorn, meinen Hass auf die beiden Verräter durch mich hindurchfließen zu lassen.
»Verdammt seid ihr!«, schreie ich die beiden an, bündele nochmals meine Wut und lege sämtliche Kraft in meine Stimme. »HÖRT IHR? IHR SOLLT VERDAMMT SEIN!«
Davon gänzlich unbeeindruckt wenden Hildegund und Gunther sich ab und gehen an mir vorbei zum westlichen Treppenturm hinüber, über den man zur Kemenate, zu den Räumen der Hausherrin, gelangt.
Zornbebend bleibe ich stehen und spüre, wie sich Verzweiflung in mir ausbreitet. Vermutlich war es mein inniger Wunsch nach Rache, der mich davon abgehalten hat, gen Himmel zu fahren. Oder wo auch immer der Platz sein mag, der für mich nach meinem Ableben vorgesehen war.
Doch wenn ich außerstande bin, Rache zu nehmen – was bleibt dann noch?
Kapitel 2
Fürwahr, nun weiß ich auch, warum es Geistern nachgesagt wird, vor allem des Nachts ihr Unwesen zu treiben.
In diesen Stunden schlafen fast alle – und es wird einem als Geist fürchterlich schnell langweilig. Pollux’ Anwesenheit ist mir die einzige Wohltat, ohne ihn an meiner Seite wäre ich sicherlich schon dem Wahnsinn verfallen. Ich für meinen Teil bin es nicht gewohnt, dem Nichtstun zu frönen, meine Tage waren stets mit harter Arbeit ausgefüllt. Nun aber bin ich die gesamte Zeit über dazu verdammt, auf meiner eigenen Burg zu hocken und auf nichts mehr Einfluss nehmen zu können.
Schnell habe ich herausgefunden, dass ich wie durch einen Fluch an die Westerburg und ihren Basaltfelsen gekettet bin – ich vermag nicht weiterzukommen als in einem Radius von fünf Metern rund um den Fuß des Felsens herum. Dort existiert eine unsichtbare Grenze, die unüberwindbar erscheint, obgleich ich alles versucht habe. Mir ist damit der Gang in die Stadt ebenso verwehrt wie ein Besuch der Kapelle, die sich nahe dem Burgtor, aber jenseits der steinernen Brücke befindet.
Und so ziehen sich die Stunden seit meinem Ableben in Eintönigkeit dahin, reihen sich schier endlos aneinander. Rasch werden aus einzelnen Tagen gleich mehrere Wochen. Tagsüber kann ich noch am Leben der anderen teilhaben, indem ich sie in ihrem Tun beobachte und ihren Gesprächen lausche, doch die Stunden der Nacht ziehen sich ereignislos, für meine Begriffe reichlich fade dahin. Schlaf brauche ich nun nicht mehr, also habe ich es mir angewöhnt, am späten Abend mit Pollux meinen gewohnten Spaziergang zur Klippe zu machen.
Auch heute Nacht haben wir den üblichen Weg genommen. Der Herbst hat Einzug gehalten, der Bäume Laub leuchtet sicherlich in wundervollen Farben. Zu meinem Bedauern ist selbst am Tage alles für mich grau, dennoch sitze ich gerne auf der Klippe, lasse die Beine über den Rand baumeln, schaue ins Tal hinab und denke dabei nach. Seit Stunden grübele ich darüber, wie ich es fertigbringen vermag, an Gunther und Hildegund Rache zu nehmen, um dieses geisterhafte Dasein zu beenden.
Eine Lösung für das Problem ist mir bislang allerdings nicht eingefallen. Es scheint mir nichts anderes übrigzubleiben, als mich in Geduld zu üben und die Geschehnisse weiter zu beobachten.
Davon abgesehen bin ich erbaut darüber, dass mein plötzliches Ableben die meisten Leute ehrlich erschüttert zu haben scheint. Offiziell wurde verkündet, ich sei wohl ausgeglitten oder habe in der Dunkelheit den Weg verfehlt. Manche munkeln hinter der hohlen Hand, ich wäre im Rausch gewesen, weil der Weinkelch, den ich mitgenommen hatte, neben mir gefunden worden war. An ein Mordkomplott scheint wohl niemand zu glauben, zumal Hildegund die wehklagende Witwe überzeugend zu spielen vermag.
Seit Wochen wurde nun getrauert, der Strom der Angehörigen benachbarter Fürstenhäuser, der Bürgersleute, Bauern und Vasallen, die um eine Audienz bei Hildegund suchten, um ihre Bestürzung kundzutun, wollte zunächst kein Ende nehmen.
In den letzten Tagen jedoch ist es ruhiger auf der Burg geworden, das gewohnte Leben nimmt wieder seinen Lauf, als wäre nichts geschehen.
Mit einer einzigen Ausnahme.
Gunther scheint nach etwas zu suchen. Gestern entdeckte ich ihn, wie er durch die Keller der Burg streifte, jede Türe öffnete, die Räume durchstöberte und sogar an Felswände klopfte. Auch den gesamten heutigen Tag über habe ich dieses Schauspiel beobachten können.
Ich grinse verschmitzt.
»Oh ja, Pollux, er sucht nach meinem Schatz«, erkläre ich dem Hund, der neben mir am Klippenrand sitzt und in die Ferne schaut.
»Wuff.« Sein Schwanzwedeln verursacht nicht einmal ein winzig kleines Staubwölkchen auf dem trockenen Boden.
»Da kann er lange suchen. Mein Gold ist gut verborgen, das wird er nicht finden.« Nachdenklich lasse ich meinen Blick über die akkurat angelegten Gerstenfelder im Tal schweifen. »Die Ernte ist im vollen Gange und scheint gut geraten zu sein. Dem Müller habe ich erst letzten Winter einen neuen Mühlstein anfertigen lassen, die Bürger und Bauern werden im kommenden Winter genug Mehl haben, um nicht hungern zu müssen.«
»Wuff.«
Pollux sieht mich fragend an.
»Ja, ich weiß, was du meinst. Meine Gedanken kreisen um das Wohlergehen der einfachen Leute, dabei sollte ich mir eher Sorgen um meinen einzigen Sohn machen. Das tue ich auch, glaube mir.«
Ich seufze betrübt, stehe auf und gebe dem Hund einen Wink.
»Komm, wir schauen nach, ob es ihm bereits besser ergeht.«
Wir nehmen den kürzesten Weg zum Westflügel des Schlosses hinüber, wo Friedrichs Gemach direkt neben dem meinen liegt. Es ist noch immer seltsam, durch Mauern und Türen hindurch schweben zu können, ohne sie als solche wahrzunehmen. Ein Gedanke genügt und mein Geist strebt in die angesagte Richtung, Hindernisse muss ich dabei nicht befürchten. Trotzdem kann ich mich irgendwohin setzen, wenn ich das will – mein Geist lenkt meinen Körper in die entsprechende Position, damit ich nicht durch eine Bank, einen Stuhl oder ein Bett hindurchfalle, sondern wie selbstverständlich darauf Platz nehme. Nur das blanke, unbehauene Basaltgestein gebietet mir Einhalt, den Felsen vermag ich nicht zu durchwandern.
Friedrichs Kammer wird von einer einzelnen Kerze erhellt, die am Fenstersims steht und im Luftzug sanft flackert. Auf einem Lehnstuhl neben der Bettstatt sitzt die schlafende Hildegund. Das Kinn meiner treulosen Gattin ist auf ihre Brust gesunken, das Stickzeug hält sie noch in der Hand. Der Junge ist in den großen, mit feinsten Daunen ausgestopften Kissen und unter den dicken Decken kaum erkennbar. Oh je, sein Zustand scheint sich eher verschlechtert zu haben. Er ist so blass wie das Leinentuch, mit dem die Matratze aus Stroh bedeckt ist, und Schweißperlen zieren seine Stirn. Ich schwebe näher heran. Zu meiner Überraschung ist der Kleine wach, seine blauen Augen jedoch wirken dunkel und glänzen vor Fieber.
»Vater?«
Erschreckt halte ich inne.
Er kann mich sehen?
Es scheint so, denn seine Augen sind fest auf mich gerichtet, er hustet schwach und versucht, sich aufzusetzen.
Ist es das Fieber, das ihn mich sehen lässt? Oder die Tatsache, dass er noch so klein ist? Wie auch immer, allerdings bete ich zu Gott, dass dieser Umstand nicht bedeutet, dass mein einziges Kind an der Schwelle zum Tode steht.
Schnell bin ich an seiner Seite.
»Bleib liegen, Friedrich, du solltest noch ruhen«, beschwichtige ich ihn leise.
»Es war mein sehnlichster Wunsch, Euch noch einmal zu sehen«, raunt er schwach, verzieht aber den Mund zu einem kleinen Lächeln. »Danke, dass Ihr mir diesen erfüllt habt.«
Intuitiv will ich nach seiner Hand greifen, ziehe meine jedoch wieder zurück. Wie gerne würde ich ihn berühren, ihn in den Arm nehmen und seine fieberheiße Stirn kühlen. Es tut mir in der Seele weh, dass uns dieser innige Moment verwehrt bleibt, gleichzeitig bedaure ich jeden verpassten Augenblick, in dem ich ihm ein besserer Vater hätte sein müssen.
»Es tut mir leid«, versichere ich dem Kind aus tiefstem Herzen. »Ich war nicht da, als du mich gebraucht hast.«
Doch Friedrich schüttelt matt den Kopf.
»Nein, Vater. Ich bedaure, Euch enttäuscht …«, sagt der Kleine mit kindlichem Ernst in der brüchigen Stimme, doch er wird von einem Husten jäh unterbrochen.
Neben uns regt sich Hildegund, sie erwacht und setzt sich auf.
»Mit wem sprichst du, Kind?«, fragt sie, greift zu einem Tuch und trocknet die Tränen, die unserem Sohn über die Wangen kullern.
»Sieh doch, es ist Vater, der mich besucht«, bringt Friedrich schwach hervor. »Er ist gekommen, um nach mir zu sehen.«
»Das ist das Fieber«, beschwichtigt ihn seine Mutter. »Dein Vater weilt nicht mehr unter uns und hier ist sonst niemand.«
»Doch, er steht genau neben Euch«, murmelt das Kind und deutet auf mich.
Hildegund zuckt jäh zusammen, ihr Blick irrt durch den Raum. Ich ergreife die sich bietende Gelegenheit und setze mich auf die Bettkante.
»Friedrich, du hast mich nie enttäuscht«, beteuere ich meinem Sohn. »Uns blieb nur viel zu wenig Zeit, die wir zusammen hätten verbringen können. Wie gerne hätte ich dir noch das Reiten und Bogenschießen beigebracht.«
»Vor den großen Pferden fürchte ich mich, aber das Bogenschießen hätte mir bestimmt gefallen«, flüstert das Kind und lächelt traurig.
»Wie kommst du nun darauf?«, fragt Hildegund, doch ich beachte sie nicht und konzentriere mich auf das Kind.
»Kannst du bitte deiner Mutter etwas von mir ausrichten?«, beginne ich wohlüberlegt, obwohl es mir widerstrebt, den Kleinen in seinem geschwächten Zustand für meine Zwecke auszunutzen. Doch das, was ich zu sagen habe, ich viel zu wichtig, weshalb ich meine Bedenken kurzerhand zur Seite schiebe. »Ich bin hier, auf meiner Westerburg, und ich werde nicht eher ruhen, als dass mein Tod gesühnt worden ist.«
Genugtuung durchflutet mich, als Friedrich brav meine Worte wiederholt und Hildegund unversehens blass wird.
»Kind, wovon … was sagst du da?«, bringt sie stockend hervor.
»Sie und Gunther können wahrlich aufhören, nach meinem Schatz zu suchen«, fahre ich fort. »Mein Gold habe ich gut verborgen und es soll niemandem dienen, der nicht reinen Herzens ist. Was bedeutet, dass meine Mörder es niemals besitzen werden.«
Auch das richtet das Kind der Mutter aus, die außer sich aufspringt und vom Bett des Kleinen zurückweicht.
»Das ist der Teufel, der aus dir spricht«, murmelt sie entsetzt.
»Nein, Mutter, es sind des Vaters Worte«, entgegnet Friedrich tapfer, dann schließt er erschöpft die Augen.