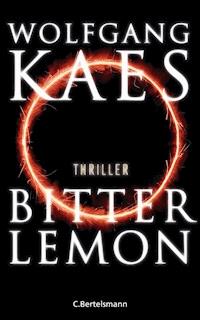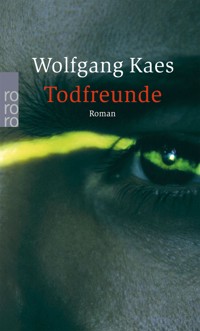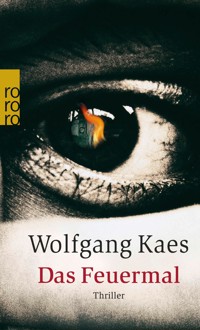8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Ein deutscher Thriller-Autor der Premium-Klasse.« (Kölner Stadt-Anzeiger)
In Istanbul sterben unzählige junge Arbeiter an Staublunge. Sie alle waren mit der Produktion von Designer-Jeans beschäftigt. Ein türkischer Mediziner macht sich nach Köln auf, um mit dem Auftraggeber zu sprechen. Vierundzwanzig Stunden später ist er tot. Kriminalhauptkommissarin Antonia Dix wird bald klar: Auch in der Modebranche gilt das Gesetz der Gier. Es geht um Profit, die Ware muss billig produziert werden. Das Textilunternehmen plant deshalb, die gesamte Produktion ins Ausland zu verlagern. Ein gefundenes Fressen für militante Globalisierungsgegner; doch auch die sind keineswegs resistent gegen die Versuchung des Geldes. Ein alter Buchhalter mit seinem Sinn für Gerechtigkeit macht jedoch allen einen Strich durch die Rechnung. »Das Gesetz der Gier«, der neue Kriminalroman von Wolfgang Kaes, wirft die Frage auf, was Mode mit Moral zu tun hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wolfgang Kaes
Das Gesetz der Gier
Kriminalroman
C. Bertelsmann
1. Auflage
Copyright © 2012 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: R·M·E Roland Eschlbeck/Rosemarie Kreuzer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-07587-3
www.cbertelsmann.de
Hanno Brühl*19. Februar 1937 in São Paulo† 5. Oktober 2010 in KölnGlücklich und dankbar bin ich, dich gekannt zu haben. Das Thema des Buches lag dir am Herzen. Nur so viel ist gewiss.»Es ist genug da für jedermanns Bedürfnis, aber nicht genug für jedermanns Gier.«
Mahatma Gandhi
Erol Ümit keuchte und rang nach Atem. Er lehnte seinen abgemagerten Körper gegen die hölzerne Hauswand und schloss die Augen. Nur einen Augenblick. Eine Pause. Eine kleine Pause. Bis die Lunge nicht mehr so rasselte. Alle fünf Schritte brauchte er eine Pause. Schon der kurze Weg vom Abort auf dem Hof zurück zum Haus wurde zur Qual. Erol sog gierig die frische Morgenluft ein. Als atmete er durch einen Strohhalm. Sein Brustkorb brannte wie Feuer.
Schmerzen.
Höllenschmerzen.
Aber noch hielt er sie aus.
Erols Lungenkapazität betrug noch 30 Prozent. Vielleicht auch schon weniger. Wahrscheinlich sogar. Denn die 30 Prozent hatte der Professor vor vier Monaten gemessen. Professor Zeki Kilicaslan war Chefarzt und Leiter der pneumologischen Abteilung am Istanbuler Universitätsklinikum. Das Wort hatte sich Erol nie merken können. Pneumologie. Er hatte sich nur gemerkt, was der Professor mit versteinerter Miene am Ende der Untersuchung gesagt hatte. Die Worte hatten sich in Erols Gehirn eingebrannt: Sie müssen jetzt sehr tapfer sein, Herr Ümit. Diese Krankheit ist unheilbar, und sie schreitet rasend schnell voran. Sie werden bald sterben, Herr Ümit. Es gibt leider keine Arznei gegen diese Krankheit. Fahren Sie nach Hause, zu Ihrer Familie …
Sterben.
Erol Ümit war erst 21 Jahre alt.
Der Professor hatte ihm Morphium mitgegeben.
Seit vier Monaten weigerte sich Erol, das Morphium zu nehmen, trotz der Schmerzen. Die Schmerzen konnte er aushalten, wenn er nur tüchtig die Zähne zusammenbiss. Nein, er blieb tapfer. Denn Morphium wäre das Ende, das wusste Erol.
Aber er wusste nicht, wie lange er die Angst aushalten konnte. Er hatte sich vorgenommen, sich das Morphium erst zu spritzen, alles auf einmal in die Vene zu spritzen, wenn die Panik, keine Luft mehr zu bekommen, unerträglich würde.
Eines Tages, so hatte der Professor in Istanbul es ihm erklärt, wenn das vernarbende Gewebe in seiner Lunge weit genug gewuchert war, dann würde er ersticken.
Tod durch Ersticken.
Erol versuchte, nicht daran zu denken. Aber es gelang ihm nicht. Seinen Eltern sagte er nichts davon. Sie litten schon genug. Nein, das Wissen darum, wie er eines Tages sterben sollte, behielt er für sich. Außerdem hatte er das Morphium.
Früher, da hatte er den randvoll mit Brennholz beladenen Karren ganz alleine zurück ins Dorf gezogen. Jetzt hatte er schon Mühe, den eigenen Körper zu bewegen. Erol wog noch 46 Kilogramm. Haut und Knochen. Früher hatte er jeden Abend Fußball gespielt, oben auf der Waldlichtung. Erol Ümit war früher bärenstark und wieselflink gewesen.
Früher. Noch vor drei Jahren.
Früher hatte er sich jeden Abend mit seinen Freunden auf der Waldlichtung getroffen. Sie hatten nicht nur Fußball gespielt, sondern danach, bis es dunkel wurde, noch über alles Mögliche geredet, über was Jungen in dem Alter so reden, über die Chancen der türkischen Nationalmannschaft bei der nächsten Weltmeisterschaft, und über die Mädchen unten im Dorf natürlich. Unnahbare Zauberwesen. Und sie hatten Pläne geschmiedet, fantastische Pläne: ein guter Job im fernen Istanbul, der Stadt ihrer Träume, Geld für die Familie verdienen, einen neuen Fernseher kaufen, Flachbildschirm, vielleicht sogar ein Auto, und später dann, als gemachter Mann, zurückkehren und um die Hand eines der Mädchen im Dorf anhalten. Erol wusste damals auch schon ganz genau, um welche Hand er später anhalten wollte: Filiz. Sie war die Schönste von allen.
Filiz.
Pläne. Träume. Luftschlösser.
Filiz hatte inzwischen geheiratet. Erols Cousin.
Erols Heimatdorf hieß Bürnük. So hießen viele Dörfer im Norden der Türkei. Erols Dorf hatte 241 Einwohner. Es war von grünen, dunklen Wäldern umgeben. Bis zur Provinzhauptstadt Bolu waren es rund 30 Kilometer über eine unbefestigte Schotterpiste mitten durch den Wald, bis zur Schwarzmeerküste waren es etwa 80 Kilometer. Weit weg, unerreichbar weit weg. Bürnük war zweifellos kein Ort für einen ehrgeizigen jungen Mann, der es zu etwas bringen wollte.
Das Meer sah Erol zum ersten Mal in Istanbul, als er mit 18 Jahren sein Dorf verließ, um in der goldenen Stadt am Bosporus sein Glück zu versuchen.
Seine Freunde, diese Feiglinge, diese Maulhelden, blieben damals allesamt in Bürnük.
Erol fand schnell Arbeit als Spüler in einem Restaurant. Leute von der Schwarzmeerküste wurden gerne genommen. Sie galten als zuverlässig, geradlinig, schweigsam, vertrauenswürdig. Das wussten Arbeitgeber zu schätzen.
Vertrauenswürdige Menschen sind oft auch vertrauensselig. Sie erwecken nicht nur Vertrauen, sie schenken auch bereitwillig Vertrauen, weil sie glauben, alle Welt sei so wie sie.
Ein großer Irrtum.
Erols Chef, der Restaurantbesitzer, ein Mittvierziger namens Önder Ocak, stammte aus Nizip, einer Provinzstadt im Südosten, unweit der syrischen Grenze. Hüte dich vor den Menschen aus dem Südosten, hatte Erols Großvater immer gesagt. Sie sind verschlagen; sie lügen schon, sobald sie nur den Mund aufmachen. Das kommt, weil sie allesamt von Schmugglern und Spionen abstammen. Wer aus dem Süden kommt, der hat garantiert was auf dem Kerbholz.
Aber die Worte seines Großvaters aus Kindertagen fielen Erol erst wieder ein, als es zu spät war.
Der Restaurantbesitzer überredete Erol, nach nur acht Wochen als Spüler den Job zu wechseln. Er vermittelte ihn an eine der zahllosen Kellerfabriken Istanbuls, die ständig Arbeitskräfte suchten, und kassierte dafür eine satte Vermittlungsgebühr. Aber das wusste Erol damals nicht. Er wusste nur, dass er mehr Geld verdienen sollte als im Restaurant.
In dem Gewölbekeller erklärte man dem jungen Mann von der Schwarzmeerküste, wie er das Gerät zu bedienen hatte, das aussah wie ein Hochdruckreiniger. Nur dass aus der Düse am Ende des Rohrs kein Wasser, sondern feiner Sand schoss. Sie zeigten Erol, wie er die nagelneuen Jeans in den kammerähnlichen Hohlräumen der gemauerten Wand auslegen musste, um die optimale Wirkung zu erzielen. Und sie zeigten ihm, wie man mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen den Sand auf die Hosenbeine schießen ließ, damit der Sand die tiefblaue Farbe aus dem Stoff kratzte und die Jeans in Minutenschnelle so aussah, als hätte Erol sie zuvor jahrelang bei der Arbeit getragen.
Erol war ein gelehriger Schüler und ein fleißiger Arbeiter. Er schuftete in der extremen Hitze des Kellers 14 bis 16 Stunden am Tag, für umgerechnet einen Euro pro Stunde. Er kapierte nicht, warum man nagelneue Jeans so furchtbar zurichtete. Aber er verstand auch alles andere nicht. Zum Beispiel, warum er plötzlich an Gewicht verlor, Kilo um Kilo, warum er so schnell müde war, sich kraftlos fühlte und Blut spuckte. Der Vorarbeiter sagte, sie sollten nach Feierabend viel Bier trinken oder aber Buttermilch, wenn man den Alkohol meiden wollte. Das spüle den eingeatmeten Sand wieder aus dem Körper.
Hätte Erol den Leiter der Pneumologie an der Istanbuler Universitätsklinik damals schon gekannt, hätte der ihm da schon sagen können, was in seinem Körper vor sich ging. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte Professor Zeki Kilicaslan bereits bei 700 Patienten die unheilbare Krankheit diagnostiziert.
Silikose.
Staublunge.
Das kannte der erfahrene Mediziner zuvor nur von alten Bergarbeitern nach jahrzehntelanger Berufstätigkeit.
Aber diese Silikose-Patienten waren noch jung, sehr jung, und schon dem sicheren Tod geweiht.
Zudem nahm die Krankheit bei ihnen einen wesentlich rasanteren Verlauf als bei Bergarbeitern. Das ließ dem Professor keine Ruhe. Er suchte nach Gemeinsamkeiten – und fand sie schließlich in den Krankenakten: Alle 700 Patienten arbeiteten in der Textilindustrie. Durch das Sandstrahlen unter Hochdruck bildete sich Silizium, das sich in Verbindung mit Sauerstoff in Quarze verwandelte. Geriet das giftige Mineral durch die Luftröhre in die Lunge, was in den unbelüfteten Kellern zwangsläufig geschah, bildete sich dort neues Gewebe, wucherte unkontrolliert und vernarbte die Lungenflügel. Die Folge: Hustenanfälle, rasselnder Atem, rapide Gewichtsreduktion, blutiger Auswurf, zunehmender Sauerstoffmangel im Körper, am Ende der Tod durch Ersticken.
Professor Zeki Kilicaslan wandte sich an Polizei und Justiz und forderte ein Verbot der gefährlichen Sandstrahler. Doch die Resonanz der Behörden hielt sich in Grenzen. Es ging schließlich um viel Geld. Um sehr viel Geld. Mit mehr als zehn Milliarden Euro Exportvolumen pro Jahr boomte die türkische Textilindustrie. Wurde dennoch eine Kellerfabrik geschlossen, öffnete die nächste in einem anderen Stadtteil.
Zehntausende junger Männer waren da schon durch die Keller geschleust worden, ohne Versicherung, ohne Arbeitsschutz. Niemand kannte die genaue Zahl. Professor Zeki Kilicaslan schätzte, dass schon mindestens 5000 Textilarbeiter unheilbar an Silikose erkrankt waren. Die meisten trauten sich nicht, zum Arzt zu gehen, aus Angst, ihren Job zu verlieren. Andere, so wie auch Erol Ümit, hatten Schriftstücke unterzeichnet, Verträge, die sie verpflichteten, draußen kein Wort über die Arbeitsbedingungen da drinnen zu verlieren. Bei Vertragsbrüchigkeit drohe ihnen Gefängnis, stand darin. Dass dies gelogen war, wusste Erol nicht. Er wusste noch nicht viel vom Leben.
Erst als Erol immer mehr Blut hustete, war er zu einem Arzt gegangen. Der Mann war zufällig ein alter Freund des Professors aus gemeinsamen Studentenzeiten und schickte Erol deshalb in die Universitätsklinik. Nach der Diagnose ging Erol nicht mehr in die Fabrik, sondern reiste zurück nach Bürnük, um dort, im Haus seines Vaters, auf seinen Tod zu warten.
Die Herstellung einer Jeans kostet in der Türkei 15 Euro, in China sieben Euro, in Bangladesch fünf Euro.
Die letzte Jeans, die Erol Ümit am Tag vor der Diagnose sandgestrahlt hatte, gehörte zu einer größeren Charge, die ein deutsches Textilunternehmen aus dem Rheinland bei einem türkischen Zwischenhändler geordert hatte. Das deutsche Unternehmen zahlte an den türkischen Zwischenhändler 35 Euro pro Stück, inklusive Transport, und verkaufte die 12 600 Exemplare zum Stückpreis von 80 Euro an eine internationale Kette mit Hauptsitz in Mailand, die wiederum die Boutiquen ihres deutschen Ablegers damit bestückte.
Die letzte Jeans, die Erol Ümit sandgestrahlt hatte, kaufte drei Wochen später die Gattin eines Düsseldorfer Architekten in einer Boutique an der Königsallee. Die 58-Jährige war stolz darauf, immer noch in Kleidergröße 34 zu passen. Dafür trainierte sie täglich zwei Stunden im Fitness-Studio und aß so gut wie nichts. Die amerikanische Inch-Größe 27 schreckte sie nicht, auch wenn sie bei der Anprobe kaum zu atmen wagte. Die letzte Jeans, die Erol Ümit im fernen Istanbul sandgestrahlt hatte, war nun eine Designer-Jeans der Marke Metro Heroine und kostete 379 Euro. Aber der Preis interessierte die Käuferin nicht sonderlich. Sie bezahlte mit der goldenen Kreditkarte ihres Mannes, setzte ihre Sonnenbrille auf und verließ den Laden.
Die Frau trug die Neuerwerbung noch am selben Abend, beim Jahrgangstreffen. Sie hatte lange gezögert: Wollte sie all die Gestalten aus ihrer Jugendzeit tatsächlich wiedersehen? Nach vierzig Jahren? Schließlich hatte sie doch zugesagt. Besser allemal, als einen dieser langweiligen, nervenden Abende mit ihrem Mann zu verbringen. Außerdem: Alle sollten sehen, wie gut sie sich gehalten hatte. Das ließ sich nun mal am besten mit einer hautengen Jeans demonstrieren, in Kombination mit Zwölf-Zentimeter-Absätzen und einer sündhaft teuren Ledercorsage. Sie genoss das neidvolle Tuscheln der im Lauf der Jahrzehnte verdorrten Mauerblümchen und die anzüglichen, sehnsüchtigen Blicke der bierbäuchigen Filialleitertypen und bedachte alle mit einem Augenaufschlag, der sexuelle Aggressivität und zugleich Unerreichbarkeit signalisierte. Alles lief nach Plan, bis sie ihre beste Freundin seit Schülertagen vor dem Spiegel des Waschtischs der Damentoilette traf: Ist die neu? Sie steht dir überhaupt nicht. Sie macht dich irgendwie fett.
Zehn Minuten später verließ die Gattin des Architekten die Party, fuhr mit dem Taxi nach Hause und mit dem Privataufzug hinauf in die Penthouse-Wohnung im achten Stock, zerrte an dem noch sperrigen Reißverschluss, zwängte sich aus der Jeans und stopfte sie wutentbrannt durch die Klappe des Müllschluckers. Diesen Abend hatte sie sich völlig anders vorgestellt. Wieso war ihr Mann nicht da? Wo steckte der schon wieder?
Sie nahm eine Flasche Taittinger aus dem Kühlschrank, öffnete sie routiniert, ließ sich im Wohnzimmer auf die Couch fallen und schaltete den Fernseher ein. Während sie das vierte Glas leerte und sich der allmählichen Betäubung hingab, setzte sich Erol Ümit im Holzhaus seines Vaters in Bürnük unweit der Schwarzmeerküste eine Überdosis Morphium, um dem nahenden Erstickungstod zu entgehen.
Am Morgen des 30. Oktober hatte Bernd Oschatz nicht die geringste Ahnung, dass ihm nur noch 26 Tage bis zu seinem Tod blieben. Dabei war er nicht einmal krank, für sein Alter sogar kerngesund, bescheinigte ihm regelmäßig sein Hausarzt, den er einmal im Jahr zum Routinecheck aufsuchte. Er pflegte keine riskanten Hobbys; Bernd Oschatz pflegte überhaupt keine Hobbys. Er besaß keinen Führerschein, und vor dem Überqueren von Straßen sah er stets zunächst nach links und dann nach rechts und dann noch mal nach links. Wie also hätte er ahnen sollen, dass sein Leben so bald enden würde? Wie hätte er ahnen können, dass eine höhere Ordnung seinen Tod in 26 Tagen erforderte, nur weil er ein einziges Mal in seinem bislang kümmerlichen Leben sein Schicksal selbst in die Hand nahm? Und was hätte es geändert, wenn er seinen baldigen Tod zu diesem Zeitpunkt geahnt hätte?
Vielleicht alles.
Vielleicht auch nichts.
Am Morgen des 30. Oktober meldete sich der Radiowecker auf die Minute genau mit den Sechs-Uhr-Nachrichten. Aber da war Bernd Oschatz längst wach. Seit knapp einer Stunde lag er schon so da, stocksteif auf dem Rücken, als wäre er bereits tot, die Bettdecke bis zum Hals gezogen, die Hände wie zum Gebet gefaltet, und starrte hinauf ins Dunkel. Der Radiosprecher redete ohne Unterlass, über Tote in Kabul, über Aktienkurse in New York, über Straßenschlachten in Paris, Straßenschlachten in Athen, Straßenschlachten in London, brennende Autos, brennende Geschäftshäuser in Birmingham, Liverpool und Manchester, aber Bernd Oschatz hörte nicht richtig zu. Er dachte nach. Seine Gedanken drehten sich im Kreis, drehten sich unermüdlich um sein zweites, um sein neues Leben, das mit dem heutigen Tag beginnen sollte.
Die Gedanken dienten nicht etwa dazu, eine Entscheidung zu treffen. Seine Entscheidung hatte er schon vor Monaten getroffen. Unumstößlich. Nüchtern, vernünftig, sachlich, ohne auch nur einen Funken Euphorie. Bernd Oschatz war kein Mensch, der sich von Gefühlen überwältigen ließ.
Nein, die Gedanken dienten vielmehr dazu, sich mit dieser getroffenen Entscheidung anzufreunden, sie zu liebkosen und zu streicheln, um sie nicht länger als Fremdkörper in seiner Seele, sondern wie einen guten Freund zu empfinden.
Oder wie eine Geliebte.
Der Vergleich amüsierte ihn. Seit mehr als zwanzig Jahren hatte keine Frau mehr das Bett mit ihm geteilt, und Bernd Oschatz rechnete nicht damit, dass sich dies in Zukunft noch einmal ändern würde. Als der Radiosprecher das Wetter für den 30. Oktober verlas, schaltete Oschatz das Licht an, kletterte aus dem Bett, schlüpfte in die Pantoffeln, zog den Bademantel über, schlug das Kopfkissen auf und strich das Laken glatt.
Das Wetter. Null Grad. Höchstwert im Lauf des Tages: sieben Grad. Aber trocken. Oschatz gehörte nicht zu den Menschen, die sich tagtäglich über das Wetter erregten. Oschatz passte sich an. An das Wetter. An die Menschen.
Er schaltete den Radiowecker aus, schlurfte in die Küche, füllte den Filter der Kaffeemaschine mit Pulver für fünf Tassen, schlurfte über den kalten Flur hinüber ins Badezimmer, pinkelte, wusch sich anschließend gründlich die Hände und betrachtete sein Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken.
65 Jahre.
Von manchen Menschen behauptete man, sie sähen jünger aus, als sie tatsächlich waren.
Von ihm behauptete das niemand.
Bernd Oschatz belegte das Knäckebrot mit einer Scheibe Gouda. Fettreduziert. Seit Jahren schon verzichtete er auf Butter und auf Wurst, wegen des Cholesterinspiegels. Dazu hatte ihm sein Hausarzt geraten. Oschatz achtete auf seine Gesundheit, trank selten Alkohol, ging abends zeitig zu Bett und benutzte im Büro selten den Fahrstuhl, stattdessen fast immer die Treppen. Nur das Rauchen hatte er sich nicht abgewöhnt.
Während er die zweite Tasse Kaffee trank, rauchte er bei geöffnetem Fenster eine Zigarette, die erste von fünfen, die er sich pro Tag gestattete. Den restlichen Kaffee goss er in eine Thermoskanne und füllte sie anschließend mit warmer Milch auf. Er belegte zwei weitere Scheiben Knäckebrot mit Gouda, platzierte sie sorgsam in einer Tupperware-Dose, zusammen mit zwei Cocktailtomaten aus dem Edeka und vier Delikatessgürkchen von Hengstenberg. Anschließend steckte er die Plastikdose und die Thermoskanne in seine Aktentasche, die unter der Garderobe neben der Wohnungstür bereitstand.
So wie jeden Morgen.
Wenn ihn jemand als den langweiligsten Menschen der Welt gescholten hätte – Bernd Oschatz hätte vermutlich nicht einmal widersprochen. Widerspruch war ohnehin nicht seine Stärke, und Routine, wie er das benennen würde, was andere Menschen Langeweile nannten, verlieh ihm eine Sicherheit, die seine Seele angenehm beruhigte.
Die letzte Frau, die hin und wieder das Bett mit ihm geteilt hatte, elf Monate lang, vor mehr als zwanzig Jahren, hatte ihn bei ihrer endgültig letzten Unterredung einen Langweiler genannt. Bald jedoch würde es mit der geliebten Routine vorbei sein, wusste Bernd Oschatz. Morgen schon.
Das Duschen hatte er bereits am Vorabend erledigt. So wie jeden Abend. Bernd Oschatz putzte sich die Zähne, rasierte sich und kämmte sorgfältig die wenigen Haare, die ihm verblieben waren. Er nahm frische Unterwäsche und ein frisch gebügeltes weißes Hemd aus dem Schrank und wählte den grauen Anzug. Er besaß außerdem einen braunen und einen dunkelblauen Anzug, die er abwechselnd trug, den grauen, den braunen, den dunkelblauen, dann wieder den grauen. Ferner besaß er drei farblich auf die Anzüge abgestimmte Krawatten.
Jedes Wochenende bügelte er die Anzüge auf und polierte seine vier Paar Schuhe, zwei dunkelbraune und zwei schwarze. Sein Leben lang hatte er beim Kauf seiner Kleidung darauf geachtet, nur ja nicht aufzufallen und aus der Menge zu stechen. Heute beschlich ihn zum ersten Mal das gute Gefühl, dass ihm dies einmal von Nutzen sein könnte.
An der Bushaltestelle stand an diesem Morgen ein alter Mann, der zweifellos nicht zu den wartenden Fahrgästen gehörte, und durchwühlte den Abfallbehälter. Sein Arm verschwand durch die enge Öffnung fast bis zur Schulter in dem Metallzylinder. Er roch an den Essensresten, die er zutage beförderte, bevor er sie in der mitgebrachten Plastiktüte verschwinden ließ. Nur ein einziges Mal blickte er kurz auf, und Oschatz sah schnell weg.
Der Bus, der ihn zur U-Bahn-Station bringen würde, hatte siebeneinhalb Minuten Verspätung. Das war nicht weiter schlimm, weil Oschatz immer einen Zeitpuffer einplante, sicherheitshalber. Pünktlich um acht saß er also an seinem Schreibtisch im dritten Stock des Nordflügels, startete den Computer und überbrückte die Wartezeit, indem er sich etwas Milchkaffee aus der Thermoskanne in die Tasse goss.
Bernd Oschatz war ein Vorbild, was die Arbeitszeiten betraf. So gehörte sich das, fand er: Als Chef sollte man Vorbild für seine Mitarbeiter sein. Oschatz war Chef der neunköpfigen Abteilung Rechnungswesen und Mahnwesen. Chefbuchhalter Oschatz würde auch heute das Büro erst gegen 19 Uhr verlassen. Nach elf Stunden ohne Mittagspause. Zum letzten Mal.
Aber das wussten sie nicht.
Niemand in der Firma wusste das. Denn offiziell war erst morgen sein letzter Arbeitstag. Der 31. Oktober.
Morgen früh würde ein hässlicher Blumenstrauß angeliefert werden, nicht zu teuer, das Abschiedsgeschenk der Firma, ferner war sicher ein kleiner Umtrunk vorgesehen, Sekt, nicht zu teuer, wahlweise mit oder ohne Orangensaft, einer aus dem Vorstand würde vermutlich kurz vorbeischauen und eine kleine Rede halten wollen, eine von der ganz billigen Sorte, mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Die acht Mitarbeiter des Chefbuchhalters Oschatz hatten sicher schon heimlich Geld gesammelt und würden ihm zum Abschied einen Gutschein überreichen wollen, im neutralen Umschlag, im Wert von 73 Euro oder so, wahrscheinlich von der Buchhandlung am Ubierring. Oschatz, die Leseratte. Oschatz, der Bücherwurm.
Um all dem zu entgehen, hatte Bernd Oschatz beschlossen, dass bereits heute sein letzter Arbeitstag sein sollte.
Morgen früh um halb acht würde er sich krank melden, und zwar telefonisch beim Pförtner. Das würde einige im Büro mächtig irritieren. Aber das würde erst der Anfang sein. Chefbuchhalter Bernd Oschatz hatte beizeiten Vorsorge getroffen, dass er der Firmenleitung auch nach seinem Abschied noch lange in Erinnerung bleiben würde.
Eule schleuderte die Mappe so heftig über den Küchentisch, dass sie über die jenseitige Kante rutschte und zu Boden segelte. Eule war wütend. Sehr wütend sogar. Sonja hatte die Eule jedenfalls noch nie so wütend gesehen.
Patrick schüttelte missbilligend den Kopf, bückte sich und hob die Mappe wieder auf.
»Bis du jetzt völlig übergeschnappt?«
Patricks Frage machte Eule nur noch wütender.
»Wir haben Regeln. Du verstößt gegen die Regeln.«
»Was für Regeln?«
»Wir lassen uns nicht kaufen.«
»Kaufen? Von wem denn?«
»Von niemandem!«
»Ich meinte: Wer will uns denn kaufen?«
»Dieser senile Sack. Wer sonst?«
»So ein Blödsinn. Ein alter Mann, der begriffen hat, dass er ein Leben lang auf der falschen Seite gestanden hat. Der etwas gutmachen will. Ein einziges Mal etwas richtig machen will in seinem Leben, bevor es vorbei ist, das kleine, bedeutungslose Leben. So einer ist mir doch allemal lieber als diese intellektuellen Maulhelden, die in ihren schicken Lofts hocken, teuren Rotwein schlürfen und dabei selbstgefällig über ihre wilden Jugendjahre schwadronieren, über ihre aufregenden Kriegserlebnisse bei den Anti-AKW-Demos …«
»Patrick, ich will doch nur sagen, es fühlt sich irgendwie falsch an. Das sagt mir mein Bauchgefühl.«
»Bauchgefühl? Jetzt mal ganz ehrlich: Seit wann haben Computerfreaks wie du denn Bauchgefühle?«
»Verschone mich mit deinem Sarkasmus.«
»Mann, Eule, das ist der Wendepunkt. Die einzigartige Chance, die Aktion endlich auf ein neues Level zu heben.«
»Wir brauchen ihn nicht. Wir sind schon 150 000 …«
»… User, ja. Zuschauer vor dem Computer, auf den bequem gepolsterten Logenplätzen. Träumer. Sozialromantiker, die Angst um ihren lächerlichen 400-Euro-Job haben, oder um ihren beschissenen Zeitvertrag. Die nach Feierabend gegen die Abholzung des Regenwalds protestieren, indem sie E-Mails an die brasilianische Regierung schicken. Großartig. Oder in der Mittagspause mal schnell zum Flashmob rüber zu McDonald’s hüpfen. Toll. Kapuze über, damit die Überwachungskamera sie nicht outet und die Karriere versaut. Und schon die Panik kriegen, wenn sie nur eine Minute zu spät zurück zur Arbeit kommen. Aber wie viele von denen kriegen tatsächlich den Arsch hoch, wenn’s wirklich drauf ankommt? Ein Promille vielleicht? Aber bitte nur, wenn’s nicht zu viele Umstände macht.«
»Alles braucht seine Zeit …«
»Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.«
»Kann ich vielleicht auch mal was sagen?«
Eule und Patrick starrten Sonja verwundert an, als registrierten sie erst jetzt, dass sie nicht zu zweit, sondern zu dritt in der Küche saßen. Sonja ließ sich Zeit, nahm erst einen Schluck aus ihrem Kaffeebecher, bevor sie die beiden Jungs mit einem ernsten, sorgenvollen Blick bedachte.
»Was ist, wenn das Ganze eine Falle ist?«
Am Morgen seines letzten regulären Arbeitstages flog Bernd Oschatz für eine Woche nach Fuerteventura.
Dabei hatte er Urlaub Zeit seines Berufslebens für pure Zeitverschwendung gehalten. Gelegentlich hatte er einen freien Tag genommen, um Behördengänge zu erledigen. Vor zwölf Jahren war er aus dem Apartment in die größere Zwei-Zimmer-Wohnung nebenan umgezogen, da hatte er sich drei Urlaubstage gegönnt. Aber jetzt war er ja nicht mehr berufstätig. Jetzt, zum Start in sein neues, unstetes Leben, wollte er ein einziges Mal spüren, wie sich das wohl anfühlte, wovon alle so schwärmten, wonach alle so gierten, als hinge das Glück der Erde davon ab, als zählten die restlichen Tage des Jahres nicht.
Nicht, dass ihm seine Arbeit jemals besonders viel Spaß gemacht hätte. Spaß. Ging es bei der Arbeit um Spaß? Ging es etwa beim Zähneputzen um Spaß?
Die letzten Jahre hatte ihn die Arbeit nur noch belastet. Nicht seinen Körper, nicht seinen Geist.
Nur seine Seele.
Dieser einwöchige Urlaub war für Bernd Oschatz in jeder Hinsicht eine Premiere. Seine erste Flugreise. Und seine erste Auslandsreise. Weil er sich für den alten, schäbigen Koffer schämte, in dem er auf dem Dachboden den geerbten, nie benutzten Christbaumschmuck aufbewahrte, hatte er sich zuvor noch eigens einen neuen Koffer gekauft, einen Samsonite, mit Rollen, viel zu groß für eine Person und für eine Woche. Ich will die erste Novemberwoche irgendwohin, wo es dann noch schön warm ist, hatte er der Frau im Reisebüro gesagt, während draußen der Herbststurm die welken Blätter von den Bäumen riss und der kalte Regen gegen das Schaufenster trommelte. Was wollen Sie denn machen in der Woche? Aktivurlaub? Wellness? Neue Leute kennenlernen? Wir haben mittlerweile auch spezielle Angebote für Singles im Seniorenalter.
Bernd Oschatz hatte jedes Mal den Kopf geschüttelt. Ich will nur meine Ruhe haben. Das Meer sehen. Und vielleicht mal am Strand spazieren gehen. Die Frau hatte verständnislos gelächelt und ihm Fuerteventura empfohlen.
Vulkankegel. Lavafelder. Und das Meer, immer wieder das Meer. Bernd Oschatz starrte unentwegt durch die eingestaubte Seitenscheibe. Keine Sekunde wollte er das Meer aus dem Blick verlieren, während der Bus durch die Wüste raste, als sei der Teufel hinter dem Fahrer her. Das Meer. Alle Schattierungen von Blau und Türkis, endlos weit.
Mitten in der gottverlassenen Mondlandschaft zwischen Costa Calma und Jandia bremste der Bus, bog von der Schnellstraße ab und folgte den Serpentinen zur Küste hinunter. Hotel Melia Gorriones. Ein Betonklotz mit Palmen vor dem Portal, das einzige Gebäude weit und breit, abgesehen von der Hütte der Surfer unten am Strand.
Außer Bernd Oschatz stieg niemand aus. Der Bus kämpfte sich zurück zur Schnellstraße.
Die ersten drei Tage verließ er sein Zimmer im obersten Stockwerk nur zu den Mahlzeiten. Frühstück und Abendessen. Bernd Oschatz hatte Halbpension gebucht. Die Zeit zwischen den beiden Mahlzeiten verbrachte er auf seinem Balkon. Meerblick. Darauf hatte er im Reisebüro bestanden. 17 Euro Aufpreis pro Nacht. Er konnte sich gar nicht satt sehen. Wasser, nichts als Wasser bis zum Horizont. Gerade mal 95 Kilometer waren es bis zur Küste Afrikas, hatte er zuvor in seinem Reiseführer gelesen. Westsahara. Bernd Oschatz saß da, auf seinem Balkon, saß einfach nur da und tat nichts, außer aufs Meer zu schauen und die Wärme zu genießen, eine trockene, frische, angenehm schmeichelnde Wärme, das ganze Jahr über, so stand es in seinem Reiseführer, und es stimmte, es stimmte haargenau, zumindest stimmte es in dieser ersten Woche des Novembers.
ARD und RTL.
Mehr deutsche Programme fand er nicht, sosehr er auch die ausgeleierte Fernbedienung bemühte. Jede Menge spanische Sender, außerdem zwei französische, ein britischer, ein belgischer und ein italienischer Kanal. Abends legte er sich aufs Bett und schaute so lange fern, bis er müde genug war, um einzuschlafen. Am zweiten Abend zeigten die Tagesthemen einen Bericht aus Berlin. Junge Leute, einige hundert vielleicht, stürmten das Hotel Intercontinental und schockierten für wenige Minuten die Gäste des Bundespresseballs. Eine Hundertschaft der Polizei trieb sie schließlich zurück auf die Straße. Der Moderator vergaß zu erwähnen, um welches Thema es bei dem unerwünschten Protest gegangen war. Auch die Organisatoren des Protests wurden nicht erwähnt. Dabei war der Schriftzug auf den Plakaten einige Male deutlich zu lesen: REBMOB.
Im Speisesaal wählte Bernd Oschatz stets einen winzigen Tisch in der Nähe der Schwingtür, durch die das Personal, vorwiegend Marokkaner und Schwarzafrikaner, das schmutzige Geschirr abtransportierten. Niemand machte ihm diesen Tisch streitig, niemand wollte diesen Tisch haben. Er las, während er aß, aus Sorge, er könnte dennoch von den anderen Hotelgästen angesprochen werden, und um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Er blätterte in seinem Notizbuch und las nach, was er in den vergangenen zwei Jahren so alles eingesammelt und aufgeschrieben hatte, zunächst ziellos und planlos, aber schon damals mit stetig wachsender Wut.
Nach dem Zusammenbruch des Hitler-Regimes verabschiedet die CDU am 3. Februar 1947 in der Aula eines Gymnasiums in der westfälischen Bergarbeiterstadt Ahlen das erste Parteiprogramm der neuen Partei. Längst vergessen. Aber die ersten zwei Sätze muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen:
»Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Inhalt und Ziel einer sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein …«
Der schlaksige Schwarze nickte freundlich und zog den leeren, schmutzigen Teller weg. Bernd Oschatz nickte freundlich zurück. Zu gerne hätte er ihn gefragt, wo er herkommt, warum er hier ist. Aber er traute sich nicht. In welcher Sprache hätte er ihn anreden sollen? Oschatz blickte ihm nach, bis der Schwarze in der Küche verschwunden war, dann las er weiter:
»Je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch.«
Hat der Mann das tatsächlich geglaubt? Ludwig Erhard (CDU) war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister, Autor des Buches »Wohlstand für alle«, politischer Motor des deutschen Wirtschaftswunders. Was ist aus dem »Rheinischen Kapitalismus« geworden? Was würde der dicke Professor mit der Zigarre heute sagen, angesichts der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts?
»Leider war das zu diesem Zeitpunkt politisch längst nicht mehr durchsetzbar.«
Dr. Franz Möller, rheinischer Bundestagsabgeordneter der CDU von 1976 bis 1994, zuletzt Mitglied des Ältestenrates und Justitiar seiner Fraktion. Kluger Mann. Aufrechter Mann. Politiker aus Überzeugung. War maßgeblich an der durch die Wiedervereinigung erforderlichen Neufassung des Grundgesetzes beteiligt, scheiterte aber mit seinem Versuch, in einem Aufwaschen die »Soziale Marktwirtschaft« als verbindliche Wirtschaftsordnung in der deutschen Verfassung zu verankern. Keine Chance.
»Der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen hat natürlich mehr Macht als ich.«
Gerhard Schröder (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, dann Bundeskanzler (1998–2005). Wie kann man so etwas sagen? Wusste er überhaupt, was das bedeutete? War es ihm vielleicht egal?
Oschatz blätterte noch einmal zurück. In seiner Schulzeit hatte der Geschichtsunterricht bei Bismarck geendet. 1871. Alles, was er über die Geschichte des 20. Jahrhunderts wusste, hatte er sich später selbst beigebracht. Die beiden großen Volksparteien der Bundesrepublik. Wandlungsfähig bis zum Erbrechen. Adenauer brachte die CDU in Windeseile von ihrem antikapitalistischen Kurs ab. Aus Angst vor den Russen. Und um den Westmächten zu gefallen. Das konnte Oschatz noch verstehen. Stalin. Ulbricht. Der Kalte Krieg. Die Mauer. Schwierige Zeiten. Aber die Sozialdemokratische Partei Deutschlands? Von Schröder bis zur Unkenntlichkeit demontiert. Wofür hatten August Bebel, Kurt Schumacher, Willy Brandt in ihren frühen politischen Jahren so gelitten, Repressalien auf sich genommen, schwerste Demütigungen, Todesangst?
»Generalamnesie, Generalamnestie.« Oschatz murmelte vor sich hin und schüttelte den Kopf. Der Schwarze sah ihn fragend an und hob dabei die linke Augenbraue. Oschatz nickte nun heftig, damit sein Kopfschütteln nicht missverstanden wurde. »Doch, doch, sehr gerne.« Der Schwarze eilte davon und kehrte bald mit einer Tasse Kaffee zurück.
»Danke. Thank you. Gracias.« Der Schwarze nickte, lächelte und antwortete: »De nada.«
Eigentlich galt Selbstbedienung im Speisesaal des Hotels, aber der Schwarze las ihm dennoch jeden erdenklichen Wunsch von den Lippen ab. Oschatz gab ihm ein Trinkgeld, wie jeden Abend. Er hatte Halbpension gebucht, die meisten anderen Gäste hingegen all inclusive, wie man auf einen Blick an den bunten Bändchen an den Handgelenken erkennen konnte. Das Personal erhielt fast nie ein Trinkgeld, hatte er beobachtet. Oschatz fand, das gehörte sich nicht.
Je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch. Oschatz fand, die Soziale Marktwirtschaft war die genialste PR-Aktion der Nachkriegszeit. Angeblich hatte nicht Erhard, sondern sein Staatssekretär den Begriff erfunden und in die Welt gesetzt. Der Dicke soll zunächst vor Wut geschäumt haben – bis er die Genialität der Parole begriff. Bernd Oschatz war 1947 zur Welt gekommen und zusammen mit der Sozialen Marktwirtschaft aufgewachsen. Lange Zeit hatte er felsenfest daran geglaubt, sie gehöre zur Bundesrepublik wie das Grundgesetz.
»Das ist ein weltweiter Trend, dem kann man sich nicht verschließen. Das Normalarbeitsverhältnis ist ein Mythos, der in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Das war vorher so nie da, das wird auch in Zukunft so nicht wieder kommen. Das war nur eine kurze Phase.«
Professor Klaus F. Zimmermann, Direktor des Instituts zur Zukunft der Arbeit und bis Februar 2011 Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, in einem Interview des Bonner General-Anzeigers auf die Frage, warum es immer mehr prekäre Arbeit gibt und ob es eines Tages wieder zu geregelten Verhältnissen für Arbeitnehmer kommen könnte.
Oschatz schüttelte den Kopf. So, so, Herr Professor. Ein Mythos. Entstanden in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Fragen wir doch mal einen Unternehmer, der diese Nachkriegsepoche gar nicht mehr erlebt hat:
»Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich eine Menge Geld habe. Ich habe vielmehr eine Menge Geld, weil ich gute Löhne zahle.«
Robert Bosch (1861–1942), deutscher Industrieller und Gründer des Bosch-Imperiums.
Es gab sie sogar heute noch in Deutschland, diese anderen Unternehmer. Auch davon war Bernd Oschatz felsenfest überzeugt. Vor allem unter den älteren Selfmade-Männern. Götz Werner zum Beispiel, der Gründer der dm-Märkte. Oder dessen Branchenkollege Dirk Roßmann. Oder Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Oder Holger Strait, Inhaber der Lübecker Marzipanmanufaktur Niederegger. Leben und leben lassen. Aber die große Mehrheit, vorzugsweise diese von sämtlichen Risiken befreiten Topmanager-Kaste in den Vorständen und Geschäftsleitungen, diese egozentrischen Tantiemenabkassierer, kannte nur noch ein einziges Gesetz: das der grenzenlosen, gnadenlosen Gier.
»Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa sieht der westliche Kapitalismus keine Veranlassung mehr, ständig zu beweisen, dass er die humanere Gesellschaftsordnung verkörpert.«
Andreas Bohne, ehemaliger Wirtschaftsredakteur und Korrespondent (u. a. FAZ, Handelsblatt).
Wann würde der Tropfen kommen, der selbst in Deutschland das Fass zum Überlaufen brachte? Hatte eine Revolution jemals in der Weltgeschichte eine bessere Gesellschaft hervorgebracht? Fragen über Fragen, über die sich Bernd Oschatz seit zwei Jahren schon Abend für Abend den Kopf zerbrach. Er hatte für sich eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die sein restliches Leben verändern würde.
»Wir werden am Ende siegen, weil wir den verstaubten Begriff ›Revolte‹ neu definieren und justieren. Widerstand ist nun ein konsequent lustvoller, ein kreativer und basisdemokratischer Prozess …«
REBMOB – Rebellierende Massen / Deutsche Internet-Aktionsplattform des internationalen Prekariats. Was für ein fürchterlicher Name. Wer hatte sich nur diesen fürchterlichen Namen ausgedacht?
Am Morgen des vierten Tages unternahm Bernd Oschatz zum ersten Mal einen Strandspaziergang.
Er marschierte etwa eine halbe Stunde lang strammen Schrittes und gegen den Wind in Richtung Süden, ohne auch nur einer einzigen Menschenseele zu begegnen. Die Möwen beäugten ihn misstrauisch, als er sich in einem kurzen, aber mächtigen Anfall von Glück seiner Kleidung entledigte und übermütig wie ein Schuljunge durch die Brandung hüpfte. Das Wasser hatte immerhin noch 21 Grad. Er prustete und juchzte und tauchte unter den flachen Wellen hindurch. Erst als er feststellte, wie stark und gefährlich der Sog war, der ihn hinauszuziehen drohte, schwamm er zurück.
Der Wind trocknete ihn rasch, die allgegenwärtige Sonne wärmte wohlig sein Herz. Er breitete die Arme aus und schloss die Augen. Er hätte gerne geschrien, ganz laut geschrien, einfach so, vor Freude vielleicht, aber das gestattete er sich nicht. Bernd Oschatz konnte sich nicht erinnern, wann er sich jemals so frei gefühlt hatte. Nackt und alleine auf dieser Welt. Er stand an der Wasserlinie und sah zu, wie seine Füße mit jeder sanften Welle tiefer im schlammigen Sand versanken.
Was für eine Lust.
Er spürte den Blick und drehte sich ruckartig um. Fast wäre er gestolpert, weil seine Füße noch immer bis zu den Knöcheln im schlammigen Sand steckten.
Keine zwanzig Meter entfernt stand eine Frau.
Ihre Augen ruhten auf ihm.
Sie lächelte.
Sie war etwa so alt wie er, vielleicht aber auch etwas jünger. Auf die Entfernung war das schwer zu sagen. Wie lange hatte sie schon so dagestanden und ihm zugeschaut? Sie trug Sportschuhe und all diese Sachen, die auch die Jogger daheim im Volkspark trugen. Ein Stirnband bändigte ihr schulterlanges, graues Haar.
Drei Schritte bis zum Kleiderberg.
Bernd Oschatz bückte sich, griff nach seiner Unterhose, zog sie hastig an, dann die lange Hose, ungeschickt auf einem Bein hüpfend. Als er wieder aufschaute, hatte sie sich schon ein gutes Stück weiter in Richtung Süden entfernt. Sie lief nicht, sie marschierte. Erst jetzt bemerkte er die Skistöcke. Bernd Oschatz beobachtete sie eine Weile, ihre schmalen Schultern, ihren federnden Gang, ihr flatterndes Haar. Dann machte er sich auf. Zurück zum Hotel. Hatte er ihr Lächeln erwidert? Er konnte sich nicht daran erinnern.
Am Abend sah er sie wieder.
Aus im Nachhinein unerfindlichen Gründen war er nach dem Abendessen nicht unverzüglich zurück auf sein Zimmer gegangen, sondern hatte sich an die Theke der Bar im Erdgeschoss gesetzt und einen Kaffee bestellt.
»Ist der Platz noch frei?«
Jede Menge Barhocker waren noch frei, um diese Zeit. Aber sie fragte ihn nach dem Hocker gleich neben ihm.
Warum?
Oschatz nickte.
Sie schenkte dem Barmann ein Lächeln und unterhielt sich mit ihm auf Spanisch. Oschatz verstand kein Wort, obwohl er sämtliche Vokabeln, die sein Reiseführer auf den letzten beiden Seiten aufgelistet hatte, auswendig gelernt hatte, als Zeichen des Respekts vor dem Gastland.
Der Barmann stellte ein fast bis zum Rand gefülltes Sektglas vor ihr ab. Sie dankte ihm mit einem weiteren Lächeln, nahm gleich einen Schluck und schloss, während sie trank, genüsslich die Augen. Sie trug ihr graues Haar schulterlang, viel länger, als Frauen in ihrem Alter, die Bernd Oschatz kannte, ihr Haar gewöhnlich trugen. Das silbrige Grau ihrer Haare passte gut zu ihrer gebräunten Haut und zu dem schneeweißen, knöchellangen Kleid, fand er. Sie hatte Sommersprossen. Auf der Nase. Auf ihren Armen. Und auf dem Ansatz ihrer Brüste, soweit Oschatz dies aus den Augenwinkeln erkennen konnte. Er fühlte sich ertappt, als sie das Glas abstellte und ihn anlächelte.
»Ich hoffe, ich habe Sie heute Vormittag am Strand nicht in Verlegenheit gebracht.«
Oschatz schüttelte den Kopf.
»Wenn ich morgens meine Nordic-Walking-Runde drehe, lasse ich mich gewöhnlich von nichts und niemandem ablenken. Ich weiß auch nicht, was da plötzlich in mich gefahren ist. Aber als ich Sie so sah, eins mit dem Wind und den Wellen, in friedlicher Harmonie mit sich und der Natur, da war ich …«
»Schon gut. Kein Problem.«
»Ich heiße Inge.«
»Günther«, log Bernd Oschatz. Ein besserer Name als der seines Bruders fiel ihm auf die Schnelle nicht ein. Ausgerechnet Günther, das Sorgenkind, das schwarze Schaf der Familie, der Lebemann, der schwule Jazztrompeter, der …
»Günther, sind Sie zum ersten Mal …«
»Ja!«
Alles passierte in diesen Tagen zum ersten Mal in seinem Leben. Auch, dass ihn eine wildfremde Frau ansprach.
»Dachte ich mir schon!«
»Wieso?«
»Nun ja … wer im Anzug zum Strand geht …«
»Was ist denn Ihrer Meinung nach die angemessene Kleidung, um einen Strand aufzusuchen?«
Sie lachte. Ein schönes Lachen. Völlig zweckfrei. Es diente nicht dazu, andere zu verletzen.
»Daheim drückt jetzt der graue November aufs Gemüt, und wir sitzen hier, im Paradies. Ist das nicht wunderbar?«
Oschatz nickte.
»Ich komme zweimal im Jahr hierher, Anfang November und Anfang März, jeweils für drei Wochen. Um den Winter abzukürzen. Wissen Sie, Fuerteventura kann man nur lieben oder hassen. Entweder kommen Sie nie wieder her, oder Sie kommen immer wieder her. So wie ich.«
Bernd Oschatz nickte zustimmend. Denn er war sich ganz sicher, nie wieder herzukommen.
Inge leerte ihr Glas.
»Günther, Ihr Kaffee ist alle. Trinken Sie noch etwas mit mir? Ich würde Sie gerne auf ein Glas einladen.«
Sie wartete die Antwort erst gar nicht ab, sondern rief dem Barmann hinter dem Tresen etwas auf Spanisch zu. Der grinste, eigentümlich anzüglich, so kam es Oschatz jedenfalls vor, und griff ins Kühlfach. Aus den Boxen an der Decke tröpfelte Musik, rieselte herab wie pulverisiertes Beruhigungsmittel, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Sinn.
»Cava. Das ist spanischer Sekt. Oder besser gesagt: spanischer Champagner. Flaschengärung. Sehr lecker. Schon mal probiert?«
Bernd Oschatz schüttelte den Kopf.
»Günther, Günther, Sie sind ja nicht gerade besonders redselig. Aber vielleicht klappt’s ja nach dem ersten Gläschen besser. Prost. Oder salud, wie man hier sagt. A tu salud, Günther. Das Leben ist kurz. Viel zu kurz. Und deshalb viel zu schade, um es mit Nebensächlichkeiten zu verplempern.«
»Zum Wohl.«
Bernd Oschatz schloss die Augen und trank. Mit geschlossenen Augen sah er Inge vor sich, wie sie in der Tür seines Zimmers stand und ihn anlächelte, er sah, wie sie sich die Träger von den Schultern schob und das Kleid achtlos zu Boden gleiten ließ, wie sie über das Kleid hinwegstieg und …
»Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben. Mit 64 Jahren. Das ist doch kein Alter zum Sterben, oder? Wir hatten noch so viel vor, wollten reisen, die Welt sehen.«
»Das tut mir leid.«
»Sind Sie verheiratet, Günther?«
Bernd Oschatz schüttelte den Kopf.
»Waren Sie es jemals, Günther?«
»Nein.«
»Nach seinem Tod war ich die ersten anderthalb Jahre wie gelähmt. Ich verließ die Wohnung nur noch, um zur Arbeit zu gehen. Ich machte meinen Job, ich funktionierte wie ein gut geöltes Uhrwerk. Wie ein seelenloser Roboter. Mein Arbeitgeber konnte sich nicht beklagen. Die tapfere Inge, sagten die Kollegen immer. Sie hatten keine Ahnung. Dann wurde ich pensioniert, und plötzlich gab es nichts mehr, womit ich mich ablenken konnte. Ich war also gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mich zu fragen: Inge, wie willst du dein restliches Leben verbringen?«
Inge gab dem Barmann ein Zeichen. Der nickte.
»Günther, ich müsste mal ganz kurz verschwinden. Für kleine Mädchen. Bin gleich wieder da.«
Sie bedachte ihn mit einem koketten Augenaufschlag, wie ein junges Mädchen, und legte ihre warme Hand auf seinen Unterarm. Es brannte wie Feuer.
»Aber nicht weglaufen, ja?«
Bernd Oschatz sah ihr nach.
Sie war schön.
So wunderschön.
Der Barmann stellte zwei frisch gefüllte Sektgläser vor ihm ab und räumte die beiden leeren Gläser weg. Bernd Oschatz bat auf Spanisch um die Rechnung.
»Zimmernummer oder bar?« Das Deutsch des Barmanns war perfekt und fast akzentlos.
»Bar, bitte.«
Bernd Oschatz wartete nicht auf den Kassenbon, sondern legte einen Zwanzig-Euro-Schein auf die Theke und durchquerte eiligen Schrittes die Lobby. Er nahm die Treppe statt des Aufzugs. Er war völlig außer Atem, als er schließlich das oberste Stockwerk erreichte. Den Rest der Woche verbrachte er wieder auf seinem Zimmer. Einmal, als er auf seinem Balkon saß, eines Morgens am Tag vor seiner Abreise, da sah er sie, unten am Strand, mit ihren Stöcken, weit weg, unerreichbar weit weg.
Professor Zeki Kilicaslan ließ den Brief und die Brille in seinen Schoß sinken, massierte die Nasenwurzel und dachte nach. Vergeblich versuchte er sich an das Gesicht des Patienten zu erinnern. Erol Ümit. Doch sosehr er sein Gehirn marterte, es gelang ihm nicht. Er hatte zu viele dieser Gesichter gesehen. Junge Burschen, in der breiten, muskulösen Brust die Lungen alter, sterbender Männer. Hoffnung in den Augen, zunächst. Am Ende nichts als nackte Angst und blankes Entsetzen.
Keinen einzigen hatte er retten können.
Es gab keine Rettung, es gab keine Hoffnung. Nur die bittere Wahrheit. Die Verkündigung des nahenden, schmerzvollen Todes. Wie vielen jungen Männern in seinem Sprechzimmer hatte er den Tod prophezeit? 800? 900? Bei 700 hatte der Chefarzt und Leiter der pneumologischen Abteilung am Istanbuler Universitätsklinikum aufgehört zu zählen und fortan die statistische Auswertung der Krankenblätter seinen ehrgeizigen Assistenzärzten überlassen. Vor zwei Jahren etwa. Um seine Seele zu schützen. Natürlich erschienen längst nicht alle Erkrankten in seinem Institut. Kilicaslan schätzte die Gesamtzahl auf mindestens 5000.
Erol Ümit.
21 Jahre.
So alt war sein Sohn gewesen, als er vor elf Jahren ums Leben kam. Bei einem Verkehrsunfall. Sein Sohn und seine Frau waren gemeinsam in die Stadt gefahren. Der winzige Toyota hatte gegen den Lastwagen keine Chance. Der Lastwagen hatte Vorfahrt. Sein Sohn war wohl einen Moment lang unaufmerksam gewesen, sagte die Polizei. Kilicaslans Frau, die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, war auf der Stelle tot gewesen, sein Sohn wenig später in der Klinik gestorben.
Seither lebte Professor Zeki Kilicaslan alleine. Lange Zeit hatte er geglaubt, die Arbeit könnte ihm die Familie ersetzen.
Erol Ümit.
Morgen würde er sich die Patientenakte aus dem Keller des Zentralarchivs kommen lassen.
Sie müssen jetzt sehr tapfer sein. Diese Krankheit ist unheilbar, und sie schreitet rasend schnell voran. Sie werden bald sterben. Es gibt keine Arznei gegen diese Krankheit. Fahren Sie nach Hause, zu Ihrer Familie …
Sein Standardspruch. Wie trivial. Und als kleines Geschenk ein paar Ampullen Morphium. Etwas Wegzehrung für die Reise in den Tod. Der Nächste bitte.
Sein Aufsatz in der englischsprachigen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet über die merkwürdige türkische Variante der Silikose bei jungen Männern hatte vor zwei Jahren für Furore in der wissenschaftlichen Welt gesorgt. Eine Veröffentlichung in The Lancet war für einen Mediziner auf der Suche nach internationaler Reputation so etwas wie der Ritterschlag. Wenige Monate später wurde er als Topredner zu einem Pneumologenkongress nach Davos geladen.
War er deshalb Arzt geworden? Um kluge Aufsätze zu schreiben, eine Gratis-Urlaubswoche in der Schweiz zu verbringen und sterbende Menschen nach Hause zu schicken?
Zeki Kilicaslan nippte an seinem Tee.
Die Terrasse war ebenso wie die Penthouse-Wohnung zwar nicht besonders groß, gestattete dafür aber einen schier atemberaubenden Blick über die Stadt, in der er vor 64 Jahren geboren worden war. Istanbul. 13 Millionen Einwohner an der Nahtstelle zwischen Okzident und Orient. Schmelztiegel der Kulturen und Weltreligionen. Eine Stadt mit 2600 Jahren Geschichte. 100 000 Dollarmillionäre lebten in dieser Stadt, hatte er kürzlich gelesen. Eine reiche Stadt, eine bitterarme Stadt. Es gab zweifellos eine ganze Reihe von Gründen, warum die Zahl der Dollarmillionäre in dieser Stadt so üppig war. Einer der Gründe waren die Kellerfabriken.
Erol Ümit.
Zeki Kilicaslan stellte die Tasse ab, setzte die Brille auf und las den Brief ein drittes Mal:
Sehr geehrter Herr Professor Kilicaslan,bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihre kostbare Zeit in Anspruch nehme. Mein Name ist Filiz. Meinen Familiennamen möchte ich nicht nennen, weil ich nicht möchte, dass mein Ehemann davon erfährt. Er ist ein gütiger Ehemann, ich kann mich nicht beklagen, und deshalb möchte ich ihn nicht kränken.Das Geheimnis, um dessen Wahrung ich Sie bitten möchte, hat weniger damit zu tun, dass ich Ihnen schreibe, sondern vielmehr, warum ich Ihnen schreibe. Ich lebe in Bürnük. Das ist ein kleines Dorf mit rund 240 Einwohnern im Norden unseres Landes, etwa 80 Kilometer von der Küste des Schwarzen Meeres entfernt, und gut 30 Kilometer von der Provinzhauptstadt Bolu. Dort lebte auch Erol Ümit.Der Cousin meines Mannes.Und die große Liebe meines Lebens, wie ich heute weiß.Erol war für kurze Zeit Ihr Patient, Herr Professor. Erinnern Sie sich vielleicht? Staublunge. Erol war kein alter Mann, er war auch kein Bergarbeiter. Staublunge. Wie kann das sein? Sie haben ihn zurück in sein Heimatdorf geschickt. Zum Sterben. Erol hat mir von Ihnen erzählt. Er mochte Sie, obwohl er Sie gar nicht lange und gut kannte. Er schätzte Sie sehr, als Arzt und als Mensch. Ich weiß nicht, ob ich Erols Sympathie für Sie teilen kann. Denn ich frage mich: Warum haben Sie ihm nicht geholfen? Warum haben Sie ihn nicht gesund gemacht? War Erol zu arm? Konnte er Ihre Rechnung nicht bezahlen? Nacht für Nacht quälen mich diese Fragen bis in den Schlaf.Ich habe Erol sehr geliebt. Als er nach Istanbul ging, fühlte ich mich verloren. Und verletzt. Ich wusste doch nicht, dass er nur gegangen war, um Geld für die Gründung einer Familie zu verdienen. Und ich wusste nicht, dass er mich ebenfalls sehr geliebt hatte, mich heiraten wollte, wenn er genug Geld verdient hätte, um vor den Augen meines Vaters zu bestehen. All das wusste ich doch nicht, und so habe ich seinen Cousin geheiratet, während Erol in Istanbul war. Jetzt ist Erol tot.21 Jahre.Das ist doch kein Alter zum Sterben.Mein geliebter Erol. Er hat eines Nachts das komplette Morphium genommen, alles auf einmal, um schnell zu sterben, als er die Schmerzen und die panische Angst vor dem Ersticken nicht mehr aushalten konnte. Er hat es vorher nie benutzt, sondern alles aufbewahrt, für diesen Fall. Ich nehme an, das Morphium hatten Sie ihm gegeben.In sechs Tagen, am kommenden Dienstag, ist seine Beerdigung. Ich weiß nicht, ob Sie praktizierender Muslim sind. Sicher ist in Istanbul vieles anders als hier bei uns. Hier in Bürnük wird die islamische Tradition sehr ernst genommen. Unser Glaube verlangt, dass wir unsere Toten binnen 24 Stunden bestatten. Aber wegen des unnatürlichen Todes durch die Überdosis Morphium hat die Polizeidirektion in Bolu eine rechtsmedizinische Obduktion angeordnet. Keine Angst, ich werde Sie nicht verraten. Auch Erols Eltern halten den Mund, dafür werde ich sorgen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Brief Sie noch rechtzeitig erreichen wird. Es ist ein weiter Weg von Istanbul nach Bürnük. Sollten Sie sich entschließen, an Erols Beerdigung teilnehmen zu wollen, würde mich das sehr freuen. Vielleicht ergäbe sich die Gelegenheit, ein paar Worte zu wechseln. Vielleicht könnten Sie mir dann auch meine Fragen beantworten. Damit ich meinen Frieden machen kann.HochachtungsvollFiliz
Professor Zeki Kilicaslan verließ schweren Schrittes die Terrasse, durchquerte das Wohnzimmer und nahm in seinem Arbeitszimmer den Straßenatlas aus dem Bücherregal, um ein Dorf namens Bürnük zu suchen.
Die zweite Zugabe. Das Original stammte von Roy Hargrove, einem schwarzen texanischen Trompeter. Das Stück hieß »Strasbourg«, aus Hargroves wunderbarem Hardbop-Album »Earfood«. Das Publikum tobte, als Günther Oschatz und sein Posaunist, ein rothaariger, blutjunger Bursche, der Günthers Enkel hätte sein können, unisono einstiegen, sich zu einem abenteuerlich schnellen Kanon trennten und schließlich mit einer heiteren Leichtigkeit, die diesem Stück zu eigen war, wieder unisono zusammenfanden. Leverkusener Jazztage. Das waren keine kreischenden, pubertierenden Fans, die nachts von ihren Idolen träumten. Leverkusener Jazztage, das bedeutete ein verwöhntes, extrem kritisches Publikum, das schon jeden und alles gehört hatte. Nicht so einfach, diese Leute aus der Reserve zu locken und zu überzeugen.
Günther hatte es geschafft. Das Publikum wusste nicht nur die handwerkliche Perfektion und die schöpferische Kraft des Quintetts bei den eigenen Kompositionen zu schätzen, sondern auch den Respekt, den Günther Oschatz stets den von seinem Quintett adaptierten fremden Stücken zollte. Erst im zweiten Drittel begann er, Hargroves »Strasbourg« nach seinen Vorstellungen zu interpretieren. Behutsam wich die heitere Leichtigkeit des Originals jener sanften, alles durchdringenden Melancholie, die Günther so sehr liebte.
Der Beifall nahm kein Ende. Der schüchterne Bassist nickte höflich, der Pianist sprang auf und applaudierte dem Publikum, der junge Rothaarige stemmte seine Posaune wie eine Gewichtheberhantel in die Höhe, der Schlagzeuger winkte fröhlich mit seinen Stöcken, und Günther Oschatz, der Grandseigneur der Kölner Jazz-Szene, verneigte sich ehrfürchtig, dieser große, weißhaarige, alte Mann, tief und tiefer, bis die Trompete, die an seinem Zeigefinger baumelte, beinahe den Boden berührte, und verharrte in der demutsvollen Haltung.
David Manthey bahnte sich mühsam einen Weg aus dem Saal, vorbei an entrüsteten Augenpaaren, die wenig Verständnis dafür zeigten, wie man ein solch fantastisches Konzert vorzeitig verlassen konnte. Aber David wusste, dass die Musiker kein weiteres Mal zurück auf die Bühne kommen würden. Weil Günther keine inflationären Zugabenparts mochte. Das war für ihn Betrug am Publikum. Das Konzert war nach zweieinhalb Stunden zu Ende. Als David die Glastür zum Foyer aufstieß, flammte im Saal die grelle Deckenbeleuchtung auf.
David Manthey suchte und fand die Garderobe hinter der Bühne. Die Tür stand sperrangelweit offen. Der Schlagzeuger stülpte hingebungsvoll eine Literflasche Mineralwasser auf die Lippen. Günther Oschatz strahlte wie ein Schuljunge nach dem ersten Händchenhalten. Seine Wangen glühten, Schweißperlen standen auf seiner Stirn, die weiße Haarpracht wirkte inzwischen reichlich derangiert. David drückte ihn fest an sich und flüsterte ihm zärtlich ins Ohr:
»Ehrlich … das war das großartigste Konzert, das ich in meinem Leben sehen und hören durfte.«
»Danke, mein Junge. Du machst mich ganz verlegen. Schön, dass du kommen konntest.«
»Ich danke dir für die Einladung.«
»Wie war der Flug?«
»Die Maschine hatte Verspätung. Deshalb bin ich vom Flughafen gleich hierher gekommen.«
»Wie ist das Wetter in Málaga?«
»Auch nicht viel besser als hier.«
»Du Lügner. Du willst nur nicht, dass ich dich um die Sonne und um die Wärme beneide. Was macht der Job?«
»Es geht voran.«
»So, so. Pass gut auf dich auf, mein Junge.«
Pass gut auf dich auf, mein Junge. Mehr sagte Günther nie. Er wusste sehr genau, dass David Mantheys Jobs grundsätzlich gefährlich waren, mitunter lebensgefährlich, aber er fragte nie nach, er bohrte nicht weiter, weil er sehr genau wusste, dass Manthey ohnehin nicht darüber sprechen würde.
»Wie lange bleibst du?«
»Leider nur zwei Tage.«
»Wir gehen noch was trinken. Kommst du mit?«
»Gerne. Wohin?«
»In Leverkusen kann man zwar Konzerte geben, aber keine Konzerte feiern. Wir fahren also lieber zurück nach Köln. Ich habe im Keimaks einen Tisch bestellt. Kennst du das?«
»In der Südstadt?«
»Genau. Kurfürstenstraße, Ecke Alteburger Straße. Vielleicht fährst du schon vor und gibst Bescheid, dass wir etwas später kommen. Wir brauchen hier noch eine halbe Stunde.«
»Soll ich euch beim Abbauen helfen?«
»Die Zeiten sind zum Glück vorbei, mein Junge. Wir haben doch jetzt eigene Roadies.«
Günther sagte es fast so, als schämte er sich dafür.
»Okay. Dann bis später.«
Günther nickte und lächelte. Er sah glücklich aus. Alt und müde und erschöpft, aber glücklich.