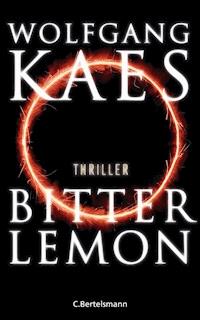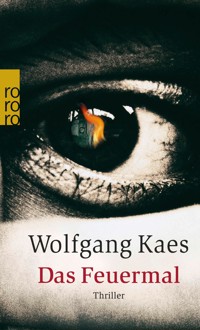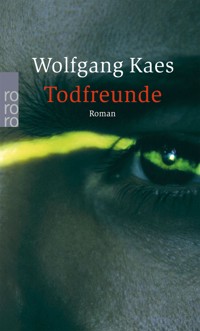
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Morian ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender Thriller In den achtziger Jahren werden in Deutschland Bluterkranke mit HIV-verseuchten Präparaten infiziert und so dem sicheren Tod geweiht. Ärzte, Pharmakonzerne und Politiker formieren sich zu einer Gemeinschaft der Vertuscher. Dr. Julius Weinert, Abgeordneter und Mitglied des Untersuchungsausschusses, unterschlägt Beweismaterial, sodass es nie zu einem Prozess gegen die Schuldigen kommt. Kriminalhauptkommissar Jo Morian versucht, gegen Weinert zu ermitteln, doch er stößt auf eine Mauer des Schweigens. Jetzt, nach zwanzig Jahren, wird der allseits hochgeachtete Weinert mit durchschnittener Kehle aufgefunden. Morian soll den Mord aufklären. Als Hauptverdächtiger gilt Weinerts verschwundener Adoptivsohn. Doch Morian weiß, dass dieser Täter sehr vielen Leuten ins Konzept passen würde. Also verfolgt er seine eigenen Spuren und gerät immer tiefer in eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfgang Kaes
Todfreunde
Roman
Über dieses Buch
Ein atemberaubender Thriller
In den achtziger Jahren werden in Deutschland Bluterkranke mit HIV-verseuchten Präparten infiziert und so dem sicheren Tod geweiht. Ärzte, Pharmakonzerne und Politiker formieren sich zu einer Gemeinschaft der Vertuscher. Dr. Julius Weinert, Abgeordneter und Mitglied des Untersuchungsausschusses, unterschlägt Beweismaterial, so dass es nie zu einem Prozess gegen die Schuldigen kommt. Kriminalhauptkommissar Jo Morian versucht gegen Weinert zu ermitteln, doch er stößt gegen eine Mauer des Schweigens.
Jetzt, nach zwanzig Jahren, wird der allseits hochgeachtete Weinert mit durchschnittener Kehle aufgefunden. Morian soll den Mord aufklären. Als Hauptverdächtiger gilt Weinerts verschwundener Adoptivsohn. Doch Morian weiß, daß dieser Täter sehr vielen Leuten ins Konzept passen würde. Also verfolgt er seine eigenen Spuren und gerät immer tiefer in eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt...
Vita
Wolfgang Kaes, 1958 in der Eifel geboren, finanzierte sein Studium der Politikwissenschaft und Kulturanthropologie als Waldarbeiter, Hilfsarbeiter im Straßenbau, Lastwagenfahrer, Taxifahrer und schließlich als Polizeireporter. Er schrieb Reportagen für den Stern, die Zeit und andere. 2012 kürte ihn das Medium Magazin zum «Reporter des Jahres», 2013 erhielt er den Henri-Nannen-Preis in der Kategorie «Investigative Recherche». Seit 2003 verarbeitet er seine journalistischen Recherchen auch zu Romanen. Kaes war viele Jahre Chefreporter des Bonner General-Anzeigers, bevor er 2020 entschied, sich künftig ganz dem Bücherschreiben zu widmen.
Mehr zum Autor erfahren sie im Internet unter: www.wolfgang-kaes.de
Der Autor zu seinem Buch:
«Die im Buch geschilderten Straftaten haben sich tatsächlich so zugetragen und stammen aus meiner unmittelbaren journalistischen Recherche und den Informationen befreundeter Richter, Staatsanwälte und Kriminalisten. Für den Roman sind diese Straftaten allerdings im Interesse des Personenschutzes der Opfer sowie aus dramaturgischen Gründen verfremdet worden.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2021
Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther
Coverabbildung Louis Moses/Getty Images
ISBN 978-3-644-01095-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
meinem Vater
1.11.1930
19.6.2000
Jedes Kind,
das geboren wird,
ist eine neue Chance,
die Welt zu retten.
Andrew Vachss
Guatemala. 1976
Sie fuhren nach Norden, vorbei an den immer noch brennenden Skeletten aus Stahlbeton, die statt der ausgefallenen Straßenlaternen die Nacht erhellten. Er durfte vorne sitzen in diesem großen, weißen Auto, das Mercedes hieß, wie seine tote Mutter, an die ihn nichts weiter erinnerte als dieser Name.
Neben ihm, auf dem Fahrersitz, saß der Leibwächter und Chauffeur des Don und steuerte die Limousine durch die Straßenschluchten, wich den Trümmern aus und umkurvte die tiefen Risse im Asphalt, die aussahen wie geschürzte schwarze Lippen. Wild hupend überholte ein Feuerwehrwagen den Mercedes, das Blaulicht zuckte nervös durch die Nacht.
«Nun seht euch das an. Wie ein Haufen aufgescheuchter Ameisen.» Das war die Stimme des Don im Fond. «Später wird man sagen, das Erdbeben habe dem bedauernswerten Land den Rest gegeben. Dabei hätte diese unfähige Regierung aus lamettabehangenen Maulhelden das auch problemlos ohne Mithilfe der Natur zustande gebracht. Es hätte nur etwas länger gedauert.»
Der Don saß immer auf dem Rücksitz, wenn sie unterwegs waren. Er beugte sich vor und tätschelte ihm versonnen den Kopf. «Wir werden dieses grauenhafte Land verlassen, mein Junge», sagte er auf Spanisch. «Gleich sind wir da. Bist du bereit?»
Ricardo nickte stumm. Der Don hatte ihm Spanisch beibringen lassen. Als er vor vier Jahren in das Waisenhaus gebracht worden war, hatte er nur Quiché gesprochen, die Sprache seiner Vorfahren. Der Don hatte ihm alles beigebracht.
Auch das Töten.
«Wie alt bist du jetzt, Ricardo?»
«Fünfzehn, Herr.» Mehr brachte er nicht heraus. Er hatte einen Riesenkloß im Hals.
«Fünfzehn, ist das denn zu glauben? Wie die Zeit vergeht.» Der Don schüttelte den Kopf. «Hast du das gehört, Juan? Fünfzehn Jahre.» Ricardo nahm aus den Augenwinkeln das unbewegte, pockennarbige Gesicht des Chauffeurs wahr.
Sie überholten die langen Schlangen der von einer Sekunde auf die nächste obdachlos gewordenen Menschen vor den mit Hilfsgütern beladenen Lastwagen der Militärs. Schwer bewaffnete Offiziere der Nationalpolizei tauchten im Scheinwerferlicht des Mercedes auf. Ricardo zuckte unwillkürlich zusammen. So hatten die ausgesehen, die ihn damals mit der gestohlenen Zwei-Liter-Dose erwischten, bis oben hin voll mit zähflüssigem Kunststoffkleber. Das Zeug war so gut gewesen, dass er gleich weggedämmert war, und er war noch ganz benommen, als sie ihn aus dem Pappkarton zerrten, der drei Jahre sein Zuhause gewesen war. Zwei Polizisten hatten ihn festgehalten, während der dritte mit einem Lächeln auf den Lippen den Inhalt der Dose über Ricardos Kopf entleerte. Dann hatten sie gelacht, sich ausgeschüttet vor Lachen, hatten ihn getreten, in die Hoden, in den Bauch, nur nicht ins Gesicht, sonst hätte der Klebstoff ihre Stiefel verschmutzt. Dann hörte Ricardo, wie sie in ihren Jeep stiegen und davonfuhren. Sehen konnte er nichts mehr. Der Kleber hatte seine Augenlider verschlossen.
Der Don hatte ihn gefunden. Im Krankenhaus mussten sie ihn dreimal operieren. Er hatte alle Haare und große Stücke seiner Kopf- und Gesichtshaut verloren. Der Don hatte dafür gesorgt, dass er gesund gemacht und anschließend ins «pueblo dignidad» gebracht wurde. Der Don sammelte Straßenkinder auf. Aber nur die hübschen und kräftigen. Wer Glück hatte, landete in dem Heim, das der Don vor vier Jahren gegründet hatte. Wer Pech hatte, wurde vorher von den Soldaten beim Betteln oder Stehlen oder auf dem Strich erwischt, mit dem Gewehrkolben erschlagen oder totgetreten. Oder wachte morgens einfach nicht mehr auf, weil er in der Nacht zu lange geschnüffelt hatte, so wie Pedro damals. Oder starb noch vor der Geschlechtsreife an Tripper. So wie Luisa.
Ricardo hatte Glück gehabt. Der Don hatte ihm ein neues Leben geschenkt. Der Don hatte ihm auch versprochen, dass seine schönen, glänzenden schwarzen Haare wieder nachwachsen würden. Der Don hatte Recht behalten. Ricardo wünschte sich nichts sehnlicher, als einmal so zu werden wie der Don. So groß und kräftig und schön und mächtig.
«Du weißt, was du zu tun hast?»
Ricardo nickte.
«Gut. Wenn du das hinter dich gebracht hast, bist du ein Mann. Jeder Junge muss etwas Besonderes tun, um ein Mann zu werden. Und dieses Besondere ist oft etwas, was man nicht gerne macht. Aber ein Mann muss seine Pflicht tun, verstehst du das, Ricardo?»
Ricardo verstand. Der Wagen bog von der asphaltierten Straße auf einen von Bäumen gesäumten, schmalen Pfad aus gestampfter Erde ab. Jetzt erst wurde Ricardo bewusst, was anders war, seit sich das Erdbeben vor nicht einmal 24 Stunden angekündigt hatte: Man hörte keine Vögel mehr singen.
Nach etwa fünf Minuten Fahrt rollte der Mercedes im Schritttempo auf den Hof des einstigen Gutes, das noch aus der Kolonialzeit stammte, und hielt vor dem von Ställen und Scheunen umrahmten Haupthaus, neben der schweren, eisenbeschlagenen Holztür des lang gestreckten, zweistöckigen Gebäudes. Nur in dem Fenster rechts neben der Tür brannte noch Licht. Alle Fenster im Erdgeschoss und im Dachgeschoss waren vergittert.
Damit niemand abhaute aus dem «Dorf der Würde».
Der Chauffeur nickte ihm wortlos zu.
Ricardo öffnete die Beifahrertür und stieg aus. Die Nachtluft war feucht und kalt. Er ging um den Mercedes herum, öffnete den Kofferraum. Er schob die Abdeckung über der Vertiefung beiseite, die normalerweise das Reserverad aufnahm. Darin lag stattdessen ein Kanister, an dem eine Pumpe, ein Schlauch und eine Düse angebracht waren. Er schnallte sich den Kanister auf den Rücken. Dann nahm er die kleine, handliche Maschinenpistole mit dem kurzen Schalldämpfer aus der Vertiefung. Er schaltete auf Einzelfeuer. Als er den Deckel des Kofferraums schloss, sah er die ausgestreckte Hand des Don aus dem zur Hälfte geöffneten Seitenfenster ragen. Er sah die teure Uhr, die er immer so bewundert hatte. Den dicken, goldenen Siegelring. Und den Schlüsselbund, der an seinem Zeigefinger baumelte.
Der Ladino in dem weißen Kittel sah nur kurz auf und widmete sich wieder der Illustrierten auf dem Tresen der Pförtnerloge. «Ah, Ricardo, que tal? Sollst du wieder ein kleines, nettes Spielzeug abholen?» Ricardo hob die Waffe und schoss ihm mitten ins Gesicht.
Der Schalldämpfer sorgte dafür, dass nichts weiter zu hören war als ein kurzes, scharfes Zischen und der anschließende Aufprall des Körpers auf dem Steinboden. Dennoch hielt Ricardo einen Augenblick inne. Und lauschte.
Nichts.
Im Flur und im Treppenhaus brannte die Notbeleuchtung. Die Glühbirnen flackerten hektisch. Ricardo hörte das Brummen des Benzingenerators im Geräteraum links neben dem Eingang. In der ganzen Stadt war das Stromnetz zusammengebrochen. Er schlich durch den Flur bis zu dem Zimmer am Kopfende des Ganges. Die Tür war verschlossen. Er öffnete sie mit dem Universalschlüssel. Aus dem dunklen Raum drang lautes Schnarchen. Er brauchte keine halbe Minute. Drei Wärter. Dreimal senkte er die Spitze des Schalldämpfers, dann war Stille. Er schaltete die Pumpe ein, und die Düse überzog die drei Betten mit einem feinen Nebel.
Weiter. Das Zimmer der beiden Köchinnen und der Putzfrau. Ebenso schnell, ebenso lautlos.
Die alte Holztreppe knarrte, sosehr er sich auch mühte, leise zu sein.
Acht Zimmer. Jedes Zimmer sechs Betten. Die Zimmer der Kinder waren alle unverschlossen. Eines nach dem anderen. Er öffnete die Türen, stäubte die Zimmer sorgfältig ein, dann sperrte er mit dem Schlüssel ab, drückte zur Kontrolle die Klinke. Das letzte Zimmer. Die Flüssigkeit roch scharf und unangenehm. Eines der Kinder hustete. Er lauschte in der Dunkelheit, sein Herz schlug wild.
«Ricardo?» Leise, zaghaft. «Bist du es?»
«Sei still», zischte er. «Schlaf weiter.»
«Warum stinkt das hier so?»
«Das ist von dem Erdbeben. Der Generator ist kaputt. Das Erdbeben hat ihn kaputt gemacht. Und jetzt tropft er.»
«Liest du mir noch was vor, Ricardo? Bitte.»
«Nein. Schlaf jetzt.»
«Gute Nacht, Ricardo.»
Er stieg die Treppe hinab, nebelte die Küche ein, den Vorratsraum, den Speisesaal, als er den Lichtschein aus dem Waschraum bemerkte. Die Tür stand offen.
«Ricardo? Was ist los, wieso stinkt das hier überall nach Benzin? Außerdem gibt es kein Wasser mehr, Scheiße.»
Isabel.
Sie hatte sich über die steinerne Waschrinne gebeugt, schielte von unten in die Öffnung des verzinkten Rohrs, hielt in der linken Hand einen Schraubenzieher, während sie mit der rechten Hand den quietschenden Wasserhahn bearbeitete. Das weiße, knielange Nachthemd spannte um ihre breiten Hüften und ihre Pobacken.
Zu ihren Füßen saß ihr Baby auf den kalten Steinfliesen und kaute zufrieden auf einem Stück Stoff herum.
Sie war sechzehn, ein Jahr älter als er.
«Verdammt nochmal, kannst du nicht das Wasser in Gang bringen?»
Er hängte sich die Maschinenpistole über die Schulter, trat ganz dicht hinter sie, schob ihr das Nachthemd sachte über die Hüften und drückte sich an ihre Rückseite.
Sie sagte nichts.
Er streichelte ihren Bauch. Er war weich und warm.
Sie drückte ihren großen, runden, warmen, weichen Hintern gegen seinen Unterleib. Seine Hände wanderten nach oben, ertasteten ihre schweren Brüste, schaukelten sie sanft.
«Was ist? Kriegst du überhaupt schon einen hoch?»
Er wusste nicht, von wem das Baby war. Er hatte sich immer gewünscht, es wäre von ihm. Heimlich. Davon hatte er manchmal geträumt, nachts. Allerdings hatte er sich nie getraut, sie anzufassen. Nicht mal im Traum.
Er drehte sie um, sodass sie ihm ins Gesicht sah. Sie grinste breit, sah ihm unverfroren in die Augen und hob den Saum ihres Nachthemds bis zum Kinn. «Na los. Zeig mal her, was du da in deiner Hose hast.»
Dieses Miststück.
So waren sie alle. Alles Miststücke.
Er schlug mit der Waffe zu. Er hörte, wie ihr Nasenbein brach. Das Baby schrie. Das Blut lief ihr über Kinn und Hals und tränkte den Ausschnitt des weißen Nachthemds. Sie schnaubte, das Blut in ihren Nasenlöchern warf Blasen, und ihre Augen wurden ganz kalt, als sie ihm den Schraubenzieher quer durchs Gesicht zog. Es tat höllisch weh. Das Baby schrie wie am Spieß. Er stellte die Waffe auf Dauerfeuer, schoss ihr in den Unterleib, wieder und immer wieder. Dann durchsiebte er das Baby zu seinen Füßen.
Er hatte das Geschrei nicht mehr ertragen können.
Er hatte ihren Namen schon vergessen.
Es war nicht sein Baby.
Das Magazin war leer.
«Du Miststück.»
Er verließ den Waschraum, überquerte den Flur, öffnete den Geräteraum, stellte den Kanister neben den Benzingenerator, schraubte den Deckel ab, trat den Kanister mit der Fußspitze um. Das Benzin gluckste auf den Boden. Dann verschloss er die Haustür sorgfältig von außen. Der Mercedes stand jetzt mit laufendem Motor in entgegengesetzter Richtung, gut zehn Meter vom Haus entfernt. Juan, der Chauffeur, reichte ihm die Bierflasche und zündete mit seinem Feuerzeug den Lappen an, der aus dem Flaschenhals hing. «Mach es so, wie es dir der Don erklärt hat.»
Er machte es so. Bevor sie die asphaltierte Straße erreicht hatten, stand das «Dorf der Würde» in hellen Flammen. Juan schaltete das Radio ein. Der Nachrichtensprecher eines US-amerikanischen Senders zog eine erste Bilanz des Erdbebens. 20 000 Tote. Der Don ließ den Chauffeur halten und bedeutete Ricardo mit einer Kopfbewegung, mit ihm auszusteigen. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dachstuhl.
Keine Vogelstimmen.
Nur das Schreien der brennenden Kinder.
Er spürte die Hand des Don auf seiner Schulter. «Siehst du, Ricardo, das Leben ist ein ständiger Kampf. Das Starke muss das Schwache besiegen, sonst erdrückt das Schwache alles Leben. Es musste sein, Ricardo. Dieser neue Priester war einfach zu neugierig. Noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, und schon stellt er dumme Fragen. Wir hätten ihn rechtzeitig liquidieren sollen. Aber da hatte er schon mit diesen amerikanischen Reportern gesprochen, die hier überall herumschwirren. Und wegen des Erdbebens werden noch mehr Journalisten kommen. Die sind wie die Schmeißfliegen. Wir dürfen nichts riskieren. Deshalb verschwinden wir von hier. Das Erdbeben kam wie gerufen. Wir können nichts zurücklassen, was uns verraten könnte. Es musste sein, Ricardo. Es musste sein, verstehst du? Wir hatten keine andere Wahl. Sie hätten uns alle in Gefahr gebracht, diese dummen Kinder, wenn der Pfaffe die Reporter hierher gebracht hätte. Ja, Ricardo, das Leben kann so grausam sein.»
Er tätschelte ihm den Kopf. Ricardo verstand kein Wort von dem, was sein musste. Er wusste nur, dass der Don immer das Richtige tat.
«Übrigens, das mit der kleinen Nutte war nicht sehr professionell. Du wirst noch viel lernen müssen. Aber ich verzeihe dir.»
Er legte seine Fingerspitzen unter sein Kinn, hob seinen Kopf, damit er sein Gesicht besser sehen konnte.
«Du meine Güte, was hat sie bloß mit deinem hübschen Gesicht angestellt? Das sieht aber böse aus. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, einen Arzt aufzusuchen. Der Hubschrauber wartet schon auf uns. Aber ich habe Jod im Verbandkasten. Warte. Komm her. Da musst du jetzt die Zähne zusammenbeißen. Halb so schlimm, nicht wahr? Du bist jetzt ein Mann. Aber da wird wohl eine Narbe bleiben. Narben sind der Schmuck des Mannes. So, und jetzt fliegen wir nach Mexiko, und von dort geht’s weiter nach Europa. Wie ich es dir versprochen habe. Deutschland. Mein Heimatland. Freust du dich? Du wirst staunen. Ich habe Großes mit dir vor. Dein Leben wird sich verändern, mein kleiner Ricardo.»
Sie stiegen wieder in den Mercedes, und bevor der Wagen auf die Landstraße einbog, schaute Ricardo noch einmal zurück.
Auf sein kleines, kurzes Leben.
Deutschland. Heute
01
Kalte Augen. Wie die eines Toten. Komisch, die Augen haben sie nie richtig hingekriegt. Das wusste er noch aus seiner Schulzeit. Bildende Kunst. Mündliches Prüfungsfach im Abitur. Die Bildhauerei des Hellenismus. Weil’s so schön einfach war. Dachte er. Das Prinzip der nassen Gewänder und solche Sachen. Ein großer Fehler. Die Vier hatte seine Durchschnittsnote nicht gerade verbessert.
Drei Komma zwo.
Für den Beruf des Polizisten hatte es gereicht.
Tote Augen.
Aber was für ein Körper, du meine Güte.
Der nackte Körper des jungen Mannes war von makelloser Schönheit. Jede Faser seiner austrainierten Muskeln unter der ebenmäßigen, unbehaarten Haut schien darauf zu lauern, den Speer einem unsichtbaren Ziel entgegenzuschleudern. Ein Ziel, das nur die kalten Augen aus Marmor kannten. So durchtrainiert hatte er nie ausgesehen, selbst nicht in seinen besten Jahren. Als er noch boxte. Josef Morian blickte unwillkürlich hinunter zu der Wölbung unter seinem Sakko und klappte den Bildband zu. Zu Weihnachten hatte er sich von seiner Familie ein Trimmrad schenken lassen. Das stand im Keller, und er hatte es seit Weihnachten dreimal benutzt.
Jetzt war Sommer. Und Josef Morian schwitzte.
«Griechenland – Wiege Europas», las er auf dem Schutzumschlag. 1999 erschienen. «Von Julius Weinert». Morian ließ den Blick nach rechts wandern, vorbei an den Bücherregalen, den Glasvitrinen, den chinesischen Vasen und den griechischen Amphoren und dem ganzen, vermutlich unverschämt kostspieligen Zeugs bis hin zu dem Perserteppich. Jedenfalls hielt er ihn für einen Perserteppich. Morian kannte sich nicht aus mit Antiquitäten. Aber mit Toten. Auf dem Teppich lag der Autor des Buches, bäuchlings, den schwammigen Körper in einen seidenen Hausmantel gehüllt. Zwischen seinen Schulterblättern steckte ein Brieföffner aus stabilem Messing. Der Brieföffner war einem Dolch nachempfunden, der Griff mit bunten Steinen besetzt. Vermutlich kostbar. Morian hatte keinen blassen Schimmer. Er nahm sich vor, danach zu fragen. Später.
Die Kollegen von der Spurensicherung waren am Zug. Einer der Beamten in den weißen Overalls streifte sich Latexhandschuhe über, sammelte die Überbleibsel eines zerbrochenen Cognacschwenkers vom Parkettboden auf und ließ sie in einen Zellophanbeutel gleiten. Er beschriftete ihn mit einem Fettstift und legte ihn behutsam zu den anderen Beuteln in einen Wäschekorb. Er kniete erneut nieder und löste die kleinen, dicken, kalten Finger des Toten, die in die Fransen des Teppichs verkrallt waren.
Morian drehte das Buch um und studierte den Klappentext auf der Rückseite. «Julius Weinert versteht es, für Geschichte zu begeistern. Der 1934 in Ostpreußen geborene Jurist und Politiker hat sich nach seiner Pensionierung erneut der großen Passion seiner Jugend, dem Studium der Antike, zugewandt …»
«Verzeihung!»
Links neben Morian stand ein braun gebrannter Endfünfziger mit leicht angegrauten Schläfen. Kerzengerade. Teurer Wildlederblouson.
«Sie wollten mich sprechen …» Leicht blasierter Tonfall.
Morian streckte ihm die Hand entgegen. «Kriminalhauptkommissar Josef Morian. Mordkommission. Sie sind der Hausarzt der Familie?»
«Ja. Dr. Wilfried Degener. Meine Praxis ist zwar in Bad Godesberg, aber ich wohne in der Nachbarschaft, gleich um die Ecke. Die Luft hier oben im Siebengebirge ist einfach gesünder als unten im Rheintal. Im Augenblick kann ich nichts mehr tun. Frau Weinert …»
«Wie geht es ihr?»
«Tja … den Umständen entsprechend. Ein … Sie würden es vermutlich einen Nervenzusammenbruch nennen. Jetzt schläft sie. Die Spritze lässt den Organismus für eine Weile zur Ruhe kommen. Aber kein Arzt der Welt kann ihren Schmerz lindern.»
«Verstehe. Muss entsetzlich sein, nach Hause zu kommen und den geliebten Gatten tot vorzufinden.» Morian konnte jederzeit auf Knopfdruck Betroffenheit herstellen.
«Nein, nein. Herr Dr. Weinert war nicht ihr Ehemann. Er war ihr Bruder. Sie hat ihm den Haushalt geführt. Herr Dr. Weinert war ein Mensch, der seine ganze Schaffenskraft in den Dienst der Gesellschaft gestellt hat. Da blieb keine Zeit für eine eigene Familie.»
«Und wer hat unterm Dach gewohnt?» Die Basketball-Poster in der Mansarde passten nicht zu Weinerts Generation.
«Alexander, sein … Sohn. Nachdem …»
«Sie sagten doch, er hatte keine Familie.»
«Wenn Sie zuhören würden, statt eine Frage nach der anderen zu stellen, kämen wir rascher zum Ziel.» Dr. Degener wirkte gereizt. Offenbar behagte ihm das Thema nicht. «Nachdem Alexanders leiblicher Vater verstorben war, hat sich Herr Dr. Weinert in seiner Eigenschaft als Taufpate des Jungen angenommen und ihn adoptiert. Er hat sich aufgeopfert für ihn, wie ein leiblicher Vater. Eine eher undankbare Aufgabe, wie sich erweisen sollte.»
«So?»
Der Arzt sagte nichts. Offenbar beschlich ihn das Gefühl, schon zu viel gesagt zu haben. Morian ließ es im Augenblick dabei bewenden. «Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen?»
«Gesprochen habe ich ihn schon ewig nicht mehr. Aber gelegentlich mal aus der Ferne gesehen, wenn ich im Garten arbeitete. Das letzte Mal so vor zwei, drei Wochen, schätze ich.»
«Welches Verhältnis hatte Weinert zu dem Jungen?»
«Das habe ich doch schon gesagt. Er …»
«t’schuldigung. Ich meinte, in jüngster Zeit.»
«Vielleicht sprechen Sie besser mit Frau Weinert darüber. Ich bin schließlich nur der Hausarzt.»
Nur der Hausarzt. Morian spürte genau, dass dem Mann noch etwas auf der Zunge lag. Und abwog, ob er es nicht besser runterschlucken sollte. Deshalb wartete Morian geduldig.
Schweigen. Vielleicht half ihm eine Frage auf die Sprünge.
«Herr Doktor, wann haben Sie denn Julius Weinert zum letzten Mal gesprochen?»
«Oh, gut, dass Sie fragen. Es wäre mir fast entfallen. Vor zwei Tagen. Fernmündlich. Ich weiß natürlich nicht, ob die Sache überhaupt von Belang ist, aber …»
«Ja?»
«Herr Dr. Weinert rief mich in der Praxis an. Am Freitag; genau, am Freitag um die Mittagszeit. Er klang sehr besorgt. Richtig aufgebracht klang er. Er müsse mich dringend sprechen, wegen Alexander. Unter vier Augen. Er brauche meinen ärztlichen Rat. Und so verabredeten wir uns für Montag. Also morgen. 18 Uhr. Hier, in seinem Haus.»
«Und über was wollte er mit Ihnen sprechen?»
«Ich habe keine Ahnung. Er sagte nur, es sei dringlich.»
«Aber es war nicht so dringend, dass er darauf bestanden hätte, schon am Wochenende mit Ihnen zu sprechen?»
«Nein. Ich hätte dieser Bitte natürlich entsprochen, wenn auch ungern. Schließlich hat man auch sein Privatleben. Und mit Alexander gab es ja alle naselang Ärger. Aber Herr Weinert schlug selbst den Montag vor. Er sagte, er müsse bis dahin noch einige Dinge klären. Ich wäre Ihnen übrigens dankbar, wenn Sie diese Information diskret behandeln könnten. Ich habe einen Ruf zu wahren.»
«Natürlich. Wahrscheinlich ist es völlig ohne Belang», beruhigte ihn Morian. «Was glauben Sie: Wo ist der Junge jetzt?»
«Das weiß man nie so genau. Er treibt sich rum. Von regelmäßigem Schulbesuch hat er noch nie viel gehalten. Ohne Herrn Weinerts ständige Intervention, ohne seine großzügigen Spenden an die Schule, ohne seine guten Kontakte nach Düsseldorf wäre der Junge doch längst von der Schule geflogen. Weinert hat ihn über alles geliebt. Allein die Nachhilfestunden müssen ihn ein Vermögen gekostet haben, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten.»
«Selbstverständlich. Woher hatte er das Vermögen?»
Das Mitteilungsbedürfnis des Hausarztes geriet erneut ins Stocken. Geld schien ein zu intimes Thema zu sein. Morian spürte, wie der Arzt angestrengt über eine geeignete Formulierung nachdachte, bevor er antwortete. «Herr Dr. Weinert war zeit seines Lebens sehr erfolgreich. Als Jurist. Als Politiker. Zuletzt als Berater und Justiziar verschiedener Unternehmen und gemeinnütziger Einrichtungen. Gottlob ist es in diesem Land noch kein Verbrechen, erfolgreich zu sein.»
«Wann hat Frau Weinert Sie eigentlich angerufen?»
Der Arzt sah auf seine Armbanduhr. «Ziemlich genau um 10.30 Uhr. Sie war völlig verstört, sagte etwas von einem furchtbaren Unglück, da habe ich mich unverzüglich auf den Weg gemacht.»
10.30 Uhr. Das war ziemlich genau die Zeit, als ihm seine Frau zärtlich ins Ohr flüsterte, es sei Zeit zum Aufstehen, sie habe einen Bärenhunger, die Kinder hätten sich schon wieder heimlich vor den Fernseher geschlichen, draußen scheine eine wunderbare Sonntagmorgen-Sommer-Sonne, und ob er noch wisse, dass er den Kindern eine Radtour versprochen habe, nein, nein, nein, es habe gar keinen Zweck, sich schlafend zu stellen, raus aus den Federn, alter Brummbär, Zeit zum Aufstehen, und dann hinderte sie ihn am Aufstehen, indem sie ihre warme, sanfte Hand über seinen Körper, unter die Bettdecke wandern ließ …
«Und dann haben Sie die Polizei gerufen.»
«Ja. Nachdem ich festgestellt hatte, dass für Herrn Dr. Weinert jede Hilfe zu spät kam, wählte ich von hier aus die 110. Anschließend habe ich mich um Frau Weinert gekümmert.»
Jetzt war es kurz vor zwölf, und die Kinder würden Liz in den Ohren liegen, wann es denn endlich losgehe mit der Radtour. Morian hatte sonntägliche Radtouren noch nie leiden können. Aber noch weniger mochte er sonntägliche Morde.
«Wie lange, Herr Doktor, wird Frau Weinert wohl noch schlafen? Ich meine, wann wird sie ansprechbar sein?»
Der Doktor sah wieder auf seine Uhr. Tatsächlich, eine Rolex. Morian hätte jetzt zu gern gewusst, was der Doktor für ein Auto fuhr. Und ob da jemand auf dem Beifahrersitz saß, der ihm ein wenig übers Altwerden hinweghalf. Und beim Geldausgeben.
«Die Wirkung der Spritze lässt spätestens in einer Stunde nach.»
«Danke, Doktor. Sie haben uns sehr geholfen. Wenn wir noch Fragen haben, rufen wir Sie an.»
Morian stellte die «Wiege Europas» zurück an ihren Platz. In dem Arbeitszimmer waren einige tausend Bücher versammelt. Über das antike Griechenland, das Römische Reich, das alte Persien. Bücher über die deutsche Nachkriegsgeschichte, das Wirtschaftswunder, Bücher über die verlorenen Ostgebiete. Ostpreußen. Schlesien, verlorene Heimat. Morians Urgroßvater stammte aus Schlesien. Neugierig zog er das Buch aus dem Regal.
Etwas fiel zu Boden.
Morian hob es auf. Ein Foto. Etwas größer als eine Postkarte. Zwei Personen. Weinert, wesentlich jünger, aber nur unwesentlich schlanker, steht seitlich im Rücken einer an einem Schreibtisch frontal zur Kamera sitzenden Frau, legt eine Hand gönnerhaft auf ihre Schulter, während sie telefoniert. Eine attraktive Frau. Schlank. Ein schönes Gesicht. Seine Schwester? Nein, zu jung. Schreibmaschine. Altmodische Schreibtischlampe. Ein Büro. Seine Sekretärin? Vermutlich. Weinert lächelt in die Kamera. Das einstudierte, tausendfach erprobte Lächeln eines Politikers. Anzug, Weste, Fliege. Die Frau hingegen blickt ernst in die Kamera. Geistesabwesend? Desinteressiert? Als schaue sie durch den Fotografen hindurch. Anthrazitfarbenes Kostüm. Krawatte. Tatsächlich, sie trägt eine Krawatte, schmal, schwarz, glänzend. Pechschwarze Haare, schulterlang, streng zur Seite gescheitelt. Sie war schön und wirkte zugleich auf eine Weise, die Morian nicht zu beschreiben vermochte, unsichtbar. Eine Frau, an der man auf der Straße achtlos vorbeiging und erst zwei Blocks später begriff, dass man einer schönen Frau begegnet war. Das Foto musste mindestens zwanzig Jahre alt sein, der Kleidung und dem Mobiliar nach zu urteilen. Er drehte das Foto um. Nichts. Nicht mal ein Datum. Er nahm sich vor, Weinerts Schwester danach zu fragen. Später. Einen Moment spielte er mit dem Gedanken, das Foto einzustecken. Dann schob er es zurück an seinen Platz, zwischen Buchdeckel und Schutzumschlag.
Biografien. Adenauer. Erhard. Neben Kiesinger unterbrach ein Fenster die Regalwand, ein Sprossenfenster mit Rundbogen, und gab den Blick frei auf das Siebengebirge.
Morian hatte das Siebengebirge immer gemocht. Als kleiner Junge glaubte er, dass in einer der zahllosen Höhlen noch immer der schreckliche Drache hauste, obwohl das Ungeheuer, so stand es schließlich schwarz auf weiß in der Nibelungensage, definitiv von Siegfried getötet worden war. Als junger Streifenbeamter hatte er es dann weniger mit wilden Drachen als mit wild gewordenen Kegelclubs zu tun, aus Duisburg oder Herne, die jeden Sommertag aufs Neue sturzbetrunken am Fuß des Drachenfels aus den Lustdampfern der Köln-Düsseldorfer Personenschifffahrt quollen, in die Tanzsäle und Weinschwemmen Königswinters einfielen, sich mitunter zum Coitus interruptus im gepflasterten Hinterhof trafen und am späten Nachmittag dröhnend und schulterklopfend (Herren) oder kreischend und zu dritt untergehakt (Damen) zurück in den Schiffsbauch stolperten.
«Okay. Wir machen die Biege.»
Morian nickte, ohne hinzuschauen. «Danke. Bis später.»
Die Kollegen in den Overalls. Er wusste, was das «Eins, zwei …» hinter ihm zu bedeuten hatte. Die Zinkwanne wurde aus dem Zimmer getragen. Je schwerer der Inhalt, desto bedeutungsvoller klang das «Eins, zwei …» der Träger beim Anheben. Die vorletzte Reise des Julius Weinert. Gerichtsmedizinisches Institut der Universität Bonn. Morian blieb und sah aus dem Fenster. Er wartete auf Gertrud Weinert. In zwanzig Dienstjahren hatte er das Warten gelernt. Ein Großteil seines Jobs bestand aus Warten.
Oben auf dem Petersberg reflektierten die Fensterscheiben des vanillepuddingfarbenen Hotelbaus das grelle Sonnenlicht. Er war oft da oben gewesen, als junger Polizist. Objektschutz. Da oben waren sie ein und aus gegangen, die Wichtigen dieser Welt. Als Bonn noch wichtig und Bundeshauptstadt war. Breschnew. Die Queen. Der Schah. Bill Clinton. In der Schule hatte ihnen der Geschichtslehrer erzählt, dass auch der britische Premier Chamberlain auf dem Petersberg wohnte, um mit Hitler zu verhandeln, der am gegenüber liegenden Rheinufer im Bad Godesberger Hotel Dreesen logierte. Sie bereiteten das Münchner Abkommen vor, das den deutschen Überfall auf die Tschechen völkerrechtlich legalisierte. Das hatte ihr Geschichtslehrer allerdings ausgelassen. Und stattdessen die Klasse im Treppenhaus antreten lassen. Da stellte er sich unter die offene Treppe, krempelte die Hemdsärmel auf, sprang an die oberste Stufe und machte vor, wie man mit zweimal zwei Fingern zwanzig Klimmzüge schafft. Nachmachen! Das schaffte natürlich keiner. Verweichlichte Jugend. Der arme Erich, der Dickste in der Klasse, hing an der Treppenstufe wie ein nasser Sack, während ihm die Tränen über die Pausbacken liefen. Vor den Augen aller ließ er den Erich hängen, bis er runterfiel. Muttersöhnchen. Im Laufschritt zurück ins Klassenzimmer. Zackig. So viel zum Nationalsozialismus. Anschließend wurden tausend Jahre übersprungen, und der Geschichtslehrer machte weiter mit Adenauers historischem Schritt auf den Teppich. Da war der Petersberg Hauptquartier der Hohen Kommissare der West-Alliierten. Als Kind hatte Morian nie verstanden, was an dem Gruppenfoto auf dem Teppich so bedeutsam war. Das ist Politik, sagte geheimnisvoll sein Vater, der den toten Adenauer verehrte, und der nächste Sonntagsausflug führte in Adenauers Wohnhaus am Rhöndorfer Südhang des Drachenfels. Langweilig. Das menschenleere Haus eines toten Mannes, das nach Weihrauch und Bohnerwachs roch. Plötzlich wusste Morian, warum er sich erinnerte. Im Arbeitszimmer des toten Julius Weinert roch es genauso.
«Ich rate Ihnen: Finden Sie ihn!»
Die Stimme einer Frau. Morian trennte sich nur ungern von dem friedlichen Siebengebirgs-Panorama jenseits des Fensters. Ihm lag nicht daran, die passende Person zu der nach Rasiermesser klingenden Stimme kennen zu lernen.
«Sind Sie taub, Herr Kommissar? Ich sagte: Finden Sie die Ratte!»
02
Es war kurz nach neun, als Morian den Volvo auf dem gepflasterten Hof vor seinem Haus im Bonner Stadtteil Oberkassel parkte. Die Abendluft roch angenehm nach Sommer. Liz hatte das Außenlicht eingeschaltet, obwohl es noch hell genug war. Das machte sie immer. Um ihn zu begrüßen. Er schloss die alte Holztür unter dem Balken mit der Zahl 1464 auf. Wie sehr er dieses Haus liebte, rückte ihm jedes Mal ins Bewusstsein, wenn er abends durch diese Tür trat. Er hatte es vom ersten Moment an geliebt. Er hatte fast ein Jahr lang jede freie Minute damit verbracht, es bewohnbar zu machen.
1464. Da war Amerika noch nicht entdeckt.
Aber Morde hatte es schon gegeben.
In der Diele standen noch die gepackten Rucksäcke der Kinder. Aus der Klappe eines der Rucksäcke schaute das Ohr eines Teddybären hervor. Er konnte die Enttäuschung seiner Kinder körperlich fühlen. Und sein schlechtes Gewissen, das sich augenblicklich regte.
«Jo, bist du’s?»
Seine Frau hatte sich auf dem Wohnzimmersofa zusammengerollt und ihr großes, weiches Lieblingskissen unter den Nacken geklemmt. Liz trug eines seiner alten Sweatshirts und an den Füßen dicke Wollsocken. Ihre Lesebrille hatte sie keck auf der Nasenspitze sitzen, während sie in einem Buch blätterte. Morian fand sie ungeheuer sexy mit dieser Brille, die sie seit einigen Wochen benutzen musste, und er fand ihre in Ehren ergrauten, ungefärbten, streichholzkurz geschnittenen Haare sexy, und ihre nackten, von der Gartenarbeit gebräunten Beine. Er fand so ziemlich alles an seiner Frau sexy; selbst diesen forschenden Blick über den Rand ihrer Brille hinweg. Allerdings nicht, was diesem Blick gewöhnlich folgte.
«Geht’s dir gut, Jo?»
«Ja», log er und verließ vorsichtshalber das Wohnzimmer. «Sind die Kinder schon im Bett?»
«Sie wollten unbedingt auf dich warten, aber … Es geht dir überhaupt nicht gut, stimmt’s?»
«Doch, doch. Ich mach mir nur schnell einen Kaffee.» Er verschwand in Richtung Küche.
Liz wusste immer genau, wie es ihm ging. Sie hatte feinere Antennen als sämtliche Spionagesatelliten des Pentagon. Morian schaltete die Espressomaschine ein. Er hatte in seinem Job schon mehr Blut gesehen als sein Nachbar jemals auf der Kinoleinwand. Aber er würde sich nie daran gewöhnen, was Menschen einander antaten.
Früher hätte er drei Tage geschwiegen. Aber seit er mit Liz lebte, war’s mit dem Schweigen vorbei. Es sei denn, er fand einen Grund, sich ihren Fragen zu entziehen. Und deshalb machte er sich jetzt in der Küche zu schaffen. Er brauchte dringend seinen Schlummertrunk: einen schönen doppelten Espresso mit viel heißer Milch und viel, viel Zucker und einem Schuss Kakao. Das sei dann aber kein Espresso mehr, hatte er sich sagen lassen. Von einer dieser frustrierten Patientinnen seiner Frau. Geld ohne Ende, die Kinder aus dem Haus, der Mann ständig auf Dienstreise, das traurige Gesicht geliftet. Frau Morian, ich fühle mich so leer. Hat das Leben einen Sinn? Vor allem, wenn die Welt voller Proleten ist, die nicht wissen, was ein Espresso ist. «Nein», hatte er geantwortet und dem missbilligenden Blick standgehalten. «Ist es nicht.» Sich das «Na und?» verkniffen. Und stattdessen gesagt: «Völlig richtig beobachtet: Das ist kein gewöhnlicher Espresso, das ist Morians Spezial-Espresso.»
Wenn er eins nicht ausstehen konnte, dann Leute, die wussten, wie was zu sein hatte. Es würde ihm immer ein Rätsel bleiben, wie sich seine Frau seelenruhig den ganzen Mist anhören konnte.
Andererseits … andererseits hätten sie nie dieses nette Häuschen finanzieren können. Von ihrem Honorar als psychologische Gerichtsgutachterin und von seinem Gehalt jedenfalls nicht. Das Geld, das sie mit ihren Therapiesitzungen verdiente, war ein äußerst angenehmes Zubrot. Und Liz war gut in ihrem Job.
Er wusste, sie würde ihn nicht bedrängen. Er hatte gerade den Topf mit der Milch auf die Herdplatte gestellt, als das Telefon klingelte.
«Morian.»
«Maria Engels, ‹Rheinischer Anzeiger›. Tut mir Leid, dass ich Sie so spät noch zu Hause störe.»
«Mir auch. Dann lassen Sie’s doch einfach. Woher haben Sie meine neue Nummer?» Er hatte sie erst vor ein paar Wochen ändern lassen. Wieder einmal. Sie stand in keinem Telefonverzeichnis.
«Es geht um Julius Weinert. Die offizielle Pressemitteilung ist ein bisschen dünn. Ich habe gehört, Sie verdächtigen seinen Pflegesohn?»
«Nein. Wir suchen seinen Pflegesohn. Das ist etwas anderes. Suchen und verdächtigen, das sind zwei Paar Schuhe.»
Natürlich verdächtigten sie ihn. Weinerts Schwester hatte ausgesagt, dass Hände und Gesicht des Jungen voller Blut waren, als er an ihr vorbei durch die Haustür gestürmt war. Sie war überraschend früh vom Kirchgang zurückgekehrt. Ihr sei während der Messe übel geworden. Das bestätigten der Pfarrer und mehrere Kirchgänger übereinstimmend. Den einen hatte Morian bei einer Kindtaufe gestört, die anderen beim Sonntagnachmittagkaffee auf der Gartenterrasse.
«Hatte er ein Motiv?»
«Kein Kommentar.»
Habgier, Eifersucht, Jähzorn, Neid, krankhafte Rachsucht, verletzte Eitelkeit, Verdeckung einer Straftat, Ersatzhandlung infolge sexueller Frustrationen, erheblich unterentwickelte Fähigkeit zur Empathie in Kombination mit rücksichtslosem, egoistischem Trachten nach materiellen oder emotionalen Vorteilen. Es gab eine Menge möglicher Motive, einen Menschen zu töten. Nach Morians Ansicht regelte die überwiegende Zahl dieser Motive aber auch das Alltagsleben der Menschen im Büro oder im Straßenverkehr. Und in den meisten Ehen.
«Und wieso stand die Tür zum Garten offen?»
Woher wusste sie das? Irgendwer im Präsidium musste gequatscht haben. Irgendwer fand sich immer, der sich ein bisschen wichtig machen wollte vor einer attraktiven Frau. Und die Engels war zweifellos eine attraktive Frau. Die Terrassentür im Arbeitszimmer hatte tatsächlich sperrangelweit offen gestanden. «Frau Engels Fernandez, wie lange machen Sie schon diesen Job?»
«Wie bitte?»
«Ich meine, Frau Engels Fernandez, wie lange arbeiten Sie jetzt schon als Polizeireporterin?»
«Engels genügt völlig. Seit elf Jahren. Aber was soll …»
«Sehr gut. Meine Frau ist übrigens ein richtiger Fan von Ihnen, liest immer Ihre Artikel. Und weil Sie schon so lange im Geschäft sind, wissen Sie doch, dass ich mich um Kopf und Kragen und um meinen Job rede, wenn ich Ihnen all diese Fragen beantwortete. Ich möchte den Job aber unbedingt behalten, Frau Engels Fernandez, weil er meine Kinder ernährt. Also werden wir uns jetzt höflich voneinander verabschieden und uns einen schönen Feierabend wünschen. Morgen gibt es sicher eine Pressekonferenz.»
«Meine Güte, Sie machen es mir ganz schön schwer.»
Plötzlich wusste er, was ihn so bedrückte. Er würde einen zwanzigjährigen Gymnasiasten jagen, um ihn in den Bau zu stecken, und der Bau würde seine Ausbildung übernehmen, aus ihm binnen kürzester Zeit einen gefährlichen Mann machen, unfähig, jemals wieder im Frieden mit der Gesellschaft zu leben. Aber der zwanzigjährige Gymnasiast hatte einen Menschen umgebracht, und es war nun mal Morians Job, Mörder zu finden.
«Herr Morian? Ich kann mir denken, das wird nicht leicht für Sie.»
«Was meinen Sie?»
«Na, der ganze politische Druck. Es ist ja nicht irgendwer ermordet worden. Weinert war schließlich …»
«Falsch. Für mich ist irgendwer getötet worden. Da gibt es keinen Unterschied. Schlafen Sie gut.»
Morian legte verärgert auf. Verärgert, weil sie Recht hatte. Morgen würde die Maschinerie in Gang kommen. Der Innenminister würde den Polizeipräsidenten anrufen und von seinem Gespräch mit dem besorgten Ministerpräsidenten berichten, der Polizeipräsident würde augenblicklich eine Krisenkonferenz einberufen, mit angestrengtem Blick den Ernst der Lage verdeutlichen und sagen: Meine Herren, das Opfer war schließlich nicht irgendwer.
Zum Kotzen.
So wie der nach verbranntem Eiweiß stinkende Qualm. Die Milch. Angebrannt und übergekocht und über den Rand des Topfes auf die Herdplatte geschwappt. Liz erschien in der Küche, lächelte und schob ihn aus der Tür: «Leg dich aufs Sofa. Ich mach dir deinen Kaffee.»
03
«Alexander!»
Der Typ auf der anderen Straßenseite ruderte wild mit den Armen.
«Hey, Alex, warte doch mal!»
Das konnte er jetzt überhaupt nicht brauchen, mitten auf der Straße angequatscht zu werden. Alexander Weinert machte auf dem Absatz kehrt und hastete zurück zur U-Bahn-Station, nahm immer drei Stufen auf einmal, schlüpfte im letzten Moment durch die sich schließende Wagentür. Er hatte ihn mal auf irgendeiner Party kennen gelernt. Große Klappe, behauptete, jeden gewünschten Stoff binnen Stunden besorgen zu können. Große Fresse, ganz großes Fressbrett. Alexander hatte ihm etwas Gras zum Antesten abgekauft. Geld war nie ein Problem. Jetzt hatte er nichts weiter als zwei Groschen in der Hosentasche. Keine Zigaretten. Keinen Fahrschein. Keinen Personalausweis und keinen Führerschein. Und keine Jacke. Das lag alles in dem Haus, das er heute Morgen panisch verlassen hatte. Das Blut hatte er in einem Bach im Wald notdürftig aus dem Hemd gewaschen, dann sich und das Hemd auf einer Lichtung in der Sonne trocknen lassen. Anschließend hatte er sich zu Fuß auf den Weg nach Norden gemacht, die Straßen gemieden, am Dornheckensee das größere der beiden Fahrräder eines Liebespaars geklaut, das viel zu beschäftigt war, um etwas mitzukriegen. Immer am Rheinufer entlang, nach Köln. Die monotone Anstrengung und der angenehm warme Fahrtwind hatten ihn etwas beruhigt. Vorsichtshalber verbrachte er die Stunden bis zur Dämmerung im Deutzer Industriegebiet, drückte sich hinter den alten Lagerhallen rum, warf das Fahrrad ins Hafenbecken, bevor er die Rheinbrücke zu Fuß überquerte.
Sie hatte ihn gesehen. Im Hausflur. Keine Chance. Es war ihm nichts anderes übrig geblieben, als an ihr vorbei aus der Tür zu stürmen. Dabei hatte die Messe doch gerade erst begonnen. Sie war noch nie früher aus der Kirche weg, die heuchlerische Kuh.
Beim nächsten Halt stieg er aus, zwang sich zur Langsamkeit. Ebertplatz. Hier gab es Nutten, Dealer, Stricher. Gut so. Und eine WG voller Autofreaks, die draußen in Braunsfeld Kisten zum Verschieben herrichteten. Er hatte mal mit ihnen zu tun gehabt.
Er war müde. Sehr müde.
04
Die beiden Frachtschiffe unter ihm lieferten sich seit einer Viertelstunde ein unerbittliches Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den Strom. Max Maifeld genoss den Blick über das breite, graublaue, in der Morgensonne glitzernde Band, die Dächer der alten Fabriken, deren aufwendige Architektur einst die Ablösung der feudalen durch die industrielle Macht demonstrieren sollte und doch stets den Kürzeren zog angesichts des alles überragenden gotischen Doms. Nichts, nichts, nichts auf der Welt, keine zehn Pferde, keine noch so betörende Frau, kein noch so lukrativer Job würden ihn jemals von hier weglocken können. Hier wollte er in Ruhe alt werden. Ab und zu etwas Geld machen, gerade so viel, wie er zum Leben brauchte, Freunde zum Abendessen einladen, gemeinsam den Weinkeller plündern, über Gott und die Welt reden, ab und an etwas Herzflimmern, ein Kribbeln im Bauch, Hitze und Gier für eine Nacht, zerknüllte Bettwäsche am nächsten Morgen. Frühstück, eine letzte Umarmung und ein Lächeln zum Abschied. Mehr nicht.
Max Maifeld hatte genug gesehen von der Welt. Der alltägliche Blick von der Dachterrasse auf die ihn umgebende kleine Welt der Stadt Köln genügte ihm inzwischen vollauf. Das war das Letzte, was er nachts vor dem Zubettgehen, und das Erste, was er morgens nach dem Aufstehen tat. Er betrachtete seine Welt von oben.
Hier war er aufgewachsen, abgesehen von einigen glücklichen Jahren seiner Kindheit bei der Großmutter in der Eifel. Er hatte viel gesehen von der Welt; alles, was er glaubte sehen zu müssen. Jetzt musste er nichts mehr sehen. Und niemandem mehr etwas beweisen.
«Morgen, Papa.»
«Morgen, Süße. Keine Schule heute?»
«Papa!» Vera Maifeld legte einen knappen Zentner höchster Missbilligung in das kleine, vielseitig nutzbare Wort. «Falls es dir entgangen sein sollte: Ich stehe mitten im Abitur. Da gibt’s keinen regelmäßigen Unterricht mehr.» Sie ließ sich in einen der beiden Korbsessel am Frühstückstisch fallen.
Max löste sich von der Brüstung und nahm ihr gegenüber Platz. Seine Tochter versuchte vergebens, die viel zu langen Ärmel des Bademantels vor Butter, Marmelade und Kaffee zu schützen. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, warum die Ärmel viel zu lang waren. Der Bademantel hatte mal ihm gehört. Er hatte ihn immer gern getragen. Bis zu dem Tag, als Vera sich ihn mal auslieh.
«Papa, meine Freundin …» Sie biss herzhaft in ihr mit Marmelade bestrichenes Brötchen. «… Helena hat ein Problem.»
«Wer hat ein Problem?» Max hatte stets Mühe, Vorträgen seiner Tochter zu folgen, wenn sie unterdessen in ihr Brötchen biss.
«Hmh. Helena …»
«Wer ist Helena?»
«Papaaa!» Höchste Stufe der Missbilligung. Dann setzte sie ein breites Grinsen auf und sagte: «Helena. Meine Geliebte. Wir sind lesbisch, wollen nächste Woche heiraten, die Schule schmeißen und dann möglichst schnell ein Kind adoptieren.»
Max fiel der Kaffeelöffel aus der Hand, und Veras Gesichtsausdruck verdüsterte sich wieder: «Was muss ich tun, damit du mir zuhörst und dir endlich mal die Namen meiner Freunde merkst? Helena! Aus meiner Spanisch-AG! Sie war doch schon mal hier!»
Max durchforstete sein Gedächtnis nach den gut zwei Dutzend Gesichtern männlichen und weiblichen Geschlechts, die ihm aus dem Freundeskreis seiner nicht gerade kontaktscheuen Tochter diffus in Erinnerung geblieben waren. Nach dreißig Sekunden gab er auf.
«Und was ist mit Helena?»
«Ihr Bruder ist verschwunden.»
«Seit wann?»
«Seit gestern.»
«Aha. Wie alt ist denn Helenas Bruder?»
«Neunzehn oder zwanzig oder so.»
«Aha. Vielleicht hat ihn seine Schwester zu sehr geärgert.»
«Sie wohnen nicht zusammen.»
«Sollen wir das noch eine Weile weiterspielen, oder sagst du mir jetzt, wie das Problem heißt?»
Wortlos schob Vera die Montagausgabe des «Express» über den Tisch. Die Ausgabe von gestern. Die obere Hälfte der Titelseite des Boulevardblattes bestand aus einer fetten Schlagzeile, einem großen Farbfoto, einem kleineren Schwarzweißfoto mit Trauerrand und dem Hinweis auf einen dazugehörigen Text im Inneren des Blattes. Das Farbfoto zeigte einen ernsten Jungen in einem viel zu weiten Basketball-Trikot der L.A. Lakers. Das Foto musste schon älter sein. Denn der Junge auf dem Foto war allenfalls fünfzehn.
Das kleinere Foto zeigte einen dicken, älteren Herrn mit Halbglatze, Fliege und Strickweste vor einer hübschen Jugendstil-Villa im Grünen. Max hielt den Atem an. Er kannte den Mann. Er hatte sich gewünscht, ihm nie wieder zu begegnen. Nicht mal auf einem Foto. Er würde ihm auch nie wieder begegnen, verriet ihm die Schlagzeile.
Weinert. Max schob die Zeitung beiseite, zündete sich eine Zigarette an und schloss für einen Moment die Augen.
Vera wusste, dass ihr Vater nachdachte, wenn er die Augen schloss. Das Nachdenken ihres Vaters dauerte grundsätzlich länger, als es ihre Geduld erlaubte. «Papa, wer war Julius Weinert?»
«Eine große Nummer, als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Kanzler-Berater. Abgeordneter. Später Lobbyist.»
Und ein Schwein.
Weit unten, weit weg kreischte das Martinshorn eines Streifenwagens. Max kannte die nächste Frage seiner Tochter. Weil er seine Tochter kannte. Jedenfalls besser, als sie glaubte. Glaubte Max. Allerdings kannte er noch nicht seine Antwort auf ihre Frage. Und eigentlich war der Tag viel zu schön, um sich mit ihr zu streiten.
«Papa, wirst du ihn suchen?»
«Wen?»
«Helenas Bruder. Bitte.»
«Weshalb in Gottes Namen sollte ich das tun? Dafür gibt es in unserem Land die Polizei.»
«Aber die Polizei glaubt, dass er der Mörder ist.»
«Und wer glaubt das nicht?»
«Helena. Sie sagt, ihr Bruder ist kein Mörder.»
«Das sagen gewöhnlich alle Verwandten von Mördern.»
«Du bist doch Experte, wenn’s ums Wiederfinden von verschwundenen Dingen geht.»
«Genau. Ich suche Dinge, nicht Menschen. Gemälde, Autos, Schmuck. Gegenstände haben den Vorteil, dass es ihnen völlig egal ist, wo sie sich aufhalten. Man spürt sie auf und trägt sie zurück. Dafür werde ich bezahlt, und davon bezahlen wir das Frühstück und führen ein sorgloses Leben. Hast du Helena etwa irgendwas versprochen?»
«Natürlich nicht!»
Natürlich nicht. Aus dem Mund seiner Tochter konnte das zwei Bedeutungen haben. Erstens: Natürlich nicht. Zweitens: Selbstverständlich längst.
Der Kaffee war kalt. Die Zigarettenschachtel leer. Die Sonne hinter dem mittäglichen Kölner Grauschleier verschwunden. Der Streifenwagen offenbar am Ziel. Und Max Maifeld wusste, er hatte verloren, als er die dicken, stillen Tränen sah. Er hatte es noch nie ertragen, sie weinen zu sehen. Vielleicht, weil sie so selten geweint hatte als Kind. Bis zu dem Tag, als er weggegangen war.
«Vera, ich …»
Max reichte ihr eine Serviette, damit sie ihre Tränen trocknen konnte. Er wartete, bis sie sich beruhigt hatte. «Okay. Ich spreche mit ihr. Aber ich verspreche gar nichts. Besorg mir bitte alle Tageszeitungen von heute, die du auftreiben kannst. Und zwei Päckchen Zigaretten. Wie stand sie eigentlich zu ihrem Vater?»
«Wer? Helena? Zu Weinert? Weinert ist nicht ihr Vater.»
Veras Antwort-Technik trug nicht unbedingt zur Klärung des Sachverhalts bei. Also sparte er sich weitere Fragen. «Außerdem ist kein Kaffee mehr im Haus. Illy. Zur Not auch Segafredo. Und sag du deiner Freundin, sie soll zum Abendessen kommen. Dann sehen wir weiter.»
Vera fiel ihm um den Hals. «Kann ich den Maserati nehmen?»
Max grinste. Wie kann man nur so eine Spießer-Schaukel fahren, hatte sie geschimpft. Und diese Farbe. Ein Phallus-Symbol in Blau metallic. Bist du in der Midlife-Crisis, oder was ist los? Würde mich nicht wundern, wenn du demnächst einen rosa Porsche anschaffst.
«Die Schlüssel liegen auf meinem Schreibtisch.»
«Danke.» Sie verschwand durch die Terrassentür.
Rosa Porsche!
Unglaublich!
Theo, sein Bruder, hatte den Maserati aus einem zerknautschten Unfallwagen zusammengeschraubt. Ein Quattroporte Evolutione. Ein Haufen Schrott. Aber die Maschine war gerade mal 30 000 Kilometer gelaufen und war wie das Getriebe unversehrt. Als Theo damit fertig war, sah er aus wie frisch aus dem Laden.
Rosa Porsche! Also wirklich!
Der Maserati hatte vier Türen, eine Rückbank und einen Kofferraum. Ein ganz normales Auto also. Eine richtige Familienkutsche. Selbst der Name des Herstellers war nirgendwo zu finden, bis auf den winzigen Dreizack im Kühlergrill.
Sechs-Gang-Getriebe. Acht-Zylinder-Motor. 335 PS. Zurückhaltende Eleganz und feine Linien, wie das nur die italienischen Designer hinkriegen. Ein Wolf im Schafspelz.
Rosa Porsche!
Aber was verstehen Frauen schon von Autos?
05
Sie hatte den strahlend weißen Gebäudekomplex erspäht, bevor die Köln-Bonner Stadtbahn mit einem sanften Ruck zum Stillstand kam. Die Leuchtreklame hatte die Farbe tiefblauer Tinte, ebenso die Flaggen entlang des Zauns. Der «Rheinische Anzeiger» war wie viele deutsche Zeitungen vor Jahrzehnten aus der Innenstadt in eines dieser gesichtslosen Gewerbegebiete am Stadtrand gezogen.
«Guten Morgen. Mein Name ist Helena Walterscheid. Ich bin mit Frau Engels Fernandez verabredet.»
Der Pförtner hinter der Scheibe aus Panzerglas beäugte sie misstrauisch. Als er den Telefonhörer wieder aufgelegt hatte, hörte sie seine Stimme über Lautsprecher: «Zweiter Stock. Frau Engels erwartet Sie.» Augenblicklich summte der elektrische Türöffner.
Jemand öffnete die Aufzugtür im zweiten Stock. Eine nicht besonders große Frau mit dicken, krausen, pechschwarzen Haaren und ungewöhnlich dunklem Teint. Helena schätzte sie auf Ende dreißig, Anfang vierzig. Das streng geschnittene, geschäftsmäßige Kostüm kontrastierte zu ihrer Haarpracht und ihrer fraulichen Figur.
«Helena Walterscheid? Ich bin Maria Engels.»
Die Frau schenkte ihr ein warmes Lächeln, dann ging sie mit schnellen, energischen Schritten voran. Helena hatte Mühe, das Tempo zu halten. Die Frau hatte schöne, kräftige Waden. Sie durchquerten ein Großraumbüro mit zwei Dutzend um diese Uhrzeit noch verwaisten Computerarbeitsplätzen, bis sie einen mit Glaswänden abgetrennten Raum erreichten. Maria deutete auf den Konferenztisch: «Nehmen Sie Platz. Kaffee?»
«Nein danke. Ich wollte Sie eigentlich privat anrufen. Aber Sie stehen nicht im Telefonbuch …»
«Nein.»
«Wieso nicht?»
Maria war einen Moment sprachlos. Ihr Gegenüber war sehr selbstbewusst für ihr Alter. «Wissen Sie, wenn man seit elf Jahren täglich über Verbrechen schreibt, wächst kontinuierlich die Zahl der Leute, denen nicht passt, was man schreibt. In meinem Metier sind das aber nicht die Leute, die brav einen Leserbrief verfassen oder großkotzig den Verleger einschalten, sondern Leute von der Sorte, die einen vorzugsweise mitten in der Nacht mit anonymen Morddrohungen oder Obszönitäten aus dem Schlaf klingeln.»
«Aha. Sind Sie verheiratet?»
Maria verschluckte sich an ihrem Kaffee. Dann lachte sie. «Sie meinen, wegen des Doppelnamens? Nein. Da ist auch kein Bindestrich dazwischen. Der zweite Familienname ist der Mädchenname meiner Mutter.»
«Dann sind Sie also Spanierin? Dachte ich mir schon, wegen Ihres dunklen Hauttons und …»
«Nein. Ich bin Deutsche. Meine Mutter ist in den fünfziger Jahren aus Spanien eingewandert und hat hier einen Deutschen geheiratet.»
«Leben Ihre Eltern noch?»
«Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Aber Sie sind doch nicht gekommen, um meine Lebensgeschichte zu hören, oder?»
Schweigen. Maria betrachtete mit wachsendem Interesse die junge Frau, die gestern mit resoluter Telefonstimme um einen Termin gebeten hatte. Sie habe ihr ein interessantes Angebot zu machen, hatte sie gesagt. Die Stimme am Telefon passte so gar nicht zu dem zarten Geschöpf, das ihr jetzt gegenübersaß. Jeans, Turnschuhe, dunkelblaues Sweatshirt, eine voluminöse Umhängetasche.
«Wie alt sind Sie?»
«Achtzehn. Ich habe Ihren Artikel gelesen. Gestern auch.»
«Über den Mord? Über Julius Weinert?»
«Ja. Ich habe auch die Artikel in den anderen Zeitungen gelesen. Ihre Artikel sind sehr gut geschrieben. Und fair.»
«Fair … wem gegenüber?»
«Meinem Bruder gegenüber. Alexander. Nur Sie haben geschrieben, dass ja noch gar nicht bewiesen ist, dass er es war. Es kann doch genauso gut jemand anderes gewesen sein, nicht wahr?»
«Alexander Weinert ist Ihr Bruder?»
Maria klappte ihr Notizbuch auf. Ein antrainierter Reflex: Das Mitschreiben schaffte emotionale Distanz; in ihrem Beruf überlebenswichtig. Für das Überleben ihrer Seele. Um nicht zu ertrinken beim täglichen Blick in die Abgründe, die sich hinter den Polizeiberichten und Gerichtsakten auftaten. Bevor Maria ihre Frage loswerden konnte, beantwortete sie das Mädchen: «Ja. Wir haben verschiedene Familiennamen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Unsere Familie gibt es nämlich nicht mehr. Aber das hat nichts damit zu tun, weshalb ich hier bin. Bitte helfen Sie mir!»
«Wie soll ich Ihnen denn helfen?»
«Mein Bruder hat niemanden umgebracht. Ich kenne ihn. Er könnte niemanden umbringen.»
«Die Polizei ist anderer Meinung.»
«Deshalb bin ich ja zu Ihnen gekommen.» Helena geriet ins Stocken, als schiene sie sorgfältig über den nächsten Satz nachzudenken. Dann sagte sie leise: «Ich vertraue Ihnen. Sie haben schon einmal über meine Familie geschrieben. Vor zehn Jahren. Meine Großmutter hat Ihre Artikel von damals alle ausgeschnitten und aufbewahrt. Und sie sagte immer, Sie seien ein guter Mensch.»
Maria durchwühlte ihr Gedächtnis wie einen zu eilig gepackten Koffer. Aber sie fand nichts. «Wer ist denn Ihre Großmutter?»
Helena Walterscheid schwieg. Starrte auf die grau lasierte Beschichtung des Konferenztisches, als wäre dort die Antwort auf die Frage zu finden. Dann hob sie den Kopf, sah ihr klar und offen in die Augen, als sie weitersprach.
«Was damals passiert ist, spielt keine Rolle. Wollen Sie ein Exklusiv-Interview mit dem vermeintlichen Mörder des berühmten Julius Weinert, bevor er sich der Polizei stellt?»
Maria antwortete nicht. Stattdessen griff sie zu der Schachtel, die jemand auf dem Konferenztisch vergessen hatte, und zündete sich eine Zigarette an. Am Abend zuvor hatte sie zum ungefähr hundertsten Mal beschlossen, am nächsten Morgen mit dem Rauchen aufzuhören. Ihr Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Ihr Über-Ich klopfte an, wedelte mit dem Strafvereitelungs-Paragraphen. Die junge Frau ließ sie nicht aus den Augen, während sie eine Visitenkarte aus der Umhängetasche zog und über den Tisch schob.
«Das ist der Mann, der meinen Bruder suchen wird und hoffentlich vor der Polizei findet. Max Maifeld. So eine Art Privatdetektiv. Ich treffe ihn heute Abend. Bitte sprechen Sie anschließend mit ihm. Sie bekommen das Interview, wenn mein Bruder so die Gelegenheit erhält, die Öffentlichkeit von seiner Unschuld zu überzeugen. Danach wird er sich stellen, dafür sorge ich. Mein Ehrenwort.»
«Helena, ich kann Ihnen nichts versprechen …»
«Ich weiß. Danke.»
Sie stand auf und ging, ohne noch ein Wort zu sagen.
Maria blieb sitzen. Und dachte nach. Der Name Walterscheid sagte ihr nichts. Und das Gesicht sagte ihr nichts. Sie hätte geschworen, sich an jeden großen Prozess am Bonner Landgericht erinnern zu können.
Vor zehn Jahren.
Sie wählte die Nummer des Redaktionsarchivs.
«Engels. Guten Morgen, Professor … Danke, mir geht es gut. Professor, haben wir etwas über eine Helena Walterscheid? Natürlich habe ich einen Augenblick Zeit … Nein, nein, ich bleibe in der Leitung … Nichts? Ersetzen Sie bitte mal Walterscheid durch Weinert. Ja, Helena Weinert. Auch nichts? Dann bitte Walterscheid solo … Nichts? Hm … Nein, nicht nötig. Danke Ihnen.»
Nichts. Sie haben schon einmal über meine Familie geschrieben. Vor zehn Jahren. Was, verdammt noch mal, war vor zehn Jahren passiert?
06
Vielleicht wäre er besser Hellseher statt Bulle geworden. Morian dachte an gestern. Der Anruf der Sekretärin, atemlos: Der Präsident erwartet Sie. Unverzüglich. Der angestrengte Blick. Die in Falten gelegte Stirn, geistige Höchstleistung und mannhafte Willensstärke symbolisierend. Der Ernst der Lage. Er, und nicht nur er, und da befinde er sich mit Düsseldorf im Einklang, erwarte besonderes Engagement und zugleich Sensibilität bei den Ermittlungen; äußerste Zurückhaltung gegenüber der Presse, absolute Nachrichtensperre, um es ganz deutlich zu sagen, und eine stets unverzügliche Unterrichtung des Präsidenten über neue Beweismomente. Schließlich ist das Opfer nicht irgendwer, Morian.
Der Innenminister und der Ministerpräsident waren, ganz wie Morian prophezeit hatte, sehr besorgt, ebenso das Bundeskanzleramt in Berlin, das unverzüglich das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und den Generalbundesanwalt in Karlsruhe unterrichtet hatte. Besorgt seien außerdem verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie der Polizeipräsident atemlos versicherte.
Wer diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren und worüber diese Herrschaften eigentlich besorgt waren, hatte Morian nicht erfahren. Aber er hatte auch nicht danach gefragt.
Die bisherigen Ergebnisse aus dem Labor waren nicht gerade überwältigend. Fest stand bisher lediglich die Tatwaffe: Weinerts messerscharfer Brieföffner aus Messing, der nach Aussage seiner Schwester stets griffbereit in einer lederbezogenen Schale auf seinem Schreibtisch gelegen hatte. Der Brieföffner hatte das Aussehen eines Dolches; vielleicht erhöhte das den Akt des Brieföffnens zu einer machtvollen Demonstration männlicher Entschlossenheit.
Da Weinert von hinten erstochen worden war, musste sich der Täter in der Gewissheit genähert haben, dass das Opfer dessen Anwesenheit nicht bemerken oder aber sich darüber nicht weiter wundern würde. Das sprach für einen extrem kurzen oder aber relativ langen gemeinsamen Aufenthalt von Opfer und Täter am Tatort.
Schränke und Kommoden im Arbeitszimmer waren unversehrt; nach erstem Augenschein und nach Aussage der Schwester fehlte auch im restlichen Haus nichts. Dennoch war Habgier als Motiv nicht auszuschließen: Der Täter könnte durch die unvorhergesehene Rückkehr der Schwester gestört worden sein. Wenn der Täter sich im Haus auskannte, war die fehlende, bei Raubmorden sonst übliche Unordnung zu erklären. Ein Beziehungstäter also.
Seltsam war der Umstand, dass die Scherben des zerborstenen Cognacschwenkers blutig waren.
Warum aber fand sich nach einem solch massiven Angriff so wenig Blut auf dem Teppich oder auf dem Schreibtisch?
Kopfschmerzen bereitete Morian zudem die offene Terrassentür des Arbeitszimmers. Sowohl Gertrud Weinert als auch der Hausarzt hatten versichert, sie schon geöffnet vorgefunden zu haben. Morian hätte sich mit der Erklärung zufrieden geben können, dass Weinert sie geöffnet hatte, um frische Luft einzulassen. Allerdings, so hatte die Spurensicherung ergeben, führten durch die säuberlich geharkten Blumenbeete zwei frische Fußspuren zum Rasen, und jenseits des Rasens waren an der an einen Waldweg angrenzenden Gartenmauer aus Bruchstein Abriebspuren von Schuhsohlen und Krümel des Blumenbeetes festgestellt worden. Das könnte bedeuten: Jemand hatte die Terrassentür zur überstürzten Flucht benutzt, als Gertrud Weinert überraschend nach Hause kam. Wie aber passte das mit der Aussage der Schwester überein, der blutbesudelte Alexander Weinert sei an ihr vorbei durch die Haustür gestürmt?
Gab es mehr als einen Täter? Hatte Alexander Weinert einen Helfershelfer? Nach den Fußspuren zu urteilen, mindestens zwei. Warum sind sie nicht alle gemeinsam durch den Garten geflüchtet? Weil ihm keine schlüssigen Antworten auf seine Fragen einfielen, war Morian ganz dankbar, als das Telefon klingelte.
«Friedrich hier.»
Pathologe am Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Bonn. Nachtmensch, gestraft mit dem Gesicht einer Fledermaus. Ein unausstehlicher Kerl, der nie guten Tag sagte; vermutlich, weil er dies für pure Zeitverschwendung hielt. Ein Meister seines Fachs.
«Herr Dr. Friedrich, ich grüße Sie. Wie geht …»
«Kurzer Zwischenbericht. Ohne Gewähr.»
«Verstehe.»
«Sie verstehen gar nichts. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier los ist. Meinen Sie, ich könnte mich den lieben langen Tag ausschließlich mit Ihrem verfaulten Volksvertreter beschäftigen?»
«Selbstverständlich nicht, Herr Dr. Friedrich. Ich hatte doch nur …»
«Unterbrechen Sie mich nicht. Wie Sie erstaunlicherweise schon ganz richtig gemutmaßt hatten, fanden wir Druckspuren am Nacken und am Hals. Da die Rückenlehne des Bürosessels im Weg gewesen wäre, musste der Oberkörper zunächst nach vorne bugsiert werden. So weit lagen Sie richtig. Jetzt könnten Sie denken, der Täter hat mit der linken Hand den Nacken des Opfers umfasst, auf diese Weise dessen Kopf und Oberkörper ruckartig nach vorne bewegt, um dann mit dem Brieföffner in der rechten Faust zuzustoßen. Halt so, wie jeder Depp das machen würde, nicht wahr?»
«Ja … So war es aber nicht?»
«Ja und nein.»
«Ja und nein?»
«Im Prinzip ja. Der Täter hat jedoch nicht unmittelbar seine Hände benutzt, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.»
«Sondern?»
«Sondern eine Drahtschlinge.»
Morian zog ein Blatt Papier aus der Schublade seines Schreibtisches und fingerte nach dem Kugelschreiber in der Innentasche seines Jacketts, das über der Rückenlehne seines Stuhls hing.
«Vermutlich so eine mit Holzgriffen an den beiden Enden. Wie man sie zum Erdrosseln benutzt. Sie kennen die Dinger?»
Er kannte die Dinger. Der rostfreie Draht aus einer extrem biegsamen Legierung war etwa 40 Zentimeter lang. Die Enden waren im Winkel von 90 Grad an je einem zylinderförmigen Griff befestigt, gewöhnlich aus Holz, manchmal aus Kunststoff.
«… blitzschnell um den Hals gelegt, die Griffe um 180 Grad gedreht, und schon macht das Opfer, was Sie wollen. Teuflisch. Er hat die Drahtschlinge nicht zum Erdrosseln benutzt, sondern um das Opfer besser im Griff zu haben. Dann stieß er zu. Mit viel Kraft, der Brieföffner saß sehr tief, und zwar … Sind Sie noch da?»
«Selbstverständlich, Herr Dr. Friedrich. Ich wollte Sie nur nicht …»
«Dann hören Sie gefälligst zu. Wo war ich stehen geblieben?
«Sie wollten gerade …»
«Wie gesagt, ein kraftvoller Stoß. Das heißt nicht, dass es Arnold Schwarzenegger gewesen sein muss; aber ich würde mal behaupten, es war keiner dieser Tattergreise, wie sie hier haufenweise …»
«Sonst noch was, Herr Doktor?»
Schweigen. Friedrich räusperte sich und raschelte mit Papier. Morian vertrieb sich die Zeit, indem er den Hörer zwischen Schulter und Ohr klemmte und eine Büroklammer verbog. Als er mit seinem Werk zufrieden war, stellte er die Skulptur vor sich auf den Schreibtisch und betrachtete sie eingehend. So ging das Spiel seit Jahren. Wehe, er würde die Regeln ändern.
Nach endlos langen Sekunden kam zögernd die Antwort.
Ein einziges Wort.
«Ja.»
Schweigen, Rascheln, Räuspern. Die nächste Büroklammer. Die neue Skulptur fiel dauernd um.
«Wir sind da auf etwas Seltsames gestoßen.»
«Aha». Morian sah auf die Uhr.
«Der Brieföffner ist haarscharf am Herz vorbei. Weinert ist also nicht an dem Dolchstoß gestorben. Er wäre es natürlich, hätte man ihn eine Weile mit seinem Elend alleine gelassen. Dann wäre er natürlich verblutet. So lange wollte der Täter aber offenbar nicht warten, sondern schnitt ihm mit einem extrem scharfen Werkzeug, vermutlich einer Rasierklinge, fachmännisch die Kehle durch, während er ihn mit der Drahtschlinge in Position hielt. Weinert ist also nicht ursächlich an den mit dem Dolch herbeigeführten inneren Verletzungen gestorben, sondern man hat ihn ausbluten lassen wie ein Schwein. Und jetzt kommt’s: Das Blut, das aus der Wunde am Hals schoss, wurde in dem Cognacschwenker, dessen Scherben Sie auf dem Teppich gesehen haben, sorgsam aufgefangen. Das ist eine Theorie, wohlgemerkt. Aber sonst hätte es auf dem Schreibtisch und drum herum aussehen müssen wie Sau. Hat es aber nicht. Und außerdem wurde in dem Schwenker definitiv Weinerts Blut und keineswegs Cognac geschwenkt. Zumindest nicht seit dem letzten Spülgang.»
Die Stimme des Gerichtsmediziners klang triumphierend. Morian gönnte ihm den Triumph.
«Großartig!»
«Man tut, was man kann.»
«Sie sind ein Genie.»
«Ich bin Naturwissenschaftler. Das genügt. Man muss nicht gleich ein Genie sein, um Polizeibeamten etwas vorauszuhaben.»
«Aber warum hat jemand das Blut aufgefangen?»