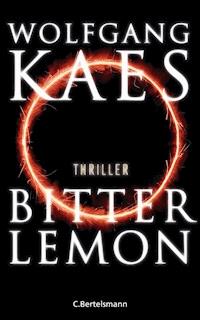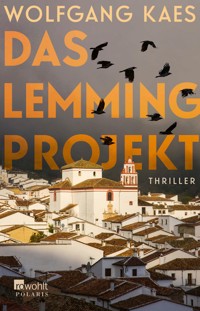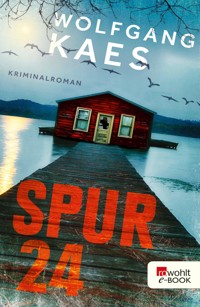7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Morian ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Er sieht dich, wo du auch bist – der Jäger Bei Männern hat Martina noch nie das große Los gezogen. Umso glücklicher und dankbarer ist die allein erziehende Mutter, als sie Mario kennen lernt – im Internet. Mario ist charmant und aufmerksam. Ein Traummann. Doch mit der Zeit fordert er von ihr als Gegenleistung bizarre Liebesbeweise. Mehr und mehr verwandelt sich Martinas Zuneigung in panische Angst. Als sie die Beziehung schließlich abbricht, wird ihr Leben zur Hölle. Da verschwindet plötzlich ihre Tochter... Kommissar Morian und seine Kollegin Antonia Dix jagen einen wahnsinnigen Stalker. Ein Wettlauf mit der Zeit. Morian muss wissen, wie der Stalker denkt und fühlt. Also tritt er selbst eine Reise ins Herz der Finsternis an. "Ein deutscher Thriller-Autor der Premium-Klasse" (Kölner Stadt-Anzeiger)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Ähnliche
Wolfgang Kaes
Herbstjagd
Thriller
Mit einem Nachwort des Autors zum Thema «Stalking»
Über dieses Buch
Er sieht dich, wo du auch bist – der Jäger
Bei Männern hat Martina noch nie das große Los gezogen. Umso glücklicher und dankbarer ist die allein erziehende Mutter, als sie Mario kennen lernt – im Internet. Mario ist charmant und aufmerksam. Ein Traummann.
Doch mit der Zeit fordert er von ihr als Gegenleistung bizarre Liebesbeweise. Mehr und mehr verwandelt sich Martinas Zuneigung in panische Angst. Als sie die Beziehung schließlich abbricht, wird ihr Leben zur Hölle. Da verschwindet plötzlich ihre Tochter…
Kommissar Morian und seine Kollegin Antonia Dix jagen einen wahnsinnigen Stalker. Ein Wettlauf mit der Zeit. Morian muss wissen, wie der Stalker denkt und fühlt. Also tritt er selbst eine Reise ins Herz der Finsternis an.
„Ein deutscher Thriller-Autor der Premium-Klasse“ (Kölner Stadt-Anzeiger)
Vita
Wolfgang Kaes, 1958 in der Eifel geboren, finanzierte sein Studium der Politikwissenschaft und Kulturanthropologie als Waldarbeiter, Hilfsarbeiter im Straßenbau, Lastwagenfahrer, Taxifahrer und schließlich als Polizeireporter. Er schrieb Reportagen für den Stern, die Zeit und andere. 2012 kürte ihn das Medium Magazin zum «Reporter des Jahres», 2013 erhielt er den Henri-Nannen-Preis in der Kategorie «Investigative Recherche». Seit 2003 verarbeitet er seine journalistischen Recherchen auch zu Romanen. Kaes war viele Jahre Chefreporter des Bonner General-Anzeigers, bevor er 2020 entschied, sich künftig ganz dem Bücherschreiben zu widmen. Mehr zum Autor erfahren sie im Internet unter: www.wolfgang-kaes.de
Ich danke zwei außergewöhnlichen Kriminalisten:
Hans-Georg Classen, Erster Kriminalhauptkommissar, der seit mehr als 20 Jahren all meine Fragen mit bewundernswerter Geduld beantwortet.
Und Friedhelm, dem familieneigenen Experten, für seine klugen Gedanken.
Die Liebe, die wir nicht als Segen und Glück empfinden, empfinden wir als eine Last.
Marie von Ebner-Eschenbach
Heute ist der 1. September. Herbstbeginn. Meteorologisch, nicht kalendarisch. Ein gewaltiger Unterschied. Kalendarisch erst drei Wochen später. Sommer ade, Scheiden tut weh. Wohin mit dem Schmerz? Weitergeben! Besser so. Dann geht das Leben weiter. Wessen Leben? Mein Leben ist wie eine fremde Stadt. Fremdes Land. Fremder Fluss. Stadt, Land, Fluss. Ein Spiel. Sie spielen es ohne mich. Deshalb spiele ich es ohne sie. Ich laufe durch die fremde Stadt, die mein Leben ist. Ich sehe keine Menschen in den Straßen. Ich sehe nur Köpfe. Die Köpfe sprechen eine fremde Sprache und sehen strafend über mich hinweg. Sie stehen um mich herum und reden über mich und sehen nichts. Mich nicht. Früher schlimm. Heute gut so. Sie haben keine Liebe, weil sie keine Sehnsucht haben. Wird Sehnsucht stillbar, ist Liebe nichts. Mein Kopf schrumpft in der fremden Stadt, bis er nichts ist. Erst wenn ich mich zwinge zu denken, die anderen sind nur Staub für mich, dann wächst mein Kopf wieder. Mein Körper ist aus Beton und innen hohl. Randvoll mit Benzin. Kein Streichholz, kein Streichholz! Die Hülle hat feine Risse. Vorsicht! Mein Geschlecht ist eingemauert. Gott sei Dank. Mich berührt nicht, was ich berühre. Deshalb berühre ich nichts. Wenn ich springe, zerspringe ich. Meine Stimme gehört nicht mir. Sie ist nur geliehen. So wie mein Name. Das bin ich nicht. Nicht ich. Mein Gehirn ist ein Computer ohne Programmierer. Deshalb muss ich mich selbst programmieren, immer wieder neu:
Ich, der Jäger.
Sie trat in die Pedale, stemmte sich gegen den Sturm, der durch die verlassenen Straßenschluchten fegte. Das Licht war kaputt. Hin und wieder warf sie einen flüchtigen Blick über die Schulter, nur um sicherzugehen. Aber niemand folgte ihr. Nicht um diese Zeit, nicht bei diesem Wetter. Falsch. Sie konnte nie sicher sein. Zu keiner Zeit. Der Regen peitschte ihr ins Gesicht. Nadelstiche auf ihrer Haut. Bornheimer Straße. Endlich. Niemand folgte ihr, außer der Angst. Sie strampelte die Angst nieder. Der Bus der Linie 620 überholte sie kurz vor dem Ziel, haarscharf und rücksichtslos, mit jaulendem Motor, als sei sie ein Nichts. Eine lange Reihe hell erleuchteter Fenster, leere Blicke aus stumpfen Augen, von oben herab. Das Spritzwasser der Pfützen tränkte ihre Hosenbeine. Ihre Finger spürten die Lenkstange nicht mehr. Sie hätte Handschuhe anziehen sollen. Sie hätte ihre gefütterte Winterjacke aus dem Schrank nehmen sollen. Im September? Sie hätte den Bus nehmen sollen. Um Mitternacht? Alleine an der Haltestelle?
Und wenn er schon in dem Bus gesessen hätte?
Als einziger Fahrgast?
Er hätte gelächelt.
Der Fahrer bremste. Sie bremste. Haltestelle Citywache.
Warum konnte ihr Sohn nicht einmal das Licht an seinem Fahrrad reparieren? Und warum konnte er nicht einmal auf seine Schwester aufpassen?
Alles lief aus dem Ruder.
Sie wartete. In sicherer Entfernung.
Sicher. Nichts war mehr sicher.
Niemand stieg aus. Der Bus fuhr weiter, gab Gas, schleuderte ihr die schmutzige Nässe der Straße entgegen. Jetzt erst stieg sie vom Rad, schob es über den Bürgersteig, vorbei an den beiden geparkten Streifenwagen, lehnte es an die grünen Glasbausteine. Sie kannte die Ziffernkombination des Zahlenschlosses nicht. Aber wer würde schon hier, unter den Augen der Polizei, ein altes Fahrrad klauen?
Er würde es tun. Wenn ihm danach wäre.
Die Tür war aus dickem, getöntem Panzerglas. Sie sah sich noch einmal um, nach links, nach rechts, sicherheitshalber.
Manchmal konnte sie seinen Blick spüren, quer über die Straße, durch die Menschen hindurch, in ihrem Rücken. Sie schaute wieder nach vorn, unschlüssig, ob sie das Richtige tat, und sah sich in der Tür. Sie erschrak vor sich selbst. Ihr mageres, blasses Gesicht spiegelte sich in dem grün schimmernden Panzerglas. Ihr Haar, das patschnass an ihren Schläfen klebte. Die Angst in ihren Augen. Der Summer. Das Brummen des Summers holte sie aus ihren Gedanken. Sie hatte noch gar nicht geklingelt. Sie hatten sie von innen beobachtet. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
«Bitte helfen Sie mir. Jasmin ist weg!»
«Sie sind ja ganz nass. Soll ich Ihnen ein Handtuch geben? Wollen Sie einen Kaffee?»
Der Polizeibeamte war sehr groß und sehr hager und schon älter. Er hatte graues Haar, eine warme, dunkle, beruhigend wirkende Stimme und einen hervorstehenden Adamsapfel, der auf und ab hüpfte, wenn er sprach. Bevor sie antworten konnte, war er verschwunden und kehrte mit einem gelben Frottéhandtuch und einem Kaffeebecher zurück. Auf dem Becher stand: PolizeisportfestNRW 1983 Duisburg. Der Mann gab ihr das Handtuch und stellte den Becher vor sie, dicht an die Kante seines Schreibtisches.
Der Kaffee dampfte, so heiß war er.
«Hier. Bitte setzen Sie sich. Wir haben leider im Moment keine Milch da. Zucker? Wer ist Jasmin?»
«Meine Tochter. Sie ist weg.»
Der Polizeibeamte zog die Tastatur des Computers zu sich heran und starrte angestrengt auf den Monitor.
«Einen Moment noch, bitte.»
Niemand der anderen Männer im Raum beachtete sie. Das war ihr angenehm. So wie sie aussah. Das gelbe Handtuch war jetzt voller schwarzer Flecken. Von der zerlaufenden Wimperntusche. Sie knüllte das Handtuch auf ihrem Schoß zusammen, sodass man die Flecken nicht mehr sah. Sie hätte jetzt gerne ihr Gesicht abgewaschen. Sie hätte sich die Haare hochstecken sollen, so wie sie es tat, wenn sie morgens zur Arbeit ging. Ein Beamter sprach mit monotoner Stimme in ein Mikrofon, das vor ihm aus dem Tisch ragte. Sie verstand kein Wort. Zwei weitere Polizisten kontrollierten ihre Pistolen, steckten sie zurück in die Taschen an ihren Gürteln, setzten ihre Mützen auf, nickten dem Mann am Mikrofon zu und gingen wortlos. Sekunden später gellte das Martinshorn eines Streifenwagens durch die Nacht.
«So. Da haben wir’s. Diese elektronischen Formulare. Furchtbar. Nächstes Jahr werde ich pensioniert. Dann kann ich diesen ganzen Computerkram getrost wieder vergessen. Wie heißen Sie?»
«Wer? Ich?» Sie erschrak. «Martina Hahne.»
«Martina …»
«Ja. Hahne.»
«Hahne wie Hahn mit e?»
«Ja.»
«Und Ihre Tochter heißt Jasmin mit J…»
«Ja.»
«Jasmin Hahne …»
«Ja.»
«Wie alt ist Ihre Tochter, Frau Hahne?»
«Fünfzehn ist sie letzten Monat geworden.»
«Oje. Schwieriges Alter, nicht wahr? Die Pubertät. Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Töchter in dem Alter waren. Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen?»
Sie erzählte ihm, was er wissen wollte, und der fremde Mann schrieb alles in seinen Computer. Sie erzählte ihm auch Dinge, die er wohl gar nicht wissen wollte. Dann schrieb der Mann nichts in den Computer und hörte ihr einfach zu. Sie erzählte ihm, dass sie Jasmin zum letzten Mal am Morgen gesehen hatte, gegen halb acht, als ihre Tochter wieder mal ohne Frühstück die Wohnung verließ, um zur Schule zu gehen. Ihre Tochter hatte ständig Angst, zu dick zu werden, dabei war sie so schrecklich dünn, viel zu dünn. So dünn, dass die Rektorin der Hauptschule schon angerufen hatte. Aber was sollte sie machen? Die Rektorin hatte gut reden. Jasmin wollte unbedingt Model werden, später, nach der Schule, so wie Kate Moss, deren Poster über dem Bett hing, so eine verrückte Idee, die war ihr nicht auszutreiben, deshalb aß sie kaum etwas und übte in ihrem Zimmer, ging vor dem großen Spiegel auf und ab und kontrollierte ihren Gang, aber ansonsten war sie eine gute Schülerin und ein pflegeleichtes Kind, ja: Pflegeleicht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Im Gegensatz zu ihrem Bruder. Wie alt? Wer? Boris? Gerade neunzehn geworden und immer noch nicht mit der Ausbildung fertig. Ja, insgesamt zwei Kinder. Das reicht doch auch, als Alleinerziehende, oder?
«Und Ihr Sohn lebt ebenfalls in Ihrem Haushalt?»
Ja klar, wo denn sonst? Mit dem bisschen Lehrgeld. Boris war schon immer das Sorgenkind gewesen, schon als er ein Baby war. Oft krank. Vor vier Wochen hat Boris seine dritte Lehrstelle angefangen, Kfz-Schlosser diesmal. Der Meister war ein guter Bekannter ihres Chefs. Was für ein Glück. Zwei Ausbildungen hat Boris schon abgebrochen, eine als Metzger und eine als Dachdecker, und jedes Mal eine passende Ausrede. Sie betete jeden Tag, dass er die neue Ausbildung diesmal zu Ende brächte, eine vierte Chance würde er nicht bekommen. Mit Autos hatte er gerne zu tun, das machte ihm Spaß. Nur das Arbeiten machte ihm keinen Spaß. Für die paar Kröten, jammerte der allen Ernstes rum. Schau dich doch mal um, guck doch mal, was los ist auf dem Arbeitsmarkt, sei froh, dass du überhaupt Arbeit hast, oder meinst du, die hätten nur auf dich gewartet? Aber meistens fehlte ihr die Kraft, um sich mit ihm zu streiten. Und dem Jungen fehlte der Vater, da war sie sich sicher, das Vorbild, die starke Hand. Nur hätte der Erzeuger ihrer beiden Kinder für diese Rolle ohnehin nicht getaugt. Der hatte sich aus dem Staub gemacht, als Jasmin noch ein Baby war. Der Dreckskerl.
«Wo lebt der Vater?»
«Keine Ahnung.»
Sie wusste es wirklich nicht. Sie wollte es auch nicht wissen. Anfangs, als Jasmin noch klein war, da hatte sie versucht, dass er wenigstens für die Kinder Unterhalt zahlte. Aber dann wurde er arbeitslos und zog weg aus der Stadt. Wohin? Keine Ahnung. Die Arbeit hatte der sowieso nicht erfunden. Der hing schon immer lieber in der Kneipe rum und jammerte der Wirtin die Ohren voll, über sein verpfuschtes Leben und dass an allem die anderen schuld sind. Ein Säufer. Alkoholkrank nannte man das heute. Und sie konnte den Anwalt nicht mehr bezahlen.
«Wir kriegen das raus, wo er sich aufhält. Und seit wann vermissen Sie nun Ihre Tochter, Frau Hahne?»
Sie hatte ihren Sohn noch gebeten, den Frühstückstisch abzuräumen, obwohl sie sich das auch hätte sparen können, dann hatte sie fünf Minuten nach ihrer Tochter ebenfalls die Wohnung verlassen, um zu Fuß zur Arbeit zu gehen, über die Brücke und die Bahngleise rüber zum Lidl in der Justus-von-Liebig-Straße, wo sie als Kassiererin arbeitete, bis 20 Uhr. Sie brauchte die Überstunden. Die Waschmaschine gab ihren Geist auf. Waschmaschinen waren teuer. Ungefähr um halb neun abends war sie dann wieder daheim. Boris lag auf seinem Bett und guckte Fernsehen. Warst du nicht auf der Arbeit? Nein, hatte er gesagt, ich bin erkältet, und hatte sich umgedreht und die Decke über den Kopf gezogen. Ende der Diskussion.
Jasmin war nicht da. Die Panik befiel sie auf der Stelle. Etwa eine halbe Stunde lang zwang sie sich, Ruhe zu bewahren. Dann rief Martina Hahne die Freundinnen ihrer Tochter an, eine nach der anderen, und schließlich die Klassenlehrerin. Nichts.
Sie riss Boris die Bettdecke weg. Ist Jasmin nach der Schule hier gewesen? Nein! Was weiß ich, wo sich die blöde Zicke wieder herumtreibt.
Jasmin trieb sich nie herum. Jasmin nicht. Um Mitternacht nahm Martina Hahne das Fahrrad ihres Sohnes aus dem Waschkeller und fuhr damit zur Polizei.
Der Beamte sah von seinem Computer auf: «Frau Hahne, ich kann Ihre Sorge gut verstehen. Aber nur damit Sie mal eine Vorstellung haben: Bei den Dienststellen des Bonner Polizeipräsidiums werden jeden Tag zwischen zwei und fünfzehn Jugendliche als vermisst gemeldet. Tag für Tag! Je nach Wetterlage. Im Sommer mehr, im Winter weniger. Davon tauchen 95 Prozent schon am nächsten Tag wieder unversehrt auf. Oder spätestens nach dem Wochenende. Die Party war so schön und ging bis sechs Uhr morgens, oder man hat bei der Freundin übernachtet und verschwitzt, Bescheid zu geben, oder man hat sich verliebt und darüber alles andere vergessen …»
Martina Hahne klammerte sich mit ihren Augen an seinen hüpfenden Adamsapfel. Sie wollte seinen Worten so gerne Glauben schenken. Aber tief in ihrem Inneren wusste sie, dass ihre Tochter Jasmin zu den restlichen fünf Prozent der Polizeistatistik gehörte. Sie hatte dem netten Beamten so viel über sich erzählt.
Aber nicht die ganze Wahrheit.
Sie saß hinten in dem Streifenwagen. Zwei uniformierte Polizisten saßen vorne. Ständig krächzte der Lautsprecher des Funkgeräts. Mehrmals konnte sie aus dem Gekrächze den Namen ihrer Tochter erkennen. Jasmin Hahne. Negativ. Schulweg. Negativ. Rettungsleitstelle. Negativ. Die beiden Kollegen bringen Sie jetzt zur Kriminalwache im Präsidium, hatte der nette Beamte mit dem Adamsapfel ihr erklärt. Die Adenauerallee war hell erleuchtet. Das Licht spiegelte sich im regennassen Asphalt. Der Post-Tower wechselte ständig die Farbe. Auch die Gebäude entlang der Museumsmeile waren beleuchtet. Das sah schön aus. Sie war noch nie in einem der Museen gewesen.
Der Streifenwagen rollte die Rampe zum Haupteingang des Präsidiums hinauf. Das Präsidium sah aus wie ein Bunker. Die beiden Streifenpolizisten lotsten sie durch endlose Korridore aus grauem Sichtbeton, öffneten schließlich eine Tür, auf der ‹Kriminalwache› stand, ließen ihr den Vortritt und verschwanden. Ein Mann gab ihr die Hand, nannte seinen Namen, den sie sofort wieder vergaß, bot ihr einen Stuhl an und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Er trug keine Uniform, sondern Jeans, so wie sie, und eine moderne Jacke aus ganz weichem Leder, die bestimmt teuer gewesen war. Er war etwa so alt wie sie, schätzte sie. Er war schlank und muskulös. Sie hatte bis zu diesem Augenblick geglaubt, solche netten, sportlichen, gut aussehenden Typen gäbe es nur in den Krimi-Serien im Fernsehen.
Nicht im wirklichen Leben. Und nicht für sie.
«Frau Hahne, die Kollegen von der Citywache haben bereits die Rettungsleitstellen sowie sämtliche Krankenhäuser im Umkreis abgecheckt. Ergebnis negativ. Das ist doch schon mal beruhigend. Ihre Tochter wurde also nicht Opfer eines Verkehrsunfalls. Außerdem haben die Kollegen die Wegstrecken von der Hauptschule zu Ihrer Wohnung sowie vorsichtshalber auch von der Schule zu Ihrer Arbeitsstätte abgefahren. Ebenfalls negativ. Wir werden das aber morgen bei Tageslicht wiederholen. Außerdem werden wir die Ladeninhaber entlang der Wegstrecke und natürlich Mitschüler und Lehrer befragen. Sie haben Grün-Weiß ja schon eine Menge Namen und Adressen zu Protokoll gegeben …»
«Grün-Weiß?»
«’tschuldigung. Das ist hier bei der Kripo unser flapsiger interner Sprachgebrauch für die uniformierte Polizei.»
«Ach so.»
Der Mann sagte nichts. Sie sagte nichts. Der Mann sah sie an, als versuche er, durch ihre Augen bis in den hintersten Winkel ihres Gehirns vorzudringen. Sie wollte nicht, dass er dort etwas fand. Deshalb sagte sie: «Und wie geht es jetzt weiter?»
«Ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen, Frau Hahne. Reine Routine. Einverstanden?»
Er lächelte. Sie nickte stumm. Er fragte sie nach ihrem Alter. 36. Oh, dann sind wir ja ein Alter. Familienstand? Geschieden. Tja, dann haben wir ja noch etwas gemeinsam. Nur Kinder habe ich nicht. Hat sich nicht so ergeben. Gott sei Dank, im Nachhinein betrachtet. Gab es in letzter Zeit Streit zwischen Ihnen und Ihrer Tochter? Nein? Das wäre wichtig zu wissen für uns. Wirklich nicht? Sie können es mir ruhig sagen, Frau Hahne, ist doch normal, bei Kindern in der Pubertät. Wirklich nicht? Könnte es sein, dass Jasmin zu ihrem Vater ist? Nein? Sind Sie sicher? Wir werden das vorsichtshalber überprüfen. Wie heißt er? Wer? Der Vater? Günther. Günther Hahne. Und Sie wissen nicht, wo er wohnt? Hatte, ’tschuldigung, hat Ihre Tochter einen Freund? Nein? Sind Sie sicher? Sie kommt doch langsam in das Alter, wo …
«Ich sagte Ihnen doch: Nein!»
«Gut. Wir werden Sie jetzt nach Hause fahren, Frau Hahne. Wir müssen uns die Wohnung ansehen.»
«Welche Wohnung?»
«Ihre Wohnung, Frau Hahne.»
«Wozu?»
«Das gehört zur Routine. Wir müssen uns ein Bild machen. Außerdem brauchen wir noch ein Foto Ihrer Tochter. Sie haben doch sicher ein Foto?»
Martina Hahne saß auf der Rückbank, der gut aussehende Kriminalbeamte, dessen Namen sie vergessen hatte, am Steuer. Neben ihm saß seine Kollegin, die noch weniger wie eine echte Polizistin aussah. Sie war vielleicht Ende zwanzig, schätzte Martina Hahne, während sie der jungen Frau in den Nacken starrte. Sie hatte eine ungewöhnlich dunkle Haut, die bekam man nicht von der Sonnenbank. Martina Hahne war früher gern ab und zu auf die Sonnenbank gegangen, man sah frischer und gesünder aus. Attraktiver. Jetzt nicht mehr. Jetzt sparte sie für die neue Waschmaschine.
Die Polizistin auf dem Beifahrersitz trug ihre pechschwarzen Haare bleistiftkurz. Das stand nicht jedem. Ihr stand es gut. Weil sie ein schönes Gesicht hatte. Sie trug ebenfalls eine Lederjacke, aber so eine schwere, altmodische, schon ziemlich abgeschabte, wie aus alten Kriegsfilmen, das Leder knarrte richtig, wenn sie sich bewegte. Dazu trug sie diese modernen, olivgrünen Militär-Hosen mit den vielen Taschen an den Beinen, die eigentlich nur ganz schlanke Frauen tragen durften, fand Martina Hahne. Aber diese Frau war nicht superschlank. Sie war aber auch nicht dick. Sie war klein und muskulös. Sie hatte kräftige Oberschenkel. So ein richtiges Kraftpaket. Zu muskulös für eine Frau, fand Martina Hahne. Außerdem trug sie Arbeitsschuhe wie die Männer auf dem Bau. Hätte sie nicht ein so schönes Gesicht gehabt, hätte Martina Hahne sie auf den ersten Blick, wenigstens von hinten, für einen Kerl gehalten. Die Polizistin hatte ein Gesicht wie diese brasilianischen Samba-Tänzerinnen, die sie mal im Fernsehen gesehen hatte. Das schöne Gesicht passte nicht zu ihr, fand Martina Hahne. Und sie fand, die Frau sah aus, als zöge sie noch diese Nacht in den Krieg.
Der gut aussehende Polizist am Steuer versuchte, nett mit seiner Kollegin zu plaudern. Sie ließ ihn ziemlich abblitzen, indem sie nur mit Ja oder Nein antwortete oder gar nicht. Das konnte Martina Hahne nicht verstehen. Sie hätte es gemocht, wenn sich jemand nett mit ihr unterhalten hätte. Vor allem ein so attraktiver Mann. Sie sah den ganzen Tag an der Kasse bei Lidl nur die mürrischen Gesichter der Kunden. Kein einziges nettes Wort. Aber die Frau auf dem Beifahrersitz ließ ihren netten Kollegen andauernd abblitzen, und schließlich sagte auch er nichts mehr.
Sie fuhren durch die menschenleeren Straßen des Dransdorfer Gewerbegebiets, folgten der endlos langen, schnurgeraden Justus-von-Liebig-Straße nach Norden, vorbei an dem Supermarkt, in dem sie arbeitete, vorbei am Gebäudekomplex des Bonner General-Anzeigers. Die Druckerei war hell erleuchtet. Lastwagen warteten vor der Rampe, wie immer nachts.
Sie bogen nach rechts ab, auf die Brücke über die Bahngleise.
Neu-Tannenbusch. Memelweg.
So schnell ging das, wenn man ein Auto hatte.
Die Haustür aus Alu ließ sich nicht mehr schließen, so oft war sie aufgebrochen worden. Ebenso die Hälfte der Briefkästen im Flur. Martina Hahne schämte sich vor den beiden Kriminalbeamten. Sie hatte nicht zum ersten Mal das Gefühl, im hässlichsten Haus der Stadt zu wohnen. Die Miete war billig. Der Aufzug kam nicht. Martina Hahne drückte mehrmals den Knopf. Wahrscheinlich hatte wieder irgendein Schwachkopf in irgendeiner Etage vergessen, die Tür zu schließen. Oder es war ihm egal. Hier war allen alles egal. Vierter Stock.
«Ich glaube, wir müssen zu Fuß gehen.»
Hoffentlich hatte Boris die Wohnung inzwischen nicht wieder in ein Schlachtfeld verwandelt.
«Wo warst du so lange?»
Boris hatte sich im Flur aufgebaut. Sein aggressiver Ton verflog erst, als er sah, dass seine Mutter nicht alleine war.
«Mach sofort die Musik aus, Boris. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Du weckst noch die ganze Nachbarschaft.»
«Wer sind die Leute?»
Bevor Martina Hahne ihrem Sohn antworten konnte, hatte sich der Polizist schon selbst vorgestellt: «Polizei. Guten Abend. Ich bin Kriminaloberkommissar Ludger Beyer. Und das ist meine Kollegin. Kriminalkommissarin Antonia Dix. Ich schlage vor, Sie zeigen mir den Keller, junger Mann, während Ihre Mutter meiner Kollegin die Wohnung zeigt.»
Boris griff sich den Schlüsselbund vom Haken neben der Wohnungstür und ging wortlos voran. Der Kommissar folgte ihm. Martina Hahne zeigte der Kommissarin die Wohnung.
Küche, Bad, das kleine Wohnzimmer, das Zimmer ihres Sohnes und schließlich Jasmins Zimmer.
«Und wo schlafen Sie, Frau Hahne?»
«Im Wohnzimmer. Man kann die Couch ausziehen. Ich kann mir keine größere Wohnung leisten.»
Sie schämte sich, weil die Wohnung nicht aufgeräumt, nicht mal der Frühstückstisch abgeräumt war, aber die Kommissarin sagte nichts, sondern zog sich Gummihandschuhe an, so hauchdünn, dass sie fast schon durchsichtig waren, und untersuchte Jasmins Zimmer, öffnete alle Schubladen, sah sogar unters Bett und hob die Matratze hoch.
«Hat Ihre Tochter ein Tagebuch geführt?»
«Jasmin? Nicht dass ich wüsste.»
«Wer benutzt den Computer im Wohnzimmer?»
«Wir alle. Also meine Tochter. Und ich. Ich hab den mal dem Freund einer Kollegin abgekauft, gebraucht natürlich, ganz billig. Ich dachte, das ist heutzutage wichtig für Kinder, dass sie mit einem Computer aufwachsen, aber Boris, mein Sohn, der hat keinen Spaß daran, der hat’s mehr mit Autos. Wir haben Flatrate, das ist unterm Strich billiger, auch fürs Telefon …»
Sie entschuldigte sich schon wieder. Für was eigentlich? Was ging das die Kommissarin eigentlich an, was sie mit ihrem hart verdienten Geld …
«Frau Hahne, wir werden einen Experten vorbeischicken, der die Festplatte überprüft. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf das Verschwinden Ihrer Tochter. Eine E-Mail beispielsweise, die Aufschluss über ihren Aufenthaltsort gibt. Besitzen Sie ein aktuelles Foto Ihrer Tochter?»
«Sie löscht immer alles. Damit ihr Bruder nichts liest.»
«Frau Hahne, unsere Experten können selbst von einer komplett gelöschten Festplatte vieles rekonstruieren, keine Sorge. Also: Haben Sie ein Foto für mich?»
Martina Hahne ging hinüber ins Wohnzimmer und kramte in den Schubladen ihrer Kommode. Die Kommissarin war ihr gefolgt, wartete aber diskret in der Diele, während Martina Hahne nervös in ihrer Wäsche wühlte. Boris kehrte mit dem Beamten aus dem Keller zurück. Aus dem Augenwinkel beobachtete sie, wie der Polizeibeamte den fragenden Blick seiner Kollegin mit einem Kopfschütteln beantwortete und dann mit Boris in dessen Zimmer verschwand. Schließlich fand sie ein Foto.
«Hier. Ich habe keinen Fotoapparat. Das hat eine Freundin von Jasmin gemacht. Das war kurz vor den Sommerferien. Bei einer Klassenfahrt nach Berlin. Sie ist die Zweite von links.»
Die Kommissarin betrachtete das Foto. Es zeigte vier Mädchen vor dem Brandenburger Tor. Martina Hahne wusste ganz genau, was der Kommissarin jetzt durch den Kopf ging, während sie das Foto studierte. Dass Jasmin im Vergleich zu den drei anderen Mädchen ziemlich herausgeputzt aussah.
Na und? Sie machte eben was aus sich. Warum auch nicht? Besser, als so vergammelt in der Gegend rumzulaufen, wie so viele in ihrem Alter. Aber die Kommissarin kommentierte das Foto nicht. Sondern fragte:
«Frau Hahne, können Sie mir beschreiben, wie Ihre Tochter gekleidet war, als sie heute zur Schule ging?»
«Ich glaube, sie trug ihre neue Jeans. Die hatte sie sich erst letzte Woche gekauft. Knalleng müssen die immer sein und auf der Hüfte sitzen. Der Bund mindestens eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Damit man ihr Piercing sieht.»
«Farbe?»
«Die Jeans?»
«Ja. Frau Hahne. Jedes Detail ist wichtig für uns.»
«Blau. Aber so ganz hell und verwaschen.»
«Gürtel?»
«Ja. Ihren weißen Gürtel. Das ist ihr Lieblingsgürtel. Ein weißer Ledergürtel mit ganz vielen glitzernden Strass-Steinen drauf.»
«Schuhe?»
«Sie trägt immer Schuhe mit hohen Absätzen, damit sie größer wirkt. Schwarz. Nein, warten Sie … das waren die weißen Schuhe. Klar, wegen des weißen Gürtels. Sie hat ein paar weiße Schuhe, ganz spitz vorne, mit Pfennigabsätzen. Ich weiß gar nicht, wie man darauf überhaupt laufen kann, ich könnte das gar nicht.»
Martina Hahne blickte an sich herab und betrachtete ihre vom Regen aufgeweichten Turnschuhe.
«Was trug sie noch?»
«Obenrum hatte sie ein weißes T-Shirt an. Knalleng und bauchfrei natürlich. Alles muss immer knalleng sein. Der Regen kam zwar erst heute Abend, und den ganzen Tag schien die Sonne, aber ich sagte noch, Kind, der Sommer ist vorbei, die Sonne wärmt jetzt nicht mehr so, im Herbst, außerdem hatten die abends vorher im Fernsehen schon Regen gemeldet, im Wetterbericht, nimm wenigstens eine Jacke oder einen Pullover mit.»
«Und?»
«Was und?»
«Hat sie Ihren Rat angenommen?»
«Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie noch schnell einen Pulli in ihre Tasche gestopft. Das macht sie dann manchmal, nur um mich zu beruhigen.»
«Eine Tasche trug sie also auch bei sich?»
«Ja. Die hat sie immer dabei. Sie hat nur die eine.»
«Wie sieht die aus?»
«Rosa. Aus Plastik. Glänzend, wie Lack. So eine große Umhängetasche. Da hat sie auch ihre Schulsachen drin. Die hat sie immer mit, wenn sie unterwegs ist.»
Nun frag mich schon, dachte Martina Hahne. Frag mich schon, warum meine Tochter zur Schule geht wie die Nutten unten am Ende der Siemensstraße zum Straßenstrich. Ich weiß es nicht. Das ist modern so, Mama. Da hast du keine Ahnung von. Und sie, Martina Hahne, war müde; müde und ausgelaugt von den endlosen Diskussionen mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn, abends, wenn sie mit Kopfschmerzen von der Arbeit kam und die Wäsche noch gebügelt, das schmutzige Geschirr gespült, der Teppichboden gesaugt, der Küchenboden wieder mal geschrubbt, das Klo geputzt werden musste.
Aber die Kommissarin fragte nicht. Sondern klappte ihr Notizbuch zu, bedankte sich für das Foto und steckte beides in ihre unförmige Lederjacke.
«Damit wird Ihre Tochter jetzt bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben.»
«Was hat Ihr Kollege denn im Keller gesucht?»
«Frau Hahne, wir erleben die verrücktesten Dinge. Deshalb müssen wir immer alle Eventualitäten in Betracht ziehen und ausschließen. Eine Familie vermisst plötzlich den Großvater. Wir finden ihn im Keller, wo er sich erhängt hat. Eltern vermissen ihr dreijähriges Kind. Wir finden es unter der Küchenbank. Dort hat es sich eine Höhle aus Decken gebaut und schlummert friedlich. Ein Mann vermisst seine Ehefrau. Wir finden sie bei den Nachbarn, wo sie sich festgequatscht und darüber die Zeit vergessen hat. Mein Kollege hat nicht nur im Keller nachgesehen. Er war auch auf dem Dachboden und hat alle Nachbarn aus dem Bett geklingelt.»
«Was? Um diese Uhrzeit? Und was macht er jetzt gerade mit meinem Sohn? Der weiß doch nichts.»
«Er vernimmt ihn. Alle Kontaktpersonen müssen vernommen werden. Das ist Routine. Frau Hahne, ich habe noch eine Bitte. Sehen Sie sich, wenn wir weg sind, in Ruhe nochmal das Zimmer und den Kleiderschrank ihrer Tochter an. Ob etwas fehlt. Ob sie sich zusätzlich Wäsche und Kleidung zum Wechseln in die Tasche gesteckt hat. Ob etwas aus dem Badezimmer fehlt. Ist zum Beispiel ihre Zahnbürste noch da?»
Martina Hahne sah nach. «Ja.»
«Und denken Sie bitte noch einmal in Ruhe darüber nach, ob die Kleidung, die Ihre Tochter zuletzt trug, noch irgendwelche unverwechselbaren Merkmale aufweist. Ebenso die Umhängetasche. Nehmen Sie sich Zeit dafür.»
Martina Hahne nickte geistesabwesend.
In diesem Moment trat der Mann aus dem Zimmer ihres Sohnes und nickte seiner Kollegin zu.
Die Kommissarin gab Martina Hahne ihre Visitenkarte.
«Unter dieser Nummer können Sie mich erreichen. Wir beide haben diese Nacht turnusgemäß zufällig zusammen Dienst auf der Kriminalwache. Mein Kollege Beyer ist eigentlich Drogenfahnder, aber ich gehöre zu dem Kommissariat, das für Sie weiterhin zuständig sein wird. Vermisstensachen. Ich verspreche Ihnen, wir werden Ihre Tochter finden.»
Tot oder lebendig. Martina Hahne sah auf die Visitenkarte, weil sie den Namen der Kommissarin schon wieder vergessen hatte.
Antonia Dix.
Martina Hahne schloss die Wohnungstür hinter den beiden Kriminalbeamten und wartete, bis ihre Schritte im Treppenhaus verhallt waren. Dann drehte sie den Schlüssel zweimal um und ließ ihn von innen im Schloss stecken. Sie trat ans Küchenfenster und schaute zu, wie das Auto, das sie hergebracht hatte, den Wendehammer verließ und die beiden roten Schlusslichter in der Dunkelheit verschwanden. Sie blieb noch eine Weile am Fenster stehen, wartete und rauchte eine Zigarette und starrte in die Dunkelheit. Aber niemand war da unten auf der Straße.
Heute nicht.
Sie ging in die Diele, verharrte dort eine Weile unschlüssig, lauschte, ging zurück in die Küche, setzte sich, bis sie es nicht mehr aushielt. Sie stand auf, räumte den Frühstückstisch ab, spülte das schmutzige Geschirr, sah noch einmal aus dem Fenster, nur vorsichtshalber, dann ging sie erneut in die Diele und öffnete die Tür zum Zimmer ihres Sohnes.
Boris lag auf seinem Bett. Er blickte nicht mal auf.
«Was willst du?»
Der Fernseher lief. Werbung.
«Deine kleine Schwester ist verschwunden, und dich interessiert das überhaupt nicht?»
«Wer ist denn schuld daran, du oder ich? Hast du ihnen wenigstens die Wahrheit gesagt?»
Sie schwieg.
«Wo ist eigentlich mein Fahrrad?»
Seine Stimme klang lauernd. An das Fahrrad hatte sie überhaupt nicht mehr gedacht, seit sie es kurz nach Mitternacht vor der Citywache in der Bornheimer Straße abgestellt hatte.
«Das Fahrrad steht noch …»
«Ja super! Kannst du mir mal verraten, wie ich nachher zur Arbeit kommen soll?»
Er sprang vom Bett auf und war mit zwei langen Schritten bei ihr. Sie sah die Wut in seinen Augen blitzen. Sie hob die Hände schützend vor ihr Gesicht. Er knallte ihr die Tür vor der Nase zu. Sie blieb eine Weile wie erstarrt stehen, das Gesicht keine zehn Zentimeter von der geschlossenen Tür entfernt. Dann schlich sie ins Wohnzimmer, setzte sich auf die Kante der Couch und versuchte vergeblich, die Tränen aufzuhalten.
Jemand schrie.
Sie kamen zu dritt, um ihn zu holen. Er sah sie kommen, aber er konnte sich nicht bewegen. Herbach mit den blauen Augen und dem gefrorenen Lächeln. Die Frau mit der Maske. Und Ricardo, der schöne Ricardo mit der hässlichen Narbe im Gesicht.
Jemand schrie.
Sie öffneten die Tür. Er konnte sich nicht rühren. Er konnte weder Arme noch Beine bewegen.
Sie würden ihn zwingen, sich das Video anzusehen. Dann würden sie ihm fürchterliche Schmerzen zufügen. Und später, viel später, würden sie ihn töten.
Jemand schrie.
Sie wollten seine Kinder. Seinen Sohn und seine Tochter. Aber die hatte er gut versteckt, die würden sie niemals finden.
Deshalb suchten sie ihn.
Es war kalt in dem Keller. Er fror, aber er konnte sich nicht bewegen. Er wusste, was sie mit ihm machen würden.
Sie kamen näher, sie …
Jemand schrie.
Max Maifeld wachte auf. Er hielt sich die Hand vor den Mund und sah sich um. Er war allein. Er war von seinem eigenen Schrei aufgewacht. Von seinem Schrei und von seinem Albtraum.
Auf seiner Stirn stand der kalte Schweiß.
Manchmal ließ ihn die Erinnerung wenigstens nachts in Ruhe. Dann wieder riss ihn der Albtraum morgens vor dem Wecker aus dem Schlaf. Oder mitten in der Nacht. Seit vier Jahren.
Max Maifeld erschrak erneut, als es klingelte, Sekunden später. Aber das war nicht der Wecker. Er sprang aus dem Bett, lief nackt hinüber zum Schreibtisch und schaltete den Monitor ein.
Draußen, drei Stockwerke tiefer, stand Josef Morian auf dem gepflasterten Hof der verlassenen Fabrik vor dem geschlossenen Lastenaufzug. Er hatte den Kragen seines Mantels hochgeschlagen und versuchte vergeblich, sich vor dem Regen zu schützen. Wie lange trug er diesen Mantel schon? Solange sich Max erinnern konnte. Morian schaute mürrisch in die Videokamera über seinem Kopf und machte eine unmissverständliche Geste: Schick endlich den verdammten Aufzug runter. Max drückte den Knopf unter dem Schreibtisch, ging hinüber zum Küchentresen und schaltete die Espresso-Maschine ein. Dann ging er ins Bad, putzte sich die Zähne, rasierte sich unter der Dusche, stellte den Mischhebel auf kalt, ganz kalt, um den Traum abzuschütteln.
Die Frau mit der Maske war tot. Auch der schöne Ricardo mit der hässlichen Narbe war tot. Seit vier Jahren.
Aber Hartmut Herbach lebte.
Irgendwo.
Max Maifeld stieg in die Hose, die er am Abend achtlos neben das Klo hatte fallen lassen, streifte sich das daneben liegende zerknüllte T-Shirt über, schnitt ein paar gymnastische Grimassen vor dem Spiegel und bemühte sich, das wirre Gestrüpp auf seinem Kopf zu bändigen. Dann erst sah er sich in der Lage, Morian vor die Augen zu treten.
«Morgen. Als ich dich das letzte Mal sah, sahst du zehn Jahre jünger aus.»
«Danke. Das letzte Mal war vor drei Wochen. Was hast du in Köln zu suchen?»
Morian schob ihm eine der beiden Schalen mit Milchkaffee über den Küchentisch entgegen. Der Milchkaffee dampfte.
«Das macht der neue Job. Ständig wird irgendwo konferiert und getagt. Mein Kölner Amtskollege möchte mich mal persönlich kennen lernen.» Morian sah auf die Uhr. «Um neun. Ich hab also nicht viel Zeit. Ich wollte nur schnell mal sehen, wie es dir geht.»
«Und? Was siehst du?»
«Einen Mann, der sich aufgegeben hat.»
«Nochmals danke. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung übrigens. Was bist du denn jetzt?»
«Wer hat es dir erzählt?»
«Du weißt doch: Ich kriege alles raus.»
«Früher ja. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.»
«Antonia Dix hat es mir erzählt.»
«Antonia, hätte ich mir denken können. Die gute Seele. Also: Bisher war ich Kriminalhauptkommissar und Leiter der Bonner Mordkommission. Seit 1. September bin ich Erster Kriminalhauptkommissar und außerdem Dienststellenleiter des KK 11, Tötungsdelikte, Brandstiftung, Sexualdelikte, Vermisstensachen. Und nebenbei immer noch Leiter der Mordkommission, die Bestandteil des KK 11 ist.»
«Alle Achtung, Jo. Erster Kriminalhauptkommissar Josef Morian. Hört sich gut an. Da fällt mir ein, ich hatte damals in Sarajewo mal mit einem Kerl von der deutschen Botschaft zu tun, auf dessen Visitenkarte stand: Vortragender Legationsrat Erster Klasse. Das klingt noch einen Zacken schärfer, finde ich. Gibt’s denn wenigstens richtig Kohle für die Mehrarbeit?»
«Keinen Pfennig. Die Besoldungsgruppe hat sich nicht geändert. Immer noch A13. Das war’s jetzt bis zur Pensionierung. Wann willst du endlich dein Problem lösen, Max?»
«Was für ein Problem?»
«Du weißt genau, was ich meine.»
«Im Moment verhält er sich ruhig. Er scheint mich tatsächlich vergessen zu haben.»
«Max, er vergisst nie. Herbach wird dich nie vergessen. Egal, wo er sich aufhält auf diesem Planeten. Eines Tages will er seine Rache. Er hat Geld, und er hat Zeit. Du hast deine Kinder seit vier Jahren im Ausland versteckt, du haust unter dem verlausten Dach dieser verkommenen Industriebrache wie in einem apokalyptischen Hochsicherheitstrakt, du ziehst dich immer mehr aus der Welt zurück, du hast kein Geld mehr, du …»
«Hör endlich auf damit, Jo. Bist du deshalb gekommen? Um mir eine Moralpredigt zu halten?»
Morian erhob sich schwerfällig von seinem Stuhl und hängte sich den Trenchcoat über die Schulter. «Danke für den Kaffee. War nett, mit dir zu plaudern. Grüß Hurl von mir.» Dann verschwand er mit dem rumpelnden Lastenaufzug nach unten, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Max trat an das Fenster in der Gaube, die einst den Flaschenzug für die Maschinenteile beherbergt hatte, und ließ den Blick über die Scheddächer der ehemaligen Draht-Seilereien und Walzwerke und über die verrosteten Gleise des stillgelegten Güterbahnhofs schweifen. Die Fabrik war Ende des 19. Jahrhunderts aus solidem Backstein gebaut worden und stand wie so viele Fabriken in Köln-Mülheim seit Jahrzehnten leer. Zwischen Schanzenstraße, Keupstraße und Carlswerkstraße hatten einmal 40000 Menschen gearbeitet. Jetzt waren es noch 400.
Seit Beginn der Industrialisierung waren hier aus feinem Draht bis zu faustdicke Seile gedreht worden, aus Eisen und aus Stahl, aus Kupfer, aus Palladium oder aus anderen Edelmetallen, für den Bau von Spannbeton- und Hängebrücken, für die Oberleitungen der Eisenbahn und der Straßenbahn, für Hochspannungsleitungen und für Telegraphen-Verbindungen und für das unterseeische Transatlantik-Telefonkabel zwischen Europa und Amerika.
Dann kamen die Satelliten und der drahtlose Funkverkehr und die Globalisierung, Felten & Guillaume hieß plötzlich «nkt cables», produziert wurde seither billiger in Polen und in China, und Boomtown Mülheim war jetzt ein sozialer Brennpunkt von inzwischen bundesweiter Bekanntheit, seit dort vor einem türkischen Friseurladen eine Nagelbombe hochgegangen war.
22 Menschen wurden schwer verletzt. Ausnahmslos Türken. 90 Prozent der Bewohner der Keupstraße waren Türken. Und 100 Prozent der Geschäftsinhaber. Wie durch ein Wunder wurde bei der Explosion niemand getötet.
Wie eine zuckersüße Zukunftsverheißung priesen die Kölner Kommunalpolitiker den Umstand, dass einige der Backsteinbauten zu Tempeln der modernen Event-Kultur umgerüstet worden waren. Im ‹E-Werk› stand David Bowie auf der Bühne, im ‹Palladium› stellte DaimlerChrysler die neue E-Klasse vor, Harald Schmidt sendete aus dem ‹Studio 449›, gleich um die Ecke ging Viva hinter neonblauer Reklame auf Sendung, und die Gag-Factory-Denkarbeiter von ‹Brainpool› und ‹Bonito TV› fühlten sich ebenfalls von der Geisterstadt aus Backstein inspiriert.
Zum Totlachen.
Max stand regungslos in der Gaube und beobachtete durch das Fenster Morian, wie er sich auf dem Weg zum Auto immer wieder nach allen Seiten umschaute. Polizistenblick. Wie er umständlich in seinen vergammelten, verrosteten Volvo Kombi kletterte und über das Kopfsteinpflaster des Hofs davonrollte. Warum hing Morian nur so an diesem Schrotthaufen? Weil der Volvo ihn an sein früheres Leben erinnerte? Als Ehemann und Familienvater. Die Morians. Max hatte ihn stets um seine schöne, kluge Frau beneidet. Morian hatte wieder zugenommen, fand Max. Hurl versuchte immer mal wieder und stets vergeblich, ihn zum Sport zu überreden. Morian war mal ein verdammt guter Amateurboxer gewesen. Halbschwergewicht. Das war lange her. Als Max Maifeld noch als Reporter arbeitete.
In einem früheren Leben.
In einem früheren Leben hatten die größten Fabrikgebäude im Revier die Grundmaße mehrerer Fußballfelder. Das vermutlich kleinste im Revier hatte Max Maifeld gemietet. Es war von der Carlswerkstraße aus gar nicht zu sehen. Genau deshalb hatte er es gemietet. Vom Inhaber des türkischen Reisebüros in der Keupstraße. Man musste erst das weitläufige und verwinkelte Areal der ‹Future-Factory› passieren, die in kostspielig restaurierten Lofts gut ein Dutzend Software-Unternehmen und IT-Firmen beherbergte, die nun ‹intelligente Lösungen› feilboten, so wie früher Felten & Guillaume seine Kabel.
Er hatte zunächst die Zufahrt gerodet, bis das Kopfsteinpflaster unter dem Gestrüpp wieder sichtbar wurde, die zersprungenen Scheiben in den gewaltigen Sprossenfenstern ersetzt, auf dem Dachboden eine Heizung eingebaut, die Versorgungsleitungen erneuert und den Lastenaufzug reparieren lassen. Die zweigeschossige Halle unter dem Dachboden ließ er unberührt, und auch von außen wirkte das Gebäude weiterhin verlassen. Das war gut so. Niemand wusste, dass er hier oben hauste. Außer seinem türkischen Vermieter.
Und Morian. Und Hurl.
Es regnete nicht mehr.
Und Herbach?
Nur eine Frage der Zeit.
Vor vier Jahren hätten sie ihn beinahe zu Fall gebracht. Den mächtigen Drahtzieher des größten Pädophilen-Rings Europas. Ihn und seine Todfreunde. Hartmut Herbach konnte sich noch rechtzeitig nach Lateinamerika absetzen. Seine Spur verlor sich damals in Santiago de Chile.
Morian hatte völlig Recht: Herbach vergaß nie. Er war ein Soziopath. Ein charmanter Plauderer mit geschliffenen Umgangsformen. Ein Mensch ohne Empathie.
Ein seelenloses Monster.
Er hatte Rache geschworen. Max Maifeld hatte zunächst seine Kinder in Sicherheit gebracht. Seine Tochter Vera studierte unter falschem Namen und mit gefälschten Papieren in Amsterdam, sein Sohn Paul besuchte ein College in den USA und lebte dort bei Hurls Cousin. Und Max war zunächst für zwei Jahre in Spanien untergetaucht, hatte sich unsichtbar gemacht, in einem gottverlassenen Dorf am Rande Europas gelebt. Bis er dort seine wohl gehütete Anonymität aufgeben musste, um eine vermisste Frau zu suchen, und prompt jede Menge Scherereien bekam. Und eines Tages Post. Von Herbach.
Verehrter Herr Maifeld:
Schön, dass ich Sie endlich gefunden habe.
Bis bald. Ich freue mich.
Ergebenst, Ihr HH
Am nächsten Morgen hatte Max Maifeld das Dorf im wilden Nordwesten der Insel Fuerteventura, in dem er sich so lange so sicher gefühlt hatte, verlassen. Seither lebte er wieder in Köln. Und hoffte inständig, dass Hurl in der Nähe sein würde, wenn Herbachs Killerkommando ihn aufspürte.
Max Maifeld.
45 Jahre alt, geschieden. Bisherige berufliche Stationen: erfolgreicher Polizeireporter, gefeierter Kriegsreporter, erfolgreicher Privatdetektiv, Spät-Hippie auf Zeit, neuerdings Penner auf Lebenszeit. Steile Karriere. Und vielleicht bald tot.
Was hatte er aus seinem Leben gemacht?
Was hatte Herbach mit seinem Leben gemacht?
Max Maifeld machte sich einen Kaffee.
Morian hatte Recht.
Er musste Herbach stoppen, bevor der ihn stoppte.
Für immer.
Er hatte nicht die blasseste Ahnung, wie er das anstellen sollte.
Der Kölner Kollege stand unmittelbar vor der Pensionierung, war als Dienststellenleiter im Gegensatz zu Morian nicht zugleich in Personalunion auch noch Leiter der Mordkommission, sondern hatte seine Leute für die Frontarbeit – und langweilte sich ganz offensichtlich auf seine letzten Tage. Da er aber ein netter älterer Herr war, behielt Morian seinen Entschluss, den er soeben gefasst hatte, für sich: dass er künftig nicht mehr gewillt sein würde, auf diese Weise seine Zeit zu verschwenden. Es gab angenehmere Möglichkeiten, seine Zeit zu verschwenden. Um aber den netten älteren Herrn, der sich schon so sehr auf die baldige Pensionierung freute, nicht unnötig zu verärgern, bewunderte Morian pflichtschuldig sein schönes Büro im obersten Stockwerk des schicken Neubaus des Kölner Hauptquartiers mit beeindruckender Sicht auf den Rhein und den jenseits des Flusses aufragenden gotischen Dom, ließ sich lobende Worte darüber entlocken, dass die Kölner Polizeiführung regelmäßig Kölner Nachwuchskünstler mit Ausstellungen im Foyer des neuen Präsidiums förderte, und unterdrückte sogar sein Stirnrunzeln angesichts eines grün und orange lackierten sowie mit Vogelfedern beklebten Besenstiels, der einsam an einer Wand neben dem Informationsschalter lehnte. Morian wollte erst gar nicht wissen, was der junge Künstler ihm wohl damit sagen wollte.
Nach anderthalb Stunden lenkte er den Volvo zurück nach Bonn. Er hatte schon die Klinke der Tür seines Büros in der Hand, als eine Stimme ihn aufhielt.
«Josef? Kannst du mal kommen?»
Niemand nannte ihn Josef. Auch die Kollegen im Bonner Präsidium, die ihn duzten, nannten ihn beim Nachnamen. Morian. Manche nannten ihn Jo. Zum Beispiel Max. Und Hurl. Und die Kumpels aus seinem früheren Boxsportverein. Und seine Ex-Frau. Aber niemand nannte ihn Josef.
Außer Antonia Dix.
«Bitte. Ich brauche deine Hilfe, Josef.»
Dann musste es wichtig sein. Antonia Dix bat höchst selten und höchst ungern um Hilfe.
In ihrem Büro saßen auf den beiden Besucherstühlen vor ihrem Schreibtisch ein Mann und eine Frau und hielten sich bei der Hand. Eine Geste, die man bei Paaren dieses Alters nicht allzu oft beobachten konnte. Fand Morian. Sie waren schätzungsweise Mitte vierzig und ihrem Äußeren nach zu urteilen gebildete Leute aus der oberen Mittelschicht. Akademiker. Die Frau hielt den Blick gesenkt und hatte verweinte Augen.
«Josef, das sind …»
Der Mann sprang auf, bevor Antonia Dix den Satz zu Ende bringen konnte, und streckte Morian die Hand entgegen. Er wirkte fahrig und nervös.
«Dr. Walter Wagner. Das ist meine Frau. Dr. Ruth Wagner.»
«Angenehm. Josef Morian.»
«Sie sind der Leiter dieser Dienststelle?»
«Ja. Was kann ich für Sie tun?»
«Josef, ihre Tochter ist …»
«Unsere Tochter ist verschwunden. Seit gestern schon. Wir hatten deshalb gestern Abend die Polizeiwache in Beuel aufgesucht. Wir wohnen im Siebengebirge, aber da gibt es ja schon seit geraumer Zeit keine Wache mehr, die abends besetzt ist. Schon seit Jahren nicht mehr. Als ob wir Bürger zweiter Klasse wären. Also fuhren wir zur nächstgelegenen Wache nach …»
«Das war sehr vernünftig von Ihnen.»
«Mag sein. Allerdings hatten wir nicht den Eindruck, dass dort und anschließend seitens der Kriminalwache hier im Präsidium alles getan wurde, um unsere Tochter zu finden.»
Morian registrierte aus den Augenwinkeln den völlig entnervten Blick seiner Mitarbeiterin. «Hattest du nicht gestern Abend Nachtdienst in der Kriminalwache? Und wenn ja, wieso bist du dann eigentlich schon wieder hier?»
«Weil sich die Arbeit auf meinem Schreibtisch nun mal nicht von alleine erledigt. Außerdem bin ich erst vor einer halben Stunde gekommen, quasi gleichzeitig mit dem Ehepaar Wagner. Ja, ich hatte Nachtdienst. Diese Nacht war die Hölle los, wir hatten acht Einbrüche, eine Massenschlägerei, eine Fahrerflucht, eine versuchte Vergewaltigung und zwei Hausverbote gegen gewalttätige Ehemänner. Ich war gerade mit Beyer draußen, in einer anderen Vermisstensache, draußen in Neu-Tannenbusch, in der Zeit haben sich die Kollegen um die Wagners gekümmert, sagt der Computer, aber im Computer ist auch ersichtlich, dass alles korrekt gelaufen ist, die ganze Maschinerie ist angelaufen, ich weiß wirklich nicht, was …»
Morian unterbrach sie mit einer Handbewegung und wandte sich wieder dem Ehepaar Wagner zu.
«Dürfte ich Sie bitten, einen Moment draußen zu warten?»
Der Mann und die Frau starrten ihn ungläubig an.
«Bitte. Es dauert auch nicht lange. Nur ein paar Minuten. Ich möchte mich nur zwei Minuten mit meiner Kollegin alleine besprechen. Bitte nehmen Sie solange draußen auf der Bank im Flur Platz. Danke.»
Sie folgten nur widerwillig seiner Bitte. Aber sie spürten, dass dieser Mann im Augenblick keine Widerrede duldete.
Morian schloss die Tür.
Antonia Dix verschränkte die Arme, Trotz im Blick.
Morian setzte sich auf einen der beiden Besucherstühle, beugte sich vor, stützte seine Unterarme auf ihren Schreibtisch und verschränkte die Hände wie zum Gebet.
«Antonia, du bist eine gute Polizistin. Du machst hier einen richtig guten Job. Wir alle machen hier unseren Job. Mehr oder weniger gut. Wir versuchen, unser Bestes zu geben. Bitte merke dir: Für Eltern, die ihr Kind vermissen, ist das nie gut genug. Nie. Das ist ein Naturgesetz. Verstanden?»
Antonia Dix nickte. Sie hatte begriffen, was er ihr damit sagen wollte. Sie begriff immer sehr schnell.
«Antonia, Eltern von vermissten Kindern sind verzweifelt, verängstigt, außerdem geplagt von Schuldgefühlen. Sie verzeihen sich nicht, ihr Kind noch am Vortag angeraunzt zu haben, ihm etwas verboten zu haben, ihm nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Ihr schlechtes Gewissen nagt an ihren Nerven. Oft grundlos, aber das spielt keine Rolle. Sie würden diese Selbstzweifel übrigens uns gegenüber niemals zugeben. Sie haben plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen. Ihr Wertesystem, ihr kompletter, sorgsam zusammengezimmerter Lebensentwurf bricht plötzlich wie ein Kartenhaus zusammen. Dann werden sie ungerecht uns gegenüber, manchmal sogar richtig eklig, weil sie nach jedem Strohhalm greifen, und sei es der Strohhalm der Wut. Und je höher ihr sozialer Status und ihr Bildungsgrad, desto schwieriger wird die Zusammenarbeit.»
«Ich habe verstanden.»
«In diesem Fall ist es auch noch ganz offensichtlich so, dass Herr Wagner seine Frau beschützen will, weil er sie für zu schwach hält, das durchzustehen. Also markiert er den Macher, den Weltmann, der stets Herr der Lage ist. Das hilft ihm, mit seiner Ohnmacht und seiner Verzweiflung klarzukommen.»
«Ich sagte doch: Ich habe verstanden.»
«Gut. Dann verschaff mir jetzt bitte rasch ein Bild, bevor die Wagners da draußen im Flur durchdrehen und zum Polizeipräsidenten durchmarschieren.»
«Dr. Walter Wagner, 44 Jahre alt, Chemiker, leitender Angestellter bei Bayer in Leverkusen. Dr. Ruth Wagner, 42 Jahre alt, promovierte Germanistin, arbeitete bis zur Geburt ihres ersten Kindes in der Erwachsenenbildung, seither Hausfrau. Sie sind seit 15 Jahren verheiratet. Drei Kinder. Der Jüngste, Lukas, ist drei Jahre alt, die Mittlere, Katharina, gerade zwölf geworden, und Anna, die Älteste, ist 14 Jahre alt. Anna ist verschwunden.»
«Seit wann genau?»
«Seit gestern. Sie besucht das Thomas-Morus-Gymnasium in Königswinter. Ein christlich orientiertes Privatgymnasium …»
«Sagtest du Thomas Morus?»
«Ja. Kennst du das?»
«Meine Kinder gehen dort zur Schule.»
«Oh. Ich wusste gar nicht, dass du so religiös bist.»
«Die Schule ist nicht religiös in dem Sinne. Sie vermittelt nur ein christliches Wertesystem. Solidarität statt Ellbogen und so. Rücksichtnahme auf Schwächere und Benachteiligte. Die Schule fördert Hochbegabte genauso wie Legastheniker. Dagegen ist ja wohl nichts einzuwenden.»
«Natürlich nicht. Sei nicht gleich eingeschnappt. Ich bin nur ein bisschen ausgebrannt, nach der Nacht. Jedenfalls: Nach Schulschluss um eins fuhr sie nicht wie an den anderen Tagen der Woche mit dem Bus nach Hause, hinauf in das idyllische Dörfchen Ittenbach im Siebengebirge, sondern aß wie immer donnerstags in der Mensa der Schule zu Mittag und machte anschließend ihre Hausaufgaben im Aufenthaltsraum unter Aufsicht eines Betreuungslehrers. Denn um 16 Uhr begann, wie immer donnerstags, die Schreibwerkstatt, das ist eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Literatur-AG für besonders begabte Nachwuchsautoren, geleitet von Annas Deutschlehrerin. Danach verliert sich ihre Spur. Die Schreibwerkstatt geht immer zwei Stunden, bis 18 Uhr. Dann hätte sie normalerweise eine halbe Stunde später, um 18.30 Uhr, den Bus hinauf ins Siebengebirge genommen.»
«Und?»
«Hat sie aber nicht. Die anderen Kollegen vom Nachtdienst haben das schon überprüft. Der Fahrer schwört Stein und Bein, dass sie nicht im Bus saß.»
«Daraufhin haben sich die Wagners also am frühen Abend bei der Wache in Beuel gemeldet …»
«Nein. Denn ungefähr um 18.15 Uhr hatte Anna Wagner von ihrem Handy aus ihre Mutter angerufen und ihr mitgeteilt, sie säße bereits im Bus, würde aber anschließend nicht gleich nach Hause kommen, sondern in Ittenbach in der Nachbarschaft noch eine Freundin besuchen. Am nächsten Tag, also heute, ist schulfrei. Lehrerkonferenz. Weil Anna hätte ausschlafen können, erlaubte die Mutter ihr, bis 22 Uhr bei der Freundin bleiben zu dürfen. Nur: Anna ist erst gar nicht bei der Freundin aufgetaucht, und die Kollegen schreiben, so steht es jedenfalls im Computer, der Busfahrer wirke absolut vertrauenswürdig. Das hieße also mit anderen Worten: Anna hat ihre Mutter belogen.»
«Sie saß also gar nicht in dem Bus. Sie hatte was anderes vor, was ihre Eltern nicht wissen durften. Das streiten die Wagners natürlich ab, nehme ich an. Unsere Tochter tut so etwas nicht, unsere Tochter lügt uns nicht an.»
«Genau. Inzwischen war Walter Wagner von der Arbeit zurück. Er arbeitet immer sehr lange. Um 22.30 Uhr begannen sie sich Sorgen zu machen. Sie riefen die Mutter von Annas Freundin an. Dann fuhr Walter Wagner alleine zur Polizei, zur Wache nach Beuel. Ganz schöne Strecke, wenn man Angst um sein Kind hat. Um 23.17 Uhr traf er dort ein.»
«Danke, Antonia.» Morian erhob sich. «Dann wollen wir die Wagners mal wieder hereinbitten.»
«Moment noch.» Antonia Dix schob ein Foto über den Schreibtisch. «Heute fand Ruth Wagner das hier im Briefkasten. In einem weißen Briefumschlag, zusammen mit einem Gedicht von Anna. Ziemlich deprimierend. Das Gedicht, meine ich. Es geht nur um Tod und Sterben und so. Die Eltern sind sich sicher, dass es von ihr stammt. Sie schrieb wohl andauernd solche Sachen. Das hier ist eine gescannte Kopie des Fotos, die ich auf die Schnelle gemacht habe. Das Original habe ich bereits an den Erkennungsdienst weitergegeben, zusammen mit dem Gedicht und dem Umschlag. Vielleicht finden die noch Fingerabdrücke, auch wenn die Eltern alles inzwischen schon tausend Mal angefasst haben. Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte?»
Morian setzte sich wieder und betrachtete das Foto.
«Ist das Anna?»
«Ja.»
Das Foto zeigte ein hübsches Mädchen. Ihr Blick war ernst. Viel zu ernst für eine 14-Jährige, fand Morian. Das Foto zeigte das Mädchen im Profil. Ihr Blick war seltsam abwesend, als nähme sie den Fotografen gar nicht wahr. Sie trug eine schwarze Cordhose und einen schwarzen Pulli und hielt eine schwarze Regenjacke in der Hand. Ihre Schuhe konnte Morian nicht sehen. Denn das Mädchen stand bis zu den Knien im Wasser.
«Josef? Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte?»
Antonia Dix war erst vor zwei Jahren von Köln nach Bonn umgezogen. Aber Josef Morian kannte jeden Winkel seiner Heimatstadt. Er war hier geboren und aufgewachsen. Er hatte Bonn noch nie länger als zwei Wochen verlassen.
«Sieht aus wie ein Urwald, Josef.»
«Das sieht nicht nur so aus, Antonia. Das ist ein Urwald.»
Die Auenlandschaft war unverwechselbar. Pappeln, Weiden, Schwarzerlen. Durch den Urwald schlängelte sich träge ein Fluss. Im Lauf der Jahrhunderte hatte er immer wieder seine Richtung geändert und Dutzende Altarme hinterlassen. Sie waren als Jungs oft mit dem Rad dorthin gefahren, um Cowboy und Indianer zu spielen. Oder Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Oder Tarzan. Sie hatten Baumhäuser gebaut und Flusskrebse gefangen und Krabbenspinnen, die wie Chamäleons ihre Farbe wechseln konnten. Weiß. Braun. Rot. Grün. Gelb. Sie hatten die Graureiher und Eisvögel beim Fischfang beobachtet. Sie hatten ein Schlauchboot im Unterholz deponiert und sich manchmal ein Floß aus Treibholz gebaut. Sie hatten stets davon geträumt, am Ende des Flusses einen Schatz zu finden, eines Tages, und zugleich gefürchtet, auf gefährliche Piraten zu treffen. Oder auf einen Eingeborenenstamm, der sie mit Pfeilen und Speeren empfing, sie gefangen nahm und sie marterte. Sie hatten es geliebt, für ein paar Stunden in ihrer abenteuerlichen Phantasiewelt zu leben und die langweilige Realität der Erwachsenenwelt auszusperren.
«Josef! Sag doch mal was.»
Auf dem Foto wirkte der Fluss viel kleiner als in den unlöschbar in seinem Gedächtnis verankerten Erinnerungen seiner Kindheit. Aber er machte ihm jetzt zum ersten Mal Angst.
«Josef?»
«Lass uns fahren. Ich brauche einen Rettungswagen, einen Notarzt, eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, die Hundestaffel und den Erkennungsdienst. Aber die können wir noch von unterwegs aus alarmieren. Halt! Ruf zuerst noch den Polizeipsychologen an. Er soll sich um die Wagners kümmern. Sag ihm, es ist ein Notfall. Er soll sofort kommen und sie hier unten abholen und mit ihnen in die Kantine gehen oder so. Ich geh schon mal raus auf den Flur und rede mit ihnen.»
«Josef, was ist los? Wo ist sie?»
«Später, Antonia. Ruf den Psychologen an. Mach schon. Wir treffen uns draußen.»
Morian schloss die Bürotür hinter sich. Die Wagners erhoben sich von der Bank im Flur.
«Bitte bleiben Sie doch ruhig sitzen.»
Morian sah die Angst und die Hoffnung in ihren Augen. Was sollte er ihnen sagen?
Miguel war sofort dran. Max Maifeld hatte Miguels Sekretärin vor einer Stunde ausgerichtet, dass er noch einmal anrufen würde, sobald Miguel von seinem gewohnten mittäglichen Spaziergang zu seinem Lieblingscafé an der Gran Vía zurückgekehrt sei.
«Wie geht es dir, Max?»
«Danke, es geht so. Mas o menos. Ich brauche deine Hilfe.»
«Kein Problem. Que pasa?»
Kein Problem. So war Miguel. Sie hatten sich vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen. In Madrid. Auch da war Miguel sofort gekommen, ohne überflüssige Fragen zu stellen.
Das vorletzte Mal hatten sie sich auf dem Flughafen von Bogotá in die Augen geschaut. Das war vor zwölf Jahren. Miguel wurde auf einer Krankenbahre und in Begleitung eines Arztes sowie eines ranghohen Diplomaten der spanischen Botschaft in Kolumbien in ein Flugzeug verfrachtet, das ihn zurück in seine Heimat brachte. Miguel war noch sehr jung gewesen damals, Mitte zwanzig, ehrgeizig und hitzköpfig, er hatte Biss, und er hatte sich in den Kopf gesetzt, eine Reportage über die üblen Machenschaften des Medellín-Kartells zu schreiben.
Ein Job für Lebensmüde.
Max Maifeld hatte ihm das Leben gerettet.
Die Knochenbrüche waren schnell verheilt, ebenso die Prellungen und Blutergüsse an Miguels Hoden und die Verbrennungen auf seiner Haut. Aber der kleine Finger seiner rechten Hand fehlte seither und würde ihn für den Rest seines Lebens an seine journalistischen Anfänge erinnern. Seither beschäftigte sich Miguel nicht mehr mit dem internationalen Kokainhandel, sondern in der Madrider Zentralredaktion von El País mit spanischer Innenpolitik.
«Ist euer Informantennetz in Lateinamerika immer noch so legendär wie damals?»
«Max! Willst du mich beleidigen? Du weißt doch: Madrid ist seit den Conquistadores die Hauptstadt Lateinamerikas. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Allerdings: Auch unsere Zeitung leidet unter der Konkurrenz des Internets … nicht was den redaktionellen Teil betrifft, sondern auf dem Anzeigensektor. Aber weil wir nun mal wie alle anderen Zeitungen dieser Welt von den Anzeigen leben, hat es auch bei uns Kostenreduzierungen in der Redaktion gegeben. Auch, was die Zahl unserer Auslandskorrespondenten betrifft. Aber unser Netz in Lateinamerika ist immer noch beneidenswert. Max, wer hätte das gedacht, dass wir Journalisten mal um jeden Gebrauchtwagen trauern, der nicht bei uns inseriert wird, sondern im Internet. Wir sind übrigens gerade dabei, eine neue Strategie zu …»
«Miguel, kannst du mir helfen?»
«Natürlich, Max. Ich schweife ab. Meine Kollegen nennen mich schon den Professor, weil ich dauernd doziere. Wie im Hörsaal. Eine Marotte. Wahrscheinlich das Alter. Stell dir vor, ich werde bald vierzig. Meine Güte. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Ich freue mich, dir etwas zurückgeben zu können, Max. Mich erkenntlich zeigen zu können für …»
«Miguel! Du bist mir nichts schuldig.»
Dann sagte Max ihm, welche Art von Hilfe er benötigte.
Von der Quelle am Rothaarkamm im Siegerland benötigte die Sieg exakt 131 Kilometer bis zu ihrer Mündung in den Rhein knapp jenseits der nördlichen Bonner Stadtgrenze – eine der letzten völlig naturbelassenen Nebenfluss-Mündungen des Rheins, reich an seltenen Wildpflanzen und ein Paradies für Vögel, weshalb man das Areal inklusive der Altarme 1986 unter Naturschutz stellte. Seither war es verboten, dort Baumhäuser zu bauen und Flusskrebse zu fangen und Krabbenspinnen zu ärgern. Allerdings hatte Josef Morian ohnehin den Eindruck, dass die meisten Kinder inzwischen ihre Abenteuer lieber vor dem Fernseher oder vor dem Computer erlebten.
Das einzige störende Element weit und breit in dieser urwüchsigen Idylle waren die grauen Stelzen der Betonbrücke der L 269, die den Fluss und den Rand des Naturschutzgebietes überspannte und Bonn mit dem einstigen Fischerdorf Mondorf verband – abgesehen von der Motorlautstärke des Kleinwagens, der soeben ungeachtet der erlaubten Höchstgeschwindigkeit mit Vollgas über die Brücke jagte.
«Gleich hinter der Brücke biegst du nach rechts ab, dann gleich wieder rechts, unterquerst diese hässliche Brücke und folgst der Beschilderung zum Fährhaus. Vielleicht könntest du den Bremsvorgang so rechtzeitig einleiten, dass ich nicht mit der Stirn gegen die Windschutzscheibe schlage.»
Antonia schaltete zurück und ließ den Motor des Minis aufjaulen. Morian hoffte inständig, jemals wieder heil aus den tiefen Schalensitzen zu kommen.
«Fährst du immer so schnell?»
«Nur wenn ich es eilig habe.»
«Wie schnell ist diese Kanonenkugel eigentlich?»
«Das ist ein Cooper S. 7,2 Sekunden von null auf 100. Spitze 220 laut Werksangaben. Ich hatte ihn allerdings auch schon mal auf 225. Aber das Beste ist die Kurvenlage. Wie ein Gokart. Nicht übel, oder?»
Morian war übel. Antonia stoppte neben dem Fährhaus. Sie waren die Ersten. Was Morian nicht wunderte. Bevor er aus dem engen Wagen geklettert war, hatte Antonia Dix bereits von außen die Heckklappe des Wagens geöffnet und ihre Schuhe gegen ein paar olivgrüne Gummistiefel aus dem Kofferraum getauscht.
«Was ist das hier, Josef?»
«Das Fährhaus ist eine Gaststätte. Hier legen im Sommer Wanderer und Radfahrer und Kanuten gerne eine Rast ein. Saisongeschäft. Bei Hochwasser guckt nur noch die Dachspitze aus der Sieg. Dann ist hier alles überschwemmt. Kilometerweit. Hier gibt es übrigens noch eine interessante Möglichkeit, den Fluss trockenen Fußes zu überqueren.»
Antonia Dix bemerkte erst jetzt den gut zehn Meter langen, fast zwei Meter breiten, eigenartig eckigen und altertümlichen Kahn am Ufer. Morian folgte ihrem Blick.
«Das ist die einzige Ein-Mann-Gierfähre Deutschlands. Siehst du die riesige Ruderpinne am Heck? Sie ist fast so lang wie der Kahn selbst. Der Fährmann benötigt großes Geschick und viel Erfahrung, um ohne Motorkraft und nur mit Hilfe der Strömung überzusetzen. Der Kahn ist fast sechzig Jahre alt, der Fährmann über siebzig. Seit vierzig Jahren macht er den Job. Seit ihn sein Vater nicht mehr macht. Wahrscheinlich sitzt er jetzt drinnen im Fährhaus. Wärmt sich auf und wartet auf Kundschaft. Von September bis April ist hier wochentags nichts los.»
«Dann schlage ich vor, du setzt über und nimmst dir die andere Seite vor, und ich marschiere auf dieser Seite des Flusses.»
«Wir werden überhaupt nicht marschieren. Wir warten jetzt hier auf die Einsatzhundertschaft.»
«Dann warte du. Mich macht Warten nervös.»
Sie stapfte los, Richtung Mündung, überhörte sein verärgertes Rufen. Sie wusste, es war gegen die Vorschrift, alleine loszugehen. Ein Polizeibeamter geht niemals alleine. Erster Lehrsatz auf der Polizeischule. Denn hinter dem nächsten Baum konnte nicht nur ein Opfer auf Hilfe warten, sondern auch der Täter mit einer tödlichen Waffe.
Das Fährhaus war längst außer Sichtweite. Antonia Dix hörte in ihrem Rücken Martinshörner über die Brücke jagen. Endlich. Die Einsatzhundertschaft. Wurde auch Zeit.
Ein Vogel flatterte aus der Kopfweide vor ihr, entsetzt über den Eindringling. Josef hatte Recht. Wie immer. Vielleicht war genau das ihr Problem. Dass er immer Recht hatte. Natürlich war es richtig, auf die Einsatzhundertschaft zu warten und ihnen den Weg zu weisen. Und im Gegensatz zu ihr wusste Morian auch ganz genau, wo sie suchen mussten.
Was sie hier machte, wie sie hier in ihren Gummistiefeln durch den Morast stapfte, das war absoluter Irrsinn.
Das dumpfe Gebell der Hunde drang gedämpft von weit weg bis zu ihr durch, übertönt vom Gurgeln und Plätschern des Flusses neben ihr, vom Zwitschern der Vögel über ihr, vom Knacken der Äste und Zweige unter ihren Füßen. Antonia Dix kannte das Schauspiel, wenn die Hunde aus ihren vergitterten Verschlägen im Kofferraum der Kombis gelassen wurden. Sie waren angespannt, erregt, hyperaktiv, wie immer vor einem Einsatz. Jede Hundestaffel verfügte über eine Reihe völlig unterschiedlich ausgebildeter Tiere. Absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet. Schutzhunde, die Flüchtige verfolgen oder Messerstecher stoppen konnten. Dann die Spürhunde, wiederum unterschiedlich ausgebildet. Sie waren entweder spezialisiert auf Fährten. Oder auf das Aufspüren von Drogen. Oder Sprengstoff.
Oder Leichen.
In diesem Moment spürte Antonia Dix sehr deutlich, dass sie überhaupt nicht spezialisiert auf das Aufspüren von Leichen war. Je weiter sie durch das dichte Gestrüpp in den Urwald vordrang, desto mehr schnürte sich ihr die Kehle zu.