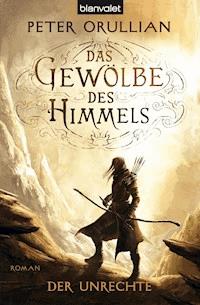11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Gewölbe des Himmels
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Um ein Bündnis gegen das Böse zu schmieden, bedarf es großer Opfer!
Tahn Junnell reist nach Estem Salo, um den Magierorden der Sheson davon zu überzeugen, sich dem Kampf gegen den Vergessenen anzuschließen. Doch diese Aufgabe ist weit komplizierter als erwartet, denn der Orden ist tief gespalten, und ihr Anführer ist in eine alte Fehde mit Tahns Mentor Vedanji verstrickt. Da erfährt Tahn von einer zweiten Prophezeiung, die sich auf ihn beziehen könnte. Ist er gar nicht derjenige, der die Welt von dem Vergessenen befreien soll? Wird er ihr vielmehr den Untergang bringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Ähnliche
Peter Orullian
Das Gewölbe
des Himmels
Die Verbündeten
Aus dem Englischen
von Maike Claußnitzer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Vault of Heaven 2. Trial of Intentions (Part Two)«
bei Tor Books, New York.
1. Auflage
November 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Peter Orullian
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung und -illustration: © Melanie Miklitza, Inkcraft
Karte © by Peter Orullian
Redaktion: Alexander Groß
Lektorat: Holger Kappel
Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-12524-0
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
www.blanvalet.de
Landkarte
1
EIN HAUCH VON RESONANZ
Für einen Leiholan ist die Signatur eines Menschen nicht dessen Name, nichts, was man schreibt oder sagt, sondern vielmehr der Notensatz, der festlegt, wer und was man ist. Es ist die resonante Harmonie des Wesens eines Menschen. Wenn man sie kennt, dann kennt man ihn ganz.
(Einleitende Bemerkung zum Studium der Harmonien und persönlichen Signaturen, Discantus-Kathedrale)
Wendra trat in ein offenes Atrium hinaus, das sich irgendwo tief im Labyrinth der Säle und Gebäude der Discantus-Kathedrale verbarg. Der junge Musikschüler, der sie hergeführt hatte, zog sich wortlos zurück. Jenseits der Freifläche stand Belamae und wartete. Er hatte Wendra erst nach Mittag zu sich gerufen und ihr den Morgen gelassen, um über die Erinnerungen an ihre Mutter nachzudenken, die in ihren Geist zurückgeströmt waren.
Beinahe sofort waren diese Erinnerungen zu etwas wie einem alten, vertrauten Schal geworden, den sie sich um die Schultern legen mochte, wenn der Abend kühl wurde. Die zweite Hälfte der letzten Nacht hatte sie nicht geschlafen. Sie hatte neben ihrem Bett gesessen und getrauert, als hätte sie ihre Mutter aufs Neue verloren. Sie war dankbar, dass ihr die Erinnerungen an Voncencia zurückgegeben worden waren, aber sie machten die Abwesenheit ihrer Mutter noch schwerer erträglich.
Belamae winkte sie zu sich heran.
Wendra durchquerte das Atrium und gelangte zu einem hohen Tisch, auf dem mehrere Stimmgabeln aufgereiht waren.
Belamae stand auf der anderen Seite des Tisches wie ein Schankwirt hinter der Theke, der sich anschickte, ihr etwas zu trinken anzubieten. Er hob eine der Stimmgabeln hoch und schlug damit kräftig auf die Tischplatte. Die Stimmgabel begann zu summen.
»Schwingung«, sagte der Maester und steckte die Gabel in ein Loch, das in ein kleines Kästchen gebohrt war, das auf dem Tisch stand. Während die Gabel weitersummte, hob Belamae eine zweite Stimmgabel auf und steckte sie in das Loch eines benachbarten Kästchens. Dann legte er die Hand auf die erste Stimmgabel, um sie zum Schweigen zu bringen. Zu Wendras Überraschung summte die zweite Gabel in derselben Tonhöhe wie zuvor die erste.
Sie blickte zu Belamae auf und entdeckte ein selbstzufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht. »Die beiden Stimmgabeln sind auf dieselbe Tonhöhe eingestimmt. Die zweite summt das, was wir einen Antwortton nennen. Was Ihr hier hört, ist die Übertragung von Vibration, Wendra. Das nennen wir …«
»Resonanz«, warf sie ein.
»Genau«, sagte er lächelnd. »Wusstet Ihr übrigens, dass man die Sheson einst als ›Innere Resonanz‹ bezeichnet hat? Sheson üben eine Macht über den Willen aus, die diesen Schwingungsanteil aller Dinge nutzt und sich darauf auswirkt. Jetzt passt auf.«
Der Maester wiederholte die Demonstration, benutzte diesmal aber drei ähnlich gestimmte Gabeln, um die Weitergabe der Resonanz von einer an die zweite und von dieser wiederum an die dritte vorzuführen. Wendras Gedanken überschlugen sich, als sie sich Anwendungsmöglichkeiten für dieses neue Wissen ausmalte. Doch bevor sie damit weit kam, hob Belamae eine der Stimmgabeln hoch und winkte Wendra zu einem Klavier hinüber, dem man den Deckel abgenommen hatte.
Es war nur ein kurzer Weg, aber als sie das Instrument erreichten, ging Belamaes Atem mit einem leichten Keuchen. Er sammelte sich und stützte sich mit verkniffenem Gesicht an der Seite des Klaviers ab.
»Belamae?«
»Es geht mir gut, mein Mädchen. Manchmal können meine Atemluft und mein Blut nicht mit mir mithalten.« Er rieb sich ein wenig die Brust. Wendra erkannte, wie bleich seine Haut war und wie hohl seine Wangen wirkten. Er sah krank aus. Aber er bemerkte ihre Besorgnis und lächelte strahlend. »Nun«, fuhr er fort, »könntet Ihr aus unserem ersten Experiment den Schluss ziehen, dass Resonanz nur in exakt derselben Tonhöhe auftritt. Beobachtet dies hier.« Er schlug mit der Stimmgabel seitlich gegen das Instrument und führte sie mit einer langsamen, anmutigen Bewegung eine Handbreit über die Saiten hinweg. Als er fertig war, ließ er die Stimmgabel verstummen und fragte: »Was hört Ihr?«
Wendra beugte sich über das Klavier. Was sie wahrnahm, erstaunte sie. Sie hörte nicht nur denselben Ton, sondern auch, wie mehrere seiner Oktaven in den Saiten mitschwangen, die über den Resonanzboden gespannt waren.
»Ihr hört Oktaven, mein Mädchen – Saiten, die nicht in derselben Schwingung gespannt sind, aber in einer mathematisch verwandten. Seht her.« Er deutete auf mehrere Saiten. »Ihre Längen sind alle proportional: Wenn sich die Länge verdoppelt, klingt die Saite eine Oktave tiefer.«
Sie nahm Belamae die Stimmgabel ab, schlug sie an und führte sie noch einmal über die Saiten. Nachdem sie die Gabel gedämpft hatte, beugte sie sich vor und spitzte die Ohren. »Ich höre auch Terzen und Quinten, aber leiser.«
»Genau!«, rief Belamae. »Das sind zweit- und drittrangige Harmonien und noch weit mehr. Zusammen wirken sie nicht immer wohlklingend, und doch sind sie mit der Signatur eines Gegenstands verwandt. Zwei beliebige Töne stehen wirklich immer in einem Verhältnis zueinander, das sich aus unwandelbaren Strukturen ergibt. Es hat viel mit Mathematik zu tun.«
Sie verfielen in freundschaftliches Schweigen, bis Wendras Verstand sich einer anderen Frage zuwandte: »Wenn alle beliebigen Töne in einem Verhältnis zueinander stehen, hilft das zu erklären, wie eine Leiholan von dem, was sie singt, geprägt wird.«
Er nickte. »In sehr handfester Hinsicht werdet Ihr zu dem, was Ihr singt.«
»Was ist dann mit dem Leidenslied?«, fragte sie und dachte dabei zugleich an die Version des Liedes, die Belamae für den Krieg umgearbeitet hatte.
Belamaes Lächeln verschwand.
Wendra erläuterte ihre Frage näher: »Ihr sagt, dass das Leidenslied sich ständig wandelt.« Sie verfolgte den Gedankengang weiter. »Wenn das Leidenslied sich also wandelt und eine Leiholan auf einer gewissen Ebene zu dem wird, was sie singt, dann ist Soluna …«
Er hob die Hände. »Wir singen das Leidenslied schon seit vielen Zeitaltern, Wendra. Wir verstehen uns darauf, uns seinen winzigen Veränderungen anzupassen. Aber … in den letzten Jahren ist es anders geworden. Ich bin überzeugt, dass mehr am Werk ist als nur die gewöhnliche Entwicklung des Liedes.«
»Habt Ihr eine genauere Ahnung, was es sein könnte?«
Aus seinem angespannten Gesicht sprach aufrichtige Besorgnis, doch er schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Aber eine andere Leiholan hat sich gestern Nacht schlimmer denn je abgemüht. Das Leidenslied hat sie übel zugerichtet. Ich mache mir Sorgen, dass sie vielleicht nicht …« Er blickte zu Wendra hoch und umfasste ihre Hände. »Aber bitte regt Euch nicht auf. Wir müssen Musik machen, und heute werden wir uns auf das konzentrieren, was ich Euch gerade gezeigt habe: Alles verfügt über eine Resonanzstruktur, die sich aus vielen harmonischen Signaturen zusammensetzt, und es ist möglich, gemeinsame Resonanzen zu diesen Signaturen in vielen Dingen gleichzeitig zu finden.«
Wendra schlenderte allein durch die Straßen des Kathedralenviertels. Sie war von neuem überrascht, dass die Discantus-Kathedrale, die sie seit Beginn ihrer Ausbildung nicht mehr verlassen hatte, inmitten eines Elendsquartiers stand.
Die Leute grüßten sie überwiegend voller Wärme. Der Kampf gegen die geringen Möglichkeiten, die das Leben ihnen bot, verband alle Elenden. Die Hälfte derer, an denen sie vorbeikam, ließen ihrem »Hallo« eine Bitte um Essen oder Geld folgen, und wenn Wendra den Kopf schüttelte, bekam sie gewöhnlich ein »Mögen die toten Götter Euch behüten« zu hören, bevor sie weiterging. Die Übrigen grüßten sie gleichermaßen liebenswürdig, aber unter ihrer Herzlichkeit verbarg sich ein Anflug von Unlauterkeit oder Wahnsinn.
Außerdem war ständig Musik zu hören. In beinahe jedem Gasthaus und jeder Taverne fand irgendeine Aufführung statt. Die Klänge der verschiedenen Lieder, der Fleischgeruch und der durchdringende Gestank derjenigen, die sich kein Bad leisten konnten, ließen Wendra fast vergessen, dass sie unterwegs war, um Menschenhändler wie Jastail zu finden, der sie und Penit beinahe verkauft hätte. Sie hatte es sogar darauf abgesehen, den Wegelagerer selbst aufzuspüren.
Sie hatte keinen rechten Hinweis darauf, wo sie ihn aufstöbern könnte, aber bei ihrer damaligen Entführung hatte er sie ein ganzes Stück auf dem Fluss mitgenommen, demselben Fluss, der durch Decalam strömte. Daher vermutete sie, dass sie nur einen ruhigen Anleger finden musste, um Schiffe zu entdecken, die dem verbotenen Handel dienten – die Sorte, die schnell in die Strömung hinausstoßen und mitsamt der Beute schon weit flussabwärts sein konnte, bevor eine allgemeine Suche begann.
Deshalb machte sie sich nicht erst die Mühe, den Kopf in Saufbuden an engen Gässchen zu stecken oder Bordelle, Spielhöllen oder Auktionshäuser aufzusuchen, und sie teilte auch niemandem mit, wohin sie unterwegs war, am wenigsten von allen Belamae. Er würde diesen Ausflug als genau das betrachten, was er war: einen Schritt auf das Wissen zu, ob und wann sie ihre Ausbildung abbrechen würde. Aber sie musste wenigstens damit beginnen, Nachforschungen anzustellen, auch wenn es sie gefreut hätte herauszufinden, dass der Flusshafen von Decalam wenig mehr als ein Fischmarkt und der Ausgangspunkt von Reisen war. Jedenfalls suchte sie sich einen möglichst geraden Weg durch das Viertel, eifrig darauf bedacht zu ergründen, wie es darum stand.
Die Luft wurde kälter, als sie sich dem Flussbezirk näherte. Sie bemerkte, dass die Musik hier langsamer war und häufiger in Moll dargeboten wurde, die Stimmen ungeschliffener und gebrochener, als litten sie unter ständigem Tabakkrautgenuss oder Schlafmangel. Ein Teil von ihr erkannte, dass diese Musik auf gewisse Weise im Einklang mit der Atmosphäre des Viertels stand – und mit seinen Bewohnern.
Sie kam an mehreren Wirtshäusern vorbei, die zugleich auch als Herbergen dienten, bevor sie ein verwinkeltes Molenlabyrinth erreichte, das einer Reihe von Straßen und Wegen auf dem Wasser glich. Zahllose Schiffe und Kähne lagen vertäut in der Nacht. Der Geruch nach altem, nassem Holz hing schwer über allem. Nur wenige Menschen spazierten an der Kaifront entlang, und die, die es taten, sprachen mit gedämpfter Stimme, wenn sie es denn überhaupt taten. Ein zarter Nebel hing in der Luft, genug, um lästig zu sein, aber nicht so dicht, dass er Wendras Gesichtsfeld sehr eingeschränkt hätte.
Als sie den Blick über Dutzende von Schiffen schweifen ließ, bemerkte sie mehrere mit beleuchteten Fenstern. Die Art von Leuten, nach denen sie Ausschau hielt, blieb gewiss unter sich, statt in Tavernen oder Gasthäusern herumzustehen. Nur zum Zeitvertreib irgendwo Geld auszugeben, wäre unvernünftig gewesen – nicht das, was Jastail getan hätte. Mit dem Gedanken wagte sie sich auf die Anleger hinaus.
Leichtsinnig, mich allein auf das Wagnis einzulassen, dachte sie. Aber sie hatte ja ihr Lied.
Die Pfähle und Stegränder waren mit braunem Moos bewachsen. Im schwachen Schimmer der Sturmlaternen, die von eisernen Haken hingen, die in die Pfähle getrieben waren, wirkte es rau, wie Korallen. Einige der Schiffe, an denen sie vorbeikam, schienen leer zu sein, trotz der Lampen, die in ihrem Innern brannten. Je weiter sie in das Molenlabyrinth hinausgelangte, desto häufiger hörte sie die Stimmen derer, die sich in kleinen, schwimmenden Wirtshäusern in Grüppchen um flackernde Öllampen scharten und sich dem wichtigen Geschäft des Trinkens hingaben.
Das Geräusch Wellen schlagenden Wassers. Der Geruch von verfaulendem Holz und ein angedeutetes Fischaroma. Der matte Lichtschein auf einem Schiff, das binnen eines Augenblicks ablegen und auf den Fluss hinausfahren konnte. Irgendetwas sagte ihr, dass sie bald am Ziel sein würde. Am äußersten Rand der Anleger standen auf dem Landungssteg vor einigen der Schiffe kräftige Männer als stumme Wächter. Auf einem von denen, riet sie.
Sie trat an zwei der Männer heran, wurde aber schon fortgescheucht, bevor sie auch nur den Mund geöffnet hatte, um zu lügen. Am Ende wandte sie sich nach links und wanderte am äußersten Ende der Kaianlagen entlang, bis sie kaum noch die Lichter der Hafenkante sehen konnte. Die wenigen Geräusche, die bis hierher drangen, klangen wie eine verstimmte Spieldose, verzerrt und schleppend. Fast ganz am Ende erspähte sie noch einen Wächter, der auf einer Kiste saß und reglos vor sich hinstarrte.
Sie holte tief Luft und trat auf ihn zu. Nicht schnell. Nicht zögerlich. Sie blieb dort, wo er das Anlegerende einer kurzen Planke bewachte, vor ihm stehen. »Ich komme in geschäftlichen Angelegenheiten.«
Der Mann musterte sie von Kopf bis Fuß wie ein Bauer ein Maultier, das versteigert wird. »Das glaube ich kaum.«
»Ich komme in geschäftlichen Angelegenheiten«, wiederholte sie und zwängte ihre Stimme aus der Kehle hervor, um ihr einen heiseren Beiklang zu verleihen. »Wenn ich das noch einmal sagen muss, dann sorge ich dafür, dass dein Herr dir den verlorenen Kauf aus dem Arsch schneidet.«
Ihre Drohung schien keinerlei Auswirkung auf die Bereitschaft des Mannes zu haben, sich zu bewegen. »Und was für ein Geschäft glaubst du hier abschließen zu können?«
»Ich habe Ware zu verkaufen«, antwortete sie und bemühte sich, gleichmütig zu klingen. »Das kann ich hier tun, oder ich kann woanders hingehen. Wenn du mich abweist, dann sorge ich dafür, dass sich herumspricht, dass du es getan hast – und ich sorge dafür, dass eure Rivalen erfahren, dass ihr schlecht bezahlt. Ich vermute, dein Herr wird dir auch das aus dem Arsch schneiden.«
Er sah sie mit zusammengekniffenen Augen an. »Das glaube ich dir nicht.«
»Wie wäre es dann damit?« Wendra beugte sich vor, um ihm ruhig in die Augen zu sehen. »Was, wenn ich die Geschäfte deines Herrn nicht einfach schädige, sondern sie beende? Was, wenn ich alle Einzelheiten über dieses Schiff der Stadtwache von Decalam mitteile? Einem der Gardisten ist vor kurzem die Tochter entführt worden. Seine Gerechtigkeit wird anders aussehen als die deines Herrn, denke ich.«
Der Mann lachte. »Geh schon rein.« Er packte sie am Arm. »Und wenn du dich nachher einsam fühlst, habe ich hier etwas, das dagegen hilft.« Er fasste sich in den Schritt.
»Ich glaube nicht, dass du die nötige Ausdauer hast«, sagte sie. »Aber ich werde das Angebot nicht vergessen.«
Er ließ sie los, und Wendra überquerte die Planke und stieg zwei Stufen aufs Deck hinab. Sie ging zu einer großen Kajüte vorn auf dem Schiff, holte tief Atem und trat ein, nicht übereifrig, nicht zaudernd, sondern einfach wie jemand, der etwas zu versilbern hatte.
Oje – hier war sie wirklich fehl am Platz! Ihre Kleider waren zwar keine tristen Lumpen, standen aber mehrere Stufen unter denen, die diese Leute trugen: Brokatgewänder so bunt wie das Gefieder eines Erpels oder in üppigem Kobaltblau und Scharlachrot. Breite Ärmelaufschläge und Kragen. Gürtel, die mit Glassteinen besetzt waren. Ordentlich gestutzte, mit Rosenöl zurechtgestrichene Bärte. Die Damen waren mit Perlenketten unterschiedlicher Länge ausstaffiert. Sie machten kein Geheimnis daraus, wofür sie einen Teil ihrer Handelsgewinne ausgaben. Aber der Aufputz wirkte beinahe komisch und zutiefst unangemessen, wenn man die zahlreichen Flecken auf jedem einzelnen Kleidungsstück bedachte, und als würden die Kleider selbst noch nicht seltsam genug aussehen, standen sie zudem in scharfem Kontrast zu den Gesichtern ihrer Besitzer. Die Haut dieser Leute war so wettergegerbt wie die von Flussschiffern, die dem grellen Schein der Sonne ausgesetzt waren, die nicht nur vom Himmel niederbrannte, sondern auch vom Wasser widergespiegelt wurde.
Sie waren zu fünft, drei Männer und zwei Frauen. Sie wirkten nicht bösartig oder leutselig wie Jastail, sondern eher wie ein Trupp Händler. Der einzige Unterschied bestand in der Flasche auf dem Tisch. Das hier war weder Maische noch Glühwein. Die Flasche hatte ein vergoldetes Etikett. Es war ein alter Whisky. Sein durchdringender Geruch lag in der Luft.
Sie warteten ab, was sie tun würde, nicht so, als ob sie ein Eindringling wäre, aber so, als sei sie wie hundert andere. Wendra sah Messer und Schwerter an ihren Gürteln. Zwei Dolche lagen auf dem Tisch neben der Flasche.
»Ich nehme einen Schluck davon«, begann Wendra in dem Versuch, ihre Rolle zu spielen.
Wortlos goss einer der Männer einen Mundvoll in sein eigenes Glas und streckte es ihr hin.
Wendra nahm es, stürzte den Inhalt hinunter und kämpfte gegen das Brennen an, das ihr in der Nase und hinter den Augen aufstieg. Dann reichte sie das Glas zurück.
Immer noch sprach keiner von ihnen. Sie warteten.
Wendra schluckte zwei Mal. »Ich habe Ware zu verkaufen. Kauft Ihr?«
»Wir haben keine Ahnung, wovon Ihr da sprecht«, sagte der Mann, der ihr das Getränk eingegossen hatte. Er hatte einen kräftigen Bauch. Einen, der aussah, als ob er aus verhärteten Muskeln bestand.
»Drei Kinder«, fügte sie hinzu, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen.
Der Mann zeigte keinerlei Neugier.
Wendra dachte an ihre eigene Entführung zurück, und ihr kam ein Einfall. »Und außerdem noch eine schwangere Frau.«
Einen Moment lang verrieten die gefühllosen Gesichter reges Interesse. Der Mann, der ihr eingeschenkt hatte, winkte einem seinen Gefährten zu, sich hinter Wendra zu stellen, um ihr den Weg zur Tür abzuschneiden.
»Menschen zu verkaufen ist verabscheuungswürdig«, sagte der Mann. »Was bringt Euch auf den Gedanken, dass wir mit solcher Ware handeln?«
Wendra kämpfte ihren panischen Drang nieder davonzulaufen und trat weiter in den Raum. Sie betastete die Flasche und nahm das Etikett in Augenschein, als wäre sie jemand, der die Unterschiede zwischen verschiedenen Whiskysorten kannte. »Ich kann meine Ware auch anderswo anbieten, wenn Ihr zu zimperlich dafür seid.«
Nun lächelte der Mann und entblößte Zähne, die so braun waren wie das Moos auf den Pfählen. »Setzt Euch«, lud er sie ein.
»Ich habe nicht vor, lange genug hierzubleiben, um es mir gemütlich zu machen«, entgegnete sie. »Nehmt es mir nicht übel. Der Whisky leistet Euch schon Gesellschaft.«
Der Mann lachte über die Beleidigung. »Ihr seid sehr wagemutig für ein hübsches Mädchen, das allein weit draußen auf den Anlegern unterwegs ist.«
»Was bringt Euch auf den Gedanken, dass ich allein hier bin?« Wendra sah ihnen nacheinander herausfordernd in die Augen.
»Ach, ich weiß nicht.« Der Stuhl des Mannes ächzte unter seinem beträchtlichen Gewicht, als er sich zurücklehnte. »Die Anleger verbergen nicht viel. Und jede Unterstützung, die Ihr vielleicht habt, würde wohl zu spät kommen. Meint Ihr nicht?«
Wendra entschloss sich, an dieser Stelle eine Karte auszuspielen. Eine, von der sie hoffte, dass sie eine Reaktion hervorrufen würde, die sie ausnutzen konnte. »Sagt der Name Jastail Euch irgendetwas?«
Das Lächeln des Mannes verflog augenblicklich. Wendra sah Ärger auf mehreren Gesichtern. »Ihr seid doppelt dumm, hier herauszukommen und dann auch noch den Namen dieses Schufts zu nennen!« Er beugte sich vor und starrte sie an. »Ihr seid keine Händlerin, sonst wärt Ihr klug genug, uns nicht mit Jastails Freundschaft zu drohen. Das würden selbst seine engsten Freunde nicht tun – also seid Ihr nicht mit ihm befreundet.« Das Lächeln des Mannes kehrte zurück. Er schenkte sich noch etwas ein und leckte den Rand des Bechers ab, um anzudeuten, dass er gern Wendras Lippen gekostet hätte, bevor er den Whisky hinunterstürzte. »Die eigentliche Frage«, fuhr er fort, »ist doch, warum Ihr nach ihm sucht. So ein hübsches Ding wie Ihr …«
Unter dem Fußboden hervor hörte Wendra einen gedämpften Schrei: »Los! Lauf weg!«
Der Hüne sah einen seiner Männer an, der daraufhin durch die hintere Kajütentür schlüpfte. Dann richtete er sein Augenmerk wieder auf Wendra.
Sie versuchte nicht, ihre Verstellung weiter durchzuhalten. »Ganz recht. Der Hurensohn schuldet mir etwas. Ich werde ihn dafür bezahlen lassen, darauf könnt Ihr Gift nehmen. Aber ich muss wissen, wo ich ihn finden kann. Ich muss wissen, wo er Handel treibt.« Wendra dachte nach und fügte schnell hinzu: »Ich habe nichts gegen die Ware, mit der Ihr handelt, und es stimmt, dass ich selbst vorhabe, Händlerin zu werden.« Ihr wurde schon übel dabei, auch nur die Worte auszusprechen. »Aber für den Augenblick begnüge ich mich mit einer Liste von Orten, an denen ›es staubt‹.«
Wendra erinnerte sich an den Ausdruck für die Versteigerungsblöcke, auf denen gefangene Ware mit gekalkten Füßen, die bei jedem Schritt Staub aufwirbelten, eine behelfsmäßige Bühne überquerte. Die Schuhe wurden ihnen abgenommen, um einer Flucht vorzubeugen, und ihre Füße wurden gekalkt, damit sie nicht rissig wurden und den Wert der Sklaven minderten.
Der Mann nickte und wusste anscheinend sowohl ihre Absicht, von Jastail einen Preis zu fordern, als auch ihre Kenntnis des Handels zu schätzen. »Was ist mit den drei Kindern? Und der schwangeren Frau?«, fragte er hoffnungsvoll.
»Eine Lüge«, gestand sie.
Ein gedämpfter Schlag ertönte, gefolgt von einem Schmerzensschrei. Wieder unter den Bodendielen hervor.
Der Mann bekundete theatralisch seine Enttäuschung. »Schade um die Schwangere … Gebärmütter sind unsere Spezialität.« Er lächelte und beugte sich so nahe heran, dass Wendra den Alkohol in seinem Atem riechen konnte. »Aber was die toten Götter einem mit einer Hand nehmen, geben sie einem mit der anderen zurück.« Er sah über ihre Schulter einen seiner Kumpane an, der vorwärtshechtete, Wendras Arme packte und sie ihr auf dem Rücken festhielt.
Der Mann lehnte sich zurück, goss sich noch einen Whisky ein und nippte diesmal nur daran, während er sie nachdenklich musterte. »Du bist in gebärfähigem Alter. Du wirst einen schönen Preis einbringen. Und wenn Jastail irgendeinen Hader mit dir hat, zahlt er vielleicht anderthalbmal so viel, um Gelegenheit zu haben, derjenige zu sein, der dich hineinverkauft.«
»Hinein?«, fragte sie.
Der Mann winkte ab, statt ihre Frage zu beantworten. »Steckt sie zu den anderen«, sagte er und widmete seine Aufmerksamkeit wieder seinem Getränk.
»Wartet!«, rief sie. Etwas im Klang ihrer Stimme weckte die Neugier der Händler und ließ den Mann, der sie festhielt, stehen bleiben. »Nur für den Fall, dass ich entkomme … sagt mir, wo ich ihn finden kann. Ich lasse es mir nicht nehmen, ihn zu töten.«
Der Mann sah sie wieder an und schüttelte mit einer gewissen Anerkennung den Kopf. »Der Dreckskerl muss ja eine ziemliche Wirkung auf dich gehabt haben! Was hat er getan, dich gezwungen, die Beine breit zu machen? Das ist nichts, worauf unsere Käufer Wert legen.« Der Mann beugte sich vor und riss ihr die Hose weit genug herunter, um ihre Taille in Augenschein zu nehmen. Ihm war anzusehen, dass ihm etwas dämmerte, als er die Dehnstreifen erspähte, die ihre Haut von ihrer nicht lange zurückliegenden Schwangerschaft zurückbehalten hatte. »Du hast ein Kind zur Welt gebracht, wie ich sehe. Jastail hat dich um des Kindes willen entführt. Der Dummkopf ist zu allem entschlossen, das muss man ihm lassen!«
»Sagt es mir einfach«, drängte Wendra.
Noch während sie sprach, kehrte der Mann, der hinausgegangen war, zurück und schloss die rückwärtige Kajütentür hinter sich.
»Auch wenn es dir kaum etwas nützen wird, mein Mädchen: Jastail ist ein Gewohnheitstier. Wenn du schon in seiner Gesellschaft warst, dann weißt du, wo du ihn findest.«
Natürlich.
Der Mann hatte ihre Hose nicht losgelassen und beäugte jetzt ihre Haut. Sein Blick schweifte über ihren Bauch und bis zu ihren Brüsten hinauf. »Vielleicht können wir ja auch etwas Spaß mit dir haben. Was ein Käufer nicht weiß …«
Beide Frauen in der kleinen Kajüte bedachten Wendra mit lüsternen Blicken. Der zweite Mann, den sie noch sehen konnte, machte sich nicht die Mühe, seine Begierde zu verhehlen. »Vielleicht kann sie ja mit den Damen anfangen«, schlug er vor, »und wir stoßen später hinzu.«
Ihr Menschenhandel, ihre Vorliebe für guten Whisky, die unverkennbare Wollust, die diese Männer und Frauen miteinander gemein hatten … Diese Mannschaft verfügte über einen tiefen, wahnwitzigen Vergnügungsdrang, nicht anders als Jastail, der nur noch dann spielen konnte, wenn es um den allerhöchsten Einsatz ging.
Wendra konnte sich nicht aus dem Griff des Mannes befreien, der sie festhielt, und selbst, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre, hätte es keinen Sinn gehabt davonzulaufen. Sie wäre niemals auch nur bis zur Tür gelangt, ohne wieder von den Händlern gepackt zu werden, und schon gar nicht an dem Wächter auf dem Anleger vorbei. Sing sie nieder. Aber sie wollte nicht ihr Schreilied singen. Das hätte viel Aufmerksamkeit erregt – es wäre laut gewesen und hätte wahrscheinlich gleich die ganze Kajüte zerstört.
Resonanz. In vielen Dingen zugleich.
Ohne weiter nachzudenken, begann sie zu summen. Das musste die Händler seltsam berühren, denn sie erstarrten alle und musterten sie unverwandt.
Wendra ließ ihr Summen in Gesang übergehen, griff damit aus, streichelte sie und malte sich die dunklen Lüste aus, die ihnen innewohnten – Fleisch auf Fleisch, Atem, der modrig von ganzen Flaschen voll gutem Roggenbrand war, mit anzusehen, wie Menschen die letzte Hoffnung verloren, wenn sie für so wenige Münzen verscherbelt wurden, dass man das Geld einfach in die Tasche stecken konnte.
Wendra bemühte sich, den Ton leise zu halten und eine schwermütige, verführerische Melodie zu singen. Sie improvisierte einen Text, der unausgesprochene fleischliche Gelüste andeutete, ganze Winter, die man damit zubrachte, vor dem Feuer alten, lange aufgesparten Whisky zu trinken, während Körper sich in unterschiedlichsten Kombinationen lustvoll vereinten … und die Klagen der Sklaven, die sie verkauften, um das alles zu bezahlen. Kontrolle. Das war das Aphrodisiakum im Herzen jedes Händlers. Und Wendra sang ihr Lied. Sie fand die Stelle in jedem Einzelnen von ihnen, an der jene Töne Resonanz erzeugten.
So, wie eine Stimmgabel die andere zum Summen brachte, und dann noch eine, und noch eine, umfing Wendras Lied sie alle mit der Umarmung dessen, was sie wollten … wonach sie sich aus tiefster Seele sehnten. Was den größten Widerhall in ihnen erzeugte.
Und sie liebkoste diese Gelüste mit ihrem Lied.
Sie sah, wie die Augen der Händler glasig wurden, gebannt von den Visionen, die sie in ihnen heraufbeschwor. Der Mann, der sie festgehalten hatte, ließ sie los. Dem Anführer glitt das Glas aus der Hand und zerbarst auf dem Boden – niemand zuckte zusammen. Die Frauen zogen die Brauen zu dem Ausdruck des Genusses zusammen, den man in Augenblicken höchster Lust empfindet.
Wendra sang weiter und fand eine neue Mitte für das Lied. Eine tiefere Resonanz. Sie überstürzte nichts und sang auch nicht lauter. Sie sang tiefer. Sie griff nach ihren eigenen Gefühlen, nach den Abgründen düsterer Lust, die sie empfand, wenn sie sich ausmalte, die Stilletreuen zu zerfleischen, die diesen Handel überhaupt erst herbeigeführt hatten. Sie fand wieder die Resonanz ihres eigenen Herzens, als ihre Vision schonungslos wurde und ihr Lied Fleisch von den Knochen derjenigen riss, die menschliche Ware kauften.
Und sie malte sich aus, das Gleiche den Händlern anzutun, in deren Kreis sie auf diesem vor Anker liegenden Schiff stand.
Aber diesmal war ihr Lied keine Reihe heiserer Schreie. Diesmal war es eine langsame, persönliche Melodie, ein Klang, der die Saiten der düsteren Begierde so gewaltsam anschlug, dass diese Händler dort, wo sie saßen oder standen, allmählich in sich zusammensackten.
Wendra sang weiter. Sie drang noch weiter nach unten vor, fand eine Resonanztiefe, von der sie nicht geglaubt hatte, sie erreichen zu können, und die ihrem eigenen Verstand düstere Begierden eingab: Verlockendes, das ausprobiert und erlebt werden wollte. Sie richtete sie gegen die Händler und entdeckte in ihnen abscheuliche Absichten, die sie sich nicht einmal ansatzweise vorstellen konnte. Aber sie scheute nicht davor zurück. Sie gab sich ihnen hin. Sang sie. Erweckte sie für diese fünf zum Leben. Für sich selbst. Sie verwandelte sie in solch einen jubilierenden, unerträglichen Rausch der Erfüllung, dass sie sich nur ansatzweise bewusst wurde, dass sie alle schon dank der Heftigkeit ihrer Lust ihren letzten Atemzug getan hatten.
Sie hatte sie getötet. Sie hatte mit ihrem Lied in Körper und Geist ein stummes Entzücken gewoben – eines, das die Erregung ausnutzte, die Macht und Überlegenheit in einem auslösten. Die Erregung der Lust.
Sie hörte auf zu singen und sank zitternd auf Hände und Knie. Ihr Gesicht und ihr Körper waren schweißüberströmt. Sie keuchte vor Erschöpfung und angesichts der Empfindungen, die sie noch immer in Wellen durchliefen.
Nachträglich kam ihr der Gedanke, dass eine der Frauen in ihren letzten Augenblicken dankbar dafür gewesen war, von den Zwängen befreit zu werden, die sie an dieses Geschäft gebunden hatten.
Es verging wohl eine halbe Stunde, bis Wendra wieder klar sehen konnte. Als sie den Kopf hob, entdeckte sie ein Röhrchen im Stiefel des toten Anführers. Sie zog es hervor, öffnete es und fand eine Landkarte, auf der Sklavenhandelsposten verzeichnet waren.
Als sie inmitten dieser Sklavenhändler kniete, erschauerte sie, weil ihr bewusst wurde, wie wahr Belamaes Mahnung gewesen war.
Jedes Mal, wenn Ihr in Resonanz mit etwas oder jemandem singt, verändern sich Eure eigenen Schwingungen ein klein wenig.
Sie konnte einen gefährlichen, sinnlichen Klang spüren, der sich in ihr vor Lachen ausschüttete. Ein unvernünftiger Gedanke huschte ihr durch den Sinn: Geh schon, leg den Türsteher flach!
… verändern sich Eure eigenen Schwingungen ein klein wenig.
Das brachte sie dazu, über das Singen des Leidensliedes nachzudenken. War das, was sie gerade gesungen hatte, auch eine Art Leidenslied gewesen? Sie wusste es nicht. Was hier geschehen war, kam ihr seltsam unwirklich vor. Und berauschend. Was kann ich noch singen … und wem könnte es schaden? Aber es tat ihr nicht leid, die Händler getötet zu haben. Davon konnte keine Rede sein.
Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sie aufstand. Stumm durchsuchte sie die Toten und entdeckte einen Schlüsselbund bei dem Mann, der die Runde kurz verlassen hatte. Sie huschte durch die Hintertür und fand eine Luke auf dem Deck. Sie öffnete das Vorhängeschloss, mit dem sie gesichert war, und zog die Klappe hoch, unter der sich eine Treppe verbarg, die in einen dunklen Laderaum führte.
Wendra stieg langsam in die Tintenschwärze hinab. Sie hatte den Eindruck, gemustert und beurteilt zu werden. Einen Augenblick später wurde tiefer im Laderaum eine kleine Öllampe entzündet. Was sie sah, ließ ihr das Herz vor Mitgefühl und Zorn heftiger klopfen. Sieben Frauen waren an hölzerne Pritschen gekettet. Drei von ihnen waren schwanger. Wenn sie sich nicht täuschte, würden die Kinder binnen einem oder zwei Mondumläufen geboren werden.
Wortlos suchte sie den Schlüssel, um ihre Ketten aufzuschließen. Die Frauen beobachteten Wendra schweigend. Was sie am meisten überraschte, war, dass keine von ihnen von der Pritsche, aus dem Laderaum hervor oder vom Schiff stürmte.
Die Jüngste von ihnen sah Wendras Augen die Frage wohl an. Sie zitterte in der Kälte, und ihr Bauch verriet, dass ihr Kind fast weit genug war, geboren zu werden. »Sie werden uns wiederfinden.« Es war die Angst, die sie gebunden hielt – vermutlich eine Drohung, die sie wiederholt gehört hatten, seit man sie gefangen genommen hatte.
»Nein«, sagte Wendra. »Die entführen keine Frauen mehr.«
Sie wollte ihnen etwas vorsingen. Etwas Sanftes, Tröstliches. Aber, bei allen Höllen, wie müde sie war – und wie sie innerlich fror! Also legte sie sich stattdessen neben das junge Mädchen und hoffte, dass sie selbst über genug Körperwärme verfügte, um dessen Zittern zu lindern. Sie lächelte im Dämmerlicht ein klein wenig und ertappte sich bei dem Gedanken, dass sie vielleicht mehr Wärme brauchte als das Mädchen.
»Was tun wir jetzt?«, fragte eine andere Frau.
»Lasst mich eine Weile ruhen. Dann verlassen wir den Hafen, und Ihr geht nach Hause.«
Zwei der Frauen tauschten einen zweifelnden Blick. »Was ist mit dem Wachhund auf dem Anleger?«
Wendra schenkte ihnen noch ein kleines Lächeln. »Für den habe ich ein Lied.«
2
ABSICHTENPRÜFUNG
Absichten sind vielleicht die prägendste Eigenschaft des Menschen. Sie verleihen ihm die Fähigkeit, vorauszudenken und seinen animalischen Überlebensinstinkt zu ignorieren, und damit auch die Entschlossenheit, nach einem Ideal zu streben.
(Auszug aus der Verteidigung der ersten Absichtenprüfung, verwahrt in den Archiven von Estem Salo)
Thaelon betrat den Verhandlungssaal und stellte fest, dass jeder Platz besetzt war und das Raunen leiser Gespräche in der Luft lag. Der weitläufige Saal verfügte über einige hundert Sitze in sanft ansteigenden Reihen und zwei Ränge, die mehrere hundert zusätzliche Plätze boten. Die kunstvolle, dreißig Schritt hohe Decke war hell erleuchtet, und jenseits der Bühne, auf der die Debatte stattfinden würde, hatte man einen unverstellten Blick auf Estem Salo. Der Saal war ohne Rückwand errichtet worden, um den Verhandlungen, denen diese Halle dienen sollte, eine eindrucksvolle Kulisse zu verleihen.
Das Gemurmel verstummte, als Thaelon vorüberkam: Einiges davon klang ehrerbietig, anderes anklagend. Die Kluft, die seine Bruderschaft spaltete, trat deutlicher denn je zutage.
Er ließ die großen Wandgemälde auf sich wirken, mit denen die gewaltigen Mauern beiderseits der ansteigenden Sitzreihen verziert waren. Anders als in der Galerie, wo er sich auf diesen Augenblick vorbereitet hatte, waren hier Zivilprozesse dargestellt, die teilweise erregte Streitgespräche mit sich brachten, aber keine Todesfälle nach sich zogen. Der Gedanke, dem dieser Saal geweiht war, war der des Disputs und des Abwägens.
Auf der erhöhten Bühne vor den Sitzreihen saßen zur Rechten vier Shesonexemplare – diejenigen, die den Bereichen der Argumentation, Aussprechlichkeit, Einsicht und Rhetorik vorstanden – als Richtertribunal. Zur Linken stand an einem den Richtern zugewandten Pult der erste Sheson, dem der Prozess gemacht werden sollte. Er war ein Mann mittleren Alters und selbst Ethiklehrer. Sein Name lautete Toyl Delane. Er war Vater und ein Mensch, dessen Haare immer zerzaust wirkten.
Thaelon stieg auf die Bühne und stellte sich vor seine Richter. »Sind wir bereit zu beginnen?«
Er hatte Raalena den ganzen Morgen nicht gesehen, aber jetzt stand sie plötzlich neben ihm. Sie sagte nichts, aber schon ihre Gegenwart allein trug dazu bei, ihn ein wenig gelassener zu machen.
»Toyl.« Warrin, derjenige seiner Exemplare, der in Geschichte und Glauben am besten bewandert war, sprach den Namen leise aus. »Er hat sich freiwillig gemeldet, der Erste zu sein. Ich vermute, er hat vor, eine Rede zu halten.«
Thaelon schenkte Warrin ein Lächeln, das vor allem dazu dienen sollte, ihn selbst zu beruhigen, und schritt in die Mitte der Bühne. Zuerst sah er aus der offenen Rückseite des Saals auf das langgestreckte Panorama seiner Stadt hinaus. Es war ein großartiger Anblick. Tausend Dächer. Mehr als tausend. Und jenseits davon die hohen Berge und bewaldeten Hügel der Dividen. Das alles verlieh ihm die nötige Standfestigkeit für seine Aufgabe.
Er drehte sich um und wandte sich den Sitzreihen zu. Stimmen verstummten. Er wartete mehrere Augenblicke lang und sprach dann so wie ein Mensch, der sich an einen Freund wendet: »Ich berufe keine Absichtenprüfung leichtfertig ein. Wir sind hier, weil echte Gefahr besteht.« Thaelon blieb stehen, wo er war. Er würde nicht auf und ab gehen und seine Worte auch nicht mit theatralischen Gebärden unterstreichen. »Ich habe viele lange Tage mit den Vorbereitungen darauf zugebracht. Während ich zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran hatte, dass die Absichtenprüfung notwendig ist, wünsche ich mir schon die ganze Zeit über, sie wäre nicht vonnöten, und ich bin nicht stolz auf das, was gleich geschehen wird.«
Aus dem zweiten Rang war ein wenig Getuschel zu hören.
Thaelon beachtete es gar nicht. »Absichtenprüfungen sind selten«, räumte er ein. »Soweit ich weiß, sind sie in unserem Kreise sogar nur zwei Mal in aller Form vorgenommen worden: einmal, als der Zweite Eid beinahe gescheitert wäre, und zuvor in der Zeit nach der Weißung des Quietus, als man für das, was wir gleich tun werden, noch keine Bezeichnung kannte.« Er hielt inne und dachte an die Gemälde an den Wänden der Galerie, auf denen Sheson dargestellt waren, die nach behelfsmäßigen Absichtenprüfungen tot am Boden lagen. »Falsche Absichten haben Konsequenzen«, sagte er und ließ den Blick über die Versammlung schweifen. »Konsequenzen, die in früheren Zeiten den Tod bedeuteten. Aber diesmal wird es nicht so sein.«
»Was dann?«, fragte Toyl an seinem Rednerpult rechts von Thaelon. »Verbannung? Ächtung?«
Thaelon sah den Mann nicht an, sondern schenkte alle Aufmerksamkeit weiterhin den vor ihm Versammelten. »Entkleidung«, antwortete er.
Die Menge begann zu tuscheln. Ein paar laute Aufschreie durchbrachen das Gemurmel, das einem Summen glich. Einen davon verstand er: »Es ist eine Taktik, die uns in Angst und Schrecken versetzen soll!«
Er hob die Hand, um Schweigen zu gebieten. »Die Entkleidung war lange ein Mythos, und glücklicherweise bestand für uns keine Notwendigkeit, seine Existenz zu beweisen.« Er hielt einen Moment inne. »Bis jetzt. Ich war in den Tiefen des Tabernakels. Ich habe die alten Schriftzeichen gefunden und den Weg entdeckt, auf dem man einem Sheson die Macht entziehen kann, den Willen zu lenken.«
Das Raunen brandete diesmal lauter auf, und einige riefen nach der Todesstrafe, die der Entkleidung vorzuziehen sei.
Thaelon wartete einfach ab, bis sie einsahen, dass er nicht fortfahren würde, bevor es wieder still geworden war. Am Ende kam der Saal zur Ruhe.
»Es sind die richtigen Konsequenzen«, stellte er mit Nachdruck fest. »Der Zweck der Prüfungen besteht darin festzustellen, ob der Gebrauch, den ein Sheson vom Willen macht, mit unserer ältesten Charta im Einklang steht. Denn wenn nicht, dann ist er kein Sheson, und wenn er kein Sheson ist, hat er kein Anrecht auf die Macht eines Sheson.«
Wieder unterbrach ihn Toyl. »Und Ihr werdet uns darüber unterrichten, was jene Charta enthält, nicht wahr, Thaelon? Denn soweit ich weiß, gibt es kein Dokument, das wir zurate ziehen könnten, um festzustellen, was sie besagt.«
Thaelon sagte schlicht, immer noch an die Sitzreihen gewandt: »Das werde ich tun.«
»Welch treffliches Kunststück!«, höhnte Toyl und erntete hier und da im Saal leises Gelächter.
Thaelon wandte sich dem Mann nun zu. »Ihr werdet Euch erinnern, dass ich Euer Randior bin – oder zählt Respektlosigkeit auch zu den Eigenschaften derer, die Vendanji folgen?« Er starrte Toyl kalt an und verkündete mit lauter Stimme: »Jeder Sheson wird einer Absichtenprüfung unterzogen und kann sich in ihrem Verlauf äußern, und ich bin froh, dass gleich bei unserem ersten Prozess jemand mit scharfem Verstand die Gegenmeinung zu unserer vertreten kann.«
»Ich bin mir nicht sicher, wen Ihr meint, wenn Ihr ›unserer‹ sagt, mein Randior«, sagte Toyl in vor Sarkasmus triefendem Ton. »Aber ich helfe Euch gern, die Redlichkeit dieser gesamten Verhandlung zu überprüfen.«
Langes Schweigen senkte sich über den Saal, gebrochen nur vom Wind, der sich an der Rückseite der Bühne regte und die Pappelblätter rascheln ließ.
Thaelon beschloss, eine einfache Frage zu stellen, um zu demonstrieren, worum es bei diesen Prozessen eigentlich ging. »Toyl, gibt es nichts, was einen Sheson beim Willenslenken leitet?«
»Wollt Ihr nicht eigentlich fragen, ob ich Vendanjis Meinung teile oder sein Anhänger bin?« Toyl trat hinter seinem Verteidigerpult von einem Fuß auf den anderen.
Langsam ging Thaelon auf ihn zu, beugte sich vor und sagte: »Ich dachte, danach hätte ich gefragt.«
Zur Antwort darauf ertönte an vielen Stellen gedämpftes Gelächter.
Toyl lächelte und nickte. »Schlau, ja. Das, was den Gebrauch des Willens leitet – oder leiten sollte –, ist die moralische Mitte des Willenslenkers.«
»Ich verstehe.« Thaelon wandte sich um, so dass er die Reaktion der Versammlung auf seine nächste Frage beobachten konnte. »Und die Velle, die ebenfalls den Willen lenken, gebrauchen ihn also angemessen, da sie sich auf ihre eigene moralische Mitte verlassen?«
Toyl runzelte die Stirn und hob dann einen Finger, wie man es tut, wenn man einen Einwand erheben oder etwas näher erläutern möchte. »Sie sind keine Sheson.«
»Euch ist bewusst«, hakte Thaelon nach, »dass sie ursprünglich Sheson waren? Dass wir einst alle demselben Orden angehörten? Sie wurden schließlich erst im Zuge der ersten Absichtenprüfungen aus unserer Gemeinschaft ausgestoßen.«
Vielleicht könnten wir wieder eins werden.
»Das sind nichts als Wortspiele eines Debattierers«, sagte Toyl und entspannte sich sichtlich. »Die Velle unterscheiden sich grundlegend von uns, weil sie sich an keinerlei moralische Grundsätze halten. Das wisst Ihr.«
Thaelon drehte sich um und zeigte auf den Mann. »Und woher wisst Ihr das?«
Toyl öffnete den Mund, um zu antworten, aber ihm fehlten die Worte. Wenige Augenblicke später schien er sich auf ein paar Bemerkungen zu besinnen, die er sich vorab zurechtgelegt hatte. »Dann lasst uns doch über Zusammenhänge sprechen, über die wir uns alle einig werden können, ja? Beispielsweise über das Nachspiel, das der Zweite Eid hatte.«
Thaelon erkannte, worauf Toyl hinauswollte, und wusste, dass es nur schwer zu rechtfertigen sein würde.
»Die Sheson, die erzürnt darüber waren, dass das Zweite Große Mandat die Sedagin verriet und sie allein im Kampf sterben ließ, zogen an die Höfe der Menschen und mordeten. Mord, Thaelon. Um Taten zu erzwingen.« Toyl wies mit großer Geste hinter sich. »Entsprach das der Charta, von der Ihr Euch angeblich leiten lasst?«
Thaelons Gedanken überschlugen sich, und er suchte nach einem Gegenargument.
Toyl ließ ihm keine Zeit. »Und was ist mit unserem eigenen Zeitalter? Was ist mit dem Zivilisierungsgesetz? Wie geht Ihr damit um? Meines Wissens lasst Ihr unseresgleichen sterben. Wenn Ihr mich also fragt, ob ich ein Anhänger von Vendanji bin, der sich gegen die Stille und gegen die Liga stellt und sich nicht fragt, ob es mit irgendeiner schwammigen Vorstellung von einer Charta im Einklang steht, Menschen zu beschützen … dann bin ich sein Anhänger, ja.«
Thaelon fand seine Stimme wieder. »Eine Gesandtschaft unter Führung meiner eigenen Tochter ist nach Decalam gereist, um eine Rücknahme des Zivilisierungsgesetzes auszuhandeln. Und der Mord, von dem Ihr sprecht – am Ende des Zweiten Eides –, hat sehr wohl eine Absichtenprüfung nach sich gezogen.«
Toyl setzte eine sichtlich befriedigte Miene auf. »Die wiederum ergab, dass kaum ein Sheson für schuldig befunden wurde, gegen die Charta verstoßen zu haben. Treffen meine Geschichtskenntnisse zu?«
Hinter dem Richtertisch hervor nickte Warrin.
Es war ein kluges Argument, das musste Thaelon zugeben. Er trat an den Rand der Bühne und musterte eindringlich die Zuschauer. Dann hob er einen Finger und hielt ihn mehrere Augenblicke lang hoch erhoben, bevor er mit klarer Stimme in sanftem Ton zu sprechen begann. Es war für ihn unabdingbar, dass alle ihn hörten. Wirklich hörten. »Die Charta spürt man genauso sehr, wie man sie versteht. Jeder von Euch hier würde sofort loslaufen, um ein Kind in Gefahr zu retten. Ihr benötigt kein Dokument, das Euch sagt, was Ihr tun müsst, und Ihr wisst, dass Eure Handlungsweise richtig ist, sogar, wenn sie Euch selbst Schaden zufügt.« Er hielt inne und schaute zu der hell erleuchteten Decke weit oben empor. Dort gab es weitere Gemälde: Sterne und Wolkenbänder, die über das Firmament zogen. Sie flößten ihm eine gewisse Kraft ein, und er sah wieder seine Mitsheson an. »Uns ist in Form der Macht, den Willen zu lenken, eine Gabe verliehen. Sie ist ein Abglanz der Macht, derer sich die Väter bedient haben, um die Welt zu erschaffen. Aber wir sind keine Götter, und wenn wir diese Macht nach Lust und Laune gebrauchen oder nicht darüber nachdenken, wem sie schaden könnte, dann zeugt das von unserer Arroganz: So, als wären wir tatsächlich Götter in Menschengestalt! Wenn wir Leben schenken und nehmen, nur weil wir die Macht dazu haben, verwirken wir das Recht, diese Macht zu beanspruchen, oder sollten es zumindest tun.« Er wandte sich Toyl zu. »Das soll bei der Absichtenprüfung festgestellt werden. Wir werden uns immer Invasionen oder Eroberern entgegenstellen. Aber auf die richtige Art.«
Toyl, der Ethiklehrer, schüttelte langsam den Kopf. Wie Thaelon sagte er mit leiser, aber ausdrucksvoller Stimme: »Worauf es ankommt, ist, unsere Lande und unsere Leute zu bewahren. Es spielt keine Rolle, wie prinzipientreu wir sind, wenn wir sie verlieren. Krieg ist kein gesellschaftliches Experiment, Thaelon. Er ist kein Alltag. Er ist alles und jedes, was man unternehmen kann, um das Leben, das man hat, zu behalten.« Er sah die Versammelten an. »Ich stehe auf Vendanjis Seite.«
Deine Ethik hört sich sehr opportunistisch an, mein Ethikfreund.
Aus der Menge ertönten Beifallsrufe zu Toyls Worten. Nicht einstimmig. Aber es waren viele. Es betrübte Thaelon, sie zu hören. Während es in den Sitzreihen wieder still wurde, dachte er an seinen Pergamentkrieg mit Ketrin zurück. Das half ihm, sich auf das zu konzentrieren, was er sagen musste.
»Wir lehren hier die Neuausrichtung. Aber wir lehren sie vor allem, um Euch in dem zu unterweisen, was Ihr nicht tun solltet. Es ist eine Form des Willenslenkens, die darauf ausgerichtet ist zu bekommen, was man will, indem man den freien Willen eines anderen manipuliert.« Thaelons leidenschaftliche Überzeugungen kochten heiß in ihm hoch. Er hob die Stimme: »Es steht uns nicht zu, Leben zu erschaffen oder zu beherrschen, damit es für uns kämpft. Wenn es einen Krieg gibt, der es wert ist, geführt zu werden, dann sollten wir die Kosten dafür selbst tragen.« Er dachte an den jungen Tahn, den Vendanji benutzte, und an die Tatsache, dass es diesen Jungen überhaupt gab – ein wiederbelebtes, totgeborenes Kind. »Es damit anders zu halten ist die Art der Stilletreuen. Das muss ich Euch nicht erst erzählen, damit Ihr erkennt, dass es die Wahrheit ist.«
Köpfe nickten.
Thaelon trat vor und verkündete mit lauter, fester Stimme: »Wir sind keine Götter, aber wir können gottgleich sein, und um das zu werden, müssen wir uns fragen: Wie weit wollen wir gehen, und um welchen Preis lenken wir den Willen, bevor wir auch nicht mehr anders als die Stilletreuen sind, gegen die wir kämpfen? Wir sind besser als sie! Wir müssen besser sein!«
Was darauf folgte, war kein Aufschrei der Menge. Es war dröhnende Stille, in der die Sheson an ihren Eid zurückdachten. Thaelon konnte ihre Herzen spüren – zumindest die der meisten. Und diesen Herzen entströmten gute Absichten. Zumindest glaubte er das.
Es rührte ihn. Es machte ihn stolz. Diese Prozesse würden einen steinigen Weg bilden, aber jetzt verstanden alle, warum er beschritten werden musste.
Langsam wandte er sich wieder Toyl zu. Er sah dem Mann einen langen Moment in die Augen. »Es gibt nur eine Frage«, sagte Thaelon, und sein Tonfall legte Toyl nahe, gut über seine Antwort nachzudenken. »Antwortet nicht für diejenigen, die hier vor Euch sitzen, und auch nicht für die, mit denen Ihr Euch beraten habt, bevor Ihr auf diese Bühne getreten seid.« Er hielt inne und holte tief Atem. »Toyl Delane, würdet Ihr um jeden Preis den Willen lenken, alles tun, um Eure Absichten umzusetzen … würdet Ihr Vendanji folgen, wenn er es verlangen würde?«
Ohne Trotz sagte Toyl schlicht: »Das würde ich.«
Diese drei Worte brachen Thaelon das Herz. Ungeachtet all seiner geschliffenen Rhetorik, war es Toyl mit seiner Gegenmeinung ernst. Er glaubte an einen anderen Weg. Einen Weg, der gegen den Shesoneid verstieß, den er geschworen hatte. So nahe, wie er nun bei ihm stand, sah Thaelon Toyls Augen an, wie sehr ihn das alles belastete. Ein guter Mensch enttäuscht nicht gern einen Freund, selbst wenn er davon überzeugt ist, recht zu haben.
Toyl beugte sich vor und wiederholte flüsternd: »Das würde ich … und, mein Randior, Ihr solltet es auch tun.« Es klang wie eine flehentliche Bitte.
Thaelon stand da und starrte ihn an. Seine Eingeweide ballten sich zu einem Knoten zusammen. Wie viele? Die Hälfte? Würde er die Hälfte seiner Leute ihrer Macht entkleiden, bevor diese Prozesse vorüber waren? Gute Menschen. Das waren sie alle. Aber mit einer Absicht, die einen Hauch zu weit ging. Einen gefährlichen Hauch. Sein Orden würde das hier vielleicht nicht überleben. Aber was sonst konnte er tun?
Thaelon trat noch näher heran, um eine Frage stellen zu können, die nur Toyl hören sollte. Er musterte die Augen des Mannes, und nun waren seine eigenen Worte flehentlich: »Toyl … was ist mit Eurem Eid?«
Sie tauschten einen langen Blick, bevor Toyl leise sagte: »Vielleicht, mein Randior, wird es Zeit, dass der Eid sich ändert.« Die Behauptung klang aufrichtig, sogar hoffnungsvoll.
Sie ließ Thaelon eiskalt werden. Bei seinen Nachforschungen hatte er herausgefunden, dass genau diese Worte von jenen Sheson gesprochen worden waren, die in den Born gezogen waren … um zu Velle zu werden.
Thaelon sah Toyl gütig an und nickte. Ein Signal. Der Mann wurde in die Mitte der Bühne geführt. Und dort erweckte Thaelon etwas zum Leben, das es bisher nur in Form von Schriftzeichen gegeben hatte, die tief in staubige Steinflächen eingegraben waren.
Es kam zu keinem großen Getöse oder Bersten. Thaelon und einige der Richter legten Toyl einfach die Hände auf den Körper. Der Mann erschauerte, als Thaelon ihm die Resonanz entzog, die seinem Lebenslied mehr als einen einzelnen Ton und eine einzelne Schwingung verlieh.
Als es geschehen war, schleppte sich Toyl zu einer Frau und einem Kind zurück, die in der Nähe einer Tür auf ihn warteten.
3
EINE ZIVILISIERTE AUSEINANDERSETZUNG
Wohlerzogen ist man, wenn man einem Drecksack, den man verabscheut, höflich lächelnd zunickt.
(Antwort auf eine Umfrage der Liga über die Bedeutung des Begriffes »Edukation«)
Der Saal schwirrte vor Geplauder, als Roth ihn am zweiten Tag des Großen Mandats betrat. Wenn alles gut ging, würde es keinen dritten Tag geben. Alle Könige, Königinnen und anderen Herrscher hatten bereits ihre Sitze am Haupttisch eingenommen, und die Plätze auf den Galerien waren ebenfalls belegt. Roth war absichtlich zu spät gekommen, um jeglichem Gespräch im Vorfeld der offiziellen Verhandlungen auszuweichen, aber auch, um die Aufmerksamkeit mehrerer Teilnehmer zu erregen.
Nicht weniger als sechs der entscheidenden Stimmberechtigten hatten ein gefaltetes und versiegeltes Blatt aus schlichtem, weißem Pergament erhalten. Jedem war in seiner Nachricht das ein oder andere Geheimnis in aller Deutlichkeit beschrieben worden. Am unteren Ende des geheimen Schreibens folgte auf die Versicherung, diese Indiskretionen öffentlich machen zu wollen, die Aufforderung, sich gegen die Regentin zu stellen.
Bei manchen derjenigen, die diese Nachrichten erhalten hatten, bestand kein großes Risiko, dass sie Widerstand gegen Roths Pläne leisten würden, aber es war dennoch sinnvoll, sich ihrer Stimmen zu versichern. Einige der anderen, die heute Morgen Briefe erhalten hatten, waren der Liga nicht gewogen; beim Abfassen der Botschaften an diese Männer und eine Königin war die Tinte reichlicher geflossen.
Roth nahm seinen Sitz ein und sah rings um den Tisch jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau an. Auf den Gesichtern derjenigen, deren Augen seine Nachrichten in dieser letzten halben Stunde überflogen hatten, ließ er den Blick eine Sekunde länger ruhen. Es würde ein schöner Tag werden.
Helaina stand auf. »Ich danke Euch allen abermals dafür, dass Ihr zu diesem wichtigen Zeitpunkt hier seid. Was wir bisher gesehen und gehört haben, war bereits historisch. Ich möchte unsere Verhandlungen jetzt gern beschleunigen und uns alle zur Eintracht untereinander mahnen. Wir können es uns nicht leisten, den Fehler zu begehen, den Regent Corihehn vor so vielen Zeitaltern gemacht hat, als er Holivagh I’Malichael und den Rechten Arm des Eides im Krieg in die Bresche springen ließ, ohne auch nur vorzuhaben, Verstärkung zu schicken.« Sie deutete auf den leeren Sitz neben sich. »Die Sedagin werden hier nicht zu uns stoßen. Unser Verrat hat uns die Familienbande zu ihnen gekostet. Wir können es uns nicht leisten, hier Falsches vorzuspiegeln. Lasst uns beginnen. Ich bin erpicht darauf, Eure Gedanken zu hören.«
Ungewohntes Schweigen hielt mehrere Augenblicke lang an. Roth verstand das Zögern vieler, das Wort zu ergreifen, hatte er doch selbst dafür gesorgt. Er nahm es als Zeichen, dass er nicht warten musste – dass seine Zeit gekommen war. Also erhob er sich und begann, um den Tisch herumzugehen. »Herrin, vielleicht fällt es mir zu, den Anfang zu machen.« Er sah diejenigen an, die um den Tisch saßen, und ließ dann den Blick über die breite Galerie schweifen. Er dachte kurz an seine Zeit am Kai von Falhaven zurück, an die Ungerechtigkeiten, mit denen diejenigen überhäuft wurden, die an einem Ort wie diesem Saal keine Stimme hatten. Mit durchdringender, erhobener Stimme erklärte er: »Ich verhehle unsere offenen Meinungsverschiedenheiten nicht, Regentin Storalaith. Auch Ihr tut das nicht. Ich gestehe hiermit freimütig, dass ich in den letzten Tagen den Versuch unternommen habe, Euch Eures Amtes zu entheben, nicht, wie ich sogleich hinzufügen möchte, weil ich Euch persönlich oder sogar als Regentin nicht schätzen würde. Ich glaube einfach, dass Eure Zeit abgelaufen ist. Die Art von Herrschaft, die Ihr zu bieten habt, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen über die Tradition hinauswachsen, und es bedarf neuer Gedanken und der Kraft eines jüngeren Verstandes und Körpers, um all dies zu veranlassen. Wir sollten Euch für Eure Dienste ehren.« Roth blieb wenige Schritte von Helaina entfernt stehen und erklärte ernst: »Aber ich muss Euren Vorsitz bei diesem Mandat anfechten.«
Helaina ließ berechnend zu, dass sich das Schweigen in die Länge zog, bevor sie sagte: »Ihr habt hier keine Autorität. Nehmt Euren Platz wieder ein, Aszendent.«
»Herrin«, fuhr Roth in liebenswürdigem Ton fort, »es gibt keine Gesetze, denen diese länderübergreifende Versammlung gehorcht, und auch keine Regeln darüber, wie wir unsere Debatten abhalten sollten. Wir sind alle aus freiem Willen hier, und ich muss mich fragen, ob auch nur einer von uns überzeugt ist, dass Ihr nicht zu gebrechlich seid, diese Verhandlungen zu leiten oder gar den Krieg zu führen, auf den Ihr uns einschwören wollt.« Seine Stimme wurde herablassend. »Da wir gerade dabei sind … Glaubt irgendeiner von uns tatsächlich an Euren Vorwand dafür, uns hier zu versammeln?«
Wildes Gemurmel brandete durch den Saal – einige waren empört, andere nickten, als hätten sie das Gleiche gedacht. Wieder andere saßen nur da, starrten vor sich hin und warteten auf Helainas Antwort.
Sie stand auf und ging gemessen auf ihn zu. Hochgewachsen, wie sie war, sah sie ihm in die Augen und sprach mit klarer, kraftvoller Stimme, so dass alle sie hören konnten: »Ihr lenkt uns von wichtigen Belangen ab, und schlimmer noch: Ihr tut es vor dem Hintergrund Eurer eigenen politischen Agenda. Nun gut. Lasst uns die politischen Winkelzüge ein für alle Mal aus dem Weg schaffen. Dieser Mann«, sagte sie, und ihre Worte klangen bitter, während sie Roth finster anstarrte, »dieser Aszendent der Liga der Edukation, ist ein ehrgeiziger Mensch. Ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass er von den Glaubenssätzen überzeugt ist, die er befolgt – Glaubenssätzen, von denen er will, dass wir alle uns dazu bekennen. Aber sein Ehrgeiz macht ihn blind. Macht ihn gefährlich.« Sie wandte noch immer nicht den Blick ab und zuckte nicht mit der Wimper, während sie seinen Namen durch den Schmutz zog.
Roth bewunderte ihren eisernen Willen. Und er ließ ihr geduldig Zeit zu sprechen, bevor er seinen radikalen Vorschlag machen würde.
»Gegen den Aszendenten Staned und seine Liga wird wegen des Verdachts ermittelt, ein Kind vergiftet zu haben, um die Auflagen ihres Zivilisierungsgesetzes zu verschärfen. Gegen den Aszendenten Staned und seine Liga wird weiterhin wegen des Verdachts ermittelt, die Bastulan-Kathedrale in Brand gesetzt zu haben, einen Zufluchtsort und ein Wahrzeichen nicht nur für Decalam, sondern für Pilger aus vielen Eurer eigenen Länder. Ferner wird gegen den Aszendenten Staned und seine Liga wegen des Verdachts ermittelt, den Versuch unternommen zu haben, mich zu ermorden, wenige Tage bevor er im Hohen Rat von Decalam eine Abstimmung einberufen hat, in der er verkündete, für meine Nachfolge zu kandidieren.« Die Regentin hielt inne, und Roth setzte schon fast zum Sprechen an, als sie fortfuhr: »Und gestern Abend, nach unserem ersten Beratungstag, wurde der Erste Sodale E’Sau in seinem eigenen Schlafzimmer ermordet.«
Eine weitere Welle wilden Raunens toste durch den Mandatssaal.
Was die Regentin als Nächstes sagen würde, wurde Roth einen Moment zu spät bewusst, als dass er noch hätte einschreiten können.
»Gegen den Aszendenten Staned«, verkündete Helaina mit fanfarengleicher Stimme, die über das Flüstern und Getuschel hinwegtönte, »und seine Liga wird des Weiteren auch wegen des Todes des Ersten Sodalen ermittelt. Einzeln betrachtet«, fügte sie hinzu, »könnte man jeden dieser Vorfälle als Tragödie, Verbrechen oder bedauerlichen Unglücksfall bezeichnen. Aber zusammengenommen und angesichts der Tatsache, dass Indizien darauf hindeuten, dass in allen Fällen die Liga die Hand im Spiel hatte, zeugen sie von den Intrigen eines Mannes, der versessen darauf ist, eine Machtposition einzunehmen.«
Roth kämpfte gegen seinen aufsteigenden Zorn an. Er hatte nicht geahnt, dass Helaina die so feierlichen Beratungen beim Großen Mandat mit den Vorfällen in Decalam oder ihren Privatfehden besudeln würde. Bisher hatte sie stets besonderen Takt an den Tag gelegt, wenn sie größere Versammlungen geleitet hatte. Obwohl seine Wut hochkochte, musste er sich eingestehen, dass er wachsenden Respekt vor der alten Krähe empfand. Sie hatte sich auf sein Spiel eingelassen. Aber nun drohten ihre Worte, die Stimmung wieder zu ihren Gunsten umschwenken zu lassen. Ganz gleich, was die hier Versammelten von den alten Geschichten hielten, sie würden nicht viel Verständnis für Roths Blickwinkel aufbringen, wenn sie ihn für eine politische Bedrohung hielten.
ENDE DER LESEPROBE