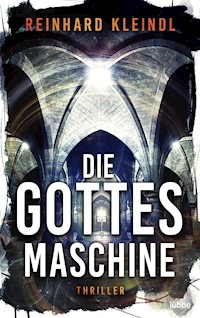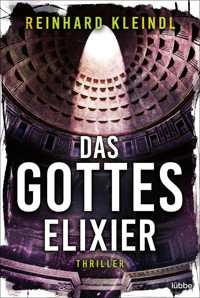
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie weit würdest du gehen, um ewig zu leben?
Als der einflussreiche Kardinal Pabil tot aufgefunden wird, ist die Verwunderung bei allen Beteiligten groß. Denn der Körper des 90jährigen Geistlichen wirkt wie der eines jungen, gesunden Mannes. Bischof Stefano Lombardi, der vom Vatikan auf den Fall angesetzt wird, glaubt nicht an ein Wunder. Hat Pabil möglicherweise ein medizinisches Mittel gegen das Altern gefunden? Wenn so ein Mittel existierte, wäre Unsterblichkeit keine Utopie mehr. Gemeinsam mit der Physikerin Samira Amirpour versucht Lombardi herauszufinden, was wirklich mit dem Kardinal passiert ist, und gerät dabei in Lebensgefahr. Denn es gibt eine Person, die alles tun würde, um zu verhindern, dass die Medizin Gott ersetzt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Wie weit würdest du gehen, um ewig zu leben? Als der einflussreiche Kardinal Pabil tot aufgefunden wird, ist die Verwunderung bei allen Beteiligten groß. Denn der Körper des 90jährigen Geistlichen wirkt wie der eines jungen, gesunden Mannes. Bischof Stefano Lombardi, der vom Vatikan auf den Fall angesetzt wird, glaubt nicht an ein Wunder. Hat Pabil möglicherweise ein medizinisches Mittel gegen das Altern gefunden? Wenn so ein Mittel existierte, wäre Unsterblichkeit keine Utopie mehr. Gemeinsam mit der Physikerin Samira Amirpour versucht Lombardi herauszufinden, was wirklich mit dem Kardinal passiert ist, und gerät dabei in Lebensgefahr. Denn es gibt eine Person, die alles tun würde, um zu verhindern, dass die Medizin Gott ersetzt …
ÜBER DEN AUTOR
Reinhard Kleindl ist ein österreichischer Thrillerautor, Wissenschaftsjournalist und Extremsportler. Er besuchte ein katholisches Gymnasium, studierte Theoretische Elementarteilchenphysik und diplomierte mit Auszeichnung. Internationale Bekanntheit erlangte er als Extremsportler, mit Slacklineaktionen an den Victoria-Wasserfällen und auf den Drei Zinnen. Er gehört zu den aktivsten Wissenschaftserklärern Österreichs und schrieb für Zeitungen, Magazine und Universitäten. Derzeit schreibt er freiberuflich für den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.
REINHARD KLEINDL
DAS
GOTTES
ELIXIER
THRILLER
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: René Stein, Kusterdingen
Titelmotive: © shutterstock.com: sakkmesterke; © stock.adobe.com: Bednarek | viperagp | ilolab
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2859-1
luebbe.de
lesejury.de
Für Romy
Die Geschichte beruht auf realen wissenschaftlichenTheorien und Fakten.
PROLOG
KUYÛNIK, PROVINZ MOSSUL (1837)
Pater Ryllo blickte auf, als er die aufgeregten Rufe hörte. Er hatte gerade seine Hände im Tigris gewaschen, der laut der Genesis im Garten Eden entsprang, hatte sein Spiegelbild mit dem immer vertrauter werdenden Turban betrachtet und über die Leute hier nachgedacht. Wie viel Potenzial in ihnen steckte, wenn sie sich nur ihrer Fähigkeiten bewusst wurden. Bis vor wenigen Jahren hatten mameluckische Statthalter das Land regiert, christliche Sklaven, die zu Herrschern erzogen worden waren. Doch der letzte Mameluckenpascha war zu eigensinnig geworden, und die Ottomanen hatten die Gebiete wieder unter die Kontrolle Istanbuls gebracht.
Ryllo wusste, dass er vorsichtig sein musste. Er war als Missionar hier, sein Einfluss als Jesuit wurde derzeit geduldet. Doch sein Sinn für Gerechtigkeit machte ihm die Arbeit schwer. Seine Predigten seien zu politisch, hatte man ihn gewarnt. Er riet den Leuten, sich gegen Unterdrückung aller Art zu wehren, was ebenso Argwohn erweckte wie seine Bestrebungen, überall Schulen zu errichten. Aber er war fest davon überzeugt, dass die Menschen ihr Schicksal letztlich selbst in die Hand nehmen mussten.
Ryllo wischte sich die Hände ab und folgte den Rufen. Er hatte einen jungen Mann losgeschickt, um sich nach der Stelle zu erkundigen, die von den Einheimischen Ninaa genannt wurde. Ein Name, der ihm vertraut erschien. Schon bei seiner Ankunft hatte er von seltsamen Ornamenten gehört, die in dieser Gegend gefunden worden waren und manche Gelehrte wahlweise als sinnlose Verzierungen, andere als heidnische Gebetsformeln ansahen.
Doch als Ryllo dem Mann folgte, führte dieser ihn nicht ins Dorf, wo sich vielleicht einer der Alten an etwas erinnerte, sondern auf den Hügel, der Ryllo vorhin schon aufgefallen war, weil er etwas zu regelmäßig schien. Als sie den steilen Hang hinaufkletterten, entdeckte er zerbrochene Tonziegel, und sein Herz schlug schneller.
Oben angekommen, zeigte ihm der Mann eine frisch ausgehobene Grube. Als er sah, was sich auf ihrem Grund befand, wusste er sofort, dass er mit seinem Verdacht richtiglag. Er hatte sich nicht getäuscht, als ihm der Name Ninaa bekannt vorgekommen war.
Ninaa – Ninive.
Was vor ihm lag und für Laien aussehen mochte wie ein Haufen Schutt, war ein Schatz, der den Schlüssel zum ältesten Geheimnis der Menschheit darstellte – einem Geheimnis, das gefährlich werden konnte, wenn es in falsche Hände geriet.
Ryllo musste dringend mit Rom Kontakt aufnehmen, damit der Heilige Stuhl davon erfuhr.
TEIL 1
LOMBARDI, ROM (HEUTE)
Nichts im Leben kommt so, wie man es plant.
Der Gedanke ging Stefano Lombardi durch den Kopf, als er um kurz vor halb acht morgens durch die Grenzkontrolle in der Via Tunica das Gelände des Vatikanstaats betrat. Die Kühle des Morgens lag noch in der Luft, doch der Himmel war wolkenlos und der Wetterbericht versprach einen warmen Tag, den ersten in diesem Jahr. Beim Aussteigen aus dem Taxi hatte er die Glocken des Petersdoms vernommen, was seltsam war, denn um diese Uhrzeit sollten sie eigentlich nicht läuten.
Der Wachsoldat der Schweizergarde nickte ihm zu.
»Exzellenza …«
Lombardi zuckte zusammen, nickte flüchtig zurück und eilte weiter. Heute trug er nach längerer Zeit wieder einmal seine Priestertracht mit schwarzem Kollarhemd. Es war für ihn ungewohnt, als Geistlicher erkannt zu werden. In Zivil fiel er normalerweise nicht auf, ein zurückhaltender Mann mittleren Alters, der langsam, aber sicher einen Bauch bekam.
Lombardi ließ den deutschen Friedhof hinter sich und hielt auf die Sakristei des Doms zu, die selbst die Ausmaße einer mittleren Kirche hatte. Er blickte hinauf zum Dom, der zu seiner Rechten wuchtig aufragte und dessen Glocken inzwischen wieder schwiegen. Konnte es ein Jux gewesen sein? Immerhin war gerade Karneval. Lombardi verwarf die Erklärung mit einem Kopfschütteln. Er durchquerte zwei aufeinanderfolgende Durchgänge zwischen der Sakristei und der Kirchenmauer, passierte das vatikanische Ausgrabungsamt und tauchte in die Gärten ein, die vom Regen der vergangenen Wochen in prächtigem, frischem Grün erstrahlten.
Er hatte einen Termin bei Kardinal Turilli. Seit Monaten wartete er darauf, und nun musste es auf einmal schnell gehen. Vor einer Stunde hatte er die E-Mail mit der Einladung erhalten. Er hatte gerade noch Zeit gehabt, sich umzuziehen und ein Taxi in die Innenstadt zu rufen. Und dank der Rushhour der römischen Metropole drohte er nun zu spät zu kommen.
Sein bester Freund, Alessandro Badalamenti, hatte ihm von seinem Vorhaben abgeraten.
»Der Heilige Stuhl gibt dir eine zweite Chance. Bist du sicher, dass du das in den Wind schlagen willst?«
»Ich schlage es doch gar nicht in den Wind. Ich bin sehr dankbar für die Nachsicht des Heiligen Stuhls. Und für deine Unterstützung. Das weißt du.«
Badalamenti hatte genickt. »Und doch könnte man das falsch auffassen. Eine Freundin? Die kennen doch deine Geschichte. Sie werden glauben, dass du eine Beziehung hast.«
Lombardi hatte sich unwohl gefühlt auf dem Sofa der Dachterrasse, von der aus Rom wie eine Spielzeugstadt ausgebreitet vor ihnen lag, der Hügel mit der päpstlichen Universität im Süden, die Kuppel des Petersdoms im Norden. Eine Skyline, die ihn schwindlig machte, wenn er darüber nachdachte. Die Gebäude hier wussten mehr Geschichten zu erzählen als in irgendeiner anderen Stadt der Welt. Wer in Rom ein Loch grub, stieß auf Gemäuer, die Könige beherbergt hatten oder Päpste. Julius Caesar was here, behauptete ein Graffiti an einer Hauswand hier in der Nähe.
Lombardi hielt sich nicht gern in Badalamentis Penthouse auf. Es erinnerte ihn an den Reichtum seines Freundes. Obwohl er wusste, dass Badalamentis Geschäfte sauber waren und dieses Penthouse mit Geld aus der Automobilzulieferindustrie bezahlt war, beschäftigte ihn dieser zur Schau gestellte Prunk.
»Du solltest dir langsam überlegen, was du wirklich willst«, war Badalamentis Ratschlag zum Abschluss gewesen.
Das war das Grundproblem, dachte Lombardi. Ein Bischof durfte nicht zweifeln, zumindest nicht so, wie er das tat. Schon gar nicht einer, der bis vor Kurzem eine so lupenreine Karriere hingelegt hatte.
So musste es von außen jedenfalls ausgesehen haben.
Vielleicht war sein Weg zu gerade verlaufen. Manche Männer fochten schwere Kämpfe mit sich und ihrem Glauben aus, bevor sie sich für das Priesteramt entschieden. Er wusste, dass die anderen seine Bodenständigkeit schätzten, die sie vielleicht sogar insgeheim für Einfältigkeit hielten – der unverdorbene Junge vom Land, wo gab es so etwas noch?
Lombardi hatte es mit seiner demütigen Art bis zum Bischof gebracht, unter großen Erwartungen der Diözese, er könne bald dem alten Bischof nachfolgen. Doch irgendwann waren angesichts der bevorstehenden Verantwortung auch ihm Zweifel gekommen. Er hatte sich in karitative Arbeit geflüchtet, bis er schließlich bei einem Hilfsprojekt in Afrika gelandet war. Lombardi hatte einer Händlerin ein Moped gekauft, der Mutter von acht Kindern einen Esel. Schließlich hatte er den Bau einer Schule finanziert und dort Chibuike kennengelernt. Und damit war alles erst richtig kompliziert geworden.
Es gab eine Szene, an die er oft zurückdenken musste. Sie hatte sich einige Monate nach seiner Weihe zum Bischof zugetragen. Er hatte mit Badalamenti und Kardinal Turilli in den vatikanischen Gärten Fußball gespielt, wobei sie sich einander den Ball zugeschoben und gekichert hatten wie Schuljungen. Schließlich war der Gärtner aufgetaucht und hatte zu einer Schimpftirade angesetzt, bis er Turillis Kardinalskluft erkannt hatte. Heute, Jahre später, glaubte Lombardi, dass es die letzte unbeschwerte Zeit in seinem Leben gewesen war. Auch wenn es danach noch Zeiten rauschhaften, verwirrenden Glücks gegeben hatte.
Doch auch das war inzwischen wieder Vergangenheit. Seit einiger Zeit versuchte er nun, sein Leben so zu akzeptieren, wie es war. Er fühlte sich ein wenig verloren, durchlebte Phasen der Melancholie, aber nichts, was einen daran hinderte weiterzumachen. Vielleicht war die bübische Fußballrunde weniger weit entfernt, als er glaubte. Es galt nur, mit Offenheit durchs Leben zu gehen, und das war sein Ziel.
Doch dann hatte er plötzlich diese eilige Nachricht aus dem Vatikan erhalten, einen Antrag betreffend, den er vor Monaten abgeschickt hatte.
Warum er ausgerechnet Turilli treffen sollte und nicht den zuständigen Beamten des Wirtschaftsrats, der Arbeitsvisa für Ausländer ausstellte, war ihm ein Rätsel, und er nahm sich vor, seinen Unmut zur Abwechslung einmal rauszulassen. Lombardi wusste, wie sensibel Aufenthaltsgenehmigungen im Vatikan waren und dass sie nur äußerst selten bewilligt wurden.
Dazu noch für eine afrikanische Lehrerin, die von dem Antrag gar nichts wusste.
Doch die Art und Weise, wie man ihn hinhielt, fand er unangemessen.
Vor Lombardi kam das zentrale Verwaltungsgebäude in Sicht, in dem sich Turillis Büro befand – ein massiver Komplex, der in die Innenstadt Roms gepasst hatte, hier in den Gärten aber deplatziert wirkte. Davor parkten Kleinwagen, von denen die meisten italienische Kennzeichen hatten. Nur wenige trugen weiße vatikanische Nummerntafeln mit dem Kürzel SCV. Er passierte ein Beet mit dem Wappen des Heiligen Stuhls und wollte die Straße überqueren, als er plötzlich einen Motor aufheulen hörte. Er trat instinktiv zur Seite, als ein niedriger, aschgrauer Sportwagen unmittelbar neben ihm zum Stillstand kam – ein Wagen, der ihm bekannt vorkam. Eine Frau hatte eine Mappe verloren und ließ eine Schimpftirade vom Stapel.
»Vaffanculo! Hier ist eine 30er-Zone!«
Doch der braun gebrannte Mann in dem blauen Slimfit-Anzug, der aus dem Maserati stieg, dessen Motor weiter leise schnurrend lief, ignorierte sie. Lombardi sah, dass er sich nicht getäuscht hatte, was den Wagen anging.
»Stefano, Gott sei Dank – du musst mitkommen!«, sagte Alessandro Badalamenti und ging auf ihn zu.
Lombardi brauchte eine Sekunde, um sich zu sammeln. »Bist du vollkommen wahnsinnig? Du hättest mich fast überfahren!«
Badalamenti wischte die Bemerkung mit einer Geste beiseite. »Ich erkläre dir alles. Jetzt steig schon ein!«
»Aber ich muss zu Turilli! Ich habe einen …«
»Turilli weiß Bescheid«, unterbrach ihn sein Freund und schubste ihn unsanft in Richtung Beifahrertür, öffnete sie und eilte um das Heck des Fahrzeugs herum, wobei er sich an der Kofferraumklappe abstützte.
Lombardi wollte noch etwas sagen, doch Badalamentis Blick duldete keinen Widerspruch. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen, und noch bevor er die Tür ganz geschlossen hatte, setzte sich der Sportwagen in Bewegung und Lombardi wurde in den überraschend harten Schalensitz gedrückt. Badalamenti wendete mit quietschenden Reifen, wobei das Heck über das kunstvoll aus kniehohen Büschen geformte Papstwappen schlitterte und Erde in hohem Bogen in die Luft wirbelte. Die Fußgängerin, die ihre Mappe wieder unter den Arm geklemmt hatte, rettete sich erneut mit einem Sprung zur Seite. Badalamenti raste in Richtung der Piazza Stazione, wo er scharf um die Ecke bog, die vatikanische Tankstelle passierte, die sich gleich neben dem Gästehaus der Heiligen Martha befand, in dem der Papst wohnte. Dessen Wachbeamte griffen erschrocken zu ihren Waffen, bevor sie Badalamentis Sportwagen erkannten.
Sie verließen den Vatikanstaat durch die Via Tunica, wo sie sich rechts hielten und sich in den römischen Stadtverkehr einordneten.
Badalamenti hatte zwar sein Vermögen in der Automobilzulieferindustrie gemacht, aber ein guter Autofahrer war er nie gewesen. Trotz des Sportwagens, den er sich leistete – alle zwei Jahre ein anderes Modell –, fuhr er nie schnell. Er war bekannt dafür, zu seinen eigenen Firmenmeetings zu spät zu kommen. Wer legte schon Wert auf Pünktlichkeit, wenn der Kaffee stark und gut war und die Pasta den richtigen Biss hatte? Seine Unbeschwertheit ließ sich normalerweise kaum erschüttern. Etwas Schlimmes musste passiert sein.
»Du wirst noch jemanden umbringen!«, sagte Lombardi. »Wo fahren wir überhaupt hin?«
Badalamenti kniff die Augen zusammen und hupte, als ein Radfahrer vor ihm keine Anstalten machte, zur Seite zu fahren.
»Turilli sagt, bei ihnen ist alles in Aufruhr. Es ist nur ein Gerücht.«
»Was für ein Gerücht?«
»Von einem Wunder.«
»Ein Wunder?«
»Noch unbestätigt. Die medizinische Kommission nimmt gerade ihre Arbeit auf. Aber Turilli will, dass wir für ihn einen Blick darauf werfen.«
Die Kommission. Es würde also eine offizielle kirchliche Untersuchung geben. Das klang nicht nach einem Gerücht. Hier ging es um mehr.
»Aber warum wir? Und wozu diese Eile?«
Badalamenti überholte den Radfahrer und stieß dabei fast mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Lombardi kam zum Schluss, dass es sicherer war, ihn nicht weiter abzulenken. Sie ließen den wuchtigen Komplex der Engelsburg hinter sich und fuhren in Richtung Osten. Lombardi musste sich immer wieder an den Seiten des Schalensitzes festhalten, wenn sein Freund mit quietschenden Reifen eine Kurve fuhr oder scharf bremste, weil sich irgendeine Lücke zwischen zwei Autos doch wieder geschlossen hatte.
Der Bahnhof Termini tauchte vor ihnen auf, und kurz darauf fanden sie sich in einem Viertel mit engen Gassen wieder, das von Schildern mit chinesischen Schriftzeichen beherrscht war. Badalamenti steuerte den Wagen in eine Seitengasse, die so schmal war, dass Lombardi überzeugt war, der breite Maserati könne unmöglich hindurchpassen. Bevor Lombardi etwas sagen konnte, rammte sein Freund einen Haufen nicht abgeholter Müllsäcke und brachte den Wagen auf einem kleinen Platz zum Stillstand, über den Wäscheleinen gespannt waren.
Sofort fiel Lombardi der Polizeiwagen auf, der quer vor einem Gebäude mit abbröckelndem Putz geparkt war. Vom Auto zu den Ecken des Hauses war ein Absperrband der Polizei gespannt. Davor hatte sich eine kleine Gruppe Schaulustiger versammelt. Ein Mann mit einer großen Spiegelreflexkamera beobachtete den Eingang, eine Frau hatte einen Rosenkranz in der Hand und betete.
Ein Polizist ging auf sie zu und blieb vor dem aussteigenden Badalamenti stehen.
»Da sind Sie ja endlich. Hier entlang. Wir haben nicht viel Zeit.«
Badalamenti bedankte sich, und sie folgten dem Mann, der sie zu ihrer Überraschung nicht zum Eingang führte, sondern in eine Seitengasse und von dort in ein weiteres Gässchen, das so schmal war, dass sie im Gänsemarsch gehen mussten. Eine Katze erschrak und lief davon.
Der Polizist brachte sie zur Hinterseite des abgesperrten Hauses, wo ein alter Lancia mit platten Reifen geparkt war. Sie betraten ein Treppenhaus mit zerbrochenen Bodenfliesen und hielten auf eine offen stehende Wohnungstür zu, aus der ihnen warme Luft entgegenkam, in der ein süßlicher Gestank nach faulem Obst hing. Als sie eintraten, verdichtete sich der Geruch, und Lombardi atmete flach durch den Mund. Sie durchquerten einen fensterlosen Korridor mit knarrendem Parkettboden, der mit dunklen Flecken gesprenkelt war. Lombardi machte unwillkürlich größere Schritte, um darüberzutreten. Durch einen Türspalt vor ihnen drang trübe Helligkeit. Der Gestank wurde beinah unerträglich. Als der Polizist die Tür aufstieß, erwartete ihn ein Bild, an dem nichts stimmte.
SAMIRA AMIRPOUR, REYKJAVIK
Samira Amirpour musterte den gealterten Naturschützer, der vor ihr auf einem Barhocker lungerte, und fragte sich, was sie hier eigentlich wollte. Die Bar, mit ihren Harpunen und Walknochen an den Wänden, war ein Relikt zwischen hippen Cafés. Draußen spuckte einer der isländischen Vulkane Feuer und lockte die Kundschaft weg. Der Barkeeper polierte gelangweilt Gläser, während Matthias Wank, ihr Fotograf, unruhig mit dem Fuß wippte.
Bereits als kleines Mädchen hatte sie Journalistin gespielt. Sie war ihren Eltern mit einem viel zu großen Notizblock in der Hand nachgelaufen und hatte in schlechtem Englisch Dinge wie Was sagen Sie dazu, Frau Amirpour? Herr Amirpour, ein kurzes Statement für unsere Leser! gerufen, wobei sie den Bleistift wie ein Mikrofon hochgehalten hatte, um danach konzentriert Kreise und Linien auf das karierte Papier zu malen. Sie trug dabei die zu große Brille ihrer Mutter, die kurioserweise ihrer jetzigen ähnelte, und auch die dunklen Haare, die sich wild zu locken begannen, wenn sie nicht täglich gebändigt wurden, waren damals schon die gleichen. Journalismus entwickelte sich während ihrer Schulzeit zu einer ernsthaften Option. Doch wenig später war ihre Liebe zu abstrakten Dingen erwacht, und es war alles anders gekommen.
Sie musste zugeben, dass es in ihrem Labor zuletzt einsam geworden war. Zwei Projektanträge für neue Forschungen waren abgelehnt worden, und so hatte sie ein paar alte Freunde angerufen. Eins hatte zum anderen geführt, und seither schrieb sie für ein Magazin namens Wunder der Wissenschaft. Bis vor einer halben Stunde hatte sich das perfekt angefühlt. Sie war extra für dieses Interview nach Island geflogen, und inzwischen fragte sie sich, ob das eine gute Idee gewesen war.
»Sie hören mir nicht zu«, sagte der Mann mit mehr Müdigkeit als Enttäuschung in der Stimme. »Niemand hört mir zu.«
Sein Name war Floris Meyer, ein Schweizer, der seit zehn Jahren in Reykjavik lebte und seine eigene Tierschutz-NGO unterhielt. Mit einem kleinen Schlauchboot hatte er mit wehenden Fahnen isländische Walfänger gejagt, doch die letzten Fotos auf seiner Website waren drei Jahre alt, und der rote Gummi seines Boots war blass geworden. Ohne Motor stand es auf einem Anhänger in der Nähe des Hafens. Doch nun war ihm der große Wurf gelungen, behauptete er.
»Ich höre Ihnen zu«, widersprach Amirpour. »Doch Sie müssen sich so ausdrücken, dass ich Sie verstehe. Ich habe mit Greenpeace telefoniert, und die wissen nichts von der Jagd auf geschützte Wale.«
Er wich ihrem Blick aus, und sie beugte sich zu ihm, bis er gezwungen war, ihr in die Augen zu sehen.
»Ich meine es ernst. Bitte. Was für ein Wal war das noch mal?«
Er seufzte. »Balaena mysticetus. Grönlandwal, früher auch Gemeiner Wal genannt. Er war einst der verbreitetste Wal überhaupt, bevor er gnadenlos gejagt wurde. Weil er so langsam schwimmt, ist er leichte Beute. Er war das erste Lebewesen überhaupt, das unter Schutz gestellt wurde. Heute gibt es noch fünftausend Exemplare.«
»Und es war bestimmt ein Walfangschiff, sagen Sie?«
Er zeigte auf das ausgedruckte Foto, das immer noch vor ihnen lag. »Sehen Sie doch!«
»Ich sehe da gar nichts«, gestand Amirpour.
Tatsächlich handelte es sich um einen unscharfen Umriss vor einem nächtlichen, blauen Sternenhimmel.
Er breitete fatalistisch die Arme aus. Amirpour verstand, dass ihr die Situation entglitt.
»Ich habe auch davon gelesen«, begann sie. »Isländische Walfänger jagen Finnwale, jedes Jahr, was erlaubt ist, weil es Tradition ist.«
»Ein Skandal!«
»Ein Skandal. Und sie verkaufen das Fleisch nach Japan. Was vermutlich ein viel größerer Skandal ist. Aber was Sie erzählen, ergibt keinen Sinn. Warum sollte jemand einen Grönlandwal jagen? Und nachts heimlich an Land bringen? Und wie überhaupt? Das muss doch ein enormer logistischer Aufwand sein.«
»Der Wal wurde an einem Strand nicht weit von Reykjavik an Land gebracht. Dort waren Scheinwerfer aufgestellt. Aber da waren überall bewaffnete Sicherheitsleute, ich konnte nicht näher ran.«
Amirpour verkniff sich die Frage, warum er davon keine Bilder hatte. »Aber warum?«, drängte sie.
»Ich verstand es erst auch nicht, habe mir den Kopf zerbrochen, wochenlang. Und dann entdeckte ich diesen Gebäudekomplex neben dem Erdwärmekraftwerk. Ist Ihnen der Stacheldrahtzaun drumherum aufgefallen?«
Tatsächlich war sie, auf den Hinweis von Meyer hin, zu dem Gelände gefahren und hatte vor dem Zaun gestanden. Jemand wollte keine Eindringlinge, das zumindest stand fest.
»Okay«, sagte Amirpour. »Angenommen, ich glaube Ihnen. Wie geht es weiter? Sie müssen mir mehr geben. Das hier ist keine Geschichte.«
Ein Lächeln blitzte in seinem Gesicht auf, und kurz sah sie den geistreichen, humorvollen und wahrscheinlich liebevollen Mann, der er einmal gewesen war.
»Ich habe eine Theorie«, sagte er. »Und ich bin bereit, Ihnen alles zu erzählen, wenn wir die Verwertungsrechte –«
In diesem Moment klingelte Amirpours Telefon. Sie sah, dass ihr Redakteur versuchte, sie anzurufen. Amirpour nahm das Gespräch an und presste das Telefon an ihr Ohr. Sie hörte seine Stimme, doch der Empfang war schlecht, er kam nur abgehackt durch.
»Warte, ich gehe hinaus, vielleicht ist es dann besser.«
Sie schaltete das Aufnahmegerät auf dem Tisch auf Pause und ging vor die Tür, wo sie schneidend kalte Luft empfing. Doch nun hörte sie plötzlich gar nichts mehr.
Sie überquerte die Straße, in der Hoffnung, dass es dort besser war. Als sie aus dem Schatten der Bar trat, traf das Sonnenlicht warm auf ihre Haut. Doch als sie wieder auf das Display blickte, war die Verbindung unterbrochen. Resigniert ließ sie das Gerät sinken. Vielleicht lag es an der Asche, die der Vulkan in die Atmosphäre spie. Es war schwer gewesen, ein Hotel zu bekommen, weil das Spektakel so viele Schaulustige anzog.
Wank war ihr ins Freie gefolgt. Abgesehen davon, dass er sie immer wieder unbeholfen anbaggerte, schien er in Ordnung zu sein. Seine Bilder waren gut. Und ab und zu schrieb er sogar selbst ein paar Zeilen zu seinen Fotos, auch wenn sie noch nie etwas von ihm gelesen hatte. Er wäre lieber zum Vulkan gefahren wie die Touristen. Vielleicht wäre das tatsächlich besser gewesen.
»Meyer ist gegangen«, sagte er. »Er war angepisst.«
»Kann ich nicht ändern.«
Wank hielt die Bilder hoch, die Meyer von dem Schiff gemacht hatte, und Amirpour nahm sie entgegen. Auch ihr Aufnahmegerät hatte er mitgebracht. Er blickte hinauf zu der Rauchsäule, die sich am wolkenlosen Himmel abzeichnete.
»Wissen Sie, wir könnten auch einmal etwas anderes machen«, begann Wank. »Eine echte Abenteuergeschichte.«
Amirpour stand mit dem Handy in der Hand da und überlegte, was sie jetzt tun sollte.
»Es muss nicht dieser Vulkan sein, wenn Sie nicht möchten. Ein Freund hat mir Bilder von Perlentauchern auf den Philippinen geschickt«, fuhr Wank fort. »Die können zehn Minuten die Luft anhalten! Er sagt, die Wissenschaftler können das nicht erklären.«
Amirpour nickte abwesend, während sie abwog, ob sie zurück ins Zentrum von Reykjavik gehen sollte, um zu sehen, ob sie dort Empfang hatte, oder ob sie sich besser auf die Suche nach einer WLAN-Verbindung machte.
»Perlentaucher«, wiederholte er. »Was denken Sie? Weiße Strände, blaues Meer. Einmal etwas anderes! Und wenn wir schon einmal dort sind, können wir ein bisschen Urlaub machen.«
Amirpour sah ihn an. »Sie wollen mit mir Urlaub machen?«
»Warum nicht? Wir harmonieren doch gut.« In dem Moment, in dem es ihm herausgerutscht war, wurde er rot.
Amirpour sah auf das Meer hinaus. Ein Eisberg trieb vor ihnen. Sie dachte daran, dass der Wind, den sie im Rücken hatte, direkt vom Nordpol kam.
»Ich finde das Polarmeer beeindruckender«, murmelte sie.
Er sah sie irritiert an, dann schüttelte er plötzlich den Kopf. »Das Polarmeer …«, wiederholte er verächtlich. »Sie wissen doch gar nichts über das Polarmeer.«
Amirpour drehte sich zu ihm um. »Was meinen Sie?«
»Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, mit Haien zu tauchen, wie es auf einem aktiven Vulkan riecht. Weil Sie in Ihrem Labor gesessen haben, während ich draußen in der Wildnis war, um Bilder zu machen.«
»Ich habe ein Handtuch im Gepäck. Wir könnten hineinhüpfen.« Sie deutete mit der Hand auf den Eisberg.
Er lachte. »Das Wasser hier hat unter zehn Grad.«
»Und wenn schon, so schnell kühlt der Körper nicht aus.«
»Wissen Sie was? Gehen Sie zurück auf Ihre Universität, wo Sie hingehören«, sagte Wank und trottete davon.
LOMBARDI
Im Zimmer herrschte Chaos. Zwischen dem Müll gab es kaum Platz, sich zu bewegen. Bücher, Kleidung, Bilder mit schweren Rahmen, alles lag wild durcheinander. In Regalen lagen Töpferwaren aus rohem Ton, von denen manche auf den Boden gefallen waren. An einem Bücherregal hing ein groß geschnittenes Abendkleid, daneben ein Pelzmantel. Mehrere volle Müllsäcke zeugten davon, dass jemand begonnen hatte aufzuräumen. Das Fenster war mit einer Jalousie verschlossen, durch die nur einzelne Lichtstreifen drangen. Auf dem Boden davor lagen tote Fliegen. Es stank so intensiv nach fauligem Obst, dass Lombardi sich einen Ärmel vor Mund und Nase hielt und einen Moment die Augen schloss. Als er sie wieder öffnete, brannte sich das Bild in seine Netzhaut.
Mitten im Raum stand ein riesiges, weißes Intensivkrankenbett, das inmitten des restlichen Mobiliars wirkte wie ein Raumschiff. Darin lag ein offensichtlich sehr alter Mann, die Decke bis zum Kinn hochgezogen. Das Bild erinnerte an Aufbahrungsriten für hohe Geistliche, doch mit absurden Abweichungen: Der Mann war intubiert, der Beatmungsschlauch war mit Klebeband an seinem Mund befestigt. Neben den Händen kam ein Schlauch unter der Decke hervor, der zu einem Infusionsbeutel an einem metallenen Ständer führte. Neben dem Bett standen Geräte, die nicht hierher gehörten, sondern eigentlich in der Intensivstation eines Krankenhauses stehen sollten, darunter ein Beatmungsgerät, ein EKG-Monitor und ein Defibrillator. Es gab noch weitere weiße, blinkende Apparate, die Lombardi nicht zuordnen konnte. Alles sah nagelneu aus, als wäre es gerade erst ausgepackt worden.
Lombardi wurde von Schwindel erfasst und konnte nicht sagen, ob es am Gestank lag oder daran, dass er kaum noch atmete. Das Gesicht des Mannes im Bett war abgemagert, mit eingefallenen Wangen. Die Haut wirkte zerbrechlich wie altes Papier. Die Augen waren kaum zu sehen, so tief lagen sie in den Höhlen. So maskenhaft dieses Antlitz auch war, so vertraut wirkte es zugleich auf Lombardi, obwohl er nicht sagen konnte, woran das lag.
Er hörte ein langsames, rhythmisches Geräusch und sah, wie sich der Brustkorb des Mannes hob und senkte. Abgesehen von dem Polizisten schienen sie allein zu sein, nirgendwo war medizinisches Personal zu sehen. Hatte man ihn aufgegeben? Ein Monitor zeichnete den Herzschlag auf, die Pulsfrequenz sah mit über hundertfünfzig Schlägen pro Minute und starken Unregelmäßigkeiten alles andere als gut aus.
Badalamenti stand inzwischen am Bett und begann, den Mann genauer in Augenschein zu nehmen. Er wollte gerade die Decke zurückschlagen, als hinter ihnen der Polizist den Raum betrat.
»Bitte nichts anfassen!«, flehte er. »Ich habe getan, was Seine Eminenz Turilli verlangt hat. Einen Blick, hat er gesagt.«
Badalamenti bückte sich nach etwas, das neben dem Krankenbett auf dem Boden lag. Der Polizist drängte sich zwischen ihn und das Krankenbett. Badalamenti schien einzusehen, dass er nicht näher randurfte, und begann, Fotos mit seinem Handy zu machen. Vor allem eine Hand, die unter der Decke hervorlugte, schien ihn zu interessieren. Lombardi trat ebenfalls näher, um die Hand genauer betrachten zu können. Sie wirkte sehr zart, mit heller Haut, fast wie aus Porzellan.
»Wer ist das?«, fragte er. »Kennst du ihn?«
Doch sein Freund war so konzentriert, dass er ihn nicht zu hören schien. In diesem Moment erklang aus dem Treppenhaus ein Rumpeln.
»Meine Kollegen müssen jeden Moment hier sein. Bitte, man darf Sie hier nicht sehen!«, drängte der Polizist.
Badalamenti machte ein letztes Foto, bevor er schließlich nickte. »Danke, dass Sie gewartet haben.«
Der Mann schien sehr erleichtert und griff zu seinem Telefon. Draußen war Getrampel zu hören, dann ging die Tür auf. Es handelte sich um zwei Sanitäter, die kurz wegen des Gestanks zusammenzuckten, bevor sie sich dem Mann in dem Krankenbett zuwandten. Ihnen folgte ein schwarz gekleideter, stämmiger Kerl, der einen kurz getrimmten, blonden Vollbart hatte und zu einem Sicherheitsdienst zu gehören schien.
Der Polizist hatte noch sein Handy am Ohr und starrte sie mit offenem Mund an. Er steckte das Telefon ein.
»Was machen Sie hier?«
Die beiden Sanitäter reagierten nicht. Es war der Mann in Schwarz, der sich mit einer beschwichtigenden Geste an den Polizisten wandte.
»Keine Sorge. Wir verlegen nur den Patienten«, sagte er mit unverkennbar skandinavischem Akzent.
»Wer hat das veranlasst?«, gab der Polizist zurück.
»Es ist mit Ihrer Dienststelle abgesprochen. Rufen Sie Ihre Kollegen an.«
»Davon weiß ich nichts. Mit wem haben Sie gesprochen?«
Darauf wusste der Mann in Schwarz keine Antwort. Unter dem blonden Bart zeichnete sich eine lange Narbe ab. Sein Lächeln hatte sich nicht verändert, und man konnte sehen, dass die Freundlichkeit nur gespielt war. Auch der Polizist bemerkte es und trat einen Schritt zurück. Er senkte die Hand zu seinem Gürtel, doch als er den Griff seiner Dienstwaffe berührte, war ein dumpfes Plopp zu hören. Ein Ruck ging durch den Körper des Beamten, und er sank zu Boden. Erst jetzt entdeckte Lombardi die Pistole mit dem Schalldämpfer in der Hand des Schwarzgekleideten.
Die Szene war so ruhig über die Bühne gegangen, dass Lombardi einen Moment zweifelte, ob er richtig gesehen hatte. Dann sah er einen Blutfleck, der sich langsam auf dem Uniformhemd des Beamten ausbreitete. Aus seinem Augenwinkel nahm er wahr, wie Badalamenti die Hände hob.
»Bitte, wir sind unbewaffnet!«, sagte er.
Der Mann, der auf den Polizisten geschossen hatte, richtete seine Waffe auf ihn. Lombardi war wie erstarrt und wartete darauf, das schreckliche Geräusch eines weiteren schallgedämpften Schusses zu hören, doch nichts passierte.
»Weitermachen«, sagte der Mann mit der Waffe in Richtung der beiden Sanitäter, die entsetzt den leblosen Polizisten anstarrten.
Während Lombardi noch immer wie betäubt war, schien Badalamenti hoch konzentriert.
»Wir sind gerade erst gekommen. Wir haben nichts gesehen. Lassen Sie uns gehen, bitte.«
Der Mann trat an ihn heran und versetzte ihm mit dem Ellbogen einen Schlag gegen den Kopf. Badalamenti ging zu Boden. Lombardi stürzte zu ihm hin.
»Keine Bewegung!«, fauchte der Mann.
Doch Lombardi war schon bei seinem Freund, der benommen schien, aber sofort mit der Hand anzeigte, dass es ihm gut ging.
Währenddessen begann der Blonde leise zu murmeln. Lombardi erkannte, dass er in ein Mikrofon sprach. Dann nickte er.
»Ihr beide, mitkommen«, befahl er.
Badalamenti rappelte sich auf und bekam sogleich vom Angreifer einen Stoß in den Rücken.
Mit weichen Knien ging Lombardi hinaus, gefolgt von Badalamenti und dem Bewaffneten. Als er auf die Hintertür zuhielt, kam ihm der Gedanke an eine Flucht in den Sinn. In welche Richtung konnte er sich wenden?
Doch er verdrängte die Idee schnell wieder. Er wäre viel zu langsam. Ihm blieb nichts weiter übrig, als zu tun, was der Mann von ihnen verlangte.
Draußen standen neben dem rostigen Lancia ein großer Krankenwagen, den Lombardi als Intensivtransportwagen erkannte – einen speziell ausgerüsteten Rettungswagen, mit dem Intensivpatienten verlegt werden konnten –, und ein weißer Lieferwagen. Der Bewaffnete trat kurz an das Fenster der Fahrertür, dann führte er seine beiden Geiseln zur Schiebetür und öffnete sie. Ein Stoß in seine Rippen beförderte ihn ins Innere des Lieferwagens. Sie setzten sich auf den Boden des Laderaums, in dem sich Kisten befanden, die etwas Militärisches an sich hatten. Der Mann schloss die Tür hinter ihnen. Einen Augenblick später heulte der Motor des Wagens auf, und sie setzten sich holpernd in Bewegung.
Lombardi wusste nicht, wie ihm geschah, aber er war froh, Badalamenti neben sich zu wissen.
Mein Gott. Sie haben den Polizisten erschossen.
Doch sie beide waren noch am Leben. Wo brachte man sie hin? Wer waren diese Leute?
Da bemerkte er, dass Badalamenti sich zu ihm beugte und ihn ansah.
»Nicht reden!«, herrschte ihn der Angreifer an.
Badalamenti zog sich sofort zurück und hob die Hände.
Lombardi versuchte zu eruieren, wohin sie fuhren. Im Stadtverkehr dauerte es bestimmt eine ganze Weile, um sie aus Rom hinauszubringen, vielleicht in ein Landhaus der Mafia oder das Lager eines Drogenkartells. Diese Leute waren eindeutig dem Kreis des organisierten Verbrechens zuzurechnen, auch wenn er keinen Schimmer hatte, was sie mit dem kranken Mann vorhatten. Lombardi unternahm einen Versuch, das Straßennetz der Stadt zu visualisieren, scheiterte aber. Sie konnten überall sein, es hatte keinen Sinn.
Als sie eine Weile geradeaus gefahren waren, bemerkte Lombardi, dass der Mann mit der Waffe seinen Blick auf die Scheibe zum Fahrerhaus richtete. Da spürte er eine Berührung am Arm. Sein Freund versuchte, ihm etwas mitzuteilen. Lombardi tastete nach Badalamentis Hand und fühlte plötzlich etwas Kühles, Rundes.
»Du musst jetzt genau zuhören. Zeig das Turilli, sag ihm, ich hatte recht.«
»STILL JETZT!«, schrie der Angreifer. Er wollte erneut mit dem Kolben der Waffe nach ihm schlagen, doch Badalamenti hob abwehrend die Arme.
»Das ist alles ein Missverständnis. Ich kann es erklären.«
Er stand auf und kam auf den überraschten Mann zu, es entstand ein Handgemenge, und ein Schuss löste sich. Durch das Dach des Wagens fiel plötzlich ein dünner Lichtstrahl. Da hatte der Angreifer die Gewalt über seine Waffe wiedererlangt, und kurz dachte Lombardi, dass sein Freund jetzt sterben würde. Doch der Mann zögerte. Als Badalamenti es bemerkte, versetzte er ihm einen Fußtritt. Der Mann stolperte und fiel rücklings hin. Badalamenti beugte sich zur Hecktür des Fahrzeugs und betätigte den Türgriff. Es wurde hell im Innenraum. Nun konnte Lombardi auch das Gesicht seines Freundes sehen, in dessen Augen ein seltsames Strahlen war.
»Hab keine Angst. Es sieht nicht so aus, aber das ist der Beweis, dass etwas Wunderbares geschieht.«
Hinter ihm regte sich der Angreifer, und bevor Lombardi überhaupt wusste, wie ihm geschah, bekam er einen Stoß und kippte nach hinten. Er prallte mit seiner rechten Körperhälfte hart auf die Straße und rollte mehrmals über den Asphalt, bevor er zum Liegen kam. Ein lautes Hupen ertönte, und ein Auto wich im letzten Moment aus. Ein zweites kam nur Zentimeter vor ihm zum Stillstand. Jemand stieg aus und beugte sich zu ihm hinunter.
»Signore – geht es Ihnen gut? Sind Sie verletzt?«, fragte ihn eine Frau.
Lombardi hob den Blick und versuchte, sich zu orientieren. Der Lieferwagen verschwand in der Ferne.
Er rappelte sich auf, und mithilfe der verdutzten Frau gelang es ihm, sich aufzurichten. Seine ganze rechte Seite schmerzte, doch er konnte stehen. Er wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton heraus.
Lombardi spürte etwas Feuchtes in seiner Hosentasche. Als er danach tastete, erkannte er, dass das Ding, das Badalamenti ihm gegeben hatte, ein Medikament war. Die Ampulle war zerbrochen.
DER GOTTESFÜRCHTIGE
An diesem Morgen war es noch ruhig in der Basilika. Im Zwielicht waren die Ausmaße des Gebäudes nur undeutlich erkennbar. Draußen war die Ewige Stadt erwacht und einem lebendigen, atmenden Körper gleich in flirrende Aktivität verfallen, doch bis hierher war der Trubel noch nicht durchgedrungen.
Niemand nahm Notiz von ihm, als er die letzten Stufen der Treppe unmittelbar vor dem Altar nahm und über die Absperrung stieg. Dabei kontrollierte er, ob an seinen Schuhsohlen noch Lehm klebte.
Er befand sich im Hauptschiff der Basilika. Vor ihm zogen sich vergoldete Rundbögen bis zum Zentrum hin, wo unmittelbar über dem Grab des Apostels der Altar errichtet worden war, überdacht von einem Baldachin, der von vier gewundenen Säulen getragen wurde.
Der Gottesfürchtige holte mit einer tausendmal geübten Bewegung seine Taschenuhr hervor, schüttelte sie und horchte am Gehäuse. Kurz hatte er das Gefühl, dass sie tickte, doch das musste eine Täuschung gewesen sein. Sie war vor einigen Wochen stehen geblieben, nachdem sie jahrzehntelang ein Muster an Verlässlichkeit gewesen war. Die Uhr war ein Geschenk seiner Mutter zu seiner Firmung gewesen. Er hatte daran gedacht, sie reparieren zu lassen, sich dann aber dagegen entschieden. Ihm gefiel der Gedanke, dass sie aus einem bestimmten Grund zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen geblieben war. Umso sonderbarer, dass er in den letzten Tagen das Gefühl hatte, ihr Ticken zu hören.
Du bist nur angespannt. Wegen dem, was kommt.
Er zwang sich zu einem Moment der Ruhe und blieb stehen, um den Dom auf sich wirken zu lassen, den Baldachin und das dahinter liegende Alabasterfenster Berninis aus dem Jahr mit der seltsamen Nummer 1666, das eine Taube zeigte. Er wusste, dass er diese Pracht vermutlich zum letzten Mal sah, und auf einmal wurde das Gefühl des Verlusts fast übermächtig. Er musste unwillkürlich schlucken.
Zwei Touristen begannen neben ihm laut zu kichern. Der Gottesfürchtige erwachte aus seiner Trance und blickte sich um. Ein schneller Griff zum Schulterhalfter, in dem seine Glock steckte – eine weitere Verlegenheitsgeste, die zunehmend Routine wurde, obwohl er die Waffe erst seit ein paar Wochen trug.
Er ermahnte sich, seine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Er hatte keinen Bedarf mehr für Symbole wie dieses, das für den Heiligen Geist stand. Die Zeichen verdichteten sich, dass der Wendepunkt nah war – jener Zeitpunkt, den sie Singularität nannten und an dem die bisher bekannten Gesetze ihre Gültigkeit verloren. Der Segen, den er in diesem Raum immer wieder empfangen hatte, war bedeutungslos geworden. Und falls ihn Zweifel heimsuchten, diente die Waffe unter seiner Achsel als Erinnerung daran, dass er die Brücken ein für alle Mal abgebrochen hatte.
Der Gedanke war unverändert seltsam. Er hatte dieser Autorität bisher alles untergeordnet, auch das Private, wenn es in seinem Leben je etwas gegeben hatte, das es wert gewesen war, privat genannt zu werden. Er hatte wahrlich viel aufzuholen, aber es eilte nicht.
Er erinnerte sich an eine weitere Arbeit von Bernini, das Grab von Papst Alexander VII., das über einem niedrigen Durchgang errichtet worden war. Er musste nur ein paar Schritte nach rechts gehen, um es hinter dem Baldachin ausmachen zu können. Unter der weißen Papststatue befand sich ein aus dieser Entfernung absolut lebensecht wirkendes Tuch, das in Wirklichkeit aus rotem Stein bestand. Darunter ließ sich ein aus Bronze gefertigtes Skelett ausmachen, dem jemand das Tuch über den Kopf geworfen zu haben schien. Ein groteskes Bild, das fast etwas Komisches hatte, würde der Tod nicht eine Hand unter dem Tuch hervorstrecken, in der er eine Sanduhr hielt. Es war eine Warnung, die der Gottesfürchtige zum ersten Mal mit anderen Augen sah. Er hatte das Grabmal so oft betrachtet, dass er es in- und auswendig kannte.
Einen Moment lang dachte er darüber nach, noch einmal hinunterzugehen und die Spitzhacke zu holen. Er fragte sich, ob die Sanduhr gleich abbrechen würde oder ob es mehrere Schläge brauchte. Die Verlockung war groß, doch er wollte das Risiko nicht eingehen. Wichtigere Dinge standen an.
Leb wohl. Du hast keine Macht mehr über mich.
Das Brummen seines Mobiltelefons riss ihn aus seiner Trance.
»Was ist?«, fragte er gepresst.
Als er hörte, was der Mann am anderen Ende zu sagen hatte, kühlte seine Wut ab. Es gab neue Entwicklungen. Die Schlacht war noch nicht geschlagen. Er hatte sich schon gefragt, ob es wirklich so leicht gehen konnte.
Er bedankte sich und beendete das Gespräch. Seine Leute waren auf Probleme gestoßen und verlangten Anweisungen. Er musste die Sache selbst in die Hand nehmen.
LOMBARDI
Als er wieder in der Lage war zu sprechen, gelang es ihm, die Fahrerin davon zu überzeugen, dass er nicht in ein Krankenhaus wollte. Sie ließ es sich aber nicht nehmen, ihn zurück zum Vatikan zu bringen, wobei sie sich lauthals über die Rücksichtslosigkeit der Autofahrer beschwerte.
»Er hat nicht einmal angehalten! Sie müssen Anzeige erstatten!«
Lombardi nickte nur und beobachtete den Verkehr. Der weiße Lieferwagen war nirgends mehr zu sehen.
Lombardi fasste vorsichtig in seine Tasche und versuchte, die Scherben herauszupicken. Es gelang ihm, ein größeres Stück zu fassen zu kriegen, auf dem ein Etikett klebte. Lombardi entzifferte mit Mühe einige englische Begriffe: … Lösung für subkutane Injektion … Verwendung laut Studienprotokoll …
Eine Herstellerangabe oder ein Logo fand er nicht. Überhaupt sah das Etikett ungewöhnlich aus. Als die Frau abrupt bremste, wäre ihm die große Scherbe beinahe aus der Hand gefallen.
»Wir sind da. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht?«
»Es geht schon. Danke, dass Sie mich gefahren haben.«
Lombardi schleppte sich zum zweiten Mal an diesem Tag an dem Gardisten am Grenzposten vorbei, der erneut salutierte. Er passierte den Platz vor dem Verwaltungsgebäude, wo der Gärtner mit mehreren Mitarbeitern gerade den Schaden an den Beeten begutachtete, und erreichte das Büro von Kardinal Turilli. Durch die geschlossene Tür hörte er laute Stimmen.
»… das ist nicht Ihre Zuständigkeit! Sie führen unsere sensiblen Prozesse ad absurdum! Und überhaupt – wer ist dieser Autohändler, dass er hier aus- und eingeht, wie es ihm passt?«
Die Antwort verstand Lombardi nicht, die zweite Person sprach leiser. Er glaubte aber, Turillis Stimme zu erkennen.
»Man hat mir gesagt, dass die Wohnung leer ist«, polterte der Mann. »Wie erklären Sie sich das? Nachdem Ihre Leute dort waren?«
Turilli antwortete etwas, doch der laute Mann unterbrach ihn. Er sprach Italienisch mit deutschem Akzent. »Er bewegt sich in diesen Mauern, als wäre er hier zu Hause. Was wollte er im Museumsmagazin? Weiß man das schon? Das ist unsere Untersuchung! Er hätte sich fernhalten müssen!«
Lombardi machte gerade noch rechtzeitig einen Schritt zur Seite, als die Tür aufflog und ein hochgewachsener Priester aus dem Raum stürmte, ohne sich umzusehen.
Lombardi trat ein und sah Kardinal Turilli, der an seinem Schreibtisch saß und den Kopf in die Hände gestützt hatte. Erst als die Tür ins Schloss fiel, nahm der Geistliche ihn wahr.
»Lombardi, da sind Sie ja. Wo ist Alessandro … mein Gott, was ist denn mit Ihnen geschehen?«
Turilli sprang auf, so schnell es seine Leibesfülle erlaubte. Er schien in letzter Zeit zugenommen zu haben, was seiner Gestalt eine fast barocke Unförmigkeit gab. Es war die Art von widersprüchlicher Anmutung, die Maler und Bildhauer inspirierte. In der Art und Weise, wie er ihm voller Sorge zu Hilfe eilte, erkannte Lombardi aber sofort den alten Turilli. Als er den Griff des Kardinals spürte, gaben seine Knie nach.
»Bitte, ich möchte mich setzen«, sagte Lombardi.
Turilli führte ihn zu seinem Schreibtisch und holte einen Stuhl, in den sich Lombardi fallen ließ.
»Ich hole einen Arzt«, sagte Turilli, doch Lombardi bedeutete ihm mit einer Geste zu schweigen. Er brauchte nur einen Moment Ruhe, sonst nichts. Als er sich das Geschehene vergegenwärtigte, schnürte sich ihm der Hals zu, und die Gefühle drohten ihn zu überwältigen.
»Was ist geschehen?«, fragte Turilli. »Wo ist Alessandro?«
Lombardi kämpfte um Beherrschung und begann zu sprechen, und als er einmal angefangen hatte, sprudelte es regelrecht aus ihm heraus. Als er berichtete, wie der Polizist erschossen wurde, unterbrach ihn der Kardinal.
»Man hat auf ihn geschossen?«, fragte er fassungslos.
»Ja. Ich glaube, er ist tot.«
Obwohl er nicht sicher war, ob Turilli ihm glaubte, erzählte er weiter. Als er geendet hatte, wankte Turilli mit hängenden Schultern hinter seinen Schreibtisch. Lombardi war erleichtert und spürte nun, wie erschöpft er war. Doch die Unruhe kehrte schnell zurück.
»Da ist noch etwas. Bevor er die Tür des Wagens öffnete, hat er mir das hier für Sie gegeben.«
Er fasste in seine Tasche und zog die Scherbe mit dem Etikett der Flasche heraus.
Turilli stand auf und beugte sich darüber, als wäre es vergiftet. Die Inschrift schien ihn zu irritieren.
»Was bedeutet es?«, fragte Lombardi.
»Sonst hat er nichts gesagt?«
Lombardi verneinte. Turilli schien ratlos, und Lombardi nahm ihm das Etikett wieder aus der Hand. Er ließ nicht locker.
»Was haben wir dort gesehen? Alessandro meinte, Sie hätten ihn beauftragt. Ich hätte heute einen Termin mit dem Wirtschaftsrat haben sollen, doch stattdessen wurde ich zu Ihnen geschickt, und dann gabelt mich zufällig Alessandro auf. Was ist hier los?«
Turilli sah zu ihm auf. »Haben Sie sein Gesicht gesehen? Können Sie sagen, ob Sie ihn kannten?«
Lombardi schüttelte den Kopf. »Hätte ich ihn kennen sollen?«
»Hat Alessandro irgendwas gesagt?«
Lombardi wurde zornig. »Ich habe gerade zugesehen, wie ein Mann erschossen wurde, und ich bin selbst mit dem Tod bedroht worden! Sie sind mir eine Erklärung schuldig.«
»Sie haben vollkommen recht«, sagte Turilli schuldbewusst. Doch er schien nicht zu wissen, wie er anfangen sollte.
»Vor zwei Stunden machte hier ein Gerücht die Runde«, begann er schließlich. »Dass ein Wunder geschehen sei. Eine medizinisch nicht erklärbare Heilung.«
Lombardi wartete auf weitere Ausführungen. »Der Mann vorhin«, half er Turilli auf die Sprünge, »das war doch Severin Gaisel, nicht wahr?«
Turilli nickte. Gaisel war Leiter der vatikanischen Behörde, die Selig- und Heiligsprechungen behandelte. Im Rahmen von Heiligsprechungsprozessen wurde im Umfeld des Kandidaten nach Wundern gesucht – spontane Heilungen, unerklärbare Erscheinungen. Dafür wurden sogar medizinische Sachverständige verpflichtet, insbesondere Atheisten, die nach einer natürlichen Erklärung für das jeweilige Phänomen suchten. Erst wenn dieser medizinische Beirat keine wissenschaftliche Erklärung fand, wurde das Wunder als solches akzeptiert, und der Heiligsprechungsprozess ging seinen weiteren Gang. Es handelte sich um ein Politikum und eine wichtige Einnahmequelle für den Heiligen Stuhl, denn solche Untersuchungen kosteten viel Geld. Dabei wurden vom Dikasterium für Selig- und Heiligsprechungen, wie die Behörde genannt wurde, mit großer Regelmäßigkeit Wunder identifiziert – allein unter den letzten drei Päpsten wurden über tausend Menschen heiliggesprochen, es gab also, laut Untersuchungen des Vatikans, mindestens zweitausend dokumentierte Wunder ohne wissenschaftliche Erklärung allein in diesem Zeitraum.
Lombardi kannte Gaisel nur flüchtig. Er war ein Mystiker alter Schule, der sich stundenlang darüber unterhalten konnte, wie viele Engel auf einem Stecknadelkopf Platz fanden – ein leidenschaftlicher, streitbarer Mensch, der gern recht behielt und den die Ministranten hinter vorgehaltener Hand Gaisel Gottes nannten. Lombardi wäre nicht auf die Idee gekommen, einem wie ihm eine vatikanische Behörde zu übertragen, aber seit der letzten Kurienreform waren Besetzungen wie diese häufiger geworden – die Kardinalswürde war keine Voraussetzung mehr für höchste Ämter, und sogar Frauen waren nicht mehr davon ausgeschlossen. Gaisel erfüllte seine Aufgabe mit Feuereifer, der selbst innerhalb des Vatikans außergewöhnlich war.
»Er will eine kanonische Untersuchung beginnen«, erklärte Turilli.
»Wie kommt er darauf?«, fragte Lombardi.
Turilli konnte Lombardi nicht in die Augen sehen. »Gaisel hat medizinische Befunde, die er überall herumzeigt, Blutuntersuchungen, Röntgenbilder. Jemand hat sie ihm zugespielt, aber wir wissen nicht, wer.«
Lombardi schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was wir dort gesehen haben, aber ich traue mich zu sagen, dass es kein Wunder war.«
Turilli zögerte. »Sind Sie sicher, dass sich alles wirklich genau so zugetragen hat, wie Sie es mir erzählt haben?«
Lombardi sah zu ihm auf. »Was soll das denn bedeuten?«
Der Kardinal suchte nach Worten, dann platzte es aus ihm heraus. »Was Sie erzählen, ergibt keinen Sinn! Warum sollte jemand auf Polizisten schießen? Und warum sollte Alessandro so seltsam reagieren?«
Turilli kämpfte sichtlich mit sich. Lombardi wusste, dass er und Badalamenti sehr vertraut waren. Der Geistliche war der Grund, warum ihr gemeinsamer Freund sich im Vatikan so frei bewegen konnte, warum er in verschiedenen informellen Gremien saß und zu Wirtschaftsfragen und Fragen der Medienarbeit hinzugezogen wurde. Vieles, was dort besprochen wurde, war streng geheim und nicht für fremde Ohren bestimmt, nicht einmal für die eines römischen Weihbischofs.
Er weiß mehr, als er zugibt.
»Es tut mir so leid, dass ich Sie da hineingezogen habe«, flüsterte Turilli. »Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Alessandro niemals hingeschickt. Ich entschuldige mich.«
»Das ist doch jetzt egal.« Lombardi stand auf, und sofort wurde ihm schwindelig, sodass er sich an der Tischkante abstützen musste.
»Meine Güte, Sie müssen wirklich in ein Krankenhaus«, sagte Turilli.
Lombardi wartete, bis der Schwindel nachließ, dann schüttelte er den Kopf. »Ich will nur wissen, ob es Alessandro gut geht.«
»Dann sollten wir jetzt die Polizei informieren. Sie müssen berichten, was Sie erlebt haben!«
Bei dem Gedanken war Lombardi nicht wohl. Er hatte Angst, dass man ihm nicht glauben könnte. Schließlich glaubte er es selbst kaum.
»Ich meine natürlich die Gendarmeria Vaticana. Es gibt da einen Mann, dem ich vertraue. Und danach überlegen wir beide, was wir für Alessandro tun können.«
FLORIS MEYER, REYKJAVIK
Es war immer noch Tag in Reykjavik, doch Floris Meyer konnte nicht länger warten. Die Sonne war soeben hinter der Rauchsäule des Vulkans verschwunden, und ein sonderbares Zwielicht legte sich über die Landschaft.
Dazu war Wind aufgekommen, über den Meyer froh war. Er wirbelte Staub und alten Schnee auf und bot ihm Schutz, auch wenn die beißende Kälte Gift für seine Gelenke war und ihm das Gesicht abfror.
Meyer trug eine mit Klebeband geflickte Daunenjacke, und sein Rucksack war schwerer als zuletzt. Er hätte längst beim Zaun sein sollen, doch jedes Mal, wenn er aufblickte, brannten ihm Eiskristalle in den Augen. Er bewegte sich einfach langsamer vorwärts als das letzte Mal. Der Zaun würde kommen.
Bisher war er noch nie auf der anderen Seite des Zauns gewesen. Er hatte gehofft, dass das nicht nötig sein würde. Doch sie hatte ihm nicht geglaubt, genau wie die anderen. Er musste es selbst in die Hand nehmen, die Beweise zu beschaffen.
Als der Zaun schließlich auftauchte, wäre er fast hineingelaufen. Seine Finger ertasteten die kalten Drahtmaschen, als müsste er sichergehen, nicht zu träumen. Meyer stellte seinen Rucksack ab und holte den schweren Bolzenschneider heraus. Mit diesem Teil konnte er auch Vorhängeschlösser knacken, wenn es nötig war. Er hatte keine Lust, ein zweites Mal herzukommen.
Meyer durchtrennte einen Draht nach dem anderen, bis ein Teil des Geflechts scheppernd zu Boden fiel. Dann packte er den Bolzenschneider wieder ein und schob sich vorsichtig durch das Loch.
Er war drin. Davor hatte er sich gefürchtet, doch es gab kein Zurück. Er dachte an das alte, leckgeschlagene Boot im Hafen von Reykjavik. Diese Geschichte war seine Rettung.
Mit eingezogenem Kopf ging er weiter. Kurz darauf tauchten die Umrisse eines Gebäudes auf.
LOMBARDI
Lombardi war froh gewesen, dem jungen, etwas steifen Gendarmen seine Geschichte zu erzählen. Der Beamte hörte sich alles ruhig an, und obwohl seine Augen größer wurden, je länger Lombardi erzählte, schien er ihm zu glauben und unterbrach ihn kein einziges Mal. Zum Abschluss ließ er sich noch Lombardis Nummer geben.
»Was geschieht jetzt?«, fragte Lombardi.
»Wenn es stimmt, was der Polizist Ihnen gesagt hat, dann müssen seine Kollegen ihn inzwischen gefunden haben«, sagte der Gendarm.
»Das ist alles? Mein Freund ist in der Gewalt dieser Leute!«, ereiferte sich Lombardi. »Sie müssen doch irgendetwas tun!«
»Sobald ich weiß, wer die Ermittlungen übernimmt, werde ich Kontakt aufnehmen. Und wenn ich etwas erfahre, gebe ich Ihnen Bescheid.«
»Uns wäre sehr daran gelegen, wenn Sie damit noch etwas warten«, schaltete sich Turilli ein.
Lombardi riss ungläubig die Augen auf, und auch der Beamte schien nicht besonders glücklich zu sein.
»Bischof Lombardi steht unter Schock. Geben wir ihm etwas Zeit, bevor die römische Kriminalpolizei über ihn herfällt.«
»Ich sehe, was ich tun kann«, entgegnete der Gendarm, nahm sein Mobiltelefon und ließ sie allein.
»Schauen Sie nicht so«, sagte Turilli. »Das verschafft uns eine Atempause, die wir nutzen müssen, um herauszufinden, wie wir Alessandro helfen können.«
Lombardi schluckte seinen Unmut hinunter. »Gaisel hat vorhin etwas gesagt, das ich nicht genau verstanden habe. Alessandro war im Magazin des Museums?«
»Sind Sie sicher, dass Sie nicht …«
»Mir geht es gut«, unterbrach Lombardi eindringlich, obwohl es nicht stimmte.
Turilli seufzte. »Was Gaisel gesagt hat, ist wahr. Ich zeige es Ihnen, kommen Sie mit.«
Kurz darauf standen sie in der Kaserne der Schweizergarde und starrten über die Schulter eines Soldaten in Zivil auf die Monitore der Überwachungskamera. Turilli hatte erst den Chef der Garde überreden müssen, doch Turillis Nervosität schien ihn überzeugt zu haben.
Das Bild zeigte eindeutig Badalamenti, sein entschlossener Gang war unverkennbar. Er durchquerte eilig die unterirdischen Räume, die mit Kunstgegenständen aus aller Welt gefüllt waren – Geschenke für die Päpste, die über die Jahre zu einer der bedeutendsten Sammlungen der Welt herangewachsen waren und Stücke von unschätzbarem Wert enthielten. Lombardi hatte immer geglaubt, dass diese Räumlichkeiten sicher seien wie ein Tresorraum, aber er hatte sich offenbar getäuscht.
»Was hat er da in seiner Hand?«, fragte Turilli.
Gerade hob Badalamenti etwas auf, das so groß war wie eine Untertasse. Dann warf er einen Blick hinauf zur Überwachungskamera, deren Position er offenbar genau kannte, und verschwand eilig wieder.
»Hat er es mitgenommen?«, fragte Lombardi ungläubig. »Weiß jemand, was sich in dieser Abteilung befindet?«
Niemand antwortete ihm.
»Wir müssen dorthin«, sagte Lombardi und zeigte auf den Bildschirm. »Wir müssen wissen, was er dort wollte. Können Sie das arrangieren?«
Turilli biss die Zähne zusammen, widersprach aber nicht.
FLORIS MEYER
Meyer konnte sein Glück kaum fassen. Die beiden Wachen waren direkt an ihm vorbeimarschiert. Er hatte sich nicht aus seiner Deckung hinter einem Abluftgebläse gewagt und nur die geschnürten Stiefel ausmachen können. Als ihre Stimmen ganz verstummt waren, ging Meyer weiter. Er hielt auf das Gebäude zu, einen niedrigen Komplex, der mit einigen Glashäusern verbunden war.
Meyer schlich in angemessener Entfernung am Gebäude entlang. Während er nach offenen Fenstern Ausschau hielt, fiel ihm ein seltsamer Geruch auf, wie jener, der von Tierexkrementen stammte. Er wusste, was das bedeutete.
Ich hatte recht! Das ist der Beweis!
Er wollte es dieser Journalistin ins Gesicht schreien, die ihm nicht zugehört hatte: Es ging hier nicht bloß um Walfang. Diese Geschichte war viel größer. Doch er wusste, dass er nicht voreilig sein durfte. Er brauchte echte Beweise. Als er die Hinterseite des Gebäudes erreichte, entdeckte er eine Tür, neben der ein großer Schneehügel aufgeschüttet war. Sie war vermutlich auch alarmgesichert und noch dazu verschlossen. Doch er war hier am Rand des Geländes, wenn etwas schiefging, konnte er zum Zaun rennen und dort ein Loch hineinschneiden. Bis jemand reagieren konnte, wäre er längst über alle Berge.
Meyer atmete durch den Mund, während er sich dem Gebäude näherte. Es handelte sich um eine simple Tür aus Stahlblech, die er mit seinem Bolzenschneider wie eine Dose Bohnen aufhebeln konnte.
Da war das altbekannte Kribbeln wieder. Er tat es wirklich. Er zog nicht den Schwanz ein. Bald würde ihn niemand mehr Mongo nennen, Kurzform für My Own NGO, ein Schmähbegriff für Ein-Mann-Organisationen wie ihn. Heute wurde selbst aktivistische Arbeit in nackte Zahlen gegossen. Ein guter Mensch konnte nur sein, wer effizient half, so wie dieser junge Milliardär, der sein mit Kryptowährungen aufgebautes Unternehmen wohltätigen Zwecken spenden wollte.
Doch er würde beweisen, dass ehrlicher Aktivismus wie der seine immer noch einen unentbehrlichen Beitrag leistete.
Er brauchte die Journalistin nicht. Wenn er erst Bilder vom Inneren hatte, würde jedes Medium der Welt darüber berichten.
Meyer setzte den Rucksack ab, um den Bolzenschneider herauszuholen, probierte aber doch die Türklinke.
Die Tür schwang auf. Es gab keinen Alarm.
Er war drin.
LOMBARDI
Am Eingang zum Magazin des Vatikanischen Museums sahen sie zu, wie die Nonne, die sie hergeführt hatte, mittels Fingerabdruck und Eingabe eines Codes die Glastür entriegelte.
Sie befanden sich in jener verborgenen Ebene unmittelbar unter der der Vatikanstadt, in der sich das Petrusgrab und das Geheimarchiv befanden.
»Wäre es möglich, dass wir uns allein umsehen?«, fragte Turilli, während Lombardi vorausging, ohne die Antwort abzuwarten.
Als drinnen flackernd das Licht anging, glaubte er sich in einen Abenteuerfilm versetzt. Im Hauptraum, der etwa hundert Quadratmeter maß, befanden sich die großen Objekte, die zur ethnologischen Sammlung gehörten – Statuen aus Stein, Möbel aus Holz, ein präkolumbianischer Totempfahl, eine sechsarmige Shiva-Skulptur, eine grün schillernde Federkrone und ein chinesischer Drache. Diese Stücke waren, wenn sie nicht Geschenke für den Heiligen Stuhl gewesen waren, von Missionaren in aller Welt zusammengetragen worden. Manche von ihnen, wie der Jesuit Diego de Landa, der in Mexiko die Maya den christlichen Glauben gelehrt hatte, waren immerhin so klug gewesen, die heimische Kultur zu dokumentieren, bevor sie sie zerstörten. Viele dieser Exponate waren die letzten ihrer Art, ein Schatz von unschätzbarem Wert, vielleicht bedeutender als die bekannteren Kunstwerke von Raffael und Michelangelo oder die antiken Skulpturen, die in den Vatikanischen Museen ausgestellt waren. Während Lombardi staunend dastand, hatte Turilli keine Augen dafür.
»Hier entlang!«
Sie betraten einen kleinen Raum, an dessen Wänden Regale standen, sodass in der Mitte gerade noch Platz für zwei Personen blieb. Turilli zog weiße Handschuhe an und nahm vorsichtig eine braune Schachtel heraus.
»Es muss etwas aus diesem Regal gewesen sein.«
Er hob den Deckel an, und darin befand sich, auf ein Tuch gebettet, eine kleine Tontafel in der Form einer Teigtasche. Sie war über und über mit kleinen dreieckigen Abdrücken gefüllt.
»Keilschrift«, sagte Lombardi.
Turilli nickte. »Das hier ist die orientalische Sammlung. »Aber warum eine antike Tontafel? Was sollte er damit wollen?«
»Vielleicht hilft es, wenn wir wissen, welches Stück er sich angesehen hat«, meinte Lombardi und nahm eine der Schachteln in die Hand.
»Nicht!«, entfuhr es Turilli.
Doch Lombardi war bereits dabei, eine Schachtel nach der anderen zu öffnen.
»Keine Sorge, ich fasse die Stücke nicht an.«
Turilli mahnte ihn zur Vorsicht, doch Lombardi hörte ihn kaum. Einige der Schachteln enthielten kleine Zylinder aus Stein oder Elfenbein, Rollsiegel, die man in weichen Ton drücken und dann die darauf in Spiegelschrift geschriebenen Zeichen abrollen konnte. Er fand ägyptische Stücke mit Hieroglyphen, aber keine weitere Tontafel.
Schließlich entdeckte Lombardi eine Schachtel, die ihm leichter erschien als die anderen. Er öffnete den Deckel und sah seinen Verdacht bestätigt.
»Da, sehen Sie!«
Doch Turilli hörte ihn nicht. Er war ganz auf sein Telefon konzentriert.
»Sie hatten recht.«
»Womit hatte ich recht?«, fragte Lombardi.
»Sehen Sie selbst.«
Lombardi las die Schlagzeile auf der Website des Messagero und verstand, wovon Turilli sprach.
An einer Autobahnauffahrt südlich von Rom hatte man einen toten Polizisten gefunden.
FLORIS MEYER
Der Geruch war wieder da, stärker als vorhin. Trotz der Dunkelheit, in der er sich vortastete, war er sicher, dass sich in diesem Bereich mehrere Gehege für Tiere befinden mussten.
Meyer spürte etwas Weiches unter seinen Füßen. Wo war er hier wirklich gelandet? Er beschloss, einen Blick mit seiner Taschenlampe zu riskieren, und sah, dass er recht gehabt hatte: Es handelte sich um Kot, aber die schwarzen Brocken waren kleiner, als er gedacht hatte. Er atmete erleichtert auf. Er hatte schon Angst gehabt, im Käfig eines gefährlichen Raubtiers gelandet zu sein. Doch der Raum schien leer zu sein, abgesehen von ein paar im Boden fixierten Ästen, die entrindet worden waren und wie kleine Bäume nach oben ragten. Meyer richtete den Strahl seiner Lampe höher, etwas Großes hing an der Decke. Da traf ihn etwas Weiches im Gesicht, und im selben Moment brach um ihn herum die Hölle los.
Schrilles, ohrenbetäubendes Geschrei schien von überallher zu kommen und raubte ihm die Orientierung. Meyer hob die Hände über den Kopf, als etwas Pelziges, Kratzendes ihn im Genick berührte. Er verlor seine Taschenlampe und schrie auf. Instinktiv rannte er zurück zu der Tür, durch die er gekommen war, doch er fand sie nicht mehr. Er trat mehrmals auf etwas Weiches, das ein quietschendes Geräusch von sich gab. Meyer tastete mit den Händen die Wand ab und versuchte verzweifelt, sich an die Position der Tür zu erinnern. Weiter nach rechts? Oder nach links? Alle paar Sekunden spürte er, wie etwas gegen seinen Kopf stieß. Als etwas sein Auge berührte, griff er reflexartig danach und hielt für einen kurzen Moment ein kleines Tier in seiner Hand. Da erst verstand er, womit er es zu tun hatte: Fledermäuse. Meyer duckte sich und blieb ruhig stehen, wobei er den Kopf mit seinen Händen schützte. Langsam ließ das Wirbeln um ihn herum nach.
In diesem Moment wurde der Raum von Licht geflutet. Jemand hatte die Tür geöffnet. Das Wirbeln der Fledermäuse ging wieder los. Doch Meyer hatte genug gesehen, in dem Augenblick, als die Tür aufschwang, hatte er eine weitere Tür am anderen Ende des Raumes ausgemacht. Er rannte los.
»Hæ þú!«, rief der Mann, der an der geöffneten Tür stand. »Sie da, halt!«, fügte er auf Englisch hinzu, als Meyer nicht reagierte. Doch da hatte er die andere Tür bereits erreicht.