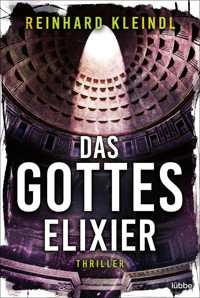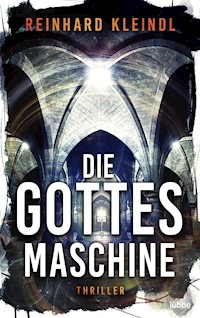
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der römische Weihbischof Lombardi wird in ein Kloster im Montblanc-Gebiet geschickt, das eine geheime Forschungseinrichtung betreibt. Gleich am ersten Abend findet er den Mönch Sébastien brutal gekreuzigt im Computerraum. Kurz darauf wird das Kloster von der Außenwelt abgeschnitten, und Lombardi ist auf sich gestellt. Gemeinsam mit der Physikerin Samira Amirpour findet er heraus, dass Sébastien eine Entdeckung gemacht hat, die die Grundfesten der katholischen Kirche erschüttert. Und dieses Wissen wird nun auch für Lombardi lebensgefährlich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Wer nach Gott sucht, wird den Tod finden Als Gefallen für einen guten Freund reist der römische Weihbischof Lombardi in ein abgelegenes Kloster im Montblanc-Gebiet. Hier erforschen Wissenschaftler aus aller Welt mit einem leistungsfähigen Supercomputer die Geheimnisse der Schöpfung. Aber der Frieden wird zerstört, als Lombardi den Mönch Sébastien, den er treffen sollte, tot im Computerraum findet. Die Leiche weist Spuren eines grausamen Rituals auf und ist mit rätselhaften Symbolen übersät. Gemeinsam mit der Physikerin Samira Amirpour findet Lombardi heraus, dass Sébastien eine folgenschwere Entdeckung gemacht hat. Und dieses Wissen wird nun auch für Lombardi und Amirpour lebensgefährlich …
Über den Autor
Reinhard Kleindl ist ein österreichischer Thrillerautor, Wissenschaftsjournalist und Extremsportler. Er besuchte ein katholisches Gymnasium, studierte Theoretische Elementarteilchenphysik und diplomierte mit Auszeichnung. Internationale Bekanntheit erlangte er als Extremsportler, mit Slacklineaktionen an den Victoria-Wasserfällen und auf den Drei Zinnen. Er gehört zu den aktivsten Wissenschaftserklärern Österreichs und schrieb für Zeitungen, Magazine und Universitäten. Derzeit schreibt er freiberuflich für den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.
www.reinhardkleindl.at
REINHARD KLEINDL
DIE
GOTTES
MASCHINE
THRILLER
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © Dreieck/photocase.de; © shutterstock.com: pixelparticle | Jurik Peter | ilolab
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0395-6
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Andreas und Maria Kleindl,die mir Europa zeigten.
Diese Geschichte beruht auf realenwissenschaftlichen Theorien und Fakten.
Und es ward Licht.
Die gleißende Helligkeit blendete ihn. Sein Körper war ganz leicht, schien zu schweben, dem Licht entgegen. Er fühlte sich geborgen, aufgehoben. Er schien in diesem Moment eins mit der Schöpfung zu sein, er spürte sie, wie man seine Hände und Füße spürt, den Kosmos mit seinen Rätseln, die Bausteine der Materie mit ihrer göttlichen Ordnung – die Dinge, mit denen sein Verstand sich beschäftigte, seit er ein kleiner Junge war, die er aber noch nie gefühlt hatte wie jetzt. Er verstand nun, dass das Göttliche, das er immer in unerreichbarer Ferne gesucht hatte, bei ihm war, in ihm war. Er selbst war das Göttliche. Das Gefühl überwältigte ihn. Er empfand Seligkeit – sie begleitete ihn seit Wochen und war in den letzten Tagen übermächtig geworden. Er hatte gewusst, dass er seiner Bestimmung näher kam, dass er die Welt verändern würde. Nun waren seine Forschungen abgeschlossen. Zuerst hatte er es nicht glauben wollen, doch das Ergebnis des Computers war eindeutig, ein Irrtum war ausgeschlossen. Wenn er die Daten veröffentlichte, würde ein Beben durch die Welt gehen. Schon bald würde nichts mehr so sein wie früher. Es lag an ihm, einen jahrtausendealten Krieg zu beenden. Doch er empfand keinen Stolz, sondern Demut. Er wusste, er war nur ein Bote. Dazu war er auserkoren, das war der Weg, dem er unbeirrt gefolgt war.
Dieser Weg war nun zu Ende. Die Aufgabe des Boten war abgeschlossen, alles war vorbereitet. In wenigen Stunden würde sich die Nachricht auf der ganzen Welt verbreiten. Die Veränderung ließ sich nicht mehr aufhalten. Das erfüllte ihn mit einem unendlichen Glücksgefühl, obwohl er wusste, dass das Gefühl des Schwebens eine Einbildung war. Es war ein Zeichen, dass seine Seele sich von seinem Körper zu lösen begann. Eigentlich sollte er schreckliche Schmerzen haben, von den Kabeln, die in seine Hand- und Fußgelenke schnitten. Blut staute sich in seinem Kopf und pochte in seinen Ohren. Er konnte sich nicht mehr bewegen, etwas in ihm schien zerbrochen zu sein, das Atmen wurde zunehmend schwerer. Doch der Schmerz war nicht mehr da, er hatte ihn verlassen wie die Zweifel.
Mit einem Mal trat jemand in das Licht, das in Wirklichkeit eine Deckenleuchte war. Ein Mensch stand über ihm, ein Kreuz hing an einer Kette um seinen Hals – ein falsches Kreuz, voll dunkler Symbolik. Das Gesicht lag im Schatten, doch er wusste, wem dieses Kreuz gehörte, und das Wissen erfüllte ihn mit Liebe. Der Mensch hob etwas Großes über seinen Kopf, das so schwer war, dass er taumelte.
»Nicht«, flüsterte der Bote.
Dann wurde es dunkel.
Währenddessen zählte auf einem Server im klimatisierten Serverraum eines IT-Dienstleisters in Genf eine Uhr einen Countdown herab, nach dessen Ablauf ein Script ausgeführt und ein drei Gigabyte großes Datenpaket namens »liberatio.zip« zum Download freigegeben werden würde.
22 Stunden, 53 Minuten, 4 Sekunden.
22 Stunden, 53 Minuten, 3 Sekunden.
22 Stunden, 53 Minuten, 2 Sekunden …
1
»Entschuldigung – haben Sie etwas gesagt?«
Stefano Lombardi hob den Blick und sah den weißen Schnauzbart des Taxifahrers im Rückspiegel. Er war so in Gedanken gewesen, dass er sich nicht sicher war, ob der Mann ihn angesprochen hatte. Lombardi hatte in die Landschaft hinausgeblickt, die an den Fenstern des alten Renault vorbeizog, und mit seinem Halsband aus einem dünnen Lederstreifen gespielt, an dem eine aus Speckstein geschnitzte Schlange hing. Draußen lichtete sich der Wald immer mehr. Die hohen Nadelbäume wichen niedrigen Kiefern, manche davon auf einer Seite völlig kahl. In ihrem Schatten lagen Schneefelder. Der Fahrer hatte die Heizung eingeschaltet, und die trockene Luft aus dem Gebläse brannte ihm in der Nase.
»Ich sagte, dass ein Sturm kommen wird«, wiederholte der Mann. »Une tempête grave! Das ist nicht selten um diese Jahreszeit. Sie müssen sich keine Sorgen machen, das Kloster hat über die Jahrhunderte viel Schlimmeres überstanden. Ich verstehe die Aufregung nicht.«
Der Taxifahrer lachte heiser. Lombardi verstand sein Französisch nur schwer. Es würde eine Weile dauern, bis er sich wieder an diese Sprache gewöhnt hatte. Er ließ den Anhänger seines Halsbands los und versuchte, sich auf die vorbeiziehenden Bäume zu konzentrieren. Ihm lag noch das schwere Essen im Magen, das er am Bahnhof in Zürich zu sich genommen hatte. Er hatte ein Eingeklemmts bestellt, das sich als Sandwich mit Wurst und viel Käse entpuppt hatte. Danach war er in einen TGV in Richtung Paris umgestiegen und hatte seine Fahrt fortgesetzt. Die Bäume und Brücken waren so schnell an ihm vorbeigeflogen, dass ihm mulmig geworden war. Er glaubte gehört zu haben, dass diese Züge über 500 km/h schnell fahren konnten, aber er war sich nicht sicher, ob das überhaupt möglich war. Vom Bahnhof in Genf hatte er dann einen französischen Bus genommen und war schließlich ins Taxi umgestiegen, das ihn in die Berge brachte.
»Was führt Sie hierher?«, fragte der Fahrer, als sich ihre Blicke im Rückspiegel trafen. »Sind Sie Wissenschaftler?«
»Nein, ich mache nur Urlaub«, antwortete Lombardi.
Der Taxifahrer hörte nicht auf, ihn durch den Spiegel anzustarren. Lombardi war nicht wohl bei dieser Lüge und hoffte, dass man es nicht sah.
Er musste an den Abend denken, als er mit Alessandro Badalamenti in dessen Garten unter alten Pinien gesessen hatte und würzigen apulischen Rotwein aus seinem Keller getrunken hatte. Sein Freund, der Automobilindustrielle und Vatikan-Kenner, war ungewöhnlich schweigsam gewesen. Erst als die Flasche leer gewesen war, hatte Badalamenti ihm offenbart, was ihn bedrückte und um seine Hilfe gebeten. Lombardi wollte helfen, aber er war unsicher.
»Was soll ich sagen, wenn jemand fragt, was ich dort will?«
»Niemand wird fragen. Viele Gäste kommen nach L’Archange Michel. Du wirst gar nicht auffallen.«
Doch Lombardi hatte gezögert.
»Denkst du, ich bin der Richtige dafür? Du kennst mich, ich bin nicht so abenteuerlustig wie du. Ich sitze gern in der Sonne, ich trinke gern Wein.«
Da hatte Badalamenti gelacht. »Bist du deshalb nach Afrika gegangen? Weil du gern Wein trinkst?«
»Du weißt, was ich meine. Ich bin Pragmatiker. Ich mache mir nichts aus solchen Dingen.«
»Genau darum brauche ich dich. Mach dir ein Bild, ganz nüchtern. Du hast mich nach einer Beschäftigung gefragt. Nach etwas, das dich ablenkt. Das ist es, was ich dir anbiete.«
Darauf hatte er nichts zu sagen gewusst, und schließlich hatte er eingewilligt.
Lombardi dachte daran, dass er den Garten und die langen Piniennadeln unter seinen nackten Füßen vermisste.
Vielleicht sollte er ernst nehmen, was Badalamenti gesagt hatte. Er war ein Reisender, nicht mehr. Eigentlich reiste er gern. Und es stimmte, er hatte wirklich nach Ablenkung gesucht. Der Gedanke machte ihm Mut. Alles, was ihm fehlte, war ein Zimmer, wo er die Tür hinter sich schließen und duschen konnte.
»Waren Sie schon einmal hier?«, fragte der Taxifahrer.
»Nein«, gestand Lombardi, »es ist das erste Mal.«
»Oh!«, rief der Taxifahrer aus. »C’est magnifique!«
Der Mann schien mehr sagen zu wollen, zögerte aber. »Pardon Monsieur. Ich nerve Sie.«
»Sie nerven gar nicht«, widersprach Lombardi, obwohl der Mann ihn tatsächlich ein wenig ermüdete.
Stefano Lombardi rutschte auf dem schwarzen Ledersitz hin und her. Auf der Sitzbank neben ihm lag eine Broschüre mit Informationen über das Kloster, die er während der Zugfahrt hatte lesen wollen. Er bemerkte, dass er zu riechen begonnen hatte. Er trug immer noch die Jeans und den Pullover, mit denen er vor Stunden in den Zug nach Paris gestiegen war. Lombardi hatte ganz plötzlich Lust auf eine Zigarette. Er hatte insgesamt nur drei Jahre geraucht, doch das Verlangen überfiel ihn von Zeit zu Zeit. Nur ein paar Züge, gleich hier neben der Straße, an der frischen Luft. Er verscheuchte den Gedanken.
Er griff nach der Broschüre und blätterte unkonzentriert durch die Seiten. Badalamenti hatte ihm mit leuchtenden Augen von dem Kloster erzählt – Revolutionär, ein völlig neues Konzept! Doch das Gehörte hatte für Lombardi keinen rechten Sinn ergeben.
Laut der Broschüre handelte es sich um eine dem heiligen Michael geweihte Abtei aus dem 11. Jahrhundert. Lombardi kannte diesen Kloster-Typus. Im Mittelalter wurden eine ganze Reihe von Sankt-Michaels-Klöstern an exponierten Stellen errichtet. Das bekannteste und größte war Mont-Saint-Michel auf einer Felseninsel vor der bretonischen Küste. Das Kloster, eines der einflussreichsten und mächtigsten seiner Zeit, war heute eine Touristenattraktion. Doch auch in Cornwall und im Piemont gab es ähnliche Abteien. Die Ursprünge von L’Archange Michel reichten weiter zurück, wie Lombardi erfuhr. Bereits im 9. Jahrhundert existierte hier eine Einsiedelei, über der später eine Kirche errichtet wurde. Im 11. Jahrhundert fanden Benediktiner aus dem Norden das verlassene Gotteshaus und bauten die Abtei.
Heute schien L’Archange Michel, auch Saint Michel à la gorge genannt, eine Art Seminarhotel zu beherbergen, das für Tagungen gebucht werden konnte. Der Text lobte die modern ausgestatteten Tagungsräume und die internationale Küche. Doch dann war plötzlich von einem leistungsfähigen Computercluster die Rede. Verwirrt legte Lombardi die Broschüre weg. Es half nichts, er musste sich selbst ein Bild machen.
Das Taxi nahm eine Kehre, und Lombardi wurde durchgeschüttelt. Da öffnete sich die Landschaft und gab den Blick auf ein tiefes Tal frei. Lombardi hörte einen Moment lang auf zu grübeln, so beeindruckend war die Szenerie. Der Himmel über ihm war von schweren Wolken bedeckt, doch über den Bergkämmen in der Ferne hatte sich ein Sonnenfenster geöffnet. Die Sonne stand genau in Verlängerung des Tals und warf ihr Licht auf feuchte Felswände, die auf der linken Talseite einen Vorsprung bildeten und die Helligkeit reflektierten, als stünden sie in Flammen. Darauf stand, steil aufragend, ein Gebäudekomplex, gekrönt von einem gedrungenen Kirchturm mit goldglänzender Statue auf seiner Spitze. Vor ihnen lag die Abtei L’Archange Michel.
2
Windböen zerrten an Lombardis Kleidern, als er sich mit seinem Trolley im Schlepptau dem Tor näherte, das ins Innere der wuchtigen Stadtmauern führte. Die Hose flatterte wild um seine Waden. Die Wolken zogen schnell über den Himmel. Es hatte zu schneien begonnen, und die Rollen seines Trolleys hinterließen dünne Spuren in der frischen Schneedecke.
Als er aus dem Taxi ausgestiegen war, hatten dort bereits vier Personen in dicken Mänteln gewartet, neben Stapeln von Gepäck. Sie hatten ihm zugenickt, bevor sie ihre Koffer in das Taxi geladen hatten.
Lombardi trat durch das Tor, und der Wind ließ augenblicklich nach. Zu seiner Überraschung fand er sich in einer kleinen Stadt wieder: enge Gassen, Fachwerkhäuser, eine sanft ansteigende, gepflasterte Straße. Auf einem Parkplatz standen drei identische Kleinbusse, ein Hinweisschild wies einen Shuttleservice für Touristen aus. Ein Lebensmittelgeschäft hatte geschlossen.
Lombardi folgte der Straße höher auf den Berg. Die Stadt war wie ausgestorben – eine Geisterstadt, die etwas von einer Filmkulisse hatte. Eine Frau öffnete einen rot gestrichenen Fensterladen und grüßte ihn freundlich, bevor sie zu den Wolken aufblickte. Er folgte ihrem Blick und sah, dass die Bebauung an einer Felswand endete. Die kleinen Häuser schmiegten sich an den rohen Granit, der weiter oben in eine hohe Mauer überging, die ihn in ihren Bann zog. Die Architektur schien den gesunden Menschenverstand zu verhöhnen. Er fragte sich, wie es im Mittelalter möglich gewesen sein sollte, solche Mauern zu errichten. Er hatte gelesen, dass die Anlage über Jahrhunderte immer weiter ausgebaut worden war, neue Mauern auf alten aufbauend, eingestürzte, romanische Gebäude durch prachtvolle gotische ersetzend. So sei ein regelrechtes Labyrinth entstanden, und noch immer wurden bei so mancher Renovierung zugemauerte Räume entdeckt.
Lombardi bemerkte, wie die Frau, die aus dem Fenster gesehen hatte, das Haus verließ und mit einem Rollkoffer, der seinem ähnelte, hinab zum Stadttor ging. Er hingegen stieg weiter den Berg hinauf.
Über mehrere Treppen erreichte er eine steinerne Brücke, die über eine schmale Schlucht führte. Ein Schwindelgefühl überkam ihn, als er sich der Balustrade näherte. Am anderen Ende lag der Eingang des Klosters. Lombardi gab sich einen Ruck und überquerte die Brücke, wobei er sich bemühte, nicht nach unten zu sehen. Auf der anderen Seite angekommen stellte er müde seinen Trolley ab und fand eine kleine, eisenbeschlagene Tür offen vor. Dahinter waren weitere Treppen. Als er eine kleine Plattform erreichte, frischte der Wind wieder auf, und er spürte plötzlich einen warmen Schein auf den Wangen. Die Sonne stand feuerrot über einem Gipfel. Einen Moment lang sah Lombardi ihr zu, wie sie unterging. Dann wandte er sich dem Eingang zu.
3
»Hallo?«, fragte Lombardi vorsichtig.
Er stand vor einer verglasten Portiersloge, die verwaist war. Eine Tür dahinter stand offen. Er bekam keine Antwort, doch er hörte ein Geräusch durch einige Löcher im Glas. Da war jemand. Ein Mensch sprach sehr leise und machte dabei immer wieder Pausen, als würde er telefonieren. Lombardi trommelte ungeduldig mit den Fingern auf eine Ablage vor der Loge, auf der Prospekte und Informationsblätter lagen. Daneben stand eine Klingel aus stumpfem Metall, wie in einem alten Hotel. Lombardi betätigte sie. Das Geräusch war unangenehm laut, und sofort verstummte das Murmeln im Nebenraum. Dann ging die Tür auf, und ein junger Benediktinermönch erschien, fast noch ein Teenager, mit asiatisch anmutenden Augen. Es musste sich um einen Novizen handeln, einen Mönch auf Probe.
»Qu’est-ce que vous voulez?«, fragte der Junge scharf.
Lombardi stellte sich vor. »Ich werde erwartet.«
»Aber die Abtei ist doch geschlossen!«
Lombardi spürte Ärger in sich aufsteigen. »Das hätten Sie sich früher überlegen sollen«, entgegnete er ungeduldig. »Ich habe vorhin mit dem Abt telefoniert. Erkundigen Sie sich. Er hat mir ein Taxi geschickt. Er weiß, dass ich komme.«
Der Novize begann, in einen Bildschirm zu starren und mit einer Computermaus zu hantieren, bis sein Blick auf einen Zettel mit chinesischen Schriftzeichen vor ihm fiel und seine Miene sich aufhellte.
»Bischof Lombardi? Bitte vielmals um Entschuldigung! Ich wusste nicht – in Zivil habe ich Sie nicht erkannt. Wie war Ihre Fahrt?«
Lombardis Ärger ließ schnell nach. »Gut, danke. Ein wenig müde bin ich.«
»Willkommen in L’Archange Michel!«, plapperte der Novize. »Mein Name ist Weiwei. Ich werde gleich sehen, ob Ihr Zimmer schon bereit ist, falls Sie sich ausruhen wollen.«
»Ich möchte gern zuerst den Abt treffen«, sagte Lombardi. »Könnten Sie mir erklären, wie ich ihn finde?«
Weiwei wirkte unschlüssig.
»Oder ist er zu beschäftigt?«, fragte Lombardi in süffisantem Ton.
»Natürlich nicht«, versicherte Weiwei mit gequältem Gesichtsausdruck. Die Sache war ihm ausgesprochen peinlich. »Haben Sie ein Telefon?«
Lombardi nahm sein Smartphone aus der Tasche. Er hatte es in Afrika gekauft, ein in Ruanda produziertes Modell. Es war nun ein Jahr alt, und er benutzte es hauptsächlich zum Telefonieren.
»Ich habe leider keinen Empfang«, stellte er fest.
»Das macht nichts. Die Meisten haben hier keinen Empfang. Verbinden Sie sich einfach mit dem WLAN und installieren Sie unsere App. Der Netzwerkname ist archange_guest. Dann können Sie auch ins Internet.«
Lombardi sah ihn fragend an.
»Die App enthält alles, was Sie brauchen«, erklärte der Junge, »das Tagesmenü der Kantine, die Zeiten für die Gebete, das Gesamtverzeichnis der Bibliothek und natürlich ein Navigationssystem. Hier ist alles ziemlich verwinkelt, wir wollen nicht, dass unsere Gäste verloren gehen. Es gibt auch eine virtuelle Führung durchs Kloster, wenn Sie das möchten.«
Weiwei erklärte ihm etwas über Positionsbestimmung via WLAN und dass alles Open Source sei. Lombardi verstand nichts davon und war nicht begeistert. Er hatte nur eine Handvoll ausgewählter Apps auf seinem Telefon installiert, einige italienische und afrikanische Zeitungen, eine Sammlung von Kochrezepten und ein Programm zur Himmelsbeobachtung, das ihm Badalamenti aufgeschwatzt hatte. Die vielen Funktionen des Smartphones verunsicherten ihn, und er beneidete Menschen wie Badalamenti, die arglos jede neue App sofort installierten und sich nichts dabei dachten. Doch der Novize wartete, und er ergab sich. Mithilfe des Mönchs dauerte es nur eine Minute, bis Lombardi einen Grundrissplan auf seinem Handy hatte.
»Da, sehen Sie, das Büro des Herrn Abt ist hier.« Der Novize zeigte auf einen Punkt. »Am besten folgen Sie einfach den Pfeilen.«
»Danke. Mein Koffer …«
»Den können Sie hierlassen. Ich bringe ihn aufs Zimmer. Und bitte nochmals um Entschuldigung, dass ich Sie nicht erkannt habe.«
»Macht nichts.« Lombardi bemühte sich um ein Lächeln und wandte sich zum Gehen.
Doch zuvor fiel sein Blick durch den Türspalt, und plötzlich stutzte er. Dort hing ein Kreuz an der Wand, das seine Aufmerksamkeit fesselte. Bevor Lombardi genauer hinsehen konnte, zog sich der junge Mönch in den Nebenraum zurück und schloss die Tür hinter sich.
Lombardi blieb verwirrt zurück. Als er darüber nachdachte, kam er zum Schluss, dass er sich wohl getäuscht hatte. Er war einfach nur übermüdet. Kurz hatte er geglaubt, dass mit dem Kreuz etwas nicht gestimmt hatte.
Auf dem Weg stellte er dankbar fest, dass die Räume gut beheizt waren. Er rieb die Hände aneinander, die seit der Taxifahrt noch immer kalt waren.
Er sah nicht mehr, wie Weiwei ihm durch den inzwischen wieder geöffneten Türspalt nachblickte, um dann aufgeregt zum Telefonhörer zu greifen.
4
»Bischof Lombardi, bonjour!«
Der Abt breitete die Arme aus, als er von seinem Schreibtisch aufstand, auf dem zwei große Monitore standen, und ging auf Lombardi zu. Er umfasste dessen Hand mit beiden Händen und schüttelte sie etwas zu heftig. Lombardi war verblüfft: Der Mönch hatte das schwarze, krause Haar und den dunklen Teint eines Inders. Die Mönche schienen aus allen Erdteilen zu kommen.
Lombardi erwiderte das Lächeln, doch der Abt sah ihm schon nicht mehr in die Augen.
»Wir haben telefoniert, ich bin Shanti. Willkommen! Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise«, sagte er mit einem Singsang, der von seiner Herkunft zeugte. Abgesehen von dem Akzent war sein Französisch fließend.
»Danke für das Taxi. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich habe nur die Bushaltestelle nicht gefunden.«
»Heute fahren die Shuttlebusse nicht mehr, wegen des Sturms«, erklärte der Abt.
»Ihr Novize am Eingang hat erwähnt, dass die Abtei geschlossen ist«, erinnerte sich Lombardi. »Muss ich mir Sorgen machen?«
»Die Behörden überreagieren etwas, wenn Sie mich fragen. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben! Es tut gut, wieder jemanden aus Rom hier zu sehen.«
Das Lächeln des Abts hatte sich seit der Begrüßung nicht verändert. Es wirkte aufgesetzt. Lombardi sah sich den Mönch genauer an. Shanti war einige Jahre jünger als Lombardi, vielleicht Mitte dreißig. Er trug die schwarze Tracht der Benediktiner, eine Tunika und den vorne und hinten bis zu den Füßen reichenden Überwurf mit Kapuze. Doch wo war diese eigentümliche salbungsvolle Sanftheit, die für Mönche so typisch war? Dieser Mann hätte auch ein Unternehmer aus der IT-Branche sein können.
»Eigentlich genehmigen wir derzeit keine Besuche mehr, wir befinden uns mitten in einer großen Umbauphase. Aber Ihr Freund Badalamenti war sehr hartnäckig. Er ist einer unserer größten Förderer, deshalb habe ich ein Auge zugedrückt. Gibt es einen speziellen Grund, warum Sie sich gerade jetzt dazu entschlossen haben?«
Shanti grinste und legte den Kopf zur Seite, ohne ihn aus den Augen zu lassen. »Verzeihen Sie meine Neugierde«, fuhr er fort, »aber Sie waren doch an einem Hilfsprojekt in Afrika engagiert, sehr erfolgreich, wie man hört. Was hat Sie zur Rückkehr bewogen? Man hört verschiedenste Gerüchte aus Rom.«
Lombardi war vor den Kopf gestoßen. Er hatte erwartet, dass man ihn nach seiner caritativen Arbeit fragen würde, aber nicht so früh. Die Sache hatte sich offenbar schneller herumgesprochen als erwartet. Er fragte sich, wie viel der Abt wusste.
Shanti sah, wie unangenehm es Lombardi war, und wischte alles mit einer Geste beiseite. »Sie müssen es nicht erzählen. Vergessen Sie bitte, dass ich gefragt habe. Was mich wirklich interessiert: Wie ist Ihr erster Eindruck?«
»Ich versuche immer noch zu verstehen, womit ich es zu tun habe«, erwiderte Lombardi. »Tagungsstätte, Kloster, Computercluster – es ist schwer, den Überblick zu behalten.«
Shanti sah ihn fragend an. »Haben Sie unsere Broschüre nicht erhalten? Dort ist alles gut erklärt.«
»Die Broschüre habe ich, danke. Es ist nur …«
Shanti seufzte. »Sie ist nicht verständlich genug. Wir werden alles noch einmal überarbeiten.« Der Abt hob die Hände wie zum Segen. »Vergessen Sie die Broschüre, unser Ziel ist schließlich ganz einfach, es lautet: Frieden. Wir arbeiten daran, zwei Welten miteinander zu verbinden, zwischen denen seit Jahrhunderten ein Graben verläuft: die Welt der Religion und die der Wissenschaft. Diesen Graben wollen wir schließen.«
Lombardi wartete auf eine Erklärung. »Mit einem Computer?«
»Sie können ihn auch gern Supercomputer nennen, das ist durchaus gängig. Hier wird nicht nur am Austausch gearbeitet, es wird auch wirklich Naturwissenschaft betrieben. Das klingt vielleicht verwirrend, aber wenn Sie es mit eigenen Augen sehen, wird alles klar werden.«
Lombardi spürte, wie sich Skepsis in ihm regte. »Naturwissenschaft?«
»Warum nicht? Das Rationale und der Glaube ergänzen einander. Oder wie Einstein es ausgedrückt hat: Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind.«
Lombardi glaubte, den Spruch schon einmal gehört zu haben, doch bestimmt noch nie von einem Mönch.
»Ein sensibles Feld«, sagte er. »Die Kirche hat sich da des Öfteren die Finger verbrannt.«
Shanti nickte, doch Lombardis Zweifel schienen ihn nur noch mehr anzustacheln. »Eine Reihe von Fehlern und Missverständnissen. Wer behauptet eigentlich, dass Glaube und Wissenschaft getrennt sein müssen? Überlegen Sie! Wann kam das auf? Gibt es irgendwelche zwingenden Argumente dafür?«
Lombardi forschte in seiner Erinnerung. Auf die Schnelle fiel ihm nichts ein, um seine Behauptung zu belegen. Für ihn war das immer so klar gewesen, dass er es noch nie hatte begründen müssen.
»Das war eine politische Entscheidung, Bischof Lombardi. Nach der Schmach mit Galilei, dem wir nach fast vierhundert Jahren schließlich recht geben mussten, versuchten wir, Schadensbegrenzung zu betreiben. Man überließ es der Wissenschaft, die Natur zu beschreiben, und entschied, sich da herauszuhalten. Im Gegenzug verlangte man von der Wissenschaft, die Religion in Ruhe zu lassen. Das ist die Situation, die wir heute haben. Eine Art Waffenstillstand. Doch es gibt keinerlei zwingende Begründung dafür.«
»Was Sie vorhaben, klingt sehr ambitioniert«, stellte Lombardi fest.
Shantis Lächeln verschwand. »Überambitioniert. Das meinen Sie doch, nicht wahr? Ich weiß, dass manche uns für Abtrünnige halten, gerade im Vatikan. Dabei setzen wir nur das um, was im Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen wurde. Deshalb sind gewisse Geisteshaltungen zu bedauern, die in der Mentalität vieler die Überzeugung schufen, dass Glauben und Wissenschaft einander entgegensetzt seien – so steht es in den Dokumenten des Konzils. Ein Friedensangebot der Kirche, wenn Sie so wollen. Und das Konzil geht sogar noch weiter: Wenn der Mensch sich der Mathematik und Naturwissenschaft widmet, kann er im höchsten Grad dazu beitragen, dass die menschliche Familie zu den höheren Prinzipien des Wahren, Guten und Schönen kommt. An dem, was wir tun, ist also nichts Rebellisches.«
»Aber es ist sehr ungewöhnlich«, gab Lombardi zu bedenken. »Es wundert mich ehrlich gesagt, dass ich noch nie von Ihrer Abtei gehört habe.«
Shanti nickte. »Zum Teil ist das Kalkül. Wir wollten die Sache in Ruhe wachsen lassen. In der wissenschaftlichen Welt spricht es sich bereits herum. Natürlich wollen wir nach außen gehen, schon sehr bald, doch das ist ein großer Schritt, und wir wollen nichts überstürzen.«
»Eine große Verantwortung.« Manche halten die Wissenschaft immer noch für unseren Feind.
Er sprach es nicht aus.
»Zweifellos«, fuhr der Abt fort. »Aber wir sollten der Herausforderung mit Mut und Gottvertrauen begegnen. Es ist eine einmalige Chance. Doch was weiß ich schon? Ich bin nur ein Verwalter. Fragen Sie meine Mitbrüder, die können Ihnen bestimmt viel interessantere Dinge erzählen.«
Lombardi nickte. »Das werde ich tun. Vor allem würde ich gern Pater Sébastien treffen. Ich habe viel von ihm gehört.«
Lombardi hatte sich bemüht, das ganz beiläufig klingen zu lassen. Er beobachtete Shanti genau, ohne ihn anzusehen. Die Miene des Abts verfinsterte sich kaum merkbar.
»Natürlich nur, wenn es keine Umstände macht …«, fügte Lombardi hinzu, als der Abt zögerte.
Shanti fand seine Contenance schnell wieder.
»Überhaupt nicht«, versicherte er. »Ich kann es Ihnen aber nicht versprechen. Sébastien ist in letzter Zeit sehr beschäftigt. Sie werden ihn kaum zu Gesicht bekommen. Er konzentriert sich derzeit ganz auf die Vorbereitung seiner Präsentation.«
Bei dem Wort »Präsentation« horchte Lombardi auf. Er wartete auf weitere Erklärungen, doch als er keine bekam, winkte er ab.
»Schon in Ordnung, wirklich.«
Er war nicht überrascht. Badalamenti hatte ihm prophezeit, dass so etwas passieren würde.
Shanti seufzte geräuschvoll. »Ich werde sehen, was ich tun kann. Signore Badalamenti hat ja schon erwähnt, dass Sie ihn treffen möchten. Sie müssen verstehen, wir versuchen nach Kräften, allen Trubel von ihm fernzuhalten. Aber ich werde nachsehen, vielleicht haben wir Glück.«
»Sagen Sie ihm, ich bin ein Freund seines Ziehvaters.«
»Wie gesagt, ich kann nichts versprechen.« Der Abt wirkte plötzlich ungeduldig. Er ging zurück hinter seinen Schreibtisch und griff nach der Computermaus. »Und jetzt muss ich Sie bitten, mich zu entschuldigen. Ihr Zimmer ist bereits vorbereitet, in einer Stunde gibt es Abendessen. Der neue Speisesaal ist noch nicht fertig, wir essen derzeit im alten Refektorium. Sie finden es ganz leicht mit der App. Das Programm enthält außerdem eine interaktive Führung. Es handelt sich um einen Prototypen, der in Kürze für alle Gäste freigeschaltet werden soll. Augmented Reality. Sie richten nur Ihr Smartphone auf ein Detail, das Sie interessiert, und die App zeigt Ihnen alle relevanten Informationen dazu. Kennen Sie Pokémon Go?«
Lombardi war sein Unbehagen offenbar anzusehen, denn Shanti hob fragend die Augenbrauen. »Oder soll Sie einer Ihrer Mitbrüder durch die Anlage führen?«
»Wäre das ein Problem?«, fragte Lombardi vorsichtig.
»Überhaupt nicht! Ich schicke Ihnen Demetrios vorbei, unseren Cellerar. Er ist für alles Wirtschaftliche in unserer Abtei zuständig. Die App informiert Sie auch über unsere Gebetszeiten. Sie beten doch später noch die Komplet mit uns?«
Die Komplet war das letzte der über den Tag verteilten täglichen Gebete der Benediktiner. Lombardi zögerte. Zwar hatte er damit gerechnet, zu den Gebeten eingeladen zu werden, doch während der Reise war er so in Gedanken gewesen, dass er es vergessen hatte.
»Sie können es sich ja noch überlegen«, sagte der Abt schließlich.
Lombardi bedankte sich und verabschiedete sich mit einem Nicken. Er war froh, dass Shanti nicht nachbohrte.
Draußen auf dem Flur nahm er sein Handy und öffnete die App. Es war also, wie Badalamenti vermutet hatte. Sébastien arbeitete an etwas. Und er bereitete eine Präsentation vor. Was die anderen Mutmaßungen anging, so traute er sich noch kein Urteil zu. Bis jetzt wirkte alles normal – sofern man hier überhaupt von Normalität sprechen konnte. Alles schien in perfekter Harmonie zu sein, fast zu perfekt für Lombardis Geschmack.
Lombardi starrte auf den Bildschirm seines Telefons. Etwas schien nicht richtig zu funktionieren, nur die Kamera ging an und zeigte ihm ein Bild seiner Schuhe, die noch feucht vom Schnee waren. Als er das Telefon hob, erschien im Bild plötzlich ein Pfeil, der aussah, als wäre er auf den Boden gemalt. Er stellte fest, dass der Pfeil nicht wirklich existierte, sondern von der App ins Kamerabild eingefügt wurde. Davon hatte der Abt gesprochen.
Er folgte den Pfeilen in einen Korridor, an dessen Wänden Reihen großer Ölgemälde hingen, die Porträts zu sein schienen. Plötzlich sah er im Kamerabild einen Mönch stehen, der ihn anblickte.
Lombardi sah von seinem Handy auf und erkannte, dass auch dieser nicht real war, sondern nur in seinem Smartphone existierte. Als er näher kam, tauchte ein Button auf, der ihm eine Erklärung zu den Bildern anbot. Offenbar wartete der fiktive, freundlich dreinblickende Mönch darauf, aktiviert zu werden.
Ich wusste nicht, dass so etwas möglich ist. Was ist noch alles passiert, während ich in Afrika war?
Der Mönch lächelte erwartungsvoll, doch seine Augen waren tot. Lombardi lief ein Schauer über den Rücken. Er ging schnell weiter. Plötzlich war er heilfroh, dass ihn der Cellerar durch das Kloster führen sollte.
Lombardi passierte einen Korridor mit identischen Türen, die mit Nummernschildern aus weißem Blech gekennzeichnet waren. Die dunklen hölzernen Türrahmen glänzten, als wären sie frisch poliert, doch an der unebenen Oberfläche konnte man erkennen, dass sie seit Jahrzehnten nicht erneuert worden waren. Danach folgte ein Bereich, der vollständig mit Gerüsten verkleidet war. Ein Raum ohne Tür war frisch gestrichen worden und hatte einen neuen Parkettboden bekommen. Aus einem Loch im Boden ragten Kabel, an der Decke hing ein Stativ für einen Beamer. Ein Seminarraum.
Dann kam er an zwei Whiteboards vorbei, die mit langen Formeln in bunten Farben beschrieben waren – der erste Beweis, dass die Geschichten stimmten. Eines der beiden Boards war aus seiner Verankerung gerissen worden und hing schief da.
5
Die warme Dusche tat Lombardi gut. Danach ging es ihm besser. Er trat aus der Duschkabine, wickelte sich das Handtuch um die Hüften und nahm das Halsband von der Ablage unter dem Spiegel, um es anzulegen. Als er seinen Trolley öffnete, sah er, dass er viel zu wenig Kleidung mitgenommen hatte. Beim Packen war er sehr zerstreut gewesen. Lombardi nahm ein schwarzes Kollarhemd und eine schwarze Baumwollhose heraus und legte sie auf das Bett. Dabei rieselte roter Sand aus einer der Hosentaschen. Seit seiner Rückkehr aus Afrika hatte er die Priesterkluft nicht mehr getragen. Sorgfältig leerte er die groben Sandkörner aus den Taschen in die Toilette. Im Trolley fand er Unterhosen und Socken. Er streifte das Hemd über, zog die Hose an und schloss die Knöpfe über dem Halsband. Ganz unten im Trolley fand er das Kollar, den weißen Priesterkragen aus Kunststoff, und setzte ihn ein.
Wie fühlte sich das an? Lombardi stand vor dem Badezimmerspiegel und sah darin einen mageren Priester, den er nicht kannte. Einen Mann, der auch gut und gern fünfzig sein konnte, mit Sorgenfalten um den Augen. Er hatte von sich selbst immer noch das Bild des jungen, motivierten Theologiestudenten vom Land, der in Rom seinen Traum lebte. Doch er war als ein anderer Mensch aus Afrika zurückgekehrt.
Lombardi überlegte kurz, das Hemd wieder auszuziehen und in seinem Trolley nach etwas anderem zu suchen, doch dann schenkte er seinem Spiegelbild ein Lächeln, legte sich auf das Bett und verschränkte die Finger hinter dem Kopf.
Das bist du, du solltest dich daran gewöhnen.
Lombardi schloss die Augen und atmete tief und langsam. Das Zimmer verströmte den Geruch zu oft gewaschener Bettlaken. Wie ein ganz normales Hotelzimmer. Die Lust auf eine Zigarette war immer noch da, aber sie hatte nachgelassen. Er konnte sie zu den anderen unerledigten Dingen schieben, die sich im Leben anhäuften – Ballast, den man mitschleppte und irgendwann nicht mehr wahrnahm.
Lombardi öffnete die Augen und sah eine unregelmäßige Holzdecke. Vor ihm war eine unverputzte Mauer aus großen Steinen. Das Fenster war tief in die Mauer eingeschnitten und der Sims in etwa gleich lang wie breit. Vor der Scheibe war noch ausreichend Platz für ein schweres Eisengitter, hinter dem sich die Weite des Tals auftat.
Er sah hier das Selbstverständnis des Lebens im Mittelalter: Mauern für die Ewigkeit – der Mensch hatte dafür mit engen, kalten Kammern und winzigen Fenstern auszukommen. Die Leute hatten ein unerschütterliches Vertrauen gehabt, dass es Dinge gab, die größer waren als sie selbst. Die Ironie war, dass gerade die Klöster, deren Ausstattung für heutige Verhältnisse so karg wirkte, im Mittelalter Symbole des Wohlstands gewesen waren, die es in Reichtum und Macht locker mit Königen aufnehmen konnten. Diese Macht hatte in der jüngeren Geschichte mehr und mehr abgenommen. Heute waren nur noch die dicken Mauern übrig.
Stefano Lombardi stand auf. Er war nun endgültig hungrig geworden und machte sich auf den Weg ins Refektorium, den klösterlichen Speisesaal.
6
Lombardi folgte den Pfeilen, die sein Handy ihm anzeigte. Inzwischen hatte er die Orientierung komplett verloren und musste sich auf die App verlassen, die ihn auf verschlungenen Wegen durch die Abtei führte. Einmal trat er zwischen zwei hohen Gebäuden ins Freie, um gleich durch die nächste Tür wieder ins nächste Haus zu gelangen. Lombardi kam an einigen Fenstern vorbei, die einen Blick auf einen kleinen Garten boten. Er bemerkte dort einen Mönch und blieb stehen. Etwas an ihm erregte seine Aufmerksamkeit.
Die Gestalt hatte die Kapuze aufgesetzt. Sie stand an der Wand und fuhr mit der Hand über die steinerne Oberfläche. Lombardi versuchte zu erkennen, was dort an der Wand war, doch er sah nichts als über Jahrhunderte verwitterte Granitflächen.
Der Mönch klopfte mit den Fingerknöcheln gegen die Mauer und legte dann den Kopf dagegen, so, als würde er horchen. Lombardi beugte sich noch näher an die Scheibe heran. Ihm fiel auf, wie gebückt diese Gestalt war. Nun erst entdeckte er eingemauerte Gewölbesteine. Dort war ein Durchgang zugemauert worden. Lombardi fröstelte, obwohl ihm nicht kalt war.
In diesem Moment trat ein junger Mönch neben ihn, der Sommersprossen und feuerrotes Haar hatte und völlig außer Atem war. »Verzeihung – haben Sie Pater Angelus gesehen?«
»Wen?«
Der Mönch schien ganz verzweifelt zu sein. »Ich habe nur einen Moment nicht aufgepasst«, rechtfertigte er sich ungefragt und mit dem rollenden R eines osteuropäischen Akzents.
Lombardi hatte eine Idee.
»Dort«, sagte er und deutete aus dem Fenster. »Ist er das?«
Der Mönch blickte durch die Scheibe in die Richtung, in die Lombardi zeigte, und als er die Gestalt entdeckte, war ihm die Erleichterung anzusehen.
»Vielen Dank!«, sagte er und lief los.
Kurz darauf sah Lombardi ihn draußen im Garten auftauchen. Er ging zu dem gebückten Mönch und nahm ihn an die Hand. Dieser folgte ihm ohne Widerspruch und ließ sich durch die Tür zurück ins Warme führen.
Verwirrt ging Lombardi weiter.
7
Als Lombardi den Raum betrat, den der Abt das »alte Refektorium« genannt hatte, wehte ihm der Duft von Curry und gekochtem Gemüse entgegen. Monotones Gemurmel drang aus dem Raum.
Was er sah, überraschte ihn. Er hatte erwartet, mehr schwere, mittelalterliche Granitmauern vorzufinden, stattdessen gab es schlanke Säulen, die elegante Rundbögen trugen. Darauf ruhte eine nach oben gewölbte Holzdecke. Am Ende des Refektoriums waren zwei schmale Fenster. Auf dem gefliesten Boden standen Tische, ein Buffet war aufgebaut, auf Stapeln standen Tabletts und Teller, die Speisen nahm man sich aus beheizten Edelstahlbehältern. Als er sich dem Buffet näherte, erkannte er, dass sich hinter den schmalen Säulen zu beiden Seiten unzählige hohe Fenster verbargen, die ins Freie führten. Er realisierte, dass er sich ganz oben auf einer der Mauern befinden musste, die er vom Dorf aus gesehen hatte.
An den Tischen war Platz für etwa fünfundzwanzig Personen, und die Plätze waren gut gefüllt. Die meisten waren Mönche in den Kutten der Benediktiner, dazu kamen einige Laien in Zivilkleidung, darunter auch Frauen.
Die Küche war international: thailändische Glasnudeln, indisches Curry, afrikanisches Yamswurzelpüree. Lombardi war froh, auch ganz gewöhnliche neapolitanische Pasta zu finden – genau das Richtige nach dem Schweizer Käsesandwich. Er nahm sich einen Teller und setzte sich an einen Tisch zu Weiwei, dem Novizen vom Eingang. Der Junge war in eine lebhafte Diskussion mit einem Mitbruder verwickelt und beachtete ihn nicht.
Lombardi kostete die Pasta, die ihm ausgezeichnet schmeckte. Er hörte, dass Weiwei über die ungewöhnliche Wettersituation sprach, und wurde neugierig.
»Sie sprechen über den Sturm«, mischte er sich ein, »was wissen Sie darüber?«
Weiwei schüttelte den Kopf. »Der flaut wieder ab. Machen Sie sich keine Sorgen.«
»Sind Sie sicher? Das Dorf war ganz verlassen. Alle scheinen sich in Sicherheit zu bringen.«
»Die offiziellen Wettermodelle sind falsch«, behauptete der Novize. »Hier bei uns forscht einer der besten Meteorologen der Welt, und er sieht keinen Sturm. Das Wetter ist komplizierter geworden, aber solche Stürme gibt es in diesen Breiten nicht.«
Die Selbstverständlichkeit im Ton von Weiwei beruhigte Lombardi. Während er seine Pasta aß, beobachtete er unauffällig die anderen Leute. Er entdeckte Abt Shanti, der schweigend aß, sonst glaubte er niemanden zu kennen.
Da sah Lombardi jemanden winken – eine große, dunkelhaarige Frau, die ihm bekannt vorkam. Er brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass die Geste ihm galt. Dann fiel es ihm ein: Es war Samira Amirpour, eine aus dem Iran stammende Physikerin, die in Österreich arbeitete. Er hatte sie bei einer Talkshow des italienischen Fernsehens kennengelernt, zu der sie beide eingeladen gewesen waren. Sie saß neben zwei Männern, von denen einer ein wenig wie Albert Einstein aussah, mit weißen Haaren und einem Strickpullover. Die Physikerin stand auf und kam zu ihm herüber.
»Bischof Lombardi, das ist aber eine Überraschung! Was machen Sie denn hier?«
Lombardi gab ihr die Hand. Sie hatte einen angenehmen, nicht zu harten Händedruck. »Ich bin im Urlaub. Und Sie?«
»Beruflich. Wir haben seit Kurzem einen großen Teil unserer Berechnungen hierher verlegt.«
Lombardi sah sie fragend an. Er versuchte sich zu erinnern, woran genau sie arbeitete.
Amirpour zuckte mit den Schultern. »Diese findigen Leute hier haben einfach das beste Angebot gemacht. Grundlagenforschung ist kein einfaches Business. Wenn Sie mir vor ein paar Jahren gesagt hätten, dass ausgerechnet die Kirche meine Rettung sein würde, hätte ich Sie für verrückt erklärt!«
Lombardi musste schmunzeln. »Rettung ist unser Geschäft.«
Da lachte Amirpour – ein erfrischendes Lachen, das ihr hervorragend stand. Sie hatte die vierzig hinter sich gelassen und erinnerte ihn an die eleganten Italienerinnen in Rom, abgesehen von einer Weitsichtbrille, die ihre blaugrünen Augen größer erscheinen ließ. Ihre schelmische Art war ihm schon im Fernsehstudio sympathisch gewesen.
»Ich verstehe genau, was Sie meinen, Herr Bischof. Aber für mich ist es eine ganz klare rationale Entscheidung. Dass die ganze Sache etwas kurios ist, stört mich nicht. Sind Sie heute angekommen?«
»Ja, erst vor einer Stunde.«
Amirpour nickte. »Und wie lange bleiben Sie?«
»Das weiß ich noch nicht genau. Ein paar Tage werden es schon sein, vielleicht eine Woche.«
»Ich werde leider morgen schon wieder abreisen«, erklärte sie bedauernd. »Meine Kollegen fahren heute noch. Die Tagung über Schwarze Löcher ist wegen des Sturms abgesagt.« Sie deutete auf den Einstein-Doppelgänger, der herübersah und freundlich nickte. »Vielleicht haben Sie ja Lust, später noch bei mir vorbeizukommen. Auf ein Glas Rotwein? Würde mich interessieren, was es in Rom Neues gibt.«
»Das klingt sehr verlockend«, gab Lombardi zu. »Wo sind Sie denn untergebracht?«
Sie nannte ihm ihre Zimmernummer.
»Das werde ich finden, denke ich.«
»Perfekt. Dann bis gleich!« Amirpour drehte ihm den Rücken zu und ging davon.
Als Lombardi sich später auf den Weg zu seinem Zimmer machte, war er guter Laune. Er stellte fest, dass ihn die Vorstellung, die nächsten Tage in diesen Mauern mit Mönchen eingesperrt zu sein, bedrückt hatte. Amirpours offene Art war genau das, was er jetzt brauchte.
Bevor er das Refektorium verließ, sah er sich noch einmal alle Leute genau an. Sébastien war nicht dabei.
8
»Hallo?« Lombardi drückte vorsichtig die Tür auf, die nur angelehnt war. Im Zimmer war es dunkel und warm, nur die Leselampe am Bett brannte und war nach oben gerichtet, sodass sie die Wand bestrahlte. Amirpour war nirgends zu sehen, doch der Duft eines Parfums hing in der Luft.
Nach dem Essen hatte er sich in seinem Zimmer kurz hingelegt und war prompt eingeschlafen. Als er aufgewacht war, hatte er sich nur schnell kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt und sich dann sofort auf den Weg gemacht. Lombardi fühlte sich plötzlich unbehaglich. Er hätte klopfen sollen. Gerade wollte er umkehren, als die Tür zum Badezimmer aufging und Helligkeit den Raum erfüllte.
»Lombardi, da sind Sie ja!«, sagte Amirpour. Sie trug ein wallendes blaues Kleid.
»Ich habe die Flasche schon entkorkt, damit er atmen kann.« Sie zeigte auf den Tisch. »Ein Bordeaux. Ob er gut ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Mögen Sie Risiko?«
Lombardi merkte, wie er sich entspannte.
»Risiko ist nicht so meine Sache«, sagte er. »Wenn er schlecht ist, werde ich mich in Demut üben. Haben Sie schon einmal Messwein gekostet? Unsereins ist hart im Nehmen.«
Amirpour sah Lombardi prüfend durch ihre Brille an, dann lachte sie herzhaft. »Machen Sie es sich gemütlich, Herr Bischof.«
Amirpour hatte die gleiche Sitzgarnitur, die auch in Lombardis Zimmer stand. Sie ließen sich auf den lederbezogenen Polstersesseln nieder. Auf einem kleinen Tisch stand die Flasche mit zwei Gläsern.
»Wie lange ist das her?«, fragte Amirpour. »Es müssen drei Jahre sein.«
»Ziemlich genau, ja.«
Amirpour seufzte und schenkte rubinroten Wein in die beiden Gläser. »Ich habe so viel um die Ohren, mir fehlt im Moment jedes Zeitgefühl.«
Sie nahmen die Gläser und erhoben sie. Ein heller Klang erfüllte den kleinen Raum, als sie anstießen. Lombardi kostete. Der Wein war schwer, schmeckte nach Beeren und Datteln und hinterließ ein samtiges Gefühl auf der Zunge.
»Der ist gut«, stellte er fest.
»Finden Sie? Dann bin ich beruhigt. Ein Mensch mit meinen Ansprüchen und meinen bescheidenen Mitteln ist immer auf etwas Glück angewiesen, wenn es um Wein geht.«
Lombardi nahm einen zweiten Schluck und ließ ihn einen Moment auf der Zunge liegen.
»Haben Sie wieder einmal an so einer Talkshow teilgenommen?«, fragte Amirpour. »Ich erinnere mich, dass mich beeindruckt hat, was Sie über Ihre caritative Arbeit erzählten. Ich habe damals sehr genossen, mit Ihnen über die Schöpfung zu diskutieren. Die Leute haben darauf gewartet, dass wir uns vor laufender Kamera gegenseitig zerfleischen, aber irgendwie war die Stimmung sehr gemütlich. Nur der Diskussionsleiter war mit seinen Provokationsversuchen etwas nervig.«
»Nein, das war das einzige Mal«, gestand Lombardi. »Und Sie?«
Sie verneinte. »Ich mag das Rampenlicht nicht. Mein Labor ist mir lieber.«
»Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß, woran Sie forschen.«
Amirpour schien nicht beleidigt zu sein. »Ich bin Quantenphysikerin«, erklärte sie. »Das bedeutet, ich arbeite mit Glasbehältern, die etwa so groß sind wie ein Fußball. Ich entferne die Luft darin und fülle sehr dünne Gaswolken hinein, die ich abkühle, bis sie kälter sind als das Vakuum des Weltraums. Danach schieße ich von allen Seiten mit Laserstrahlen darauf und schaue mir an, was passiert.«
Lombardi musste grinsen. Er erinnerte sich nun wieder an Amirpours Humor. Schon bei der Talkshow war ihm aufgefallen, dass Physiker sich einen Sport daraus machten, sich über ihre Forschungen lustig zu machen. Der Ursprung des Universums hieß »Big Bang«, die bedrohlichsten Objekte des Alls hießen »Schwarze Löcher«, und es gab ein Theorem von Stephen Hawking, das behauptete, dass sie »unbehaart« seien. Die kleinsten bekannten Bausteine der Materie wiederum hießen »Quarks«, und es gab sie in verschiedenen bunten Farben. Lombardi hatte aber bereits festgestellt, dass dieser Tick nichts mit der Sorgfalt der Forschungen selbst zu tun hatte.
»Das klingt, als hätten Sie eine Menge Spaß.«
»Darauf können Sie wetten!«
Lombardi schwieg und nippte an seinem Wein. Von draußen hörte er das Pfeifen des Windes. War es stärker geworden? Es erinnerte ihn jedenfalls daran, dass er am Rand eines Felsabbruchs saß. Er versuchte, sich wieder auf Amirpour zu konzentrieren. Die Vertrautheit zwischen ihnen fand er sehr angenehm. Doch Lombardi hatte ihre Einladung nicht nur deshalb angenommen. Vielleicht konnte er von ihr auch etwas über Sébastien erfahren.
»Und Sie sind im Urlaub?«, fragte Amirpour. »Ich wusste nicht, dass Bischöfe Urlaub machen können.«
»Im Normalfall ist das auch schwierig. Aber ich bin ein Weihbischof. Das bedeutet, ich bin geweiht, aber mir wurde noch kein Amt zugeteilt. Ich bin quasi in Wartestellung. Das gibt mir gewisse Freiheiten.« Das war nicht einmal gelogen.
»Klingt gut«, sagte sie versonnen und trank von ihrem Wein.
»Wie steht es mit Ihnen?«, fragte er zurück. »Arbeiten Sie auch an der wundersamen Versöhnung von Wissenschaft und Glauben?«
»Der Abt hat Ihnen also auch seine Rede gehalten?«
Lombardi nickte. »Ich muss zugeben, es klingt sehr ambitioniert. Was denken Sie?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Es gibt bahnbrechende Forschung hier. Das ist es, was mich interessiert.«
Amirpour schien ihm seine Skepsis anzusehen.
»Sie finden das seltsam«, stellte sie fest.
»Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich traue der Sache nicht. Wir alle wissen, dass Glaube und Wissenschaft seit Hunderten Jahren im Konflikt zueinander stehen.«
»Inwiefern stehen Glaube und Wissenschaft miteinander in Konflikt?«, wollte Amirpour wissen.
Lombardi stutzte. Ihre Frage war offensichtlich ernst gemeint. »Ist es nicht offensichtlich?«
»Nein, überhaupt nicht«, entgegnete Amirpour ungerührt. »Worin sollte dieser Konflikt bestehen?«
Lombardi versuchte, ihrem Blick zu entnehmen, ob sie sich über ihn lustig machte.
»Die Wissenschaft braucht die Religion nicht, sie versucht sie zu ersetzen«, antwortete er schließlich. »Alles, was passiert, ist eigentlich Zufall, es gibt keinen großen Plan. Und Gott greift nicht ins Weltgeschehen ein. Gott ist nicht nur nicht notwendig, er soll abgeschafft werden. Es ist kein Platz mehr für ihn, und das scheint genau die Idee dabei zu sein. Man will die Welt von allem Übernatürlichen befreien – von allem, was unerklärlich ist. Und so wie ich das verstehe, hat man es fast geschafft. Ich würde sagen, der Konflikt ist offensichtlich.«
Amirpour schien nicht im Geringsten beeindruckt zu sein. Sie schüttelte langsam den Kopf. »Nichts davon behauptet die Wissenschaft.«
Lombardi sah sie fassungslos an. »Tut sie das nicht?«
Amirpour trank einen Schluck Wein. Sie kostete Lombardis Reaktion aus. »Es stimmt, die Naturwissenschaften haben ein nahezu vollständiges Bild der sichtbaren Materie entwickelt, und bisher hat es alle Tests überstanden. Das Ding nennt sich Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Ziemlich klobig, wenn Sie mich fragen, aber auch ganz erstaunlich. Ein System aus gekoppelten Feldgleichungen, das nur dank einiger außergewöhnlicher mathematischer Tricks nicht auseinanderfällt. Aber es funktioniert! Alles, was wir sehen können – Sie, ich, die Erde, die Sterne im All –, wird dadurch erklärt. Das heißt allerdings weder, dass wir alles, was auf der Welt geschieht, auch verstehen, noch, dass alles Zufall ist. Wir in der Naturwissenschaft wissen sehr wohl, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen können. Ein großer Teil der Wissenschaftler ist überdies religiös oder glaubt an eine höhere Macht.«
Das war neu für Lombardi. »Ich dachte, die meisten sind Atheisten.«
Amirpour schien langsam richtig in Fahrt zu kommen. »Ich frage Sie: Von den Nobelpreisträgern zwischen den Jahren 1900 und 2000 – wie viele von ihnen waren Atheisten?«
Bischof Lombardi fühlte, dass das eine Fangfrage war, und beschloss, auf Nummer sicher zu gehen. »Hmm. Etwa die Hälfte?«
»Falsch«, gab Amirpour zurück. »Nur zehn Prozent waren Atheisten. Bei über 60 Prozent handelte es sich um Christen.«
Er akzeptierte, dass er sich geirrt hatte. Aber so schnell wollte er sich nicht geschlagen geben. »Gut, von mir aus. Aber das sind alte Zahlen. Wie sieht es aktuell aus? Naturwissenschaftler sind sicher besonders häufig Atheisten.«
»Und doch ergab eine vor wenigen Jahren in den USA durchgeführte Studie, dass nur zwanzig Prozent der Professoren für Naturwissenschaft Atheisten waren. Zumindest dreißig Prozent waren sich nicht sicher, und ganze fünfzig Prozent glaubten an Gott oder an eine höhere Macht.«
Lombardi war perplex. »Ich dachte immer, Naturwissenschaftler glauben, alles zu wissen und hätten keine Verwendung für Gott.«
Amirpour zuckte mit den Schultern. »Wenn Sie das glauben, ist es falsch. Es stimmt, dass Stephen Hawking einmal in einer Rede im Vatikan behauptete, dass die moderne Physik keinen Gott mehr brauche, wenn es gelänge, eine Weltformel zu finden. Aber selbst er musste 2004 zugeben, dass er die Suche nach einer solchen Formel aufgegeben hat.«
Lombardi musterte sie. Sie erklärte ihm hier ganz sachlich, dass Wissenschaftler religiös sein konnten. Dennoch hatte er nicht das Gefühl, dass sie von sich selbst sprach. Er widerstand der Versuchung, sie nach ihrem Glauben zu fragen.
»Dass wir nicht alles wissen können, lässt sich sogar wissenschaftlich belegen«, fuhr sie fort.
»Ach ja?«
»Sie haben davon gehört. Die Unschärferelation der Quantenphysik.«
In Lombardis Kopf klingelte etwas. »Ich wusste nicht, dass das bedeutet, dass die Wissenschaft nicht alles wissen kann.«
Amirpour sah ihn triumphierend an. »Die Unschärferelation besagt, dass man den Ort und die Geschwindigkeit eines Objekts nie zugleich exakt feststellen kann. Sie wissen entweder, wie schnell ein Objekt ist oder wo es sich befindet. Beides geht nicht. Ihr Bild des Objekts bleibt unscharf. Sie können nicht alles darüber wissen. Das Paradoxe dabei ist, dass Sie den Grad dieses Unwissens mithilfe der Unschärferelation sehr exakt berechnen können. Etwas Ähnliches gibt es auch in der Mathematik. Es wurde gezeigt, dass wir nicht alles, was wahr ist, auch beweisen können.«
»Tatsächlich?«
»Der Unvollständigkeitssatz. Nie davon gehört?«
Lombardi erinnerte sich dunkel, aber er hatte dem Ergebnis keine Bedeutung beigemessen.
»Es wird also immer etwas geben, das wir nicht wissen. Das ist wissenschaftlich belegt!«
»So habe ich das noch nie gehört«, gab Lombardi zu.
»Natürlich nicht, weil es manchen Wissenschaftlern unangenehm ist. Niemand gesteht gern Schwächen ein. Aber für mich sind das die wichtigsten Formeln.«
Amirpour machte eine Kunstpause, bevor sie weitersprach. »Es sieht fast so aus, als wäre es Absicht.«
Lombardi horchte auf. »Wie meinen Sie das?«
Amirpour grinste, sichtlich zufrieden mit Lombardis Reaktion. »Als hätte jemand einen Schleier über die Welt gelegt«, präzisierte sie. »Jemand, der verhindern will, dass wir genauer hinsehen. Als hätte jemand gesagt: bis hierher und nicht weiter.«
Lombardi war verblüfft über ihre Andeutung.
»Um zu Ihrer Frage zurückzukommen«, fuhr sie fort, »ich halte dieses Institut für eine der besten privaten Forschungseinrichtungen in Europa. Dass es sich um ein Kloster handelt, ist für mich Nebensache.«
Lombardi ließ das auf sich wirken. »Ganz so einfach ist die Sache nicht«, stellte er fest. »Immerhin ist einer der Wissenschaftler selbst Mönch, wie ich hörte.«
»Sie meinen Pater Sébastien.«
Lombardi nickte »Kennen Sie Ihn?«
»Natürlich.«
»Und?«
Amirpour blickte nachdenklich auf ihr Weinglas.
»Ein Genie«, sagte sie dann. »Das muss man so sagen.«
Lombardi war überrascht. Er hatte zwar gewusst, dass Sébastien Physik studiert hatte und inzwischen als Forscher arbeitete, aber Badalamentis Lobeshymnen hatte er bislang nicht ernst genommen. Sein Freund war leicht zu begeistern. Es von einer Fachfrau zu hören, war etwas anderes.
»Nicht, dass er bisher viel vorzuweisen hätte«, fuhr sie fort. »Wie auch, er probiert Dinge, die sich niemand traut. Nur ein Verrückter kann ernsthaft glauben, dass er auf dem Gebiet der Quantengravitation etwas völlig Neues entdecken kann. Wobei, verrückt zu sein ist in der Wissenschaft nicht immer etwas Schlechtes. Peter Higgs hat während seiner ganzen Karriere nur eine Handvoll Arbeiten veröffentlicht, eine davon wurde von einem Fachjournal sogar abgelehnt, brachte ihm aber schließlich den Nobelpreis. Er sagt selbst, dass er mit dieser Arbeitsweise heute nirgendwo einen Job bekommen würde. Vielleicht hat Sébastien deshalb eine Karriere am Kernforschungszentrum CERN aufgegeben, um in dieses Kloster einzutreten. Hier gibt es Freiheiten, die anderswo undenkbar wären.«
Lombardi schmunzelte. Das passte wiederum ausgezeichnet zu dem Bild, das er von Sébastien hatte. Er selbst hatte ihn nur einmal getroffen, als er noch ein pickeliger Junge in einem Zinedin-Zidane-T-Shirt gewesen war. Badalamenti hatte in seinem Garten Fußball mit ihm gespielt. Etwas Ernstes war in seinen Augen gewesen, das seinem Alter nicht angemessen schien. Vielleicht lag es am frühen Verlust der Eltern, doch wahrscheinlich war das zu einfach gedacht. Schon damals hatte sein Freund das Potenzial des Jungen in den höchsten Tönen gelobt. Als Badalamenti Sébastien Bücher über alte Sprachen und Geheimcodes aus der Zeit des Absolutismus geschenkt hatte, um seinem ruhelosen Geist Nahrung zu geben, hatte er das schnell bereut, denn der Kleine hatte die folgenden Wochen nur mittels verschlüsselter Nachrichten in Latein mit ihm kommuniziert. Bald darauf gab Badalamenti ihm die ersten Bücher über Mathematik und Naturwissenschaften aus seiner Bibliothek.
»Er soll eine Präsentation vorbereiten«, erwähnte Lombardi scheinbar beiläufig. »Haben Sie davon gehört?«
»Natürlich. Er will irgendwelche Ergebnisse präsentieren. Jeder redet davon. Seit Wochen nutzt er praktisch jede freie Minute an Rechenzeit auf dem Computercluster. Einige meiner Kollegen mussten ihre Simulationen anhalten und sind ziemlich angepisst. Was immer er da berechnet, ist enorm aufwändig.«
Auch das passte zu dem, was Badalamenti erzählt hatte. Der Junge war an etwas dran. »Ich habe gehört, dass er seine Präsentation verschoben hat.«
»Sogar mehrmals.«
Er musterte sie. Er hatte den Eindruck, als hätte sich ihre Stimmung verdüstert, doch er konnte nicht sagen, woran das lag. »Ist mit ihm alles in Ordnung?«
»Sie sind wegen ihm hier, oder?«, fragte Amirpour unvermittelt.
Lombardi ärgerte sich über sich selbst. Er hatte sich vorgenommen, niemandem hier im Kloster die ganze Wahrheit zu sagen. Er überlegte, wie viel er ihr erzählen sollte. Schließlich gab er sich einen Ruck. »Sein Ziehvater ist ein guter Freund von mir. Alessandro Badalamenti, ein bekannter italienischer Unternehmer, vielleicht haben Sie von ihm gehört. Er hat sich an mich gewandt, weil er sich Sorgen um ihn macht.«
»Warum?«
»Sie hatten einen Streit. Seither erreicht er ihn nicht mehr.«
Amirpour nickte. »Ich kann nicht sagen, dass mich das überrascht. Normalerweise lässt Sébastien keinen Vortrag aus und nimmt an Diskussionen teil. Aber seit einigen Wochen lässt er sich kaum noch blicken.«
»Haben Sie eine Idee, woher diese Veränderung kam?«, wollte er wissen.
Sie zögerte. »Es betrifft nicht nur ihn«, wich sie aus. »Auch die anderen sind angespannt. Irgendetwas beschäftigt die Mönche.«
In Lombardis Geist fügte sich ein weiteres Puzzlestück ins Bild. Er musste an die schroffe Begrüßung des Novizen denken. Die Idylle, die der Abt ihm hatte vermitteln wollen, trog. Er musterte Amirpour, die plötzlich ganz schweigsam war.
»Sie wissen doch etwas«, drängte er. »Wollen Sie es mir nicht sagen?«
Da seufzte sie. »Es ist nur ein Gerücht«, erwiderte sie. »Aber es heißt, Sébastien hätte etwas Wichtiges gefunden. Etwas, das mit Gott zu tun hat.«
Er wartete darauf, dass sie mehr erzählte, als er durch seinen Sitz hindurch ein Rumpeln spürte. Einen Augenblick später folgte ein dumpfes, markdurchdringendes Krachen. Lombardi zuckte zusammen, und seine Finger krampften sich um die Stuhllehnen. Er sah die Überraschung in Amirpours Gesicht, dann ging mit einem leisen Knacken das Licht aus.
9
Die Schwärze war undurchdringlich. Lombardi spürte, dass er blinzelte, doch es machte keinen Unterschied. Nur das Pfeifen des Windes war zu hören und erschien ihm plötzlich viel lauter.