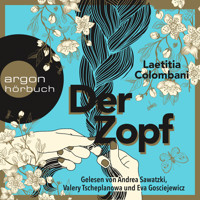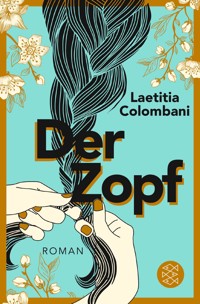9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Laetitia Colombani erzählt in ihrem neuen Roman »Das Haus der Frauen« von zwei heldenhaften Frauen - für alle Leserinnen von »Der Zopf« In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. Auch der erfolgreichen Anwältin Solène, die nach einem Zusammenbruch ihr Leben in Frage stellt. Im »Haus der Frauen« schreibt sie nun im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe - an die Ausländerbehörde, den zurückgelassenen Sohn in Guinea, den Geliebten - und erfährt das Glück des Zusammenhalts und die Magie dieses Hauses. Doch wer war die mutige Frau, die vor hundert Jahren allen Widerständen zum Trotz diesen Schutzort schuf? Solène beschließt, die Geschichte der Begründerin Blanche Peyron aufzuschreiben. Ein ergreifender Roman über mutige Frauen und ein Plädoyer für mehr Solidarität. In ihrem neuen Roman »Das Mädchen mit dem Drachen« (Erscheint am 23.02.2022) erzählt Laetitia Colombani die bewegende Geschichte des Mädchens Lalita und einer Schule am Indischen Ozean – einem hoffnungsvollen Ort, der alles verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Laetitia Colombani
Das Haus der Frauen
Roman
Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte eines magischen Ortes in Paris – ein Haus des Zusammenhalts für alle Frauen dieser Welt
In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. Auch der erfolgreichen Anwältin Solène, die nach einem Zusammenbruch ihr Leben in Frage stellt. Im Haus der Frauen schreibt sie nun im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe - an die Ausländerbehörde, den zurückgelassenen Sohn in Guinea, den Geliebten - und erfährt das Glück des Zusammenhalts und die Magie dieses Hauses. Doch wer war die mutige Frau, die vor hundert Jahren allen Widerständen zum Trotz diesen Schutzort schuf? Solène beschließt, die Geschichte der Begründerin Blanche Peyron aufzuschreiben.
Ein ergreifender Roman über mutige Frauen und ein Plädoyer für mehr Solidarität.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Über die Autorin und die Übersetzerin
Mit ihrem ersten Roman »Der Zopf« wurde Laetitia Colombani über Nacht weltberühmt. Die Recherche für ihren zweiten Roman führte die Autorin in den »Palais de la Femme« in Paris. Colombani sprach mit Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen und wurde eine von ihnen. »Das Haus der Frauen« ist der erste Roman über Blanche Peyron, die 1926 unter widrigsten Umständen eins der ersten Frauenhäuser begründete.
Claudia Marquardt studierte Romanistik, Germanistik und Kunstgeschichte in Berlin und Lyon. Sie arbeitet als Lektorin und Übersetzerin in Berlin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Meiner Mutter
Meiner Tochter
Den Frauen des Palastes
»Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun –
will ich kämpfen.
Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es
jetzt tun – will ich kämpfen (…)
Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die
Räder geraten (…) – will ich kämpfen.
Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug!«
William Booth
»Eins ist sicher, die Toten spuken an den Orten, an
denen sie gelebt haben, als ob sie den Boden dort mit
ihrer Erinnerung getränkt hätten.«
Sylvain Tesson, Une très légère oscillation
Der Boden ist eiskalt.
Dieser Gedanke erfasst mich, während ich daliege,
die Stirn am Steinboden, die Arme zur Seite ausgestreckt, wie eine Gekreuzigte.
Heute erkläre ich diesen Ort zu meiner ewigen Wohnstätte.
Ich lege mein Gelübde ab. Es ist meine Wahl.
Zwischen diesen Mauern werde ich mein Leben verbringen.
Ich wollte mich der Welt entziehen, um mehr an ihr teilzuhaben.
Ich befinde mich mitten in ihrem Herzen und zugleich weit von ihr entfernt.
Ich fühle mich nützlicher hier als in den lebhaften Vierteln der Stadt, die mich umgeben.
Hier, in diesem Kloster, wo die Zeit stehengeblieben ist.
Ich schließe die Augen und bete.
Ich bete für die Menschen, die Beistand brauchen,
die das Leben gezeichnet und erschüttert,
die man am Wegesrand zurückgelassen hat.
Ich bete für diejenigen, die Kälte und Hunger leiden,
die alle Hoffnung und jedes Verlangen verloren haben.
Ich bete für die, die nichts mehr haben.
Mein Gebet erhebt sich zwischen den Steinen,
in diesem Garten, diesem fruchtbaren Garten des Herrn,
dieser im Winter eiskalten Kapelle,
in dieser winzigen Zelle, die man mir zugeteilt hat.
Ihr, die ihr in dieser Welt wandelt,
stimmt weiter eure Gesänge an, zieht weiter eure Runden.
Ich bin da, in der Stille und im Schatten,
und ich bete, dass euch, solltet ihr inmitten des Getöses und Getümmels einmal stürzen,
eine Hand gereicht wird, sanft und stark,
eine freundschaftliche Hand,
die euch ergreift und wieder aufrichtet
und euch, ohne zu verurteilen, aufs Neue
in den Strudel des Lebens entlässt,
wo ihr weitertanzen werdet.
Gebet einer Schwester der Ordensgemeinschaft
Töchter vom heiligen Kreuz.
Anonym, 19. Jahrhundert
1Paris, heute
Es ging alles blitzschnell. Solène verließ den Gerichtssaal mit Arthur Saint-Clair. Sie wollte ihm gerade sagen, dass sie die Entscheidung des Richters nicht nachvollziehen könne, auch nicht die Strenge, mit der er sein Urteil verkündete. Doch dafür blieb ihr keine Zeit.
Saint-Clair steuerte auf die Glasbrüstung zu und übersprang sie mit einem großen Satz.
Ungehindert stürzte er sich aus dem sechsten Stock des Gerichtsgebäudes.
Für einige Augenblicke, die sich zu einer Ewigkeit ausdehnten, schwebte sein Körper im Leeren. Dann schlug er fünfundzwanzig Meter tiefer auf.
An das, was folgte, erinnert sich Solène nicht mehr. Die Bilder drängen sich ungeordnet auf, spulen sich wie in Zeitlupe vor ihrem geistigen Auge ab. Sie muss geschrien haben, ja, bestimmt hat sie geschrien, bevor sie zusammenbrach.
Aufgewacht ist sie in einem Zimmer mit weißen Wänden.
Der Arzt hat es in zwei Wörter gefasst: Burn-out. Wobei Solène nicht klar war, ob sich seine Diagnose auf sie oder ihren Mandanten bezog. Dann aber fügten sich die Einzelteile wieder zu einem Ganzen.
Sie kannte Arthur Saint-Clair schon eine ganze Weile, er war ein einflussreicher Geschäftsmann, der sich wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten musste. Bis ins kleinste Detail wusste sie über sein Leben Bescheid, über seine Ehen, seine Scheidungen, seine Affären, hatte Einblick in die Unterhaltszahlungen an seine Exfrauen und seine Kinder, war im Bilde über die Geschenke, die er ihnen von seinen Auslandsreisen mitbrachte. Sie wusste von seiner Villa in Sainte-Maxime, seiner herrlichen Wohnung im VII. Arrondissement von Paris. Er hatte sie stets ins Vertrauen gezogen, sie in all seine Geheimnisse eingeweiht. Monatelang hatte Solène sich auf die Verhandlung vorbereitet, hatte bereitwillig ihre gesamte Freizeit, jeden Urlaubs- und Feiertag geopfert, um nur nichts dem Zufall zu überlassen. Sie war eine herausragende Anwältin, unermüdlich, perfektionistisch, gewissenhaft. Ihre Kanzleikollegen schätzten ihre Qualitäten als Juristin einhellig. Dass ein gewisses Rechtsprechungsrisiko besteht, weiß jeder. Trotzdem – mit einem solchen Urteil hatte Solène nicht gerechnet. Der Richter forderte für ihren Mandanten eine Gefängnisstrafe und einen Schadenersatz in Millionenhöhe. Saint-Clair hätte bis an sein Lebensende zahlen müssen. Ganz abgesehen von dem Ehrverlust, der sozialen Ächtung. Er konnte es nicht ertragen.
Lieber stürzte er sich in den gigantischen Lichthof des neuen Pariser Justizpalastes.
An alles haben die Architekten gedacht, nur nicht daran. Ihr Ziel war es, ein elegantes Gebäude zu entwerfen, einen wahren »Palast aus Glas und Licht«, der durch seine perfekte Formgebung besticht. Und trotzdem gegen Terroranschläge gewappnet ist. Ein Gebäude mit massiven Fassaden und tausendundeiner Sicherheitsschleuse, mit Videokameras an sämtlichen Pforten. Überall haben sie Zutrittskontrollen vorgesehen, es gibt keinen Eingang, der nicht elektronisch überwacht, mit Gegensprechanlage und High-Tech-Monitor ausgerüstet wäre. Was sie in ihren Plänen allerdings nicht berücksichtigt haben, ist, dass in diesen Mauern Menschen über andere, manchmal sehr verzweifelte Menschen richten. Auf sechs Etagen verteilen sich die Gerichtssäle um ein fünftausend Quadratmeter großes Atrium, das mit seinen achtundzwanzig Metern Deckenhöhe schwindelerregend wirkt. Ein frisch Verurteilter kann an diesem Ort leicht auf dumme Gedanken kommen.
In Gefängnissen gibt es überall Sicherheitsvorkehrungen, um dem Selbstmord entgegenzuwirken. Nicht aber hier. Einfache Glasbrüstungen begrenzen die Gänge um das Atrium. Es war ein Leichtes für Saint-Clair, das Geländer zu überwinden und in die Tiefe zu springen.
Das Bild verfolgt Solène, sie kann es nicht vergessen. Wieder und wieder sieht sie den verrenkten, reglosen Körper ihres Mandanten auf dem Marmorboden des Palastes liegen. Sie muss an seine Familie denken, an seine Kinder, seine Freunde, seine Angestellten. Sie ist die Letzte, die mit ihm gesprochen hat, die Letzte, die neben ihm gesessen hat. Schuldgefühle quälen sie. Was hat sie falsch gemacht? Was hätte sie sagen oder tun können? Hätte sie das Schlimmste vorhersehen müssen? Sie kannte Arthur Saint-Clair gut, dennoch kann sie sich seine Tat nicht erklären. Sie hätte nie gedacht, dass er sich so erschüttern lassen und die Nerven verlieren, dass er wie eine Bombe hochgehen würde.
Der Schock hat ihr Leben in Stücke gesprengt. Auch Solène ist tief gefallen. Sie verbringt die Tage in dem Zimmer mit den weißen Wänden hinter zugezogenen Vorhängen, ihr fehlt die Kraft, auch nur aufzustehen. Sie erträgt kein Licht, und schon die kleinste Bewegung verlangt ihr eine übermenschliche Anstrengung ab. Die Kanzlei hat ihr Blumen geschickt, die Kollegen aufmunternde Grüße, doch auch davon fühlt sie sich überfordert. Sie funktioniert nicht mehr, so wie ein Auto, das ohne Benzin am Straßenrand liegengeblieben ist.
Und das mit gerade mal vierzig.
Burn-out, auf Englisch hört es sich leichter an. Ein Modebegriff, der besser klingt als Depression. Am Anfang wollte Solène es nicht glauben. Sie doch nicht, nein, mit so was hat sie nichts zu tun. Sie ist keine von diesen fragilen Zeitgenossen, deren Erfahrungsberichte die Seiten von Lifestyle-Magazinen füllen. Sie ist immer stark gewesen, aktiv, in Bewegung. Mit beiden Beinen fest auf dem Boden, dachte sie zumindest.
Es gibt viele Menschen, die unter beruflicher Überbeanspruchung leiden, erklärt ihr der Psychiater mit ruhiger und bedächtiger Stimme. Er benutzt Fachwörter, die sie hört, ohne sie zu verstehen, Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, es ist eine ganze Palette an Begriffen, Anxiolytika, Benzodiazepine, Antidepressiva. Er verschreibt ihr Tabletten, die sie abends nehmen soll, um einzuschlafen, und morgens, damit sie aufstehen kann. Tabletten, die ihr helfen sollen, zu leben.
Dabei schien sie unter einem guten Stern geboren zu sein. Als die ältere von zwei Töchtern eines Juristenehepaars wuchs sie in einem wohlhabenden Vorort von Paris auf. Schon früh hatte man ihr eine große Zukunft vorausgesagt, denn sie war ein äußerst intelligentes, sensibles und strebsames Kind. Schule und Studium absolvierte sie mit links, bereits mit zweiundzwanzig gehörte sie der Anwaltskammer von Paris an und arbeitete in einer renommierten Kanzlei. So weit, so gut. Doch nach kurzer Zeit begannen sich die Akten auf ihrem Schreibtisch zu türmen, und die Wochenenden, Nächte und Urlaube fielen zunehmend der Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten zum Opfer, der Schlafmangel wurde chronisch, die vielen Verhandlungen, Termine und Sitzungen erlaubten kaum mehr eine Verschnaufpause. Sie rauschte durchs Leben wie ein Schnellzug, der nicht anzuhalten war. Und dann die Sache mit Jérémy, dem Mann, den sie mehr liebt als alle anderen. Den sie nicht vergessen kann. Er wollte kein Kind haben, keine Verpflichtungen eingehen. Er hatte es ihr gesagt, für sie war das in Ordnung gewesen. Solène gehörte nicht zu den Frauen, die davon träumten, Mutter zu sein. Sie sah sich nicht als eine dieser jungen Mamas, die mit schlaffen Armen einen Kinderwagen durch die Straßen schoben. Dieses Vergnügen überließ sie gern ihrer Schwester, die in der Rolle der Hausfrau und Mutter vollkommen aufzugehen schien. Solène war ihre Freiheit wichtiger – zumindest behauptete sie das. Jérémy und sie lebten jeweils ihr Leben. Sie verstanden sich als modernes Paar – verliebt, aber unabhängig.
Die Trennung kam für Solène völlig überraschend. Eine harte Landung auf dem Boden der Tatsachen.
Nach ein paar Wochen fühlt sie sich in der Lage, das Zimmer mit den weißen Wänden zu verlassen, um eine Runde im Park zu drehen. Der Psychiater setzt sich neben sie auf die Bank und gratuliert ihr zu diesem Fortschritt, überschwänglich, als wäre sie ein kleines Kind. Bald schon werde sie in ihre Wohnung zurückkehren können, sagt er, unter der Bedingung, dass sie ihre Medikamente weiterhin einnehme. Die Neuigkeit löst keine Begeisterung in Solène aus. Sie findet die Vorstellung, allein zu Hause zu sitzen, ohne Ziel und Plan, nicht sehr verlockend.
Sicher, sie lebt in einer schicken Dreizimmerwohnung in einem schönen Stadtviertel. Doch auf einmal kommt sie ihr kalt und zu groß vor. In ihrem Kleiderschrank wartet der Kaschmirpulli auf sie, den Jérémy vergessen hat und den sie sich manchmal überzieht. In der Küche stapeln sich die amerikanischen Chips mit dem penetrant künstlichen Geschmack – Jérémys Lieblingssorte, die sie jedes Mal aus dem Supermarkt mitbringt, die Macht der Gewohnheit. Dabei mag sie selbst die Dinger gar nicht. Und das Knistern von Chipstüten im Kino oder vor dem Fernseher hat sie schon immer genervt. Heute würde sie alles darum geben, es noch einmal zu hören: das Geräusch, wenn Jérémy neben ihr auf dem Sofa seine Chips knabbert.
In die Kanzlei möchte sie nicht zurück. Sie macht niemandem einen Vorwurf. Aber nur die Vorstellung, das Gerichtsgebäude zu betreten, bereitet ihr Übelkeit. Sie wird lange brauchen, bevor sie überhaupt wieder einen Schritt in das Viertel setzen kann. Sie wird kündigen, der Arbeit fernbleiben, wie es so schön heißt – das klingt sanfter und suggeriert die Möglichkeit einer Rückkehr. Eine Rückkehr, die sie nicht ernsthaft in Betracht zieht.
Solène gesteht dem Psychiater, dass sie Angst hat, die Klinik zu verlassen. Sie hat keine Ahnung, wie das gehen soll: ein Leben ohne Arbeit, ohne Terminkalender, ohne Sitzungen, ohne Verpflichtungen. Ohne diese Halteleinen fürchtet sie abzudriften. Helfen Sie anderen, schlägt der Arzt ihr vor. Warum nicht ein Ehrenamt? … Solène hört ihm perplex zu. Sie durchlaufe eine Sinnkrise, fährt er fort. In solchen Situationen hilft es, sich selbst aus dem Fokus zu nehmen, sich anderen Menschen zu öffnen, man muss wieder einen Grund finden, morgens aufzustehen. Sich nützlich zu fühlen, sich für eine Sache zu engagieren, anderen zu helfen, könnte einer sein.
Pillen und soziales Engagement – ist das alles, was ihm einfällt? Und dafür studiert man jahrelang Medizin? Solène ist fassungslos. Nicht, dass sie grundsätzlich etwas gegen eine ehrenamtliche Tätigkeit einzuwenden hätte. Aber sie selbst fühlt sich nicht unbedingt dazu berufen, Mutter Teresa nachzueifern. Wem könnte sie in ihrem Zustand auch schon helfen, sie schafft es ja selbst kaum aus dem Bett.
Doch der Psychiater lässt nicht locker. Versuchen Sie es, insistiert er, während er ihre Entlassungspapiere unterschreibt.
Tagelang dämmert Solène zu Hause auf dem Sofa, blättert in Zeitschriften, für die sie am liebsten sofort ihr Geld zurückverlangen möchte. Auch die Anrufe und Besuche von Familienangehörigen und Freunden erlösen sie nicht von ihrem Weltschmerz. Sie hat zu nichts Lust, schon gar nicht steht ihr der Sinn nach Konversation. Alles langweilt sie. Ziellos irrt sie durch die Räume, vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer und zurück. Ab und zu schleppt sie sich zum Lebensmittelladen an der Ecke oder zur Apotheke, um ihren Vorrat an Tabletten aufzufrischen, danach legt sie sich gleich wieder hin.
An einem der vielen Nachmittage, die sie träge auf der Couch verbringt, klappt sie ihr nagelneues MacBook auf – ein Geschenk ihrer Kollegen zum Vierzigsten, kurz vor ihrem Burn-out –, das sie bisher so gut wie nicht benutzt hat. Eine ehrenamtliche Tätigkeit … Warum eigentlich nicht? Über die Suchmaschine gelangt sie zum offiziellen Stadtportal von Paris, wo alle möglichen Trägerschaften Suchanzeigen gepostet haben. Der Name der Domain lässt sie aufmerken: ichbindabei.org. »Mit nur einem Klick zum sozialen Engagement!«, verspricht die Startseite. Und sogleich flimmert eine Vielzahl von Fragen über den Bildschirm: Wo wollen Sie helfen? In welchem Umfang? In welcher Form? Auf keine dieser Fragen weiß Solène eine Antwort. Eine Menüleiste mit den unterschiedlichsten Rubriken klappt auf: Alphabetisierungs-Workshops für Menschen ohne Lese- und Schreibkenntnis, Hausbesuche bei Alzheimerpatienten, Fahrradkurierdienste zur Verteilung von Essensspenden, Schichtdienst in der Notübernachtung für Obdachlose, Coaching für überschuldete Haushalte, Lernhilfe in sozialen Brennpunkten, Moderation von Bürgerdiskussionen, Retter für Tiere in Not, Unterstützung von geflüchteten Menschen, Betreuung von Langzeitarbeitslosen, Mithilfe bei der Essensausgabe, Vorträge in einem Seniorenheim, Animateur*in in Krankenhäusern, Besuchsdienste im Gefängnis, Kleider- und Sachspendensortierung, Betreuung von behinderten Schülerinnen und Schülern, Sprechstunde beim Sorgentelefon, Erste-Hilfe-Ausbilder*in … Es gibt sogar einen Verein, der sich Schutzengel nennt. Kurz huscht ein Lächeln über Solènes Gesicht – sie fragt sich, wo ihrer wohl gerade steckt. Er muss sich verflogen, irgendeine Abzweigung verpasst haben. Sie gibt ihre Recherche auf, ratlos angesichts der Überfülle an Annoncen. Jedes einzelne Anliegen ist ehrenwert und unterstützungswürdig. Doch sich auf eine Sache festlegen zu müssen lähmt sie vollkommen.
Es ist der Einsatz von Zeit, den alle Organisationen fordern. Also das, was am schwierigsten zu bewerkstelligen ist in einer Gesellschaft, in der jede Sekunde zählt. Sich wirklich zu engagieren bedeutet, seine Zeit zur Verfügung zu stellen. Zeit hat Solène, ihr fehlt es an der nötigen Energie. Sie fühlt sich nicht imstande, eine Entscheidung für oder gegen etwas zu treffen. Dieser Schritt erscheint ihr zu viel verlangt, er überfordert sie. Lieber spendet sie weiterhin Geld – das ist unverbindlicher.
Im Grunde ihres Herzens weiß sie, dass es feige ist. Aber sie will im Moment einfach nur schlafen. Weiterschlafen, noch eine Stunde, einen Monat, ein Jahr. Will ihre Pillen schlucken und abstumpfen, um nicht mehr nachdenken zu müssen.
Als sie die Hand ausstreckt, um ihren Laptop zuzuklappen, sticht ihr eine Anzeige ins Auge, sie steht ganz unten auf der Seite. Eine knappe Zeile, die ihr vorher nicht aufgefallen war.
2
Öffentlicher Schreiber gesucht. Kontaktieren Sie uns.
Als Solène diese Zeilen liest, überfällt sie ein seltsamer Schauer. Schreiber. Nur ein Wort, und alles ist wieder da.
Anwältin zu werden war nie ihr Herzenswunsch gewesen. Als Kind hatte Solène alle mit ihrer überbordenden Phantasie beeindruckt. Als Jugendliche fiel sie durch ihre besondere Fähigkeit im sprachlichen Ausdruck auf. Die Lehrer bescheinigten ihr einhellig ein großes Talent auf diesem Gebiet. Tag und Nacht füllte sie leere Hefte mit Gedichten und Erzählungen, ihre Imagination schien nie zu versiegen. Insgeheim träumte sie davon, Schriftstellerin zu werden. Sie wollte ihr Leben an einem Schreibtisch verbringen, wie Colette, mit einer Katze auf dem Schoß, und wie Virginia, in einem eigenen Zimmer.
Als Solène ihren Eltern von ihren beruflichen Plänen erzählte, reagierten sie mehr als reserviert. Sie waren beide Juraprofessoren, durch und durch, künstlerische Neigungen beäugten sie mit Argwohn, Flausen waren das, die ins Abseits führten. Sie sollte sich einen anständigen Beruf aussuchen, einen, der ihr gesellschaftliche Anerkennung einbrachte. Das war es, was zählte.
Ein anständiger Beruf. Ganz egal, ob er einen glücklich machte.
Vom Bücherschreiben kann man nicht leben, meinte ihr Vater. Es sei denn, man ist ein Hemingway, aber das … Er hatte das Ende seines Satzes in der Schwebe gelassen. Doch Solène wusste genau, was dieses Zögern bedeutete. Er wollte sagen: aber das hängt davon ab. Es hängt von deinem Talent ab. Es hängt von anderen ab. Es hängt von so vielen Dingen ab, die wir nicht beeinflussen können und die uns Angst machen. Also: Lass die Finger davon. Hör auf zu träumen.
Du solltest lieber Jura studieren, hatte er stattdessen vorgeschlagen. Schreiben kannst du ja trotzdem, für dich. Woraufhin Solène ihre Pläne an den Nagel hängte, die Idee der Katze auf ihren Knien ebenso wie die Romane von Virginia. Wie ein braver kleiner Soldat trat sie zurück ins Glied. Ihre Eltern wollten eine Anwältin zur Tochter, sie würde sich diesem Wunsch fügen. Anstelle ihrer eigenen Bedürfnisse würde sie die Bedürfnisse ihrer Eltern verwirklichen. Mit Jura kommst du überallhin, hatte ihre Mutter behauptet. Eine Lüge. Mit Jura kam man nirgendwohin. Jura führte immer nur zu Jura. Deswegen war Solène in dem Zimmer mit den weißen Wänden gelandet, wo sie versuchte, all die Jahre zu vergessen, die sie mit der Juristerei zugebracht hatte. Als die Eltern sie in der Klinik besuchten, zeigten sie sich ratlos angesichts ihres Zustandes. Du hast doch alles, sagten sie, einen tollen Job in einer renommierten Kanzlei, eine schöne Wohnung …
Ja, und?, denkt Solène bitter. Ihr Leben kommt ihr vor wie ein Modellhaus. Auf dem Foto wirkt es hübsch, aber bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass das Wesentliche fehlt. Es ist nicht bewohnt. Ihr kommt ein Ausspruch von Marilyn Monroe in den Sinn: Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen. Solènes Füße sind eiskalt. Ihr Herz ist es auch.
Kindheitsträume zu vergessen ist nicht schwer, man hört einfach auf, daran zu denken. Man bedeckt sie mit einem Schleier, so wie man Laken über Möbelstücke wirft, wenn man ein Haus für längere Zeit verlässt.
Eine Weile gelang es Solène, neben der Arbeit in der Kanzlei zu schreiben, sie nutzte jede freie Minute. Doch die zeitlichen Abstände zwischen ihren Texten wurden immer größer. Bis in ihrem überladenen Terminkalender schließlich gar kein Platz mehr fürs Schreiben war. Der Alltag als Anwältin war anspruchsvoll, Solène war es auch. Die Arbeit fraß immer öfter ihre Abende, Wochenenden und Urlaube auf. Sie hatte einem unerschrockenen Monster, das nie satt und zufrieden war, die Tür geöffnet, und es dauerte nicht lange, da verschlang es alles. Freizeit, Freunde. Und auch ihr Liebesleben. Die Männer stiegen aus, sobald sie begriffen, dass sie der Konkurrenz nicht gewachsen waren. Nächtelanges Durcharbeiten, ausgeschlagene Essenseinladungen, in letzter Minute stornierte Urlaubsreisen – immer lag etwas Dringendes in der Kanzlei an, immer war alles wichtiger als das Private. Dennoch zog Solène den Gewaltmarsch durch. Keine Zeit zu leiden, keine Zeit zu heulen.
Bis Jérémy auf der Bildfläche erschien.
Ein attraktiver, gebildeter, geistreicher Jurist, den sie bei der Wahl des Präsidenten der Pariser Anwaltskammer kennenlernte. Dass sie den gleichen Beruf ausübten, beruhigte Solène. Jérémy würde sie verstehen, er setzte dieselben Prioritäten, dachte sie. Dabei hatte eine Freundin sie gewarnt: »Zwei Anwälte in einer Beziehung, sind einer zu viel.« Sie sollte recht behalten. Jérémy verließ Solène für eine weniger brillante Frau, die jedoch verfügbarer war. Er hatte sie bei einem Abendessen getroffen, das Solène absagen musste, weil ein Fall sie mal wieder völlig in Beschlag nahm.
Öffentlicher Schreiber. Die Wörter haben Kraft. Sie wirken wie Zündstoff. Lange bleibt Solènes Blick an der Überschrift dieser Anzeige haften. Über einen Link gelangt sie auf die Website einer Organisation, die sich »Schreiben verbindet« nennt. Gleich auf der Startseite findet sich das detaillierte Anforderungsprofil für einen öffentlichen Schreiber: Sie sind ein Profi in der schriftlichen Kommunikation und verstehen sich als Ansprechpartner*in für jedes Anliegen, das einen Schriftverkehr erfordert – vom persönlichen Brief bis zum amtlichen Schreiben. Sie sollten vielseitig informiert sein, die Regeln von Syntax, Rechtschreibung und Grammatik beherrschen und über Gewandtheit und Routine im Formulieren verfügen. Darüber hinaus sind Sie vertraut mit administrativen Vorgängen und sicher im Umgang mit dem Internet sowie den gängigen Textverarbeitungssystemen. Kenntnisse im juristischen und wirtschaftlichen Bereich sind empfehlenswert.
Solène bringt alle diese Kompetenzen mit. Die Anzeige scheint wie auf sie zugeschnitten. An der Universität wurde sie oft für ihren flüssigen Stil und reichen Wortschatz gelobt. Und nicht selten baten Kanzleikollegen sie um Rat, wenn sie ihre Schriftsätze verfassten. Du schreibst so gut, fanden sie.
Die Idee, ihre Worte Menschen an die Hand zu geben, die sie brauchten, gefällt ihr. Sie könnte das. Ja, das würde sie hinkriegen.
In einem letzten Punkt präzisiert die Anzeige, dass die Fähigkeit, gut zuzuhören, ebenfalls ins Portfolio eines öffentlichen Schreibers gehört. Wenn Solène im Umgang mit ihren Mandanten eines perfektioniert hat, dann wohl das: sich selbst zurückzunehmen und ihrem Gegenüber Raum zu geben. Ein guter Anwalt hat auch psychologisches Geschick, er ist eine Vertrauensperson. Sie selbst hat sich viele Lebensbeichten angehört, Geheimnisse, die bis dahin unausgesprochen waren, und sie hat eine Menge Tränen getrocknet. Sie hat ein Gespür für Menschen. Sie ist jemand, dem man sich bereitwillig offenbart.
Sich selbst aus dem Fokus nehmen, hat der Psychiater ihr geraten, sich nützlich fühlen, indem man sich für eine Sache engagiert, anderen hilft. Entschlossen klickt Solène auf »Kontakt«, schreibt eine Nachricht an die Organisation und schickt sie ab. Alles ist besser, als weiterhin langsam auf diesem Sofa zu verkümmern. Außerdem, findet sie, ist »Schreiben verbindet« ein schöner Name, und einen Versuch ist es wert, sie hat schließlich nichts zu verlieren.
Am nächsten Morgen klingelt das Telefon, es ist der Leiter der Organisation. Er heißt Léonard. Seine Stimme ist klar, er wirkt heiter. Er bittet sie um ein Treffen, noch am selben Tag, in seinem Büro im XII. Arrondissement. Überrascht von dieser prompten Rückmeldung, sagt Solène zu und notiert die Adresse auf einem kleinen Zettel.
Sich anzukleiden kostet sie Überwindung. In letzter Zeit hat sie sich nur noch im Jogginganzug durch die Wohnung geschleppt. Zum Einkaufen im Laden an der Ecke ist sie in Leggings und Jérémys altem Pulli gegangen. Der Gedanke daran, die Metro zu nehmen, um einen Termin in einem entlegenen Viertel wahrzunehmen, strapaziert sie schon im Voraus. Sie ist kurz davor, die Sache abzublasen. Sie fühlt sich nicht in der Lage, irgendwelche Fragen zu beantworten, eine gepflegte Konversation zu betreiben.
Andererseits klang der Mann am Telefon sehr sympathisch. Also schluckt Solène ihre Tabletten und begibt sich tapfer zu der Adresse auf ihrem Zettel. Keine sehr einladende Gegend. Ihr Ziel ist ein baufälliges Gebäude am Ende einer Sackgasse. Die Eingangstür lässt sich nicht öffnen – die Gegensprechanlage ist kaputt, teilt ihr ein Bewohner mit, der gerade aus dem Haus tritt, der Aufzug übrigens auch. Solène kämpft sich zu Fuß die fünf Stockwerke hoch bis zu »Schreiben verbindet«. Ein Mann um die vierzig empfängt sie mit offenen Armen. Er freut sich ganz offensichtlich, sie zu treffen, und führt sie in einen Raum, den er stolz als »Sitz der Organisation« bezeichnet, ein winziges Büro, in dem unglaubliches Chaos herrscht. Solène muss an ihre perfekt aufgeräumte Wohnung denken und fragt sich, wie man auf einer solchen Baustelle arbeiten kann. Léonard befreit einen Stuhl von einem Stapel Briefe und lädt sie ein, Platz zu nehmen. Er bietet ihr einen Kaffee an, sie nickt, warum, ist ihr schleierhaft – sie trinkt nie Kaffee, immer nur Tee. Er reicht ihr eine Tasse mit einer bitteren, kalten Brühe, die sie nur aus Höflichkeit herunterbringt. Beim nächsten Mal, nimmt sie sich vor, wird sie das Angebot ausschlagen.
Léonard setzt sich eine Brille auf und überfliegt erstaunt ihren Lebenslauf. Normalerweise, gesteht er, bewerben sich bei ihm Rentner, die nichts anderes zu tun haben, eine Anwältin aus einer Großkanzlei war noch nicht dabei. Über die Gründe, die sie hierhergeführt haben, schweigt Solène. Sie erwähnt mit keiner Silbe die Depression, den Burn-out, den Tod von Arthur Saint-Clair, all das, was ihr den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Sie spricht von einer beruflichen Umorientierung. Auf keinen Fall will sie sich outen und eine wie auch immer geartete Vertraulichkeit zu einem Unbekannten herstellen. Deswegen sitzt sie nicht hier. Während Léonard ihre Unterlagen durchsieht, fallen ihr die Kinderzeichnungen ins Auge, die an der Wand hinter ihm hängen. Eine ist mit einem krakeligen Ich hab dich lihb versehen. Ein selbstgetöpferter Dinosaurier thront auf dem Schreibtisch und dient als Briefbeschwerer. Das ist ein Deltadromeus, erklärt Léonard, man könnte meinen, es handle sich um einen Tyrannosaurus Rex, aber nein, schauen Sie mal, seine Pranken sind viel feiner. Solène lächelt zustimmend. Ein normales Leben zu führen bedeutet offenbar, dass man sich mit den komplizierten Namen von Dinosauriern auskennt und eine Sammlung von Liebesbekundungen mit Rechtschreibfehlern sein Eigen nennt.
Léonard gratuliert ihr zu ihrer glanzvollen Laufbahn mit all den Abschlüssen und reicht ihr den Lebenslauf wieder über den Tisch. Sie ist perfekt für die ausgeschriebene Stelle! Ein Geschenk des Himmels für die Organisation! Wann kann sie anfangen? Solène zögert, sie ist ein bisschen irritiert. Sie hat soeben das wohl kürzeste Bewerbungsgespräch ihres Lebens geführt. Wenn sie im Vergleich dazu an die vielen Etappen denkt, die sie bis zur Einstellung in der Kanzlei durchlaufen musste – ein langer, mühsamer Prozess. Natürlich hat sie nicht erwartet, dass man hier den gleichen Anforderungen unterzogen wird, aber sie ist davon ausgegangen, dass man sie zumindest zu ihrer Erfahrung befragt. Wir suchen händeringend nach freiwilligen Helfern, sagt Léonard, zwei unserer Rentner sind vor kurzem gestorben. Als er merkt, dass seine Ausführungen nicht gerade ermutigend wirken, lacht er: Nicht alle Mitglieder der Organisation sterben, ein paar überleben auch, manchmal. Nun muss Solène auch lachen. Léonard übertreibt es ein wenig, aber seine Art ist nicht unangenehm. Seine positive Energie überträgt sich. Er fügt hinzu, dass sie den Kandidaten normalerweise eine Ausbildung von zwei Tagen anbieten, dass ihm das in ihrem Fall allerdings nicht nötig erscheine. Sie sei klar überqualifiziert, sie werde sich problemlos in den Job einfinden. Sie wisse vermutlich besser als jeder andere, wie man ein offizielles Schreiben aufsetzt, Formulare ausfüllt, Ratschläge gibt, jemanden anleitet und Menschen begleitet, die sich hilfesuchend an sie wenden. Dann taucht Léonard hinter dem Berg Papier ab, der sich auf seinem Schreibtisch angesammelt hat, und zieht ein Blatt hervor – es sieht chaotischer hier aus, als es ist, bemerkt er, aber ich weiß immer genau, wo ich was suchen muss. Er schlägt ihr eine Aufgabe in einem Haus für Frauen vor. Sie brauchen dort jemanden, der eine Stunde pro Woche zur Verfügung steht, um die Bewohnerinnen bei der Erledigung ihrer Korrespondenz zu unterstützen.
Solène atmet tief durch. Ein Wohnheim für Frauen, die Idee lässt sie nicht gerade vor Freude tanzen. Sie dachte, dass man sie vielleicht ins Rathaus oder in irgendeine Behörde schickt. Wer Frauenhaus sagt, meint Elend und soziale Not – nein, das ist im Augenblick keine gute Idee. Ihr schwebt eher etwas in der Bezirksverwaltung vor, ja, das wäre perfekt … Léonard schüttelt den Kopf, dafür gibt es aktuell keinen Bedarf. Er verschwindet wieder hinter seinen Stapeln und zieht zwei weitere Gesuche hervor. Ein Untersuchungsgefängnis in der Banlieue … und ein Palliativzentrum für Patienten, die im Sterben liegen. Solènes Zuversicht schwindet zusehends. Gefängnisse hat sie als Anwältin ausreichend von innen erleben dürfen, nein, danke, da hat sie ihren Beitrag bereits geleistet. Und was das Palliativzentrum anbelangt … Auch nicht gerade die beste Option für jemanden, der einen Weg aus der Depression sucht. Sie möchte am liebsten aufstehen und einfach gehen. Sie fragt sich, was sie hier eigentlich tut. Welcher Irrtum hat sie bloß in dieses erbärmliche Büro am Rande der Stadt geführt? Was hat sie hier verloren?
Léonard wartet ab, sein Blick hängt an ihren Lippen, seine Augen sind so voller Hoffnung, es ist beinahe rührend. Er wartet wie ein Angeklagter auf sein Urteil. Solène fühlt sich außerstande, ihm eine Abfuhr zu erteilen. Sie hat es bis hierher geschafft, fünf Stockwerke hoch, sie hat den schlechtesten Kaffee aller Zeiten getrunken und ein Gespräch geführt. Vor einem Monat wäre all das undenkbar gewesen, sie hätte es nicht einmal aus dem Bett geschafft. Sie muss weitermachen, sie muss sich gewissen Herausforderungen stellen.
Einverstanden, hört sie sich sagen. Ich nehme das Frauenwohnheim.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: