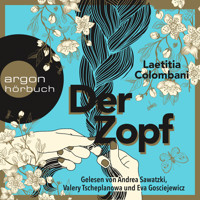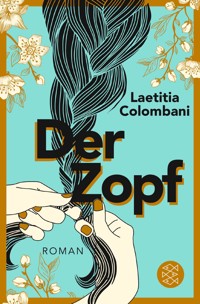9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Das Mädchen mit dem Drachen« - nach »Der Zopf« und »Das Haus der Frauen« der neue Roman der Bestsellerautorin Laetitia Colombani Eine Schule am Indischen Ozean - ein hoffnungsvoller Ort, der alles verändert Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in Frankreich vergessen. Jeden Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das seinen Drachen fliegen lässt. Als Léna von einer Ozeanwelle fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe bei Preeti, der furchtlosen Anführerin einer Selbstverteidigungsgruppe für junge Frauen. Léna überlebt und zusammen mit Preeti schmiedet sie einen Plan, der nicht nur Lalitas Leben grundlegend verändern wird. Wie schon in ihren Bestsellern »Der Zopf« und »Das Haus der Frauen« erzählt Laetitia Colombani bewegend und mitreißend von mutigen Frauen, denen das scheinbar Unmögliche gelingt. Das indische Mädchen Lalita, bekannt aus »Der Zopf«, bekommt im Roman »Das Mädchen mit dem Drachen« ihre eigene Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Laetitia Colombani
Das Mädchen mit dem Drachen
Roman
Über dieses Buch
Eine Schule am Indischen Ozean - ein hoffnungsvoller Ort, der alles verändert
Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in Frankreich vergessen. Jeden Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das seinen Drachen fliegen lässt. Als Léna von einer Ozeanwelle fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe bei Preeti, der furchtlosen Anführerin einer Selbstverteidigungsgruppe für junge Frauen. Léna überlebt und fasst einen Plan. Als ehemalige Lehrerin will sie Lalita, die für ihre Familie arbeiten muss statt zur Schule zu gehen, lesen und schreiben beibringen. Allen Widerständen zum Trotz gründen Léna und Preeti die erste Dorfschule, die alles verändern wird.
Wie schon in ihren Bestsellern »Der Zopf« und »Das Haus der Frauen« erzählt Laetitia Colombani bewegend und mitreißend von mutigen Frauen, die das scheinbar Unmögliche wagen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Laetitia Colombani wurde 1976 in Bordeaux geboren, sie ist Filmschauspielerin und Regisseurin. Ihr erster Roman »Der Zopf« stand wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wird verfilmt. Für ihren zweiten Roman »Das Haus der Frauen« recherchierte Colombani im »Palais de la Femme« in Paris, einem Wohnheim für Frauen in Not. »Das Haus der Frauen« ist der erste Roman über Blanche Peyron, die 1926 unter widrigsten Umständen eines der ersten Frauenhäuser begründete. Die Idee für ihren dritten Roman »Das Mädchen mit dem Drachen« fand Laetitia Colombani in Indien, in einer Schule für Dalits. Laetitia Colombani lebt in Paris.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
[Widmung]
[Motto]
Prolog
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Zweiter Teil
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Bouguenais, ein Vorort von Nantes,zwei Jahre zuvor
Dritter Teil
»Bildung ist keine [...]
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Jacques
Den Kindern in der Wüste Thar
Meiner Mutter,
die ihr Leben lang unterrichtet hat
Im Gedenken an Dany,
die den Drachen in den Himmel gefolgt ist
»Gehe nicht vor mir her, vielleicht folge ich dir nicht. Geh nicht hinter mir, vielleicht führe ich dich nicht. Geh einfach neben mir und sei mein Freund.«
Albert Camus
»Das Unglück ist groß,doch der Mensch ist größer als das Unglück.«
Rabindranath Tagore
Prolog
Mahabalipuram
Distrikt Kanchipuram,
Tamil Nadu, Indien
Léna erwacht mit einem seltsamen Gefühl, als hätte sie Schmetterlinge im Bauch. Gerade geht die Sonne über Mahabalipuram auf. In der Hütte, gleich neben der Schule, ist es bereits drückend warm. Laut Vorhersage soll die Temperatur an diesem Tag auf vierzig Grad steigen. Léna hat es abgelehnt, eine Klimaanlage einbauen zu lassen – keine der Baracken im Viertel hat eine, wieso sollte für ihre Unterkunft eine Ausnahme gemacht werden? Ein einfacher Ventilator durchknetet die stickige Luft im Raum. Vom nahen Meer weht eine schwüle Brise wie übelriechender Atem herüber, der beißende Gestank von vertrocknetem Fisch überlagert den Duft der Gischt. Ein Schulbeginn in brütender Hitze, unter bleiernem Himmel. In diesem Teil der Welt fängt der Unterricht im Juli wieder an.
Die Kinder werden bald da sein. Punkt acht Uhr dreißig werden sie durch das Eingangstor kommen, über den Hof laufen und, etwas linkisch in ihrer nagelneuen Uniform, zum einzigen Klassenraum hinstürzen. Auf diesen Tag hat Léna gewartet, gehofft, ihn sich tausendmal vorgestellt. Sie musste viel Energie aufbringen, um das Projekt erfolgreich auf die Beine zu stellen – ein verrücktes, wahnwitziges Projekt, das einzig und allein ihrem Willen zu verdanken ist. Wie eine Lotusblume, die in einer Vase wächst und sich entfaltet, ist die kleine Schule aufgeblüht am Rande dieser Küstenstadt, die manche noch als Dorf bezeichnen – dicht an dicht leben Tausende Menschen hier, am Golf von Bengalen, zwischen alten Tempeln und dem Strand, an dem sich unterschiedslos Kühe, Fischer und Pilger tummeln. Nichts an dem Gebäude mit seinem gestrichenen Mauerwerk und seinem Hof, in dessen Mitte ein einziger Baum steht, ein großer Banyan, ist auffällig, es fügt sich bescheiden in die Umgebung ein. Niemand kann erahnen, dass die Existenz dieser Schule das reinste Wunder ist. Léna müsste sich freuen, diesen Augenblick wie ein Fest begehen, wie einen Sieg, eine Vollendung feiern.
Doch sie schafft es nicht aufzustehen. Ihr Körper ist bleischwer. In der vergangenen Nacht haben ihre Geister sie wieder heimgesucht. Sie hat sich unruhig in ihrem Bett hin und her gewälzt, bevor sie in einen oberflächlichen Schlaf fiel, in dem sich Gegenwart und Vergangenheit miteinander verwoben – sie sah sich als Lehrerin zu Schuljahresbeginn, wie sie einen Haufen Papiere ausfüllte, Materiallisten erstellte, Unterrichtsstunden vorbereitete. Sie hat diese betriebsamen ersten Tage nach den langen Sommerferien immer geliebt. Der Geruch der glatten, neuen Heftschoner, die Bleistifte und Filzschreiber, die das weiche Leder der Federmäppchen wölbten, die jungfräulichen Taschenkalender und die frisch geputzten Tafeln bereiteten ihr eine unglaubliche Freude, gaben ihr die tröstliche Gewissheit eines ewigen Neubeginns. Ob zu Hause oder in den Korridoren der Schule, stets war sie umtriebig, immer im Einsatz. Das Glück war greifbar, es steckte in all diesen kleinen Augenblicken des Alltags, dessen Gleichmaß ihr das Gefühl einer unerschütterlichen, sicheren Existenz gab.
Wie fern es ihr erscheint, dieses frühere Leben. Während sie ihren Erinnerungen freien Lauf lässt, spürt Léna, dass sie in einen Ozean aus Angst hineingleitet, sie weiß nicht, wie sie diese Angst loswerden soll. Plötzlich packt sie der Zweifel. Was tut sie hier bloß, im hintersten Winkel des indischen Subkontinents, Lichtjahre entfernt von zu Hause? Was hofft sie hier zu finden? Indien hat sie ihrer Bezugspunkte und Gewissheiten beraubt. In dieser neuen Welt glaubte sie, ihren Schmerz vergessen zu können – ein allzu menschliches Bedürfnis, sie wollte dem Unglück ein brüchiges Bollwerk entgegensetzen, genauso gut hätte sie eine Sandburg am Ufer eines tobenden Meeres bauen können. Der Deich hat nicht gehalten. Der Kummer holt sie ständig ein, er klebt ihr auf der Haut wie die von der feuchten Sommerhitze durchtränkte Kleidung. Auch an diesem Tag, dem ersten Schultag, ist er wieder da, ungebrochen.
Von ihrem Bett aus hört sie die ersten Schüler sich nähern. Sie sind früh aufgestanden, voller Erwartung – an diesen Tag werden sie sich ihr Leben lang erinnern. Sie drängeln sich schon am Eingang zum Hof. Léna ist zu keiner Bewegung imstande. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie von der Fahne gehen will. Jetzt aufgeben, nachdem sie so lange gekämpft hat … Was für eine Enttäuschung. Die Sache hat Mut, Geduld und Entschlossenheit erfordert. Allein mit dem Erstellen von Statuten und dem Einholen von Genehmigungen war es nicht getan. In ihrer westlichen Naivität war Léna davon ausgegangen, dass die Bewohner des Viertels nichts Eiligeres zu tun hätten, als ihre Kinder zur Schule zu schicken, dass sie überglücklich wären, ihnen die Grundbildung zu ermöglichen, die ihnen die Gesellschaft bisher verwehrt hatte. Sie hatte nicht damit gerechnet, so viel Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. Reis, Linsen und Chapati[1] waren dabei ihre engsten Verbündeten. In der Schule werden sie zu essen bekommen, versprach sie. Gefüllte Mägen waren ein schlagkräftiges Argument für die oft kinderreichen und hungernden Familien – im Dorf bekommen die Frauen bis zu zehn, zwölf Kinder.
In einigen Fällen erwies sich die Verhandlung als besonders schwierig. Ich gebe dir eine von beiden, aber die andere bleibt bei mir, sagte eine Mutter und deutete auf ihre Töchter. Welche traurige Realität sich hinter diesen Worten verbarg, hat Léna bald begriffen. Genau wie die größeren Kinder, müssen hierzulande auch die Kleinen arbeiten, sie stellen eine Einkommensquelle dar. Sie schuften in den Reismühlen, im Staub und im ohrenbetäubenden Lärm der Mahlwerke, in den Webereien, den Ziegelbrennereien, den Minen, auf den Farmen, den Jasmin-, Tee- und Cashewplantagen, in den Glas-, Streichholz- und Zigarettenfabriken, auf den Reisfeldern, den Müllhalden. Sie sind Verkäufer, Schuhputzer, Bettler, Lumpensammler, Landarbeiter, Steinhauer, Fahrradtaxifahrer. Theoretisch wusste Léna davon, doch das wahre Ausmaß hat sie erst ermessen, als sie herkam und festen Fuß hier fasste: Indien ist der größte Kinderarbeitsmarkt der Welt. Sie hat Reportagen über die Fabriken im Carpet Belt im Norden des Landes gesehen, wo man Kinder an Webstühle kettet und bis zu zwanzig Stunden am Tag arbeiten lässt, das ganze Jahr über. Eine Form moderner Sklaverei, mit der die ärmsten Schichten der Gesellschaft zermürbt werden. Hauptsächlich betroffen ist die Gemeinschaft der Unberührbaren. Sie gelten als unrein und werden seit jeher von den sogenannten höheren Kasten geknechtet. Nicht einmal die Jüngsten verschont das System, sie sind gezwungen, den Älteren bei den undankbarsten Aufgaben zur Hand zu gehen. Léna hat Kinder gesehen, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in einer dunklen Ecke ihrer Hütte Beedies[2] zwischen ihren schmalen Fingern rollten. Natürlich leugnet die Regierung solche Praktiken: Offiziell verbietet das Gesetz die Arbeit von unter Vierzehnjährigen, jedoch mit einer bemerkenswerten Ausnahme: »sofern sie nicht in einem Familienbetrieb beschäftigt sind« … Eine Klausel am Rande, die auf fast alle ausgebeuteten Minderjährigen zutrifft. Eine Zeile, die Millionen Kindern die Zukunft beschneidet. Opfer dieser Zwangsarbeit sind in erster Linie die Mädchen. Sie müssen zu Hause bleiben, sich um ihre Geschwister kümmern, kochen, Wasser holen, Holz herbeischaffen, putzen, spülen, Wäsche waschen, den ganzen Tag lang.
Den Eltern gegenüber hat Léna sich wacker geschlagen. Sie hat Abmachungen getroffen, die sie kaum für möglich gehalten hätte, geschworen, den Lohn eines jeden Sprösslings in Reis zurückzuzahlen, um den Fehlbetrag der Familie auszugleichen. Die Zukunft eines Kindes gegen einen Sack Reis, ein seltsamer Tauschhandel, auf den sie sich ohne Skrupel eingelassen hat. Jedes Mittel ist recht, hat sie sich gesagt. Im Kampf um Bildung sind alle Tricks erlaubt. Sie hat ihr Ziel mit hartnäckiger Entschlossenheit verfolgt. Und heute sind die Kinder da.
Besorgt, weil Léna auf dem Hof nicht zu sehen ist, rennt ein Junge hin zu der Hütte mit den zugezogenen Vorhängen – alle wissen, dass sie dort wohnt, in diesem Anhängsel der Schule, das ihr als Schlaf- und Arbeitszimmer dient. Der Knirps muss denken, dass sie noch nicht wach ist, er klopft an die Tür und brüllt eines der wenigen Wörter, die er auf Englisch kennt: »School! School!« Sein unvermitteltes Rufen kommt einem Appell gleich, einer Hymne an das Leben.
Léna weiß nur zu gut, was das Wort bedeutet. Zwanzig Jahre ihres Lebens hat sie in seinen Dienst gestellt. So weit sie zurückdenken kann, wollte sie immer unterrichten. Ich werde später Lehrerin, behauptete sie schon als Kind. Kein außergewöhnlicher Wunsch, würden manche sagen. Doch ihr Weg hat sie fernab der ausgetretenen Pfade bis nach Tamil Nadu geführt, einem Dorf zwischen Chennai und Puducherry, bis in diese Hütte, in der sie nun liegt. Du brennst für deine Sache, hatte ihr ein Professor an der Uni gesagt. Selbst wenn ihre Begeisterung und ihre Energie mit zunehmenden Berufsjahren abgeklungen sind, ist sie unerschütterlich in ihren Überzeugungen geblieben: Sie glaubt an Bildung als wirksame Waffe gegen das Elend.
»Die Kinder haben alles, außer das, was man ihnen nimmt«, schrieb Jacques Prévert – dieser Satz hat sie auf ihrer Odyssee wie ein Mantra begleitet. Léna will diejenige sein, die den Kindern zurückgibt, was man ihnen genommen hat. Manchmal stellt sie sich vor, dass sie später studieren, Ingenieure, Chemiker, Mediziner, Lehrer, Buchhalter oder Agronome werden. Wenn sie dieses Territorium, zu dem ihnen der Zutritt so lange verwehrt war, zurückerobert haben, wird Léna allen im Dorf sagen können: Seht nur, eure Kinder, eines Tages werden sie die Welt regieren und sie zu einem besseren Ort machen, einem gerechteren und freieren Ort. In diesem Gedanken steckt eine gewisse Naivität und natürlich Stolz, aber auch Liebe und vor allem der Glaube an ihren Beruf.
»School! School!« Der Junge ruft weiter, und dieses Wort klingt wie eine Kampfansage an das Elend, wie ein gewaltiger Fußtritt wirbelt es Indiens tausendjähriges Kastensystem auf, mischt die Karten der Gesellschaft neu. Ein Wort wie ein Versprechen, ein Passierschein in ein anderes Leben. Es drückt mehr als nur Hoffnung aus: Es bedeutet Rettung. Léna weiß, in dem Augenblick, da die Kinder das Schultor durchschreiten, in der Minute, da sie diese Mauern betreten, ist das Leben nicht mehr ihr Feind, sondern wird ihnen eine Gewissheit offenbaren: Bildung ist ihre einzige Chance, sich von dem Schicksal zu befreien, das ihnen mit der Geburt auferlegt wurde.
School. Wie ein Pfeil trifft dieses Wort Léna mitten ins Herz. Es belebt sie wieder, fegt die Ängste der Vergangenheit beiseite, führt sie in die Gegenwart zurück. Aus ihm schöpft sie die Kraft aufzustehen. Sie zieht sich an, und als sie vor die Hütte tritt, bietet sich ihr ein ergreifender Anblick: Der Hof ist voll Schülerinnen und Schüler, die rund um den Banyanbaum spielen. Wie schön sie sind mit ihren schwarzen Augen, ihren strubbligen Haaren und ihrem strahlenden Lachen. Ein Bild, das Léna unbedingt festhalten, für immer im Gedächtnis behalten möchte.
Das kleine Mädchen ist auch gekommen. Aufrecht und stolz steht es da, inmitten des lärmenden Gewimmels. Nimmt weder an den Spielen noch an den Gesprächen teil. Ist einfach da, und allein seine Anwesenheit rechtfertigt alle Kämpfe der letzten Monate. Léna betrachtet das Gesicht der Kleinen, ihr geflochtenes Haar, ihre schmale Gestalt in der Uniform, die sie wie ein Banner trägt, die nicht bloß ein Stück Stoff ist, sondern ein Sieg. Es ist der Traum einer anderen Frau, den sie beide an diesem Tag verwirklichen.
Léna gibt dem Kind ein Zeichen. Die Kleine geht zur Glocke und bringt sie mit kräftigem Schwung zum Klingen. Eine Geste, in der viel Energie steckt, die aber von Selbstbehauptung zeugt, von einem neuen Vertrauen in die Zukunft. Das Läuten flirrt durch die bereits warme Morgenluft. Abrupt haben die Spiele und der Lärm ein Ende. Die Schüler laufen zu dem Raum mit den weißen Wänden hinüber, setzen sich auf die Matten, nehmen die Bücher und Hefte in Empfang, die Léna verteilt. Sie schauen zu ihr auf, und plötzlich wird es still, so still, dass man ein Insekt surren hören könnte. Die Schmetterlinge in Lénas Bauch flattern aufgeregt durcheinander. Sie atmet tief durch.
Und der Unterricht beginnt.
Erster Teil
Das kleine Mädchen am Strand
1
Zwei Jahre zuvor
Trotz der späten Stunde herrscht eine schwüle Hitze, die Léna schon beim Landeanflug zusetzt. Als sie auf dem Rollfeld des Flughafens von Chennai aussteigt, schwirren bereits ein Dutzend Angestellte geschäftig durch die Dunkelheit, um den Bauch der soeben gelandeten Maschine zu leeren. Mit tiefen Furchen im Gesicht nach der endlos langen Reise passiert sie den Zoll, nimmt ihr Gepäck vom Band, verlässt die riesige klimatisierte Halle und steuert auf die verglasten Ausgangstüren zu. Kaum tritt sie ins Freie, rückt Indien ihr in seiner ganzen Intensität zu Leibe. Das Land fällt sie an wie ein tollwütiges Tier.
Léna ist augenblicklich überwältigt von den vielen Menschen, die sich um sie drängen, dem Lärm und dem Gehupe, den Staus mitten in der Nacht. Sie umklammert ihre Taschen, während Stimmen sie von allen Seiten bestürmen und tausend gesichtslose Hände nach ihr greifen, man bietet ihr ein Taxi, eine Rikscha an, versucht, ihr Gepäck gegen ein paar Rupien an sich zu reißen. Sie hat keine Ahnung, wie sie auf der Rückbank des zerbeulten Autos gelandet ist, dessen Fahrer sich vergeblich bemüht, den Kofferraum zu schließen, ihn dann einfach offen lässt und in einen Redeschwall auf Tamil und Englisch ausbricht. Super driver!, ruft er immer wieder, während Léna besorgt ihren Koffer im Blick behält, der mit jeder Kurve aus dem Wagen zu hüpfen droht. Staunend beobachtet sie den dichten Verkehr ringsum, die zwischen den Lastwagen slalomfahrenden Radfahrer, die Mopeds, auf denen drei oder vier Leute sitzen, Erwachsene, Greise und Kinder, ohne Helm, mit wehendem Haar, die Menschen am Straßenrand, die fliegenden Händler, die Touristengruppen vor den Restaurants, die alten und modernen, mit Girlanden geschmückten Tempel, die abbruchreifen Verkaufsbuden, vor denen Bettler herumstreifen. Überall Menschen, denkt sie, auf den Landstraßen, in der Stadt, am Strand, an dem der Taxifahrer gerade entlangfährt. Etwas Vergleichbares hat Léna noch nie gesehen. Ein faszinierender und zugleich beängstigender Tumult, der sie vollkommen in den Bann schlägt.
Schließlich hält der Fahrer vor einem schmucklosen und unauffälligen Gebäude, ihrem Guesthouse, das auf den Buchungsportalen im Internet gut bewertet wurde. Der Ort strahlt nichts Luxuriöses aus, aber er bietet Zimmer mit Meerblick an – der einzige Anspruch, den Léna stellt, ihr einziger Wunsch.
Fortgehen, das Weite suchen, dieser Gedanke drängte sich ihr in einer schlaflosen Nacht wie eine Selbstverständlichkeit auf. Sich in der Ferne verlieren, um sich besser wiederzufinden. Die alten Gewohnheiten hinter sich lassen, den Alltag, das ganze durchorganisierte Leben. In ihrem stillen Haus, wo jedes Foto, jeder Gegenstand an vergangene Zeiten erinnert, fürchtete sie, im Kummer zu erstarren, wie eine Wachsstatue in einem Museum. Unter anderen Himmeln, in anderen Breiten würde sie wieder zu Kräften kommen, ihre Wunden heilen lassen. Abstand kann hilfreich sein, überlegt sie. Sie braucht Sonne, Licht. Das Meer.
Indien, warum nicht? … François und sie hatten sich fest vorgenommen, einmal dorthin zu reisen, aber wie so viele Pläne, die man schmiedet, war ihnen dieser mangels Zeit, Energie oder verfügbarer Mittel aus dem Blick geraten. Das Leben zog vorüber mit seinem Kommando aus Unterrichtsstunden, Versammlungen, Klassenkonferenzen, Schulausflügen, all diesen Momenten, die durch ihre stete Abfolge die Tage ausfüllten. Die Zeit verging, ohne dass sie es mitbekam, sie ließ sich treiben im Strom der Ereignisse, ließ sich mitreißen von den Turbulenzen eines Alltags, der sie ganz und gar mit Beschlag belegte. Sie erinnert sich gern an diese rastlosen, durchgetakteten Jahre. Damals war sie eine verliebte Frau, eine engagierte Lehrerin, die für ihren Beruf brannte. Dann, eines Nachmittags im Juli, nahm der bunte Reigen ein jähes Ende. Sie muss standhaft bleiben, dem Abgrund widerstehen. Darf nicht den Boden unter den Füßen verlieren.
Sie entscheidet sich für die Koromandelküste am Golf von Bengalen, allein dieser Name verspricht eine willkommene Abwechslung. Und die Sonnenaufgänge über dem Meer dort sollen legendär sein. François hatte immer von diesem Küstenstreifen geträumt. Manchmal macht Léna sich etwas vor. Sie phantasiert, dass er hingereist ist und dort auf sie wartet, am Strand, an einer Wegbiegung, in irgendeinem Dorf. Es ist Balsam, daran zu glauben, sich selbst zu täuschen … Leider währt die Illusion nur einen Augenblick. Schon kehrt der Schmerz zurück, die Trauer. Eines Abends bucht Léna aus einem Impuls heraus ein Flugticket und ein Hotelzimmer. Sie handelt dabei nicht gedankenlos, vielmehr folgt sie einem inneren Appell, einer Eingebung, die sich der Vernunft entzieht.
In den ersten Tagen geht sie kaum vor die Tür. Sie lässt sich massieren, trinkt Tee im ayurvedischen Behandlungszentrum der Unterkunft, ruht sich aus in dem baumbestandenen Innenhof. Die Atmosphäre ist angenehm, entspannend, das Personal aufmerksam und diskret. Dennoch gelingt es Léna nicht abzuschalten, sie kann den Fluss ihrer Gedanken nicht eindämmen. Nachts schläft sie schlecht, hat Albträume, greift schließlich zu Tabletten, die dafür sorgen, dass sie sich völlig benommen durch den Tag schleppt. Zur Essenszeit verkriecht sie sich, sie hat keine Lust auf die krampfhaften Konversationsbemühungen anderer Gäste oder sich auf oberflächliches Gerede im Speisesaal einzulassen, womöglich irgendwelche Fragen beantworten zu müssen. Lieber bleibt sie in ihrem Zimmer, lässt sich ein Gericht bringen, in dem sie appetitlos, auf ihrem Bett kauernd, herumstochert. Die Gesellschaft anderer Menschen findet sie genauso unerträglich wie das Alleinsein. Und auch das Klima ist kaum auszuhalten: Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit schlagen ihr aufs Gemüt.
Sie nimmt an keiner Exkursion teil, besichtigt keinen der touristischen Hotspots in der Umgebung. In einem anderen Leben wäre sie die Erste gewesen, die ihre Reiseführer gewälzt und ausgiebige Erkundungstouren unternommen hätte. Heute fehlt ihr die Kraft dafür. Sie fühlt sich außerstande, sich für irgendetwas zu begeistern, die geringste Neugier für das, was sie umgibt, zu entwickeln, als hätte man die Welt ihrer Substanz beraubt, als stellte sie nur mehr einen leeren, gesichtslosen Raum dar.
Eines Morgens verlässt sie in der Dämmerung das Hotel und spaziert ein wenig am Strand entlang, der um diese Zeit noch menschenleer ist. Nur die Fischer sind bereits auf den Beinen, zwischen den bunten Booten bessern sie ihre Netze aus, die sich vor ihnen zu kleinen, dunstigen Haufen türmen, wie Wolken aus Schaum. Léna setzt sich in den Sand und sieht der Sonne beim Aufgehen zu. Der Anblick hat eine seltsam beruhigende Wirkung auf sie. Sie legt ihre Kleidung ab und geht ins Meer. Das kühle Wasser auf ihrer Haut hebt ihre Stimmung. Sie könnte immer so weiter schwimmen, eins werden mit den Wellen, die sie sanft wiegen.
Sie macht es sich zur Gewohnheit, im Meer zu baden, während um sie herum noch alles schläft. Später am Tag verwandelt sich der Strand in ein einziges buntes Treiben aus Pilgern, die in voller Montur unter Wasser tauchen, und Touristen aus dem Westen, die nach Fotos gieren, hinzu gesellen sich Fischverkäuferinnen, Straßenhändler und nicht zuletzt Kühe, die all diese Menschen vorbeidrängen sehen. Ganz früh am Morgen aber stört kein Lärm die Ruhe dieses Ortes. Einsam und verlassen liegt er da wie ein Freilichttempel, eine Oase des Friedens und der Stille.
Manchmal durchzuckt sie ein Gedanke, wenn sie hinausschwimmt: Sie müsste sich nur einen kleinen Ruck geben, ihrem erschöpften Körper eine letzte Anstrengung abringen. Es wäre herrlich, einfach mit den Elementen zu verschmelzen, völlig lautlos. Am Ende schwimmt sie aber doch ans Ufer zurück und geht zum Hotel, wo das Frühstück auf sie wartet.
Von Zeit zu Zeit sieht sie einen Drachen in den Himmel aufsteigen. Es ist ein improvisierter Drachen, etliche Male zusammengeflickt, ein zierliches Mädchen hält seine Schnur fest umklammert. Die Kleine wirkt so zart, dass man fürchtet, sie könne im nächsten Augenblick selbst davonfliegen, wie der Kleine Prinz mit seinen wilden Vögeln auf der Illustration von Saint-Exupéry, die Léna so sehr mag. Sie fragt sich, was das Kind am Strand macht, um eine Uhrzeit, da niemand außer den Fischern wach ist. Das Spiel dauert ein paar Minuten, dann verschwindet die Kleine wieder.
Einmal geht Léna wie üblich zum Strand hinunter, die Schlaflosigkeit steht ihr an diesem Tag ins Gesicht geschrieben – ein Zustand, an den sie sich gewöhnt hat. Die Müdigkeit hat sich in ihr festgesetzt – sie steckt in dem Kribbeln um ihre Augen, in der unbestimmten Übelkeit, die ihr jeglichen Appetit verschlägt, in der Schwere ihrer Beine, in dem Schwindelgefühl, den anhaltenden Kopfschmerzen. Der Himmel ist klar und wolkenlos, nichts trübt das strahlende Blau. Als Léna später versucht, die Ereignisse zu rekonstruieren, kann sie nicht mehr sagen, wie es dazu kam. Hat sie ihre Kräfte überschätzt? Oder hat sie die Gefahr der Flut und den in den frühen Morgenstunden heraufziehenden Wind bewusst ignoriert? Gerade als sie zum Ufer zurückschwimmen will, wird sie von einer starken Strömung überrascht, die sie wieder hinaus aufs offene Meer zieht. In einem Überlebensreflex versucht sie zunächst, gegen den Ozean anzukämpfen. Vergeblich. Das Meer gewinnt schnell die Oberhand über ihre mageren, von schlaflosen Nächten weitgehend aufgezehrten Energiereserven. Das Letzte, was Léna erkennt, bevor sie in den Fluten versinkt, ist die Silhouette eines Drachens, der irgendwo am Himmel über ihr schwebt.
Als sie am Strand zu sich kommt, sieht sie in das Gesicht eines Kindes. Zwei dunkle Augen starren sie an, durchdringend, als gelte es, sie mit Blicken zum Leben wiederzuerwecken. Rot-schwarze Schatten hasten hin und her, rufen einander panisch Worte zu, deren Sinn Léna nicht erfasst. Das Bild des Kindes verschwimmt im allgemeinen Tumult, bis es sich schließlich vollständig in der sich bildenden Menschentraube auflöst.
2
Léna erwacht in einer weißen, wie von einem Dunstschleier verhangenen Kulisse, umringt von einer Schar junger Mädchen, die über sie gebeugt stehen. Eine ältere Frau sorgt dafür, dass sie sich zerstreuen, scheucht sie fort wie lästige Fliegen. Sie sind im Krankenhaus!, ruft sie laut in einem Englisch mit starkem indischen Akzent. Es ist ein Wunder, dass Sie noch leben, fügt sie hinzu. Die Winde in dieser Gegend sind sehr kräftig, die Touristen nehmen sich einfach nicht in Acht. Immer wieder kommt es zu Unfällen. Sie horcht sie ab, schlägt dann einen beschwichtigenden Ton an: Der Schreck war größer als der Schaden, aber wir werden Sie zur Beobachtung hierbehalten. Bei dieser Ankündigung wäre Léna beinah ein weiteres Mal in Ohnmacht gefallen. Mir geht es gut, lügt sie, ich kann gehen. Dabei fühlt sie sich eigentlich am Rande der Erschöpfung. Sie hat Schmerzen am ganzen Körper, als hätte man sie grün und blau geprügelt, als wäre sie einmal in der Waschmaschine durchgeschleudert worden. Doch ihr Protest stößt nicht auf offene Ohren. Ruhen Sie sich aus!, rät die Schwester ihr abschließend und überlässt sie dann sich selbst in ihrem Krankenbett.
Ausruhen, hier? Der Rat entbehrt nicht einer gewissen Ironie … In diesem Krankenhaus herrscht ein Treiben wie auf einer indischen Autobahn am helllichten Tag. Einige Patienten warten zusammengepfercht auf dem Gang, andere lassen sich gerade ihr Essen schmecken. Wiederum andere beschimpfen das Pflegepersonal, das von der Situation überfordert wirkt. Gleich nebenan, im Behandlungszimmer, entrüstet sich eine junge Frau gegenüber einem Arzt, der sie untersuchen will. Um Lénas Bett wirbelt noch immer die Mädchenschar. Die meisten von ihnen sind Teenager, sie alle tragen einen rot-schwarzen Salwar Kameez[3]