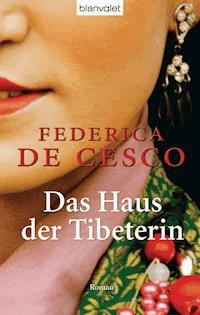Inhaltsverzeichnis
PROLOG
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
Copyright
Berührt nicht die Schulter des Reiters, der vorbeizieht.
Er könnte sich umwenden, und da würde es Nacht.
Eine Nacht ohne Sterne, ohne Wölbung, ohne Wolken.
Was würde dann aus all dem, was der Himmel macht?
Aus dem Mond und seiner Bahn, aus dem Brausen der Sonne?
Ihr müsstet nochmals warten, ob ein zweiter Reiter, gleich mächtig wie der andere, gewillt sei, den Weg zu gehen.
Jules Supervielle (1884-1960)
Und nur für Kazuyuki
PROLOG
Ich saß da, in eine Decke eingehüllt, und fror. Ich war schläfrig. Die Zeitverschiebung. Mein Körper war schon zurück, mein Geist noch in Tagträumen gefangen. Was hatte ich erlebt? Die verblassenden Szenen, die noch vor wenigen Augenblicken in der Erinnerung an mir vorbeigezogen waren, lösten sich auf und formten sich neu, denn jenseits von Ahnen und Begreifen wird die Welt unablässig wiedergeboren. Nichts kann diese Vorwärtsbewegung aufhalten, die vergessene Ereignisse gegenwärtig macht. Das einst Erlebte, aus welcher Ferne es auch kommen mag, kann wieder klar gesehen werden. Der alte Mönch kannte das Geheimnis und hielt nach der Vergangenheit Ausschau. Er sah die Dinge kristallklar und unglaublich leuchtend, weil sie in seiner Erinnerung nie verblasst waren. »Das kannst du auch«, hatte er mir mit großem Nachdruck eingeschärft. Es sei keine durch Anstrengung erworbene Kraft. Was für ihn selbst gut sei, genüge auch für mich. Ich hatte ihm zuerst nicht geglaubt, wieso auch? Jetzt aber ging ich mit weichen Knien meine Handtasche holen und zog das Bild, das Lhamo mir in Lhasa gegeben hatte, aus dem Umschlag. Mein Großvater hatte das Haus mit einer Rolleiflex fotografiert. Ich wusste, dass er eine eigene Dunkelkammer hatte und die Filme selbst entwickelte. Alte Bilder ziehen sich in sich selbst zurück, wie alte Menschen es tun; alte Bilder sterben. Der Mönch, dessen Namen ich nie erfahren hatte, brauchte kein Bild, um Buddha zu sehen. Er erträumte sich, was er brauchte, rief im Geist die Erinnerungen wach. Es war ein Akt der Wiederbelebung.
Was hatte Lhamo gesagt? Dass sie das Bild seit vielen Jahren nicht mehr angesehen hatte. Seltsam. Woher kamen dann die Fingerabdrücke? Warum fühlten sich Lhamos Hände damals so schwer an, so schwer wie Stein? Sie hatte nur das Bild zu geben gehabt und hatte es mir gegeben. Für alles, was ich ihr hätte geben können, sah sie keine Verwendung mehr. Ich legte das Foto vor mich auf den Tisch und betrachtete das Haus. Ich betrachtete es lange, eindringlich, prägte mir jede Einzelheit ein. Ich fühlte dabei eine Art Vakuum in mir, eine Übelkeit. Einst war das Haus groß und prächtig und voller Leben gewesen. Auch jetzt war es noch nicht tot. Das Haus schwebte in einem Anderswo, das ganz nahe war. Einem Anderswo, das vibrierte. Ich konzentrierte meine Vorstellungskraft. Viele Leute wären gewiss fähig, ein solches Haus zum Leben zu erwecken, vorausgesetzt, sie wüssten, dass sie es könnten. Weil es bei einer Wiederbelebung nicht um mehr oder weniger Kraft ging, nicht um Willensstärke. Der Mönch wusste genau, worum es ging. Um etwas ganz anderes, nämlich um das, was die Menschen Glauben nennen. Einen Bewusstseinszustand, der frei von Gedanken oder Gemütsbewegungen irgendwelcher Art ist. Das Bild zeigte nur ein kleines Teilchen der Vergangenheit, aber wo so ein Bild ist, rührt sein Anblick an Tiefen, die wir nur mit den Tiefen vergleichen können, wie sie ein Symphonieorchester in uns öffnet, wenn wir die Musik kennen, verstehen und lieben. Beharrlich arbeitete ich mich in die Sache hinein, starrte auf das Bild. Ich konnte hören, wie ich atmete, schnell und kurz. Warum hatte ich Schmerzen im Rückgrat? Warum saß ich schon so lange unbeweglich da mit dem Bedürfnis, mich zu kratzen und auf die Toilette zu gehen? Man kann ein Bild anschauen, man kann es nicht bewohnen. Man kann nur verrückt dabei werden, das wird es wohl sein. Oder auch nicht?
Und mit einem Mal fuhr ich auf, mit einem seltsamen Zucken im Nacken, als ob eine Schnur riss. Klack! Mir war, als ob das Foto in meinen Händen zurückschnellte, als ob das Haus sich - leicht schwankend - aufrichtete und vergrößerte. Die Wände strebten seitwärts empor, gewannen an Form, festigten sich. Tatsächlich kam es auf die Beharrlichkeit an, alles Erträumte war nur eine Sache der Geduld. Noch eine kleine Anstrengung - sie war nicht der Rede wert! Ich fühlte einen Schauder voraus, der kein Schauder der Angst war. Das Abgelebte würde aufleben und wieder ablaufen, wie es gewesen war. Dass alles der Wahrheit entsprechen würde, stand außer Zweifel. Weil der Schein nicht weniger als das Wirkliche war, sondern mehr. Weil ich die Erinnerung im Blut trug und auch die Gerüche nach Staub, Holzkohle und schwitzenden Pferden und ebenfalls das Gelächter, die Satzfetzen, das Klappern von Pferdegeschirr. Ich hörte auch Musik, oder nicht? Doch, sie kam aus einem der Erkerfenster. Und wenn ich meine Augen auf die Toten richtete, die Toten, die noch kommen würden, sah ich sie jetzt gesund und lachend und lebendig wieder vor mir. Ich beobachtete sie in einem Zustand von großer Neugier und Erregung, denn einst hatte ich sie im Dämmer der Träume erblickt, und sie alle waren mir vertraut. Ein paar Schritte über den Fußweg, an den Stallungen vorbei, an den Kürbissen, die vor der Vorratskammer glühten, dem Haus entgegen. Und jetzt drei Steinstufen noch. Die Tür von dunkler Kastanienfarbe, mit Haken und Riegel versehen, ragte vor mir auf und schien geschlossen. Da hörte ich ganz deutlich ein Knarren, und die Tür schwang auf.
ERSTES KAPITEL
Ich entsinne mich genau, wann die Zeit sich für mich rückwärts zu bewegen begann. Den Augenblick habe ich noch exakt in Erinnerung. Es war ja nicht so, dass vorher nichts geschehen wäre. Aber ich führte ein geordnetes Leben. Ich erinnere mich, dass meine Nase seit zwei Tagen lief und ich ohne Taschentücher keinen Schritt tun konnte. Viele Leute im Büro waren in dieser Zeit erkältet. Ich hatte einen dumpfen Kopf, konnte nicht arbeiten. Ich ließ mich krankschreiben. Jetzt lag ich im Bett und hatte hohes Fieber. Durch das Fenster sah ich ein Stück blauen Herbsthimmel, in den die dunklen Wipfel zweier Tannen hineinragten. Wir hatten starken Föhn, die Wipfel bogen sich. Erstaunlich, dachte ich, wie geschmeidig doch lebendiges Holz ist! Ich döste vor mich hin, konnte ja sonst nichts tun, sogar das Lesen strengte mich an. Zum Glück war Freitag. Am Dienstag sollte meine Arbeitsgruppe eine Sitzung haben; das neue Projekt, das wir entwickelten, hielt uns in Atem. Seit acht Monaten war ich im »Atelier 5«, einem der berühmtesten Architekturbüros in Zürich, als Bauzeichnerin fest angestellt. Ein harter Job, aber ein großartiger. Es kam vor, dass ich zwölf Stunden lang pausenlos bei der Arbeit saß, denn als jüngste und erst kürzlich eingestellte Mitarbeiterin wurde ich ausgenutzt. Aber ich war stolz, dass ich dazugehörte.
Ich versuchte, in meinem Kopf Leere zu schaffen. War das überhaupt möglich? Mir gelang es jedenfalls nicht, oder nur sehr schlecht. Das Fieber trieb meine Gedanken pausenlos zusammen und wieder auseinander. Der starke Wind, der an den Scheiben rüttelte, rief mir ins Gedächtnis, was meine Mutter kürzlich erzählt hatte: Sie hatte vom Wind in Tibet gesprochen, von diesem weißen, kolossalen Wind, der über die Berge rollte und Eisstürme brachte. Solche Stürme konnten Bäume in Stücke reißen, Menschen erschlagen oder in Eisblöcke verwandeln. Die Eisstücke fallen wie Backsteine vom Himmel, sagte Mutter. Es kommt vor, dass der Mensch dort erstarrt, wo er liegt oder steht. Er überzieht sich mit einer Haut aus Eis und erfriert. Er bleibt bei Bewusstsein, aber nie länger als vierzig Sekunden. So lange braucht es, bis das Gehirn seine Tätigkeit einstellt.
»Ich habe das gesehen«, sagte Mutter. »Und ich glaube nicht, dass man Schmerzen dabei spürt. Schmerzen verspürt man nur, solange das Blut warm ist. - Was meinst du dazu, Kelsang?«, hatte sie ihren Bruder gefragt, denn sie hatte davon gesprochen, als er - was nicht oft vorkam - bei ihr zu Besuch war. Und bei diesen Worten hatte sie ihren Blick starr auf Kelsang gerichtet, während er, als ob er auf diese Bewegung gefasst gewesen wäre und sie schon befürchtet hätte, die Augen abwandte. Ich glaubte, ein Gefühl von Ohnmacht, von Kummer und eine Bitte auf seinem Gesicht zu erkennen. Er hatte nichts gesagt, nur mit langsamer Bewegung seine Robe über die dürre Schulter gezogen. Und ich hatte plötzlich gedacht, dass er dieses Gesicht haben würde, wenn er tot wäre. Ja, genau das gleiche Gesicht. Aber Mutter hatte nichts mehr hinzugefügt, und dann wurde über etwas anderes gesprochen.
Eigentlich gingen sie sehr vorsichtig miteinander um, freundlich, kaum ein Wort lauter als das andere. Aber da war etwas Hartes, etwas wie ein Groll zwischen ihnen. Ich hatte es schon oft beobachtet. Es war etwas, das von früher kam.
Onkel Kelsang war bereits Novize gewesen, als er nach Indien flüchtete. Bevor er Anfang der Neunzigerjahre in die Schweiz kam, war er im Jonan-Kloster in Nordindien in buddhistischer Erkenntnislehre ausgebildet worden. Jetzt lebte er im Klösterlichen Institut in Rikon, in einer vertieften mehrjährigen Meditation. Wir bekamen ihn selten zu Gesicht. Im Grunde war es nicht nett von Mutter, dass sie ihn auf diese Weise provozierte.
Aber Mutter war nicht immer nett, auch wenn sie viel lachen konnte, laut und unbändig wie ein ganz junges Mädchen. Sie hatte einen unglaublich derben, fremdartigen Humor. Man merkte daran, dass man sich vor ihr in Acht nehmen musste. Dass sie überaus anmaßend war, flößte mir eigentlich Respekt ein. Sie konnte aber auch gemein werden und mit Worten zuschlagen wie mit einer Pranke.
Einmal hatte sie von Kelsang gesagt: »Der ist es nicht wert, dass man seinetwegen leidet.«
Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, warum sie das sagte. Aber es hörte sich schrecklich an.
Gelegentlich kam mir der Gedanke, dass sie gar nicht hierher gehörte. Ihre Anwesenheit war irgendwie unpassend, befremdend. Sie gehörte zu einer anderen Welt. Diese Frau, die meine Mutter war, schaffte es immer wieder, mich aus dem Konzept zu bringen. Mein Leben lang würde ich mich gegen ihre Überheblichkeit wehren, obwohl sie viele Freunde hatte, die ihr über viele Jahre hinweg treu blieben. Alle liebten ihre Tatkraft, ihre lebhafte, geschmeidige Intelligenz, ihre wortgewandte Klugheit. Sie hatte mich pflichtbewusst erzogen, hatte mir alles gesagt, was ich wissen musste, und mir alles erlaubt, was sie finanziell vermochte. Keine übertrieben modischen Klamotten, aber gute, aus dem Ausverkauf. Ferien, die wenig kosteten: Skilager, Jugendherbergen, Klassenreisen nach Paris oder Barcelona. Mutter hätte gewollt, dass ich reiten lernte. Als Kind in Lhasa hatte sie ihr eigenes Pferd gehabt. Ihre Eltern waren sehr wohlhabend gewesen. Aber sie konnte den Unterricht nicht bezahlen. Stattdessen bekam ich jeden Sommer eine Dauerkarte fürs Schwimmbad. Kein Luxus also. Dafür aber die höhere Schule, das Architekturstudium. Wir hatten nur wenige Grundsatzdiskussionen geführt, aber sie hatte Selbstbewusstsein, Fantasie und Vernunft in mir geweckt. Tsering, mein Vater, hatte sich kaum eingemischt - eigentlich nur, wenn es darum ging, wie pünktlich ich zu sein hatte. Da war er strenger als sie, weil er schnell in Sorge geriet. Er war ein stiller Mensch, und es ging ihm nicht gut, schon lange nicht. Er hatte sich in Indien eine böse Geschwulst geholt und hielt es nicht für nötig, den Arzt aufzusuchen. Die Folge davon: Der Zustand verschlimmerte sich, der Tumor breitete sich aus, ergriff den ganzen Körper. Er ließ sich erst untersuchen, als die Schmerzen unerträglich wurden, und da war es bereits zu spät. Mit zunehmendem Alter setzte er der Krankheit immer weniger Widerstand entgegen. Er war ein manischer Kettenraucher, er konnte es sich nicht abgewöhnen. Bis zum Schluss rauchte er. Er sagte, ich bin eben so, ich kann mich nicht ändern - wozu auch? Ich hatte gerade die höhere Schule beendet, als sein Herz versagte. So verschieden wir drei auch waren, wir hatten einander geliebt. Ich war erschüttert, aber immerhin traf mich sein Ende nicht unvorbereitet. Mutter und ich trugen den Gedanken schon lange mit uns herum, dass er eines Tages nicht mehr da sein würde.
Mutter - ihr Name war Sonam - hatte eine schwere Geburt mit mir gehabt. Etwas war bei ihr nicht in Ordnung gewesen. Die Ärztin entschloss sich noch rechtzeitig zu einem Kaiserschnitt, sonst wäre ich wohl behindert auf die Welt gekommen. Danach zog sie es vor, Sonams Eileiter zu unterbrechen. Die Patientin war ja auch schon beinahe vierzig. Somit blieb ich Einzelkind, was in tibetischen Familien eher unüblich ist.
Dachte ich über mein Leben nach, was ich eigentlich selten tat, kam ich immer wieder zu dem Ergebnis, dass es ein geordnetes Leben war. Alles war auf Ordnung ausgerichtet; von klein auf deutete sich dies bereits in meinen Begabungen an. Schon als Kind hatte ich eine besondere Vorliebe für die Anordnung von Gegenständen in Räumen. Dafür konnte ich mich ebenso begeistern wie für die Logik der Zahlen. Ich spielte mit Zahlen Pingpong, und ich gruppierte nach Herzenslust Linien, Flächen und geometrische Körper. Dass ich aufs Gymnasium ging und später zur Uni, hatte ich auch meiner Mutter zu verdanken, die als Kassiererin im Supermarkt Überstunden machte, damit ich lernen konnte. Dazu kam natürlich, dass ich nicht leicht auf mein Ziel, zu studieren, verzichtet hätte. Ich besaß einen starken Willen.
Sie rief an: »Brauchst du etwas?«, und kam gegen Abend. Ich döste im Halbschlaf, als sie draußen zweimal schellte. Ich strich mein wirres Haar aus der Stirn und setzte meine Füße auf den tibetischen Teppich mit dem schönen blauen Muster. Als ich mich aufrichtete, musste ich mich am Nachttisch festhalten. Ich wankte zur Tür, zog den Riegel auf. Meine Mutter trat ein, schnell, geschäftig, geräuschlos.
»Kind, wie siehst du aus? Dich hat es ja böse erwischt!«
Sie hatte für mich eingekauft und sagte, dass sie für mich kochen würde. Ich wollte ihr die Taschen abnehmen, aber sie stieß mich weg.
»Verschwinde! Leg dich hin. Ich mache das schon.«
Ich hörte sie in der Küche hantieren. Sie war in großartiger Weise gütig und hilfsbereit. Dass sie immer noch sehr anziehend war, entdeckte ich ganz plötzlich an diesem Abend. Ich hatte sie schon längere Zeit nicht mehr gesehen; deswegen fiel es mir auf, als sie mir heißen Tee brachte und mit dem Fuß auf den Schalter der Stehlampe trat. Das Licht fiel auf ihr dunkles Oval, auf die gewölbte Stirn, das eigenwillige Kinn. Die Augen waren mandelförmig und goldbraun, und der hohe Bogen der Wangenknochen gab ihnen außen eine leichte Schrägneigung nach oben. Nur die blauen Ringe unter diesen Augen verrieten den Herbst ihres Lebens. Sie hielt sich übertrieben gerade, immer, auch beim Sitzen. Sie war stark, mied jedoch gewisse Bewegungen, die ihr Schmerzen bereiteten. Unter Rheuma, sagte sie, habe sie schon als Heranwachsende gelitten. Eine Folge der Entbehrungen damals.
Sie hatte in Tibet harte Zeiten erlebt. Zeiten, von denen sie selten sprach. Im Großen und Ganzen kannte ich die Geschichte. Aber sobald ich - was gelegentlich vorkam - mehr erfahren wollte, verschanzte sie sich hinter einer Mauer aus Schweigen.
»Was gibt es da noch zu erzählen?«
»Du redest so wenig über diese Dinge! Macht dir das so viel Mühe?«
»Es ist schon lange her. Ich habe vieles vergessen.«
Vergessen? Das glaubte ich nicht. Verdrängt wäre wohl das bessere Wort gewesen. Aber ich wollte mich mit ihr nicht anlegen. Sie hatte den stärkeren Dickschädel.
Sie hatte oft von den schwierigen Zeiten ihrer Kindheit gesprochen, von den schrecklichen Ereignissen damals. Mir kam in den Sinn, dass es stets nur nackte Ereignisse waren, über die sie berichtet hatte, bloße Tatsachen und allgemeine Gefahren, anderswo, in einem anderen Zeitalter, unter einem anderen Himmel. Elf war sie gewesen, als die Soldaten sie geholt hatten. Sie hatte uns alles ausführlich erzählt.
Wirklich alles? Die Tatsache, dass sie nie wieder darüber sprach, war vielleicht der Kern der Geschichte. Das Fieber bewirkte, dass ich gewisse Bilder meiner Vorstellung schemenhaft und dann wieder überdeutlich sah. Die Bilder, die aus dem Nebel heraustraten, gefielen mir gar nicht. Ich mochte keine Schatten, die vor mir auftauchten, Schatten, die das Fieber verdichtete. Ich setzte mich auf.
»Wie bringst du es fertig«, murmelte ich, »dass du immer noch so gut aussiehst?«
Sie stellte das Tablett auf den Nachttisch, wobei sie kurz auflachte. Ihr Lachen hatte einen rauen Klang, etwas Jugendliches, als wäre sie schüchtern und bemühte sich, das zu verbergen.
»Und meine Falten?«
»Ich sehe keine.«
»Weil du kurzsichtig bist. Ich, ich sehe meine Falten.«
Sie reichte mir die Tasse. Ich nahm einen Schluck von dem heißen, starken Getränk.
»Er ist gut, dein Tee!«
»Ich habe viel Honig hineingetan. Und Zitrone. Das hilft bei Fieber.«
Ich drückte die warme Tasse an meine Wange und beobachtete meine Mutter. Mir fiel auf, dass sie das nicht gern hatte, denn sie wandte die Augen ab. Vierzehn Jahre war es jetzt her, dass mein Vater gestorben war. Ich fragte: »Warum hast du eigentlich nie wieder geheiratet?«
Sie stutzte, bevor sie den Mund zu einer kleinen Grimasse verzog. »Dumme Frage! Wie kommst du darauf?«
»Na ja, es hätte ja sein können.«
Sie wies mich zurecht.
»Es konnte nicht sein, und jetzt hör davon auf.«
Seit Vaters Tod hatte sie nie eine Affäre gehabt. Ich fand das seltsam. Aber diese Art von Treue musste ihr wohl eigen sein. Ich schämte mich plötzlich, dass ich gefragt hatte.
»Es tut mir leid«, sagte ich.
Sie nickte.
»Trink deinen Tee, bevor er kalt wird.«
Sie wollte nicht lange bleiben, sie hatte noch eine Sitzung im Frauenverein. Aber sie nahm sich noch die Zeit, um für zwei Tage zu kochen: Suppe, Fleischbällchen und Kartoffeln. Bevor sie ging, stopfte sie die schmutzige Wäsche in die Waschmaschine und ermahnte mich, den Trockner nicht zu vergessen. Sie zog ihren Mantel an und wickelte ihren braunen Pashmina um die Schultern. Sie trug meistens tibetische Tracht, die ihr sehr gut stand.
»Ich rufe dich morgen an. Bleib schön im Bett, und iss die Trauben. Die geben dir Vitamine.«
Ich öffnete die Augen und sah, wie sie die Weintrauben auf den Nachttisch stellte. Sie hatte das Obst sogar gewaschen.
»Ja, Amla - Mutter. Und … danke für alles!«
»Nichts zu danken«, erwiderte sie spröde.
Ich fühlte mich müde, entsetzlich müde. Ich hörte kaum, wie sie in ihre Schuhe schlüpfte, ihre Einkaufstasche nahm und leise die Tür schloss. Ich war bereits wieder eingeschlafen.
Als ich spätabends erwachte, war das Fieber gestiegen. Ich fühlte mich scheußlich.
ZWEITES KAPITEL
Am Morgen ging es mir kaum besser. Ich schleppte mich ins Badezimmer, blickte mich trübselig im Spiegel an und wechselte den Schlafanzug. Ich zog die Wäsche aus dem Trockner, trank etwas Tee, aß einige Trauben. Das Essen stellte ich in den Kühlschrank. Dann kroch ich schlotternd wieder ins Bett und döste. Im Halbschlaf hörte ich, wie mein Handy klingelte. Halb benommen tastete ich nach dem Apparat.
»Ja?«
»Sasha hat mir erzählt, dass du krank bist«, sagte Felix. »Ich hoffe, nichts Schlimmes.«
Sasha arbeitete mit mir im Architekturbüro. Zu der Zeit tüftelten wir beide am selben Bauplan. Er war mit Felix zur Schule gegangen, die Eltern waren Nachbarn. Es war Zufall, dass sich beide getroffen hatten, aber ich war froh, dass Felix anrief.
»Nur Grippe.«
»Deine Stimme klingt nicht gerade gut«, meinte Felix. »Hast du Fieber?«
»Ich habe gerade gemessen. Fast 39 Grad.«
»Um diese Zeit? Das gefällt mir nicht.«
»Ich bleibe im Bett.«
»Ja, du tust gut daran. In einer halben Stunde bin ich bei dir. Ich komme mit der Straßenbahn.«
Felix und ich hatten einige Monate lang zusammengelebt; zwischen uns war sogar die Rede von Heiraten gewesen. Aber daraus wurde nichts. Wir stellten fest, dass wir nicht füreinander bestimmt waren. Felix war ein freundlicher Mensch, vielleicht etwas schüchtern. Ich liebte ihn von ganzem Herzen, aber ich wusste auch, dass ich nicht das Gleiche empfand wie er, dass stärker als mein schlechtes Gewissen die Abneigung dagegen war, mit ihm zu schlafen.
Es klingelte. Ich schlüpfte in meinen Bademantel und wankte zur Tür. Felix stand da, zeigte sein bezauberndes Lächeln, hielt mir eine kleine Tüte mit Trockenobst entgegen. Ananas, die ich am liebsten mochte.
»Keine Schokolade«, sagte er. »Bei Fieber besser nicht.«
Ich sah ihn an: das dichte, dunkelblonde Haar, die tiefblauen Augen. Das Gesicht schmal und klar, um den Mund zwei Falten. Er hatte früher im Krankenhaus gearbeitet; jetzt war er Arzt mit eigener Praxis, verdiente mehr Geld, aber schuftete bis zur Erschöpfung.
Felix zog seinen Parka aus, folgte mir ins Schlafzimmer. Ich zeigte ihm das Fieberthermometer. Er schnalzte mit der Zunge, bevor er sich zu mir auf den Bettrand setzte. Er horchte auf meinen Puls, befühlte meine Halsdrüsen, ließ mich Aaaaah! sagen wie ein Kind. Schließlich nickte er.
»Akut, aber nicht dramatisch. Bettwärme ist das Beste. Und viel trinken.«
Er ging in die Küche und brachte mir ein Glas Wasser mit einer Tablette, die das Fieber senken sollte.
»Dreimal am Tag unzerkaut schlucken. Hier, die Tabletten sind für dich.«
Ich lächelte ihn etwas verzerrt an.
»Ein Hausarzt ist einfach großartig.«
»Für gewöhnlich stelle ich solche Besuche in Rechnung. Und du musst gut essen, ja? Du hast ja nichts zuzusetzen.«
»Amla war hier und hat für zwei Tage gekocht.«
Er nickte.
»Ausgezeichnet.«
Und dann, nach kurzer Stille: »Wie geht es ihr?«
»Gut«, sagte ich. »Ihr geht es gut.«
Wieder Stille. Felix stand auf, schob die Hände in die Hosentaschen und ging zum Fenster. Unsere Geschichte hatte sich in einer anderen Wohnung abgespielt, die größer war, ein altes Haus in Zürich-Stadelhofen, in das wir vielleicht auch eines Tages gezogen wären. Jetzt lebte ich allein in zwei Zimmern.
Ich betrachtete seinen Rücken, der mir so vertraut war. Er war noch immer ein attraktiver Mann. Warum nur hatte ich plötzlich kein Verlangen mehr nach ihm gehabt? Das war einfach so gekommen und hatte zu den Dingen gehört, die ich nie wirklich bis auf den Grund verstehen konnte. Wir hatten zusammengelebt, aber vielleicht waren wir einander zu wenig ähnlich geworden, für ein Zweierdasein ungeeignet. Ich hatte getan, was ich tun zu müssen glaubte, auf anständige Weise. Es bestand kein Anlass, beleidigt zu sein.
Felix stand immer noch in Gedanken versunken. Dann reckte er sich, dehnte die Arme und brach schließlich das Schweigen.
»Deine Mutter hat mich nie akzeptiert«, sagte er.
»Aber das ist doch lächerlich!«
Er drehte sich zu mir um. Seine Augen zogen sich leicht zusammen. Ich kannte diesen Blick. Abwechselnd vermied er, mich anzusehen, und betrachtete mich dann wieder mit intensivem Blick.
»Ich habe darüber nachgedacht«, sagte er. »Du lebst in Symbiose mit deiner Familie. Ein Clan-Denken, das ist es und nichts anderes. Du hast es wahrscheinlich selbst nicht gemerkt.«
»Ich lebe doch allein!«, rief ich.
»Gewiss. Aber die Familie ist immer da, im Hintergrund.«
Was sollte das heißen? Dass ich unfähig war, aus der Reihe zu tanzen? Das war doch dumm, das hieße, nicht mehr zu denken, oder vielmehr so zu denken, dass es aufs Nichtdenken hinauskam.
»Hör mal«, widersprach ich wütend. »Wie kommst du darauf? Ich bin ohne Geschwister groß geworden, und mein Vater ist tot. Der Bruder meiner Mutter lebt in Rikon als Mönch. Sie hat noch eine ältere Schwester in Lhasa, zu der wir überhaupt keinen Kontakt haben. Ein paar ferne Verwandte sind auch noch da, die wir höchstens zweimal im Jahr sehen. Und wenn du mich fragst, wie die heißen, muss ich zuerst nachdenken.«
»Ich rede von einem Clan-Denken im geistigen Sinne«, beharrte er auf seinem Standpunkt. »Vielleicht kannst du das nicht verstehen, aber das steckt in dir und hat mit deiner tibetischen Herkunft zu tun.«
Und ich erinnerte mich. Da war eine Sache, die ich verdrängt hatte, tief unten im Dunklen verborgen, im Hintergrund meines Denkens. Jetzt kam sie wieder ans Tageslicht, jetzt musste ich sie in einem Vergrößerungsspiegel betrachten. Diese Erinnerung war immer bei mir gewesen, unausgesprochen. Sie ließ sich nicht überspielen oder beschönigen und hatte mit meiner Mutter zu tun. Es war nur ein kurzer Satz gewesen, den sie über Felix gesagt hatte, aber ihr Gesicht war seltsam dabei erstarrt; und danach hatte ich es niemals geschafft, nicht mehr daran zu denken.
»Er ist nett, aber ich werde nicht oft kommen, wenn er da ist. Ich mag seinen Geruch nicht.«
Im Nachhinein schien mir, dass ich ihre Bemerkung kaum beachtet hatte. Aber irgendwie mussten die Worte in mir gewirkt haben. Ich war Felix bitterböse, weil er recht haben konnte. Tibeter, die wie ich im Exil geboren sind, sind nicht innerlich gespalten und ein bisschen taumelig wie so viele Entwurzelte. Für diese mag es eine Welt von Werten, von falschen Werten, von Unwertem geben. Wir aber leben in einer Welt, die zu uns gehört, die wir ohne Zwänge und Romantik verstehen. Trotzdem sind wir gläubige Buddhisten, gießen jeden Morgen frisches Wasser in die sieben kleinen Schalen auf dem Hausaltar, zünden die sieben Lichter vor der Buddhastatue an. Sind es elektrische Lichter, hat das überhaupt nichts zu bedeuten. Wir legen die Hände zusammen, sprechen das kurze Gebet, mit dem jeder Tag beginnt. Und das ist alles. Wir leben im Hier und Jetzt, ohne religiöse Neurosen. Was Felix gesagt hatte, schockierte mich. Clan-Denken, was war das überhaupt? Ich war mit meiner Familie durch den Klang und die Wärme der Kindheit, durch unaussprechliche sinnliche Erinnerungen verbunden. Und das andere? Ich spürte auf einmal ein schlechtes Gewissen. Meine Mutter hatte stets an meinem Leben teilgenommen. Sie gehörte dazu. Hatte ich ihr meine Eigenständigkeit geopfert? Das Zusammenwirken von Spontaneität und Vernunft, das bisher mein Stolz und meine Stärke war, wurde erschüttert. Ich sträubte mich zornig und schuldbewusst und sagte zu Felix: »Ich kann dir nicht glauben!«
Er nahm es gleichmütig hin.
»Du solltest es aber glauben.«
Es hatte also an Sonam gelegen. Sonam, die für gewöhnlich nicht redselig war. Die vom Schweigen lebte und mich immer reichlich damit bedacht hatte. Mit diesen paar Worten hatte sie mich von Felix getrennt. Ich hatte danach keine Lust mehr gehabt, mit ihm zu schlafen. Weil ich Mutter mehr vertraut hatte als der eigenen Liebe.
»Scheiße!«, murmelte ich.
Er seufzte.
»Es tut mir leid, Dolkar.«
Mir wurde auf einmal der Abstand bewusst, der uns trennte. Der Schatten meiner Mutter stand zwischen uns. Ich sagte mit matter Stimme: »Möglicherweise liegt der Fehler bei mir. Ich bin Einzelkind. Das ist bequem, aber bisweilen auch unpraktisch.«
Er lehnte sich leicht zurück.
»Erzähl mir von deiner Mutter.«
»Wozu? Du kennst sie doch.«
»Ist es dir unangenehm, von ihr zu sprechen?«
»Nein, durchaus nicht. Aber ich möchte wissen, warum ich dir von ihr erzählen soll.«
»Dolkar, erinnerst du dich, wie wir uns begegnet sind?«, fragte er, und ich war betroffen von seinem stählernen Blick.
Das war, als die Amla unter starkem Husten litt, der nicht besser wurde. Sie meinte zwar, sie sei zäh und bei ihr heile alles von selbst, doch ich machte mir Sorgen. Schließlich vereinbarte ich für sie einen Termin beim Arzt. Dieser war gerade nicht da: ein Notfall. Ein Assistenzarzt empfing uns. Sein freundliches Gesicht strahlte ein bezauberndes Lächeln aus. Sympathisch, dachte ich. Er untersuchte meine Mutter. Ich war nicht dabei; sie hatte darauf bestanden, dass ich draußen wartete. Es stellte sich heraus, dass sie eine Bronchitis hatte. Der Assistenzarzt verschrieb ihr Medikamente, die ihr guttaten. Ein paar Tage später rief er an und fragte, wie es ihr ging. Danach gab er offen zu, dass er mich gern wiedersehen würde, und lud mich zum Essen ein. So fing es an. Ich verfolgte die Gedanken, die sich so lebendig in mir regten, und nickte.
»Ich habe alles noch gut im Kopf.«
Er ging vom Fenster weg, setzte sich wieder zu mir auf die Bettkante. Wir saßen ganz nahe beieinander, ohne uns zu berühren. Er sprach ein bisschen müde und so sanftmütig, dass ich verlegen wurde.
»Dolkar, ich breche hier ein Berufsgeheimnis. Aber schließlich handelt es sich um unser Privatleben. Sag, hast du deine Mutter schon einmal nackt gesehen?«
Ich fuhr zusammen.
»Ich … ich verstehe dich nicht. Was hat das damit zu tun?«
»Antworte mir einfach: ja oder nein?«
Ich hörte ihn die Frage stellen und war fassungslos. Und musste betroffen zugeben, dass - nein - ich meine Mutter nie unbekleidet gesehen hatte. Selbst im Sommer, bei heißem Wetter, trug sie die tibetische Tracht, leichte Stoffe, die sie bis zum Hals verhüllten. Bei der Hausarbeit hatte sie Jeans an, dazu eine langärmlige Bluse oder einen Pullover. Sie hatte sich auch nie einen Badeanzug gekauft. Sie sagte, dass sie nicht schwimmen könne und zu alt sei, um es zu lernen.
Sogar ihr Nachthemd war lang und hochgeschlossen. Und wenn sie duschte oder badete, schloss sie sich ein. So war es immer gewesen. Wie sonderbar, dass es mir nie aufgefallen war!
Die Adern an meinen Schläfen begannen zu pochen.
»Nein«, sagte ich, »eigentlich nie. Ist etwas Besonderes mit ihr?«
Er antwortete langsam und bitter: »Sie hat Narben auf dem Rücken. Narben, wie ich sie noch nie gesehen habe. Als ob jemand versucht hätte, Hackfleisch aus ihrem Rücken zu machen. Sei mir nicht böse«, setzte er schnell hinzu, als er mein Gesicht sah. »Ich will dir nur die Sache beschreiben.«
Es war wie ein Blitzlicht. Es leuchtete mir und blendete mich im gleichen Augenblick. Durch die Funken sah ich die Wahrheit, eine schreckliche Wahrheit. Ich stammelte: »Ist sie gefoltert worden?«
»Es sieht ganz danach aus. Aber sie muss noch sehr jung gewesen sein, die Narben sind gut verheilt. Natürlich verfügt sie nicht über ihre volle Bewegungsfreiheit.«
»Sie sagte, sie hätte Rheumaschmerzen …«
Er machte eine vage Bewegung.
»Das mag hinzukommen. Ich persönlich wundere mich …«
Er schluckte und biss sich auf die Lippen. Ich sah ihn aufgewühlt an.
Er sagte: »Um ganz ehrlich zu sein, wundere ich mich, dass sie überhaupt noch am Leben ist.«
Ein Frösteln überlief mich.
»Warum hast du das so lange mit dir herumgetragen?«
»Ich dachte, du wüsstest Bescheid und wolltest nicht darüber sprechen …«
Ich fasste mich an die schmerzende Stirn.
»Sie hat mir nie etwas davon gesagt.«
»Ich kann mir das nicht vorstellen. Du bist ihre Tochter.«
Ich war verwirrt, abwesend und erschöpft. Felix schien sich seiner Sache so sicher. Er hatte der Kraft, die ich zu besitzen glaubte, einen schweren Schlag versetzt. Meine Ruhe, meine Heiterkeit waren dahin. Alle Appelle an die Vernunft konnten daran nichts ändern. Ich sagte mit matter Stimme: »Ich nehme an, dass sie mich schonen wollte.«
»Vielleicht wollte sie sich selber schonen?«
Die Angst hatte mich gepackt. Eine von der Sorte, die zu weit geht, wenn man Fieber hat. Ich fühlte mich hilflos.
»Ich weiß es nicht. Sie lebt in ihrer eigenen Welt.«
»Und lässt dich draußen stehen. Findest du das gut und richtig? Ich für meinen Teil glaube, dass es besser ist, wenn man die Wahrheit weiß.«
Meine Verwirrung musste deutlich zu erkennen sein. Ich nickte stumm. Und dann sagte ich mit leiser Stimme: »Vielleicht verübelte sie dir, dass du ihr Geheimnis kanntest. Es war ja nur ein Arztbesuch, damals. Wie hätte sie ahnen können, dass du und ich … uns wiedersehen würden?«
Er antwortete nachdenklich: »Ja, das wird wohl der Grund dafür sein, dass sie mich nicht in der Familie haben wollte. Wahrscheinlich gab es noch andere Gründe. Aber das war der erste und wichtigste wahre Grund. Sie hatte Angst vor mir.«
Ein langes Schweigen folgte, bevor er auf die Uhr sah, mit der Bemerkung, dass er jetzt gehen müsse. Er würde anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir ging. Ich brachte ihn zur Tür, taumelte zurück ins Schlafzimmer, warf mich aufs Bett, kuschelte mich in das Kissen. Es war, als berste meine Stirn. In meinem Kopf kreisten die Gedanken. Ich hatte stets geahnt, dass da etwas war, tief auf dem Grund, etwas, das ich nicht begreifen konnte. Es war ein schlimmes Geheimnis, ein Hort der Unsicherheit. Sonams Schweigen war so, als diente es dazu, noch andere Geheimnisse vor mir zu verbergen. Ich musste mich damit abfinden, dass plötzlich Gespenster vor mir auftauchten. Vor mir, hinter meinem Rücken, durch die Glasscheibe, durch den Türspalt, durch das Schlüsselloch. Und ich zitterte im Bett vor Fieber, Angst und Übelkeit. Ich tauchte zurück in den Nebel, versuchte zu vergessen, was ich niemals vergessen würde. Ich schlief ein und träumte von meiner Mutter. Ihr Gesicht war ein anderes, ein wildes und märchenhaftes. Die Augen leuchteten wie die Augen einer Katze, die Haare waren zerrauft, die Lippen rot. Ihre Arme waren in Schnüren gefesselt, sie hatte schwarze Farbe auf der Haut, und ihr Hals steckte in einer Schlinge. Oder trug sie eine Kette, die so gelb leuchtete wie ihre Augen? Im Traum betrachtete ich sie voller Mitleid und Ekel. Und während ich sie betrachtete, verzerrte sich ihr Gesicht. Ihre Schultern und ihre nackten Brüste waren braun, hager und von pulsierenden Adern durchzogen. Sie lachte keuchend und wild, spie vor mir aus, und ein Faden Blut floss ihr aus dem Mund.
DRITTES KAPITEL
Die Medikamente enthielten irgendein Beruhigungsmittel. Das Triebwerk meiner Träume ließ sich nicht wieder in Gang setzen. Die unheimlichen Bilder verblassten und kehrten nicht wieder. Ich schlief morgens lange, schlief sogar nachmittags, und zwei Tage später war auch das Fieber gesunken. Als Sonam anrief und fragte, wie es mir ging, sagte ich ganz ruhig: »Doch, mir geht es wieder gut.« Ich sprach zu ihr mit leichter Verdrossenheit, wusste noch nicht, wie ich mit ihr umgehen sollte. Die Gedanken schmerzten. Das Gespräch mit ihr bereitete mir kein Entsetzen mehr, nur Kummer. Mein dumpfer Kopf ertrug mit Mühe die Tatsache, dass es ein Problem gab. Die Leichtigkeit, mit der ich für gewöhnlich die Dinge vereinfachte, war mir nur eine geringe Hilfe. Was ich verspürte, war ein Verlust, und ich hatte keine Ahnung, welchen Weg ich einschlagen sollte.
Am Dienstag war ich wieder in der Firma. Ich brauchte jetzt die Arbeit, sie war mir unentbehrlich, um Ordnung in meine Gefühle zu bringen. Sasha, mit dem ich das Büro teilte, saß bereits an seinem Bildschirm und blickte mich durch seine wie üblich verschmierten Brillengläser an.
»Fühlst du dich besser?«
»Der Husten ist weg, das Fieber auch. Ich bin nur noch etwas wackelig auf den Beinen.«
»Du hättest Felix heiraten sollen«, sagte er in vorwurfsvollem Ton.
Ich wandte die Augen ab.
»Komm, fang nicht wieder davon an!«
Danach sprachen wir nur noch von der Arbeit.
Es war halb acht, als ich das Atelier verließ und mit der Straßenbahn nach Hause fuhr. Ich kaufte mir einen Nudelsalat mit Curry, aß zwei Orangen und ließ mir ein heißes Bad einlaufen. Dann nahm ich die letzte Tablette, die Felix mir gegeben hatte. Ich suchte nichts mehr, womit ich meine Einbildungskraft hätte beschäftigen können, und schlief gleich ein. Am nächsten Morgen rief ich meine Freundin Chimie an.
Wir verabredeten uns in einer Sushi-Bar, in der Nähe des Bellevue-Platzes. Chimie war wie ich in der Schweiz geboren. Sie hatte zwei Jahre in Tokio verbracht und arbeitete für eine japanische Handelsfirma. Ihr Beruf verlangte, dass sie sich klassisch anzog, dunkle Hosenanzüge und schmucklose Blazer, die ihr etwas Strenges gaben. Traf ich sie in der Freizeit, ungeschminkt, in Jeans und T-Shirt, schien sie eine ganz andere Frau zu sein. Sie war vier Jahre älter als ich, hatte aber noch viel von einer Jugendlichen. Ich liebte ihre beiden Gesichter. Das eine war ihr Privatgesicht; das andere trug sie wie ihre Berufskleidung. Und beide gehörten zu ihr. Chimie war viel schöner als ich; ihre Haare fielen wie schwere Seide und waren oberhalb der Brauen, die kräftig gezeichnet und nach außen hochgezogen waren, gerade geschnitten. Ihre Augen waren tief und scharfsinnig, und sie hatte ein lebhaftes Mienenspiel.
Als wir in der Sushi-Bar an der Theke saßen, schaute sie mich an, lächelnd und entspannt. Es war nach der Arbeit. Sie erklärte mir, dass die Japaner sich - nein - nicht täglich von Sushi ernährten. Eigentlich sei Sushi das Gericht, das sich die japanischen Frauen ins Haus bringen ließen, wenn sie nicht kochen wollten. Chimie hatte immerhin zwei Jahre in Tokio gelebt und wäre gern länger dort geblieben. Aber sie hatte noch ihre Eltern in der Schweiz, dazu Geschwister, Cousins, Onkel und Tanten. Die Großfamilie eben, die ich nicht hatte.
»Warte«, sagte sie, »ich suche den Fisch für dich aus. Du kannst hier nicht jede Fischsorte essen. Zürich liegt nicht am Meer, und manche Fische haben schon tote Augen.«
Ich musste lachen. Chimie hatte eine drollige Art, in der sie die Worte zusammenbrachte. Dabei kam sie mir oft viel erfahrener und klüger vor als ich. Das Problem, das mich beschäftigte, war derart komplex, dass ich mit jemandem darüber sprechen musste. Ich konnte ja nicht so tun, als bräuchte ich nur einen Zauberspruch aufzusagen, und die Sache wäre verschwunden. Mir war, als sei ich für immer in Unruhe versetzt worden.
»Du siehst müde aus«, stellte sie fest, als wir unsere Sushi-Schälchen vom Fließband zogen. »Ist etwas nicht in Ordnung?«
»Meine Mutter macht mir Sorgen«, sagte ich.
»Hast du dich mit ihr verkracht?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste nicht, womit ich beginnen sollte. Chimie sah mich von der Seite an, abwartend, aber rücksichtsvoll schweigend. Als ich mit erstickter Stimme sprach, spürte ich wieder dieses unbeschreibliche Entsetzen. Und gleichzeitig tat es mir gut, über die Sache zu reden.
»Und seither bin ich unschlüssig, wie ich mit ihr umgehen soll. Es ist so ungeheuerlich! Und dazu hat sie sich in mein Privatleben eingemischt und ziemlichen Unfug angerichtet. Sie hat Felix praktisch aus der Familie geworfen. Ich konnte gar nichts tun; er war so beleidigt. Und was nun? Ich kann doch nicht weitermachen, als sei nichts geschehen!«
Chimies Blick drückte viel Verständnis aus.
»Nein«, sagte sie, »das wäre nicht ehrlich. Du musst ehrlich sein, Dolkar. Bist du es nicht, spürt es die Amla sofort.«
»Ach«, jammerte ich, »was soll ich denn bloß machen?«
Chimie stellte mit geübtem Griff eine Portion Sushi mit gegrilltem Rotbarsch vor mich.
»Da, probier mal«, sagte sie. »Ich glaube, der ist frisch.«
Ich nahm behutsam die Portion Reis zwischen die Stäbchen. Sie sah zu, wie ich kostete.
»Gut, nicht wahr?«
Ich nickte. Chimie zog ein weiteres Schälchen zu sich.
»Eigentlich lieben es ältere Leute, von der Vergangenheit zu erzählen. Bloß dann nicht, wenn sie zu viel mitgemacht haben. Ich nehme an, sie denken, dass wir sie sowieso nicht verstehen können. Sie meinen das wirklich, obwohl es albern klingt. Auch meine Eltern sprechen selten von ihrer Flucht. Sie hatten alles verloren und kamen wie Bettler in Indien an. Mein Vater sagte oft, dass unser eigenes Leiden gemindert werden kann, indem wir uns die Leiden anderer Menschen vorstellen. Das sind noble Gedanken. Sie passen zu unseren Eltern, zu ihrer Generation. Ich an ihrer Stelle würde zornig und frustriert sein. Das ist nicht sehr buddhistisch, das gebe ich zu. Aber wir sind anders. Hat deine Amla dir von früher erzählt?«
»Aber sicher. Und oft und immer wieder. Wie sie bei der Großmutter auf die Eltern warteten, die in Indien waren und nie zurückkamen. Wie die Rotgardisten sie in ein Lager verschleppten.«
»Wie alt war sie damals?«
»Sonam war elf, ihr Bruder Kelsang ein Jahr jünger. Ihre Schwester Lhamo war schon fünfzehn oder sechzehn; Sonam weiß es nicht mehr genau. Ihre Eltern waren mit einem chinesischen Ehepaar befreundet. Die hatten versprochen, sich um die Kinder zu kümmern. Aber irgendetwas ging schief. Jedenfalls kam ein Lastwagen und brachte die Kinder fort. Sie lebten fünf Jahre im Arbeitslager, mussten Steine für den Straßenbau schleppen. Sie bekamen kaum zu essen, wurden geschlagen und misshandelt. Sonam sagte, dass mit jedem Tag ihre Kräfte ein wenig schwanden, bis der seelische Widerstand einen Ausgleich schuf. Rebellisch, wie sie war, schien sie sich oft in die Nesseln gesetzt zu haben. ›Ich hatte einfach meinen Dickschädel‹, sagt Sonam.«
»Erzählt sie auch Einzelheiten?«
»Sie bekamen kaum zu essen, schliefen in einem zerschlissenen Zelt, wurden geschlagen und misshandelt. Kelsang gelang als Erstem die Flucht. Später schaffte es auch Sonam.«
»Warum ist sie nicht mit ihrem Bruder geflohen?«
»Ich weiß es nicht. Jedenfalls erreichten beide die indische Grenze, und das Rote Kreuz brachte sie wieder zusammen.«
»Und die ältere Schwester?«
»Lhamo? Die blieb im Lager. Ich weiß von der Amla, dass sie dort einen Mann kennengelernt hatte. Einen Chinesen, den sie später heiratete. Mir kommt das seltsam vor. Sie hatte wahrscheinlich nicht gewagt, zu fliehen. Wer ausriss und wieder eingefangen wurde, musste mit furchtbaren Strafen rechnen.«
»Die Vernichtung des Selbst ist etwas, was wir nicht verstehen können«, sagte Chimie leise. »Es waren entsetzliche Zeiten. Und auch heute noch …«
Sie stockte, bevor sie nachdenklich hinzufügte: »Weißt du, ich habe das Gefühl, dass Sonam dir nicht alles gesagt hat.«
Ich trank einen Schluck grünen Tee; ich trank ihn zu schnell und verbrannte mir die Zunge.
»Wenn das stimmt, möchte ich gern wissen, warum.«
»Vielleicht, weil alles zu schrecklich war. Oder auch, weil sie sich schämt. Weil sie befürchtet, dass du dich vor ihr ekeln würdest. Es ist eine Sache der Selbstachtung, einer übertriebenen zwar, aber so ist es nun einmal.«
Ich sagte: »Kelsang deutete an, dass er haarsträubende Sachen erlebt hat. Ich könnte mir denken, dass er sich schuldig fühlt.«
»Schuldig? Aber warum denn?«
»Weil er in Lhasa eine chinesische Schule besuchte, wo sein politisches Weltbild geformt wurde. Es gab eine klare Trennungslinie: auf der einen Seite die Guten - die Kommunisten -, auf der anderen die Bösen - die Ausbeuter des Volkes. Und folglich gehörte Kelsang dazu und musste schleunigst umdenken. Je radikaler solche Gedanken vorgebracht werden, desto stärker prägen sie ein Kind.«
Chimie nickte.
»Junge Menschen empfangen solche Worte mit Begeisterung. Ja, ja, wir wollen zu den Guten gehören! Laute Zustimmung, aber nicht das geringste Verständnis. Und dann richten sie den größten Unfug an und erkennen zu spät, womit sie es zu tun haben. Wurde Kelsang deswegen Mönch?«
»Wegen der Schuldgefühle?«
»Genau das meine ich.«
Fremde, dachte ich. Fremde in der eigenen Familie.
»Ja, das mag schon sein«, erwiderte ich matt.
»Frag ihn doch mal, bevor du mit deiner Mutter redest. Aber sachte, versprich mir das! Weil er dir ja nie etwas gesagt hat …«
»Vielleicht, weil ich ein Trampeltier bin?«
Sie lächelte.
»Deswegen warne ich dich ja.«
VIERTES KAPITEL
Das bevorstehende Gespräch erfüllte mich mit Unbehagen. Ich zögerte ein paar Tage, verschob den Entschluss immer wieder auf morgen, bis ich mir feige und erbärmlich vorkam und im Kloster anrief. Kelsang hatte keinen Telefonanschluss. Er wollte keinen. Ich rief bei der Verwaltung an und ließ ihm ausrichten, dass ich ihn sprechen wollte. Es dauerte eine Weile, bis er zum Empfang kam und sich meldete. Er hatte diesen metallischen, kurz angebundenen Tonfall, den er wie zur Defensive immer vor sich hielt.
»Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Ich bereite gerade ein Examen vor.«
»Ach, Onkel Kelsang, ich bitte dich! Ich muss unbedingt mit dir reden.«
»Ist etwas vorgefallen?«
Seine Stimme wurde weich. Wenn er diese weiche Stimme hatte, mochte ich ihn.
»Nein, eigentlich nicht. Oder doch - ja. Ich habe ein Problem mit Amla …«
Kurze Stille. Ich hörte, wie er laut atmete.
»Geht es ihr nicht gut?«
»Ich weiß nicht, was los ist, Onkel Kelsang. Bitte, lass mich nicht im Stich.«
Stille. Dann, nach ein paar Augenblicken widerstrebensten Zögerns: »Samstag um elf, geht das bei dir?«
Ich dankte ihm und fühlte, wie mein Herz klopfte. Aber kaum hatte ich mein Handy ausgeschaltet, fühlte ich mich schon ruhiger. Ich wusste nicht, ob ich jemals bis zur Wahrheit würde vordringen können, aber ich wollte auf sie zugehen.
Von Zürich nach Winterthur fuhr ich auf der Autobahn, durch die wohlgeordnete Schweizer Landschaft mit ihren kleinen Auswüchsen einer rebellischen Subkultur, die sich in Graffiti auf Betonwänden und Baustellen Luft machte. Der Protest zeigte wenig Kreativität, die alternative Szene war mickrig. Nach Winterthur verließ ich die Autobahn. In den Ortschaften längs der Landstraße waren früher die ersten Exiltibeter aufgenommen worden, hatten in Werkstätten und Spinnereien gearbeitet. Sie waren wortkarge, höfliche Leute gewesen, verschreckt und entwurzelt. Ihre eigene Zukunft bedeutete ihnen wenig, sie dachten an die ihrer Kinder. Sie hatten ihre Heimat im Herzen bewahrt, erstarrt in der Erinnerung und immer in der Angst, die Bilder könnten zerfallen oder hinfällig werden vor allzu offenkundiger Sinnlosigkeit.
Über Rikon war der Himmel pastellfarben, die Häuser mit ihren Vorgärten still. Eine provinzielle Melancholie prägte die Ortschaft. Dann wurde die Straße steil und kurvig. Laubwälder. Herbststimmung. Nässe. Nach einer Weile erschien auf der rechten Straßenseite das Klostergebäude. Es war, wie alle tibetischen Hauser, nach Süden ausgerichtet und in den Hang gebaut. Um diese Zeit standen vor dem Kloster nur wenige Autos. Ich fand schnell einen Parkplatz, stieg aus und ging eine kurze Wegstrecke zurück. Das Gebäude am grasbewachsenen Steilhang war von einem Schweizer, Heinrich Kuhn-Ziegler, gestiftet worden. Kuhn-Ziegler, der 1969 starb, hatte zuerst nur ein Haus für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Er sah die Geduld, die offenbare Sanftmut, mit der jene, die vor Chinas Invasion geflohen waren, ihr Los trugen, das derart ungerecht war. Man konnte diesen Zustand weder verstehen noch sich erklären, wenn man nicht mit der buddhistischen Glaubenswelt vertraut war. Kuhn-Ziegler beschloss, für die Tibeter im Exil und auch für die Menschen im Westen einen Ort zu schaffen, wo sich beide Kulturen begegnen konnten. Menschen wie er waren es, die durch ihre Handlungen Licht in diese Zeiten der Verzweiflung brachten. Das Kloster war das erste Institut dieser Art, das in Europa errichtet wurde. An seiner Planung waren tibetische Äbte beteiligt gewesen, sodass alles nach angestammten Grundregeln gebaut wurde. Modern und gleichsam zeitlos passte sich das Gebäude in die Landschaft ein. Die frühere Generation der Tibeter kannte noch die Kunst der Geomantik. Die Gebäude wurden aufgrund der Beobachtung von Wind, Wasser und Erdkraft errichtet. Man glaubte, die Beachtung aller natürlichen Gleichgewichte könne kosmische Energien binden, die Gesundheit, Wohlstand und ein langes Leben sicherten. Ich war erfüllt von Begeisterung, wie jedes Mal, wenn ich diese Harmonie spürte. Meine geschulten Augen folgten den unsichtbaren geometrischen Linien bis zu dem »Tschörten«, ein goldenes Türmchen, aus zwei glockenförmigen Kuppeln gebildet. Der Reliquienschrein war Sinnbild der fünf Elemente und enthielt alte heilige Schriften, die dem Kloster Frieden und Segen bescherten. Über dem Eingang zeigte eine etwas kitschige Skulptur ein zweites goldenes Symbol: ein Rad mit acht Speichen, die dem achtfachen Weg der Erleuchtung entsprachen. Und weil Buddha seine erste Lehre im Gazellenhain vermittelt hatte, wurde das Rad von zwei kauernden Gazellen flankiert. In dem Dachfirst war, in tibetischer Schrift, der Name des Gebäudes, »Tscho Khor gön« - »Kloster zum Rad der Lehre« -, eingraviert.
Ich betrat das Institut durch die Halle, die auch als Unterrichtsraum diente. Die Decke war aus Beton, die Wände aus unverputzten Ziegelsteinen. Ein großer hölzerner Tisch und viele Stühle standen in der Mitte. Rundherum befanden sich die Zellen des Abtes und die der Mönche, etwas weiter der Speiseraum und dahinter die Küche. Die Bibliothek war unter dem Dach, der große Kultraum im Untergeschoss. Ein paar Mönche in ihren braunroten Roben kamen die Stufen empor. Ich grüßte höflich, wie es sich gehörte, und sie grüßten mit freundlichem Lächeln zurück. Wie jedes Mal, wenn ich das Kloster aufsuchte, wurde ich von zwiespältigen Gefühlen heimgesucht. Der Ort war mir zu funktionell, zu gepflegt. Und gleichzeitig war hier ein Hauch tibetischer Seele spürbar, eine diskrete Behauptung, ein Festhalten an etwas Bildhaftem, das vielen so wertvoll wie das Wirkliche war. Es mochte nahezu unmöglich sein, eine verlorene Welt ohne Risse wiederaufzubauen. Man hatte den Eindruck, hier war zu viel Fantasie am Werk. Als Architektin fiel mir das auf. Man hatte eine Kartothek des Verlorenen zusammengestellt, ein Umfeld geschaffen, das anders und schwach war, aber trotzdem Trost bot. So unendliche Weiten vom wirklichen Tibet entfernt, mochte es nicht sinnlos erscheinen, ein Stück Erinnerung sichtbar zu machen.
Ich hatte mich mit Kelsang im Besuchszimmer verabredet. Der Raum empfing das Licht aus einem großen Fenster, von dem man auf den Waldrand sah. An zwei Bäumen war eine Leine mit Gebetsfahnen geknüpft, die schlaff in der windstillen Luft hingen. Ein großes Bild Seiner Heiligkeit stand auf einem vergoldeten Altar, mit den Silberschalen und den Kerzen. Die Amla hatte einen ähnlichen Hausaltar, viel weniger prunkvoll allerdings. Ich selbst kam mit einem kleinen und sehr schlichten aus. Ich sah auf die Uhr an der Wand. Um halb elf, hatte Kelsang gesagt. Ich war zu früh. Ich setzte mich und blätterte zerstreut in ein paar Informationsschriften. Eine Thermoskanne mit Buttertee und einige Becher standen für die Gäste bereit. Meine Kehle war trocken, aber als höfliche Tibeterin wartete ich, bis mein Gastgeber kam. Die Zeiger meiner Uhr rückten auf halb elf, als sich die Tür öffnete und Kelsang erschien. Großartig, dachte ich, wie immer auf die Sekunde pünktlich! Ich stand auf, legte die Hände in Brusthöhe zusammen und verbeugte mich, eine Huldigung, die ich ihm als Mönch schuldig war. Er legte mir leicht die Hand auf den Kopf und murmelte einen Segensspruch, bevor er zu einem Stuhl ging und sich setzte. Dabei zog er das linke Beim ziemlich stark nach. Er hatte eine schlimme Hüfte, sagte die Amla, was auch immer sie darunter verstand.
»Wie geht es Sonam?«, war das Erste, was er fragte.
»Ach, eigentlich wie immer.«
Er zog die Brauen zusammen.
»Ihretwegen wolltest du mich doch sehen! Oder habe ich dich falsch verstanden?«
»Nein, keineswegs«, sagte ich.
Als Heranwachsender war Kelsang an Pocken erkrankt, sodass seine Wangen lauter kleine Narben aufwiesen. Ich betrachtete das braune Gesicht, den braunen Hals, die nackte braune Schulter. Die Wangen waren unter den Backenknochen eingesunken, die kohlschwarzen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Es war ein hartes, aber empfindsames, ein leidendes Gesicht. Die Nase hatte einen edlen Schwung, die Lippen waren fest zusammengepresst. Es musste stimmen, was Sonam gesagt hatte. Einst musste er ebenmäßige, ja anziehende Gesichtszüge besessen haben. Aber jetzt war er alt, sein Haar war geschoren, Stoppeln wuchsen weiß nach. Seine feingliedrigen Hände waren rau von der Arbeit und verformt - die Arthrose. Seine nackten Füße steckten in Sandalen. Er hatte keine Fußnägel mehr, nur Wülste. Eine Krankheit vermutlich. Er saß krumm, hielt den schmalen Kopf etwas zur Seite geneigt. Ich bin hier, schien seine ganze Haltung zu sagen, und vergeude meine Zeit mit dir.
»Und du hast mich etwas zu fragen?«
Er hatte diese besondere Art zu sprechen, abgehackt, erstickt. Er sprach die Interpunktion sozusagen mit, was seinen Worten etwas Steifes verlieh.
Ich saß an der anderen Tischseite auf einem wackeligen Stuhl. Das Wackeln machte mich nervös. Ich hätte jetzt Chimies Rat befolgen und langsam, vorsichtig zum Kern der Sache kommen sollen. Aber impulsiv, wie ich nun mal war, entschloss ich mich zum Frontalangriff.
»Onkel Kelsang, die Amla hat den Rücken voller Narben. Ich habe das nicht gewusst. Was war mit ihr?«
Sein Gesicht blieb unbewegt; er verlagerte nur sein Körpergewicht auf beide Füße. Es war, als ob er sich leicht duckte, um einen Schlag abzuwehren.
»Hat sie dir die Narben nie gezeigt?«
Ich spürte, wie mein Mund nervös zuckte.
»Nein. Ich erfuhr es von einem Arzt.«
Er nickte, versunken und doch auf seltsame Weise angespannt. Schließlich sagte er: »Du solltest mit ihr darüber reden, nicht mit mir.«
»Soll das heißen, dass du nichts weißt oder dass du nichts sagen willst?«
Er blickte an meiner Schulter vorbei. Er war alt und verbraucht. Und doch war etwas funkelnd Lebendiges in ihm, etwas Wachsames.
»Nun«, sagte er, »sie hat Schweres durchgemacht. Bevor wir fliehen konnten, geschah viel Unerfreuliches. Wir lebten in ständiger Angst, dass wir den morgigen Tag nicht mehr erleben würden. Selbst die Berge, die das Lager umgaben, schienen bereits zum Totenreich zu gehören. Es war eine Landschaft für die Götter. Wir aber erlebten, wie die Götter höherschwebten, sich zurückzogen, die Welt kalt und kahl hinterließen. Etwas Entsetzliches vergiftete die Erde. Wir sahen mit eigenen Augen, wie die Welt sich veränderte und wir sie nicht mehr erkannten. Das Böse, das überall war, zuckte und sang auch in uns. Was konnten wir tun? Wir waren nur Kinder. Und Beten war uns fremd geworden.«
Der Stuhl unter mir wackelte. Ich setzte mich gerade hin. Was er sagte, kam unerwartet. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Ich spürte ein Frösteln aus dem Zwerchfell, das langsam meinen ganzen Körper überzog. Er indessen sprach weiter, wie zu sich selbst.
»Was diese Sache betrifft, war ich eine Zeit lang nicht sehr einsichtig. Ich würde nur zu gern den abgespulten Faden wieder aufwickeln zu einem Knäuel. Ich träume davon, dass die Zeit sich erbarmen lässt, dass die Wiedergeburt nicht nur im Großen gewährt wird, sondern auch als tägliches kleines Geschenk. Ein Neubeginn, der uns freispricht, während die Tiefe Verfehltes verschlingt. Nur darauf kommt es an, verstehst du?«
Er zog das merkwürdige Bekenntnis aus sich heraus wie das Mark aus den Knochen. Nicht, dass ich etwas begriffen oder durch logische Gedanken gefolgert hätte, aber die Unruhe in mir verstärkte sich, begleitet von einem Zittern des Körpers, bis mir der kalte Schweiß ausbrach.
»Was versuchst du mir zu sagen, Onkel Kelsang? Dass du die Sache mit Sonam verschuldet hast?«
»Vielleicht hätte ich es verhindern können. Aber ich habe mich nicht eingemischt.«
»Warum nicht?«
Jeder hatte sein Vorher und Nachher, seine Ausreden, die Vorstellung, dass er es hätte besser machen können. Er aber sprach mit müder, unheimlicher Gewissheit, bar jeder Illusion und jeder Hoffnung.
»Weil ich dachte, dass es sein musste. Und wenn sie starb, dann war das eben … weil sie ungehorsam war.«
Ich starrte ihn an.
»Entschuldige, Onkel Kelsang. Aber ich verstehe dich wirklich nicht.«
Er starrte zurück, doch ich bemerkte, dass er mich eigentlich nicht wahrnahm. Seine Augen waren ins Leere gerichtet, oder auf einen Punkt in seinem Innern, den nur er sah.
»Ich weiß noch heute nicht, wie es kam, dass ich alles tat, was sie sagten. Sie steckten mich in eine Uniform, drückten mir ein Gewehr in die Hand. Sie sagten, du gehörst zu uns, wir beschützen dich und helfen dir. Bei uns hast du täglich zu essen. Ich bekam sogar eine Decke, nachts, wenn es kalt war. Eine Decke konnte darüber entscheiden, ob man am Leben blieb oder nicht. Es war noch vor der Kulturrevolution, schon damals versuchten sie uns dazu zu bringen, dass wir nur noch das taten, was sie sagten. Heute wollen sie es nicht mehr wahrhaben, was sie damals anrichteten. Sie trugen keine Entwicklungsmöglichkeit in sich. Selbst Buddha gab sie auf. Ich habe ihn weinen sehen. Die Tränen flossen aus seinen Augen.«
Wieder wackelte der Stuhl. Ich lehnte den Oberkörper nach hinten.
»Wer hat geweint? Buddha?«
»Das sage ich ja. Er gab sie auf. Er konnte sie nicht verschwinden lassen und bessere Menschen aus ihnen machen; das lag nicht in seiner Macht. Weil Buddha will, dass die Menschen es selbst tun, verstehst du? Er wusste, dass sie es nicht konnten. Ihr Einfluss wirkt noch heute, in vielen Teilen dieser Welt. Weil ihre Methoden so furchtbar erfolgreich sind. Weil den Menschen auf diese Weise alles genommen werden kann: Besitz und Rechte und Einfluss und Rang und Haus und Heimat und Wissen und Glauben und Liebe und Gesundheit. Alles, was den Menschen zum Menschen macht. Ich hatte meine Seele verloren, doch dann kam sie zu mir zurück, und ich sah Buddha weinen. Die Tränen liefen über sein Gesicht. Buddha weinte, du glaubst es nicht? Ich weiß es besser. Denn es hört nie auf. Das Böse kommt immer wieder und ist auch jetzt da. Ich kann es durchs Fenster sehen.«
Meine Blicke folgten unwillkürlich seiner deutenden Hand, sahen nichts, nur ein Stück nasse Wiese.
»Eigentlich sollte ich nicht darüber sprechen. Aber es geht mir nicht aus dem Kopf. Sie musste meinetwegen so schrecklich leiden.«
»Sonam?«
Seine Zähne schlugen an den Rand des Bechers.
»Ich war klug, ich lernte schnell. Aber Klugheit frisst ihre eigenen Kinder, die Klugen sind die Gefährlichsten. Ich hatte das alles vergessen wollen. Aber es geht nicht. So wie der Magen etwas erbricht, das ihm nicht bekommt, so muss auch der Geist die Vergangenheit erbrechen.«
Er wiegte sich leicht hin und her, starrte auf die Halluzination, die er selbst erzeugt hatte. Ich nippte an dem Buttertee, der nicht gut war.
»Onkel Kelsang, bitte erzähl mir mehr!«
Er fuhr leicht zusammen, schüttelte den Kopf.
»Nein. Es wurde mir verboten.«
»Verboten, von wem?«
Der Ton seiner eigenen Stimme gab ihm das Gefühl der Realität und der Gegenwart zurück.
»Von ihr natürlich. Von Sonam.«
»Dann werde ich von dir nichts erfahren?«
Er bewegte matt den Kopf.
»Von mir gibt es nichts zu erfahren. Wenn ich nur umkehren könnte, in die Vergangenheit, würde ich Buddha suchen und vielleicht finden. Damals habe ich ihn nicht gesucht, das war es ja eben.«
»Onkel Kelsang, ich möchte so gern wissen …«
Er zog die Falten seiner Robe zurecht, die nach Weihrauch roch. Seine Gebetsschnur, aus kleinen Knochenstückchen geschnitzt, klirrte leise.
»Frag Sonam. Nicht mich.«
Er wirkte erschöpft und so viel älter als seine Schwester, obwohl er jünger war. Ich fühlte mich plötzlich schuldig. Ich hatte ihn gezwungen, sich an böse Dinge zu erinnern.
»Ach, Onkel Kelsang, es tut mir leid.«
Er zog sich schwerfällig aus dem Stuhl, indem er mit beiden Händen die Armlehnen packte.
»Es braucht dir nicht leidzutun. Und das da jetzt, das habe
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Copyright © 2009 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
eISBN : 978-3-641-03714-1
www.blanvalet.de
Leseprobe
www.randomhouse.de