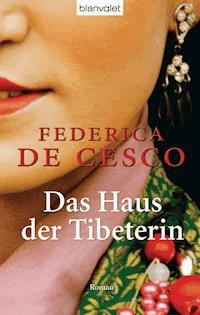Inhaltsverzeichnis
DIE AUTORIN
Widmung
Lob
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Zweiter Teil
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dritter Teil
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Copyright
DIE AUTORIN
Federica de Cesco, geboren in der Nähe von Venedig, wuchs mehrsprachig in verschiedenen Ländern auf und studierte in Belgien Kunstgeschichte und Psychologie. Nachdem sie bereits über 50 erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher verfasst hat, begeistert sie seit ihrem Bestseller »Silbermuschel« auch zahllose erwachsene Leser, zuletzt mit »Die Augen des Schmetterlings«. Federica de Cesco lebt mit ihrem Mann, dem japanischen Fotografen Kazuyuki Kitamura, in der Schweiz.
Von Federica de Cesco ist bei cbt ebenfalls erschienen:
Im Zeichen der roten Sonne (30398) Im Zeichen der blauen Flamme (30400)
Karin Bär herzlich gewidmet
»In der Nacht sah ich die Sonne im blendenden Licht erstrahlen. Ich besuchte die Götter der Ober- und Unterwelt und betete sie an – unerschrocken ihrer Herrlichkeit ins Angesicht schauend.«
Apuleius (Die Isisweihe)
Erster Teil
1
Die Fänge des Adlers umklammerten die Querstange der Standarte, an die er mit einer Eisenkette gefesselt war. Wenn er die Schwingen ausbreitete und sein Gleichgewicht verlagerte, sah ich, wie der Standartenträger seine Muskeln spannte. Der Adler war so schwer, dass der Mann, der dicht hinter dem König ritt, regelmäßig abgelöst werden musste. Es war eine besondere Ehre, die königliche Standarte zu tragen; nur verdienstvolle Krieger wurden für dieses Amt ausgewählt. Der Adler hieß Kana, der »Goldene Bote«. Er war gut abgerichtet, aber trotzdem noch gefährlich. Sein Flügelschlag konnte einen Menschen zu Boden reißen. Der Adler galt als Sinnbild der königlichen Macht, doch seine Funktion war nicht nur symbolisch: Die Tungusen benutzten ihn, um im Krieg den Feind aufzuspüren. Wenn der Adler nichts unter sich erblickte, flog er geradeaus mit regelmäßigen Bewegungen. Jagte er, glitt er unruhig hin und her. Hatte er seine Beute gesichtet, zog er immer engere und tiefere Kreise. Doch wenn er Menschen erspähte, schwebte er hoch empor und stand in der Luft still.
Kana war seinem Wärter treu ergeben: Stets kehrte er von seinen Erkundungsflügen zu den Menschen zurück, die ihn mit frischem Fleisch versorgten. Ich hatte mich an seine Anwesenheit gewöhnt, doch hütete ich mich, in seine Nähe zu geraten.
Das dichte, federnde Moos dämpfte das Geräusch der unzähligen Hufe. Man vernahm nur das Klirren der Harnische, das Knicken der Zweige, wenn sich die Pferde durch das Dickicht kämpften. Das Heer ritt um einen bewaldeten Höhenrücken. Die Männer blickten hochmütig ins silbrige Sonnenlicht. Ihre Schuppenrüstungen leuchteten, die quastenbesetzten Lanzen federten und glitzerten. Sie trugen mit Leder eingefasste Bronzehelme. Ihre Pluderhosen ließen ihre Taille, vom Schwertgurt umschlossen, noch schmaler erscheinen.
Die Standarten flatterten im Wind. Die Wappen der Gefechtskommandanten trugen die Abbildungen der fünf heiligen Tiere: Adler, Drache, Phönix, Schildkröte und Tiger. Auf der königlichen Standarte waren die Sonne und der Mond dargestellt, denn so wie diese Himmelskörper ihr Licht bei Tag und Nacht über die Welt verbreiten, so erhaben leuchtete der Herrscher über sein Volk.
Es war Sommer und sehr heiß. Die Luft war angefüllt vom Duft der Blumen und des Harzes, dem Geruch geölten Leders, den scharfen Schweißausdünstungen von Menschen und Tieren. Der Wind wehte vom Meer und verursachte einen Salzgeschmack auf der Zunge. Ich ritt neben König Iri, meinem Gemahl. Es war sein Wunsch gewesen, dass ich ihn auf diesem Feldzug begleitete. Als Tochter der Sonnenkönigin von Yamatai stand ich in hohem Ansehen: Es fiel mir leicht, das Vertrauen unserer Lehnsherren zu gewinnen, die uns ihre Krieger zur Verfügung stellten.
Fünf Jahre waren verstrichen, seit die Heilige Insel, auf der meine Mutter, Königin Himiko, ihre letzte Ruhestätte gefunden hatte, im Ozean versunken war. Eine gewaltige Springflut hatte die Bucht überschwemmt und unsere Hauptstadt Amôda bis in die Grundfesten zerstört. Durch Vorzeichen gewarnt, war es mir gelungen, das Volk in den Bergen in Sicherheit zu bringen. Nachdem der Zorn des Himmels und der des Meeres sich gelegt hatten und die Wassermassen zurückgeströmt waren, konnten wir an unsere einstige Wohnstätte zurückkehren. Die Stadt wurde wiederaufgebaut; ein neuer Palast wurde errichtet. Es war eine mächtige Festung, deren Prunk mich erdrückte.
Dem Orakel zufolge hatte ich den Tungusenfürsten Iri als Gatten erwählt. Er hatte seine Heimat Kara1 verlassen und seinen Herrschersitz nach Amôda verlegt, wo er unter dem Titel »Sujin« – Allerhöchste Majestät – über unsere vereinigten Reiche regierte.
Die tragischen Ereignisse, die den Tod meiner Mutter herbeigeführt hatten, waren noch allgegenwärtig in mir. Noch immer zwang ich mich, die Erinnerungen aus meinem Bewusstsein zu bannen. Ich war noch nicht bereit, mir Rechenschaft abzulegen, denn ich wusste, dass nur die Zeit die Wunden der Vergangenheit mildern konnte.
Als Sonnenpriesterin hatte ich mich dem Dienst der Göttin Amaterasu, dem Quell allen Lebens, verschrieben. Doch aus Furcht, daran zu zerbrechen, hatte ich meine hellseherischen Fähigkeiten aus dem Bewusstsein verdrängt. Ich verbrachte viel Zeit im Heiligtum von Sugati, wo ich die heiligen Stoffe webte und mich den Wissenschaften der Pflanzen, Gestirne und Metalle widmete; auch die Geschäfte des Königreiches erledigte ich. Die Leute suchten mich auf bei Streitigkeiten über Grundbesitz oder Tribute. Wenn ich auch Gesetze anordnete, an den Ratsversammlungen teilnahm und Gesandtschaften empfing, so überließ ich doch den größten Teil der Staatsführung dem König. Das entsprach nicht unserer Tradition, und viele Leute murrten deswegen bei Hof: Sie stellten Vergleiche an zwischen mir und meiner Mutter, die stets als Erste über alles unterrichtet war. Es hieß, ich sei ihrer nicht würdig, denn ich hätte einem Fremden die Macht zugespielt.
Die Tungusen hatten unsere Stadt vor der Belagerung und der Vernichtung gerettet, doch ihre Gewohnheiten blieben uns fremd. Raufereien waren keine Seltenheit am Hafen oder auf dem Markt; es liegt nun mal in der Natur der Menschen, sich durch Unterschiede in Glauben und Sitten zu Feindseligkeiten hinreißen zu lassen. Trotzdem wusste ich, dass diese Differenzen geringfügig waren und dass wir im Laufe der Zeit zu einem einzigen Volk verschmelzen würden. So hatte es die Hüterin des Heiligtums geweissagt, so hatten es unsere Ahnen bestimmt, und so wollte es meine Mutter …
Die Jahre vergingen. Kinder hatte ich nicht geboren. Ich wusste, dass Iri sich immer häufiger mit Hofdamen vergnügte, aber es war zu unbedeutend, als dass ich Notiz davon nahm; auch ließ ich es zu, dass er seinen Brüdern und Verwandten Machtpositionen einräumte. Sein Ehrgeiz verhalf uns zu Sicherheit und Reichtum. Er vermied Sippenkriege, unterwarf die Häuptlinge verschiedener Stämme und zwang sie, dem Königshaus zu huldigen. Er unterhielt eine große Anzahl Sklaven, die in den Minen von Kuna nach Eisen, Kupfer, Gold und Edelsteinen gruben. Er ließ die Hafenanlagen ausbauen, die Dämme verstärken und Festungen entlang der Küste von Yamatai errichten. Unsere Schiffe mit den roten Segeln und den goldbemalten Flanken beherrschten das Meer und hielten die Piraten fern. Der Handel mit Übersee hatte sich derart ausgedehnt, dass kaum ein Tag verging, an dem nicht eine mit Waren beladene Galeere in See stach, eine fremde vor Anker ging.
Doch Iri wollte mehr: Der Eroberungsdrang lag ihm im Blut. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, die Handelswege in alle vier Himmelsrichtungen unter seine Kontrolle zu bringen. Der größte Teil des östlichen Archipels war noch unerforscht. Iri hatte bereits Stoßtrupps ausgesandt, die an strategischen Punkten Festungen errichten sollten. Sie waren bei ihrem Vormarsch in die Gebiete der Ainu eingedrungen, den Ureinwohnern des Landes. Die Ainu hatten die Fremden gastfreundlich empfangen, sie mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln versorgt. Doch als sie den Eroberungswillen der Eindringlinge bemerkten, setzten sich die Stämme zur Wehr. Bald überstürzten sich die Berichte von Überfällen und grausamen Gemetzeln, denen unsere Krieger zum Opfer fielen.
Daraufhin entschloss Iri sich zu Vergeltungsmaßnahmen und schickte eine gut ausgerüstete Reiterphalanx an das jenseitige Ufer des Yodo-Flusses. Die Streitmacht wurde in einen Hinterhalt gelockt: Es gab keine Überlebenden. Im darauffolgenden Frühling ereignete sich an den Hängen des Berges Ikoma ein Erdrutsch. In den Schutt- und Schlammmassen fand man vereinzelte Menschenknochen, vermoderte Lederteile und die Überreste eines Harnischs. Iri musste einsehen, dass er es nicht mit einem gewöhnlichen Gegner zu tun hatte, sondern mit einem Volk, das bereit war, seine Freiheit teuer zu erkaufen. Dies bestärkte ihn in seinem Entschluss, die Ainu zur Übergabe zu zwingen, um so einen freien Zugang zur Ostküste zu haben. Es dauerte jedoch zwei volle Jahre, bis ein Geschwader von hundert Schiffen bereit war, um das Heer von mehr als fünftausend Mann über die Meeresenge nach Kawachi, unserer östlichsten Provinz, zu befördern.
Ich hatte vergeblich versucht, Iri von diesem Vorhaben abzubringen. Meine Gedanken flogen zurück zu jenem Abend in Amôda, als wir in der Dämmerung vor den Schiebetüren unseres Gemaches saßen. Ich erinnerte mich an den Duft der Sommerblumen, an den lauen Wind und an das goldene Sonnenlicht, das über den geschweiften Giebeln der Strohdächer lag. Iri saß damals vor mir in einem bauschigen gelben Seidengewand. Ein Stirnband war um sein geflochtenes lackschwarzes Haar geschlungen. Seine Augen schimmerten dunkel und ließen die hochmütigen Lippen, das harte Kinn vergessen. Er hatte in der vertrauten Sprache mit mir geredet, die wir bevorzugten, wenn wir allein waren.
»Wir haben bereits Stützpunkte auf dem östlichen Archipel errichtet und Festungen entlang der Küste gebaut. Der Fluss Yodo ist breit und gut schiffbar. Wir könnten mit den Schiffen bis nach Shirakata gelangen, dann von dort aus auf dem Landweg zum Berg Ikoma vordringen und die aufständischen Stämme zur Unterwerfung zwingen oder vernichten.«
Ich verwünschte seinen Ehrgeiz und seine Habgier. Ich sah keinen Sinn darin, dass ein so mächtiges Königreich wie unseres ein ganzes Heer gegen ein Volk ins Feld schickte, das in Hütten wohnte und nur über einfache Waffen verfügte. Gewiss, ein Sinn lag schon darin: Iris Machtanspruch.
Doch ich wollte mich nicht mit ihm über Vernunft oder Gerechtigkeit auseinandersetzen und so sagte ich nur: »Wir in Yamatai glauben, dass es Unheil bringt, die Ainu zu bekämpfen. Ihre Rache kann sich auf Saat und Ernte auswirken. Sie könnten die Gewässer vergiften und die Tiere im Wald gegen uns aufhetzen.«
Iris Augen funkelten belustigt. »Und du, wie denkst du darüber?«
Ich wich der Frage aus. »Über die Ainu wird Seltsames berichtet. Es heißt, dass sie wie Eidechsen an senkrechten Mauern hochklettern, wie Fische unter Wasser schwimmen und schneller als Damhirsche laufen. Man sagt auch, dass sie die Sprache der Tiere verstehen.«
»Du vergisst etwas: Sie sind auch Spezialisten im Aufschlitzen von Kehlen und Abtrennen von Köpfen.« Iris Stimme war hart, aber dann lachte er wieder. »Ihr in Yamatai seht die Dinge so, wie ihr sie sehen wollt oder wie ihr glaubt, dass sie sein sollten. Aber das ist kein Grund, um auf ein strategisch und wirtschaftlich bedeutungsvolles Gebiet zu verzichten.«
Ich sah auf die purpurnen Lichtfäden, die den Himmel färbten. Dann sagte ich: »Wir könnten versuchen, mit den Ainu zu verhandeln.«
Iri verzog verächtlich den Mund. »Ich verhandle nicht mit einer Horde Wilder!«
»Hör zu«, sagte ich besänftigend, »zur Zeit, als ich noch ein Kind war, beauftragte meine Mutter ihren Vetter Nagasume Tomi mit der Verwaltung der Provinz Kawachi. Er hatte sich selbst dazu vorgeschlagen, denn ein Fieber hatte seine junge Frau dahingerafft, und er hoffte, in der Einsamkeit der unerforschten Grenzgebiete ein neues Lebensziel zu finden. Als Befehlshaber der Provinz kämpfte er gegen die Ainu und errang zahlreiche Siege. Dann geschah es, dass er in einer Schlacht schwer verwundet wurde und von einem ›Ottena‹, einem Stammeshäuptling der Ainu, aufgenommen und gepflegt wurde. Bei den Ainu ist es Brauch, besonders tapfere Krieger, die in ihre Hände fallen, zu umsorgen und sie wie Gäste zu behandeln. Nagasume Tomi lernte ihre Sitten und ihre Verhaltensweisen kennen. Nach seiner Genesung blieb er bei ihnen und unterzog sich einem Ritual, das aus ihm – nach den Gesetzen und dem Glauben der Ainu – einen Stammesangehörigen machte. Wir sahen ihn nie wieder. Später wurde uns bekannt, dass er als Häuptling über zahlreiche ›Kotan‹ – das sind Stammesverbände – herrscht.«
»Abtrünnige scheinen in eurer Familie häufig vorzukommen!«
Er konnte seine höhnischen Bemerkungen nicht unterlassen. Das Blut schoss mir ins Gesicht, doch ich schwieg. Iri zog einen Fächer aus dem Ärmel und bewegte ihn hin und her, um eine Mücke zu verscheuchen. Ich spürte, dass er nachdachte.
»Ich will mich da nicht einmischen. Ihr in Yamatai tragt den Kopf sehr hoch. Wenn sich dein ehrwürdiger Verwandter auf die Seite der Eingeborenen schlägt, könnte es unangenehm für uns werden. Wenn er jedoch gewillt ist, unsere Herrschaft anzuerkennen, wären wir bereit, ihm vertragliche Garantien zuzusichern und die Verteidigung der Grenzgebiete seinen Schützlingen anzuvertrauen.« Während er sprach, beobachtete er mich aufmerksam. »Du stehst ihm am nächsten. Würdest du die Verhandlungen übernehmen, wenn der Augenblick gekommen ist?«
Ich erwiderte seinen Blick und dachte: Die Tungusen sind bei all ihrer Vernunft wahrhaftig sehr von sich eingenommen! Wie können sie erwarten, dass ein Mann seinen Eid bricht, nur um sich Vorteile zu sichern? Doch ich behielt diesen Gedanken für mich und erwiderte sanft: »Er ist von meinem Blut, doch seine Seele ist mir fremd geworden. Ich werde mit ihm sprechen, aber mehr vermag ich nicht zu tun. Er wird nach dem Rat seines Herzens handeln.«
»Dann wird er sich töricht verhalten«, antwortete Iri.
Ich fragte ihn nicht, was er damit sagen wollte. Ich hatte ihn wenigstens dazu gebracht, Verhandlungen in Betracht zu ziehen. Kein Preis war mir zu hoch, um sinnloses Blutvergießen zu vermeiden; doch gab ich mich keinen falschen Hoffnungen hin: Die Tungusen würden die Wälder verwüsten. Ihnen ging es nur um Eroberungen, Beute und Ruhm. Nagasume Tomi lebte seit Jahren bei den Ainu. Welche Entscheidung würde er treffen, wenn er die Freiheit und den Lebensraum seines Volkes bedroht sah?
Iris Stimme riss mich aus meinen Gedanken. »Wenn es mir gelingt, das Ostmeer zu erreichen«, sagte er feierlich, »werde ich an der äußersten Grenze des Landes ein Heiligtum zu Ehren der Göttin errichten. Das Gebäude soll aus Basaltblöcken und Edelhölzern entstehen und mit Zierrat aus purem Gold versehen werden. Es wird höher sein als der höchste Festungsturm und Jahrhunderte überdauern …«
Seine Augen funkelten. Seine Stimme hatte den düsteren, leidenschaftlichen Klang, den ich so gut kannte. Ich spürte seine Willenskraft, seine Macht. Ja, dachte ich, er wird sein Ziel erreichen. Einen Augenblick lang rieselte es mir kalt über den Rücken, doch ich zog meine Hand nicht zurück, als er sie ergriff und streichelte …
Ende des Kirschblütenmonats (März) verließ das Geschwader den Hafen von Amôda. Jede Galeere hatte fünfzig Krieger und zehn Pferde an Bord. Iri hatte die Regentschaft meinem Onkel Tsuki-Yomi, »Majestät Wächter des Mondes«, übertragen, einem kühlen, besonnenen Mann, der den üblichen Hofintrigen gelassen gegenüberstand. Iri hatte eine kluge Wahl getroffen, denn er wusste, dass sich seine Abwesenheit über Jahre hinziehen konnte. Als Bruder der verstorbenen Sonnenkönigin wurde Tsuki-Yomi eine besondere Verehrung zuteil.
Wir überquerten die Meerenge und gingen bei Takeri, einer unserer ersten Niederlassungen, an Land. Die Ankunft des Riesenheeres brachte unzählige Versorgungs- und Unterkunftsschwierigkeiten mit sich. Es entstanden Unruhen, denn die Soldaten plünderten die Felder und die Hütten der Bauern. Es war bereits Sommer geworden, als wir mit tausend Reitern aufbrachen, um auf dem Landweg die Festung von Takashima zu erreichen. Dort sollten unsere Schiffe uns erwarten.
Bei diesem Marsch hatten wir unsere ersten Begegnungen mit den Ainu. Sie lebten in Dörfern, deren Strohhütten sich leicht in Brand stecken ließen. Iris Befehl lautete, die Männer zu töten und die Frauen und Kinder als Sklaven zu verschleppen. Doch die Tungusen merkten bald, dass die Frauen sich mit der gleichen Unerschrockenheit zur Wehr setzten wie die Männer, und sie begannen, alles, was sich regte, niederzumetzeln. Die Grausamkeiten auf beiden Seiten widerten mich an, doch sie gehörten zur Wirklichkeit des Krieges.
Da erreichte uns eine folgenschwere Nachricht aus Takeri. Die Tungusen benutzten von jeher Brieftauben, um Botschaften zu übermitteln, und wir hatten diesen Brauch auch in Yamatai eingeführt. Die Taube war am Vorabend in unserem Lager eingetroffen und einer der Offiziere hatte sie behutsam dem König überbracht. Ein winziger Zylinder aus gehämmertem Silber war an einem ihrer Beine befestigt. Vorsichtig hatte Iri den Zylinder gelöst und das Siegel aufgebrochen. Die Botschaft war von seinem Vetter Yi-Am, dem Oberbefehlshaber der Flotte. Er teilte Iri mit, dass Nagasume Tomi mit einem Heer von über zweitausend Ainu an der Mündung des Yodo-Flusses lagerte.
Iri hatte sofort eine Ratssitzung einberufen. Die Entschlüsse der Tungusen konnten sich so plötzlich ändern wie der Steppenwind die Richtung. Iri lag viel daran, Nagasume Tomi als Vasall zu gewinnen. Und er wollte vermeiden, dass weitere Ainu-Stämme sich Nagasume Tomi anschlossen und dadurch sein ohnehin schon gewaltiges Heer verstärkten.
Die Zeit drängte: Noch am gleichen Abend wurde beschlossen, vor Morgengrauen aufzubrechen und den Rückzug nach Takeri anzutreten. Vier Tage waren wir bereits unterwegs und ritten ohne Ruhepausen. Die Zähigkeit und Ausdauer der Tungusen war bewundernswert: Sie konnten zehn Stunden und mehr im Sattel verbringen und dabei ihre Pferde schonen, sodass die Tiere bis zum Abend durchhielten.
Mein Reittier hieß »Shiro-Uma« – Weißes Pferd -. Es war ein hochgewachsener, feingliedriger Schimmel mit braunen Augen und Hufen, die wie polierte Muscheln glänzten. Sein Zaumzeug war aus feinstem Leder; die silberne Mähne war nach Tungusenart geflochten und mit Amuletten geschmückt. Sein leichter Harnisch aus Kupferplättchen klirrte bei jedem Schritt: Es klang hell und zart wie Glöckchen. Ich trug weite Hosen wie ein Mann, lederne Beinschützer und darüber einen gegürteten Überwurf aus dunkelblauer Baumwolle. Ein breitrandiger Strohhut, der mit einem durchsichtigen Schleier versehen war, schützte mich vor der Sonne. Als Waffe führte ich meinen Bogen mit, der Köcher mit Pfeilen hing über meinem Rücken.
Hinter mir ritt meine Leibgarde. Sie bestand aus zehn ausgesuchten Männern. Ihr Befehlshaber, Kuchiko, war Leibwächter meiner Mutter gewesen. Er war ein hagerer, schweigsamer Mann, der mir das Waffenhandwerk als Kind beigebracht hatte: Ihm verdankte ich meine Kunstfertigkeit im Bogenschießen. Iri hatte gemeint, er sei zu alt, aber ich bestand darauf, ihn an meiner Seite zu wissen. Obgleich sein Haar jetzt ergraut war und man ihm ansah, dass er ein hartes Leben hinter sich hatte, hielt er sich noch gerade wie ein Speer, und nichts entging seinen wachsamen Augen.
Ich hatte eine einzige Dienerin bei mir. Sie hieß Maki und war fünfzehn Jahre alt. Sie war die Tochter meiner Amme Miwa. Ich hatte sie ausgewählt, weil sie verschwiegen und anpassungsfähig war und sich nicht vor den Pferden fürchtete. Trotz ihrer Anmut war sie sehr zurückhaltend, und ich sah sie nie nach den Soldaten schielen, was mir manchen Ärger ersparte.
Für mich war der lange Ritt sehr beschwerlich: Ich fühlte mich wie zerschlagen. Die kurzen Nachtstunden verbrachten wir in den Zelten, die für uns aufgestellt wurden, während die Soldaten um die Feuer lagerten. Trotz meiner Müdigkeit fand ich keinen Schlaf. Manchmal lag ich bis zum Morgengrauen wach und betrachtete durch die Zeltöffnung die Sterne, die langsam am Himmel verblassten. Königin zu sein, dachte ich, was bedeutet das? Für sein Volk da zu sein und für Gerechtigkeit zu sorgen? Oder Krieg zu führen, um das Reich zu vergrößern und seine Macht zu festigen? Es waren quälende Fragen, aber niemand war da, der mir Antwort geben konnte.
Der Weg nach Takeri führte an der Küste entlang. Es war eine felsige Gegend mit Wäldern, die selten den Blick aufs Meer freigaben. Dann wieder tauchten wir in eine Schlucht und ritten lange Zeit durch ein ausgetrocknetes Flussbett, in dem nur noch ein schmales Rinnsal floss. Die Pferde wurden getränkt und gefüttert, bevor ihnen die Tungusen die Mäuler wieder zubanden und im raschen Trab weiterritten. Wir hofften, Takeri noch vor der Dämmerung zu erreichen. Boten waren mit den nötigen Anordnungen vorausgeschickt worden, damit wir die Schiffe bei unserem Eintreffen seeklar vorfanden.
Die Sonne sank, als die Vorhut des Heeres östlich von Takeri die Passhöhe erreichte und den Abstieg zur Küste begann. Die Reiter jubelten und schwangen ihre Speere. Sie spornten ihre Pferde mit schrillen Pfiffen an und jagten die erschöpften Tiere den Abhang hinunter. Den Hafen bildete eine halbmondförmige Bucht: Es war ein großer, sicherer Hafen mit einer gepflasterten Uferstraße und steinerner Mole. Die Festung selbst mit ihren steilen Mauern und hohen Zinnen glich einer riesigen Bienenwabe, die am flachen Hang des Berges klebte.
Trotz der Müdigkeit und meiner Vorahnungen erfüllte mich der Anblick, der sich mir von der Anhöhe aus bot, mit Stolz: Die hundert Kriegsgaleeren lagen ringsum an den Hafenmauern. In der Sonne leuchteten sie golden und die schrägen Schatten zeichneten sich auf dem tiefblauen Wasser ab. Die mächtigen roten Segel blähten sich im Abendwind. Es war ein prächtiges Geschwader, das den Eindruck von Erhabenheit und Unbesiegbarkeit vermittelte.
Der Pfad führte durch terrassenförmig angelegte Reisfelder und endete in einem großen Steintor mit geschweiftem Strohdach, das den Eingang zum Hafen freigab. Bauern, die auf den Feldern arbeiteten, liefen herbei und warfen sich zu Boden. Sie drückten die Stirn in den Staub und verharrten regungslos, während der König mit seinem Gefolge vorbeiritt.
Iris Gesichtsausdruck war finster. Seit einigen Stunden war der Schritt seines Hengstes Aka-Uma unregelmäßig und zögernd. Iri scheute nicht davor zurück, seine Leute bis zur äußersten Erschöpfung anzutreiben, doch wenn es um das Wohlergehen seines Pferdes ging, war er sehr besorgt. Aka-Uma, das »Rote Pferd«, war ein prachtvoller Fuchs mit klugen, leuchtenden Augen, dessen Fell glänzte wie karminrote Seide. Seine mächtige Brust, seine hohen Flanken, seine schlanken und doch kräftigen Beine zeugten von edelster Abstammung.
Ein gewundener Pfad führte hinauf zur Festung, deren Mauerblöcke aus demselben Granitstein bestanden wie die dahinter liegende Felswand. Das Fallgitter war hochgezogen; zahlreiche Soldaten, mit Lanzen und Schwertern bewaffnet, blickten von den Böschungen, Wällen, Zinnen und Bastionen dem Reiterheer entgegen. Die Hufe donnerten auf der Holzbrücke, die über eine enge Schlucht führte. Wir durchquerten das hohe, eisenbeschlagene Tor und gelangten in den ersten Innenhof.
Die Offiziere stellten sich in einer Reihe auf, und Stallknechte hasteten herbei, um die Pferde in Empfang zu nehmen. Iris Bruder Itzuse, dem die Festung in Abwesenheit des Königs anvertraut war, eilte die Stufen herunter. Drei Schritte vor dem Herrscher blieb er stehen und verneigte sich. Itzuse war fünf Jahre jünger als Iri und bewunderte ihn grenzenlos. Er hatte elfenbeinfarbene Haut, fein geschnittene Züge und ein vornehmes, zurückhaltendes Auftreten. Er trug ein Gewand aus goldgelber Seide und einen leichten Harnisch aus Bambus und Silberplättchen. Eine Silberspange schmückte sein hochgebundenes Haar. Er war außer Atem vor Aufregung. »Willkommen, Majestät. Habt Ihr eine angenehme Reise gehabt?«
»Danke«, erwiderte Iri zerstreut. Er nahm seinen Helm ab und reichte ihn einem Diener. Dann bückte er sich, um Aka-Umas Fuß zu untersuchen. Das Pferd zitterte, blieb aber stehen. Iri schnalzte leicht mit der Zunge. Er winkte dem Stallaufseher. »Ein Schilfsplitter scheint in den Huf eingedrungen zu sein und die Wunde hat sich entzündet. Sieh zu, dass du den Splitter entfernst, ohne dem Tier Schmerzen zu bereiten. Wasch dann die Wunde mit kaltem Wasser aus und mach einen Umschlag aus heilenden Kräutern. Ich will das Pferd morgen bei frischen Kräften vorfinden.« Er streichelte Aka-Uma. »Ruh dich gut aus«, sagte er mit der Zärtlichkeit eines Liebhabers, »bald wirst du wieder gesund sein.«
Er warf dem Aufseher die Zügel zu. Dieser verneigte sich stumm, während ihm Iri den Rücken zukehrte und sich an seinen Bruder wandte. »Sind die Schiffe bereit?«
»Jawohl, Herr.« Itzuses Stimme klang atemlos und glücklich. »Ich habe persönlich darüber gewacht, dass Eure Anordnungen befolgt wurden …«
»Gut.«
Iri stieg die Stufen hinauf und betrat mit ausholenden Schritten die Festung. Itzuse folgte ihm in respektvollem Abstand. »Mit Eurer Erlaubnis, Herr, dürfte ich eine Bitte aussprechen?«
»Nun?« Iri verlangsamte kaum seinen Schritt.
Ich sah, wie eine flüchtige Röte Itzuses Wangen überzog. »Ich möchte Euch auf Eurem Feldzug begleiten! Wir... wir haben genug fähige Männer, die die Festung halten können. Schließlich befinden sich fünfhundert Krieger hier und sie können jederzeit die Bevölkerung mobilisieren.« Die Worte sprudelten aus ihm hervor. »Ich verschwende meine Zeit hinter Festungsmauern, während Ihr Eure Feinde auf der ganzen Welt vernichtet! Gestattet mir, an Eurer Seite auf dem Schlachtfeld Erfahrungen zu sammeln!«
Er zog ein Tuch aus dem Ärmel, wischte sich den Schweiß von den Händen und ich verbiss mir ein Lächeln. Er war wirklich noch sehr jung.
Iri war stehen geblieben und betrachtete ihn amüsiert.
Er war Itzuse besonders zugetan, vielleicht weil noch keine Gefahr bestand, dass der Jüngling nach einer Machtstellung trachtete, die dem König gefährlich werden könnte. So legte er ihm die Hand auf die Schulter und erwiderte lächelnd: »Wir wollen Eure Ungeduld nicht länger im Zaum halten. Ihr habt Zeit bis zum Morgengrauen, um Eurer Schwert zu schärfen!«
Itzuse verneigte sich. Seine Augen leuchteten. »Ich danke Euch, Majestät. Verzeiht, dass ich Euch aufhielt.«
Die Männer arbeiteten die ganze Nacht, um die Pferde, Waffen, Vorräte und das Gepäck an Bord zu schaffen. Das Morgenrot war bereits verblasst, und das klare, helle Sonnenlicht flutete verschwenderisch über die Berge, als das Geschwader langsam aus dem Hafen auslief. Der Wind spannte die Segel, während die Galeeren an den schaumüberspülten Klippen vorbeisteuerten. Ich stand am Bug des Schiffes, in einen Mantel gehüllt, und sah auf die Felszacken, die sich wie schwarze Krallen aus der Gischt hoben.
Die königliche Galeere hieß »Seefalke«. Ihre Flanken waren mit goldenen Schwingen bemalt, und ihre mächtige Galionsfigur zeigte den Kopf des Raubvogels, dessen Namen sie trug. Sie war ein Zweimaster und bot genügend Platz für Mannschaft und Krieger. Die Pferde waren auf dem Hinterdeck untergebracht. Überall standen Wachen und nachts wurden sie verdoppelt.
Bald lag der Hafen weit hinter uns, wir steuerten auf die offene See hinaus. Die Galeeren fuhren in geschlossener Formation. Strömung und Wind trieben sie kraftvoll dem blauen Horizont entgegen. Ich hörte das Flattern der Segel, das Knirschen der Taue, das gleichmäßige Rauschen der Wellen. Hier und da vernahm ich das Zischen der Peitsche, die der Aufseher über den Ruderern schwang, während der Taktmeister den Rhythmus mit dem Hammer angab. Die Sklaven wurden vor allem unter den Kriegsgefangenen ausgewählt; sie kamen aus aller Herren Länder: Unter ihnen waren untersetzte, breitschultrige Malaien, die als erstklassige Ruderer galten, und schlitzäugige Chinesen. Sie trugen den Kopf kahl geschoren, bis auf einen langen Zopf, der ihnen als Zeichen ihres Sklaventums über den Rücken baumelte.
Die schönen, schlanken Schiffe flogen über die Wellen. Zuweilen kam ein grüner, dicht bewaldeter Küstenstreifen in der Ferne in Sicht, dann verschwand er wieder wie das Bild eines unruhigen Traumes. Albatrosse kreisten über den Masten. Auf der Schiffsbrücke war ein Baldachin für den König und sein Gefolge errichtet worden. Yi-Am, der Oberbefehlshaber der Flotte, wich nicht von der Seite des Kapitäns. Die vielen zerstreut liegenden kleinen Inseln erforderten größte Wachsamkeit. Würde ein Schiff von der Brandung erfasst und auf die Klippen geworfen, wäre es verloren.
Ich hatte Yi-Am am Hof von Nimana kennengelernt und ihn nie gemocht. Er hatte ein glattes Gesicht mit hohen Wangenknochen, in dem Eigensinn und Grausamkeit lagen. Das Haar war seitlich hochgesteckt und hinten zu einem Knoten gewunden, der unter dem Bronzehelm festgesteckt war. Unter dem stählernen Brustharnisch trug er ein Wams mit gestärkten Flügelärmeln. Zwei Schwerter steckten in seiner breiten seidenen Schärpe. Wie alle Tungusen trug er einen Gürtel aus Leder und Goldplatten, an dem an kleinen Ketten das traditionelle Sattelzubehör der Steppenreiter baumelte: ein kleines Messer, ein Spiegel, ein Wetzstein und ein Feuerstein.
Wenig später spürte ich am leichten Rollen des Schiffes, dass der Wind sich gedreht hatte. Ich hörte den Kapitän und Yi-Am lebhaft miteinander reden. Yi-Am befehligte das Geschwader, aber Noburu war ein Seemann aus Yamatai, der sein Schiff und die Gewässer kannte. Der Wind trug ihre Stimmen zu mir herüber. Noburu versuchte, Yi-Am von der Notwendigkeit zu überzeugen, den Kurs zu ändern und in südlicher Richtung zu segeln.
»Der Wind wird in der Nacht umschlagen. Wenn die Nord- und Ostströmungen aufeinanderstoßen, bilden sich gewaltige Strudel, die den Schiffen zum Verhängnis werden können.«
»Wie viele Tage würden wir dabei verlieren?« Yi-Ams Stimme klang schroff.
»Einen Tag, Herr. Vielleicht zwei, wenn wir die Halbinsel Kii umsegeln.«
Yi-Am musterte ihn kühl. »Das ist ein großer Umweg.«
»Jawohl, Herr.« Noburu verbeugte sich entschuldigend. »Aber der Sog der Strömung kann die Schiffe abtreiben und in die Tiefe ziehen.«
»Welchen Kurs laufen wir jetzt?«
»Immer noch nach Osten, Herr.«
»Behalte den Kurs. Ich übernehme die Verantwortung.«
»Aber, Herr, der Wind …«
Yi-Am fauchte: »Halte deine Zunge im Zaum!« Seine Augen waren hart und blutunterlaufen. Die rechte Hand umfasste den Schwertgriff.
»Jawohl, Herr.« Noburu schluckte, nach außen Würde bewahrend, im Innern jedoch zitternd. »Wie Ihr befehlt!«
Yi-Am grüßte ehrerbietig, als er an mir vorbeischritt. Ich grüßte zurück mit unbeweglicher Miene. Seine Arroganz war mir zuwider. Auch konnte ich nicht vergessen, dass er mich einst gedemütigt hatte …
Gegen Abend erhob sich der Wind. Die See schäumte. Aus dem sanften Wiegen des Schiffes wurde ein Schaukeln und die Ruderer stemmten sich mit aller Kraft in die Riemen. Ich stand an Deck und beobachtete das Einziehen der Segel, als Noburu, der Kapitän, sich vor mir verneigte. Er war ein dunkelhäutiger, sehniger Mann, dessen scharfe Augen unter glatt herabhängendem Haar hervorblitzten. Ich spürte sofort, dass er eine schlechte Nachricht brachte. Wenn es schlechte Nachrichten gab, kamen die Leute immer zuerst zu mir.
»Majestät, der Wind frischt zu heftig auf«, sagte er gepresst. »Es wird uns nur schwer gelingen, die Schiffe unversehrt durch die Strömung zu steuern. Ich versuchte, den ehrwürdigen Yi-Am davon in Kenntnis zu setzen, aber ich fürchte, dass er meine Warnung unterschätzt hat.«
Ich gab ihm durch ein Kopfnicken zu verstehen, dass ich es wusste. »Wie könnten wir der Gefahr entgehen?«, fragte ich, Ruhe vortäuschend.
»Es gibt zwei Möglichkeiten, Majestät. Die erste und sicherste wäre, die Schiffe treiben zu lassen und günstigen Wind abzuwarten.«
Ich dachte bei mir: Dazu wird der König niemals bereit sein!
Noburu las die Antwort in meinem Blick, denn er stieß hörbar den Atem aus.
»Und die zweite wäre?«, fragte ich.
»Dass der Rudermeister die Sklaven zu äußerster Anstrengung zwingt. Wir müssen die Schiffe so schnell wie möglich aus den gefährlichen Gewässern bringen.«
»Gebt die nötigen Anweisungen«, sagte ich. »Ich werde es den König wissen lassen.«
Bald darauf ertönte das Dröhnen des »Dora«, des Bronzegongs, der uns dazu diente, Signale von Schiff zu Schiff zu übermitteln. Zwei Männer schlugen mit einem stoffumwickelten Hammer im Takt darauf. Der gewaltige, summende Schwington hallte weithin über das Meer.
»Alle Segel hissen!«, brüllte Noburu. »Kurs halten! Alle Mann an die Fallen!«
Der Rudermeister gab ein schnelleres Tempo an, die Männer legten sich mit aller Kraft in die Riemen. Das Vibrieren der Segel steigerte sich zu einem einzigen wirren Flattern. Ich kehrte den Windböen den Rücken zu und klammerte mich an einem Tau fest. Die Erinnerung an den Schiffbruch, den ich einst erlebt hatte, machte mir panische Angst. Kalter Schweiß bedeckte meinen Körper. Doch damals waren wir Opfer eines Sturms geworden; heute wölbte sich der Himmel wie ein gelbroter, blinkender Schild über uns. So weit das Auge reichte, schaukelte Schiff an Schiff. Die Galeeren schienen wie schwarze Speere durch flüssiges Feuer zu gleiten.
Noburu schaute zu den Galeeren hinüber, die wir mit vollen Segeln überholten, und heftete dann seinen Blick auf das Wasser, um die Richtung abzuschätzen, in die wir steuern mussten. Er brüllte Befehl auf Befehl. Weil jedes Schiff auf den Wind angewiesen war, blieb nur wenig Raum, um zu manövrieren, und die Gefahr, sich gegenseitig zu rammen, vergrößerte sich zusehends. Die Bugwellen und das Kielwasser schäumten. Windstöße blähten die Segel.
Plötzlich schleuderte die Strömung unsere Galeere seitwärts. Das Schiff erbebte und neigte sich nach Steuerbord. Starr vor Schreck sah ich, wie der Sog des Wassers uns mit rasender Geschwindigkeit auf das Nachbarschiff zutrieb.