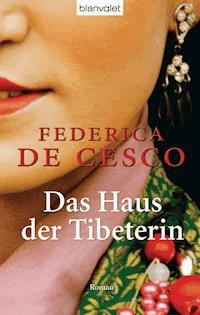Inhaltsverzeichnis
Widmung
Hauptpersonen
Prolog
KISO
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14.Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21.Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
KYOTO
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
AWASU
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
ANHANG
Copyright
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
FÜR SOPHIE RECK
Hauptpersonen
DIE FAMILIE NAKAHARA
NAKAHARA KANETOOFürst des Landes KisoCHIZUSeine Gemahlin »Tausend Kraniche«TOMOE GOZENDie Goldene Kriegerin, Tochter Kanetoos, »Wildstrudel«YAMABUKI GOZENIhre Schwester, »Bergrose«NAKAHARA KANEHIRAIhr Bruder, »Vollendung«NAKAHARA KANEMITSUIhr Bruder, »Leuchtkraft«KOMAO-MARUIhr Ziehbruder, »Kleiner Pferdekönig« (siehe auch Yoshinaka)
Hauptsitz der Familie Nakahara ist die Provinz Kiso.
DER CLAN DER MINAMOTO
MINAMOTO YOSHINAKAErbe der Minamoto-FamilieFÜRSTIN SAESeine MutterFÜRST MINAMOTO YOSHIKATASein verstorbener VaterMINAMOTO YOSHIHIRADer Fürst von Kamakura und Cousin YoshinakasHIEDA NO MAROKOPriesterin und Halbschwester YoshihirasMINAMOTO YORITOMOStatthalter des Kaisers und Cousin Yoshinakas
Die Minamoto-Familie herrscht über die Provinzen Musashi,Echigo und Honshu; ihr Hauptsitz ist Kamakura.
DER CLAN DER HAIKE
TAIRA NO KIYOMORIGeneral und oberster Befehlshaber des KaisersSOSEKA KAEDEEine Dame der HalbweltDANKAN»Meister Schwalbe«, Priester und Spion des Kaisers
KAISERLICHE FAMILIE AUS DEM SEIWA-GESCHLECHT
GO-SHIRAKAWAAltkaiser oder Klosterkaiser, nominell zurückgetretenPRINZ MOCHIHITOErbe des AltkaisersPRINZESSIN TOKIKOTochter des Altkaisers
Kyoto ist Hauptstadt des Inselreiches und Hauptsitz des Kaisers und des kaiserlichen Hofes.
WEITERE FIGUREN
GENZOO ASANOEinsiedler und ArztSORANFechtmeister und MönchTAROEin junger BauerUCHIDA IEYOSHIHauptmann der kaiserlichen LeibgardeFUBUKI & HAYATE»Schneesturm« und »Windstoß«;Tomoes und Yoshinakas Reittiere
Prolog
JE NACH LICHT UND JAHRESZEIT verändern sich die Wälder. Unsere Dichter haben schöne Worte für den Frühlingsabend, für den blanken Sommermond, für das rote Herbstlaub oder die Schneeflocken im Wind. Ich war eine schlechte Dichterin und noch immer macht mich der Anblick schöner Dinge sprachlos.
Verglichen mit meinen Geschwistern war ich eigentlich die Dümmste. Und weil ich nicht wollte, dass sie über mich lachten, unterdrückte ich rücksichtslos jeden Impuls, meine Gefühle zu zeigen, und sei es auch nur in der Dichtkunst. Unsere Lehrer verglichen mich kopfschüttelnd mit meiner Schwester Yamabuki, die Unvergessliche. Ich nahm den Tadel demütig hin, bewunderte stillschweigend Yamabukis mühelose Gabe, Gedichte zu verfassen. Man musste sie selbst gehört haben, um den Eindruck zu verstehen, den sie auf uns machte. Obschon meine Schwester weder Gegenwart noch Zukunft kennt, ist ihre Schönheit immer noch lebendig.
Auch ich gehöre ja der Vergangenheit an. Die Bauern, die in den Bergwäldern leben, erkennen mich nicht, wenn ich ihnen helfe, Reisig zu sammeln. Sie staunen, wenn ich – eine alte Frau – schwer beladen mit ihnen wandere und sie bis in ihre Dörfer begleite, wo ich ihr einfaches Mahl teile. Ich pflege ihre Tiere, wenn sie krank oder verletzt sind, helfe den Stuten, wenn sie ihre Fohlen zur Welt bringen. Manchmal setze ich mich zu den Frauen, die ihren Webstuhl ans Fenster rücken und das Schiffchen werfen: Meine Hände sind stark und flink und draußen singt die Nachtigall zum Klang der surrenden Räder und dem Stampfen. Ich bringe den Männern bei, sich ihre Schwerter zu schmieden. Die Männer hämmern das Eisen, wie ich es ihnen sage, und das Werk gelingt. Ich lehre sie auch, mit ihren Waffen umzugehen, damit sie Räuber und Plünderer verjagen können, denn wir leben in unruhigen Zeiten.
Die Leute nennen mich respektvoll die »Alt-Weise der Berge«. Sie fragen mich manchmal, wer ich denn wirklich bin, woher ich denn komme. Doch ich gebe mich nur ganz selten zu erkennen. Obwohl ich noch in der Welt und mit der Welt lebe, bin ich in Wahrheit schon weit weg.Wenn ich nachts allein durch die Berge streife, mit den Tieren spreche oder einer einsamen Drossel lausche, tauchen aus dem Nebel Gestalten auf. Ich höre Geräusche und Klänge von einst, und aus der Ferne eine Stimme, die mir vertraut ist.Wie man es oft in Träumen erlebt, ist es meine eigene Stimme, die ich höre; jene Stimme, die ich einst hatte, hell und schneidend wie die Stimme eines Vogels. Ich erkenne auch den Namen wieder, den ich rufe:
»Komao-Maru!«
Und wie ein Echo aus fernen, verblassten Zeiten erreicht die Antwort mein Ohr.
»Tomoe! Wo bist du? Ich kann dich nicht finden!«
»Komao-Maru«, sage ich dann. »Nun warte doch, ich komme schon.«
Dabei ertappe ich mich, wie ich Verwünschungen vor mich hin brummele. Er ist noch so ungeduldig wie früher. Daran wird sich wohl nie etwas ändern. Es ist auch nicht mehr wichtig – der Kummer des Verlustes ist verblasst. Zurück bleibt nur die Erinnerung. Ich bewahre sie in mir, obwohl ich sie selten betrachte.
Den gestrigen Tag vergesse ich manchmal. Doch die weit zurückliegenden Dinge stehen vor mir, als wären sie gerade erst geschehen. Und oft, wenn mir ein Ereignis durch den Kopf geht, blitzt die Erinnerung wie ein Sonnenstrahl vor mir auf. Eine Landschaft, die heute nicht mehr besteht, nimmt die scharfen Umrisse der Wirklichkeit an.Wasser rauscht über blanke Steine, es riecht nach Baumrinden und Wildblumen, und über das Tal gleiten die Schatten vereinzelter Wolken. Das Laub wispert in den sanften Farben des Sommers, der Himmel leuchtet hell und ich bin wieder jung.
KISO
1. Kapitel
ICH DENKE VIEL über mein Leben nach, über die guten und die schlechten Tage; über die Menschen, die ich gekannt habe und die jetzt nur noch Asche sind. Ich betrachte die Bilder wie in einem Bronzespiegel, sehe sie klar und ungetrübt und vollkommener als jemals zuvor, weil sie gewesen sind und sich nie mehr ändern werden, weder heute noch in tausend Jahren.
Da erscheinen mir auch schon meine Brüder Kanehira und Kanemitsu – »Vollendung« und »Leuchtkraft« -, die wir Hira und Mitsu nannten. Beide waren groß von Gestalt, mit der gleichen schönen Kopfform, dem leicht abgeflachten Profil, den vollen Lippen. Sie trugen ihr sprödes Haar streng nach hinten in Flechten gezwängt. Ihre Augen waren klar und kastanienbraun und scharf wie die eines Falken.
Sie sahen wie Zwillinge aus, meine Brüder, und waren auch fast unzertrennlich. Sie unterschieden sich nur darin, dass Hira großen Wissensdurst besaß, während Mitsu nur glücklich war, wenn er zu Pferd in die Berge ausreißen konnte. Dabei legte er viel Wert auf schöne Kleider, sodass man ihn für eitler hielt, als er eigentlich war. Er hatte zwar viele Fehler, aber er war auch edelmütig und frohsinnig. Übertrugen ihm meine ElternVerantwortung, gab er stets sein Bestes. Hira hingegen neigte dazu, sich in irgendeiner Träumerei zu verlieren. Er war ein Junge, der viel Schlaf brauchte und wenig sprach. Mutters Strenge konnte den heftigen Charakter der Söhne dämpfen, aber noch mehr hatte die väterliche Erziehung zustande gebracht, sodass beide sich in Gegenwart der Eltern recht gut und wohlerzogen zu benehmen wussten.
Meine Brüder hatten im Grunde die Gesinnung von Menschen, die zwar ein raues Leben führen, aber trotzdem Handlungsfreiheit besitzen, sowohl zum Guten wie auch zum Bösen. Meine kleine Schwester Yamabuki – »Bergrose« – zeigte, so sanft und freundlich sie auch war, einen ähnlich freien Willen. Sie hatte dabei ein Lächeln von unwiderstehlicher Anziehungskraft, das alle Menschen bezauberte.
Ich dagegen, herb und verschlossen, sprach wenig, lächelte selten und hatte den Kopf voll heroischer Fantasien. Neben den Freunden und Verwandten der Eltern und den Gästen aus der Umgebung waren es vor allem die Dienstboten, die durch ihre Schilderungen ruhmreicher Kriegszüge und Heldentaten meine Begeisterung entflammten. Sie besaßen einen schier unerschöpflichen Schatz alter Sagen und absonderlicher Geschichten über Geisterwölfe, Fuchsfrauen und Bärengötter, sodass ich und meine Geschwister oft das Gefühl hatten, sie weilten mitten unter uns.
Wir fürchteten uns nicht, im Gegenteil. Wir waren unerschrocken, wagemutig, stets bereit,Widersacher oder böse Geister in die Flucht zu jagen.Auf diese Weise taten wir beständig etwas, das nach städtischer Sitte schroff und unhöflich war. Daneben hatten wir Spiele für jede Jahreszeit, ließen auch die Kinder der Knechte daran teilnehmen, prügelten uns mit ihnen im Pferdedung und Stroh. Besucher mussten sich oft fragen, ob uns überhaupt irgendeine Erziehung zuteilwurde.
Indessen, der Schein trügte.Vergaßen wir auch gelegentlich, dass wir Kinder vornehmer Abstammung waren, unsere Eltern vergaßen es nie. Sie nannten in jener Zeit eines der bedeutendsten Vermögen des Inselreiches ihr Eigen, nicht zuletzt dank der zahlreichen Silbergruben in unseren Tälern. Später sollte ich erfahren, dass mein Vater sogar der Regierung gelegentlich Geld lieh. In der Tat brachte unsere Verwandtschaft mit dem Seiwa-Kaisergeschlecht zwar viele Pflichten mit sich, machte es aber auch möglich, dass wir – Knaben wie Mädchen – eines Tages die höchsten Stellen erreichen konnten, die unser Land seinem Adel anzubieten hatte. Undenkbar, dass wir in vornehmen Kreisen wie Bauerntölpel auftraten! Und so lernten wir früh die richtige Art, uns zu verbeugen, jede Person mit der richtigen Anrede zu begrüßen und welche Kleider und Farben den Anlässen entsprechend zu tragen waren.
Mit großem Nachdruck wurde uns eingepaukt, der Grundsatz der Schicklichkeit sei die Ehrfurcht, die sich im praktischen Leben als Harmonie in den Beziehungen auswirke.Wenn wir zum Beispiel mit Menschen von hohem Rang verkehrten, so sollte unser Betragen schlicht und natürlich, nie aber unterwürfig sein. Saßen wir mit einfachen Leuten zusammen, so mussten wir höflich mit ihnen sprechen und kein Gefühl unserer eigenen Bedeutung aufkommen lassen.Auch wurden wir früh mit unserer Mythologie und mit dem Leben der großen Persönlichkeiten unserer Geschichte vertraut gemacht.
Unsere Eltern sorgten auch dafür, dass uns nur die besten Lehrer unterrichteten. Sie ließen diese an bestimmten Tagen des Mondkalenders kommen, entschädigten sie reichlich für die beschwerliche Reise. Ein Priester, der uns in den chinesischen Klassikern unterwies, ist mir am stärksten in Erinnerung geblieben. Seine stattliche Erscheinung, sein feierliches Auftreten machte uns Bange, wir wagten kaum, den Mund aufzumachen. Er unterrichtete uns aus den Vier Büchern des Konfuzius mit der gleichen Hingabe, die er seiner Religion entgegen brachte. Wir kauerten vor niedrigen Schreibpulten und übten mit dem Schreibpinsel und beschmierten dabei Gesicht und Hände mit Tusche. Weil wir das Stillsitzen nicht gewohnt waren, tadelte uns der Lehrer häufig mit barschen Worten: »Ihr wilden Kinder, wollt ihr nicht Frieden geben! Setzt euch hin, tut eure Pflicht!«
Auch Komao-Maru – unser Ziehbruder – zeigte sich im Unterricht nicht im Geringsten ehrgeizig, und ich merkte bald, dass die Eltern eine wirkliche und tiefe Sorge empfanden, weil er so wenig Bereitschaft aufbrachte zu lernen.Weil es den Lehrern gestattet war, uns mit einem Bambusstock zu schlagen, fiel uns bald auf, dass bei Komao-Maru diese Strafe selten angewendet wurde. Und wenn, dann ging der Lehrer mit seinen Stockschlägen recht zaghaft um. Außerdem bekam Komao-Maru sein Essen immer als Erster. Wir fanden das ungerecht und ließen es ihn auch spüren. Doch im Grunde konnten wir ihm nichts nachtragen. Er brauchte uns nur mit seinen Augen anzusehen, die so kühn und golden blitzten, und unsere Herzen flogen ihm zu. Komao-Maru musste man lieben, ob er im Recht war oder im Unrecht. Er war wild, aber von großer Güte, sodass er vor Mitgefühl weinen konnte, wenn eines von uns Kindern erkrankte oder sich verletzte. Damals schon spürte ich es: Wir würden ihm folgen, wohin er uns auch rief, unsere Träume an seinen Träumen entzünden.
Komao-Maru! Noch heute erfüllt mich sein Kindername – »Kleiner Pferdekönig« – mit Wehmut. Woher er eigentlich kam, wussten wir Kinder nicht. Man hatte ihn im Alter von zwei Jahren der Familie anvertraut. Obwohl wir uns der Nacht deutlich entsinnen konnten, in der er gebracht wurde, war die Erinnerung an das, was vorher und unmittelbar danach geschah, verschwommen. Gewiss war es im Laufe der Jahre vorgekommen, dass wir Fragen stellten. Dann antworteten die Eltern jeweils, dass Komao-Maru von den Göttern zu irgendeinem weisen Zweck gekennzeichnet sei. Und sie schlossen ihre Erklärung, die eigentlich keine war, fast immer mit einer erbaulichen Ermahnung: »Bedenkt, dass es keinen Sinn hat, sich nicht dankbar dem Willen der Götter zu beugen. Was beschlossen wurde, dem muss man gehorchen.«
Für gewöhnlich genügte diese Zurechtweisung, denn zu jener Zeit wäre kein Kind so vorlaut gewesen, mehr wissen zu wollen.Von den Lippen der Dienerschaft kam auch nie ein Wort. Sie hatte in der Familie ihren festen Platz und war ihr durch Treue verbunden. Überdies hatte sie, wie uns später gesagt wurde, in jener Nacht einen Eid geschworen.
2. Kapitel
ES GESCHAH IN EINER NACHT, als die Septembersterne leuchteten, bis zu den fernen Wäldern und über die Gipfel hinweg. Gegen Mitternacht wurde heftig an das Tor geschlagen und die Diener, aus dem Schlaf gerissen, eilten nach draußen und zündeten die Laternen an. Ich war damals vier Jahre alt und hatte einen tiefen Schlaf, aber es war dieses tanzende Licht, das mich weckte.
Unser Haus war im Grunde eine Festung, mit einer Mauer aus Felsblöcken und Höfen und Gärten im Innern. Alle Fenster waren mit Holzstäben versehen, und als ich neugierig nach draußen spähte, sah ich Vater, wie er über den Fußweg schritt, der zum Tor führte. Er war vollständig angekleidet und hatte, wie es sein Vorrecht war, beide Schwerter – das kurze und das lange – umgegürtet. Ich wunderte mich, dass er mitten in der Nacht so feierlich auftrat, und rüttelte Hira und Mitsu wach.
Yamabuki, die noch zu klein war, schlief bei der Kinderfrau Aki und wurde nicht geweckt. Wir bemühten uns indessen, so wenig Lärm wie möglich zu machen, schlichen aus unserem Zimmer und durch die lange Halle nach draußen. Die Torflügel standen weit offen. Dahinter konnten wir im Sternenlicht den gepflasterten Weg sehen und die Pferde, die unter den Bäumen warteten und auf Vaters Befehl in den Hof geführt wurden. Eines der Pferde wurde in die Nähe des Steinpfeilers gebracht, auf dem Reisende beim Auf- und Absteigen ihren Fuß setzen konnten. Dort half ein stattlicher Mann einer Frau aus dem Sattel. Ihre Bewegungen waren langsam, ungeschickt. Sie war in einen weiten Reisemantel gehüllt, Haar und Gesicht unter einer Kapuze verborgen. Sie trug ein Bündel im Arm, das sie fest an ihre Brust drückte.
Mein Vater verneigte sich tief, gab Anweisungen. Man geleitete die Ankömmlinge in das Wohngemach, zündete Feuer an. Die Dienstboten bewirteten sie mit allen Zeichen der Ehrerbietung. Auch meine Mutter kam, ihr Schlafkleid unter einem wattierten Gewand aus flockiger Seide verborgen. Sie hatte sich kämmen lassen; man hatte ihr die Schminke des Tages entfernt und die Farben für die Nacht aufgelegt, die weniger grell waren. Eine Dame ihres Standes zeigte sich nie mit nacktem Gesicht. Als sie durch die Halle in das Wohngemach trat, bemerkte sie uns und sagte leise und verärgert:
»Geht sofort wieder schlafen!«
Wir wichen eingeschüchtert zurück.Weil uns aber die Neugierde keine Ruhe ließ, versteckten wir uns hinter den polierten Pfeilern, um zu lauschen. Doch im Raum wurde so leise gesprochen, dass kein Wort an unsere Ohren gelang. Schließlich befeuchtete Mitsu, der sehr erfinderisch war, seinen Finger mit Spucke und schmolz ein kleines Loch in die Papierwand, die das Wohngemach abtrennte. Auf diese Weise gelang es uns, einen Blick auf die geheimnisvollen Besucher zu werfen. Um besser zu sehen, schubsten wir uns gegenseitig mit Schimpfworten weg, versetzten uns Stöße und Fußtritte, sahen allerdings nur wenig. Doch als für ein paar Atemzüge die Frau in meinen Blickwinkel geriet, bemerkte ich, dass sie wunderschön war, aber so blass und abgezehrt, dass mich ein Phantom fast weniger erschreckt hätte. In jeder ihrer Gesten lag eine Steifheit, die nicht bloß von der Müdigkeit herrührte. Sie trug ein schlafendes Kind in ihrem Bündel; es schien, als fehle ihr die Kraft, es zu halten. Und als Mutter die Hände nach dem Kind ausstreckte, überließ die Fremde es ihr mit tränennassem Gesicht.
Wir kamen nicht dazu, mehr zu sehen, denn in diesem Augenblick erschien unsere Kinderfrau, die uns überall gesucht hatte. Unter fortwährend gemurmeltem »Unhöfliche Kinder, unhöfliche Kinder!« riss sie uns hoch und zerrte uns in unser Gemach zurück.
Als wir am Morgen erwachten, waren alle Spuren der Besucher beseitigt worden; doch neben Yamabuki lag, warm und bequem in den Kissen vergraben, ein schlafender kleiner Junge.
Beim Frühstück nannte uns Mutter seinen Namen: Komao-Maru. Er sei, erzählte sie, das Kind einer Verwandten, die, plötzlich Witwe geworden, ihr Leben fortan in einem Kloster verbringen wollte. Vater fügte hinzu, Komao-Maru würde von jetzt an unser Bruder sein.Wir gaben uns mit dieser Erklärung zufrieden, und nach einigen Wochen war es so, als hätte er schon immer zur Familie gehört. Und er selbst konnte nicht wissen – denn er würde immer nur vorwärts blicken und nie zurück -, dass, während er noch ein Kind war, sein Zauber bereits in uns wirkte.
3. Kapitel
UNWEIT UNSERER BURG dehnte sich im Schatten der Hügel eine gewaltige und flache Ebene, die früher einmal mit einem See bedeckt gewesen war. Hier stand das Gras hoch, mit Feldblumen und Schilfrohr durchsetzt, und bot Wildpferden von unbekannter Abstammung eine Heimat. Ihre riesige Herde breitete sich im ganzen Tal aus. Das Wiehern, Stampfen und Kämpfen der Pferde erzeugten einen steten Strom von Bewegung, die sich auf die Landschaft übertrug.
Niemand hatte jemals die Herkunft dieser hochgewachsenen, starken Pferde erfahren. Die Farbe ihres Fells wechselte von Dunkelgrau bis zu einem Weiß, das fast grünlich schimmerte. Bei gewissen Tieren zeigte sich ein scheckiges Muster, das sich wie kleine Wolken auf Brust und Flanken verteilte. Der Kopf mit den langen, spitzen Ohren war im Verhältnis zum Rumpf etwas zu klein, doch wohlgeformt. Die weit auseinanderliegenden Augen zeugten von Intelligenz. Der Hals war kräftig geschwungen, und sie trugen ihren Kopf sehr hoch, was auf Neugierde und Wachsamkeit schließen ließ. Der Rücken war lang und beweglich, die Muskeln ausgeprägt. Die Hufe waren abgerundet wie Muscheln und von schöner schiefergrauer Farbe. Die Mähne war stoppelartig kurz, der Schweif dagegen üppig und sehr lang.
Wir nannten diese ungewöhnlichen Pferde »Schilf- Drachen«. So schnell und stark waren sie, dass man sich erzählte, zur Paarung kämen Drachen zu den Stuten. Einmal gezähmt waren diese erstaunlichen Tiere willig, treu und anhänglich. Sie liebten die Menschen; es war, als ob sie ihre Gedanken spürten. Wie konnten sie sonst, ohne den geringsten Wink von Zügel oder Knie, vom entfesselten Galopp zum Stand übergehen, von Flucht zu Verfolgung, vom listigen Ausweichen zum offenen Angriff wechseln? Im Kampf stellten sie sich schützend über die Verletzten, verteidigten sie mit Zähnen und Huftritten. Doch war es nicht leicht, ihr Vertrauen zu gewinnen.
Fubuki war der schönste und größte Hengst dieser Herde. Ich war neun, als ich das Füllen zum ersten Mal sah und ihm diesen Namen, der »Schneesturm« bedeutet, gegeben hatte. Ich hatte beobachtet, wie er zur vollen Kraft und Größe heranwuchs, und ich war auch dabei gewesen, als er schließlich die Macht an sich riss. Die Schilf-Drachen kämpften so heftig gegeneinander, dass manche Tiere ihren Verletzungen erlagen. Dabei ging es um die Führung der Herde und die Herrschaft über die Stuten. Fubuki hatte sämtliche Rivalen in die Flucht gejagt. Sein Mut allein hätte schon genügt, dass ich ihn liebte.
Im Frühling, als mein Vater mit seinem Gefolge in das Tal kam, um junge Pferde für seine Krieger auszusuchen, ließ Fubuki zunächst keinen Mann an sich heran.
»Ein prachtvolles Tier, zu jung noch«, hatte Vater gesagt. »Er wird nicht dulden, dass ein Reiter sich auf seinen Rücken schwingt. Er hat gerade erst die Stuten erobert, lassen wir ihm Zeit. Später wird es einfacher sein, ihn zu zähmen.«
Ich hatte kein Wort gesagt. Doch schon damals hatte ich mir vorgenommen, dass der wundervolle Hengst mir gehören sollte. Wir würden zusammen eine beeindruckende Erscheinung abgeben, Fubuki und ich, sofern ich das Pferd richtig in die Hand zu nehmen verstand.
Das konnte nicht allzu schwer sein, meinte ich, denn dass Tiere mich liebten, wusste ich. Ich sprach so zu ihnen, als seien sie meine Verwandten. Ich pfiff Vögel herbei, die sich auf meine Hand setzten, und brachte Tiere aller Art ins Haus, Wildtauben, Eichhörnchen, Fasane, Rehe und sogar eine verletzte Eule.
Einmal fand ich ein verirrtes Bärenkind. Es hatte blaue Augen, saß aufrecht vor mir auf dem Waldboden und weinte. Ich suchte die Fährte seiner Mutter und streute Waldbeeren auf den Boden. Auf diese Weise fand sie zu ihrem Kind zurück. Die Tiere vertrauten mir – vielleicht, weil ich ihnen nie etwas Böses getan hatte. Ich hörte ihre Stimmen, wo andere nur Brummen, Quaken, Zirpen und Schnabelklappern vernahmen. Warum das so war, wusste ich nicht. Ich war mit dieser Gabe geboren worden.
Täglich hatte ich mich in die hohen Gräser nahe bei der Herde gesetzt, stets ein wenig näher an den großen Hengst heran. Zunächst hatte das Pferd so getan, als sei ich nicht anwesend. Aber Pferde sind sehr neugierige Geschöpfe. Männern auf zwei Beinen traute Fubuki nicht, doch weil ich auf dem Boden kauerte, war ich nach einer gewissen Zeit kein Menschenwesen mehr für ihn. Und er wollte wissen, wer ich war und was ich in der Nähe der Herde zu suchen hatte.
Eines Morgens kam ich mit meiner Flöte. Ich setzte mich auf den gewohnten Platz, hob die Flöte an meine Lippen und begann zu spielen. Beim ersten Ton wandte mir Fubuki heftig den Kopf zu. Ich sah, wie seine Ohren sich aufrichteten. Er zitterte ein wenig, doch langsam wich der Argwohn von ihm. Ich spielte weiter, eine sanfte, melodische Weise. Wie von einer unsichtbaren Macht gelenkt, näherte sich das Tier. Erst einen Schritt, dann noch einen. Als er bei mir stand, nahm ich die Flöte vom Mund und richtete mich langsam auf. Behutsam streckte ich den Arm aus, öffnete meine Finger. Er betrachte, was ich mitgebracht hatte, und leckte den Klumpen Salz aus meiner Handfläche.
Ich sah die klaren Augen unter den dichten Wimpern ganz aus der Nähe. Seine Nüstern waren feucht, er stülpte die schwarze Oberlippe zurück, zeigte die großen, gefährlichen Zähne. Sein Gebiss hätte ohne Weiteres mein Handgelenk zermalmen können. Mit seinen hohen, spitzen Ohren glich er wirklich einem Drachen. Nun, war er ein Drache, so waren wir Verbündete, mehr noch: Geschwister. Trug ich selbst nicht Drachenblut in den Adern? Das hatte meine Mutter mir oft genug erzählt. Damals glaubte ich noch halbwegs daran.
Leise sprach ich nun zu dem Pferd.
»Hat dir meine Musik gefallen? Ich bin deine Schwester, weißt du das? Wenn du willst, bringe ich dir morgen wieder Salz und spiele dir etwas vor.«
Fubuki beugte seinen Hals, um mit den Nüstern meine Wange zu berühren. Seine Mähne, die nach nassem Fell und Gräsern roch, strich über mein Gesicht, bevor er sich abwandte und mit wehendem Schweif zu den Stuten zurücktrabte.
Seit diesem Tag kam Fubuki jedes Mal zu mir, ganz wie zugerittene Pferde es tun. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er mir ganz vertraute und mich auf seinen Rücken ließ. Aber weil er noch zu selten stillhielt, war Vorsicht geboten. Immer wieder redete ich sanft auf ihn ein, damit er sich an meine Stimme gewöhnte. Ich erzählte ihm, dass wir bald zusammen reiten würden, im gestreckten Galopp, ganz wie es ihm gefiel, ungestüm und übermütig. Der bloße Gedanke daran ließ mein Herz höherschlagen.
4. Kapitel
DOCH MAN HATTE MICH bei den Wildpferden gesehen und berichtete es meiner Mutter. Noch in der gleichen Stunde ließ sie mich rufen. Sie saß wie gewohnt vor ihrem Webstuhl. Umsichtig wie sie war, kümmerte sie sich bereits im Frühsommer um unsere Kleider für die kalte Jahreszeit. Mutter begann schon frühmorgens mit der Arbeit. Wenn sie den Webstuhl an die Fenstertür rückte und das Schiffchen zu werfen begann, hörte sie draußen die ersten Vögel zum Klang des Rades zwitschern.
Mutters Name lautete Chizu – »Tausend Kraniche« – und sie kam von der nordwestlichen Küste des Landes. Chizus Eltern nannten eine Anzahl Reisfelder ihr Eigen. Sie waren nicht reich, hatten aber viel Einfluss; daneben waren sie für ihren Geiz bekannt. »Ein Reiskorn ist ein Schweißtropfen«, sagt ein Sprichwort. Chizu hatte schon als Kind hart arbeiten müssen. Sie tat es gerne und war sehr ausdauernd. Ihre Hände, die nie ruhten, besaßen auch beim Weben einen präzisen, federnden Rhythmus.
»Tomoe«, sagte sie im strengen Tonfall. »Du solltest dem Hengst fernbleiben.«
»Aber Fubuki ist doch mein Bruder!«, rief ich.
»Fubuki?«
»Ja, Mutter. Findest du nicht, dass der Name gut zu ihm passt?«
Chizu hatte fünf Kinder auf die Welt gebracht, von denen nur der Erstgeborene gestorben war. Sie war eine schöne Frau, die alles gut und richtig machte und dabei auch gerne lachte. Doch was die Pferde betraf, blieb sie unerbittlich.
»Eine Mutterstute könnte dir den Schädel spalten. Ich verbiete dir, wieder hinzugehen, solange die Stuten Fohlen haben.«
Mir kam nicht in den Sinn, mich gegen das Verbot aufzulehnen. Mutter war die Herrin, man legte sich besser nicht mit ihr an. So verneigte ich mich demütig, bevor ich schmollend aus dem Gemach stapfte.
Meine Brüder waren nicht da, doch vor dem Haus traf ich Yamabuki und Komao-Maru. Beide trugen Strohmatten mit den Abfällen der Seidenraupen, die wir im Haus züchteten. Unter dem Dach lagen große, luftige Räume, vollgestellt mit Bambusrahmen, an denen netzartige Geflechte befestigt waren, bedeckt mit Tausenden von Seidenraupen. Ihr ständiges Nagen erfüllte unser Haus mit leisem Rascheln, wie das Geräusch von Regentropfen auf Blättern. Jedes Kind trug Sorge für fünf Kästen Seidenraupen, aus denen wir täglich die Futterrückstände entfernen mussten. Wir warfen sie auf einen Haufen im Hof, wo die Gärtner sie abholten. Der Abfall ergab nämlich den besten Dünger der Welt.
Meine Brüder und ich verrichteten die Arbeit nur, weil sie zu unseren Pflichten gehörte. Tatsächlich wurde erwartet, dass wir uns – nicht anders als die Dienstboten – auf vielerlei Weise nützlich machten. Wir versorgten die Pferde, misteten die Ställe aus, holten Wasser aus dem Brunnen, waren bei der Reisernte auf den Feldern. Die Knaben spalteten Holz, halfen den Handwerkern bei der Arbeit.Wir Mädchen sammelten Reisig, wuschen die Seidengewänder im Bach, lernten Weben und Spinnen. Im Herbst sah man uns auf dem Boden sitzen, mit ausgestrecktem Fuß, zwischen unseren Zehen hielten wir das Ende eines Taues, das wir aus Reisstroh drehten.Auf diese Weise fertigten wir, wie jedes Bauernkind, unsere Schneestiefel an. Der Winter brachte schwere Schneefälle und ohne diese Stiefel konnten wir nicht aus dem Haus.
Was die Seidenraupen betraf, nun, ich fand sie langweilig.Yamabuki indessen liebte es sehr, sie zu pflegen, und Komao-Maru half ihr, weil er gerne bei ihr war.
Als sie mich am Eingang der Vorhalle sitzen sahen, blieben beide stehen. Sie hatten die Ärmel hochgekrempelt, ihre nackten Füße steckten in Strohsandalen.
»Du hast deine Kästen nicht gereinigt«, sagte Yamabuki in vorwurfsvollem Tonfall.
»Ach, später!«, murmelte ich. Sie sahen, dass ich wütend war, und setzten sich zu mir. Ich erzählte, was sich zugetragen hatte. Wir Kinder stritten uns häufig, doch wenn es darauf ankam, hielten wir zusammen. Die Eltern klagten oft, dass sie gegen uns nicht ankamen.
»Wirklich?« Komao-Maru war sehr beeindruckt. »Der große Hengst hat aus deiner Hand gefressen?«
»Er heißt Fubuki«, sagte ich.
»Fubuki!«, rief meine Schwester »Der Name passt gut zu ihm. Ach, er ist wunderschön!«
»Ja, und schon fast zahm«, seufzte ich. »Bald hätte er mich auf seinen Rücken gelassen. Aber jetzt darf ich nicht mehr auf die Weide! Und bis alle Fohlen gesäugt sind, hat mich Fubuki vergessen.«
»Wenn Mutter es dir verboten hat, musst du gehorchen«, sagte Yamabuki im vernünftigem Tonfall, und ich hätte sie am liebsten verprügelt. Doch da sagte Komao-Maru: »Mir hat sie nichts verboten.«
Ich konnte mit dieser Bemerkung nichts anfangen und starrte ihn verständnislos an; durch seine schwarzen Strähnen erwiderten seine Augen meinen Blick, schalkhaft und etwas verschlagen. Mir kam nicht in den Sinn, dass er mich hintergehen könnte. Ich war ein aufrichtiges Kind. Wie hätte ich ahnen sollen, dass Komao-Maru, schlau wie er war, sich seinen Plan bereits zurechtlegte?
Zum ersten Mal in meinem Leben erfuhr ich, was es bedeutet, verraten zu werden. Komao-Maru wusste eigentlich nicht, was er tat, und mich schüchterte sein Handeln ein, weil ich meinen Weg noch suchte. Doch er verlor den seinen, und das wusste ich schon damals besser als er. Als Folge seiner Tat würde ich ihm in späteren Jahren sagen, was er zu tun hatte, und er würde stets auf mich hören.
Die Bilder jener Nacht aber sind mir geblieben, umgeben von Düsterkeit und Aufregung. Es waren Bilder des Schreckens und der Magie. Ich erlebte sie mit klarem Bewusstsein und ohne Erstaunen, weil es damals eine andere Welt für mich überhaupt nicht gab.
5. Kapitel
AN JENEM ABEND KÜNDIGTE die drückend schwüle Luft ein Gewitter an.Wir Kinder konnten nicht einschlafen, machten Lärm, warfen uns die Bettkissen zu. Durch die offene Schiebewand strömte der herbe Geruch des Waldes, das kräftige Aroma der Maulbeerblätter. Endlich konnte Aki, die immer sehr geduldig war, unsere Liegematten wieder Seite an Seite zurechtlegen. Darauf das Geräusch einer Tür, die zugeschoben wurde, Flüstern und endlich – Schweigen. Nur noch die üblichen Geräusche waren hörbar: das Nagen der Seidenraupen, das vertraute Waffenklirren der diensthabenden Wachleute und ab und zu das Schnauben der Pferde in den Stallungen. Nach einer Weile rührten sich meine Geschwister nicht mehr. Ich hörte ihren gleichmäßigen Atem, sah ihre schwarzen Haare auf dem Kissen. Auch Komao-Maru lag still.Wäre ich erfahrener gewesen, hätte ich gemerkt, dass seine Ruhe unnatürlich war.
Irgendwann schlief auch ich ein, doch nicht sehr lange. Auf einmal war ich wieder wach. In der Ferne vernahm ich ein dumpfes Grummeln. Nicht dieses Geräusch war es, das mich geweckt hatte, sondern das Gefühl, dass irgendetwas nicht war, wie es sein sollte. Ich richtete mich auf, warf einen Blick um mich. Meine Brüder und Yamabuki schliefen tief und fest. Komao-Maru aber war verschwunden.
Mein Herz stand still, bevor es mir in der Kehle schlug. Ich wusste, wo ich ihn finden würde.
Du elender Verräter!, dachte ich, zitternd vor Wut. Hastig kleidete ich mich an, stieß leise die Schiebetür zurück und glitt nach draußen. Zum Glück kannten wir Kinder jeden Winkel der Burg, denn die Wachposten hätten mich unverzüglich wieder schlafen geschickt. So aber kroch ich unbemerkt an ihnen vorbei.
Der Mond schwebte zwischen Wolkenfetzen wie ein silbernes Schiff durch schwarze Wellentäler. Im Wald regte sich kein Windhauch. Nur Grillen zirpten und unter den Büschen schimmerten die Leuchtkäfer. Es roch nach Harz und modrigen Wurzeln. Die Luft war so schwer, dass ich sie wie eine Berührung auf der Haut empfand.
Als ich den Wald durchquert hatte, näherten sich bereits mächtige Wolken dem Mond. Ich beachtete kaum, was am Himmel vor sich ging, lief um einen Hügel herum, überquerte einen Sumpf und erklomm eine Anhöhe, von wo aus ich die Pferde im Tal sehen konnte. Von meinem Aussichtspunkt aus bemerkte ich bald die Wellenbewegung, die sich von außen, wo schützend die Hengste standen, zu den Stuten und Fohlen in der Mitte übertrug. Und ich bemerkte auch die kleine, schattenhafte Gestalt, die sich Fubuki näherte. Der Hengst, perlmuttweiß im Mondlicht, stand in wachsamer Bereitschaft abseits. Komao-Maru mochte für sein Alter ein gewandter Reiter sein, aber es gab Dinge, die ich besser wusste als er. Und dass er sich an Fubuki heranmachte, verletzte mich auf heftige, schmerzhafte Art.
Als ich mich den Hang hinabgleiten ließ, stand Komao-Maru schon in kurzer Entfernung von dem Hengst. Fubuki scharrte unruhig mit den Hufen. Seine Ohren waren wie Dolche gespitzt, er wirkte sprungbereit, voll feindlicher Abwehr. Ich hoffte, das Pferd ließe sich von Komao-Maru nicht anrühren. Dann sah ich, wie der Junge die Hand ausstreckte und Fubuki Salz anbot, genau wie ich es getan hatte. Und Fubuki, der das Salz bereits gekostet hatte und den Geruch wiedererkannte, kam näher und leckte das Salz aus Komao-Marus Hand.
Ich stand still, während das Wetterleuchten immer greller zuckte. Ein gewaltiges Elend breitete sich vom Kopf in meinem Körper aus. Hoch über dem Tal wirbelten die Wolken wie Strudel. Plötzlich fegte ein Windstoß durch die Büsche, das Schilf sang und zischte.Von einem Atemzug zum nächsten schien der ganze Wald von Seufzen und Knirschen erfüllt. Die Baumkronen begannen zu rauschen, es klang gewaltig und feierlich. Und ebenso plötzlich funkelten Glanzlichter auf, das ganze Tal schien Funken zu sprühen.
Da krachte ein gewaltiger Donnerschlag, ein violetter Lichtschein wehte von Wolke zu Wolke. Und gleichzeitig sah ich, dass Komao-Maru ein paar Schritte zurücktrat, bevor er auf den Hengst losrannte. Kalter Schrecken fuhr mir in alle Glieder. Ich wollte schreien:
»Komao-Maru, bleib ihm vom Leib!«
Doch meine Zunge war wie gelähmt. Schon machte Komao-Maru einen Satz, schwang sich hoch, warf ein Bein über Fubukis Rücken und musste nur ein bisschen vorrutschen, um richtig zu sitzen. Da endlich fand ich meine Stimme und stieß einen Warnschrei aus, wusste ich doch, dass es viel zu früh war: Fubuki würde die ungewohnte Last auf seinem Rücken mit dem Unwetter in Verbindung bringen und sich zur Wehr setzen. Blitze zuckten bereits von allen Seiten des Himmels. Unter den aufflammenden Wolken richtete Fubuki sich auf, schüttelte wild die bebenden Flanken. Ich begann zu laufen.
»Nein!«, schrie ich. »Nein, Fubuki! Tu ihm nichts!« Wieder krachte ein Donnerschlag. Für einen Augenblick ließen die Blitze vor meinen Augen nur glühende Spuren zurück. Dann klärte sich meine Sicht. Ich sah, wie Fubuki sich in wildem Zorn um die eigene Achse drehte. Schaum trat aus seinen Nüstern, und es war, als ob aus seiner Mähne Feuerzungen loderten.Voller Panik klammerte sich Komao-Maru an seinem Rücken fest. Auf einmal blieb das Pferd so unvermittelt stehen, dass seine Hufe sich in das Gras zu bohren schienen. Er senkte den Kopf und schlug mit aller Kraft aus. Wie von einer Schleuder geschnellt, flog Komao-Maru durch die Luft und stürzte kopfüber zu Boden. Fubuki trabte im Halbkreis, wieherte zornig und schrill. Er schüttelte wild den Kopf, sprengte auf die kleine Gestalt zu, die hilflos im Gras kroch, vergeblich bemüht, sich in Sicherheit zu bringen. Doch ich kam dem Pferd zuvor, warf mich vor Komao-Maru, schützte ihn mit meinen Körper.
»Geh weg, Fubuki!«, kreischte ich. »Fort mit dir!«
Im vollen Schwung machte der Hengst eine Wendung. Die Hufe fielen schwer auf den Boden zurück. Mit wütendem Schnauben drehte der Hengst ab, galoppierte der Herde entgegen. Und gleichzeitig mit ihm setzten sich alle Pferde in Bewegung, donnerten durch das Tal, der Schlucht entgegen, während schwer und warm die ersten Regentropfen fielen. Ich kauerte mich, klebrig vor Schweiß, neben Komao-Maru nieder. Er sah mich verwirrt an. Aus einer tiefen Stirnwunde tropfte Blut und mischte sich mit dem Regenwasser auf seinem Gesicht. Ich packte ihn unter den Armen und zerrte ihn hoch.
»Kannst du gehen?«
Er machte stolpernd einen Schritt. Dann knickte er mit schmerzverzerrtem Gesicht ein.
»Mein … mein Fuß!«
Der Knöchel war blutunterlaufen, dick angeschwollen. Ich stützte Komao-Maru mit der Kraft, die mir verblieb, zerrte ihn dem Wald entgegen.
Donnerschläge erschütterten den Himmel, die Wolken verdichteten sich zu wirbelnden Ungeheuern.Wie Drachen brausten sie aus allen vier Himmelsrichtungen heran, jagten uns mit flammenden Blitzen von Schrecken zu Schrecken. Bis auf die Haut durchnässt, zitternd vor Kälte, erreichten wir endlich das Dickicht. Der Bach, der für gewöhnlich friedlich plätscherte, schäumte und gurgelte. Mit gewaltiger Anstrengung wateten wir hindurch; unsere Strohsandalen rutschten auf den glitschigen Steinen aus. Endlich erreichten wir eine Felswand, pressten uns im Schutz der Steine aneinander.
In unserer Verwirrung merkten wir erst allmählich, wie sich das Unwetter entfernte. Die Welt wurde wieder ruhig; nur noch der Bach schäumte. Eine Weile saßen wir, ohne uns zu rühren. Wir waren verschlammt und blutig, erstarrt bis ins Mark, und jeder Knochen tat uns weh. Endlich brach ich mit zitternder Stimme das Schweigen.
»Du hast Mutters Verbot missachtet. Die Drachen waren zornig.«
Komao-Marus Zähne klapperten, mühsam stieß er die Worte hervor.
»Bitte … sag Mutter nicht, dass ich bei den Pferden war.«
Trotz meines elenden Zustandes merkte ich, dass er Angst vor mir hatte.
»Wenn du nicht willst, dass Mutter es von mir erfährt, musst du mir ein Versprechen geben. Denke daran, dass ich dich gerettet habe!«
Mit einem letzten fernen Grollen beruhigte sich das Gewitter. In den Himmelslöchern rollten sich die Drachen fest in ihre Schwingen ein, schlossen ihre grünen Augen und schliefen.Von irgendwoher hörte ich Komao-Marus Stimme, die mir sein Versprechen gab. Und das war alles.
Der Streit zwischen uns raubte uns beiden eine Zeit lang den Schlaf, bevor ich Komao-Maru seine unredliche Tat vergab. Unsere Verletzungen heilten schnell, während Komao-Marus Gewissensbisse mehr Zeit brauchten. Die Sache hatte immerhin zur Folge, dass unser Ansehen bei den Geschwistern stieg. Mutter klagte zwar, dass sie ständig schlimme Geschichten von uns hören musste. In Wirklichkeit war sie stolz auf mich, weil mein Verhalten ganz besondere Erinnerungen in ihr weckten, die mit meiner Geburt zusammenhingen. Aber das war etwas, das ich erst später verstand.
Der Zwischenfall hatte indes zur Folge, dass Komao-Maru der Reiter des einen oder anderen Pferdes wurde, ohne dass je eines auf Dauer sein Herz eroberte. Ich glaube, der Neid hat ihn jeden Tag begleitet, bis das Schicksal ihm Hayate bescherte. Da erst verschwand sein innerer Groll. Das aber geschah erst viele Jahre später, als Komao-Maru nicht mehr diesen Namen trug.Von dem Tag an konnten wir Seite an Seite kämpfen, ohne dass wir auch nur einen Kratzer erlitten. Die Leute sagten, die Schilf-Drachen würden uns mit einem Zauber beschützen, den sie aus dem Boden stampften. Ich für meinen Teil glaube, dass diese Pferde unsere besten Freunde waren. Weil sie unsere Körper spürten, ihre Wärme und unsere Wärme sich mischten, kannten sie uns so gut wie wir uns selbst.Womöglich sogar besser.
6. Kapitel
VIELSCHICHTIGE BILDER REGEN SICH in meinen Tagträumen. Die Vergangenheit ist gleichsam nichts – weil sie alles ist. Man kann die Dinge sehen und berühren, bevor die unergründliche und unsichtbare Zeit sie verwischt. Obwohl Fubukis Knochen längst zu Staub geworden sind, macht mich seine verschwundene Schönheit nach wie vor froh. Wir hatten in einer Zeitspanne gelebt, die uns beide mit einschloss, mögen sich auch unsere Umrisse im Dunkeln verlieren.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als damals die jungen Fohlen herangewachsen waren und es mich wieder zu den Wildpferden trieb. Mit der Flöte hatte ich Fubuki zu mir gelockt, ihm Salz aus meiner Hand angeboten. Es stimmte schon, dass der Hengst seit dem Frühling ruhiger geworden war. Er tänzelte nicht mehr, wie junge Pferde das tun, sondern stand wachsam da, betrachtete mich mit scharfen, stolzen Augen. Ich hatte mit ihm gesprochen, ihm tausend Dinge erzählt, damit er sich wieder an meine Stimme gewöhnte.
Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2009
© 2009 cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle Rechte vorbehalten Karte: Gettyimages, München (RF/Stockbyte/The Map House of London) Umschlagfoto: gettyimages; shutterstockhe ∙ Herstellung: WM
eISBN : 978-3-641-02491-8V002
www.cbj-verlag.de
www.randomhouse.de