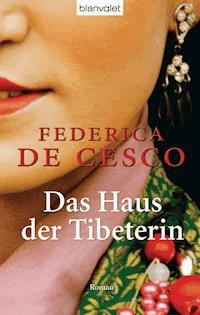Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Epilog
FEDERICA DE CESCO
Copyright
Für Hajime Hosoki, der jetzt nach draußen blickt. Für Sanae Kosugi, die mich zu den Augen des Schmetterlings führte. Und immer wieder für Kazuyuki.
Wenn du der Träumer bist, bin ich dein Traum. Doch wenn du wachen willst, bin ich dein Wille.
Rainer Maria Rilke: Das Stundenbuch
Ich war der Strauch, der Vogel und der Fisch, Denen Ihr keine Sprache unterstellt.
Empedokles
Prolog
In mir lebt ein jüngerer Bruder, der gestorben ist. Henrik kam ein Jahr nach mir zur Welt. Mit zwölf war er tot. Irgendwie habe ich ihn in meine Nähe geholt, lebe sozusagen mit ihm zusammen. Ich spreche oft zu ihm; wenn er will, gibt er Antwort. Sein Gesicht, das die Welt jenseits des Todes erblickt, sehe ich manchmal im Traum, sehe es ganz langsam aus der Tiefe schweben, von grünem Wasserfilm überglänzt. Ich sehe Augen, die glasklar starren, und eine Luftblase löst sich aus dem offenen Mund. Der Körper bewegt sich schattenhaft, die Arme schweben wie Flossen, die Finger sind leicht gespreizt, aufgeschürft und grünlich verfärbt. Vielleicht ist er jetzt das, was er sein wollte: verwandelt. Leicht dreht sich die Traumgestalt in der Strömung. Ich will sie packen, festhalten – vergeblich! Die Gestalt gleitet weg, kreist schneller. Lautlos, von Luftblasen umgeben, entschwindet der Körper in dunkel schillernde Tiefen.
Den Traum hatte ich früher häufig. Jetzt seltener. Es gibt Leid, aber auch Trost. Mein Verstand sagt mir, dass etwas, das nicht mehr da ist, auch nicht mehr zurückkommen sollte; aber ganz sicher werde ich nie sein. Ich bin eine Frau, die auf Vorzeichen achtet, die in Mondnächten mit griffbereitem Messer durchs Haus geht. Alle schlafen in diesem Haus, warm und ruhig und im Vertrauen. Ich trete leise auf, ganz leise. Die Schlafenden sollen nicht gestört werden. Es liegt etwas Beruhigendes in dem sicheren Gefühl des Messers in meiner Hand, in dem Funkeln der kurzen, scharfen Klinge. Behutsam ziehe ich die Schiebetür auf, beobachte die Bewegung der Blätter, den Nebelflor, das zarte Gespinst. Unter dem Mondlicht wandeln sich die Dinge, verändern ihr Gesicht. Ich blicke nach allen Seiten, nach drei, vier Seiten, nach allen Seiten, nach drei, vier Seiten. Immer wieder und wieder. Kurz vor der Morgendämmerung kommt Wind auf, ein salziger Wind, der vom Meer her weht. Trägt er den Blumenduft des Todes heran, schließen sich meine Finger fester um den Griff. Mein Gesicht, meine Hände glänzen hell. Ich stehe ja nicht im Schatten, ich will gesehen werden. Ein leichtes Zittern geht über meine Haut, aber Furcht empfinde ich keine. Ich bin eine Sonnentochter; der Geist, der in der Dunkelheit schwebt, entstammt dem bleichen Mondgeschlecht. Ich sage: »Weg mit dir! Was glaubst du, wer ich bin?« Bewegen sich Blätter, knistern Zweige, zieht meine Klinge einen blitzenden Kreis. Aufrecht stehe ich vor der Schiebetür, spreche halblaut die richtigen Worte. Die Menschen, die ich liebe, sind in Sicherheit. Weil Enzo nicht mehr da ist, bin ich es von nun an, die Wache hält.
1. Kapitel
Ich betrachte mich oft im Spiegel, nicht aus Eitelkeit, sondern aus Neugierde. Meine Vorfahren waren Samen, jenes Volk im Hohen Norden, das noch vor hundert Jahren in »Lavvo« – in Stangenzelten – lebte. Ich trage ihr Erbe in mir; es prägt meine äußere Erscheinung. In meinem Gesicht erkenne ich Lailas Augen, die ohne zu blinzeln das Sonnenlicht ertragen; ich sehe Reidars harte Wangen, sein starkes Kinn. Und auch Henriks dunkles Haar, die etwas stumpfe Nase, den sinnlichen Mund. Ich beschreibe mich wie die Bilder, die ich oft auf den Zeitschriftenseiten sah: grüne Augen, fein geformte Züge, über die das Licht rinnt wie Wasser, eine auffallend gewölbte Stirn. Doch womöglich trägt mein Gesicht noch andere, geheimnisvollere Spuren? Ich weiß es, ich habe sie gesehen.
Ich muss noch betonen, dass ich mich nie als schön empfunden habe, höchstens als fotogen, was etwas anderes ist. Henrik war schön. Aber Henriks Knochen sind in Grotten gefangen, wo sie der langsame Strom bewegt. Wenn das Licht für Augenblicke herunterflutet, mag geschehen, dass sie leuchten. Ich darf mich nicht zu oft diesem Bild überlassen. Vielleicht sind es längst keine Menschenknochen mehr.
Ich bin in Helsinki geboren und aufgewachsen. Von unseren Erkerfenstern aus blickten wir auf die Johanneskirche und den Observatoriumspark. Der Stadtteil Eira mit seinen viel bewunderten Jugendstilbauten gehört heute zu den »noblen« Vierteln. Die Wohnungen sind nahezu unerschwinglich. 1948 jedoch, nach der Unterzeichnung des Freundschaftspaktes mit der ehemaligen Sowjetunion, standen viele Häuser leer. Zu unpraktisch, zu geschnörkelt. Bröckelnde Stukkaturen, rostige Rohre, zu hohe Fenster, die kaum vor der Kälte schützen, zersprungene Steinfliesen und abgewetztes Parkett. Die Eltern meines Vaters Juhani hatten Geschmack. Sie wussten, was früher schön war und in besseren Zeiten wieder schön werden konnte. Sie kauften die Wohnung zu einem Spottpreis und fanden sich mit dem Mangel an Bequemlichkeit ab. Geld war nicht viel da, die Renovierungsarbeiten dauerten Jahre. Vieles machte mein Großvater in seiner Freizeit selbst. Matti Pacius – so hieß er – kam aus einer Architektenfamilie, die ihr Vermögen im Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Einer seiner Vorfahren war Fredrik Pacius, der die erste finnische Oper komponierte und unsere Nationalhymne vertonte. Ein altes Foto zeigt Matti als Kind bei einem Gartenfest neben dem berühmten Jean Sibelius, der eine so schlechte Meinung von der Welt hatte, dass er sein letztes zu Papier gebrachtes Musikstück kurzerhand vernichtete. Eine Symphonie, die kein menschliches Ohr jemals hören würde.
Ursprünglich wollte Juhani Opernsänger werden. Er war ein guter Bariton, aber kein hervorragender; bald hatte er sich der Regie zugewandt und damit seinen Lebensinhalt gefunden. Seit 1990 war er an der Finnischen Nationaloper engagiert. Dadurch schien es fast, als habe er kein Privatleben. Die Unaufhörlichkeit seiner Arbeit hatte meiner Mutter zunehmend zu schaffen gemacht und war auch der Grund ihrer allmählichen Entfremdung. Während Juhani ein Werk inszenierte, arbeitete er zwischen den Proben das nächste aus, ein drittes, meist noch ein viertes, fünftes, hatte er bereits im Kopf. Was Schriftsteller in Sprache ausdrücken, Filmemacher in Bildern, formulierte Juhani in musikalischen Vorgängen auf der Bühne. Sie waren so etwas wie eine Muttersprache. Sein Kopf war so beschaffen, dass jede Sache, die ihn beschäftigte, sogleich und unfehlbar in seinen Werken ihren Ausdruck fand. Henrik wäre nach ihm gekommen, das weiß ich mit großer Bestimmtheit. Ihre Ähnlichkeit war verwirrend; die Art, wie sie sprachen, wie sie lachten, sich bewegten. Und auch die sensiblen Hände, der leicht gequälte Ausdruck im Gesicht. Aber Henrik hatte das Strahlen eines Zwölfjährigen und würde es auf ewig bewahren.
Vielleicht hatte auch ich diese Art, die Welt zu sehen, als ob jeder Augenblick im Werden begriffen sei, als sei ich nie ganz dort, wo man mich sah, als wäre ich anderswo, weiter als das Auge reicht. Auf den Bildern, die damals von mir gemacht wurden, blickte ich den Fotografen niemals richtig an; ich blickte woandershin, als sähe ich etwas Gestalt annehmen. Das fiel mir erst später auf, Jahre danach, als ich Danjiro die Fotos von früher zeigte. Genauer gesagt, war es Danjiro, der diese Eigenart bemerkte; mir selbst war sie nie aufgefallen. Inger – meine Mutter – hasste Tagträume jeglicher Art, obwohl sie es war, die das unruhige Blut in die Familie brachte. Doch sie wandte sich ab von der großen Verworrenheit dieser unsichtbaren Welt, sie tat Buße für die Sünden der Vorfahren, verließ sich auf die Gnade Gottes. Die Welt der Bibel zumindest war solide. Sie zitierte mit Vorliebe Lars Levi Lästadius, den Bekehrer der Samen:
»Wenn eine Kuh, ein Schaf oder ein Rentier stirbt, trauert ihr. Aber ihr fühlt weder Trauer noch Kummer über euer elendes Leben.«
Sie machte eine kaufmännische Lehre, arbeitete sich empor, wurde Einkäuferin bei Stockmann. Sie entwickelte dabei einen guten Spürsinn für den Zeitgeist und hatte Erfolg. Damit stand sie fest draußen in der wirklichen Welt und beobachtete mich, mit Groll im Herzen. Etwas konnte sie jedoch nicht ändern: ihre Art, den Rücken straff zu halten, den Kopf hoch erhoben. Sie schritt schnell und elastisch aus, drehte dabei die Füße leicht einwärts und schob das Hüftgelenk vor. Es war der typische Gang der Nomaden, den auch ich hatte. Dies sagte ich ihr aber nicht. Es hätte ihr keine Freude gemacht.
Nein, ich konnte nicht, wie Inger, die unsichtbare Welt vergessen, sie war ja ein Teil von mir. Und weil sie mir entrissen wurde, suchte ich sie zunächst im Zwielicht der Theaterräume, dort, wo meine Augen von ihr nichts wahrnahmen, sie aber ständig zu spüren war, wie ein unsichtbarer Flügelschlag, ein Schatten, das Echo eines Echos …
Ich war ein nachdenkliches Kind, doch das Theater »Die dunkle Höhle« beunruhigte mich nicht. Nachdem ich meinen Bruder verloren hatte, wurde das Theater eine Zeit lang mein Zuhause. In der Wohnung war ja keiner mehr, der mich erwartete. Inger kam nie vor sieben Uhr von der Arbeit. Obwohl von der Schule aus der Weg zur Töölö-Bucht ziemlich weit war, legte ich ihn, je nach Wetter, täglich mit dem Rad oder mit dem Bus zurück. Dann stand ich zufrieden in den Kulissen, kaute Bonbons und beobachtete meinen Vater bei der Arbeit. Irgendwann bemerkte er meine Anwesenheit, bewegte kurz die Hand zum Gruß und kümmerte sich nicht weiter um mich. Für gewöhnlich dauerten die Proben bis in den Abend hinein, vor einer Aufführung sowieso.
So sehr ich das Theater auch liebte – der Wunsch, selber auf der Bühne zu stehen, überkam mich nie. Inger hatte ja auch nichts für die Oper übrig. Sie schaute lieber CNN. Mein Vater hatte sich längst damit abgefunden. Als ehemaliger Sänger verlor er nie den Überblick, führte die Künstler so individuell, dass jeder Einzelne das Gefühl hatte, er sei die wichtigste Person im Ensemble. Durch die körperliche Anspannung, die er dabei hatte, war er nach jeder Probe klatschnass. Er war – im wahrsten Sinne des Wortes – ein theatralischer Mensch, wie Henrik es geworden wäre. Und ich – ich war bei jeder Aufführung dabei, auch wenn sie bis elf Uhr dauerte und ich am nächsten Morgen wieder in die Schule musste. Müde war ich nie.
»Du bist eine Frau der Nacht«, hatte Danjiro mir mal gesagt. Und das stimmte; ich schlief so leicht und unruhig wie ein Vogel. Es gibt nicht viele Menschen, die mit wenig Schlaf auskommen. Vier oder fünf Stunden Nachtruhe genügten mir schon als Kind. »Du wirst früh altern«, sagte Inger, was wiederum falsch war. Jetzt, mit achtundzwanzig, sehe ich immer noch zehn Jahre jünger aus. Ich entsinne mich, wie ich bei einer Probe zu der »Zauberflöte« einen Moment wunderbaren Staunens erlebte. Das war übrigens kurz nach Henriks Tod. Ich muss dreizehn Jahre alt gewesen sein. Ich kam in dem Augenblick, als die Königin der Nacht ihre Arie sang. Gerade als ich den Hinterbühnenraum betrat, spielte das Orchester die ersten Akkorde. Sänger, Statisten und Techniker standen dicht gedrängt in den Kulissen und hielten den Blick auf die Bühne gerichtet. Alle machten einen gespannten, erregten Eindruck. Das war, erklärte mir Juhani später, weil sich Lina, die Sopranistin, eine Angina zugezogen hatte und eine andere Sängerin ihre Partie aus dem Stegreif übernehmen musste. »Zwei Tage vor der Premiere, stell dir das mal vor, Agneta!« Mein Vater konnte sich gut umstellen, aber die anderen wurden fast verrückt.
Ich war – ich sagte es bereits – ein ruhiges Kind. Vorsichtig drückte ich mit der Hand die Ellbogen zweier Statisten auseinander, entschuldigte mich leise und kam näher. Da war sie, die Bühne, in blaues Licht getaucht. Dieses Blau war durchsichtig wie Diamantenstaub. Auf halber Höhe schwebte eine Mondsichel, Schleierwolken zogen vorbei. Die Umrisse der Sängerin, zuerst kaum zu erkennen, gewannen zunehmend an Form. Ich sah, dass sie zwei Gesichter hatte. Ihr Kopfschmuck aus Pappmaschee war nach ihren eigenen Zügen geformt, sodass das Gesicht oben dem unteren vollkommen entsprach. Beide Gesichter waren gleich zurecht gemacht, die Augen schwarz umrandet, die Brauen gewölbt und nachgezogen, der Mund gerötet. Auf ihrem Falbelnkleid mit dem engen Schnürleib glitzerten kristallene Tropfen, und um die ausgestreckten Arme ringelten sich Schlangen. Sie sang, und es war, als ob blitzende Sternschnuppen die Erde berührten. Ein magnetischer Strom, mit Silberflammen durchwoben. Ein Naturereignis.
Ich hatte bisher geglaubt, es könnte auf der Bühne nur das geben, was dargestellt wurde. Nun aber bemerkte ich, dass es dort von unbekannten, unsichtbaren Wesen wimmelte. Unzählige Geschöpfe jeglicher Art vollführten hier einen Reigen. Geburt, Leben, Liebe, Schmerz und Tod, alles war in einem großen Gefühl vereint. Ich hatte das Bedürfnis zu lachen, zu weinen, mich auf dem Boden zu wälzen oder sogar zu schreien. Doch ich tat nichts dergleichen, sondern stand ganz still, atmete entspannt, und in meinem Kopf bewegte sich das Universum. Es gibt Momente im Leben, die über die Zukunft entscheiden. Noch wusste ich nicht, dass in mir ein geheimes Signal begonnen hatte, zu pulsieren. In der Pause, die gleich darauf folgte, versammelten sich die Mitwirkenden hinter der Bühne. Alle sahen sehr erleichtert aus, lachten und schwatzten. Tassen und Löffel klapperten, es roch gut nach Kaffee. Die Sänger, noch in ihren Kostümen, umringten mich wie Märchengestalten. Bald kamen auch die Mitglieder des Orchesters und drängten sich um die Kaffeemaschine. Da trat die Königin der Nacht aus den Kulissen, glücklich und mit Beifall begrüßt. Ihre Falbeln raschelten bei jedem Schritt. Man nahm ihr den Kopfschmuck ab und reichte ihr das gewünschte Glas Wasser. Als die Garderobenfrau ihr den golddurchwirkten Gürtel löste, sog sie erleichtert die Luft ein und lachte. Mein Vater ging zu ihr, sie wechselten ein paar Worte, bevor die Sängerin in ihrer Garderobe verschwand. Nach einer Viertelstunde war sie wieder da. Ihr Gesicht war ungeschminkt, sie trug Jeans und dazu einen Ringelpulli. Kein Fabelwesen mehr, nur eine junge Frau, die sich einen Kaffee holte und hungrig in ein Sandwich biss. Und von einem Atemzug zum anderen begriff ich, dass sich Künstler ihre Rolle aneignen mit dem Kostüm, das sie tragen. Eine Besitznahme, gewissermaßen: Sie reißen eine Herrschaft an sich, die Herrschaft über ein Phantasiewesen, das sie lebendig machen. Es ist ein schöpferischer Akt.
Später, als wir radelnd den Heimweg antraten, sagte mein Vater in zufriedenem Ton:
»Zugegeben, die Sache war heikel. Aber ich wusste, dass Soon es schaffen würde. Ich habe längst bemerkt, dass ihre Stimme etwas hat.«
»Soon?«
»Ihre Mutter ist Koreanerin. Eine sehr begabte Frau, die ihre Tochter selbst unterrichtete. Ihr Vater spielt im Orchester Cello. Für eine junge Sängerin ist es eine unglaublich wichtige Erfahrung, wenn sie mit einem Mal sieht, welche Möglichkeiten in ihr stecken.«
»Ich mag ihr Kostüm sehr.«
»Die Kostümschneiderin nahm sich die kretischen Statuen zur Vorlage. Du weißt doch, die Schlangengöttin. Soon hat das richtige Gesicht dazu.«
Der kalte Abendwind fuhr uns in die Lungen, und wir sprachen nicht mehr. Doch ich dachte über Juhanis Worte nach. Und später, beim Abendessen, fragte ich ihn, wie weit Soons Aufmachung wohl dazu beigetragen hatte, dass sie so gut sang.
»Ach, Unsinn!«, warf meine Mutter ein. »Man hat eine gute Stimme oder man hat sie nicht. Das Kostüm tut nichts zur Sache.«
Juhani widersprach. Seine sanfte Art hatte stets bewirkt, dass Inger seine Argumente zumindest zur Kenntnis nahm.
»Den Standpunkt teile ich nicht. Sänger empfinden ihr Kostüm wie die Musik, als Impuls. Wenn sie ihr Kostüm so tragen wie eine zweite Haut, wird jede Geste, jeder Bewegungsablauf zum Kunstwerk. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Darstellung und Gesang.«
Ich nickte Juhani zu, langsam und mit großem Nachdruck. Doch, ich hatte verstanden. Inger spürte, wie sooft, dass sie nicht dazugehörte. Das verletzte sie auf eine stumme, heftige Art. Henrik konnte so was nicht passieren. Seine lustige kleine Grimasse, sein zweifelndes Achselzucken, hätten jetzt auf Ingers Lippen ein Lächeln gezaubert. Eine Sache, die ich nicht fertig brachte. Und so stand Inger auf, legte mit bockigem Ausdruck die Teller ineinander.
»Na ja, Kleider machen Leute«, sagte sie trocken, womit das Gespräch beendet war.
In meinem Zimmer stand Henriks Bild in einem kleinen Messingrahmen auf der Kommode. An jenem Abend nahm ich es in die Hände, um es im Lampenlicht zu betrachten. Ein feingliedriger Halbwüchsiger, mit grünen, glasklaren Augen. Ich wusste, wie man das manchmal weiß, dass er ein großer Künstler geworden wäre. Schon als kleiner Junge übte Großvaters Geige, die meistens verschlossen in ihrem Kasten lag, eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus. Natürlich war diese Geige zu groß für ihn. Als Henrik sieben Jahre alt war, schenkte ihm mein Vater eine kleine Violine, eine Viertelgeige, wie sie genannt wurde. Henrik konnte keine Noten lesen, strich jedoch begeistert und stundenlang mit dem Bogen über die Saiten. Mein Vater hatte ihm gezeigt, wie er die Geige stimmen musste. Und schon bald gelang es ihm, alle Lieder, die er kannte, mit vielen Variationen zu spielen. Und sogar selbst erfundene Melodien aus dem Stegreif. Er hatte großen Spaß dabei. Meine Eltern beschlossen, sein Talent zu fördern, und schickten ihn zu einer Violinistin, die viele Jahre lang im Orchester gespielt hatte. Diese Lehrerin war schon ziemlich alt, aber sie gab Henrik Stunden, weil die Musik noch immer ihr Lebensziel war. Mit elf spielte Henrik bereits auf einer Dreiviertelgeige, aber in der Schule machte er die Lehrerin nervös, weil er nicht gerne auf dem Stuhl saß. Er rutschte hin und her, stand immer wieder auf, wollte den Boden unter den Füßen spüren. Hochsensibel, wie er war, schien es ihm jedoch an Verstand zu fehlen. Als Vierjähriger, am Bahnhof, warnte ihn Inger vor dem heranfahrenden Zug. »Nicht so nahe, Henrik! Du könntest den Arm verlieren.«
»Wächst der nicht nach?«, hatte der Junge gefragt.
So war er eben. Irgendwie da und nicht da. Er lebte in einer eigenen Welt. Und alles, was ihn nicht interessierte, nahm er nicht wahr. Ich habe nie gewusst, ob meine Mutter glücklich war, diese zwei Kinder zu haben. Obwohl sie in unserer Erziehung salopp war, konnte sie bisweilen hart sein. Als sie mich zum ersten Mal zum Kindergarten brachte, kam ich schreiend hinter ihr hergerannt, krallte mich an ihr fest und flehte sie an, nicht wegzugehen. Ich ließ mich nicht trösten, bis sie mein lautes Gejammer satt hatte, mich mit energischem Griff von sich stieß und sagte: »Wenn du nicht sofort still bist, verbringst du die Nacht hier und schläfst auf der Toilette!«
Ich hatte Danjiro erzählt, dass ich ein hässliches Kind war, was er nicht glauben konnte, auch nicht, als ich ihm alte Fotos zeigte.
»Hässlich? Du? Das kann nicht sein.«
Doch, auf frühen Bildern sehe ich hässlich aus. Eine Art Spinnenmädchen, magersüchtig, mit überlangen Armen und Beinen. In den Phasen unseres Erwachsenwerdens wechselt unser Antlitz: die Augen werden größer, die Wangen breiter, die Lippen voller und weicher. Ich konnte auf den Fotos die Veränderungen verfolgen. Und die Leute, die mich mit neun oder zehn gekannt hatten, waren beeindruckt, als sie mich als Siebzehnjährige auf den Titelblättern der Modezeitungen sahen. Ich sagte ihnen, es läge nur an der Schminke, dass ich plötzlich so gut aussähe.
Ein Jahr zuvor hatte ich meine Freundin Eva zu einer Agentur begleitet. Eva, in die ich verliebt war. Wir rauchten abwechselnd die gleiche Zigarette, umarmten und küssten uns in meinem oder ihrem Zimmer; ich war berauscht von ihrem Duft, dieser zarte Duft nach sauberer Haut und frisch gewaschenem Haar. Eva wollte Topmodel werden, sie war so strahlend, so makellos. Ich dachte, keine ist geeigneter als sie. Ich war neidlos, ohne Hintergedanken, als sei sie ein Stück von mir. Ja, und in der Agentur lief uns ein Fotograf über den Weg, ein berühmter, wie sich später herausstellte, ein Fotograf, der Evas süßes Gesicht langweilig und mein hässliches interessant fand.
Er gab mir seine Karte. Ob ich mal in sein Atelier kommen würde? Er wollte Probeaufnahmen von mir machen. Ich war wie gelähmt, brachte den Mund nicht auf. Eva, fröhlich und scheinbar unbefangen, antwortete für mich. Doch, selbstverständlich! Wann es ihm passen würde? Und am Tag des Shootings föhnte sie ihr fülliges Haar, trug blauen Lidschatten und blassrosa Lippenstift auf. Der Fotograf musste doch sehen, wie anmutig sie war! Und tatsächlich machte er eine Reihe Aufnahmen von Eva, die ihr Haar fliegen ließ und wie die Mädchen in den Illustrierten einen Kussmund andeutete. Eva hatte ihre Sache gut geübt, doch der Fotograf wollte unbedingt auch mich fotografieren. Ich kam mir linkisch und steif vor, er musste mir immer wieder vormachen, wie ich mich vor einer Kamera zu bewegen hatte. Und dann schloss er sich in seinem Labor ein, betrachtete unter der kleinen orangefarbenen Lampe die Gesichter, die auf dem Papier im Säurebad Form annahmen. Denn was sind Gesichter anders als Träume, die sich im Lichtfeld verdichten? Der Kosmos in unserem Kopf umfasst mehr Nervenzellen als die Milchstraße Sterne. Der Fotograf erkannte seine Träume in meinem Gesicht. Eva verlor endgültig ihre Chancen, reagierte beleidigt und bitterböse. Unsere Freundschaft ging deswegen nicht in die Brüche, verlor sich aber nach und nach, wie Spuren im Schnee. Eva machte eine Banklehre, und mein Leben nahm einen anderen Rhythmus an. Ich blickte in die Kamera, verschlossen und leicht verstört, stolperte auf hohen Absätzen über den Laufsteg, bewegte mich schlaksig wie ein Junge, und man fand es entzückend. Ich gewöhnte mich daran, mich den wissenden Händen der Visagisten zu überlassen, beobachtete im Spiegel, wie sich mein Gesicht verwandelte. Ein Gesicht, im Sekundenbruchteil aufgenommen, im Labor wiederentstanden, mag die Ursprünglichkeit unseres Wesens nackter und unverfälschter als der nackte Körper zeigen. Und bisweilen im Studio, wenn der Blitz in grellweißem Licht zuckte, trat auf meinem Gesicht ein fremdes, nicht vollkommen menschliches vielleicht, in Erscheinung. Die Augen, die Nase, der Mund, wurden breiter und flacher, wie bei einem Tier. Das war keine Sache, die ich mir einbildete; auf einigen Fotos war es deutlich zu erkennen.
Vier Jahre lang arbeitete ich als Model und verpasste das Abitur. Ich hatte einen Shootingtermin nach dem anderen, wurde berühmt, und meine Tagesgagen stiegen. Plötzlich so viel Geld zu verdienen, von Fotografen umworben zu werden, die Reisen, die Partys und First-Class-Flüge – das kann einem jungen Mädchen schon zu Kopf steigen. In einem Alter, in dem andere die Schulbank drückten, sah ich die Welt. Ich sah sie bruchstückweise, eine wirre Abfolge von Bildern, lose aneinander gereiht. Paris, Mailand, London, New York, Katmandu und Rajastan, die Malediven und Bali. Zunächst waren alle Dinge bunt und neu, aufregend und von künstlicher Fröhlichkeit; ein Leben in einem Spiegel, berauschend und vorüberziehend wie Träume, die nur mit ihren Konturen das Bewusstsein erreichen. Die Gedanken kamen später hinzu, ganz leise, ganz heimlich, bis sie sich aufdrängten und alles durcheinander brachten. War das dieselbe Welt, in der Krieg, Hunger und Elend herrschten, in der die Menschen einander alles Böse antaten, das sie erfinden konnten, in der sie für ihre Freiheit oder für das, was sie dafür hielten, so grausam und hartnäckig kämpften? Doch, sie war es. Was für eine Welt! Ich erlebte sie mit ungläubiger Verwunderung. Aber wo, um Himmels willen, war mein Platz auf dieser Welt?
Damals gab es Leute, die mich auf der Straße erkannten und mir eines meiner Fotos zum Signieren hinhielten. Solche Leute, die sich drängten und mich anblickten, beunruhigten mich. Henrik, wurde mir bewusst, hätte ähnlich reagiert. »Noli me tangere«, das Gefühl kannte ich gut. Nicht, dass ich sie fürchtete. Aber ich wurde den Eindruck nicht los, dass sie nach etwas anderem Ausschau hielten als nach mir. Nach diesem Gesicht vielleicht, das nur auf den Bildern sichtbar wurde, mein Phantomgesicht? In dieser Zeit schlief ich mal mit diesem, mal mit jenem. Präservative waren nicht immer dabei. Wer jung ist, denkt nicht an Gefahren. Ich wurde von Männern mit klingenden Namen angebaggert und sagte nicht immer Nein. Ich hatte Glück – ich hätte Pech haben können. Es waren merkwürdige Jahre, nicht so sehr, was die äußeren Ereignisse betraf, sondern in der Art, wie ich wählerisch war oder nicht. Im Grunde war es eine Zeit, zu chaotisch und reichhaltig für mein Denken, das noch Unterstützung brauchte. Aber es war gewiss besser, dass ich alles in einem Alter erlebte, in dem ich, neugierig und arglos, das Böse nicht wahrnahm und ihm auf diese Weise entging, obwohl ich trank, rauchte und Drogen nahm. Viele Models kifften. Eine Zeit lang war ich dafür bekannt, dass ich die besten Joints rollte. Aber ein Junkie wurde ich nie. Ich wollte bloß dazugehören. Doch nicht lange; bald spielte es für mich keine Rolle mehr, ob ich dazugehörte oder nicht.
Inzwischen legte Inger mein Geld gut an, kaufte eine Zweizimmer-Wohnung für mich in Helsinki und ein »Mökki«, ein hölzernes Sommerhaus, auf der Insel Seurasaari – in einer wunderbaren Lage in der gleichnamigen Bucht. Ein Notverkauf. Der Besitzer hatte sein Geld mit Spekulation gemacht und in ein paar Monaten wieder verloren. Das Haus, im Stil der Jahrhundertwende erbaut, war größer als üblich, mit Stromanschluss und Wasserversorgung, Sauna, Kaminofen und eigenem Bootssteg. Meine Mutter hatte Geld – zwei Jahresgagen von mir – und griff sofort zu. Das Haus lief auf meinen Namen. Für später, meinte Inger. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht.
Wie Recht sie hatte, erwies sich ein Jahr später, als ich beim Radfahren auf dem Glatteis ausrutschte. Ich fiel aufs Gesicht und schlug mir die Oberlippe auf. Die Wunde musste genäht werden. Zurück blieb eine Narbe, ein waagerechter roter Strich, der sich nicht wegschminken ließ.
Eine Narbe an der Oberlippe – eine Struktur mehr in meinem Gesicht. Aber mit den Shootingterminen war es aus. Mein Gesicht verschwand von den Titelbildern der Illustrierten. Und keiner fragte, was aus mir geworden war.
In meine Wohnung konnte ich nicht, die war vermietet. Und Seurasaari lag unter Eis und Schnee. Folglich wohnte ich wieder bei den Eltern, wachte eines Morgens in meinem Mädchenzimmer mit blauweißer Blümchentapete an den Wänden auf und hatte das Gefühl, sechs Jahre lang nur geträumt zu haben. Ich wandte den Blick Henriks Bild auf der Kommode zu und versuchte mich auf ihn zu konzentrieren. Das Bild wurde von der blassen Wintersonne direkt beleuchtet. Henrik sah mich an und schien zu blinzeln. Der Umriss seines Gesichtes, die weich gezogene Linie, die unter dem Haar begann, sich voller Anmut zum Kinn rundete, dieser leise Ablauf nur, zeigte mir deutlich und bewegend, dass er existiert hatte und auf unbegreifliche Weise ein Stück von mir war. Nach ein paar Atemzügen hob ich die Schultern, ein bisschen ratlos, ein bisschen trotzig, und ließ die Arme wieder sinken. Laut sprach ich zu ihm, wie ich das manchmal tat.
»Und was nun?«
Henrik antwortete, wenn es ihm passte. Diesmal lächelte er in seiner herablassenden Art. »Du bist ein albernes Ding«, schien er zu sagen. Und das war alles.
»Tu nicht so«, sagte ich, »du bist jünger als ich.«
Henrik wusste genau, wie dreckig es mir ging. Doch das kümmerte ihn wenig. Er zeigte sein verdammt verführerisches Lächeln und blieb stumm. Die Antwort kam etwas später, von Inger.
»Jetzt holst du zuerst mal dein Abitur nach.«
2. Kapitel
Also ging ich wieder zur Schule. Inzwischen hatte ich die Welt gesehen, meine Mitschüler kamen mir kleinkariert und unwissend vor. Irgendwie genierte ich mich zu sagen, wer ich war; mein send vor. Irgendwie genierte ich mich zu sagen, wer ich war; mein ungeschminktes Gesicht sah ja so anders aus. Immerhin hatte ich von Inger eine große Beharrlichkeit geerbt und schaffte das Abitur ohne besondere Mühe. Danach folgte eine Zeit, in der ich mich treiben ließ. Ich hatte einen Freund, Arno, mit dem ich nach Seurasaari fuhr. Zuerst mit dem Wagen, dann mit der Fähre. Arno hatte sein Ingenieurstudium fallen lassen, spielte Schlagzeug in einer Rockgruppe. Er hatte ein hübsches Gesicht, einen durchtrainierten, glatten Körper. Er konnte sehr fröhlich und witzig sein; ich glaubte, dass ich ihn liebte. Doch er trank – auch sein Vater war Trinker gewesen. Ich leistete ihm dabei wenig Gesellschaft. Meine Erfahrungen hatte ich längst gemacht. Alkohol vertrug ich nur in kleinen Mengen, und von Drogen hielt ich mich fern. Immerhin wurde es ein turbulenter Sommer. Arno brachte seine Kumpels nach Seurasaari, und die Kumpels brachten ihre Freundinnen mit. Die Musik war so laut, dass ich mein eigenes Wort nicht verstand. Die Kumpels betranken sich auf meine Kosten, machten gelegentlich Stunk, und die Mädchen kreischten. Die Kumpels kotzten im Badezimmer oder auch im Garten. Ich verlor die Geduld, denn Ordnung war mir wichtig. Jede Sache an ihren Platz, jede Vase da, wo sie hingehörte. Klamauk beunruhigte mich. Arno verstand das nicht. Bierbüchsen lagen herum, Kleidungsstücke waren achtlos hingeworfen. Arno lachte mich aus, wenn ich seine zusammengeknüllten Pullis faltete, seine T-Shirts mit der Hand wusch und bügelte. Er lachte mich aus, wenn ich wütend wurde, weil er meine schön polierten Holzböden mit Schuhen betrat. Das Trinken machte ihm einfach Spaß: »Mal so richtig abtauchen tut gut.« Arno verlor sich selbst dabei. Ein neuer Mensch kam zum Vorschein, aufbrausend, gewalttätig. Er riss mir die Kleider von Leib, schlug mich, forderte Analverkehr und verschiedene Perversionen. Einmal schlug er meinen Kopf gegen die Wand, bis ich bewusstlos wurde. Ich hatte Nasenbluten, ein blaues Auge und eine Gehirnerschütterung. Arno bat mich weinend um Verzeihung. Es sollte nicht wieder vorkommen, er schämte sich sehr. Aber ich ließ mich nicht umgarnen. Ich würde nie wissen, woran ich mit ihm war, jetzt nicht und niemals. Mein Instinkt sprach eine deutliche Sprache: »Gefahr!« Arno warf schmollend seine Sachen in den Rucksack und ging. Ich hasste es, wie sich die Tränen in meinen Augen anfühlten, auf meinem Kinn und meiner Hand. Weinend legte ich mich aufs Bett, rollte mich zusammen und schlief ein. Beim Aufwachen streckte ich die Hand aus, berührte die andere Hälfte meines Bettes, wo niemand mehr lag. Ich weinte noch ein paar Mal, während ich das Bett frisch überzog, den Staubsauger laufen ließ und das Haus pingelig aufräumte. Dann zog ich die Läden vor die Fenster, schaltete alle Lichter aus und verschloss sorgfältig die Tür hinter mir. Ich nahm die Fähre nach Helsinki. Es war noch Sommer, aber ich schmeckte schon Kühle in der Meeresluft. Meine Augen waren schwer und brannten, aber der frische Wind tat gut. Im Moment ging bei mir alles drunter und drüber, aber bei Inger fand ich wenig Mitleid.
»Du bist dreiundzwanzig und machst dich kaputt«, sagte sie mit einem Ton des Vorwurfs gegen diese Tochter, die so anders war. »Den Job, den du hattest, man sieht es ja, der war doch nicht gesund.«
Sie glaubte, dass ich meiner Zeit als Model nachtrauerte, und sie irrte sich. Irrte sich so weit, wie es einen Unterschied zwischen echtem Herzeleid und diffusem Kummer macht. Ja, ich hatte die Welt gesehen, aber kaum etwas verstanden. Alles, was ich fühlte und zu wissen glaubte, blieb schwebend und ungewiss. Was war es denn nun in Wirklichkeit?
»Such dir etwas, was dir wichtig ist, es gibt tausend Möglichkeiten«, hatte Inger an diesem Morgen leicht gereizt zu mir gesagt, bevor sie zu ihrem Büro fuhr, wo sie ihre Abteilung mit fester Hand leitete und niemals ein Risiko einging. Nicht einmal in ihrer Kleidung, dachte ich. Sie trug einen Hosenanzug und darüber einen eleganten Umhang, und doch lag etwas in ihrem Wesen, das nicht passte, und deshalb wirkte ihre Erscheinung so übertrieben steif. Bei gesellschaftlichen Anlässen war sie stets nervös und unsicher. Nie fühlte sie sich vollkommen behaglich, ohne jede Peinlichkeit. Ihre Vergangenheit konnte sie nicht abschütteln.
Sie ging also, und zurück blieben ungemachte Betten und schmutziges Frühstücksgeschirr. Mein Vater trank ruhig seinen Kaffee aus und rauchte seine erste Zigarette, bevor er mir half, Teller und Tassen in die Küche zu bringen.
»Nimm dir Zeit«, sagte er gütig. »Es eilt doch nicht.«
Doch, es eilte. Ich hatte zu viele Jahre verloren. Ich musste mein Leben neu erfinden.
Schon als kleines Mädchen malte ich mit Wasserfarben, hing die kindlichen Bilder an die Wand, alle akkurat im gleichen Abstand. Meine Blumen und Bäume und Tiere zeigten, wie der Schulpsychologe einst feststellte, einen ausgeprägten Sinn für Harmonie. Malen, gab es etwas Wunderbareres? Etwas sehen, es auf Papier wiederzugeben, um es immer wieder zu betrachten, das war es, was mich faszinierte. Ich entsann mich wieder jener Zeit, als ich aus einer kindlichen Begeisterung heraus nur um des Malens willen gemalt hatte. Diese Zeit war wie eine Boje in meiner Erinnerung. Und eines Tages begann ich wieder Aquarelle zu malen. Abstraktionen lagen mir nicht, meine Bilder waren real, zeigten alle Details, fast mikroskopisch genau. Meine Hand war nicht mehr so geübt wie früher, ich hatte auch nichts dazugelernt. Dennoch, in mir spürte ich eine tiefe Überzeugung. Ich hatte eine Begabung, so viel war klar. Es mochte sogar sein, dass sie Geld wert war.
Ich reichte meine Arbeitsmappe an der Hochschule für Gestaltung ein und wurde angenommen. Daneben besuchte ich Galerien und Museen, studierte die verschiedenen Kunstrichtungen, stellte Vergleiche an. Selten hingerissen, immer bewusst, meiner selbst bewusst. Gefällt dir, was du siehst? Spricht es dich an? Könntest du es ebenso gut oder besser machen?
Doch, es muss eine Verbindung zwischen Zufall und Einsicht bestehen, ein Augenblick der Achtsamkeit. Ich erlebte ihn an einem Nachmittag im September, als ich das Museum für angewandte Kunst betrat. Das Gebäude – ein ehemaliges Schulhaus – befand sich nur ein paar Straßen von unserer Wohnung entfernt. Nach der Sommerpause hatte die Zeit der Spezialausstellungen begonnen. Sie waren stets wunderbar in Szene gesetzt, und ich war sehr neugierig. Als Auftakt präsentierte eine Modedesignerin, die gerade den finnischen Nationalpreis erhalten hatte, ihre Kreationen. Ritva Salonens Mäntel, Kleider und Jacken wurden an einfachen Holzpuppen gezeigt. Mode in schlichter, erlesener Form, von perfekter Eleganz und gleichzeitig so logisch und schnörkellos, dass man sie nicht nur eine Saison, sondern jahrelang tragen konnte. Eine Mode, die dem Wort Mode eigentlich widersprach, weil sie in ihrer Aussage so zeitlos war. Als Model hatte ich von Stoffen eine Ahnung bekommen; entzückt betrachtete ich die robuste Rohseide, die mit jedem Waschen weicher und anschmiegsamer wurde, die elastischen Mikrofasern, die sich der Körpertemperatur anpassten und für jedes Wetter geeignet waren. Und die Farben! Purpur, Saphirblau, ein tiefes Orange, ein Grau, das fast lila schimmerte, ein wundervolles Zitronengelb. Farben, die das Wechselspiel der Falten und des eingefangenen Lichtes aufglänzen ließen. Dunkle, warme Farben, die niemals aufdringlich wirkten, die sich je nach Accessoires auf dem Wochenmarkt ebenso wie im Theatersaal tragen ließen.
Ich stand vor diesen Kleidern mit einem merkwürdigen Gefühl im Bauch. Sie waren auf ganz besondere Art Kunstwerke. Sich zu kleiden und zu schmücken ist für die Menschen ein ebenso starkes und ursprüngliches Bedürfnis wie Essen und Trinken. Was letztendlich daraus entsteht, mag kommerziell ausgewertet werden. Entspricht es jedoch einer Vision, ist es von Dauer, und wir sind bezaubert.
Finninnen sind geschickt im Umgang mit Nadel, Faden und Nähmaschine. Selten findet man in einem anderen Land so viele Stoffgeschäfte wie bei uns. Die Frauen lieben individuelle Kleidung; Zuschneiden und Nähen ist sogar Schulmädchen vertraut, auch wenn sie zumeist in Jeans und T-Shirt herumlaufen. In meinem Schrank hingen einige schöne Stücke. Als Model wurden uns oft Kleider überlassen; solche beispielsweise, die eine leichte Beschädigung hatten. Kreationen, die uns besonders gut standen, konnten wir gelegentlich zu einem Billigpreis haben, damit wir auch privat das Aushängeschild der Modeschöpfer blieben.
Aber ich besaß dazu noch etwas anderes: Ich besaß Lailas Nähetui, ein schweres, silbernes Kästchen, mit eingravierten Zopfbandornamenten, eine wunderschöne, antike Arbeit. Es enthielt eine kleine Schere, einen Behälter für die Seidenzwirne und verschiedene Nadeln, die ebenso für die Stickerei mit feinen Metalldrähtchen wie für das Zusammennähen von Pelzen oder Rentierhäuten zu gebrauchen waren. Die samischen Frauen tragen diesen kostbaren Gegenstand an einer Kette um den Hals. Er vererbt sich von der Mutter auf die Tochter – oder, wie bei mir -, von der Großmutter auf die Enkelin. Ich war sehr bewegt gewesen, als Laila mir das Etui gab.
»Aber warum denn, Großmutter? Du brauchst es doch noch!«
Sie hatte in ihrer brummigen Art den Kopf geschüttelt.
»Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin alt, und meine Augen werden schlecht.«
Und später, nach Henriks Tod, hatte sie mir noch ein zweites Geschenk gemacht. Aber das war eine Sache zwischen Laila und mir, und sie hing mit Henrik zusammen. Inger hatte ich nichts davon erzählt. Es hätte sie nur beunruhigt.
Und nun, während ich Ritva Salonens Kreationen betrachtete, spürte ich meine Erregung wachsen. Solche Dinge zu machen, wie schön! Kleider zu entwerfen, die andere kauften, die ich auf der Straße wiedererkannte. Mir zu sagen, diese Jacke, dieser Mantel, die stammen von dir, was musste das für ein Gefühl sein? Doch wie fing man damit an? Ich fühlte mich ratlos und verwirrt. Aber dieser Ratlosigkeit wollte ich nicht ausweichen; jeder Beruf beginnt schließlich so. Also kaufte ich mir einen Zeichenblock, verschiedene Buntstifte, und machte mich an die Arbeit. Sinn für Proportionen und Perspektive hatte ich immer gehabt. Ich zeichnete, strich wieder durch, versuchte meine Vorstellungen aufs Papier zu bringen. Die Zeit verging, nichts klappte. In einem Augenblick besonders gedrückter Stimmung hörte ich ein Musikstück im Radio. Es war, ich erinnere mich ganz genau, »De l’aube à midi sur la mer« von Debussy. Irgendwie ließ ich mich von der Musik tragen, und plötzlich konnte ich besser zeichnen. Das geschah ganz unwillkürlich, und ich vergaß alles um mich herum. Eine halbe Stunde lang zeichnete ich ganz versunken und ohne zu wissen, was und warum ich das tat. Und als ich endlich vom Zeichenblock aufblickte, wurde mir klar, dass ich nichts anderes als Ritva-Salonen-Modelle gezeichnet hatte, die Kleidungsstücke, die sich noch so klar in meiner Erinnerung zeigten. Ich erschrak über mich selbst, kam mir vor wie ein Baby, das im Imitationsreflex die ersten Worte lallt, die seine Eltern ihm vorsagen. Wütend zerknüllte ich die Skizzen, warf sie in den Papierkorb. Wie dumm und naiv von mir, zu denken, ich könnte etwas Eigenes zutage fördern, eine kreative Arbeit ohne Vorbereitung sozusagen, was für eine Überheblichkeit! Ich hob die Augen, wie so oft, zu Henriks Bild. »Zu schade«, seufzte ich, »zu schade! Ich dachte wirklich, ich könne es schaffen. Ich bin wahrscheinlich nicht begabt.«
Henrik geruhte zu antworten. In seinem Blick glitzerte sogar eine gewisse spöttische Frechheit.
»Spielt das eine Rolle?«
»Wahrscheinlich nicht. Glaube ich wenigstens.«
Henriks Geige war nicht verstummt; der Klang hing in der Luft, als ob ihn mein Denken immer wieder neu hervorbrachte. Jedes Molekül wartete auf die Musik. Früher hatte er dann und wann sein Instrument als Trommel benutzt, indem er mit den Fingern auf den Resonanzboden klopfte. Das tat er auch jetzt, zumindest war es mir so, wobei es vielleicht nur mein unruhig pochendes Herz war.
»Mach dir keine Gedanken«, sagte Henrik. »Du wirst es schon rauskriegen.«
Und es bestand kein Zweifel, manche Dinge wusste er besser als ich. Und nicht nur das, er gab mir Mut. Ich war fest entschlossen, nicht aufzugeben. Worauf beruhte diese plötzliche, unwiderstehliche Gewissheit? Wo ich mich doch zunehmend hilfloser fühlte? Es war eine Art absurde Tapferkeit, dass ich mich in eine Sache vertiefte, die mir vielleicht nie Befriedigung geben würde. Und doch wollte ich weitermachen, wollte es um jeden Preis, mit einer Ahnung von Dingen, die eintreten würden. Ein Weg lag vor mir, den ich zu gehen hatte, obwohl ich nicht wusste, wohin er führte. Und ich dachte, dass Henrik mal wieder recht hatte, dass ich es früher oder später wohl erkennen würde.
3. Kapitel
In dieser Zeit dachte ich viel an meine Großmutter. Von Laila gab es kein Bild. Sie wollte sich nie fotografieren lassen. Aber das machte nichts. In meiner Erinnerung sah ich eine alte Frau, mit mandelförmigen Augen, die nicht schwarz, sondern dunkelblau waren, wie die von Säuglingen. Ihr runzeliges Gesicht unter dem kurz geschnittenen Haar gab diesen Augen eine ungewöhnliche Beweglichkeit. Laila war kaum zur Schule gegangen und brummte kopfschüttelnd vor sich hin, dass sie alles längst verlernt hätte. Es gab wichtigere Dinge im Leben, meinte sie. Henrik und ich waren natürlich hingerissen. Eine Erwachsene, die unbefangen zugab, dass sie weder lesen noch schreiben konnte und es auch nicht nötig hatte, imponierte uns! Wir freuten uns auf die Sommerferien bei ihr, wir konnten es kaum erwarten. Kinder haben noch denselben Instinkt wie die Urmenschen, sie eignen sich die Umwelt nicht mit ihrem Verstand, sondern mit ihren Sinnen, mit ihrem Fleisch und Blut an. Wir spürten, dass Laila noch etwas von diesem Instinkt besaß, deswegen waren wir so glücklich bei ihr.
Laila war nicht groß, sie wirkte aber so, weil sie drahtig und muskulös war. Ihre Hände waren lang und schmal, die Knöchel traten deutlich hervor. Für gewöhnlich trug sie ausgebeulte Kordhosen und je nach Wetter Gummistiefel oder Sandalen aus gegerbtem Leder. Ihre Fingernägel waren schwarz, ihre T-Shirts immer mit Öl oder Farbe verschmiert. Die Mückenstiche, die uns plagten, spürte sie nicht einmal. Was uns besonders gefiel, war, dass sie Pfeife rauchte und sie beim Reden zwischen die Zähne klemmte wie ein Mann. In Helsinki, wo sie uns dann und wann besuchte, trug sie geschmacklose Kleider aus dem Warenhaus, klobige Schuhe und Strumpfhosen, die gelegentlich Laufmaschen zeigten. Als einzige Koketterie knotete sie ein buntes Tuch in ihr schiefergraues Haar, was – zu Ingers Verzweiflung – ihr ländliches Aussehen noch betonte. Sie schämte sich, mit Laila in dieser Aufmachung von den Nachbarn gesehen zu werden, kaufte ihr solide, aber teure Schuhe, eine modische Handtasche, gelegentlich eine Jacke, die nach »was Besserem« aussah. Laila bedankte sich freundlich und trug die Sachen mit Gleichgültigkeit. Kleider waren ihr schnurzegal. Oder doch nicht? Ich entsann mich an ihre Festtracht aus handgewebtem Wollstoff, mit breiten Borten in kräftigen Farben. Sie trug dazu einen Fransenschal aus Seidengarn, und darüber den aufwändigsten Silberschmuck, den ich je gesehen hatte. Prachtvolle Spangen, schwere Ketten und tellergroße Broschen aus Filigran, die in der Sonne blendeten und blitzten. Der Schmuck war alt, Laila hatte ihn von der Großmutter. Auch an ihrem Gürtel hingen Silberplättchen, wunderschön in Form von Glöckchen gearbeitet, die bei jeder Bewegung klingelten. Eine reich bestickte Haube vervollständigte die Tracht. Ich habe noch Lailas Bild vor Augen, wie sie ihren »Akja«, den von Rentieren gezogenen Schlitten, peitschenschwingend durch den hohen Schnee jagte. Zwar hatte der Schneescooter längst den urtümlichen Schlitten ersetzt, der nur bei Feierlichkeiten hervorgeholt wurde. Und doch, wie selbstbewusst und stolz vermochte Laila ihr Gespann zu lenken, mit wie viel Kraft hielt sie die Zügel! In jüngeren Jahren hatte sie furchtlos den »Porokämpää« betreten, den großen Pferch, in dem die Besitzer ihre Tiere mit einem Seil einfingen und von der Herde trennten. Die Eigentümer erkannten ihr Tier an einer kleinen Ohrkerbe, die sie bei dieser Gelegenheit anbrachten. Das erforderte viel Kraft. Die jungen Tiere rasten im Pferch herum, stießen mit den Hörnern, schlugen aus, verdrehten die Augen. Laila nahm den Kampf mit ihnen auf, nicht brutal oder verkrampft, sondern locker, fast schwerelos auf die Bewegung der Tiere konzentriert – so wie die Spinne ihren Faden webt.
In ihrer Jugend war Laila sehr schön gewesen. Ihr Haar war blauschwarz, eine Seltenheit bei den Samen, ihr Gesicht wunderbar voll. »Wie die Sonne im Frühnebel«, schwärmte mein Großvater noch mit siebzig, was Laila, in Verlegenheit gebracht, mit Entschiedenheit bestritt.
»Da, sieh mich doch an, Alter. Wie ein vertrockneter Hering wäre passender!«
Ihr Leben hatte eine traurige Wende genommen, als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg Lappland besetzten und jedes Dorf, jedes Zelt systematisch zerstörten. Zum Glück konnte sich die Familie mit ihren Rentieren rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Samen waren Jäger und Fallensteller, für Kriege hatten sie nichts übrig. Wurde ihnen der Boden zu heiß, ergriffen sie die Flucht, wobei es ihnen gleich war, ob sie Häuser und Felder dem Feind überließen; das Wichtigste für sie waren ihre Rentiere. »Das Rentier ist das Kostbarste, was wir haben«, hatte uns Laila oft und mit Nachdruck erklärt. »Sein Fleisch liefert uns Nahrung, sein Fell und seine Haut wärmen uns, aus den Sehnen machten unsere Ahnen Fäden, aus den Knochen Werkzeuge, und aus dem Knochenmark Fett. Seine Hörner erneuern sich wie der Lebensbaum, der niemals verdorrt. Es gibt im Rentier nichts, was nicht für den Menschen verwendbar wäre. Das Rentier ist ein heiliges Tier. Wir schulden ihm großen Dank. Ihm zu Ehren gibt es ein Lied. Wir singen es zu Frühlingsbeginn:
›Wir rufen die Kinder, ihr Kinder wacht auf!
Wir sagen euch: Die Tiere sind wach!
Sie treten aus ihrem Winterschlaf.
Das Rentier führt sie aus dem Dunkel, der Sonne entgegen.
Der Frühling kommt!
Unsere Herzen freuen sich!‹
Laila wusste alles über das Rentier. Zum Beispiel auch, dass es stets seine Hinterhufe in die Spur seiner Vorderhufe setzt. »Das hat eine Bedeutung«, sagte Laila. »Das Rentier lehrt uns, den Spuren der Ahnen zu folgen, sie nicht zu verlassen. Und früher, ganz früher, nähten wir unsere Verstorbenen in Rentierhäute ein, und der Geist des Tieres geleitete die Verstorbenen in die oberen Weidegründe.«
»Wo liegen die oberen Weidegründe?«
Das hatte Henrik damals wissen wollen, und Laila hatte sich gewundert.
»Weißt du das denn nicht, Junge?«
Nein, er wusste es nicht. Laila hatte unzufrieden vor sich hin gebrummt. Ach, Inger sei wahrhaftig eine wenig umsichtige Mutter! Sie musste ihren Kindern doch erzählt haben, dass außerhalb dieser Welt eine zweite Welt bestand, eine Welt mit Flüssen, Wäldern und Meeren, die vier Jahreszeiten hatte wie die unsrige, ein Spiegelbild sozusagen. Es war die reine und gute Welt der Anfänge. Von dort aus konnten die Verstorbenen ihre frühere Welt genau sehen und hören. Aber keiner sehnte sich jemals zurück, denn in der Himmelswelt konnten die Tiere sprechen, und es gab weder Krankheit, Elend noch Hungersnot. Nein, nein, diese andere Welt war viel zu perfekt! So war es denn auch noch nie vorgekommen, dass jemand sie freiwillig verließ.
»Die Rentiere wissen noch darum«, sagte Laila. »Wir sehen diese Welt, wenn wir in ihre Augen blicken. Denn aus ihrem Kopf wurde einst das Gewölbe des Himmels erschaffen.«
Die mehr oder weniger improvisierten Sprechgesänge der Samen wurden »Joik« genannt. Sie konnten zwei Minuten oder mehrere Stunden dauern. Und niemand vermochte sie so gut vorzutragen wie Laila. Stets begann sie mit den Worten: »Ich mache jetzt einen Joik«, bevor sie sich im Takt ein wenig vor und zurück wiegte und ihre raue Stimme einen archaisch rhythmischen Tonfall anschlug. Sie begann in einem hohen, dann absteigenden Tonfall, bis ihr Atem verströmt war; dann begann sie wieder und wieder, eintönig, hartnäckig, leise. Geflüsterte Worte, die wie Gebete klangen und es vielleicht auch waren.
»So erzählen es die Väter,
So gaben sie es ihren Kindern weiter,
Damit sie auch ihren Kindern erzählen von der ersten, guten Zeit.«
Sie konnte auch Personen, die sie liebte oder ablehnte, im Gesang beschreiben. Das tat sie dann auf eine derart witzige, treffende Art, dass Henrik und ich Tränen lachten. Aber am meisten gefielen uns ihre Tiergeschichten. Laila wurde nie müde, uns von Wölfen zu erzählen, von Polarfüchsen, von Steinadlern und Singschwänen. Eine besondere Rolle spielte in ihren Erzählungen der Braunbär.
»Der Braunbär ist der Gott des Mondes«, sagte Laila, »weil er im Schnee seinen Winterschlaf hält und im Frühling zum Vorschein kommt.«
»Aber Großmutter, was hat das mit dem Mond zu tun?«, hatte Henrik gefragt, als er die Geschichte zum ersten Mal hörte. Laila hatte in einem Lächeln ihre starken, weißen Zähne entblößt.
»Denk doch nach, Kind! Wer fördert das Wachstum der Pflanzen? Und wer bewirkt die Blutungen der Frau, wenn nicht der Mond?« Ingers Moralempfinden gab ihr mehrmals Anlass, Laila Vorwürfe zu machen. Wir seien noch zu klein, meinte sie, um das zu hören. In solchen Dingen setzte sie eine Art Normalmaß voraus, eine lieblose, freudlose Aufklärung. Bei Laila gab es dergleichen nicht. Sie sprach von alldem ganz unbefangen.
»Lange bevor es die Menschen gab, wurde der Bär vom Mond erschaffen. Wir nennen ihn aber niemals Bär, das würde ihm nicht gefallen. Wir geben ihm ehrenvolle Namen: ›Der Weise‹ oder der ›Meister der Wälder‹. Am liebsten hat er, wenn wir ihn Großvater oder Großmutter nennen. In alten Zeiten, wenn das Volk der Samen zusammentraf und Rat hielt, wurden alle Beschlüsse mit der Hand auf einem Bärenschädel besiegelt. Das Sternbild des Bären nennen wir das Große Schiff, oder den Großen Wagen. Eigentlich ist das Sternbild das weibliche Zeichen der Weisheit. Aber im Wald müssen Frauen und Mädchen sehr vorsichtig sein, dass ihre Füße niemals die Fährte eines Bären kreuzen.«
Ach, was war denn dabei, dass ich das nicht durfte?
Sie hatte mir bedeutungsvoll zugenickt.
»Wir Frauen sind mächtige Wesen. Sehr mächtig. Aber unsere Kraft ist mit der Bärenkraft unvereinbar. Sie würde uns und unserer Familie Unglück bringen. Früher waren wir gute Jägerinnen, oh, ja, und ich war eine der Besten! Aber mit einem Bären konnte ich es nicht aufnehmen. Der Geist des Tieres hätte sich an meinen Kindern gerächt. Das wussten alle Männer. Und wenn sie einen Bären erlegt hatten, mussten sich die Frauen im Dorf verstecken.«
Henrik machte große Augen.
»Warum hatten sie denn solche Angst?«
»Weil die Jäger unrein waren, verstehst du? Sie hatten ein Tier getötet, das etwas Menschliches in sich hatte, einen Vorfahren. Sie suchten zuerst die Schwitzhütte auf, reinigten ihren Körper mit Wacholderdampf und sprachen besondere Gebete. Dann erst konnten sie zurück zu ihren Frauen gehen.«
Ach, warum schossen sie denn die Bären tot? Wenn das so eine schlimme Sache war, sollten sie doch damit aufhören!
Nomaden vom Nordkap sind nüchterne Realisten; Lailas Antwort fiel dementsprechend aus, mit jenem Hauch von Humor, der ihr eigen war.
»Der Bär gab Fleisch für viele Menschen, versteht ihr? Die Natur hat es so eingerichtet, dass wir Fleisch essen müssen, um im Winter zu überleben. Und der Bär, der unseren Jägern nicht entkommen konnte, nun, das war eben kein sehr schlauer Bär!« Jedes Jahr, noch als alte Frau, zog Laila mit ihrer Herde zu den Sommerweiden. Ich erinnerte mich an den Kreis der »Lavvo«, der großen Stangenzelte, den die Herde nachts mit seltsamen Geräuschen umschloss. Die Zelte aus Rentierhäuten waren so fest gebaut, dass sie Stürmen widerstanden. In der Mitte befand sich die Feuerstelle; darüber hing ein Kessel an einer großen Eisenstange. In diesem Kessel wurden sowohl der traditionelle Kaffee als auch Fleisch und Fisch zubereitet. Trotzdem war drinnen die Luft nie verraucht, weil am Zeltfirst eine Öffnung angebracht war, aus der der Rauch entwich. Und gleichzeitig verhinderte der Luftzug, dass Kälte, Regen und Schnee in das Zelt drangen, wo die Bewohner, in Felle und Decken gewickelt, auch schliefen. Im Zelt war nur das Nötigste vorhanden, aber Laila schleppte stets ihre alte Nähmaschine mit sich auf die Reise. Für uns Kinder brachte das Leben im Zelt jede Menge Aufregungen und Entdeckungen. Dann und wann fuhren wir mit Lailas Paddelboot auf den See Pyhäjärvi. An gewissen Stellen legte sie das Paddel vor sich; sie erklärte, während das Boot auf den leichten Wellen auf und nieder schaukelte, dass hier gutes Fischgebiet sei. Henrik saß gerne im Boot, aber von der Angelschnur wollte er nichts wissen. Er hatte ein seltsames Mitleid mit den Fischen, die gefangen und sozusagen lebend verzehrt wurden. Ich hingegen zeigte mich beim Auswerfen der Angelschnur aufmerksam und ausgesprochen geschickt.
»Du bist wie Reidar«, sagte Laila zufrieden. »Der Fischfang liegt dir im Blut!«
Ich war sieben, da geschah etwas Eigenartiges: Ich fing einen Fisch, der so groß war, dass ich ihn nur mit Lailas Hilfe aus dem Wasser ziehen konnte. Als der Fisch, wild um sich schlagend, im Boot lag, brach Henrik in lautes Wehklagen aus. »Grässlich ist das«, schrie er immer wieder unter Tränen, »ganz furchtbar grässlich!«
Laila sagte nichts. Aber später im Zelt, während sie den Fisch zubereitete, machte sie seltsame Zeichen über dessen Fleisch, murmelte einige Worte. Erst dann durften wir unsere Teller füllen. Ich hatte großen Hunger und tauchte sofort den Löffel in die Brühe. Doch Henrik, weiß im Gesicht, schüttelte nur stumm und verkrampft den Kopf. Laila nahm ihm sanft den Teller aus der Hand.
»Wenn du keinen Fisch magst, brauchst du ihn auch nicht zu essen.«
Tatsächlich war Henrik nie wohl auf dem Wasser. Der Geruch nach Netzen und Fischen, der Geschmack der brackigen Gischt, von alldem wurde ihm übel, so übel, dass er nur noch im Boot kauern mochte, beide Hände um die hölzerne Reling geklammert. Laila wollte auch nicht mehr, dass er mitkam. Der warnende sechste Sinn war so fein bei ihr wie bei einem Tier. Sie hatte bereits ein Zeichen empfangen.
Mich nannte Laila »Kleines Wiesel«, weil ich – wie sie sagte – wie das kleine Raubtier war, hell und schnell. Laila erzählte, dass man besonders schlauen, furchtlosen Mädchen diesen Namen gab. War ich furchtlos? Ich wusste es nicht, aber ich fühlte mich geschmeichelt. Henrik hingegen nannte sie »Hummelchen«, was ihm zunächst nicht unbedingt gefiel. Bis Laila ihm erklärte, dass die Hummel des Menschen Seele war, weil sie den Hügeln entgegenflog und ihre Nahrung aus Blumen bezog. Und die Blumen, Kinder der Sonnentochter und des Bärenmannes, schöpften ihre Kraft aus der heiligen Erde, in der die Ahnen bis zum Weltende ruhten. Finnisch war eine Sprache, die sie gut beherrschte; gleichwohl zog sie es vor, wenn immer möglich, ihre Gesänge in Samisch vorzutragen. Brocken der samischen Sprache hatten wir uns früh angeeignet, sodass es für uns nicht allzu schwer war, sie zu verstehen. Wir waren in dem Alter, in dem Kinder am empfänglichsten sind.
Es gab so viele Dinge, die Laila vertraut waren, die fließenden Grenzen zwischen der Oberen und der Unteren Welt, dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Heute und dem Einst. Die ausgeprägte Kosmogonie der Samen, vollendet wie die der alten Ägypter, zeigte eine eigene Lebensform, ein geschlossenes Ganzes. Laila erzählte von Jubmel, der die Welt erschuf, indem er mit dem Polarlicht eine Brücke zwischen Himmel und Erde baute. Von den »Stallo« – den »Stahlgekleideten« -, unselige Riesen, die sich manchmal in Menschen verwandelten. Die Stallo konnten sehr grausam sein, aber die schlauen Samen wussten sie stets zu überlisten. Laila erzählte auch von Mondtochter und Sonnentochter, die jagten und fischten und einander seit Ewigkeit listenreich bekämpften, ohne dass eine die andere zu besiegen vermochte. Diese Sage war es, die mir am besten gefiel. Henrik indessen hörte lieber von den Mjandas, den wilden Rentieren, die sich menschliche Frauen nahmen, und von ihren Kindern, den Mjandasgeschöpfen, geheimnisvolle Wesen, die ihre Zauberkräfte zum Wohl guter Menschen einsetzten. Und vom Trollmann Nischergurgje, der schon als ergrauter Mann voller Weisheit aus einer Schneewehe geboren wurde. Er war der erste »Noita« – Schamane – gewesen. Schamanen gäbe es heute nur noch ganz wenige, sagte Laila, und leider verkümmere ihr Können. Sie erzählte uns, wozu die Noiden früher fähig waren. Oh, sie vollbrachten Wunder! Dass Menschen zu Tieren und Tiere zu Menschen werden konnten, faszinierte Henrik ganz besonders. Laila hatte ihm Nischergurgjes Lied beigebracht. Henrik kannte viele Strophen daraus auswendig.
»Dich, Mensch, will ich lehren,
Die Trommelzeichen zu deuten
Und die Gestalt zu wechseln,
Wenn du willst, eine Schlange,
Ein Vogel oder ein Rentier zu werden.«
»Himmel!«, rief Inger, wenn sie ihn mit seiner dünnen Kinderstimme singen hörte. »Wie stellst du dir die Menschen von früher vor? Mit Rentiergeweihen, Flügeln oder Flossen?«
»Flossen, die hätte ich am liebsten«, hatte Henrik mal gesagt. »Ich hab’s versucht, aber es geht nicht.«
Inger war aufgefahren.
»Was hast du bloß wieder angestellt?«
»Nichts. Habe nur getaucht, wo es am tiefsten ist.«
»Wo denn, um Himmels willen?«
»Im Schwimmbad.«
»War der Lehrer dabei?«
»Weiß nicht. Wollte bloß probieren, wie das ist, wenn man Flossen hat.«
»Henrik, was machst du in der Bibelstunde? Schläfst du? Gott hat den Menschen nach seinem Angesicht erschaffen, merke dir das!« Inger, entrüstet und voller Abneigung, stieß ihre üblichen Vorwürfe aus. Dieser Aberglaube! War noch kein Fortschritt im Hohen Norden eingekehrt? Die christliche Religion sollte doch wohl, würde man meinen, Einzug bei den Samen gehalten haben. Feierten sie nicht Ostern und Pfingsten und Weihnachten? Ach, sie müsse schon sagen, die Großmutter litt zuweilen an mehr als nur an einer Erkältung des Kopfes! Henrik, durchaus nicht eingeschüchtert, wartete, bis sie mit ihrer Tirade zu Ende war, und stellte dann mit guter Logik die nächste Frage.
»Wie sah Gott denn aus?«
4. Kapitel
Laila war als jüngstes von vier Geschwistern in einer »Lavvo« geboren worden und hatte spät geheiratet. Mein Großvater Reidar stammte wie sie aus einer Familie von Rentierzüchtern. Seine Eltern waren kluge Leute und hatten ihn zur Schule geschickt, zu einer Zeit noch, da Samenkinder nicht selten vom Unterricht fern gehalten wurden. Reidar hatte es bis zur Hochschule geschafft und war Lehrer geworden, ein guter Lehrer, bevor er vor sechs Jahren infolge einer Grippe starb. Laila muss ihn sehr geliebt haben, denn ihr fülliges schwarzes Haar wurde innerhalb von einigen Monaten spärlich und grau.
Außer Inger hatte Laila noch zwei Söhne, Jens und Ivo. Der Tradition zufolge hatte die Familie zunächst bei Lailas Eltern gewohnt, bevor sie nach Kemijärvi, die nördlichste Stadt Finnlands, zog. Wer die Ortschaft besuchte, konnte kaum glauben, dass dort Halbnomaden lebten. Die Häuser aus Kiefernholz, mit robusten Schindeldächern, waren hellgelb oder weiß gestrichen, und die Fenster hatten schöne Gardinen. Vor den meisten Häusern befand sich ein umzäunter, gut gepflegter Garten. Im Haus waren die Böden aus poliertem Holz, und der große, gusseiserne Küchenofen ersetzte die »Arran«, die Feuerstelle im Zelt. Auch die Wasserpumpe war direkt in der Küche angebracht. Alles war peinlich sauber. Wenn Jens und Ivo auf dem Boden Holz schnitzten, erwartete man von ihnen, dass sie die Späne sorgfältig auffegten. Nicht einmal die Hunde durften mit nassen Pfoten die Zimmer betreten.
Seit Reidars Tod lebte Laila einsam in dem Haus, alleine mit ihren Gefährten, den Hirtenhunden. Für ihren Lebensunterhalt war gesorgt, ihre Söhne waren erwachsen, und außerdem hatte sie ja noch ihre Herde. Trotzdem saß sie unermüdlich vor dem Webstuhl, spann und webte die Wolle ihrer Schafe, machte daraus warme Decken, Schals und Kleiderstoffe. Im Sommer hockte sie oft am Straßenrand, wenn die Touristen vorbeifuhren, und bot ihre überschüssigen Weberzeugnisse feil. Stur hielt sie an dieser Gewohnheit fest, die Inger abstoßend fand. Daneben gehörte sie zu den zwanzig gewählten Vertretern des »Sameting« – dem Parlament der Samen, das alle vier Jahre in Nunannen zusammentrat und sich für die Erhaltung ihrer Kultur einsetzte. Laila zeigte dort viel Engagement und war wegen ihrer scharfen Zunge berüchtigt. Diese Mischung aus verschlagener Rentierzüchterin, Straßenverkäuferin und Grande Dame mochte es sein, die Inger so verunsicherte. In ihren Augen konnte man nicht gleichzeitig in heidnischer Steinzeit und im christlichen einundzwanzigsten Jahrhundert leben. Laila brachte das offenbar fertig, und zwar mühelos. Den Söhnen machte die Sache weniger zu schaffen. Beide Brüder sah Inger nur selten. Jens arbeitete auf einem norwegischen Schiffstanker, und Ivo machte im Holzgeschäft sein Geld, worüber Laila zunächst erbost gewesen war. »Du schadest der Erdmutter, indem du ihre Schätze raubst.« Sie versöhnte sich erst wieder mit ihm, als er mit Hella, seiner Freundin, eine Tochter gezeugt hatte. Eine Heirat war bei den Samen unwichtig; jede Geburt hingegen wurde mit Freude gefeiert.
Laila Tenojoki Njurgulati. Ich sah sie vor mir, ebenso deutlich, wie ich auch Henrik sah. Wir gehörten ja zusammen. Ihre Existenz verkörperte die Existenz aller Dinge auf der anderen Seite meines Lebens. In jedem einzelnen der Äonen, die meinen Körper bildeten, waren gleichsam ihr Ich und mein Ich. Die Erbmasse war durch die Eizelle im Leib meiner Mutter an mich weitergegeben worden. Lailas Blut war es, das in meinen Adern pulsierte. Sie war mein tiefer Ursprung, die Materie, aus der ich geschaffen war, der wirkende und fühlende Geist.
Inger ärgerte sich über ihre Mutter, die uns mit ihren Liedern und Märchen betörte. Es war ihr peinlich, von einem solchen Menschen abzustammen. Sie war in diesen Dingen zu keiner Objektivität fähig. Auch heute noch frage ich mich, welche große, innere Angst sie dazu brachte, ihre Herkunft zu verleugnen. Vielleicht suchte sie nur das gute Leben, und das war, glaubte sie, einer samischen Frau einfach nicht zugänglich. »Wie es war, als ich klein war?«, sagte sie zu mir, wenn ich danach fragte. »Ich weiß nicht mehr viel zu erzählen, es ist schon zu lange her. Ich sehe auch keinen Vorteil, wenn ich’s täte.« Einen Vorteil zu sehen oder nicht war nach wie vor für sie die Sache, auf die es ankam. Nicht einmal ihre Ehe mit Juhani hatte diese Einstellung ändern können. Und mein Vater, egozentrisch in seiner sanften Art, hatte wenig getan, um sie davon abzubringen. Da Ingers Zwiespalt nicht zu den Dingen gehörte, die ihn interessierten, kümmerte er sich auch nicht darum.