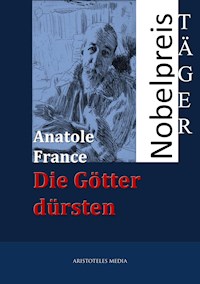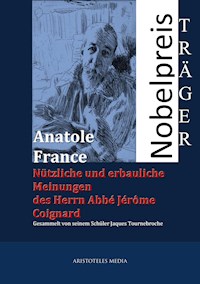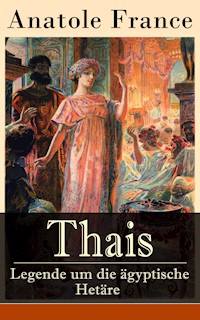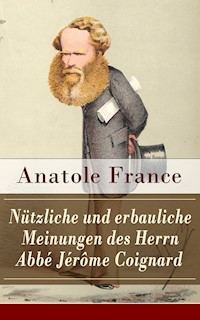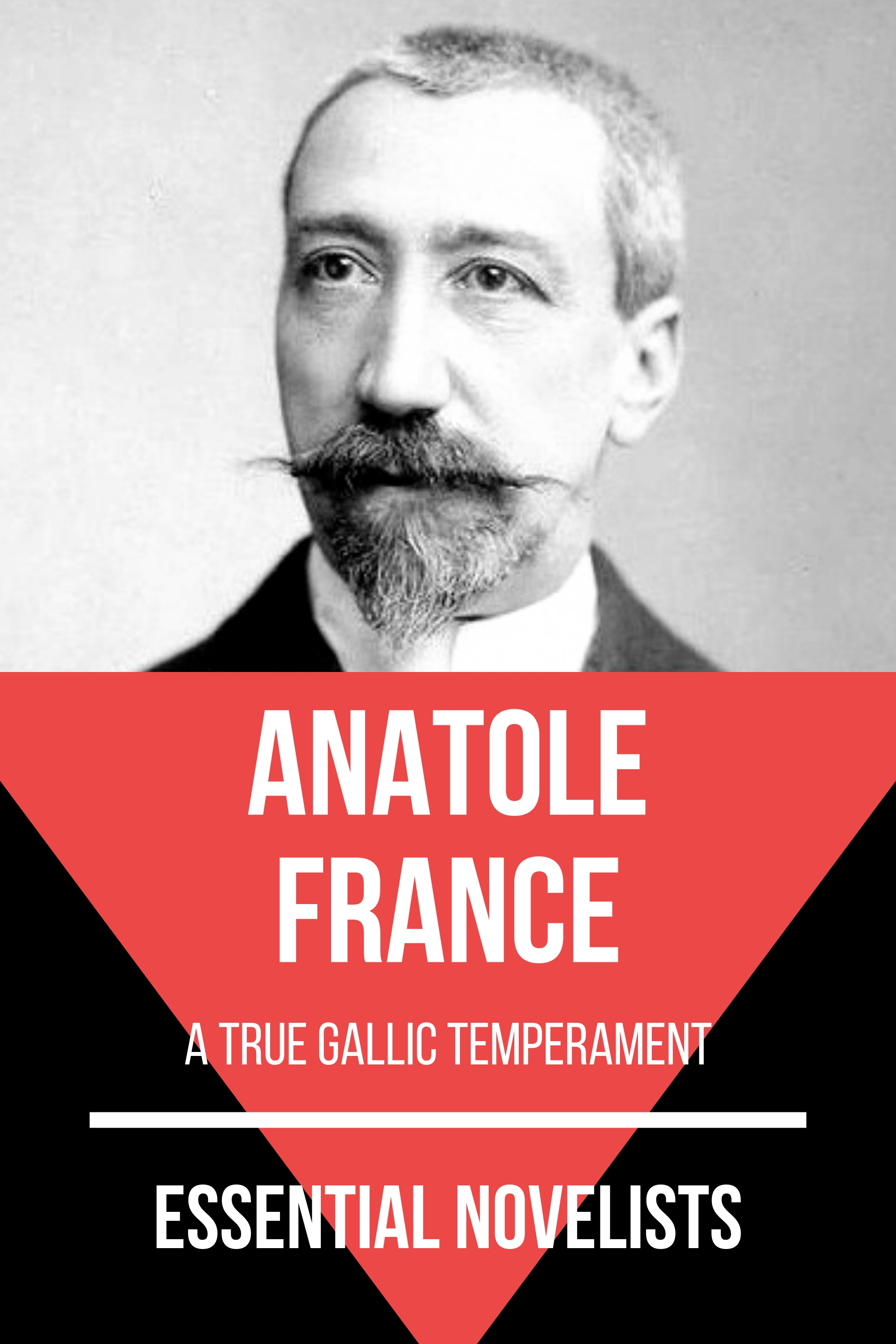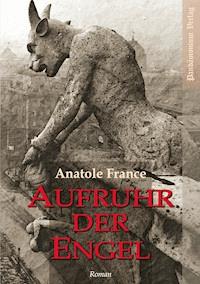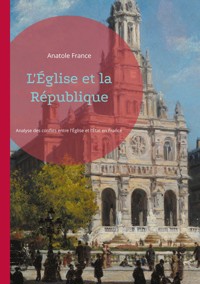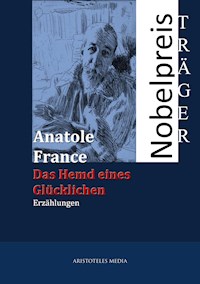
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der gute König Christoph V. erkrankt nach zehn erfolgreichen Regierungsjahren: Depression, Kreuzschmerzen und Magen-Druck schwäche, Kurzatmigkeit und Herzklopfen, Hitzewallung. Seine Leibärzte konnten die mysteriöse Krankheit nicht erklären. Nur Doktor Rodrigo weiß Rat: "Das Hemd eines Glücklichen" solle der König tragen. Seine Leibärzte suchten dieses Hemd bei Mächtigen, glücklichen Spieler, Reichen, Schönen, Religiösen, Lasterhafen, begnadeten Redner Jeronimo und militärisch erfolgreichen Marschall von Volmar. Doch es fehlte stets ein letztes Stückchen zum absoluten Glück. Nach langer erfolgloser Reise treffen sie zurückgekeht im königlichen Palast auf den besitzlosen, alten Muske, der im Baumloch haust und sich als den Glücklichsten auf Erden bezeichnet. Liebevoll erzählte, kurzweilige und pointenreiche Geschichte mit allgemeingültiger Botschaft – aktueller denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anatole France
Das Hemd eines Glücklichen
Erzählungen
*
Übersetzung: Friedrich Oppeln-Bronikowski
Inhalt
König Christoph, seine Regierung, seine Sitten und seine Krankheit Das Heilmittel des Doktors Rodrigo Die Herren von Vierblatt und von Waldteufel suchen einen Glücklichen im Königlichen Schloß Jeronimo Die Königliche Bibliothek Der Marschall Herzog von Volmar Von den Beziehungen zwischen Glück und Reichtum Die Salons der Hauptstadt Das Glück, geliebt zu werden Wenn das Glück darin liegt, nicht mehr zu fühlen ... Sigismund Dux Ob das Laster eine Tugend ist ... Der Pfarrer Handschuh Ein Glücklicher
Ein junger Schäfer lag lässig hingestreckt auf dem Grase der Wiese und verzauberte seine Einsamkeit mit den Klängen der Schalmei... Man hatte ihm seine Kleider mit Gewalt fortgenommen, aber... Großes Konversationslexikon von Pierre Laronsse; Artikel Hemd, Band IV, Seite 5, Spalte 4
König Christoph, seine Regierung, seine Sitten und seine Krankheit
Christoph V. war kein schlechter König. Er beobachtete genau die Vorschriften der parlamentarischen Verfassung und fügte sich stets dem Willen der Kammern. Diese Unterordnung wurde ihm nicht schwer; denn er hatte gemerkt, daß es wohl mehrere Arten gibt, zur Macht zu gelangen, aber nicht zwei, sich in der Macht zu erhalten und als Machthaber zu benehmen. Seine Minister regierten, trotz verschiedener Herkunft, Grundsätze, Ideen und Gesinnungen, alle gleich und wiederholten sich, wenn auch mit gewissen, rein formalen Abweichungen, mit einer beruhigenden Regelmäßigkeit. Und darum nahm er ohne Zögern alle, die ihm die Kammern vorschlugen, zu den Staatsgeschäften, am liebsten freilich die Revolutionäre, weil diese ihre Autorität am hitzigsten durchsetzten.
Er selber befaßte sich vor allem mit der Außenpolitik, ging häufig auf diplomatische Reisen, dinierte und jagte mit den Königen, seinen Vettern, und rühmte sich, der beste Minister des Auswärtigen zu sein, der sich träumen lasse. Nach innen behauptete er sich so gut, wie die unglücklichen Zeiten es gestatteten. Er war bei seinem Volke weder sehr beliebt noch sehr geachtet; und das sicherte ihm den schätzbaren Vorteil, es nie zu enttäuschen. Da er die Liebe seines Volkes nicht besaß, hatte er auch die Unbeliebtheit nicht zu fürchten, die jeden, der populär ist, mit Gewißheit erwartet. Sein Staat war reich. Gewerbe und Handel blühten, ohne jedoch die Nachbarvölker durch Ausdehnung besorgt zu machen. Vor allem erzwang seine Finanzwirtschaft Bewunderung. Die Sicherheit seines Kredits schien unerschütterlich; die Finanzleute sprachen mit Begeisterung und Liebe davon. Hochherzige Tränen feuchteten ihre Augen, und Ehre floß daraus auf König Christoph zurück. Die Bauern beluden ihn mit der Verantwortung für die Mißernten; doch die waren selten. Die Fruchtbarkeit des Bodens und die Geduld derer, die ihn bestellten, machten das Land ergiebig an Obst, Wein, Getreide und Herden. Die Fabrikarbeiter mit ihren beständigen, ungestümen Forderungen erschreckten das Bürgertum, das vom König Schutz vor der sozialen Revolution begehrte. Die Arbeiter ihrerseits konnten ihn nicht stürzen, denn sie waren zu schwach und hatten gar keine Lust dazu; auch sahen sie nicht ein, was sie dabei gewinnen könnten. Der König erleichterte weder ihr Los noch bedrückte er sie stärker, so daß sie immer eine Drohung blieben und nie zur Gefahr wurden.
Auf das Heer konnte er sich verlassen: es war von gutem Geiste erfüllt. Das Heer ist immer von gutem Geiste erfüllt. Alle Maßregeln, die getroffen werden, bezwecken, ihm diesen Geist zu erhalten; das ist die oberste Notwendigkeit des Staates. Denn, verlöre es ihn, würde die Regierung sofort gestürzt. König Christoph begünstigte die Religion. Er war allerdings kein Frömmler; und um nicht glaubenswidrig zu denken, gebrauchte er die nützliche Vorsicht, nie einen Glaubensartikel zu prüfen. Er erschien zur Messe in seiner Hauskapelle und war höflich und voller Gnadenbeweise gegen seine Bischöfe, unter denen sich drei bis vier Ultramontane befanden, die ihn mit Schmähungen überhäuften. Die Niedrigkeit und Servilität seiner Beamten erregten ihm unüberwindlichen Ekel. Er begriff nicht, wie seine Untertanen eine so ungerechte Justiz ertrugen; doch die Beamten machten ihre schandbare Schwäche gegen die Starken durch unbeugsame Härte gegen die Schwachen wett. Diese Strenge war eine Genugtuung für die Besitzenden und gebot Achtung.
Christoph V. hatte wahrgenommen, daß seine Handlungen entweder keine beträchtliche Wirkung oder das Gegenteil der Wirkung hatten, die er beabsichtigte. Daher handelte er wenig. Orden und Auszeichnungen waren das beste Werkzeug seiner Herrschaft. Er verlieh sie seinen Gegnern, die dadurch gedemütigt und zufriedengestellt wurden.
Die Königin hatte ihm drei Söhne geschenkt. Sie war häßlich, zänkisch, geizig und stumpfsinnig; aber das Volk, das sie vom König verlassen und betrogen wußte, verfolgte sie mit Lobsprüchen und Huldigungen. Nachdem der König eine Menge von Frauen aller Stände ausgezeichnet hatte, hielt er sich meist an Frau von Huhn, die ihm zur Gewohnheit geworden war. Er hatte bei Frauen stets die Neuheit geliebt; doch eine neue Frau war für ihn keine Neuheit mehr, und die Monotonie der Veränderung ward ihm zur Last. Aus Überdruß kehrte er zu Frau von Huhn zurück; und das ›kenn' ich schon‹, das ihn bei neuen Liebschaften stets anwiderte, war ihm bei einer alten Freundin erträglich. Trotzdem langweilte sie ihn mit Energie und Ausdauer. Bisweilen wurde ihm diese standhafte Fadheit zuviel; dann suchte er ihr durch Verkleidungen Abwechslung zu verleihen. Er ließ sie als Andalusierin, als Tirolerin, als Kapuziner, als Dragonerrittmeister, als Nonne kleiden, fand sie jedoch stets gleich abgeschmackt.
Seine Hauptbeschäftigung war die Jagd, die überlieferte Tätigkeit der Könige und Fürsten, die sie von den ersten Menschen geerbt haben, eine alte Notwendigkeit, die zur Zerstreuung geworden ist, eine Strapaze, die für die Großen zum Vergnügen wird. Es gibt kein Vergnügen als durch Strapazen. Christoph V. jagte wöchentlich sechsmal.
Eines Tages, im Walde, sagte er zu Herrn von Vierblatt, seinem Oberstallmeister: »Oh, die elende Hirschjagd!«
»Sire«, antwortete der Stallmeister, »die Ruhe nach der Jagd wird Ihnen wohltun.«
»Vierblatt«, seufzte der König, »früher machte es mir Spaß, mich erst zu ermüden und dann zu erholen. Jetzt gewinne ich keinem von beiden mehr Reiz ab. Jede Beschäftigung hat für mich die Leere des Müßiggangs, und die Ruhe ermüdet mich wie eine schwere Arbeit.«
Nach zehnjähriger Regierung ohne Revolutionen noch Kriege hatte Christoph V., den seine Untertanen schließlich für einen guten Politiker hielten und der zum Schiedsrichter der Könige geworden war, keine Freude am Dasein mehr. Er versank in tiefe Niedergeschlagenheit und sagte oft: »Ich habe stets schwarze Würmer vor den Augen, und unter den Rippen fühle ich einen Felsen, auf dem die Traurigkeit hockt.«
Er schlief nicht mehr und hatte keinen Appetit.
»Ich kann nichts essen«, sagte er zu Herrn von Vierblatt, vor seinem goldenen Prachtgedeck sitzend. »Ach, nicht nach Tafelfreuden steht mir der Sinn; sie haben mich nie erfreut: diese Freuden kennt kein König. Ich habe die schlechteste Tafel in meinem Königreich. Gut essen nur die kleinen Leute. Die Reichen haben Köche, die sie bestehlen und vergiften: Die größten Köche stehlen und vergiften am beflissensten, und ich habe die größten Köche Europas. Trotzdem hatte ich Anlage zum Feinschmecker, und ich würde wie ein anderer gute Happen lieben, wenn mein Zustand es mir erlaubte.«
Er klagte über Kreuzschmerzen und Druck auf den Magen, fühlte sich schwach, war kurzatmig und hatte Herzklopfen. Bisweilen stieg ihm eine schlaffe Hitze in widerwärtigen Wellen zu Kopf.
»Ich fühle«, sagte er, »ein dumpfes, fortwährendes, stilles Unbehagen, an das man sich gewöhnen kann und das von Zeit zu Zeit ein zuckender Schmerz durchblitzt. Daher meine Betäubung und meine Angst.«
Der Kopf schwindelte ihm; er war plötzlich geblendet, hatte Migräne, Krämpfe und Seitenstechen, das ihm den Atem abschnitt.
Die beiden Leibärzte des Königs, Doktor Salm und Professor Kiefer, stellten Neurasthenie fest.
»Noch unbestimmte morbide Entwicklung!« sagte Doktor Salm. »Undeutliche nosologische Ursache, daher nicht zu fassen.«
Professor Kiefer unterbrach ihn: »Nennen Sie es, Salm, einen wahren pathologischen Proteus, der sich wie jener Meergreis unter den Händen des Praktikers unaufhörlich verwandelt und die bizarrsten und erschreckendsten Gestalten annimmt! Abwechselnd Geier der Magengeschwüre und Schlange der Nierenentzündung, erhebt er plötzlich das gelbe Gesicht der Gelbsucht, zeigt die roten Backenknochen der Tuberkulose oder krampft die Hände wie ein Würger zusammen, so daß man auf Herzerweiterung schließt. Dann erscheint er als Gespenst aller unheilbaren Krankheiten, um zuletzt, der ärztlichen Tat das Feld räumend, sich für besiegt zu erklären und in seiner wahren Gestalt, der eines Affen aller Krankheiten, zu entfliehen.«
Doktor Salm war schön, anmutig, verführerisch, ein Liebling der Damen, in denen er sich selbst liebte. Als eleganter Gelehrter und Salonarzt erkannte er den Adel noch am Blinddarm und am Bauchfell und beobachtete genau die sozialen Unterschiede der Gebärmütter. Professor Kiefer war klein, dick, kurzbeinig, von der Form eines Topfes, geschwätzig und noch dünkelhafter als sein Kollege Salm. Er war ebenso eitel und hatte mehr Mühe, seine Ansprüche durchzusetzen. Beide haßten einander, doch da sie einsahen, daß sie sich durch gegenseitige Bekämpfung nur vernichten würden, so trugen sie völlige Eintracht und Gemeinsamkeit der Gedanken zur Schau. Kaum hatte der eine seine Ansicht kundgetan, so machte der andere sie sich zu eigen.
Obwohl jeder des andern Fähigkeiten und Intelligenz mißachtete, fürchteten sie nicht, ihre Meinungen auszutauschen; wußten sie doch, daß sie dabei nichts aufs Spiel setzten und beim Austausch weder verloren noch gewannen, denn es waren ja medizinische Meinungen. Die Krankheit des Königs beunruhigte sie anfänglich nicht. Sie rechneten darauf, daß der Kranke während ihrer Behandlung genesen und dieses Zusammentreffen ihnen zugute kommen werde. Sie schrieben übereinstimmend ein enthaltsames Leben vor (Quibus nervi dolent, Venus inimica), ferner kräftigende Nahrung, Bewegung in frischer Luft und vernünftige Anwendung einer Wasserkur. Salm rühmte, mit Billigung Kiefers, Schwefelkohlenstoff und Methylchlorid; Kiefer war unter Beifall von Salm für Opiate, Chloral und Brom.
Doch es vergingen Monate, ohne daß der Zustand des Königs sich im geringsten zu bessern schien. Und bald wurden die Beschwerden heftiger.
»Mir ist«, sprach Christoph V., auf der Chaiselongue liegend, eines Tages zu ihnen, »mir ist, als ob ein Nest voll Ratten in meinen Gedärmen nagt, während ein garstiger Zwerg, ein Kobold mit Kapuze, Kittel und roten Hosen, mir in den Magen gefahren ist und ihn mit seiner Hacke aushöhlt.«
»Majestät«, sagte Professor Kiefer, »das ist ein sympathischer Schmerz.«
»Ich finde ihn antipathisch«, antwortete der König. Doktor Sahn fiel ein: »Weder der Magen noch der Darm Eurer Majestät ist krank, und wenn Sie dennoch Schmerz empfinden, so kommt dies, sagen wir, durch Sympathie mit Ihrem Sonnengeflecht, dessen zahllose Nervenfasern, durcheinandergewirrt und verstrickt, in allen Richtungen an Magen und Darm zerren, wie zahllose glühende Platindrähte.«
»Die Neurasthenie«, unterbrach ihn Kiefer, »ein wahrer pathologischer Proteus ...«
Doch der König gab beiden den Laufpaß.
Als sie gegangen waren, sagte Herr von Waldteufel, der erste Staatssekretär: »Majestät sollten den Doktor Rodrigo konsultieren.«
»Jawohl«, sagte Herr von Vierblatt, »Majestät lasse den Doktor Rodrigo kommen. Das ist das einzige, was hilft.«
Zu jener Zeit setzte Doktor Rodrigo die Welt in Staunen. Man sah ihn fast gleichzeitig in allen Ländern des Erdballs. Er ließ sich seine Besuche so hoch bezahlen, daß die Milliardäre seinen Wert anerkannten. Seine Kollegen in der ganzen Welt, mochten sie auch von seinem Wissen und von seinem Charakter denken, wie sie wollten, sprachen mit Respekt von den Honoraren, die er zu einer bis dahin unerhörten Höhe hinaufgeschraubt hatte. Mehrere rühmten seine Methoden, erklärten, sie zu beherrschen und zu ermäßigten Preisen anzuwenden, und trugen so zu seinem Weltruhm bei. Da Doktor Rodrigo jedoch die Erzeugnisse der Laboratorien und die Medikamente der Apotheken aus seinem Heilverfahren auszuschalten beliebte und nie die Formeln des Arzneibuches gebrauchte, waren seine Heilmittel von verblüffender Wunderlichkeit und voll unnachahmbarer Seltsamkeiten.
Herr von Waldteufel war zwar von Rodrigo noch nie behandelt worden, setzte aber schrankenloses Vertrauen in ihn und glaubte an ihn wie an Gott. Er flehte den König an, den Wunderdoktor rufen zu lassen, doch umsonst.
»Ich halte mich«, sprach Christoph V., »an Salm und Kiefer. Ich kenne sie und weiß, daß sie unfähig sind, wogegen ich nicht weiß, wessen der Doktor Rodrigo fähig ist.«
Das Heilmittel des Doktors Rodrigo
Der König hatte für seine beiden Leibärzte nie viel übrig gehabt. Nach halbjähriger Krankheit wurden sie ihm völlig unausstehlich. Sah er nur von weitem den schönen Schnurrbart und das ewige, sieghafte Lächeln des Doktors Salm und die beiden Hörner von schwarzen Haaren, die auf Kiefers Schädel klebten, so knirschte er mit den Zähnen und wandte wütend den Blick ab. Eines Nachts warf er ihre Tränke, Pillen und Pulver, die das Zimmer mit fadem, trübseligem Geruch erfüllten, zum Fenster hinaus. Er befolgte nicht nur ihre Verordnungen nicht, sondern tat auch geflissentlich das Gegenteil. Wenn sie ihm Bewegung empfahlen, so rührte er sich nicht; verordneten sie ihm Ruhe, so machte er sich Bewegung, aß, wenn sie ihm Diät verschrieben, fastete, wenn sie die Überernährung rühmten, und bezeigte Frau von Huhn eine so überraschende Glut, daß sie dem Zeugnis ihrer Sinne nicht glauben wollte und zu träumen meinte. Trotzdem genas er nicht. So zeigte sich auch hier, daß die Medizin eine trügerische Kunst ist und ihre Vorschriften, in welchem Sinne man sie auch anwenden mag, gleich nichtig sind. Es ging ihm weder schlechter noch besser.
Seine mannigfachen, häufigen Schmerzen hörten nicht mehr auf. Er klagte, ein Ameisenhaufen habe sich in seinem Gehirn angesiedelt, und dieses emsige und kriegerische Völkchen grabe darin Gänge, Kammern, Magazine, trage Lebensmittel und Baumaterial ein, lege Milliarden Eier, füttere seine Jungen, bestehe Belagerungen, schlage Sturmangriffe ab und fechte erbitterte Schlachten in seinem Kopfe aus. Er fühle es, sagte er, wenn eine Kriegerin mit ihren scharfen Kiefern den dünnen, harten Panzer ihrer Feindin durchbreche.
»Majestät«, sagte Herr von Waldteufel zu ihm, »lassen Sie Doktor Rodrigo kommen. Er heilt Sie gewiß.«
Doch der König zuckte die Achseln, und in einer Anwandlung von Schwäche und Geistesabwesenheit verlangte er wieder Arzneien und unterwarf sich der Diät. Er ging nicht mehr zu Frau von Huhn und nahm eifrig Pillen von salpetersaurem Akonit, die damals im Glanz ihrer Neuheit und Jugend standen. Infolge dieser Enthaltsamkeit und dieser Kur bekam er einen solchen Erstickungsanfall, daß ihm die Zunge zum Munde heraustrat und die Augen aus dem Kopfe quollen. Man stellte sein Bett senkrecht, wie eine Wanduhr, und sein vom Blutandrang gerötetes Gesicht sah darin aus wie ein rotes Zifferblatt.
»Das Herzgeflecht ist in vollem Aufruhr«, sagte Professor Kiefer.
»In völliger Empörung«, setzte Doktor Salm hinzu. Herr von Waldteufel nahm die Gelegenheit wahr, den Doktor Rodrigo abermals zu empfehlen; doch der König erklärte, er habe genug an zwei Ärzten.
»Majestät«, erwiderte Waldteufel, »Doktor Rodrigo ist kein Arzt.«
»Ha«!« rief Christoph V. aus, »was Sie da sagen, Herr von Waldteufel, gereicht ihm zum Vorteil und stimmt mich ihm günstig. Er ist kein Arzt? Was ist er denn?«
»Ein Gelehrter, ein Genie, Majestät. Er hat unerhörte Eigenschaften der strahlenden Materie entdeckt und wendet sie auf die Medizin an.«
Doch in einem Tone, der keinen Widerspruch duldete, gebot der König, ihm von diesem Kurpfuscher nie wieder zu reden. »Nie!« stieß er hervor, »nie werde ich ihn empfangen, nie!«
Den ganzen Sommer verbrachte Christoph V. in leidlichem Zustande. Er unternahm mit Frau von Huhn, die als Schiffsjunge gekleidet war, eine Kreuzfahrt in einer Yacht von zweihundert Tonnen. Er lud zum Frühstück an Bord den Präsidenten einer Republik, einen König und einen Kaiser und sicherte im Einklang mit ihnen den Weltfrieden. Es verdroß ihn, die Geschicke der Völker zu bestimmen; doch als er in Frau von Huhns Kabine einen alten Schundroman für Fabrikmädchen fand, las er ihn mit leidenschaftlichem Interesse, das ihm für einige Stunden ein wohltätiges Vergessen der Wirklichkeit verschaffte. Kurz, abgesehen von gelegentlichen Migränen, Neuralgien, Rheumatismus und Lebensmüdigkeit, ging es ihm leidlich. Im Herbst kam sein altes Leiden wieder. Er erduldete die furchtbare Pein eines Menschen, der von den Füßen bis zum Gürtel in Eis liegt und dessen Oberkörper dem Feuer ausgesetzt ist. Was ihm aber noch mehr Schauder und Entsetzen bereitete, waren Gefühle, die er nicht auszudrücken vermochte, unaussprechliche Zustände. Manchmal, sagte er, sei es so, daß ihm die Haare dabei zu Berge ständen. Blutarmut entkräftete ihn, und seine Schwäche nahm täglich zu, ohne daß seine Leidensfähigkeit nachließ.
»Herr von Waldteufel«, sagte er eines Morgens nach einer schlechten Nacht, »Sie haben mir mehrmals von Doktor Rodrigo erzählt. Lassen Sie ihn kommen.«
Doktor Rodrigo wurde zu dieser Zeit am Kap, in Melbourne und in Sankt Petersburg gemeldet. Kabeltelegramme und Funksprüche wurden unverzüglich in diese Richtungen entsandt. Noch war keine Woche verflossen, als der König dringlich nach Doktor Rodrigo verlangte. In den folgenden Tagen fragte er alle Augenblicke: »Kommt er nicht bald?« Man antwortete ihm, daß Seine Majestät kein Patient sei, den man unbeachtet lasse, und daß Rodrigo mit fabelhafter Geschwindigkeit reise. Aber nichts konnte die Ungeduld des Kranken besänftigen. »Er kommt nicht«, seufzte er, »Sie werden sehen, er kommt nicht!«
Eine Depesche aus Genua meldete, daß Doktor Rodrigo sich auf der Preußen eingeschifft habe. Drei Tage darauf erschien der Weltdoktor im Palaste, nachdem er seine Kollegen Salm und Kiefer mit unverschämter Leutseligkeit besucht hatte.
Er war jünger und schöner als Doktor Salm und hatte ein stolzeres und vornehmeres Wesen. Aus Achtung vor der Natur, der er in allen Dingen gehorchte, ließ er sich Haare und Bart wachsen und glich so den antiken Philosophen, die Griechenland in Marmor verewigt hat.
Nachdem er den König untersucht hatte, sagte er: »Majestät, die Ärzte, die von Krankheiten sprechen wie der Blinde von der Farbe, behaupten, Sie litten an Neurasthenie oder Nervenschwäche. Aber wenn sie Ihre Krankheit auch erkannt haben, so sind sie deshalb um nichts mehr imstande, Sie zu heilen; denn ein organisches Gewebe läßt sich nur mit den Mitteln wiederherstellen, die die Natur gebraucht hat, um es zu schaffen, und diese Mittel kennen sie nicht. Welches sind nun aber die Mittel, welches ist das Verfahren der Natur? Sie kennt nicht Hand noch Werkzeug; sie ist fein und geistreich; sie benutzt zu ihren mächtigsten, massigsten Bauten die winzigsten Teilchen der Materie, das Atom und die Zelle. Aus unfaßbarem Nebel bildet sie Gebirge, Metalle, Pflanzen, Tiere und Menschen. Wie? Durch Anziehungskraft, Schwerkraft, Durchdringung, Einziehung, Endosmose, Kapillarität, Wahlverwandtschaft, Sympathie. Sie bildet kein Sandkorn anders als die Milchstraße: die Harmonie der Sphären herrscht hier wie dort; beide bestehen nur durch die Bewegung der Teilchen, aus denen sie zusammengesetzt sind und die ihre musikalische, liebende, ewig bewegte Seele ist. Die Sterne des Himmels und die Staubkörnchen, die in dem Sonnenstrahl tanzen, der in dieses Zimmer fällt, haben die gleiche Struktur, und das kleinste dieser Stäubchen ist ebenso bewundernswert wie der Sirius, denn das Wunderbare in allen Körpern des Weltalls ist das unendlich Kleine, das sie bildet und belebt. So arbeitet die Natur. Aus dem nicht Wahrnehmbaren, dem Unfaßbaren, Unwägbaren schuf sie die ungeheure Welt, die unsern Sinnen zugänglich ist und die unser Geist mißt und wägt; doch das, woraus sie uns selbst schuf, ist weniger als ein Hauch. Arbeiten wir wie sie mit dem Unwägbaren, Unfaßbaren, nicht Wahrnehmbaren, durch liebende Anziehung und feine Durchdringung! Das ist das Prinzip. Wie soll man es auf den vorliegenden Fall anwenden? Wie den erschöpften Nerven das Leben, wiedergeben – das bleibt zu prüfen.
Und zunächst: Was sind die Nerven? Wenn wir nach der Definition fragen, so kann der geringste Physiologe, ja selbst ein Salm, ein Kiefer, sie uns geben.« Es sind Stränge, Fibern, die von Gehirn und Rückenmark ausgehen und sich durch alle Körperteile verzweigen, um die Sinneseindrücke zu vermitteln und den motorischen Apparat in Bewegung zu setzen. Sie sind also Empfindung und Bewegung. Das genügt, um uns ihre innere Anlage erkennen zu lassen und uns ihr Wesen zu offenbaren. Mit welchen Namen man es auch bezeichnen möge – es ist identisch mit dem, was man auf dem Gebiet der Empfindungen Freude und auf moralischem Gebiet Glück nennt. Wo sich ein Atom Freude und Glück findet, da findet sich die Substanz, die die Nerven gesund macht. Und wenn ich sage, ein Atom Freude, so meine ich eine bestimmte Substanz, einen materiellen Gegenstand, einen Körper, der imstande ist, die vier Aggregatzustände: fest, flüssig, luftförmig und strahlend, zu durchlaufen, einen Körper, dessen Atomgewicht sich bestimmen läßt. Die Freude und die Trauer, deren Wirkungen die Menschen, Tiere und Pflanzen seit Anbeginn der Dinge verspüren, sind wirkliche Substanzen; sie sind Materie, da sie ja Geist sind und die Natur in ihren drei Formen: Bewegung, Materie und Geist, eins ist. Es kommt also nur noch darauf an, sich Freudenatome in genügender Anzahl zu verschaffen und sie durch Endosmose und Hautaspiration in den Organismus einzuführen. Deshalb verordne ich Euer Majestät, das Hemd eines Glücklichen zu tragen.«
»Was!« rief der König aus, »ich soll das Hemd eines Glücklichen tragen ?«
»Auf der Haut, Majestät, damit Ihre trockene Epidermis die Glücksteilchen aufsaugt, welche die Schweißdrüsen des Glücklichen durch die Kanäle seines glücklichen Dermas ausströmen. Denn Sie kennen die Funktionen der Haut: sie saugt auf und strömt aus und steht in fortwährendem Austausch mit der Umgebung, in der sie sich befindet.«
»Ist dies das Heilmittel, das Sie mir verordnen, Doktor Rodrigo?«
»Majestät, man könnte kein rationelleres verordnen. Ich wüßte nichts aus dem Arzneibuch, das es ersetzen könnte. In Unkenntnis der Natur und unfähig, sie nachzuahmen, fabrizieren unsere Giftmischer in ihren Apotheken nur eine geringe Zahl von Heilmitteln, die stets gefährlich und nicht immer wirksam sind. Die Medikamente, die wir nicht herstellen können, müssen wir wohl oder übel fertig nehmen, wie die Blutegel, das Bergklima, die Seeluft, die natürlichen Heilquellen, die Eselsmilch, die Katzenfelle und die Ausschwitzungen eines Glücklichen. Wissen Majestät etwa nicht, daß eine rohe Kartoffel, die man in der Tasche trägt, die rheumatischen Schmerzen vertreibt? Sie wollen von natürlichen Heilmitteln nichts wissen; Sie müssen künstliche oder chemische Arzneien haben, Tropfen und Pulver. Sie sind also wohl sehr zufrieden mit Ihren Pulvern und Tropfen?«
Der König entschuldigte sich und versprach zu gehorchen. Doktor Rodrigo, der bereits in der Tür stand, drehte sich um und sagte: »Lassen Sie es leicht anwärmen, ehe Sie es tragen.«
Die Herren von Vierblatt und von Waldteufel suchen einen Glücklichen im Königlichen Schloß
Christoph V. hatte es eilig, das Hemd anzulegen, von dem er seine Genesung erhoffte. Er ließ Herrn von Vierblatt, seinen Oberstallmeister, und Herrn von Waldteufel, seinen Staatssekretär, kommen und beauftragte sie, es so schnell wie möglich herbeizuschaffen. Es ward vereinbart, daß sie über den Gegenstand ihrer Nachforschungen das tiefste Schweigen wahren sollten. Es war nämlich zu befürchten, daß, wenn das Publikum erführe, welche Art von Heilmittel dem König frommte, eine Menge von Unglücklichen, insbesondere die Allerunglücklichsten und die vom Elend am meisten Bedrückten, in Erwartung einer Belohnung ihr Hemd anbieten würden. Auch befürchtete man, daß die Anarchisten vergiftete Hemden schickten.
Die beiden Edelleute glaubten, daß sie sich das Heilmittel des Doktors Rodrigo im Schlosse selbst verschaffen könnten, und stellten sich an ein Guckfenster, vor dem man die Höflinge vorüberschreiten sah. Die, welche sie erblickten, hatten ein mageres Gesicht, eine verdrossene Miene. Sie trugen ihre Leiden auf dem Gesicht geschrieben: sie verzehrten sich in dem Wunsche nach einer Stellung, einem Orden, einem Vorrecht, einem Brillantknopf. Doch als sie in die Prunkgemächer hinabgingen, fanden Vierblatt und Waldteufel den Herrn von Hayn in einem Lehnstuhl schlafend, die Lippen bis zu den Backenknochen hochgezogen, die Nasenlöcher weit geöffnet, die Backen rund und strahlend wie zwei Sonnen, die Brust ebenmäßig, den Bauch rhythmisch und friedlich, die ganze Gestalt Freude ausströmend, von der glänzenden Wölbung des Schädels bis zu den Zehen, die, auseinandergespreizt wie die Beine, in leichten Schnallenschuhen steckten.
Bei diesem Anblick sagte Vierblatt: »Suchen wir nicht länger. Sobald er erwacht ist, wollen wir ihn um sein Hemd bitten.«
Alsbald rieb sich der Schläfer die Augen, reckte sich und blickte kläglich um sich. Seine Mundwinkel senkten sich, seine Backen fielen ein, seine Augenlider hingen herab wie Wäsche an den Fenstern der Armen; seine Brust atmete seufzend; sein ganzes Wesen drückte Verdruß, Sehnsucht und Enttäuschung aus.
Als er den Oberstallmeister und den ersten Staatssekretär erkannte, sagte er: »Ach, meine Herren, ich träumte etwas Schönes. Ich träumte, der König habe mich zum Marquis von Hayn gemacht. Ach, es ist nur ein Traum, und ich weiß, die Absichten des Königs sind ganz entgegengesetzt.«
»Weiter«, sagte Herr von Waldteufel. »Es ist schon spät; wir haben keine Zeit zu verlieren.«
In der Galerie begegneten sie einem Mitglied des Oberhauses, das die Welt durch seine Charakterstärke und die Tiefe seines Geistes in Staunen setzte. Auch seine Feinde erkannten seine Selbstlosigkeit, seine Offenheit und seinen Mut an. Man wußte, daß er seine Memoiren schrieb, und ein jeder schmeichelte ihm, in der Hoffnung, in den Augen der Nachwelt eine vorteilhafte Rolle darin zu spielen.
»Vielleicht ist er glücklich«, sagte Waldteufel.
»Fragen wir ihn«, riet Vierblatt.
Sie traten auf ihn zu, wechselten ein paar Worte mit ihm und brachten das Gespräch auf das Glück. Dann stellten sie die Frage, die ihnen am Herzen lag.
»Reichtum und Ehre lassen mich kalt«, antwortete er, »und die Neigungen, selbst die rechtmäßigsten und natürlichsten, das Familienleben, die Reize der Freundschaft, füllen mein Herz nicht aus. Meine Hingabe gilt dem öffentlichen Wohle, und das ist die unglücklichste aller Leidenschaften und die Liebe mit den größten Hindernissen.
Ich war Minister; ich weigerte mich, mit den Staatsgeldern und dem Blut unserer Soldaten Unternehmungen zu unterstützen, die Freibeuter und Krämer zu ihrem eigenen Profit und zum öffentlichen Schaden organisiert hatten. Ich lieferte Heer und Flotte nicht den Lieferanten aus, und ich fiel durch die Verleumdungen aller dieser Schurken, die mir unter dem Beifall der stumpfen Menge vorwarfen, die geheiligten Interessen und den Ruhm meines Vaterlandes verraten zu haben. Gegen die vornehmen Banditen hat niemand mich unterstützt. Wenn man sieht, aus wieviel Dummheit und Feigheit die Volksmeinung besteht, so sehnt man die absolute Monarchie zurück. Die Schwäche des Königs bringt mich zur Verzweiflung; die Kleinheit der Großen ist mir ein schrecklicher Anblick; die Unfähigkeit und Unredlichkeit der Minister, die Unwissenheit, Niedrigkeit und Käuflichkeit der Volksvertreter erfüllen mich abwechselnd mit Verblüffung und Wut. Um die Schmerzen zu lindern, die ich tagsüber erdulde, schreibe ich sie des Nachts nieder und breche so die Bitterkeit aus, von der ich mich nähre.«
Vierblatt und Waldteufel zogen den Hut vor dem edlen Mitglied des Oberhauses und gingen weiter. Nach wenigen Schritten standen sie einem anscheinend buckligen Zwerg gegenüber, denn man sah seinen Rücken über seinen Kopf weg. Er hatte eine affektiert zierliche Art, zu gehen.
»Es hat keinen Zweck, sich an ihn zu wenden«, sagte Vierblatt.
»Wer weiß?« erwiderte Waldteufel.
»Glauben Sie mir«, entgegnete der Oberstallmeister, »ich kenne ihn; ich bin sein Vertrauter. Er ist mit sich zufrieden und völlig selbstgenügsam, und er hat seine Gründe dazu. Dieser kleine Bucklige ist der Verzug aller Weiber. Damen vom Hofe, aus der Stadt, Schauspielerinnen, Bürgermädchen, galante Dämchen, Gefallsüchtige, Prüde, Betschwestern, die Stolzesten und Schönsten liegen ihm zu Füßen. Um sie zu befriedigen, ruiniert er sein Leben und seine Gesundheit; er ist schwermütig geworden und trägt den Schmerz, ein Glücksbringer zu sein.«
Die Sonne ging unter, und in der Meinung, daß der König heute nicht mehr erscheine, räumten die letzten Höflinge die Gemächer des Schlosses.
»Ich gäbe gern mein Hemd her«, sagte Vierblatt. »Ich bin, wie ich wohl sagen kann, glücklich veranlagt, murre nie, ich esse, trinke und schlafe gut. Man macht mir Komplimente über mein blühendes Aussehen; man findet mein Gesicht angenehm; und über mein Gesicht habe ich in der Tat nicht zu klagen. Doch in der Blase fühle ich eine Hitze und Schwere, die mir das Leben vergällt. Heute morgen habe ich einen Stein von der Größe eines Taubeneies ausgeschieden. Ich fürchte, mein Hemd ist dem König nichts wert.«
»Ich gäbe gern meines«, sprach Waldteufel. »Doch auch ich habe meinen Stein, nämlich meine Frau. Ich habe die häßlichste und boshafteste Kreatur geheiratet, die je gelebt hat, und obwohl ich weiß, daß die Zukunft in Gottes Hand liegt, setze ich kühnlich hinzu: auch die boshafteste und häßlichste, die je leben wird; denn die Wiederkehr eines solchen Originals ist so unwahrscheinlich, daß man sie praktisch als unmöglich bezeichnen kann. Es gibt Würfe, die der Natur nicht zweimal gelingen ...«
Und diesen peinlichen Gegenstand verlassend: »Vierblatt, mein Freund, wir waren nicht bei Verstand. Nicht am Hofe noch bei den Mächtigen dieser Welt muß man einen Glücklichen suchen.«
»Sie reden wie ein Philosoph«, erwiderte Vierblatt. »Sie drücken sich aus wie der Lump, der Rousseau. Sie haben unrecht. Es gibt ebenso viele, die glücklich sind und das Glück verdienen, in den Königsschlössern und Adelspalästen wie in den Literatenkaffees und in den Kneipen, wo die Arbeiter verkehren. Wenn wir heute unter diesem Dache keinen fanden, so war es wegen der späten Stunde und weil wir kein Glück hatten. Gehen wir heute abend zum Spiel bei der Königin, da wird es uns besser gelingen.«
»Einen Glücklichen an einem Spieltische finden!« rief Herr von Waldteufel aus. »Das heißt soviel, wie ein Perlenkollier in einem Rübenfeld finden und eine Wahrheit im Mund eines Staatsmannes!... Der spanische Botschafter gibt heute abend ein Fest; die ganze Gesellschaft wird da sein. Gehen wir auch hin; dort werden wir unschwer die Hand auf ein gutes und geeignetes Hemd legen.«
»Bisweilen ist es mir passiert«, sagte Vierblatt, »daß ich die Hand auf das Hemd einer glücklichen Frau legte. Und zwar mit Vergnügen. Doch unser Glück war nur von kurzer Dauer. Wenn ich so zu Ihnen rede, so geschieht es nicht, um zu prahlen (es war wirklich nicht der Rede wert), noch um vergangenes Glück zurückzurufen, denn es kann wiederkehren, und im Gegensatz zu dem Sprichwort hat jedes Alter das gleiche Glück. Meine Absicht ist eine ganz andere; sie ist ernster und tugendhafter und bezieht sich unmittelbar auf den hohen Auftrag, den wir beide haben: ich möchte Ihnen einen Gedanken unterbreiten, der mir soeben eingefallen ist. Meinen Sie nicht, Waldteufel, daß der Doktor Rodrigo, als er das Hemd eines Glücklichen verordnete, diesen Ausdruck im allgemeinen Sinne gebrauchte, daß er die ganze Gattung Mensch meinte, ohne Ansehen des Geschlechts, und daß er sowohl das Hemd einer Frau wie das eines Mannes darunter verstand? Was mich betrifft, so neige ich zu dieser Auffassung, und wenn Sie der gleichen Ansicht sind, so könnten wir das Gebiet unserer Nachforschungen ausdehnen und unsere Chancen mehr als verdoppeln; denn in einer eleganten, geordneten Gesellschaft wie der unseren sind die Frauen glücklicher als die Männer. Wir tun für sie, was sie für uns nicht tun. Waldteufel, wenn die Aufgabe derart erweitert ist, könnten wir uns darein teilen. So könnte ich zum Beispiel von heute abend bis morgen früh nach einer glücklichen Frau suchen, während Sie nach einem glücklichen Manne suchen. Sie werden zugeben, mein Freund, daß das Hemd einer Frau eine zarte Sache ist. Ich habe einmal eines angefaßt, das sich durch einen Ring ziehen ließ; der Batist war feiner als Spinneweben. Und was sagen Sie von dem Hemd, mein Freund, das eine Dame vom französischen Hofe zur Zeit der Marie Antoinettje beim Balle zusammengerollt in ihrer hohen Frisur trug? Es wäre doch sehr hübsch, meine ich, wenn wir dem König, unserm Herrn, ein schönes Batisthemd mit Einsätzen, Volants aus Valenciennespitzen und mit schimmernden rosa Schulterbändern anbrächten, leicht wie ein Hauch, nach Iris und Liebe duftend.«
Doch Waldteufel protestierte heftig gegen diese Art, die Verordnung des Doktors Rodrigo aufzufassen.