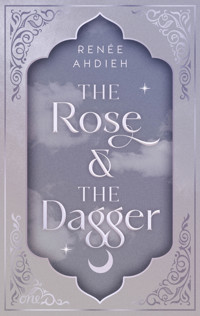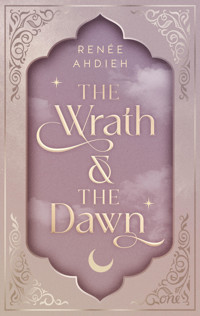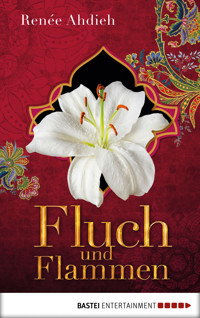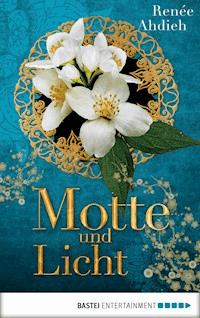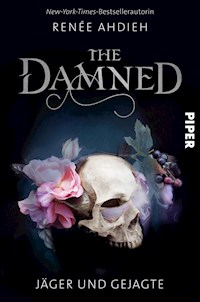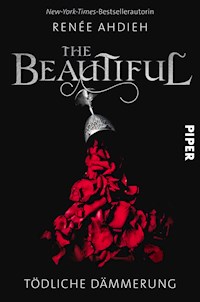5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Samurai-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Nachdem der Schwarze Clan aufgeflogen ist und Okami gefangen genommen wurde, hat Mariko keine Wahl mehr. Sie muss Prinz Raiden und ihrem Bruder nach Inako folgen und sich als Braut des Prinzen den Gefahren und Intrigen stellen, die am Hof auf sie lauern. Von nun an sind Klugheit und Umsicht ihre Waffen. Damit will sie die Ränkeschmiede aufdecken und für Gerechtigkeit sorgen. Doch hinter jedem Geheimnis verbirgt sich ein weiteres. Werden Mariko und Okami aus diesem Lügennetz entkommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Zitat
Ein guter Tod
Eine Maske der Gnade
Groß und stolz und glücklos
Der Ochse und die Ratte
Geschöpfe des Windes und des Himmels
Für das Leben gezeichnet
Die Asche der Loyalität
Spuren aus gesponnener Seide
Vergoldete Blütenblätter und tropfende Wunden
Finster glänzend
Geheimnisse eines Bambusmeeres
Das Lied der Nachtigall
Wenn
Immer Held, immer Schurke
Das Schwert der Wahrheit
Ein nicht gewähltes Leben
Die maskierte Truppe
Mehr als Liebe
Ein nachgiebiger Geist
Ein gebrochenes Lächeln
Ein schlafender Drache
Der Schrein der Sonnengöttin
Kaum menschlich
Verletzungen und gebrochene Bande
Der Schwanz der Schlange
Ein dunkler Garten
Niemandes Held
Ein gewisses Maß an Trost
Ein Meer an Erinnerungen
Wiedergutmachung
Geboren von einem Drachen und einem Phoenix
Der Weg des Kriegers
Überrascht
Losgemacht
Der Erste, der stirbt
Mein Herrscher
Bittere Erleichterung
Der Tribut des Todes
Epilog
Glossar
Danksagungen
Über den Autor
Renée Ahdieh hat die ersten Jahre ihrer Kindheit in Südkorea verbracht, inzwischen lebt sie mit ihrem Mann und einem kleinen Hund in North Carolina, USA. In ihrer Freizeit ist die Autorin eine begeisterte Salsa-Tänzerin, sie kann sich für Currys, Schuhe, das Sammeln von Schuhen und Basketball begeistern. Mit Zorn und Morgenröte legt sie ihren ersten Roman vor, zu dem es eine Fortsetzung geben wird, an dem die Autorin gerade arbeitet.
Renée Ahdieh
Das Herz aus Eis und Liebe
Band 2
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon Martina M. Oepping
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Renée Ahdieh/Penguin Random House LLC
Published by arrangement with Baror International, Inc., Armonk, New York, U.S.A.
Titel der englischsprachigen Originalausgabe:
»Smoke in the Sun«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: © Sandra Taufer, München unter Verwendungvon Motiven von shutterstock: Susan Fox; Gordan; 100ker; Essl;Breslavtsev Oleg; Elina Li; umiko
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6485-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Mädchen aus aller Welt:Ihr inspiriert mich jeden Tag.
»Die Wahrheit ist nicht, wie du sie haben möchtest; sie ist wie sie ist. Du musst dich ihrer Macht beugen oder mit einer Lüge leben.«
Miyamoto Musashi
Ein guter Tod
Düstere Wolken hingen am Himmel wie Schemen.
Die meisten Menschen hatten sich in Beerdigungsgrau gehüllt. Die Köpfe trugen sie aus Respekt gesenkt, ihre Stimmen waren gedämpft. Auch die kleinsten Kinder wagten nicht nach dem Warum zu fragen.
Dies war die Ehrerbietung, die sie ihrem jüngst dahingeschiedenen Kaiser entgegenbrachten. Das Zeichen ihrer äußersten Verehrung und ihrer unerschütterlichen Liebe. Eine Ehrerbietung, eine Liebe, die das Mädchen in ihrem Herzen nicht nachvollziehen konnte.
Dennoch verhielt sie sich ruhig. Schien es den anderen gleichzutun, obwohl sie die Hände an den Seiten zu Fäusten ballte. Sie beobachtete aus dem Augenwinkel, wie sich der Leichenzug durch die stillen Straßen von Inako wand. Sah, dass ein leichter Regen von dem düsteren silbrigen Himmel zu fallen begann. Ihre gewebten Sandalen waren bald durchweicht. Der Stoff ihrer einfachen Hose klebte an den Waden.
Ihre linke Faust umklammerte den Stein in der Hand fester.
Die Trommeln, die ihre Prozessionsschläge ertönen ließen, näherten sich, das dumpfe Donnern hallte in ihren Ohren wider. Die durchdringende Melodie des Hichiriki schnitt durch den dichter werdenden Regen.
Als die kaiserlichen Wachen, die entlang der Straße Aufstellung genommen hatten, ihre Blicke auf die Menge richteten, verneigten sich die Menschen hastig. Sie fürchteten, wegen irgendeiner Geringschätzung gezüchtigt zu werden, so unbedeutend das vermeintliche Vergehen auch wäre. Diejenigen in der Nähe des Mädchens verneigten sich besonders tief, als die Gedenktafel, die dem Leichenzug vorangetragen wurde, in Sicht kam. Schwaden des Agarholz-Räucherwerks erfüllten die Luft mit dem Geruch nach brennender Zeder und warmem Sandelholz. In die steinerne Oberfläche der Gedenktafel waren die Namen vieler verstorbener Kaiser eingeätzt – die dahingeschiedenen himmlischen Herrscher des Minamoto-Clans.
Das Mädchen beugte den Kopf nicht. Sie hielt die Augen hoch erhoben. Betrachtete die Gedenktafel.
Wenn sie dabei ertappt würde, drohte ihr die Todesstrafe. Ihr Verhalten war der Gipfel der Respektlosigkeit und hätte den Ehrverlust für ihre Familie und deren Nachkommen zur Folge. Aber Ehre hatte ihr nie viel bedeutet.
Erst recht nicht im Angesicht der Ungerechtigkeit.
Ein letztes Mal krampfte das Mädchen die Finger um den Stein. Rieb den Schweiß ihrer Hand in seine raue Oberfläche. Zielte.
Und schleuderte ihn auf die Gedenktafel.
Mit einem scharfen Krachen traf er den grauen Stein direkt in der Mitte.
Fassungslose Stille breitete sich über der Menge aus. Für einen Moment, der von Zeit und Raum losgelöst zu sein schien, gerieten die Träger der Gedenktafel ins Wanken. Sie sahen entsetzt zu, wie der Stein zerbarst und die Stücke in den Dreck fielen.
Ein einziger Aufschrei der Entrüstung schien sich auf viele Münder zu verteilen. Obwohl die Leute des Bezirks Iwakura nicht unbedingt viel für den Kaiser übriggehabt hatten, war diese Tat eine Beleidigung der Götter selbst. Die Samurai, die die Prozession bewachten, zügelten ihre Pferde und stürmten dann in die Menge. Ein Stimmengewirr erhob sich aus der Menschengruppe, ganz wie das Summen eines Bienenstocks kurz vorm Bersten. Zitternde Finger deuteten in alle Richtungen, anklagend überall und nirgends hinweisend.
Aber das Mädchen war längst in Bewegung.
Sie duckte sich in den Schatten hinter einem kleinen Laden für Heilmittel. Ihre Hände zitterten von der Kraft, die unter ihrer Haut pulsierte, während sie sich eine Maske über den unteren Teil des Gesichts zog. Dann packte das Mädchen den Rand einer Pinientraufe und stützte den Fuß gegen eine fleckig verputzte Wand. Mit der Präzision eines Blitzes sprang sie auf ein ziegelgedecktes Hausdach.
Die Rufe von unten wurde lauter. »Da ist er!«
»Das ist der, der den Stein geworfen hat.«
»Der Junge dahinten!«
Das Mädchen musste beinahe lächeln. Aber den Luxus von Gefühlen konnte sie sich nicht leisten. Leichtfüßig rannte sie auf den Dachfirst zu, dann glitt sie auf der anderen Seite hinab. Das Trappeln von Hufen zu ihrer Rechten trieb das Mädchen auf das Hausdach zu ihrer Linken. Sie sprang über den gähnenden Abgrund zwischen den beiden Tragwerken und formte ihren Körper zu einer Rolle. Selbst mit dieser Vorsichtsmaßnahme durchfuhr sie ein Schmerz von den Füßen bis hinauf in das Rückgrat.
Sie nutzte den Griff ihrer Zehen, um auf der feuchten Oberfläche Halt zu finden. Als sie weiter über die geschwungenen Dachziegel eilte, zischte ihr ein Pfeil dicht am Ohr vorbei. Wie ein Wasserfall glitt das Mädchen über die Dachkante und verschwand in den Schatten darunter.
Einen kurzen Herzschlag lang musste sie sich sammeln. Die Brust hob sich, als sie einen tiefen Atemzug nahm. Dann noch einen. Sie musste mehr Abstand gewinnen. Sie blinzelte sich die Regentropfen aus den Augen, dann schoss das Mädchen in eine schmale Gasse, vorbei an einer ausrangierten Gemüsekarre.
Plötzlich näherten sich flinke Fußtritte von links.
»Da ist er!«
»Da, in der Gasse genau bei der Schmiede!«
Rasender Herzschlag trommelte in ihren Ohren, als sie um die Ecke raste. Das Getrappel der Fußschritte drängte näher. Es gab keine Möglichkeit sich zu verstecken, außer in einer Regentonne an der Wand der baufälligen Schmiede. Sie würde mit Sicherheit geschnappt werden, wenn sie auch nur einen winzigen Moment länger zögerte.
Ihre Blicke zuckten in alle vier Himmelsrichtungen, dann traf sie eine schnelle Entscheidung. Behände wie eine Katze stemmte sie den Rücken gegen einen Holzpfahl und trat einmal nach oben, dann noch einmal. Ihr Körper zitterte vor Anstrengung, aber sie klemmte einen Fuß in der Krümmung eines Stützbalkens fest. Dann drehte sie sich und presste die Schultern in das raue Stroh der Dachunterseite.
Ihr verschwamm die Sicht vor lauter Angst, als genau unter ihr ein Soldat in Sicht kam. Wenn er hochsähe, wäre alles verloren. Der Soldat sah sich um, bevor er mit seinem sandalenbewehrten Fuß gegen die Regentonne trat. Sie stürzte mit einem dumpfen Schlag um, mit einem Platschgeräusch vermischte sich das Wasser mit dem Schlamm auf dem Fußboden. Enttäuscht schnaubte der Soldat laut auf.
In unmittelbarer Nähe gellte ein unverständlicher Zornesschrei gen Himmel.
Als der Zorn des Soldaten wuchs, spannte das Mädchen den Körper fester an, diese Anstrengung drang bis in ihr Innerstes. Sie hatte Glück, dass ihr tägliches Training alle Glieder zu solch geschmeidigen Muskelsträngen vervollkommnet hatte. Dass sie sich das Bewusstsein für jeden einzelnen Muskel erarbeitet hatte, für jede Bewegung. Sie hielt den Atem an, brachte Finger und Füße fest in die richtige Stellung.
Der Soldat trat noch ein letztes Mal gegen das Fass, dann rannte er zurück auf die Straße.
Nach einigen Augenblicken erlaubte sich das Mädchen endlich zu entspannen und überließ ihren Körper einer bequemeren Haltung. Sie duckte sich weiter in den Schatten, bis der Lärm des Tumults mit dem Prasseln des Regens verschmolz. Dann, ganz vorsichtig, griff sie nach dem Holzpfosten und ließ ihre Füße mit einem gedämpften Geräusch in den Schlamm sinken. Das Mädchen richtete sich auf und riss sich die Maske vom Gesicht.
Als sie sich gerade abwandte, um aufzubrechen, glitt die Tür, die zu dem angeschlossenen Teil der Schmiede führte, einen Spaltbreit auf. Von dem Geräusch aufgeschreckt, ließ das Mädchen die Maske in den Schmutz fallen.
Vor ihr stand eine Frau mit ergrauten Schläfen und unerbittlichem Blick.
Obwohl die Züge des Mädchens ausdruckslos blieben, setzte ihr Herzschlag für einen Moment aus.
Das Mädchen schätzte, dass die Frau ungefähr das Alter ihrer Mutter hatte. Wenn sie auch nur ein einziges Wort riefe, würde das Mädchen geschnappt. Die Angst lähmte sie, also blieb das Mädchen still, während die Frau langsam einatmete. Ihre Augen verengten sich, als sie verstand.
Dann deutete sie mit dem Kinn nach links und wies das Mädchen an zu fliehen.
Mit einer dankbaren Verneigung verschwand das Mädchen im Regen.
Sie wandte sich unzählige Male um, während sie kreuz und quer durch die regenglatten Straßen des Iwakura-Viertels irrte, immer darauf bedacht, dass niemand ihren Schritten folgen konnte. Als sie sich einer Bogenbrücke aus Stein näherte, die zu einem Wäldchen aus schneeweißem Hartriegel und blassrosa Kirschbäumen führte, nahm ihr Gang einen anderen Rhythmus an. Die Schultern sanken und der Hals streckte sich. Es geschah unbewusst in dem Augenblick, als ihre Nase den Duft von Nachtjasmin aufnahm.
Immer noch mied sie die Hauptdurchgangsstraßen außer der Brücke selbst. Verborgen unter einem Schauer verblühter Blütenblätter nahm sie erfreut den Anblick einer Jinrikisha wahr und setzte sich unter ihr verschlissenes Leinwanddach. Bebend schloss sie die Augenlider, und die Lippen öffneten sich, während sie im Stillen jeden Atemzug zählte.
Ichi.
Ni.
San.
Shi.
Dann hob das Mädchen das Kinn. Mit gewandten Bewegungen richtete sie ihre zerwühlte Kleidung, bis nichts mehr unstatthaft schien. Sie korrigierte den Haarknoten oben auf ihrem Kopf zu einer eleganten Frisur. Wie ein begabter Verwandlungskünstler, zu dem sie sich selbst ausgebildet hatte, verwandelte sich das Mädchen von einem wagemutigen Jungen in ein sittsames Mysterium. Als sie schließlich am Tor des Teehauses ankam, klopfte sie zweimal, setzte einen Schlag lang aus, bevor sie mit der Faust noch weitere fünf Male in rascher Folge an die Tür klopfte. Ein Fußschlurfen und einige geflüsterte Laute drangen hinter dem Tor hervor, ehe es aufschwang.
Obwohl die Dienerinnen wussten, dass sie die Tür bei diesen Klopfzeichen entriegeln sollten, war niemand da, der das Mädchen in Empfang nahm, genau wie sie es ausdrücklich angeordnet hatte. Auf diese Art war keine von ihnen gezwungen zu lügen, ob sie das Mädchen gesehen hatte. Ihre Missgeschicke waren es nicht wert, die Leben all dieser jungen Frauen aufs Spiel zu setzen, und der Preis, sie zu bitten, ihre Geheimnisse zu wahren, war viel zu hoch.
Das Mädchen ging über die polierten Steine im Garten, vorbei an dem plätschernden Bach und seinen drei Miniatur-Wasserfällen, hinein in eine Geräuschkulisse aus klimperndem Gelächter und einer trällernden Shamisen. Dann glitt sie an dem eleganten Bonsai-Garten vorbei und ging hinter dem Teehaus auf ein nahegelegenes kleineres Gebäude zu. Außerhalb einer aufwändig geschnitzten Schiebetür wartete ihre vertrauenswürdige Dienerin Kirin, eine Karaffe mit frischem Wasser in den Händen.
Kirin verneigte sich. Das Mädchen erwiderte die Geste.
Als sie die Sandalen auszog, stieß die sommersprossige Dienerin die seidenbespannte Schiebetür auf, die in ein Zimmer führte, das an beiden Seiten zwei große Tansu-Truhen enthielt, handgefertigt aus roter Zeder und schwarzem Eisen. Das Mädchen trat über die erhöhte Schwelle und nahm vor einem polierten Silberspiegel Platz, der hinter Reihen von anmutigen Kosmetikgefäßen und gläsernen Fläschchen angebracht war.
Sie blickte auf ihr Spiegelbild. Betrachtete die eleganten Gesichtszüge, die sie innerhalb dieser Mauern so gut verbargen.
»Möchtest du, dass ich dir ein Bad einlasse?«, fragte Kirin.
»Ja, bitte«, antwortete das Mädchen, ohne den Blick von ihrem Spiegelbild abzuwenden.
Die Dienerin verbeugte sich erneut. Wandte sich zum Gehen.
»Kirin?« Das Mädchen drehte sich auf der Stelle. »Ist während meiner Abwesenheit irgendetwas in der Okiya abgegeben worden?«
»Es tut mir leid.« Kirin schüttelte den Kopf. »Für dich sind heute keine Nachrichten eingetroffen, Yumi-sana.«
Asano Yumi nickte und kehrte zu ihrem Blick in den Spiegel zurück.
Ihr Bruder, Tsuneoki, würde sie bald aufsuchen. Dessen war sie sich sicher. Nach Ōkamis Kapitulation vor drei Tagen im Wald konnten sie und Tsuneoki es sich nicht länger leisten, untätig zu bleiben, im Schatten hin- und herzuhuschen, nur Geflüster hinter sich lassend. Ebenso wenig konnten sie weiterhin zulassen, dass ihre schmerzliche Vergangenheit den Verlauf ihrer Zukunft bestimmte. Es blieb dabei, dass Yumis älterer Bruder sie verletzt hatte. Tief verletzt. Mit seinen Lügen darüber, wer er war. Mit seiner unnachgiebigen Behauptung, dass er allein die Antworten kannte. Dass er allein die Entscheidungen traf.
Und das, obwohl seine Entscheidungen Yumi allein ließen. Immer.
Vor Jahren hatte Tsuneokis Vernachlässigung Yumi dazu gebracht, die Wände ihres parfümierten Gefängnisses zu erklettern und über die gewölbten Dachschindeln zu fliehen. Die Selbstgefälligkeit ihres Bruders hatte ihr Flügel verliehen, und mit denen konnte sie fliegen – irgendwohin, überallhin.
Geistesabwesend spielte Yumi mit dem Alabasterdeckel eines Glases mit Bienenwachs und zerstoßenen Rosenblüten.
Ihr Bruder trug sein Lächeln, wie sie diese Farben trug. Eine grinsende Maske, um Wut und ein gebrochenes Herz zu verbergen. Ihre Mutter hatte immer gesagt, sie sollten bei der Wahl ihrer Masken vorsichtig sein. Denn eines Tages könnten diese Masken zu ihren Gesichtern werden. Bei dieser Warnung hatte Tsuneoki oft die Augen verdreht, und die Zunge zwischen den Zähnen heraushängen lassen wie eine Schlange. Yumi hatte sich bei diesem Anblick immer vor Lachen geschüttelt. Als sie noch klein waren, hatte ihr Bruder sie immer zum Lachen gebracht. Und sie hatte ihm immer geglaubt.
Bis zu dem Tag, an dem alles aufhörte, wie eine Flamme, die im Wind erloschen war.
Der Deckel fiel von dem Kosmetikglas, das Scheppern riss Yumi aus ihren Gedanken. Sie sah ihren Ausdruck im Spiegel. Blinzelte die Andeutung von Tränen weg. Spannte den Kiefer an.
Es wurde Zeit, dass der Asano-Clan seine Rechte einforderte.
Rechte, die zehn Jahre brachgelegen hatten.
Yumi dachte wieder an den Stein, den sie in der Hand gehalten hatte. Obwohl das alles erst heute Morgen geschehen war, fühlte es sich an wie aus einer anderen Zeit. Sie rief sich die Schreie der Menge ins Gedächtnis, Schreie der Empörung. Man sah ihre Tat als töricht an. Aber die Menge hatte Angst, und sie hatte ihr Leben auf dieser Angst aufgebaut. Es wurde Zeit, die Menge von innen zu demontieren. Sie in ihren Grundfesten zu erschüttern.
Also hatte Yumi mit einem Stein begonnen. Das Geräusch, das er gemacht hatte, als er die Gedenktafel des Kaisers getroffen hatte, hallte ihr in den Ohren nach. Als der erste von vielen künftigen Schlachtrufen.
Sie konnte noch immer die raue Oberfläche des Steins auf ihrer Haut fühlen.
Die Zeit war gekommen, dass der Asano-Clan die Gerechtigkeit im Reich Wa wiederherstellte.
Oder bei dem Versuch starb.
Eine Maske der Gnade
Außerhalb einer baufälligen Schmiede im Bezirk Iwakura entdeckte ein patrouillierender Fußsoldat eine halb im Schlamm vergrabene schwarze Maske.
Wut vernebelte seinen Blick. Eine Wut, die rasch von Angst aufgezehrt wurde. Er hatte hier gesucht. Der Beweis seiner Bemühungen – eine umgeworfene Regentonne – verhöhnte ihn, während die Maske mit jedem Augenblick tiefer im Schlamm versank. Wenn irgendjemand entdeckte, dass er dem Jungen mit der Maske die Flucht ermöglicht hatte, würde der Soldat bestraft werden. Sofort und mit Sicherheit.
Er schickte sich an, die Maske in seinen Ärmel zu stecken, als eine Bewegung seine Aufmerksamkeit erregte. Eine Fackel erwachte hinter einer dreckigen Reispapier-Leinwand hinter der Schmiede zum Leben. Der Blick des Soldaten verengte sich. Mit nur vier Schritten trat er die zerbrechliche Tür aus Holz und Papier ein.
Eine Frau saß mit einem kleinen Kind an einem Tisch, vertieft in eine Rolle von zerknittertem Pergament. Sie brachte ihrem Sohn das Lesen bei. Die Frau erschien verhärmt und übermüdet, während der kleine Junge mit leuchtenden Augen neben ihr kniete.
Ohne zu zögern trat die Frau vor ihren Sohn, den Körper wie ein Schutzschild einsetzend. Ihr Blick fiel auf die schmutzige Maske in der Hand des Soldaten und ihre nach unten gerichteten Augen weiteten sich kurz, aber merklich.
Es handelte sich nicht um einen Ausdruck von Überraschung. Sondern eher von Verstehen.
Ein Ausdruck des Wiedererkennens.
Dieser Moment der Klarheit nahm dem Soldaten seine nächste Entscheidung ab. Niemandem sollte das Wissen nützen, dass er den Jungen mit der Maske – den Verräter, der es gewagt hatte, beim Trauerzug des Kaisers einen Stein zu werfen – hatte entkommen lassen.
Mit einem Hieb seines Schwerts zerstörte der Soldat die Ursache seiner Sorge. Brachte die Stimme der Frau mit einem einzigen Schlag zum Schweigen. Als der Junge sah, wie seine Mutter leblos auf dem festgetretenen Erdboden zusammensackte, begann er zu zittern, seine zinnfarbenen Augen liefen vor Tränen über.
Für einen kurzen Atemzug befiel den Soldaten Unsicherheit.
Nein, es würde ihm nichts helfen, auch dieses junge Leben zu nehmen. Ein junges Leben, das eines Tages der Sache ihres himmlischen Herrschers dienen könnte, vielleicht sogar besser als er.
Also hob der Soldat einen Finger an die Lippen. Lächelte wohlwollend. Eine Gnade, die die letzten verbliebenen Spuren von Schuld wegschmelzen ließ. Dann zerzauste er dem Jungen die Haare und wischte das Blut von seiner Klinge, bevor er verschwand, wie er gekommen war.
Als der Soldat die sich vertiefende Dunkelheit hinter der Schmiede durchquerte, hob er das Kinn. Die Wolken über ihm wirbelten heftig durcheinander und bewirkten, dass sich sein Magen verkrampfte, als befände er sich in der Schlacht. Vielleicht wäre es klug, wenn er später noch einmal jemanden zur Schmiede schicken würde, der sich um den Jungen kümmerte. Vielleicht eine Frau. Jemand …
Ein Stirnrunzeln verzerrte sein Gesicht.
Nein. Der Junge gehörte nicht zu seiner Zuständigkeit. Als der Soldat im Alter des Jungen gewesen war, hatte er sich allein um sich selbst und seine beiden jüngeren Schwestern gekümmert. Dieser Junge hier hatte zweifellos seine eigene Familie. Schließlich war diese Schmiede nicht nur von seiner Mutter besetzt. Das stelle man sich vor! Eine Frau, die an einem Amboss arbeitete. Mit einem Blasebalg ein Feuer entzündete. Ein Schwert formte!
Der Soldat lachte unterdrückt. Das leise Krächzen wurde lauter, als sich der Knoten in seinem Magen zusammenzog. Als ein tiefes Summen durch sein Trommelfell zu dröhnen begann.
Aus seinem Lachen wurde ein Husten.
Ein Husten, das ihm den Atem raubte.
Der Soldat knickte in der Taille ein, stützte die Hände auf die Knie. Er begann zu zittern. Verzweifelt versuchte er, Luft zu bekommen. Ein Beben ergriff seinen Körper und erschütterte ihn bis in sein Innerstes. Das Summen schwoll rings um ihn an, in seinen Ohren tönte eine Totenklage.
Es zwang ihn zu Boden.
Das Letzte, was er sah, war eine schlammverkrustete dunkle Maske.
Neben einer umgeworfenen Regentonne beobachtete ein Fuchs mit gelben Augen, wie ein Fußsoldat auf den Straßen des Bezirks Iwakura zusammenbrach und sich im Schlamm mit einem lautlosen Schrei krümmte.
Über die Züge des Fuchses schlich sich ein wissendes Grinsen. Seine finstere Aufgabe voll dunkler Magie war vollendet.
Dann verschwand er in einem Wirbel aus Rauch.
Groß und stolz und glücklos
Es war wie die Szene aus einer Geschichte, die sie schon einmal gehört hatte.
Eine junge Frau an ihrem rechtmäßigen Platz, verborgen im Goldenen Schloss. Verlobt mit dem Sohn der Lieblingskonkubine des Kaisers. Dem Namen Hattori höchste Ehre erweisend.
Das parfümierte Wasser in dem hölzernen Furo fühlte sich genauso an wie zu Hause. Wie warme Seide, die über ihre Haut glitt. Die Hände, die Marikos Arme und Schultern schrubbten, taten dies genauso, wie sie es zu Hause getan hatten – ohne Mitleid, bis ihre blasse Haut glänzte wie die eines neugeborenen Kindes, rosa, roh und perfekt. Eine Dienerin mit Runzeln der Missbilligung, die ihr in die Stirn eingemeißelt zu sein schienen, zerrte Mariko einen mit Perlmuttintarsien verzierten Kamm durch das Haar, ganz in der Art, wie es ihr Kindermädchen getan hatte, als sie jünger war.
Es fühlte sich alles so vertraut an.
Doch wenn Mariko sich jetzt einer Sache sicher sein konnte, dann der, dass ihr Leben nie mehr dasselbe sein würde.
Unter den aufmerksamen Blicken ihres Bruders waren sie spät am vergangenen Abend in Inako eingetroffen. In einer kaiserlichen Stadt, die ganz in Trauer gehüllt war. Die Straßen voller Geflüster. Heute hatte das Begräbnis ihres Kaisers stattgefunden, der ganz plötzlich gestorben war, und Verdächtigungen machten die Runde. Bei der Entdeckung seiner Leiche, sagte man, sei das Jammern der Kaiserin über alle sieben Maru zu hören gewesen. Sogar hinter den mit Eisen und Gold beschlagenen Doppeltüren des Schlosses. Sie hatte das Wort Mord hinausgeschrien. Hatte gegen alle gewütet, die in der Nähe waren, und sie des Verrats bezichtigt. Es hatte einer ganzen Schar von Dienerinnen bedurft, sie zu besänftigen, bis sie sich schließlich nur auf ihre Tränen konzentriert hatte.
Bis sie nur noch resigniert gewimmert hatte.
Aber unter dieser gedämpften Anspannung brodelte etwas Unheilvolles. Vergangene Nacht – als sich das zweite Paar Tore, das zum Schloss führte, knirschend hinter ihrem Geleitzug geschlossen hatte –, war die Luft um Mariko zum Verstummen gekommen. Die schwache Brise hinter der gewebten Leinwand ihrer Sänfte hatte ein letztes Mal aufgeseufzt. Eine Eule hatte am Firmament gerufen, ihr Schrei hallte von den Steinwänden wider.
Wie eine Warnung.
Hier in Inako würde man Mariko nicht einen Moment Bedenkzeit gewähren. Nicht, dass sie sich das gewünscht hätte. Sie würde sich nichts dergleichen zubilligen.
Denn tief im Inneren genau dieses Schlosses erwartete den letzten aus einer Reihe gefeierter Shōgune sein Schicksal: das endgültige Urteil der kaiserlichen Stadt. Und die Lügen, die diese Stadt trugen – Lügen, gehüllt in Seide und Stahl –, schimmerten unter der Oberfläche, bereit, Gestalt anzunehmen. Was immer es auch kostete, Mariko würde sie zu dem formen, was sie von Anfang hätten sein sollen: Die Wahrheit.
Sie biss die Zähne zusammen. Sie wappnete sich für den bevorstehenden Kampf. Er würde in nichts den Kämpfen ähneln, auf die Ōkami und der Schwarze Clan sie im Jukaiwald vorbereitet hatten. In diesem Kampf hatte sie keine Waffen aus Holz und Metall und Rauch zur Verfügung. Stattdessen war sie mit nichts bewaffnet als ihrem Geist und ihrem Mut. Dies war exakt die Art Kampf, auf die sie sich unbewusst als Kind vorbereitet hatte, wenn sie sich mit ihrem Bruder Kenshin gemessen hatte.
In einem Spiel von Verstand gegen Muskelkraft.
Hier in Inako war Marikos Panzer nicht gehärtetes Leder und ein verzierter Helm. Es war Parfüm und gepuderte Haut. Sie musste Prinz Raiden – ihren Verlobten – davon überzeugen, dass er ihr vertrauen konnte. Er sollte sie als das unglückliche Opfer sehen, nicht als die zu allem bereite Schurkin.
Obwohl ich vorhabe, in jeder Hinsicht eine Schurkin zu sein.
Wenn es Hattori Mariko auch alles kosten würde – selbst ihr Leben –, würde sie nicht zulassen, dass diejenigen, die sie liebte, denen zum Opfer fielen, die sie zerstören wollten. Sie würde endlich die Wahrheit darüber erfahren, wer sich verschworen hatte, sie an jenem Tag im Wald umzubringen. Warum dem Schwarzen Clan die Tat in die Schuhe geschoben wurde. Und welcher tiefere Grund ihren Plänen zugrunde lag.
Selbst wenn diejenigen, die den Kern der Verschwörung bildeten, zur kaiserlichen Familie gehörten.
Selbst wenn ihre eigene Familie ins Visier geriete.
Der Gedanke ließ sie so erzittern, als ob das Wasser im Furo plötzlich zu Eis gefroren wäre.
Kenshin hatte seine Wahl längst getroffen, lange bevor er im Jukaiwald einmarschiert war, sein Familienwappen neben dem des Kaisers gehisst. Schon bevor er die Soldaten Pfeile auf seine Schwester hatte abfeuern lassen, in einem Schauer von Feuer und Asche. Er war Samurai, und ein Samurai befolgte die Befehle seines Herrschers bis zum Tod. Er stellte keine Fragen.
Sein Gelöbnis war das des unerschütterlichen Gehorsams.
Aber die Zeit beim Schwarzen Clan hatte Mariko gelehrt, dass blindes Vertrauen einen hohen Preis hatte. Sie weigerte sich, den Namen des Hattori-Clans mit denen der trägen Adligen in der kaiserlichen Stadt gleichzusetzen. Genau jener Adligen, die lediglich darauf aus waren, ihre Taschen zu füllen und an Einfluss zu gewinnen, zu Lasten der Unterdrückten. Also der Leute, die sie eigentlich schützen sollten – wie die ältere Frau, die für die Kinder im Bezirk Iwakura sorgte, die alle abhängig waren von der Unterstützung durch Ōkami und den Schwarzen Clan.
Beschützen.
Mariko zog die Knie an die Brust, schützte ihr Herz, um zu unterbinden, dass sich die schlimmsten ihrer Gedanken dort festsetzten.
Was, wenn Ōkami schon tot wäre?
Sie umfasste die Knie fester.
Nein, er ist nicht tot. Er kann gar nicht tot sein. Sie werden aus seiner Hinrichtung ein grausames Schauspiel machen wollen.
Und wenn sie das tun, bin ich da, um ihm zu helfen.
Es war merkwürdig, sich vorzustellen, dass Mariko die Kraft besäße, jemanden, den sie liebte, zu beschützen. Sie hatte in der Vergangenheit nie die richtigen Worte gewusst. Hatte nie gewusst, mit welchen Waffen sie kämpfen musste.
Ihr Verstand könnte ein Schwert sein. Ihre Stimme könnte eine Axt sein.
Ihre Wut könnte ein Feuer entzünden.
Beschützen.
Mariko würde nicht zulassen, dass Ōkami – der Junge, der inmitten der tiefsten Nacht ihr Herz gestohlen hatte, in einem Wald voll rauschender Bäume – alles verlor, um das wiederzuerlangen, wofür er gekämpft hatte. Genauso wenig würde Mariko zulassen, dass sie etwas verlöre, das sie liebte. Sie hatte aus dem Schatten zugesehen, wie Kenshin Soldaten gestattete, im Jukaiwald über sie herzufallen. Fühlte den Schmerz über den Verrat ihres Bruders bei all seinen fragenden Blicken. Sie hatte sich auf die Zunge gebissen, als dieselben Soldaten Ōkami gezwungen hatten, im Dreck niederzuknien und sich zu ergeben. Als sie ihn von oben herab verspottet und verhöhnt hatten.
Mariko schluckte, Bitterkeit breitete sich in ihrer Kehle aus.
Nie wieder. Ich werde dich beschützen, egal um welchen Preis.
«Jetzt sieh dir diese Nägel an.« Die Furchen auf der Stirn der Dienerin vertieften sich, als sie sprach, und Marikos Überlegungen wurden unterbrochen. Die Ermahnung beschwor noch mehr Erinnerungen an Marikos Kindheit herauf. »Sie sehen aus, als hättest du dein ganzes Leben in Dreck und Steinen gewühlt.« Sie machte tss und inspizierte Marikos Finger noch weiter. »Sind das die Finger einer Herrin oder eines Küchenmädchens?«
Marikos Blick trübte sich, als sie auf ihre vernarbten Knöchel sah. Ein anderes Paar Hände formte sich vor ihrem inneren Auge, die schwieligen Finger mit ihren verflochten. Verschnürt. Dadurch noch stärker.
Ōkami.
Mariko blinzelte. Ordnete das Chaos ihrer Gedanken zu etwas Zusammenhängendem. Sie biss sich auf die Lippen und öffnete die Augen. »Der Schwarze Clan … sie haben mich für sie arbeiten lassen.« Ihre Stimme klang klein. Unbedeutend. Genau, wie sie beabsichtigt hatte.
Die Dienerin schnaufte daraufhin, ihrem Gesichtsausdruck nach hatte sie immer noch Bedenken. »Es wird die Kunst einer Zauberin brauchen, diesen Schaden zu beheben.« Ihre Worte waren noch genauso harsch, unberührt vom Anblick von Marikos geheuchelter Verzagtheit. Merkwürdig. Obwohl der Tadel dieser Frau in keiner Weise tröstlich war, wärmte er Mariko dennoch. Er erinnerte sie an das ruhige, allgegenwärtige Urteil ihrer Mutter.
Nein. Das war es nicht.
Die Dienerin erinnerte sie an Yoshi.
Beim Gedanken an den grummelnden, gutmütigen Koch begannen Marikos Augen ernsthaft zu tränen.
Die Dienerin beobachtete sie, eine Augenbraue hochgezogen.
Dieses Mal bewirkte die Beurteilung durch die ältere Frau eine vollkommen andere Reaktion.
Marikos Haut kribbelte vor Ärger. Sie zog ihre Hand weg und wandte den Blick ab, als ob sie Angst hätte. Sich schämte. Der düstere Ausdruck der Dienerin verlor etwas von seiner Strenge. Als ob Marikos Verlegenheit ein Gefühl wäre, das sie verstehen und akzeptieren könnte. Als sie das nächste Mal Marikos Hand nahm, war ihre Berührung vorsichtig. Beinahe sanft.
Im selben Moment, in dem Mariko versuchte, ihren Ärger zu drosseln, fesselte etwas ihre Aufmerksamkeit.
Meine Angst – selbst wenn sie gespielt ist – hat mehr Gewicht, wenn sie zusammen mit Wut daherkommt.
Eine der beiden jungen Frauen, die der ruppigen Dienerin zur Hand gingen, verneigte sich neben dem hölzernen Zuber, dann hob sie einen Stapel schlammiger, ausgefranster Kleidung ans Licht. »Herrin, darf ich dieses hier beseitigen?« Ihr rundes Gesicht mit der Stupsnase verzog sich angewidert.
Es handelte sich um die Kleidung, die Mariko im Jukaiwald getragen hatte, während sie als Junge verkleidet gewesen war. Sie hatte sich geweigert, den verblichenen grauen Kosode und die Hose abzulegen, selbst auf Kenshins Bitte hin. Sie waren jetzt alles, was sie noch besaß. Marikos Augen weiteten sich in einem, wie sie hoffte, bedauernden Ausdruck, und sie schüttelte den Kopf. »Bitte lass sie waschen und in der Nähe aufbewahren. Obwohl ich mir nichts sehnlicher wünsche als zu vergessen, was mir zugestoßen ist, scheint es wichtig, zumindest eine Erinnerung daran zu behalten, was passiert, wenn man im Leben eine falsche Abzweigung nimmt.«
Die übellaunige ältere Dienerin brummte missbilligend bei diesen Worten. Ein anderes diensttuendes Mädchen ergriff eine von Marikos Händen und begann ihr mit einer Bürste aus Pferdehaarborsten die Nägel zu scheuern. Währenddessen goss die junge Dienerin mit dem runden Gesicht und der Stupsnase feine Emulsionen, die die Haut geschmeidig machten, in das dampfende Wasser und fügte frische Blütenblätter hinzu. Die Farbe des Öls schimmerte um Mariko wie verblassende Regenbögen. Ein Blütenblatt blieb an ihrem Knie hängen. Sie senkte das Bein ins Wasser und sah zu, wie das Blatt davontrieb.
Der Anblick erinnerte sie daran, was ihr der alte Mann an der Wasserstelle in der Nacht, in der sie als Junge verkleidet zum ersten Mal auf den Schwarzen Clan gestoßen war, erzählt hatte. Er hatte ihr gesagt, sie habe in ihrer Persönlichkeit einen großen Anteil des Elements Wasser. Mariko hatte ihm so schnell wie möglich widersprochen. Wasser war viel zu flüssig und unbeständig. Ihre Mutter hatte immer gesagt, Mariko sei wie die Erde – eigensinnig und allzu direkt.
Jetzt muss ich Wasser sein, mehr als je zuvor.
Mariko fragte sich, was aus dem Schwarzen Clan geworden war, nachdem sich Ōkami ihrem Verlobten ergeben hatte. Fragte sich, wie es Yoshi und Haruki und Ren und all den anderen nach diesem schrecklichen Schlag ergangen war.
Erst vor drei Nächten hatten sie erfahren, dass ihr Anführer sie jahrelang getäuscht hatte. In Wahrheit war er gar nicht Takeda Shingens Sohn. Der Junge, dem sie fast zehn Jahre gefolgt waren und den sie Ranmaru genannt hatten, war stattdessen Asano Naganoris Sohn. Er hatte Takeda Ranmarus Rolle angenommen, um seinen besten Freund zu schützen und den Betrug seines Vaters wiedergutzumachen – ein Verrat, der zur Zerstörung ihrer beiden Familien geführt hatte. Der wahre Name dieses Jungen war Asano Tsuneoki.
Sie waren alle getäuscht worden.
Und Marikos Verlobter – Prinz Raiden – hatte den Wald mit einem Preis verlassen, der es wert gewesen war, auf den Grabhügel seines Vaters gelegt zu werden.
Mit dem wahren Sohn Takeda Shingens, des letzten Shōguns von Wa: Ōkami.
Ärger glomm heiß und schnell in Marikos Brust auf. Das Gefühl von Schuld wand sich durch ihre Eingeweide. Sie wagte es, in einer Wanne mit parfümiertem Wasser zu sitzen, ließ zu, dass ihre Haut und ihr Haar gebürstet und bis zur Perfektion poliert wurden, während so viele, die ihr nahestanden, unbeschreibliche Schicksale erlitten.
Sie versuchte, besonnen einzuatmen.
Es war notwendig. Das war der Grund, warum sie Kenshin gebeten hatte, sie nach Inako zu bringen. Wenn Mariko beabsichtigte, entsprechend der Pläne zu handeln, die sie während ihrer Reise vom Jukaiwald zur Kaiserstadt geschmiedet hatte, musste sie sich im Zentrum der Macht aufhalten. Mariko musste eine Möglichkeit finden, Ōkami zu befreien. Sie musste ihren Verlobten überzeugen, dass sie die bereitwillige, einfältige junge Frau war, die er sich doch sicher als Braut wünschte. Dann – wenn sie ein gewisses Maß an Vertrauen gewonnen hätte – konnte sie eine Möglichkeit suchen, Informationen nach außen zu leiten. An diejenigen, die dafür kämpften, den Charakter der Kaiserstadt zu ändern und die Gerechtigkeit dem Volk gegenüber wiederherzustellen.
Das Übel von seinem viel gerühmten Sockel zu stürzen.
»Steh auf«, verlangte die Dienerin brüsk.
Respekt vor dem Alter – ungeachtet des Status – brachte Mariko dazu, der groben Frau stumm zu gehorchen. Sie ließ sich von der Frau zu dem größten Stück polierten Silbers führen, das sie in ihrem Leben gesehen hatte. Ihre Augen weiteten sich beim Anblick ihres nackten Körpers im Spiegel.
Ihre Zeit im Wald hatte Mariko auch äußerlich verändert. Die Kanten ihres Gesichts waren ausgeprägter. Sie war schmaler geworden. Was vorher gertenschlank gewesen war, war jetzt fein geschliffen. Muskeln, von denen sie nicht gewusst hatte, dass sie sie besaß, bewegten sich mit ihr wie kleine Wellen auf einem Teich.
Sie war jetzt stärker, auf mehr als nur eine Weise.
Die ältliche Dienerin machte wieder tss. »Du bist so dünn wie Schilfrohr. Kein junger Mann wird Haut und Knochen anfassen wollen, am wenigsten von allen jemand wie Prinz Raiden.«
Wieder stieg der Drang zu reagieren in Marikos Kehle hoch. Obwohl sie den Grund für die Verachtung der Frau nicht wirklich erkennen konnte, vermutete sie, dass die Dienerin dachte, ein Mädchen, das inmitten von Banditen gelebt hatte, verdiene einfach nicht, in die kaiserliche Familie einzuheiraten. Wäre die Aufmerksamkeit eines Prinzen nicht wert. Die Wahrheit flackerte hell in ihr auf. Sie war mehr als ein Objekt der Begierde eines Mannes. Aber was diese besondere Eroberung anging, hatte die Dienerin recht. Sie musste wirklich mehr essen, wenn sie vorhatte, ihre Rolle zu spielen.
Sei Wasser.
Mariko lächelte zwischen zusammengebissenen Zähnen. Ließ ihre Lippen beben, als ob sie erschöpft wäre. Schwächlich. »Du hast recht. Bitte tu, was immer du kannst – welche Magie auch immer du beherrschst –, um mich wieder zu meinem früheren Ich zu machen. Zu einer jungen Frau, die dem Prinzen gefallen könnte. Ich will nichts mehr als vergessen, was mir widerfahren ist.« Sie gab sich Mühe, aufrechter zu stehen. Versuchte, stolz auszusehen.
Obwohl die Falten auf ihren Zügen sich vertieften, nickte die Dienerin. »Mein Name ist Shizuko. Wenn du tust, was ich sage, ist es möglich, die Folgen dieses … Missgeschicks in Ordnung zu bringen.«
Mariko schlüpfte mit den Armen in das angebotene seidene Unterkleid. »Mach, dass ich einem Prinzen gebührend aussehe, Shizuko.«
Shizuki schnaubte und räusperte sich, dann machte sie den anderen Dienerinnen ein Zeichen, näherzutreten. In ihren Armen trugen sie Ballen von glänzenden Stoffen. Stapel von Brokat und bemalter Seide, eingehüllt in durchscheinendes Papier. Tabletts voll Jade und Silber und Schildpattspangen.
Mariko fuhr mit einer Fingerspitze eine silberne Haarspange entlang.
Und dachte an das letzte Mal, als sie solch eine in der Hand gehabt hatte.
In der Nacht, als sie sie einem Mann ins Auge gestochen hatte, der auf sie losgegangen war.
Mariko wusste, was zu tun war. Denen zuliebe, die ihr lieb und teuer waren, musste sie äußerlich groß und stolz erscheinen.
Und unglücklich.
Sie sprach fast flüsternd, als ob ihre Worte nichts als ein nebensächlicher Gedanke wären. »Die kaiserliche Familie wird wollen, dass ich stark wirke, so, wie sie selbst es sind.«
Genau so, wie sie sein müssen.
Denn Hattori Mariko hatte einen Plan.
Und diese ahnungslose Frau hatte ihr gerade das erste Teil des Puzzles zugespielt.
Der Ochse und die Ratte
Ihr Verhältnis war kompliziert.
Geformt aus Hass, aufgebaut auf einem Fundament aus Täuschung. Ein Verhältnis, das verwurzelt war in den Lebensplanungen zweier junger Mütter, die beide ihre Söhne in gegenseitiger Feindseligkeit aufgezogen hatten, während sie um die Aufmerksamkeit eines gelangweilten Herrschers buhlten. Sich danach gesehnt hatten, dass er ihnen seine Gunst erwies.
Eine Mutter hatte das Spiel gut gespielt, aber sie hatte den Wettkampf mit Vorteilen begonnen, sowohl mit sichtbaren als auch unsichtbaren. Eine Frau wie eine Nymphe – sie hatte das Herz des künftigen Kaisers vor vielen Jahren erobert. Eine Frau, in deren Adern neben Schönheit und Magie List floss. Sie hatte seine Träume Wirklichkeit werden lassen. Hatte ihn gelehrt, mit allen möglichen Geschöpfen Zwiesprache zu halten und Geheimnisse im Schatten zu verbergen. Eine Frau, die ihm gezeigt hatte, was es bedeutete, zu lieben und geliebt zu werden. Kanako, die dem Kaiser seinen erstgeborenen Sohn geschenkt hatte, Raiden. Kanako, die auf den zweiten Platz in dessen Leben degradiert worden war, trotz ihrer Vorherrschaft im Herzen des Kaisers.
Die andere Frau war dem Kaiser aus Pflicht und Familienehre untergeschoben worden. Sie – mit ihrem Millionen-Koku-Landbesitz als Mitgift – hatte schwer auf ihm gelastet, ihn ausgenutzt und ihn seiner wahren Liebe gestohlen. Aber er hatte sie dafür bezahlen lassen. Jahrelang hatte Kaiserin Genmei eine einsame Handvoll kichernder Gefolgsleute regiert und sonst nichts, obwohl sie das Glück gehabt hatte, dem Kronprinzen Roku das Leben zu schenken.
Diese beiden Frauen hatten ihre Söhne dazu erzogen, sich gegenseitig zu hassen.
Doch trotz aller Bemühungen ihrer verfeindeten Mütter hatte sich eine unwahrscheinliche Freundschaft zwischen den Halbbrüdern entwickelt.
Im Frühjahr seines zehnten Lebensjahres brach sich Raiden ein Bein, als er vom Pferd fiel. Während seine Wunde heilte, zauberte der winzige Roku Süßigkeiten herbei, die er in seinem seidenen Kimono-Ärmel versteckt hatte. Später – als Roku sich als elfjähriger Junge eine lebensgefährliche Krankheit zugezogen hatte – saß Raiden an seinem Bett und erzählte ihm unzüchtige Geschichten, die Roku noch gar nicht verstand.
Aber der jüngere Bruder hatte trotzdem gelacht.
Ihre Mütter hatten ihnen weiterhin in die Ohren geflüstert und angesichts ihres gemeinsamen Lachens die Stirn gerunzelt, aber die beiden Brüder klammerten sich fest an das gemeinsame Band und schmiedeten eine dauerhafte Freundschaft. Was als ein zögerliches, kindliches Vertrauen begonnen hatte, war in letzter Zeit zu einer unerschütterlichen Liebe herangewachsen. Dennoch fragten sich die, die weiterhin hartnäckig hinter ihrem Rücken flüsterten, oft, ob die beiden Halbbrüder die wahre Prüfung ihrer Verbundenheit erst noch vor sich hatten.
Die Prüfung von Macht gegen Recht.
Der Ochse gegen die Ratte. Der eine die Kreatur des Fleißes, der andere die Kreatur der Genialität. Zwei Seiten derselben schlechten Münze.
Heute Abend standen die beiden Söhne von Kaiser Minamoto Masaru zusammen in einem Kreis von prasselnden Fackeln, im niedrigsten Außenbereich von Schloss Heian. Der größere, ältere Bruder lehnte gegen eine Steinwand, in seiner polierten Rüstung spiegelte sich die helle Flamme. Der kleinere, trickreichere Bruder schritt langsam vor einer Steintreppe auf und ab, die in die Dunkelheit hinabführte, seine seidene Kleidung makellos und schimmernd, selbst in den düstersten Außenbereichen des Schlosses.
»Raiden«, sagte der neue himmlische Herrscher von Wa, seinem Bruder den Rücken zugekehrt.
Die Körperhaltung wachsam, stieß sich Raiden von der Wand ab. »Mein Herrscher.«
»Ich weiß, dass du Fragen hast.«
Ein nachdenklicher Ausdruck überzog das Gesicht des älteren Bruders.
»Sorgen eher als Fragen.«
»Ah, aber du vergisst eins: Befürchtungen sind etwas für die Unsicheren.« Roku lächelte vor sich hin, sein Rücken immer noch dem Bruder zugekehrt. »Und Fragen für die Schlechterzogenen.«
Raidens kühles Gelächter schnitt durch die Stille. »Ich nehme an, das habe ich verdient. Vater wäre stolz zu hören, dass du mich daran erinnerst.«
»Selbst wenn er manches vermissen ließ, hatte unser Vater immer eine schneidende Bemerkung parat.« Roku wandte sich um und blickte seinen älteren Bruder an. »Aber ich habe kein Interesse daran, dass jemand mich offen herausfordert, Bruder.« Sein Ton war eine Warnung, seine Züge angespannt.
Raiden verschränkte die Arme, das gehärtete Leder seiner Brustplatte knarzte bei der Bewegung. »Im Großen und Ganzen will ich dich nicht herausfordern. Ich will dir nur Unfrieden ersparen.«
»Dann höre auf, der Anlass dazu zu sein.« Roku runzelte die Stirn. »Unser Vater kam unter fragwürdigen Umständen ums Leben, und es ist von großer Bedeutung, dass wir erfahren, wer für seinen vorzeitigen Tod verantwortlich ist. Wenn ich in diesem Moment nicht stark wirke – es nicht schaffe, meine Herrschaft über jene zu behaupten, die mich beobachten wie der Adler seine Beute -, wird dies für immer als Makel meine Regentschaft belasten. Entschlossenes Handeln ist nötig, und ich erwarte, dass du mit gutem Beispiel, mit unerschütterlichem Gehorsam, vorangehst.«
Den Rücken gerade und das Kinn stolz erhoben, bewegte sich Roku auf die Steintreppe zu und begann, sie hinunterzusteigen. Eine Hand schoss vor, um ihn aufzuhalten. Eine der wenigen Hände, denen es überhaupt noch gestattet war, ihn straflos zu berühren.
»Glaubst du wirklich, dieser Junge ist verantwortlich für Vaters Tod?«, fragte Raiden.
Roku antwortete nicht. Er schüttelte lediglich die Hand seines Halbbruders ab.
»Das ist unter deiner Würde, Roku.« Raidens Stimme war sanft.
Der junge Kaiser hob eine Augenbraue, fast wie zur Warnung. Ein Lächeln verzog eine Seite von Raidens Gesicht. »Mein Herrscher«, besserte er nach und trat zurück, um sich zu verneigen.
»Es ist nie unter der Würde eines wahren Führers, seinem Feind entgegenzutreten.« Roku tat einen weiteren Schritt hinab, sein Bruder hob eine Fackel, um ihm den Weg zu leuchten. Das Licht tanzte über die mit Holz eingefassten Steine. »Ich möchte in das Gesicht von Takeda Shingens einzigem Sohn sehen und erfahren, welches Blut durch seine Adern fließt. Welche Furcht in seinen Augen lauert.« Sein Lächeln war eigentümlich gelassen, wie Eis, das dem heulenden Wind trotzt.
Raiden folgte dichtauf, und sein Bemühen, seine Worte und seine Gedanken zu ordnen, waren allzu offensichtlich. »Wenn du ihn nicht für verantwortlich an Vaters Tod hältst, warum musst du unbedingt etwas über ihn wissen? Mach Schluss mit ihm und du bist fertig damit.«
»Ich habe nie gesagt, dass ich ihn für unschuldig halte, Bruder. Der Junge ist ein paar Tagen vor dem vorzeitigen Tod des Kaisers aufgetaucht.«
»Ein Zufall. Wir haben ihn aus dem Wald vertrieben.«
»Ich glaube nicht an Zufälle.« Ein Augenblick verging, bis Roku wieder das Wort ergriff. »Erinnerst du dich an den Wasser-Obelisken, den Vater uns von einer Reise in den Westen mitgebracht hat, als wir klein waren?«
»Diese Apparatur, die die Tageszeit spiegelte? Sie zerbrach nach zwei Tagen. Wir wurden beide dafür bestraft.«
»Sie ist nicht zerbrochen. Ich habe sie auseinandergenommen.«
Raiden stockte auf diese Aussage hin. »Du wolltest herausbekommen, wie das Ding funktioniert?«
»Vielleicht.« Rokus und Raidens Blicke trafen sich. »Oder vielleicht wollte ich wissen, was sich in seinem Kern befand.«
»Dir hat es also einfach Spaß gemacht, es zu zerbrechen.«
»Nicht so infantil, Bruder.« Roku lachte leise. »Ich finde es leichter, etwas zu kontrollieren, wenn es in Stücken liegt. Der Schwarze Clan, Takeda Shingens Sohn, jeglicher Feind, der unsere Familie scheitern sehen will …« Seine Stimme verklang im Nichts, während er einen weiteren Schritt abwärts unternahm.
Raiden seufzte, seine Verdrossenheit nahm Überhand.
«Takeda Ranmaru ist nicht dein Feind. Glaube mir, wenn ich dir sage, dass die Gerüchte über ihn sein Ansehen über jede Vernunft hinaus aufgebläht haben.« Seine Lippen kräuselten sich zu einem Hohnlächeln. »Er lebte den größeren Teil eines Jahrzehnts unter betrunkenen Bauern im Wald. Er ist ein Dieb und ein Taugenichts. Sonst nichts.«
Wie ein Peitschenschlag kam Rokus Antwort. »Dieser Taugenichts ist der Sohn des Mannes, der gegen unseren Vater gearbeitet und sich unserer Familie jahrelang erwehrt hat. Herr Shingen führte den letzten Aufstand in unserem Land an.«
»Das heißt aber nicht, dass es bei seinem Sohn auf das Gleiche hinausläuft. Ich habe ihn geschlagen, ohne überhaupt einmal das Schwert in seine Richtung zu heben.« Die Fackel in Raidens Hand flackerte, als eine Bö aus gallenbitterer Luft auf sie zukam.
Unbeirrt fuhr Roku fort, sein Lächeln wieder gelassen. »Ich habe es schon gesagt, aber deine Arroganz ist dir nicht dienlich, Bruder.«
»Deine Neugierde wird dir hier auch keinen guten Dienst erweisen, mein Herrscher«, konterte Raiden. »Gestatte mir einfach, ihn zu töten. So werden wir ihn los, schnell und leise.«
Roku verschränkte die Hände hinter dem Rücken. »Selbst wenn er sich als unschuldig erweisen sollte, sollte sein Tod spektakulär sein.«
»Na gut, dann. Wir können ihn in der Bucht von Yedo ertränken. Kopfüber, so wie Vater es mit Asano Naganori gemacht hat. Oder lass ihn von den Befestigungsmauern hängen, bis der Rumpf von seinen Armen abreißt.«
»Vielleicht«, stimmte Roku zu. »Aber jetzt noch nicht. Es hilft nichts, Unkraut nur zu hacken. Man muss es an der Wurzel ausreißen.« Er schloss die Augen, als ob er so Klarheit in seinem Kopf schaffen würde. Seinen Gedanken Deutlichkeit verleihen würde. »Dies war der Fehler, den unser Vater gemacht hat. Es war nicht sein Ansinnen, den Samen von Takeda Shingens Zwiespalt zutage zu bringen. Er hat sich nicht die Zeit genommen, seinen Feind in Stücke zu zerlegen, also kam er zu Tode.« Seine Augen blitzten auf, ein Schatten fiel über sein Gesicht, wie Sturmwolken, die sich über einem See sammelten. »Ich werde ein besserer Kaiser sein als unser Vater. Ich werde jedes einzelne dieser Unkräuter finden und sie an der Wurzel ausreißen.« Diese letzten Worte sprach er leise, mit einer Stimme, in der Drohung mitschwang.
Als Raiden antwortete, tat er es mit großer Vorsicht. »Vielleicht hast du recht, mein Herrscher. Niemand kann leugnen, dass die Takeda-Familie ein Problem war, seit Herr Shingen die Pläne unseres Vaters für das Kaiserreich infrage stellte.« Er atmete tief ein. »Aber vielleicht, wenn wir lernen, seinen Sohn zu kontrollieren – oder ihn sogar auf unsere Seite zu ziehen –, könnte es möglich sein, das zu tun, was unserem Vater nicht gelang, und unser Land vereinen.«
Roku betrachtete seinen Bruder, als ob er es mit einem törichten Kind zu tun hätte. Eines, dem gegenüber er aber echte Gefühle hegte. »Unser Land vereinen?« Seine Züge verhärteten sich einen Augenblick, ein gallebitteres Lachen ertönte von seinen Lippen. »Ich weiß, wo meine Stärken liegen. Und du?«
»Meine Stärken liegen im Dienen und Beschützen meines Herrschers.« Ein kaltes Licht funkelte in Raidens Augen. »Und Rache zu üben an jenen, die uns zerstören wollen.«
»Wenn du mich beschützen möchtest, Bruder, musst du lernen, jene zu kontrollieren, die dich umgeben.« Roku nahm einen tiefen Atemzug. »Die Rache wird zu ihrer Zeit kommen. Kontrolle ist das, was ich brauche. Angst wird meine Waffe sein.«
Erkenntnis malte sich auf Raidens Gesicht ab. »Du willst Takeda Ranmaru durch Angst kontrollieren?«
Roku nickte. »Zuerst müssen wir ihm einen Grund zur Angst geben – nicht Angst vor etwas Einfachem wie dem Tod. Etwas Tiefergehendes. Und die Aufgabe beginnt mit dem Geist. Wenn ich will, dass das Volk von Wa mich uneingeschränkt respektiert, muss dies meine Vorgehensweise sein.«
Raiden hielt nachdenklich inne. »Du hast Sorge, dass dein Volk dich nicht respektieren wird? Das werden sie, denn du bist ihr himmlischer Herrscher. Es ist ihre Pflicht und dein Recht.«
»Nein, Bruder.« Roku schüttelte den Kopf. »Respekt ist keine garantierte Sache. Respekt will verdient sein.« Mit diesen Worten schritt er zügig die letzten Stufen hinab und hielt dann inne. Er ließ die Augen sich an die Wand aus Dunkelheit gewöhnen, die er vor sich hatte, und murmelte etwas.
Wie ein Geist tauchte ein Mann auf. In seinen skelettartigen Händen trug er eine kleine hölzerne Truhe, eingebunden in Stäbe von stumpfen Eisen. Auf den ersten Blick schien das Eisen von Rost geschädigt, aber eine Andeutung von etwas viel Düsterem durchdrang die Luft, wie der Geruch nach Kupfer, das zu lange dem Regen ausgesetzt war. Der Mann verbeugte sich, seine Kapuze fiel tiefer über eine Stirn, die mit Brandflecken übersät war. Wortlos gab Roku dem Mann ein Zeichen, ihm zu folgen.
Raiden blieb zurück, seine Gesichtszüge in Aufruhr verzogen. Er spähte in die Dunkelheit vor sich, dann wandte er sich zu dem hinter seinem Rücken verbliebenen Licht, sein Blick fing eine Bewegung oben am Anfang der Stufen auf.
Die fließende Gestalt seiner Mutter glitt im Schein einer Fackel vorbei. Sie blieb stehen, als sie ihn sah, und neigte den Kopf zur Seite, ihr ungebundenes Haar ein tintenschwarzer Wasserfall über einer Schulter. Ohne ein Wort zog sie die Rauchsträhnen der nahen Fackel zwischen die Hände, während sie die Finger in kleinen Kreisen drehte. Auf ihr Kommando begannen sich Gestalten herauszubilden. Sie verdichteten sich im Schein des Feuers und erwachten zum Leben, als sie ihnen sanft Atem einhauchte, dann sandte sie sie in Richtung ihres Sohnes.
Ein widerliches Gewürm, das unter den Hufen eines gewaltigen Stieres zermalmt wurde.
Raiden blickte seine Mutter stirnrunzelnd an. Als er jünger gewesen war, hatte ihn die Magie seiner Mutter bezaubert. Mit ihrer Hilfe hatte sie Geschichten auf eine Art zum Leben erweckt, von denen andere Jungen nur träumen konnten. Ihre Magie hatte ihm Trost gespendet, wenn er die abschätzige Beurteilung durch andere am Hof zu sehr spürte. Sie war der Grund dafür gewesen, dass ihm die Adligen ein gewisses Maß an Respekt erwiesen, trotz der Umstände seiner Geburt.
Die Angst vor der Magie seiner Mutter war eine Art Kontrolle gewesen, denn Magie war eine große Seltenheit. Und Magie wie die seiner Mutter? Sogar noch seltener. Nur einmal in einer Generation mochte sie vorkommen, gewährt von den Geistern einer Welt, die für zahllose Menschen ihr Leben lang verloren war.
Es handelte sich um eine Magie, die er selbst nicht besaß. Eine Magie, die Raiden einmal versucht hatte zu verstehen, nur um zu entdecken, dass er sie nie beherrschen würde, denn er war nicht auserkoren, sie auszuüben.
Er war nicht mit dem Talent gesegnet.
Verärgerung zog über sein Gesicht. Er hatte recht gehabt, die Beratung seiner Mutter zurückzuweisen. Nach nur kurzem Zögern folgte Raiden den Schritten seines Herrschers und kehrte der Magie, die ihn als Kind gerettet hatte, den Rücken.
Kanako sah zu, wie ihr einziger Sohn in der Dunkelheit unter ihr verschwand. Ein plötzlicher Schmerz breitete sich in ihrem Herzen aus. Er wand sich durch ihre Brust und nistete sich in ihrem Magen ein wie ein schlüpfriger Aal, der im Schilfgeflecht lauerte, immer präsent.
Sie wusste, dass ihr kriegerischer Sohn nie in seiner Loyalität gegenüber seinem Herrscher wanken würde, trotzdem hatte sie ihn auf die Probe gestellt. Nur um zu sehen, wie er reagieren würde. Nur um zu sehen, ob er vielleicht seine Meinung ändern würde. Raiden war in diesem besonderen Stadium seines Lebens, wo er sich alles erhoffte, dachte, er wüsste alles und erwartete, ewig zu leben. Gelegentlich führte das zu unvorhersehbaren Folgen.
Aber die Zeit hatte Kanako gelehrt, dass das Erwartete selten eintrat. Der Tod klagte immer seinen Tribut ein. Das einzig unerschütterlich Wahre blieb die Macht. Die Macht, die man hatte. Die Macht, die man gab.
Die Macht, die man geheim hielt.
Raidens Loyalität seinem jüngeren Bruder gegenüber verlief wie der Fluss Kamo, der das Land teilte, durch die Mitte der Kaiserstadt. Vielleicht standen Kanako und ihr Sohn von Zeit zu Zeit an gegenüberliegenden Ufern, aber wenn die Pläne, die sie über Jahre gesponnen hatte, nun endlich zum Ziel führen würden, würde er neben ihr stehen. Ohne Frage.
Es traf zu, dass Raiden seinen Bruder mit einer bewundernswerten Art von Wildheit liebte. Aber Kanako war seine Mutter, und sie hatte viel aufs Spiel gesetzt, um ihm alles zu geben. Hatte vieles von vielen genommen, selbst ihren Geist, ihre Gedanken und Herzen.
Sie würde nicht zulassen, dass er es verschwendete, am wenigsten an diese wehleidige Ratte in gelber Seide.
Seufzend trat Kanako in einen Kreis, der Saum ihres Kimonos hob sich in die Luft und schluckte sie wie verblühende Blütenblätter, bis sie verschwand und nichts zurückließ außer einer Spur ihres Parfüms.
Geschöpfe des Windes und des Himmels
Es war eine magische Nacht. Eine Nacht voller Geheimnisse, in deren Tiefe eine unverkennbare Kraft pulsierte.
Ein Versprechen, eine Drohung.
Es hatte schon vorher begonnen, als der Geruch von Metall und Moos in der Luft aufgekommen war. Der nachfolgende Sommersturm hatte alles belebt, was er berührte, und so eine bis in die Nacht nachklingende Üppigkeit gebildet.
Das Versprechen.
Direkt nach dem ersten vereinzelten Regen hatte ein Blitz den Himmel zerrissen. Donner hatte in den entfernten Bergen gegrollt.
Die Drohung.
Die Festung Akechi Takamoris widerstand unerschütterlich dem Sturm, so wie sie es schon fünf Generationen lang getan hatte, in unverbrüchlichem Dienst gegenüber dem Minamoto-Clan. Immerhin war das bisschen Plätschern nichts gegen den Monsunregen, der mit Sicherheit in den nächsten Monaten folgen würde. Heute schien das Gewitter ganz im Widerspruch zu der Durchschnittlichkeit des Regens zu stehen. Als ob die Wolken ihre Drohung nur halbherzig ausgeführt hätten.
Als der Regen sich beruhigte – sein Klatschen wurde eins mit dem Klang zirpender Insekten und sich einbuddelnder Lebewesen –, erhoben sich neue Töne zwischen den Bäumen an der Grenze des Akechi-Besitzes.
Aus den tiefsten Tiefen der Schatten krochen Wesen hervor. Ihre Schemen und Umrisse schienen von der Nacht selbst geformt worden zu sein. Jeder einzelne ihrer Schritte hinterließ Spuren auf der Erde, wie von unsichtbarer Hand geleitet. Geschichten aus alten Zeiten hatten sie als Dämonen beschrieben, die aus dem Wald gekrochen kamen, einbestellt unter einem sich verdunkelnden Himmel. Diese Geschichten waren über die Jahre verlorengegangen, als die alte Magie mit jeder vergangenen Generation seltener wurde. Inzwischen gab es nur noch diejenigen, die mit den Fähigkeiten geboren wurden und diejenigen, die bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um sie zu erwerben, um ihnen Wahrheit einzuhauchen.
Doch dies hier waren keine Dämonen des Waldes, die zum Leben erweckt worden waren. Bis auf eine Ausnahme waren es Männer. Mindestens vierzig. Maskiert und in Schwarz gekleidet, trieb ein Ausdruck von Eile sie durch die Dunkelheit bis zu der Grundfeste des feindlichen Schlupfwinkels. Sie duckten sich nahe an den Boden und arbeiteten sich durch das sanft fließende Flussbett genau hinter den hoch aufgeschichteten Steinwänden der Festung von Akechi, dann hielten sie im Gleichtakt unter einer Ansammlung von Schatten. Die unsichtbare Hand teilte die Gruppe von Männern in zwei Teile, ohne einen Laut. Eine Gruppe duckte sich noch tiefer und glitt in einer einzigen Reihe auf das Schilf in der Nähe des hinteren Tors zu, perfekt synchron, ihre Schritte wie ein ungestörtes Kräuseln. Wenn die nächtliche Brise ohne Warnung plötzlich innehalten würde, wäre das einzige Geräusch das Dehnen von Kletterseilen und das Wispern von Schwertern, die gezogen würden.
Kurze Atemzüge der Vorahnung.
Die zweite Gruppe von Männern bewegte sich auf die Wand an der gegenüberliegenden Seite des Geländes zu. Die Männer drückten ihre Rücken gegen die Steine, während ihr Anführer – der Dämon in ihren Reihen – die Furchen oben betrachtete: die Kerben ausgeleiert an der Oberfläche, zwischen den mörtellosen Steinen deutliche Lücken. Dann ließ der maskierte Dämon den Pfiff eines Stares ertönen, sein Signal stieg frisch und klar in die Nacht. Dies war etwas, das er von seinem Vater Asano Naganori gelernt hatte: die Fähigkeit, einen nicht entdeckbaren Ruf erklingen zu lassen.
Aus dem Ring hoher Schatten am Rande des Waldes im Hintergrund spannte ein erfahrener Bogenschütze den Bogen, sein schwarzer Leder-Kosode und die glänzenden Augen begleiteten seine Bewegungen. Der erste Pfeil schoss durch die Dunkelheit, zischend näherte er sich seinem Ziel. Seine Stahlspitze drang zwischen die Steine der Mauer, eine Armeslänge über ihren Köpfen.
Asano Tsuneoki ergriff den Pfeil. Prüfte sein Gewicht. Dann stemmte er sich mit einem anmutigen Zug hoch. Noch bevor seine andere Hand es überhaupt zum nächsten Halt geschafft hatte, schoss ein zweiter Pfeil durch die Nacht, genau oberhalb des ersten. Die Pfeile flogen weiter an die Wand, während er sich zu den Zinnen nach oben hangelte, jede seiner Bewegungen ruhig und präzise, unterstützt durch die Stärke des Dämons, der durch seine Adern zuckte. Derselbe Dämon, der – wenn er unentdeckt unter dem Mondlicht blieb – in Gestalt einer jenseitigen Kreatur hervortrat: halb Wolf, halb Bär.
Als er oben angekommen war, atmete Tsuneoki tief durch und unterdrückte das Verlangen, im Triumph aufzuschreien. Ihre Aufgabe hatte gerade erst begonnen. Obwohl der Schwarze Clan in vier Tagen schon zwei der loyalen Untertanen des Kaisers von ihren Ländereien abgeworben hatte, würde genau dieses Bollwerk eine Bastion für seine Männer abgeben. Ein Ort, an dem sie sich in Ruhe neu formieren und eine neue Strategie entwerfen konnten, so lange es eben dauerte.
Außerdem wollte Tsuneoki gerade diese Festung. Immerhin war Akechi Takamori der erste Daimyō gewesen, der sich vor einem Jahrzehnt von Tsuneokis Vater abgewendet hatte. Der erste, der die Asano-Festung angezündet und sie voller Schadenfreude hatte abbrennen sehen.
Nun – nach zehn langen Jahren – würde Asano Tsuneoki sich einen Anteil dessen zurückholen, was seine Familie verloren hatte. Unter ihm blitzte der Funke eines Feuersteins durch die Dunkelheit. Eine in Pech getauchte Pfeilspitze fing Feuer, vervielfältigte sich in viele Feuerzungen, die unten eine gleichmäßige Reihe bildeten.
Im Gleichtakt legten die Männer des Schwarzen Clans ihre Pfeile ein, dann schossen sie sie alle gleichzeitig ab. Die flammenden Pfeile zielten himmelwärts – für einen furchterregenden Moment wie losgelöst -, bevor sie in einer Schleife über die Wand flirrten und in die Strohdächer auf der anderen Seite einschlugen.
In einem Wimpernschlag fing das Stroh Feuer. Heisere Stimmen und verschlafene Rufe drangen von überall aus dem Akechi-Schlosshof. Ein gespenstisches Wehklagen drang aus der Dunkelheit, wie das eines Tiers, das in einer Eisenfalle gefangen war und nun zusah, wie das Leben langsam aus seinem Körper rann. Die meisten Männer, die die Eingrenzung umringten, warteten. Zwei in Schwarz gehüllte Gestalten begannen die Wand zu erklettern und nutzten die eingelassenen Pfeile, um ihr Gewicht abzustützen.
Als das Feuer rasend und grell wurde, verstärkte sich das Geheul, sein Widerhall wie Katzengeschrei gegen einen mitternachtblauen Himmel. Ungeduldig hielt die zweite Gruppe im Schilf neben dem Hintertor still, die Nackenhaare gesträubt.
Oben auf den Zinnen gab Tsuneoki den Genossen unter sich ein Zeichen, während er zusah, wie Akechi-Diener mit Krügen und Eimern anfingen, auf das Tor zuzutorkeln. Schon bald wurden die Eisenstangen von den arglosen Leuten innen angehoben, und der Eingang öffnete sich knirschend. Männer und Frauen taumelten auf das Wasser zu. Im Triumph über den Erfolg ihres Plans sprangen die Mitglieder des Schwarzen Clans, die in der Nähe warteten, auf die Füße. Erwartung machte sich unter ihnen breit.
Noch ehe sie nur einen einzigen Schritt tun konnten, hielten sie inne, der Triumph abgelöst von einem Gefühl der Besorgnis.
Das Katzengeheul nahm an Tonhöhe zu, bis es zu einem kreischenden Stimmengewirr wurde. Zu einem durchdringenden Summen. Es dröhnte durch ihre Ohren, sodass einige der Männer schon mit den Händen die Köpfe umklammerten. Wortlos begannen die Leute, die durch die Tore gestolpert waren, ihre Töpfe und Krüge mit Wasser zu füllen. Eine Gestalt zu Pferde galoppierte an ihre Seite und schnalzte dabei mit der Peitsche.
Besorgt wegen der merkwürdigen Vorfälle nahm Tsuneoki eine Schlinge aus robustem Seil, die er um seine linke Hüfte geschlungen hatte. Er befestigte das Seil an den Zinnen und glitt daran auf den Boden des Akechi-Schlosshofes, so schnell, dass es zwischen seinen in Sandalen steckenden Füßen qualmte. In dem Moment, als er das Seil losließ, nahm er sein Katana