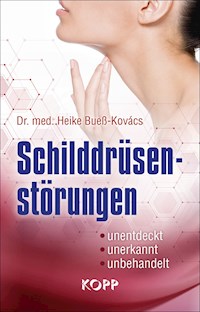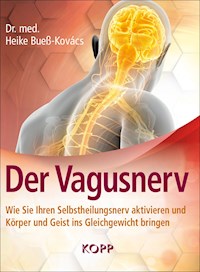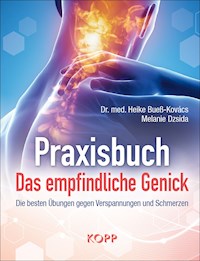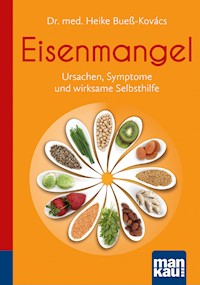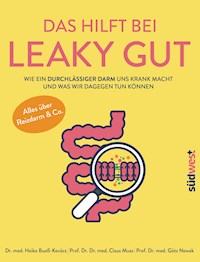
Das hilft bei Leaky Gut - Wie ein durchlässiger Darm uns krank macht und was wir dagegen tun können. Alles über Reizdarm & Co. E-Book
Heike Bueß-Kovács
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Südwest Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Intakter Darm = gesunder Darm
Beim sogenannten Leaky-Gut-Syndrom ist die schützende Barrierefunktion der Darmschleimhaut nicht mehr intakt; der Darm ist durchlässig. So können Schadstoffe ungehindert in den Blutkreislauf fließen, was fatale Folgen für den Organismus haben kann. Viele Krankheiten wie Reizdarm, Morbus Crohn und Verdauungsprobleme sind auf das Leaky-Gut-Syndrom zurückzuführen. Glücklicherweise lässt sich der „durchlässige Darm“ gut behandeln und sogar heilen. Dieser Ratgeber klärt über die Funktionsweise des Darms sowie über Therapiemöglichkeiten auf. Der darin enthaltene Kompakt-Guide für eine umfassende Darmsanierung zeigt, wie man den Darm auf schonende Weise wieder auf Vordermann bringt. Das Ergebnis: eine gesunde und intakte Darmschleimhaut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Hilf bei Leaky Gut
Wie ein durchlässiger Darm uns krank macht und was wir dagegen tun können
Dr. med. Heike Bueß-Kovács | Prof. Dr. Dr. med. Claus Muss | Dr. med. Götz Nowak
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1: Der Darm ist das Tor zum Leben
Ein Organ, das einen genaueren Blick lohnt
Die Darmwand – ein geniales Schichtsystem
Ein wichtiger Teil des Gesamtsystems
Verdauung beginnt ganz oben
Der Magen als Zwischenspeicher
Die kurvige Fahrt durch den Darm
Nahrungsverdauung durch dünn und dick
Das Ende der Reise durch den »Verdauungsschlauch«
Kapitel 2: Die Darmflora – Ökosystem mit reicher Artenvielfalt
Ein Superorganismus aus Keimen
Bakterienkulturen – von der Darmbarriere geschützt
Special: Bakterien im Darm entscheiden darüber, ob ein Mensch gesund bleibt oder krank wird
Die Darmbarriere – unsichtbare Grenze zwischen zwei Welten
Physikalische und chemische Trennlinie
Eine riesige Barrierefläche
Das Mikrobiom als weites Forschungsfeld
Lenken Mikroben unsere Gefühlswelt?
Das Mikrobiom macht Muckis
Kapitel 3: Der Darm – das zweite Gehirn im Bauch
Die enge Verbindung von Gefühl und Verstand
Wie funktioniert die Kommunikation zwischen Kopf und Bauch?
Nervus vagus – Hauptakteur des »Ruhenervs«
Gefühle – im Bauch gebildet, im Kopf verarbeitet
Das geniale Netzwerk von Nerven und Organintelligenz
Wunderwerk Gehirn
Neurotransmitter: Kleine Moleküle – große Wirkung
Sympathikus und Parasympathikus – die zwei großen Spieler des vegetativen Nervensystems
Dauerstress und seine Folgen
Special: Ist der Darm Sitz der Seele?
Kapitel 4: Nicht mit uns! Vom Kampfgeist unserer Abwehr-Armada
Allzeit bereit zur Verteidigung der Gesundheit
Die mächtigste Schutzpatrouille der Welt
Starke Helfer gegen Krebs, Infektionen & Co.
Die drei großen Verteidigungssysteme unserer Körperabwehr
Die Schutzbarrieren der Körperhülle
Die erste Verteidigungslinie des Immunsystems
Die zweite Verteidigungslinie des Immunsystems
Schwachstellen unseres Immunsystems
Allergie: Die Abwehr spielt verrückt
Zuckerkrankheit und Rheuma: Attacke gegen den eigenen Körper
Krebs: Kontrollverlust über entartete Körperzellen
Special: Die Schule der Immunzellen
Kapitel 5: Leaky-Gut – Alarm im Darm
Wenn die Darmbarriere durchlässig wird
Wer hat ein erhöhtes Risiko?
Morbus Crohn – eine Autoimmunerkrankung des Darms
Leaky Gut – die biochemischen und immunologischen Abläufe
Die häufigsten Triggerfaktoren für Leaky Gut
1. Triggerfaktor: Ungesunde Ernährung
2. Triggerfaktor: Medikamente
3. Triggerfaktor: Nahrungsmittelunverträglichkeiten
4. Triggerfaktor: Stress
Special: Was ist dran an der Diagnose »Reizdarmsyndrom«?
Kapitel 6: 100 Krankheiten, eine Ursache: Leaky Gut
Auswirkungen auf Körper und Seele
Was haben Depressionen mit dem Darm zu tun?
Psychoneuroimmunologie: Schulterschluss verschiedener Wissenschaften
Eine verhängnisvolle Aufspaltung
Leaky-Gut-Syndrom: Die dramatischen Folgen für den Körper
Warnsignal 1: Blähungen, Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen
Warnsignal 2: Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Warnsignal 3: Chronische Gelenk- und Muskelschmerzen, rheumatische Beschwerden
Warnsignal 4: Migräne, Kopfschmerzen
Warnsignal 5: Depressive Verstimmungen, Ängste
Warnsignal 6: Chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Erschöpfung bis hin zum Burn-out
Warnsignal 7: Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen, Leistungsabfall
Warnsignal 8: Ekzeme, Neurodermitis, Psoriasis
Warnsignal 9: Allergien, Autoimmunerkrankungen
Warnsignal 10: Geschwächtes Immunsystem mit wiederkehrenden Infekten
Warnsignal 11: Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen
Warnsignal 12: Übergewicht, Adipositas
Leaky Gut: Ein Syndrom in der Grauzone zwischen gesund und krank
Den Teufelskreis durchbrechen
Kapitel 7: Mit Spezialdiagnostik dem Leaky-Gut-Syndrom auf der Spur
Ein Krankheitsbild mit vielen Gesichtern
Leaky Gut labordiagnostisch erfassen
Der Zonulintest
Der Test des sekretorischen IgA im Stuhl
Der Lactulose-Mannitol-Test
Bestimmung der α-1-Antitrypsin-Konzentration im Stuhl
Der EPX-Test
Test auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Special: Innovative Diagnostik zur Erkennung des Leaky-Gut-Syndroms
Leaky-Gut-Diagnostik: Je ganzheitlicher, desto besser
Kapitel 8: Die Therapie des Leaky Gut
In drei Schritten zum Therapieerfolg
Fallbeispiele aus der Praxis
1. Missempfindungen der Nerven durch LGS
2. Allergiesymptome und Histaminintoleranz durch LGS
3. Müdigkeit, Verdauungsprobleme und Leistungsabfall durch LGS
4. Ständiger Juckreiz und Nesselsucht durch LGS
5. Chronisches Lymphödem durch LGS
6. Unruhe und Konzentrationsstörungen durch LGS
7. Chronische Schmerzen durch LGS
8. Erfolgloses Abnehmen über längere Zeit durch LGS
9. Chronische Müdigkeit durch LGS
Wichtige Helfer bei der Darmsanierung
Probiotika und Präbiotika – Fitmacher für den Darm
Akazienfaser – der absolute Geheimtipp
Salutosil – Schutzfilm für den Darm
Lezithin, Zink & Co. – wertvolle Nahrungsergänzungen für den Darm
Der Kompakt-Guide für eine umfassende Darmsanierung
Darmsanierung: So wird Ihr Darm wieder fit
Fastenkuren
Intervallfasten – perfekt für den Alltag
Fasten – Großputz für Körper und Seele
Leibwickel und Massagen
Mikrobiom-Aufbau
Ernährungsumstellung
Ein Wort zum Schluss
Hilfreiche Adressen
Register
Impressum
Vorwort
Leaky-Gut-Syndrom: Die fremdartig anmutende Krankheitsbezeichnung stammt aus dem Englischen und heißt übersetzt »durchlässiger Darm«. Tatsächlich ist beim Leaky-Gut-Syndrom die Barrierefunktion der Darmschleimhaut nicht mehr intakt. Und das hat fatale Folgen: Durch die durchlässigen Stellen des Darms können schädliche und teilweise hochtoxische, also giftige, Stoffe in den Blutkreislauf und damit in den gesamten Organismus gelangen. Die Fremdstoffe rufen das Immunsystem auf den Plan, das mit allen Mitteln versucht, die Substanzen abzuwehren. Dadurch kommt es zu entzündlichen Reizungen und in der Folge zu chronischen Krankheiten, vor allem zu Allergien und Autoimmunerkrankungen, die als unheilbar gelten. Eine Vielzahl an Symptomen und Beschwerden können so durch das Leaky-Gut-Syndrom ausgelöst werden:
Blähungen, Verstopfung, Durchfall, BauchschmerzenNahrungsmittelunverträglichkeitenChronische Gelenk- und Muskelschmerzen, rheumatische BeschwerdenChronische DarmentzündungenMigräne, KopfschmerzenDepressive Verstimmungen, Ängste, Lustlosigkeit, Chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Erschöpfung bis hin zum Burn-outKonzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen, LeistungsabfallNeurodermitis, Psoriasis, EkzemeAllergien, AutoimmunerkrankungenGeschwächtes Immunsystem mit wiederkehrenden InfektenHerz-Kreislauf-Erkrankungen, Ödeme, ThrombosenUnerklärliches ÜbergewichtObwohl das Syndrom des »lecken«, also durchlässigen, Darms schon seit den 1980er-Jahren bekannt ist und erforscht wird, bringen es die meisten Ärzte noch immer nicht in Zusammenhang mit chronischen Krankheiten und verpassen so die Chance einer Behandlung, die die Ursachen der Beschwerden angeht. Bleibt aber die Barrierestörung der Darmschleimhaut über Jahre unerkannt, kann es zu schweren Komplikationen kommen. So werden die beiden gravierenden Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die den Darm regelrecht zerstören können, mit dem Leaky-Gut-Syndrom in Verbindung gebracht. Sogar Krebserkrankungen können auf das Konto ständiger Darmschleimhautirritationen gehen.
So weit muss es nicht kommen. Das Syndrom des lecken Darms ist gut behandelbar und heilbar. Und mit der Heilung verlieren sich auch alle Krankheiten, die ursächlich mit dem Leaky-Gut-Syndrom in Zusammenhang stehen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Möglichkeiten es gibt, den Darm zu regenerieren und eine intakte Schleimhautbarriere wiederaufzubauen. Fallbeispiele von Patienten mit schweren chronischen Erkrankungen zeigen eindrucksvoll auf, wie durch eine konsequente, zielgerichtete Therapie des Darms der Genesungsprozess eingeleitet und die Gesundheit wiederhergestellt werden konnte.
Kapitel 1
Der Darm ist das Tor zum Leben
Die uralte asiatische Weisheit bringt es auf den Punkt: Der Darm ist eines der wichtigsten Organe unseres Körpers. Und eines der am meisten unterschätzten. Der Darm kann nämlich im wahrsten Sinne des Wortes über Leben und Tod entscheiden.
Ein Organ, das einen genaueren Blick lohnt
Der Steckbrief dieses wichtigen Organs liest sich nicht besonders spektakulär: sechs bis acht Meter Länge zwischen Magenausgang und After; ungefähr drei Kilo schwer; verläuft in Kurven und Windungen; Transportschlauch für Nahrung und Kot. Die Abbildungen in Anatomieatlanten sind genauso wenig einladend, sich dem Thema Darm zu nähern, wie die umgangssprachlichen Bezeichnungen »Gekröse«, »Eingeweide«, »Gedärm« – und schließlich auch die Ausscheidungen, die man mit dem Darm in Verbindung bringt.
Doch wenn man den Feinaufbau eines Zwölffinger-, Krumm-, Grimm- oder Mastdarmes betrachtet, eröffnen sich wahre Wunderwelten. Je genauer wir hinschauen, desto geheimnisvollere und mystischere Strukturen offenbaren sich. Da gibt es beispielsweise Zotten und Drüseneinbuchtungen, die das Innere des Darms wie ein unendliches Labyrinth erscheinen lassen. Ein zarter Bürstensaum ziert die Oberfläche dieser an Kurven und Windungen reichen Innenauskleidung des Darms. Die feinen Härchen dieses Bürstensaums sitzen auf den sogenannten Epithelzellen der Darmschleimhaut, die eine zentrale Funktionen bei allen Verdauungsfunktionen und der Immunabwehr hat, wie Sie später noch erfahren werden. Die Härchen des Bürstensaums werden auch als Mikrovilli bezeichnet und dienen der Vergrößerung der Oberfläche. Die in unzählige Falten gelegte Darmschleimhaut erreicht zusammen mit den Mikrovilli eine Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern! Eine geniale Architektur, die von der Natur perfekt erbaut wurde, damit die lebenswichtigen Verdauungsfunktionen des Darms optimal vonstattengehen können.
Unterhalb der Epithelschicht der Darmschleimhaut befindet sich eine zweite, aus Bindegewebe bestehende Schicht, die Lamina propria. In dieser Schicht verlaufen Blutgefäße und Nervenfasern. Auch Lymphknoten tummeln sich in der Lamina propria in reicher Zahl. Diese Zellen sind wichtige Kontrolleure des Immunsystems, die bei der Abwehr ungebetener Gäste wie etwa krank machender Erreger mithelfen.
Noch einmal darunter gewährt eine dritte, sehr feine Muskelschicht die Eigenbeweglichkeit der Darmschleimhaut. Faszinierend hierbei: Nicht nur der Darm selbst verfügt über ein ausgeklügeltes, über Muskeln gesteuertes Bewegungssystem, sondern die Darmschleimhaut in ihrem Innern ebenfalls.
Die Darmwand – ein geniales Schichtsystem
Betrachtet man den feingeweblichen Aufbau des Darms in seiner gesamten Länge, so lässt sich stets das gleiche Grundmuster erkennen – egal, ob man sich auf der Höhe des Zwölffingerdarms oder des Dickdarms befindet.
Die inneren drei Schichten der Darmschleimhaut, die Sie eben kennengelernt haben, umschließt eine komplexe Muskelschicht, die auf einem Bett aus feinem Bindegewebe gelagert ist. Hier verlaufen die Muskelfasern in der Längs- sowie Querrichtung. Auch an dieser Anordnung der Muskulatur lässt sich erkennen, wie intelligent die Natur ist und wie sie nichts dem Zufall überlässt. Die längs und quer verlaufenden Muskelfasern ermöglichen nämlich, dass sich der Darm in Längs- und Querrichtung ausdehnen und wieder zusammenziehen kann, um den aufgenommenen Nahrungsbrei vom Magen aus in Richtung Darmausgang zu transportieren.
Den Abschluss der Darmwand bildet schließlich eine Schicht aus dünnem Bindegewebe, die in der Fachsprache als Serosa oder Adventitia bezeichnet wird. Diese bindegewebige Außenhülle hält die Darmschichten sozusagen zusammen und bietet ihnen einen gewissen Schutz.
In manchen Teilen des Darms wird die Serosa vom Bauchfell, dem Peritoneum, gebildet. Beide Strukturen – die Außenschicht des Darms und das Bauchfell – pflegen eine enge nachbarschaftliche Beziehung. Deshalb kann es auch passieren, dass sich beispielsweise nach operativen Eingriffen Narben bilden, die vom Peritoneum ausgehend die Darmbeweglichkeit beeinträchtigen und den Darm im schlimmsten Fall regelrecht einschnüren können.
Im Querschnitt wird der vielschichtige und komplexe Aufbau des Darms erkennbar.
Ein wichtiger Teil des Gesamtsystems
Diese Wunderwelt des Darm-Mikrokosmos ist nur ein Teil unseres menschlichen Körpers mit seinen einzigartigen Organen, die jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde Großartiges leisten:
Das Herz schlägt ohne Unterlass und pumpt dabei pro Tag bis zu 10000 Liter Blut durch die Blutgefäße bis zu den feinsten Kapillaren und Zellen unseres Körpers.
Unsere Lunge mit ihren beiden Flügeln, dem fein verästelten System von Luftröhre, Bronchien und Bronchiolen sowie ihren zarten Lungenbläschen, den Alveolen, schenkt uns in jeder Sekunde die Möglichkeit des Ein- und Ausatmens und damit die Aufnahme von lebenswichtigem Sauerstoff in den Organismus.
Als zentrales Stoffwechsel- und Entgiftungsorgan reinigt uns die Leber von unzähligen Stoffen, die schädlich sein könnten, von Umwelttoxinen, Medikamenten, Zusatzstoffen aus der Nahrung, Alkoholabbauprodukten – und das unermüdlich, 24 Stunden am Tag.
Mit ihren Nierenkörperchen, den sogenannten Glomeruli, filtern die Nieren täglich etwa 170 Liter Primärharn aus dem Blut, sondern unbrauchbare Stoffe aus, führen Flüssigkeit dem Körper wieder zurück – trennen Gutes von Schlechtem.
Im Supercomputer in unserem Kopf, dem Gehirn, werden über ein Netzwerk von circa 100 Milliarden Neuronen unzählige Signale in atemberaubender Geschwindigkeit hin und her geschickt – Signale, die sich zu Gedanken, Gefühlen, Empfindungen formen und die unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unsere Neigungen, Talente und Begabungen prägen.
Und nun der Darm: Nimmt er sich nicht ein wenig uninteressant aus gegenüber den so viel beachteten und bewunderten Organen unseres Organismus – gar ein wenig langweilig, ist er doch nur eine Art Rohrsystem, das sich durch die Mitte des Körpers zieht?
In der Tat handelt es sich bei unserem Verdauungssystem und damit bei unserem Darm um eine Art Rohr- oder Schlauchsystem, das an der einen Stelle gerade wie ein Stock verläuft, an einer anderen Stelle eine merkwürdige Aussackung zeigt und sich dann in Schlangenlinien abwärts in Richtung Körperausgang bewegt. Wenn man sich vergegenwärtigt, wofür das in der Mitte des Körpers gelegene Rohr- oder Schlauchsystem eigentlich nötig ist – nämlich für die Aufnahme und Verwertung von Nahrung –, wird schnell klar, wo die anatomische Reise anfängt: natürlich in unserem Mund.
Gut gekaut schmeckt alles besser – und wird auch besser verdaut, denn schon im Mund wird die Nahrung von Enzymen aufgeschlossen.
Verdauung beginnt ganz oben
Alles, was wir zu uns nehmen, wird beim Kauen mit den Zähnen zerkleinert, mit Speichel aus den Speicheldrüsen im Mund durchmischt und als zerkleinerter Nahrungsbrei durch Hinunterschlucken in Richtung Speiseröhre befördert. An dieser Stelle ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, wie unangenehm es sein kann, sich Speisen hastig, in Hektik und vielleicht gar im Vorübergehen einzuverleiben. Jeder kennt das Gefühl des Brockens, der einem im Halse stecken bleibt, wenn es beim Essen allzu schnell gehen musste. Darauf zielt die Weisheit des alten Spruchs aus dem Volksmund »Gut gekaut ist halb verdaut«. Hastig hinuntergeschlungenes Essen ist viel weniger gut zerkleinert und hat viel weniger Möglichkeit, mit Speichel in Kontakt zu treten. Das wiederum behindert den ersten Verdauungsprozess, der bereits im Mund beginnt: Der Speichel macht die aufgenommene Nahrung nicht nur flüssiger, er versetzt sie auch mit speziellen Enzymen, den Amylasen, die Kohlenhydratverbindungen in einfache Zuckermoleküle teilen, die im weiteren Verlauf leichter verdaut werden können.
Vom Mund geht die Reise weiter durch die Speiseröhre, die in der Fachsprache Ösophagus genannt wird. Sie ist das fast geradlinig verlaufende Verbindungsstück zwischen Rachen und Magen, wo der Speisebrei vorerst landet. Auch der Speiseröhre tut es ausgesprochen gut, wenn nicht ganze Brocken in ihr landen, denn das kann im Extremfall einen richtigen Krampf bei ihr auslösen, in dessen Folge sich der Nahrungsbrocken erst recht festsetzt und schlimmstenfalls nur noch vom Arzt entfernt werden kann.
Am Ende der Speiseröhre trifft der Nahrungsbrei zum ersten Mal auf einen Kontrollposten, den es zu überwinden gilt. Es ist der Mageneingangs- oder auch Speiseröhrenschließmuskel. Ist dieser Verschluss des Mageneingangs gestört, kann Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließen und eine sogenannte Refluxkrankheit hervorrufen. Erstes Zeichen dieser Krankheit ist häufiges Sodbrennen, das sich vor allem im Liegen verstärkt. Da der Mageninhalt mit aggressiver Säure durchsetzt ist, wird durch ein fortwährendes Zurückfließen nicht selten auch eine Refluxösophagitis ausgelöst, eine schmerzhafte Entzündung der Speiseröhre.
Der Magen als Zwischenspeicher
Hat die Mischung aus Pasta mit Tomatensoße, Müsli mit Milch, Sandwich mit Schinken und Käse oder was immer wir zu uns genommen haben den oberen Magen-Sphinkter – so die Fachbezeichnung für einen Schließmuskel – erst einmal überwunden, landet sie im Magen selbst, der vom Aussehen ein wenig an einen Dudelsack ohne Pfeifen erinnert. Durch seine Aussackung dient der Magen als hervorragendes Nahrungslager, das den Speisebrei vorübergehend speichert und portionsweise in den Dünndarm abgibt. Dieser Zwischenspeicher ist eine geniale Einrichtung der Evolution, denn ohne Magen müssten wir über den Tag verteilt viele kleine Portionen zu uns nehmen und wären praktisch die ganze Zeit mit Essen beschäftigt. Wie lange Speisen im Magen verbleiben, hängt von ihrer Verdaulichkeit ab: Leicht Verdauliches wie Salat oder bestimmte Gemüsesorten wie Karotten oder Tomaten werden schnell weitertransportiert und verweilen nur maximal ein bis zwei Stunden im Magen; schwer Verdauliches wie ein Gänsebraten, Pilz- oder Bohnengerichte können dagegen »schwer im Magen liegen« und sich dort fünf bis acht Stunden aufhalten.
Der Magen dient zugleich als Desinfektionsstation: So wie sich Chirurgen zur Vorbereitung einer Operation die Hände und Arme bis zu den Ellbogen schrubben, mit Desinfektionsmittel einreiben und sich danach steril einkleiden, so desinfiziert der Magen seinen Inhalt und tötet nahezu alle Krankheitserreger ab. Er bedient sich dazu der Salzsäure, einer aggressiven Substanz, die er in sogenannten Belegzellen bildet und die das Magenmilieu auf einen pH-Wert von 2 bis 3 absenkt, was den allermeisten Bakterien und Krankheitserregern gar nicht gut bekommt. Interessant dabei: Beim Leaky-Gut-Syndrom stimulieren Botenstoffe aus dem Darm die Zellen, die wiederum die Magenschleimhaut zur Salzsäureproduktion anregen. Eine Therapie mit Säureblockern kann deshalb nicht den erwünschten Erfolg bringen – Zusammenhänge, die vielen Ärzten nicht bekannt sind.
Nach der Passage durch den Magenpförtner, den unteren Schließmuskel, gelangt der aufbereitete und von Keimen nahezu vollständig befreite Speisebrei zum eigentlichen Ort unserer Aufmerksamkeit: zum Darm.
Wenn viel Straße wenig Platz zur Verfügung hat, geht es ein bisschen zu wie im Darm: Eine Kurve folgt der anderen.
Die kurvige Fahrt durch den Darm
Jeder, der schon einmal eine Serpentinenstraße an Meeresklippen entlanggefahren ist oder eine Hochgebirgsroute genommen hat, um vom Skiurlaub heimzukehren, kennt diese Kurverei: rechts rum, links rum, rechts rum, links rum in zuweilen ziemlich engen, nervigen Kehrschleifen. So ähnlich muss sich der Speisebrei fühlen, wenn er mithilfe der Peristaltik – den aktiven, von Muskelkräften ausgelösten Bewegungen des Darms – durch dessen Windungen geschoben wird.
Die Dünndarmreise beginnt mit dem Zwölffingerdarm, Duodenum genannt. Seinen Namen erhielt der Zwölffingerdarm durch seine Länge, die von Anatomen früherer Zeiten auf etwa eine Länge von zwölf Fingern berechnet wurde, was etwa 30 Zentimetern entspricht. In diesem zwölf Finger langen Abschnitt des Dünndarms finden weitere bedeutsame Verdauungsprozesse statt, indem etwa Hormone und andere Botenstoffe, zum Beispiel des Immun- und Stoffwechselsystems, zur Verfügung gestellt werden. Ins Duodenum münden auch die Säfte der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase. Die darin enthaltenen Enzyme führen den Verdauungsprozess fort, indem sie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße aufspalten und in so kleine Einzelteile zerlegen, dass diese aus dem Darminnern über die Darmwand in den Blutkreislauf aufgenommen werden können.
Dem Duodenum folgt das Jejunum, das im Deutschen als Leerdarm bezeichnet wird. Diese etwas ulkige Bezeichnung stammt wohl daher, dass das Jejunum nach dem Tod zumeist leer sein soll. In dem etwa zweieinhalb Meter langen und ausgesprochen kurvigen Abschnitt werden Nährstoffe und Wasser aus dem Nahrungsbrei resorbiert, also aufgenommen. Im Jejunum setzt sich also die Aufspaltung der Nahrungsbestandteile durch Enzyme, die schon in oberen Abschnitten des Verdauungstraktes begonnen hat, fort. Die dabei entstehenden Bausteine sind vor allem Einfachzucker, Aminosäuren und Fettsäuren. Aber auch Vitamine, Elektrolyte und Spurenelemente gelangen über diesen langen Dünndarmabschnitt mit seiner enormen Resorptionskapazität in den Blutkreislauf – und natürlich jede Menge lebenswichtiger Flüssigkeit, die hier dem Nahrungsbrei besonders gründlich entzogen wird.
Die unzähligen Ausstülpungen der Darmschleimhaut schaffen eine enorme Resorptionsfläche.
Die Serpentinenfahrt durch den Dünndarm findet im Ileum, dem Krummdarm, ihr Ende. Dieser letzte Abschnitt bildet mit 60 Prozent den längsten Abschnitt der gesamten Dünndarmlänge. Er kann beim Erwachsenen durchaus bis zu drei Meter lang sein. Im Krummdarm verschwinden die Zotten und Falten, die für das Innenleben des Jejunums so charakteristisch sind, und weichen anderen Organstrukturen wie etwa Ansammlungen von Lymphknötchen, die den würdevollen Wissenschaftsnamen Peyer-Plaques tragen. Die durch Ein- und Ausstülpungen enorm vergrößerte Resorptionsoberfläche der Darmschleimhaut kommt im Ileum zunehmend weniger vor, und zwar deshalb, weil die meisten verwertbaren Nahrungsbestandteile bereits im Duodenum und Jejunum ins Blut aufgenommen wurden. Statt Resorption von Nahrungsbausteinen kommt dem Ileum eine andere wichtige Aufgabe zu, nämlich die Abwehr von Krankheitserregern und anderen Stoffen, die vom Magen durch die Salzsäure nicht schon eliminiert wurden. Man kann mit Fug und Recht sagen: Das Darmimmunsystem ist hauptsächlich im Ileum, dem letzten Teil des Dünndarms, angesiedelt. Zur enormen Bedeutung dieses enterischen Immunsystems (»enterisch« stammt aus dem Altgriechischen und steht für »Darm«) werden Sie später noch mehr erfahren.
Nahrungsverdauung durch dünn und dick
Der Dickdarm ist dicker als der Dünndarm. Das klingt zunächst wie eine Plattitüde, aber es ist tatsächlich so. Doch nicht nur das: Dünndarm und Dickdarm unterscheiden sich einerseits im Erscheinungsbild deutlich voneinander und haben andererseits auch ganz verschiedene Funktionen.
Nach dem Ileum sind wir also im Dickdarm angekommen. Dieser etwa ein Meter lange Darmabschnitt verläuft überhaupt nicht mehr kurvig, sondern umgibt den Dünndarm wie einen Rahmen. Entsprechend unterscheiden die Mediziner beim Hauptteil des Dickdarms, dem Grimmdarm oder Kolon, einen aufsteigenden Teil (Colon ascendens), einen quer verlaufenden Teil (Colon transversum) und einen absteigenden Teil (Colon descendens). Zum Dickdarm gehört auch der Blinddarm mit dem als Appendix bezeichneten Wurmfortsatz – der für seine gewisse Entzündungsneigung berühmt-berüchtigt ist – und das Sigma, ein leicht S-förmig verlaufendes Stück des Kolons (Colon sigmoideum) sowie der circa 16 Zentimeter lange Mastdarm, in der Fachsprache Rektum genannt, der über den After (Anus) die Verbindung nach außen bildet.
Während der Dünndarm in Kurven und Windungen verläuft, zieht sich der Dickdarm recht geradlinig durch den Bauchraum.
Eine wichtige Aufgabe des Dickdarms ist, dem Speisebrei weiter Wasser zu entziehen, um ihn auf diese Weise einzudicken. Parallel dazu mengt der Dickdarm dem Darminhalt Schleim bei, damit dieser eine gute Gleitfähigkeit erhält und nicht etwa während der Darmpassage ins Stocken gerät.
Die sehr unangenehmen Erscheinungen einer ins Stocken geratenen Verdauung und Bildung von trockenem, hartem Stuhl, der sich manchmal tagelang nur unter größten Schwierigkeiten in die Toilette befördern lässt, kennen wir alle als Verstopfung. Diese Verdauungsstörung, die in der medizinischen Fachsprache Obstipation genannt wird, kann durch falsche Ernährung mit zu wenig Ballaststoffen, durch veränderte Ernährungsgewohnheiten, mangelnde Bewegung, Fernreisen und vieles mehr ausgelöst werden. Typische Begleiterscheinungen sind Bauchschmerzen, Völlegefühl und Blähungen.
Unregelmäßigkeiten oder Probleme beim Stuhlgang sollten abgeklärt werden.
Das Gegenteil einer Obstipation tritt ein, wenn die sogenannten Becherzellen – das sind die Zellen, die im gesamten Magen-Darm-Trakt für die Produktion von Schleim verantwortlich sind – plötzlich übermäßig stark Schleim absondern. Bei Entzündungen des Dickdarms beispielsweise kann die Absonderung des Schleims so stark sein, dass reine Schleimstühle ausgeschieden werden.
Diese Unregelmäßigkeiten des Stuhlgangs können ein erstes wichtiges Zeichen sein, dass mit dem Darm etwas nicht in Ordnung ist und Sie genauere Abklärungen durchführen lassen sollten – denn Krankheiten des Darms sind immer ernst zu nehmen, da sie für eine Vielzahl anderer Leiden und Störungen verantwortlich sein können. Darüber erfahren Sie im weiteren Verlauf dieses Buches mehr.
Das Ende der Reise durch den »Verdauungsschlauch«
Nach dem letzten S-förmigen Abschnitt des Kolons, dem Sigma, schließt sich der Mastdarm an, dem die Mediziner den Namen Rektum gegeben haben. Hier finden keine Verdauungsprozesse mehr statt. Das Rektum dient ausschließlich als Speicher von Kot, damit dieser nicht ständig, sondern nur etwa einmal am Tag oder sogar in noch größeren Zeitabständen ausgeschieden werden muss. Bis zu fünf Tage kann der Mastdarm seinen Inhalt »aufbewahren«.
Im allerletzten Abschnitt des Darms, also am Ende des Rektums, findet sich wieder ein Sphinkter, ein Schließmuskel. Nach dem Mageneingangs- und dem Magenausgangsschließmuskel ist er der Dritte im Bunde. Es handelt sich um den Anus – auch After genannt –, ein starker Muskelring, der den Darmausgang einerseits ohne bewusste Kontrolle durch das Gehirn verschließen kann, andererseits uns die bewusste Kontrolle über den Stuhlgang ermöglicht. Diese Kontrolle erwerben wir im Kindesalter, denn die Darm- sowie auch die Blasenkontrolle hängen von gewissen Reifeprozessen ab und werden – angepasst an die individuelle kindliche Entwicklung – vom Gehirn gesteuert.
Eine dramatische und für die Betroffenen schwer belastende Situation tritt ein, wenn der Schließmuskel des Afters durch operative Eingriffe, Verletzungen oder bestimmte Krankheiten verletzt beziehungsweise geschwächt wurde. Dann kann es zur Stuhlinkontinenz kommen, bei der die Stuhlabgabe nicht mehr kontrolliert werden kann. Das ist eine immer noch tabuisierte Erkrankung, die sehr oft mit einem großen Leidensdruck einhergeht. Am häufigsten kommt es nach einem chirurgischen Eingriff, meist wegen Darmkrebs, zu dieser Inkontinenz. Glücklicherweise helfen moderne Operationstechniken, etwa mit speziellen endoskopischen Methoden, diese schwerwiegende Komplikation zu verringern.
Appendix: Wurmfortsatz ohne Funktion?
Würde man in der Fußgängerzone eine Umfrage starten, bekäme man sicher Antworten dieser Art: »Der Blinddarm? Der ist doch zu nichts nutze!« Oder: »Der ist doch nur zum Entzünden da und dafür, dass Chirurgen Geld verdienen.«
Nein, so viel Unfug treibt die Natur nicht: Organe zu schaffen, die später nur Probleme bereiten oder nur zum Geldverdienen da sind. Aber welche Bedeutung hat der Blinddarm denn nun wirklich? Zunächst ein bisschen Klarheit in die Sprachverwirrung: Der Blinddarm ist das etwa sechs bis acht Zentimeter lange Stück, das den Übergang vom Dünn- zum Dickdarm bildet. Er wird auch Caecum genannt und befindet sich in den allermeisten Fällen in der rechten unteren Bauchhöhle. Am Blinddarm sitzt ein kleines Anhängsel, der Wurmfortsatz, im Fachjargon Appendix genannt. Spricht man von Blinddarmentzündung, ist genau dieser Wurmfortsatz gemeint, deshalb heißt die Dia- gnose auch Appendizitis (die lateinische Endung -itis bedeutet »Entzündung«).
Eine akute Appendizitis ist in der Tat kein Spaziergang. Sie verursacht meist heftige Bauchschmerzen und kann sogar lebensgefährlich werden, sollte der akut entzündete Wurmfortsatz aufbrechen und schädliche Bakterien in den Bauchraum entlassen. Chirurgen greifen daher meist schnell zum Skalpell und entfernen den Appendix sogar gelegentlich vorsorglich im Rahmen eines anderen Eingriffs im Bauchraum.
In die Reihe der vermeintlich nutzlosen Organe findet sich der Blinddarm mit Appendix zusammen mit Organen wie den Rachenmandeln oder der Milz. Forschungen zeigen jedoch: Genauso wie die Rachenmandeln oder die Milz, spielt der Blinddarm eine wichtige Rolle im Immunsystem. Zusammen mit dem Appendix ist er ein Reservoir von lymphatischen Zellen, die der Körperabwehr wertvolle Dienste leisten. Zudem soll der Blinddarm auch ein Depot für »gute« Darmbakterien sein, die nach einem Darminfekt dort – geschützt wie in einer Höhle – überleben können. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse findet gerade ein Umdenken statt, den Appendix nicht vorschnell zu entfernen, sondern dem Körper dieses wertvolle Immunorgan zu überlassen, solange es gesund ist.
Kapitel 2
Die Darmflora – Ökosystem mit reicher Artenvielfalt
Billionen von Bakterien besiedeln den Darm und bestimmen über Krankheit oder Gesundheit. Was dieses körpereigene Mikrobiom alles zu leisten vermag, beginnen Wissenschaftler überhaupt erst zu erahnen – und sind auf dem Weg zu bahnbrechenden neuen Erkenntnissen.