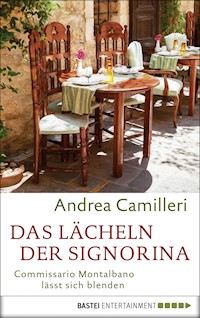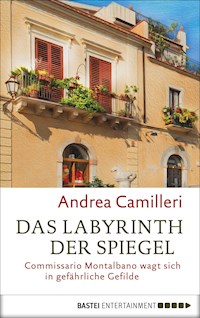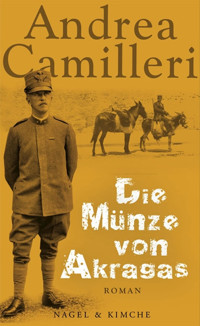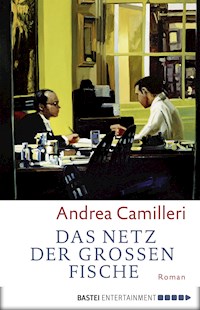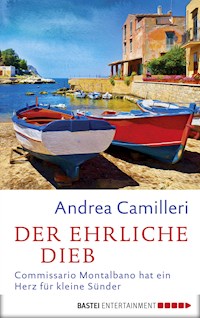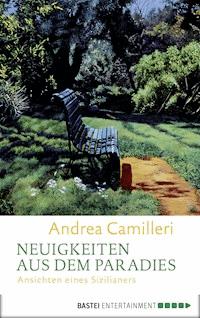9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Beim Schwimmen im Meer kollidiert Commissario Montalbano mit einer Leiche. Wie sich herausstellt, ist der Ertrunkene nur einer von vielen Menschen - illegalen Einwanderern, die von Schleppern nachts auf Booten abgesetzt werden-, die das Meer an die sizilianische Küste spült. Als Montalbano Nachforschungen anstellt, nimmt eine Tragödie gewaltigen Ausmaßes Gestalt an, die schließlich in dunkler Tiefe zu einem unvergesslichen Ort des Verbrechens führt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
ANDREA CAMILLERI
DAS KALTE LÄCHELN DES MEERES
Sizilien-Krimi
Aus dem Italienischen vonChristiane von Bechtolsheim
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
© 2003 by Sellerio Editore
Titel der italienischen Originalausgabe: »Il Giro di Boa«, erschienen bei Sellerio Editore, Via Siracusa 50, Palermo
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2005/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von © shutterstock (Evgeniya L; Nuk2013; elesi; Andrew Mayovskyy)
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1254-3
Sie finden uns im Internet unter
luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
Eins
Was für eine hundsgemeine Nacht, er hatte sich pausenlos im Bett herumgewälzt, war weggedöst und wieder wach geworden, war aufgestanden und hatte sich wieder hingelegt. Nicht etwa, weil er es beim Abendessen mit purpi strascinasali oder sarde a beccafico übertrieben hätte, das wäre wenigstens ein Grund für diese quälende Schlaflosigkeit gewesen, aber nein, nicht mal diese Befriedigung hatte er gehabt; abends war sein Magen so zugeschnürt gewesen, dass kein Grashalm hineingegangen wäre. Das lag an den düsteren Gedanken, die ihm ein Beitrag in den Fernsehnachrichten beschert hatte. »Ersoffen und noch vom Stein getroffen«, heißt es im Volksmund, wenn ein Unglücksrabe von einer unerträglichen Pechsträhne heimgesucht wird. Und da er jetzt schon seit ein paar Monaten verzweifelt in einem aufgewühlten Meer schwamm und sich manchmal verloren fühlte wie ein Ertrinkender, traf ihn dieser Bericht wirklich wie ein Stein, und zwar mitten auf den Kopf; der Schlag betäubte ihn und raubte ihm seine letzten, schwindenden Kräfte.
Mit gleichgültiger Miene hatte die Reporterin mitgeteilt, die Staatsanwaltschaft Genua sei in Zusammenhang mit der Erstürmung der Diaz-Schule während des G8-Gipfels zu der Überzeugung gekommen, dass die Polizisten die beiden in der Schule gefundenen Molotow-Cocktails dort selbst deponiert hätten, um die Aktion zu rechtfertigen. Man habe festgestellt – fuhr die Reporterin fort –, dass der Beamte, der bei der Erstürmung angeblich von einem Globalisierungsgegner mit einem Messer angegriffen worden war, gelogen habe: Er habe sich den Schnitt an der Uniform selbst zugefügt, um zu beweisen, wie gefährlich diese Jugendlichen seien, doch mittlerweile sei herausgekommen, dass sie in der Schule friedlich geschlafen hatten.
Nach dem Bericht saß Montalbano eine halbe Stunde in seinem Fernsehsessel, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, sprachlos vor Wut und Scham und schweißgebadet. Er fand nicht mal die Kraft, aufzustehen und ans Telefon zu gehen, das schon lange klingelte. Man brauchte über solche Meldungen, die die regierungsfreundlichen Medien tröpfchenweise verlautbaren ließen, nur ein bisschen nachzudenken, und schon hatte man ein klares Bild vor Augen: Seine Mitstreiter und Kollegen waren in Genua, als niemand damit rechnete, ohne jede Rechtsgrundlage gewaltsam vorgegangen, das war eine Art kaltblütiger Racheakt, obendrein mithilfe getürkter Beweise. So etwas rief verdrängte Aktionen der faschistischen Polizei oder der Polizei unter Innenminister Scelba in Erinnerung. Irgendwann beschloss Montalbano, ins Bett zu gehen. Als er vom Sessel aufstand, fing das blöde Telefon schon wieder an zu klingeln. Automatisch nahm er ab. Es war Livia.
»Salvo! Mein Gott, ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen! Ich habe mir langsam Sorgen gemacht! Hast du das Telefon denn nicht gehört?«
»Doch, aber ich hatte keine Lust dranzugehen. Ich wusste ja nicht, dass du es bist.«
»Was machst du gerade?«
»Nichts. Ich habe an das gedacht, was vorhin in den Nachrichten kam.«
»Über Genua?«
»Ja.«
»Ah. Ich habe den Bericht auch gesehen.«
Pause. Und dann:
»Ich wäre jetzt gern bei dir. Ich könnte morgen kommen, was meinst du? Dann reden wir in Ruhe über alles. Du wirst schon sehen, dass …«
»Livia, da gibt’s nicht mehr viel zu reden. Wir haben in den letzten Monaten doch so oft darüber gesprochen. Ich bin fest entschlossen.«
»Wozu denn?«
»Ich kündige. Morgen gehe ich zum Questore; Bonetti-Alderighi wird sich freuen.«
Livia antwortete nicht sofort, und Montalbano glaubte, die Verbindung sei abgebrochen.
»Livia? Bist du noch dran?«
»Ich bin noch dran. Salvo, ich halte es für einen Riesenfehler, so zu gehen.«
»Was meinst du mit ›so‹?«
»Wütend und enttäuscht. Du willst die Polizei verlassen, weil du dich fühlst, als hätte dich ein dir naher Mensch verraten, und deshalb …«
»Livia, ich fühle mich nicht verraten. Ich bin verraten worden. Hier geht’s nicht um Gefühle. Ich habe meinen Beruf immer mit Anstand ausgeübt. Als Ehrenmann. Wenn ich einem Kriminellen mein Wort gegeben habe, habe ich es auch gehalten. Und dafür respektiert man mich. Das ist meine Stärke, verstehst du? Aber jetzt reicht’s mir, ich hab die Schnauze voll!«
»Bitte schrei nicht«, sagte Livia mit zitternder Stimme.
Montalbano hörte sie nicht. In ihm war ein Geräusch, als finge sein Blut gleich an zu kochen. Er fuhr fort:
»Nicht mal dem schlimmsten Verbrecher habe ich falsche Beweise untergeschoben! Nie! Damit hätte ich mich ja auf sein Niveau begeben. Dann wäre meine Arbeit als Bulle zu einem Drecksgeschäft geworden! Stell dir das mal vor, Livia! Nicht irgendein unterbelichteter, gewalttätiger Polizist hat die Schule überfallen und irgendwelche Beweise fabriziert, da waren Polizeipräsidenten und stellvertretende Polizeipräsidenten, Hauptkommissare und Konsorten mit von der Partie!«
Erst jetzt begriff er, dass das Geräusch im Hörer Livias Schluchzer waren. Er holte tief Luft.
»Livia?«
»Ja?«
»Ich liebe dich. Schlaf gut.«
Er legte auf. Und dann hatte diese üble Nacht begonnen.
In Wirklichkeit hatte Montalbanos Unbehagen schon vorher angefangen, nämlich als im Fernsehen der Ministerpräsident zu sehen war, der durch die Gassen von Genua schlenderte, Blumenkästen aufstellen ließ und Anweisung gab, die Unterhosen, die zum Trocknen vor Balkonen und Fenstern hingen, zu entfernen, während sein Innenminister Sicherheitsmaßnahmen ergriff, die eher zu einem bevorstehenden Bürgerkrieg als zu einer Versammlung von Regierungschefs gepasst hätten: Stahlzäune zur Sperrung bestimmter Straßen, Abdichtung der Gullys, Schließung der Grenzen und mehrerer Bahnhöfe, Überwachung der Küstengewässer und sogar die Installation einer Raketenbatterie. Die Schutzvorkehrungen – dachte der Commissario – waren dermaßen übertrieben, dass sie eine Provokation darstellten. Und dann war das alles passiert: Schlimm genug, dass ein Demonstrant ums Leben gekommen war, doch das Schlimmste war vielleicht das Verhalten einiger Polizeiabteilungen, die friedliche Demonstranten mit Tränengas beschossen, während die Autonomen des so genannten Black Block tun und lassen konnten, was sie wollten. Und danach hatte sich in der Diaz-Schule diese widerwärtige Geschichte abgespielt, die weniger mit einem Polizeieinsatz zu tun hatte als mit einem miesen Überfall, um unterdrückte Rachegelüste auszutoben.
Drei Tage nach dem G8-Gipfel, als in ganz Italien heftig gestritten wurde, war Montalbano spät ins Büro gekommen. Als er aus dem Auto stieg, sah er zwei Maler, die eine Seitenwand des Kommissariats tünchten.
»Ah Dottori Dottori!, rief Catarella, als Montalbano hereinkam. »Die haben uns heute Nacht unanständige Sachen geschrieben!«
Montalbano verstand nicht sofort:
»Wer hat uns geschrieben?«
»Ich weiß nicht, wer das persönlich war, der uns geschrieben hat.«
Was für einen Mist redete Catarella da?
»Einen anonymen Brief?«
»Nein, Dottori, der war nicht onanym, Dottori, der war ein Mauerbrief. Und wegen dem Mauerbrief hat der Fazio heut Früh gleich die Maler angerufen, dass die den wieder wegmachen.«
Jetzt wusste Montalbano endlich, was es mit den beiden Malern auf sich hatte.
»Was stand denn da?«
Catarella wurde knallrot und redete um den heißen Brei herum:
»Mit so schwarzen Spreidosen haben die schlimme Wörter hingeschrieben.«
»Ja gut, aber was denn?«
»Scheißbullen«, antwortete Catarella und blickte verlegen zu Boden.
»Ist das alles?«
»Nein. Auch noch Mörder. Scheißbullen und Mörder.«
»Catarè, warum macht dir das denn so viel aus?«
Catarella fing fast an zu heulen.
»Weil hier bei uns keiner ein Scheißbulle oder ein Mörder ist, Sie schon gar nicht und niemand sonst und ich auch nicht, wo ich sowieso die letzte Geige spiele.«
Montalbano legte ihm tröstend die Hand auf die Schulter und ging dann in sein Büro. Catarella rief hinter ihm her:
»Ah Dottori! Das hab ich ganz vergessen: grannissimi cornuti war auch dabei.«
Klar, in Sizilien war aus einem Schmähspruch das Wort cornuto, Gehörnter, nicht wegzudenken! Dieses Wort war wie ein Markenname, eine typische Art, die sizilianische Mentalität auszudrücken. Er hatte sich gerade hingesetzt, als Mimì Augello hereinkam. Mimì schien sich durch nichts anfechten zu lassen, er war entspannt und guter Dinge.
»Gibt’s was Neues?«, fragte er.
»Weißt du schon, was heute Nacht an unserer Hauswand stand?«
»Ja, Fazio hat’s mir erzählt.«
»Und das findest du nichts Neues?«
Mimì sah ihn irritiert an.
»Machst du jetzt einen Witz, oder meinst du das ernst?«
»Ich mein’s ernst.«
»Dann aber Hand aufs Herz, wenn du mir antwortest. Glaubst du, dass Livia dich betrügt?«
Diesmal sah Montalbano Mimì irritiert an.
»Sag mal, spinnst du?«
»Ein cornuto bist du also nicht. Und dass Beba mich betrügt, glaube ich auch nicht. Nun zum nächsten Wort: Scheißbullen. Mir haben zwei oder drei Frauen gesagt, ich wäre ein Scheißtyp. Zu dir hat das wohl noch niemand gesagt, folglich bist du mit dem Wort nicht gemeint. Von Mörder ganz zu schweigen. Also?«
»Meine Güte, Mimì, bist du witzig mit deiner Rätselwochen-Logik!«
»Salvo, es ist ja wohl nicht das erste Mal, dass die uns als Schweine, Scheißtypen und Mörder bezeichnen.«
»Bloß dass sie dieses Mal, zumindest teilweise, Recht haben.«
»Ach ja, findest du?«
»Finde ich. Erklär mir mal, warum wir, nachdem jahrelang nichts Vergleichbares passiert ist, in Genua so vorgegangen sind.«
Mimì sah ihn aus schmalen Augenschlitzen an und schwieg. »O nein!«, sagte der Commissario. »Antworte mir richtig, nicht mit diesem Bullenblick.«
»Also gut. Aber eins noch: Ich habe nicht die Absicht, mich mit dir zu zoffen. Einverstanden?«
»Einverstanden.«
»Ich weiß schon, was dich wurmt. Nämlich dass das alles unter einer Regierung geschehen ist, der du misstraust und gegen die du Aversionen hast. Du denkst, dass diese Geschichte für die derzeitige Regierung ein gefundenes Fressen ist.«
»Sag mal, Mimì, hast du eigentlich Zeitung gelesen? Hast du ferngesehen? Mehr oder weniger deutlich wurde gesagt, dass in der Einsatzzentrale in Genua Leute waren, die dort nichts verloren hatten. Minister und Abgeordnete und alle von ein und derselben Partei. Von der Partei, die sich immer auf Recht und Gesetz beruft. Aber wohlgemerkt, Mimì: auf ihr Recht und ihr Gesetz.«
»Und das heißt?«
»Das heißt, dass sich ein Teil der Polizei, vielleicht ein besonders schwacher, da er sich für den stärksten hält, geschützt und abgesichert gefühlt hat. Und ausgerastet ist. Im besten Fall.«
»Gibt’s auch einen schlechtesten?«
»Klar. Dass wir von Leuten, die eine Art Test veranstalten wollten, wie Puppen im Marionettentheater gelenkt worden sind.«
»Was denn für einen Test?«
»Wie die Menschen auf einen solchen Gewaltakt wohl reagieren, wie viel Zustimmung, wie viel Missbilligung es gibt. Zum Glück ist die Rechnung nicht aufgegangen.«
»Na ja …«, meinte Augello zweifelnd.
Montalbano wechselte das Thema.
»Wie geht’s Beba?«
»Nicht so besonders. Die Schwangerschaft ist schwierig. Sie muss viel liegen, aber der Arzt sagt, wir bräuchten uns keine Sorgen zu machen.«
Montalbano legte mit seinen einsamen Wanderungen auf der Mole Kilometer um Kilometer zurück, saß stundenlang auf seinem Klagefelsen und dachte über Genua nach, bis ihm das Hirn rauchte, futterte zentnerweise càlia e simenza und telefonierte nachts mit Livia, und als seine innere Wunde langsam zu vernarben begann, wurde über eine weitere glorreiche Aktion der Polizei berichtet, diesmal in Neapel. Eine Hand voll Polizisten waren festgenommen worden, weil sie mutmaßlich gewaltbereite verletzte Demonstranten aus einem Krankenhaus geholt hatten. Auf der Wache wurden die Leute unter einer Flut von Beschimpfungen und Beleidigungen verprügelt. Doch was Montalbano am meisten erschütterte, war die Reaktion anderer Polizisten auf die Festnahmen: Einige ketteten sich aus Solidarität ans Tor des Präsidiums, manche organisierten Demonstrationen, die Polizeigewerkschaften regten sich auf, ein stellvertretender Polizeipräsident, der in Genua brutal auf einen zu Boden gestürzten Demonstranten eingetreten hatte, wurde in Neapel wie ein Held gefeiert. Dieselben Politiker, die während des G8-Gipfels in Genua weilten, leiteten diesen merkwürdigen (aber Montalbano fand ihn gar nicht so merkwürdig) Kleinaufstand eines Teils der Ordnungskräfte gegen die Richter, die die Festnahmen angeordnet hatten. Montalbano hatte die Schnauze voll. Noch so eine bittere Pille mochte er nicht schlucken. Daher rief er eines Morgens vom Büro aus sofort Dottor Lattes an, den Kabinettschef im Polizeipräsidium Montelusa. Eine halbe Stunde später ließ Lattes Montalbano durch Catarella ausrichten, dass der Polizeipräsident bereit sei, ihn Punkt zwölf Uhr mittags zu empfangen. Die Kollegen im Kommissariat hatten gelernt, aus dem Schritt, mit dem ihr Chef morgens ins Büro kam, auf seine Laune zu schließen, und daher wussten sie gleich, dass er mit dem linken Bein zuerst aufgestanden war. So schien es von Montalbanos Zimmer aus, als ob das Kommissariat ausgestorben wäre, keine Stimme, kein Geräusch waren zu hören. Sobald Catarella, der am Eingang Wache hielt, jemanden kommen sah, riss er die Augen auf, legte den Finger an den Mund und machte:
»Pssssst!«
Und alle betraten das Kommissariat mit einem Gesicht, als gingen sie zu einer Totenwache.
Gegen zehn klopfte Augello vorsichtig an Montalbanos Tür und durfte eintreten. Er wirkte niedergeschlagen. Montalbano sah ihn besorgt an.
»Wie geht’s Beba?«
»Gut. Darf ich mich setzen?«
»Klar.«
»Darf ich rauchen?«
»Klar, aber lass dich nicht vom Minister erwischen.«
Augello steckte sich eine Zigarette an, inhalierte und behielt den Rauch lange in der Lunge.
»Darfst ruhig wieder ausatmen«, sagte Montalbano. »Ich erlaub’s dir.«
Mimì sah ihn irritiert an.
»Na ja«, fuhr der Commissario fort, »du benimmst dich so untertänig. Wegen jedem Scheiß bittest du mich um Erlaubnis. Was ist denn los? Fällt es dir so schwer, zu sagen, was du auf dem Herzen hast?«
»Ja«, gab Augello zu.
Er drückte die Zigarette aus, setzte sich auf dem Stuhl zurecht, holte tief Luft und fing an:
»Salvo, du weißt, dass ich dich immer als meinen Vater betrachtet habe …«
»Wo hast du denn das her?«
»Was?«
»Diese Geschichte, dass ich dein Vater sein soll. Wenn deine Mutter das gesagt hat, dann hat sie dir einen Bären aufgebunden. Wir sind nur fünfzehn Jahre auseinander, und ich war zwar sehr frühreif, aber mit fünfzehn …«
»Aber Salvo, ich hab doch nicht gesagt, dass du mein Vater bist, ich meinte, du bist für mich so was wie ein Vater.«
»Damit kommst du bei mir nicht an. Lass bloß diesen Scheiß mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Sag, was los ist, und verpiss dich wieder, heute ist nicht mein Tag.«
»Warum hast du um einen Termin beim Questore gebeten?« »Wer hat das gesagt?«
»Catarella.«
»Dem werd ich was erzählen.«
»Du wirst ihm gar nichts erzählen, das kannst du mit mir ausmachen. Ich habe Catarella angewiesen, mir Bescheid zu sagen, falls du dich mit Bonetti-Alderighi in Verbindung setzt. Ich wusste, dass du das früher oder später tun würdest.«
»Was ist denn so merkwürdig daran, wenn ich als Kommissar meinen Vorgesetzten sprechen will?«
»Salvo, Bonetti-Alderighi ist doch ein rotes Tuch für dich, du erträgst ihn nicht. Wenn er als Pfarrer an dein Sterbebett käme, um dir die Absolution zu erteilen, würdest du aufstehen und ihm einen Tritt in den Hintern verpassen. Ich rede jetzt Klartext, in Ordnung?«
»Tu dir keinen Zwang an.«
»Du willst gehen.«
»Ein bisschen Urlaub würde mir gut tun.«
»Salvo, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Du willst kündigen.«
»Das ist doch mein Bier, oder?«, fuhr Montalbano ihn an und rutschte auf die Stuhlkante, jederzeit bereit aufzuspringen. Augello ließ sich nicht beeindrucken.
»Natürlich. Aber vorher müssen wir noch etwas zu Ende besprechen. Weißt du noch, dass du gesagt hast, du hättest einen Verdacht?«
»Was für einen Verdacht?«
»Dass die Geschichte in Genua absichtlich von einer Partei provoziert wurde, um die üblen Polizeiaktionen im Nachhinein irgendwie zu rechtfertigen. Weißt du das noch?«
»Ja.«
»Ich möchte dich daran erinnern, dass die Sache in Neapel unter einer Mitte-links-Regierung passiert ist, sprich vor dem G8-Gipfel. Bloß hat man es erst später erfahren. Wie findest du das?«
»Beschissen. Mimì, glaubst du, ich hätte nicht darüber nachgedacht? Das macht alles noch viel schlimmer.«
»Was meinst du damit?«
»Dass der ganze Dreck in uns steckt.«
»Und das merkst du jetzt erst? Ausgerechnet du, wo du so viel liest? Wenn du gehen willst, dann geh. Aber nicht jetzt. Geh, wenn du müde bist, wenn du die Altersgrenze erreicht hast, wenn dir die Hämorrhoiden wehtun, wenn dein Hirn nicht mehr mitmacht, aber nicht ausgerechnet jetzt.«
»Und warum nicht?«
»Weil es verletzend wäre.«
»Für wen denn?«
»Für mich zum Beispiel. Ich bin zwar ein Weiberheld, aber ein anständiger Mensch. Catarella ist ein Engel. Fazio ist auch ein feiner Kerl. Alle hier im Kommissariat von Vigàta wären verletzt. Auch Bonetti-Alderighi, der immer Ärger macht und einem nie was durchgehen lässt, aber in Ordnung ist. Alle deine Kollegen, die du schätzt und die dich mögen. Die allermeisten Leute bei der Polizei, die nichts mit ein paar Schuften, egal, in welcher Position, zu tun haben. Wenn du gehst, knallst du uns die Tür ins Gesicht. Überleg dir das. Wiedersehen.«
Er stand auf und verschwand. Um halb zwölf ließ Montalbano sich von Catarella mit der Questura verbinden; er teilte Dottor Lattes mit, er komme doch nicht, was er dem Questore habe sagen wollen, sei unwichtig, ganz unwichtig.
Nach dem Anruf verspürte er ein Bedürfnis nach Meeresluft. Als er an der Telefonvermittlung vorbeiging, blaffte er Catarella an:
»Kannst mich wieder bei Augello verpetzen.«
Catarella sah ihn traurig an wie ein verloren gegangener Hund.
»Warum sagen Sie so was zu mir, Dottori?«
Jeder fühlte sich von ihm verletzt, nur er selbst durfte sich von niemandem verletzt fühlen.
Auf einmal mochte er nicht mehr im Bett liegen und über all das nachgrübeln, was er und Mimì in den vergangenen Tagen miteinander besprochen hatten. Hatte er Livia nicht seinen Entschluss mitgeteilt? Die Sache war erledigt. Montalbano sah zum Fenster, durch das kaum Licht drang. Die Uhr zeigte fast sechs. Er stand auf und öffnete die Fensterläden. Im Osten zeichnete die aufgehende Sonne Arabesken luftiger Wolken, keine Regenwolken. Das Meer bewegte sich leicht in der Morgenbrise. Montalbano füllte seine Lungen mit Luft und spürte, wie jeder Atemzug ein wenig von dieser furchtbaren Nacht mit sich forttrug. Er ging in die Küche, setzte die Espressokanne auf und öffnete, während er auf den Kaffee wartete, die Verandatür.
Der Strand schien leer, zumindest waren bei dem Dämmerlicht weit und breit kein Mensch und kein Tier zu sehen. Er trank zwei Tassen Kaffee hintereinander, zog die Badehose an und ging zum Strand hinunter. Der Sand war feucht und fest, vielleicht hatte es am frühen Abend ein bisschen geregnet. Er steckte einen Fuß ins Wasser. Es war längst nicht so eisig, wie er gedacht hatte. Vorsichtig ging er weiter, hin und wieder lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Warum, fragte er sich, muss ich mit über fünfzig eigentlich noch einen solchen Unfug machen? Wahrscheinlich kriege ich eine dicke Erkältung mit Brummschädel, und dann niese ich eine Woche lang.
Mit gemächlichen, ausholenden Zügen begann er zu schwimmen. Das Meerwasser hatte einen scharfen Geruch und kitzelte in der Nase, beinahe wie Champagner. Und Montalbano fühlte sich wie betrunken, denn er schwamm weiter und weiter, endlich war sein Kopf frei von jeglichem Gedanken, und er genoss es, dass er sich in eine Art Aufziehpuppe verwandelt hatte. Was ihn auf einen Schlag wieder zum Menschen machte, war ein Krampf, der ihm in die linke Wade fuhr. Fluchend drehte Montalbano sich auf den Rücken und machte den toten Mann. Die Schmerzen waren so stark, dass er die Zähne zusammenbeißen musste, aber er wusste, dass sie früher oder später vorbeigehen würden. Diese verfluchten Krämpfe waren in den letzten zwei, drei Jahren immer häufiger aufgetreten. Erste Symptome des Alters, das hinter der Ecke lauerte? Er ließ sich weiter treiben. Die Schmerzen wurden allmählich schwächer, sodass er zwei Schwimmzüge rückwärts machen konnte. Beim zweiten Zug stieß er mit der rechten Hand gegen etwas.
Im Bruchteil einer Sekunde begriff Montalbano, dass dieses Etwas der Fuß eines Menschen war. Direkt hinter ihm machte noch jemand den toten Mann, und er hatte ihn nicht gesehen.
»Entschuldigung«, sagte er hastig und drehte sich auf den Bauch.
Der andere gab keine Antwort, er machte nämlich nicht den toten Mann. Er war wirklich tot. Und so wie er aussah, war er das schon ziemlich lange.
Zwei
Montalbano schwamm verwirrt um die Leiche herum und versuchte, das Wasser nicht mit den Armen aufzuwühlen. Inzwischen war es hell geworden, und der Krampf war vorbei. Die Leiche war wirklich nicht frisch, sie musste schon lange im Wasser liegen, denn viel Fleisch hing nicht mehr an den Knochen und der Kopf war praktisch ein Schädel. Ein Schädel mit Algenfrisur. Das rechte Bein löste sich fast vom Körper. Die Fische und das Meer hatten den armen Kerl übel zugerichtet, er musste ein Schiffbrüchiger oder ein Flüchtling sein, der vor Hunger und aus Verzweiflung versucht hatte, illegal ins Land zu gelangen; vermutlich hatte ihn ein Sklavenhändler, ein noch gewissenloseres Schwein als andere, ins Meer geworfen. Die Leiche musste von weither gekommen sein. Und während der ganzen Zeit, in der dieses Strandgut im Wasser trieb, sollte kein Fischkutter oder sonst ein Boot etwas gemerkt haben? Schwer vorstellbar. Bestimmt hatte jemand den Toten gesehen, aber rasch die neue landläufige Moral beherzigt, nach der man, wenn man jemanden überfahren hatte, einfach weiterfuhr, ohne zu helfen: Und dann sollte ein Fischkutter wegen so etwas Überflüssigem wie einem Toten stoppen? Hatten Fischer menschliche Überreste, die sie in ihren Netzen fanden, nicht schon umgehend wieder ins Meer geworfen, um bürokratischen Ärger zu vermeiden? »Pietà l’è morta«, das Erbarmen ist tot, hieß es vor langer Zeit prophetisch, vielleicht in einem Lied. Nach und nach siechten auch das Mitleid, die Brüderlichkeit, die Solidarität, die Achtung vor den Alten, den Kranken, den Kindern dahin, im Sterben lagen auch die Regeln des …
»Jetzt mach doch nicht einen auf scheißmoralisch«, sagte Montalbano zu Montalbano. »Lass dir lieber was einfallen.«
Er riss sich aus seinen Gedanken und blickte zum Ufer. Matre santa, war das weit weg! Wie hatte er es geschafft, so weit rauszuschwimmen? Und wie zum Teufel sollte er es bewerkstelligen, den Toten an Land zu bringen? Selbigen hatte die Strömung inzwischen ein paar Meter weitergetrieben. Wollte er etwa mit ihm um die Wette schwimmen? Da fiel Montalbano ein, wie er das Problem lösen konnte. Er zog die Badehose aus, die außer einem Gummi im Hosenbund auch eine ziemlich lange Kordel hatte, die völlig überflüssig war und nur schick aussah. Mit zwei Schwimmzügen war er wieder bei dem Toten; er überlegte kurz, zog ihm die Badehose über den linken Arm, wickelte sie ihm eng ums Handgelenk und befestigte sie mit dem einen Ende der Kordel. Das andere Ende band er sich mit einem Doppelknoten ums linke Fußgelenk. Falls sich der Arm der Leiche während des Transports nicht löste, was allerdings sehr gut möglich war, würde er, wenn auch unter großen Strapazen, das Ding schon schaukeln, im wahrsten Sinn des Wortes. Montalbano schwamm los. Er schwamm lange, sehr langsam, gezwungenermaßen nur mit den Armen, und hielt gelegentlich inne, um Atem zu holen oder zu kontrollieren, ob die Leiche noch gut befestigt war. Nach etwas mehr als der halben Strecke musste er eine längere Pause einlegen, weil er wie ein Blasebalg schnaufte. Er legte sich auf den Rücken, um den toten Mann zu machen, und durch den Zug auf die Kordel wurde der Tote, der echte Tote, auf den Bauch gedreht.
»Du musst dich noch etwas gedulden«, entschuldigte sich Montalbano.
Als er nicht mehr so keuchen musste, schwamm er wieder los. Nach einer Zeit, die ihm unendlich lang vorkam, war er so weit, dass er fast stehen konnte. Er löste die Kordel von seinem Fuß, hielt das Ende fest und stellte sich aufrecht hin. Das Wasser reichte ihm bis zur Nase. Auf Zehenspitzen hüpfte er ein paar Meter vorwärts, bis er schließlich richtig auftreten konnte. Jetzt fühlte er sich in Sicherheit und wollte den ersten Schritt tun.
Er wollte ihn tun, konnte sich aber nicht bewegen. Er versuchte es noch mal. Es ging nicht. O Gott, er war gelähmt! Montalbano stand da wie ein mitten im Wasser in den Boden gerammter Pfosten, an dem eine Leiche angeleint war. Und am Strand kein Mensch weit und breit, den er hätte zu Hilfe rufen können. War das alles vielleicht nur ein Traum, ein Albtraum?
»Jetzt wache ich gleich auf«, sagte er zu sich.
Aber er wachte nicht auf. Verzweifelt warf er den Kopf in den Nacken und stieß einen so gewaltigen Schrei aus, dass er davon selbst ganz benommen wurde. Der Schrei bewirkte sofort zweierlei: Erstens schwirrten ein paar Möwen, die über ihm flogen und sich an der Posse ergötzten, erschrocken davon; zweitens kam, wenn auch sehr mühsam, wieder Leben in seine Muskeln, seine Nerven, eben alles, was seinen Körper zusammenhielt. Etwa dreißig Schritte trennten ihn noch vom Ufer, aber sie waren ein wahrer Leidensweg. An der Wassergrenze ließ er sich auf den Hintern plumpsen und blieb lange sitzen, mit der Kordel in der Hand. Montalbano sah aus wie ein Fischer, der einen Riesenfisch erbeutet hatte und ihn nicht an Land ziehen konnte. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass er das Schlimmste überstanden hatte.
»Hände hoch!«, schrie eine Stimme hinter ihm.
Erschrocken fuhr Montalbano herum. Wer da geschrien hatte und mit einem Revolver, der den Italienisch-Türkischen Krieg (1911–12) erlebt haben musste, auf ihn zielte, war ein hagerer, nervöser Mann in den Siebzigern, mit besessenem Blick und wenigen Haaren, die ihm wie Drähte vom Kopf abstanden. Neben ihm fuchtelte eine Frau mit Strohhut, die ebenfalls über siebzig war, mit einer Eisenstange herum, wobei man nicht recht wusste, ob es sich dabei um eine Drohgebärde oder fortgeschrittenen Parkinson handelte.
»Moment«, sagte Montalbano. »Ich bin …«
»Du bist ein Mörder!«, kreischte die Frau so durchdringend, dass die Möwen, die zurückgekommen waren, um sich am zweiten Akt der Posse zu ergötzen, schreiend davonstoben.
»Signora, ich …«
»Gib’s zu, du Mörder, ich beobachte dich schon seit zwei Stunden mit dem Fernglas!«, brüllte die Alte noch lauter. Montalbano war völlig verdattert. Ohne die Folgen zu bedenken, ließ er die Kordel los, stand auf und wandte sich den beiden zu.
»O Gott! Der ist nackt!«, schrie die Alte und wich zwei Schritte zurück.
»Du Schuft! Du bist des Todes!«, schrie der Alte und wich zwei Schritte zurück.
Und drückte ab. Der ohrenbetäubende Schuss verfehlte den Commissario, den vor allem der Krach erschreckte, um zwanzig Meter. Der Alte, der bei dem Rückstoß weitere zwei Schritte nach hinten getaumelt war, nahm ihn stur wieder ins Visier.
»Was soll das? Sind Sie verrückt geworden? Ich bin …«
»Halt’s Maul und keine Bewegung!«, befahl der Alte. »Wir haben die Polizei verständigt. Sie ist gleich da.«
Montalbano rührte sich nicht. Aus dem Augenwinkel sah er die Leiche langsam aufs Meer hinaustreiben. Dann hatte der Herrgott ein Einsehen, und zwei Autos kamen angerast und hielten am Straßenrand. Aus dem ersten stürzten Fazio und Gallo, beide in Zivil. Montalbano war erleichtert, doch das dauerte nicht lange, denn aus dem zweiten Auto stieg ein Fotograf, der ihn unter Beschuss nahm. Fazio hatte den Commissario sofort erkannt und rief dem Alten zu:
»Polizei! Nicht schießen!«
»Und woher weiß ich, ob ihr nicht Komplizen seid?«, lautete die Antwort.
Er richtete den Revolver auf Fazio. Doch das lenkte ihn von Montalbano ab. Und der, stinksauer wie er war, stürzte sich auf den Alten, packte ihn am Handgelenk und entwaffnete ihn. Doch dem kräftigen Schlag auf den Kopf, den ihm die Alte mit der Eisenstange verpasste, konnte er nicht ausweichen. Ihm wurde schwarz vor den Augen, er sank auf die Knie und fiel in Ohnmacht.
Die Ohnmacht musste in Schlaf übergegangen sein, denn als er in seinem Bett erwachte und auf die Uhr sah, war es halb zwölf. Als Erstes nieste er, dann nieste er noch mal und dann noch mal. Er war erkältet, und sein Kopf brummte ziemlich. In der Küche hörte er Adelina, seine Haushälterin.
»Sind Sie wach, Dutturi?«
»Ja, aber der Kopf tut mir weh. Vielleicht hat mir die Alte ja ein Loch reingehauen.«
»Ihr Kopf kriegt doch nicht mal von einer Kanonenkugel ein Loch.«
Das Telefon klingelte, und er wollte aufstehen, doch ein Schwindel zwang ihn zurück ins Bett. Konnte diese verfluchte Alte eine solche Kraft in den Armen haben? Adelina ging dran. Sie sagte:
»Er ist grade aufgewacht. Ist gut, ich sag’s ihm.«
Sie erschien mit einer dampfenden Tasse Espresso.
»Der Signor Fazio. Er hat gesagt, dass er nachher kommt, spätestens in einer halben Stunde.«
»Wann bist du denn gekommen, Adelì?«
»Um neun, wie immer, Dutturi. Die haben Sie ins Bett gebracht, und der Signor Gallu ist bei Ihnen geblieben. Da hab ich ihm gesagt, dass ich jetzt bei Ihnen bleib, und da ist er dann gegangen.«
Sie verschwand und kam nach einer Weile wieder, in einer Hand ein Glas und in der anderen eine Tablette.
»Ich hab ein Spirin für Sie.«
Montalbano schluckte es brav. Als er aufrecht im Bett saß, bekam er Schüttelfrost. Adelina holte grummelnd eine Decke aus dem Schrank und breitete sie auf dem Bett aus.
»In Ihrem Alter dürfen Sie so dumme Sachen nicht mehr machen.«
Montalbano verwünschte sie. Er zog sich die Decke über den Kopf und schloss die Augen.
Das Telefon klingelte lange. Wieso ging Adelina nicht dran? Montalbano stand auf und wankte ins andere Zimmer.
»Haddo?«, fragte er mit Näselstimme.
»Dottore? Ich bin’s, Fazio. Ich kann leider doch nicht, mir ist was dazwischengekommen.«
»Was Ernsdes?«
»Nein, nicht der Rede wert. Ich schaue am Nachmittag mal vorbei. Gute Besserung.«
Montalbano legte auf und ging in die Küche. Adelina war schon fort, auf dem Tisch lag ein Zettel:
Sie haben geschlahfen und ich wolte Sie nich weggen. Komt ja gleich der Sinior Fazziu. Im Külschrank sin Sachen. Adelina.
Montalbano hatte keine Lust, in den Kühlschrank zu schauen, er hatte keinen Appetit. Da merkte er, dass er im Adamskostüm durch die Wohnung lief, wie Journalisten und Leute, die sich für witzig halten, das nennen. Er schlüpfte in Unterhose, Hemd und Hose und setzte sich in den Fernsehsessel. Es war viertel vor eins, Zeit für die Mittagsnachrichten von »Televigàta«, dem Sender, der sich stets berufen fühlte, mit der Regierung zu sympathisieren, egal, ob die extreme Linke oder die extreme Rechte am Ruder war. Das Erste, was er sah, war er selbst. Splitterfasernackt, mit aufgerissenem Mund und überraschtem Blick, die Hände über das Geschlecht gewölbt. Wie eine in die Jahre gekommene keusche Susanna, nur um einiges behaarter. Eine Bildunterschrift vermeldete:
Commissario Montalbano (im Bild) rettet eine Leiche. Montalbano dachte an den Fotografen, der mit Fazio und Gallo gekommen war, und wünschte ihm im Stillen aufs Aufrichtigste und Herzlichste ein langes, glückliches Leben. Auf dem Bildschirm erschien das Hühnerarschgesicht von Pippo Ragonese, Montalbanos erklärtem Feind. »Heute Morgen kurz nach Tagesanbruch …«
Auf dem Bildschirm erschien für die, die schwer von Begriff waren, irgendein Tagesanbruch.
»… wollte unser Held, Commissario Salvo Montalbano, schwimmen gehen …«
Es erschien ein Meeresausschnitt mit einem Schwimmer, der weit weg und nicht zu erkennen war.
»Sie werden wohl denken, dass die Badesaison noch nicht angefangen hat, vor allem aber, dass das nicht gerade die geeignete Uhrzeit ist. Aber was wollen Sie machen? Unser Held ist nun mal so, vielleicht war ihm ja nach Schwimmen zumute, um sich die verschrobenen Ideen aus dem Kopf zu treiben, denen er häufig zum Opfer fällt. Als er hinausschwamm, stieß er auf die Leiche eines Unbekannten. Anstatt zu telefonieren und die zuständige Stelle …«
»… mit dem im Schwanz implantierten Handy«, ergänzte Montalbano wütend.
»… zu informieren, beschloss unser Commissario, die Leiche ganz allein an Land zu ziehen, und band sie mit der Badehose an seinem Fuß fest. Selbst ist der Mann, lautet sein Motto. Nicht entgangen ist dieses Unternehmen Signora Pina Bausan, die das Meer mit einem Fernglas beobachtete.«
Daraufhin erschien das Gesicht von Signora Bausan, die ihm mit der Eisenstange eins über den Schädel gezogen hatte.
»Woher kommen Sie, Signora?«
»Wir sind aus Treviso, ich und mein Mann Angelo.«
Zu dem Gesicht der Frau gesellte sich das ihres Mannes, des Schützen.
»Sind Sie schon lange in Sizilien?«
»Seit vier Tagen.«
»Machen Sie hier Urlaub?«
»Von wegen Urlaub! Ich habe Asthma, und der Arzt hat gesagt, Seeluft würde mir gut tun. Meine Tochter Zina ist mit einem Sizilianer verheiratet, der in Treviso arbeitet …«
Signora Bausan, der das böse Schicksal einen sizilianischen Schwiegersohn beschert hatte, unterbrach ihre Erklärung mit einem tiefen, kummervollen Seufzer.
»… und hat gesagt, wir sollen eine Weile im Haus ihres Mannes wohnen, das sie nur einen Monat im Sommer nutzen. Da sind wir eben gekommen.«
Der kummervolle Seufzer war diesmal noch lauter: Wie war das Leben auf dieser wilden Insel doch hart und gefährlich!
»Sagen Sie, Signora, warum haben Sie um diese Uhrzeit das Meer beobachtet?«
»Ich stehe früh auf, da muss ich doch was tun, oder?«
»Und Sie, Signor Bausan, tragen Sie immer eine Waffe bei sich?«
»Nein. Ich besitze keine Waffe. Den Revolver habe ich mir von einem Cousin geliehen. Sie verstehen, wenn man nach Sizilien muss …«
»Sie sind der Meinung, dass man in Sizilien bewaffnet sein sollte?«
»Ist doch logisch, wo es hier kein Gesetz gibt, oder?«
Ragoneses Hühnerarschgesicht tauchte wieder auf.
»Und damit entstand das groteske Missverständnis. Im Glauben …«
Montalbano schaltete aus. Er war auf Bausan nicht wütend, weil er geschossen, sondern weil er so geredet hatte. Er ging ans Telefon.
»Haddo, Cadarella?«
»Jetzt hör mal zu, du Arschloch, du Saukerl …«
»Cadarè, erkennz du mich nich? Ich binz, Montalbano.«