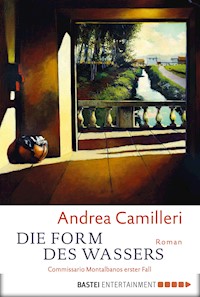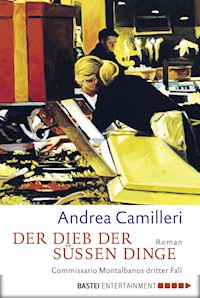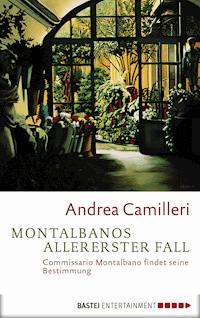9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Commissario Montalbano ist schon ein bißchen überrascht, als der flüchtige Mehrfachmörder Tano u Grecu um seine Verhaftung bittet. Schließlich ist der Commissario, was diese Dinge betrifft, eher an Widerstand gewöhnt. Die Erklärung indes ist einleuchtend: Tano fürchtet seine Feinde in der Mafia mehr als die Polizei - mit Recht, wie sich herausstellt, denn wenig später wird er ermordet. Was zunächst aussieht wie ein typisches Verbrechen der Mafia, entwickelt sich zu einem komplizierten Fall, als Montalbano bei seinen Nachforschungen auf ein weiteres, bereits fünfzig Jahre zurückliegendes Verbrechen stößt. In einer Höhle entdeckt er die skelettierten Leichen eines Mannes und einer Frau in inniger Umarmung, bewacht von einem lebensgroßen Schäferhund aus Terracotta ... Commissario Montalbano löst seinen zweiten Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Anmerkung des Autors
Anmerkungen der Übersetzerin
Im Text erwähnte kulinarische Köstlichkeiten
Über den Autor
Andrea Camilleri, 1925 in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle geboren, ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und lehrt seit über zwanzig Jahren an der Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. Mit seinem vielfach ausgezeichneten literarischen Werk löste er in Italien eine Begeisterung aus, die DIE WELT treffend als »Camillerimania« bezeichnete. Vor allem die Kriminalromane um Commissario Salvo Montalbano haben Andrea Camilleri mittlerweile auch in Deutschland eine große Fangemeinde beschert.
Andrea Camilleri
Der Hund aus Terracotta
Commissario Montalbano löstseinen zweiten Fall
Aus dem Italienischen vonChristiane von Bechtolsheim
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der italienischen Originalausgabe:
IL CANE DI TERRACOTTA,
erschienen bei Sellerio Editore, Via Siracusa 50, Palermo
© 1996 by Sellerio Editore
© für die deutschsprachige Ausgabe 1999 by:
Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright Cover © corbis/A. Belov
Umschlaggestaltung: Marina Boda
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0324-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
So wie sich der Morgen präsentierte, kündigte sich ein gräßlicher Tag an, mal würde die Sonne vom Himmel brennen, mal eisiger Regen niederprasseln, und auch mit ein paar heftigen Windböen war zu rechnen. Wenn an solchen Tagen Kopf und Kreislauf unter dem plötzlichen Wetterwechsel leiden, kann es schon mal vorkommen, daß man dauernd seine Meinung und seine Gefühle ändert, so wie sich die Blechdinger in Form einer Fahne oder eines Hahns beim kleinsten Windstoß auf den Dächern in alle Himmelsrichtungen drehen.
Commissario Salvo Montalbano gehörte immer schon zu dieser bedauernswerten Sorte Mensch; denn er hatte die Wetterfühligkeit von seiner Mutter geerbt, die kränklich gewesen war und sich oft ins abgedunkelte Schlafzimmer zurückgezogen hatte, weil sie an Kopfschmerzen litt. Dann mußte es im Haus mucksmäuschenstill sein, und man durfte nur auf Zehenspitzen herumlaufen. Sein Vater dagegen war immer gesund, bei jedem Wetter, er war stets ausgeglichen, egal, ob es regnete oder die Sonne schien.
Auch an diesem Tag blieb der Commissario seiner offensichtlich angeborenen Unschlüssigkeit treu: Kaum war er mit dem Auto am Kilometer zehn der Provinciale zwischen Vigàta und Fela stehengeblieben, wie ihm aufgetragen worden war, wäre er am liebsten wieder umgekehrt und ins Dorf zurückgefahren und hätte die ganze Sache sausenlassen. Aber er nahm sich zusammen, parkte das Auto näher am Straßenrand und öffnete das Handschuhfach, um seine Pistole herauszuholen, die er normalerweise nicht umgeschnallt hatte. Doch mitten in der Bewegung hielt er inne: Er rührte sich nicht und starrte gebannt auf die Waffe.
Madonna santa! Es stimmt wirklich! dachte er.
Am Abend zuvor, ein paar Stunden bevor Gegè Gulottas Anruf die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hatte – Gegè war ein kleiner Dealer weicher Drogen und Betreiber eines Bordells unter freiem Himmel, bekannt als Mànnara –, hatte der Commissario einen Krimi gelesen, der ihn ziemlich beschäftigte und dessen aus Barcelona stammender Autor außerdem den gleichen Nachnamen trug wie er, nur in der spanischen Version: Montalbán. Ein Satz hatte ihn besonders beeindruckt: Die schlafende Pistole sah aus wie eine kalte Eidechse. Leicht angewidert zog er seine Hand zurück, schloß das Fach und ließ die Eidechse schlafen. Wenn sich diese Geschichte, die da ihren Anfang nahm, als übler Trick, als Falle herausstellen sollte, dann hätte er seine Pistole schon ganz gern dabei, aber die würden ihn sowieso, ohne mit der Wimper zu zucken, mit einer Kalaschnikow durchlöchern, und dann war eh alles zu spät. Er konnte nur hoffen, daß Gegè eingedenk der Jahre, die sie in der Grundschule nebeneinandersitzend verbracht hatten – auch als Erwachsene waren sie Freunde geblieben –, in seinem Interesse nicht beschlossen hatte, ihn den Hunden zum Fraß vorzuwerfen, und ihm irgendeinen Mist erzählt hatte, um ihn in einen Hinterhalt zu locken. Nein, nicht irgendeinen: Wenn die Geschichte stimmte, dann war sie ein dicker Hund und würde großen Wirbel machen.
Er holte tief Atem und stieg, langsam einen Fuß vor den anderen setzend, einen schmalen steinigen Pfad zwischen langen Reihen von Weinstöcken hinauf. Was hier wuchs, war eine Tafeltraube mit runden, festen Beeren, die, weiß der Himmel warum, uva d’Italia hieß, die einzige, die auf diesem Boden gedieh; für den Anbau jeder Keltertraube konnte man sich hier in der Gegend Kosten und Arbeit sparen.
Das einstöckige Häuschen, ein Zimmer oben, eines unten, stand ganz oben auf dem Hügel, halb verborgen hinter vier mächtigen Olivenbäumen, die es fast vollständig umschlossen. Es sah genauso aus, wie Gegè es beschrieben hatte: Tür und Fenster verriegelt, die Farbe ausgebleicht, auf dem Platz davor ein riesiger Kapernbusch und kleinere Sträucher winziger Eselsgurken, die bei der geringsten Berührung mit einem spitzen Stock aufplatzen und ihre Kernchen verspritzen, ein umgekippter Stuhl, dessen geflochtener Sitz gebrochen war, ein alter Zinkeimer zum Wasserholen, der vom Rost zerfressen und unbrauchbar geworden war. Der Rest war von Gras überwuchert. All das trug zu dem Eindruck bei, daß der Ort seit Jahren unbewohnt war, aber der Schein trog, und Montalbano war zu erfahren, als daß er sich davon hätte überzeugen lassen. Er war sogar sicher, daß ihn jemand vom Inneren des Hauses aus beobachtete und aus seinen Bewegungen schloß, was er vorhatte. Er blieb drei Schritte vor der Tür stehen, zog sein Jackett aus, hängte es an einen Olivenbaum, damit man sehen konnte, daß er keine Waffe trug, und rief, nicht allzu laut, wie jemand, der einen Freund besucht: »He! Ist jemand da?«
Niemand antwortete, nichts war zu hören. Der Commissario zog ein Feuerzeug und ein Päckchen Zigaretten aus der Hosentasche, steckte sich eine in den Mund, stellte sich gegen den Wind, indem er sich halb um sich selbst drehte, und zündete sie an. So konnte ihn jemand, der im Haus war, problemlos von hinten beobachten, wie er ihn vorher von vorn beobachtet hatte. Er nahm zwei Züge, dann ging er entschlossen auf die Tür zu und schlug so fest mit der Faust dagegen, daß ihm die Knöchel von den verkrusteten Stellen im Lack weh taten.
»Ist da jemand?« rief er wieder.
Auf alles war er gefaßt gewesen, nur nicht auf die spöttische, ruhige Stimme, die ihn gemeinerweise von hinten ansprach.
»Ja, ja. Hier bin ich.«
»Pronto? Pronto? Montalbano? Salvuzzo! Ich bin’s, Gegè!«
»Schon klar, beruhig dich. Wie geht’s, mein Honigschleckermäulchen?«
»Gut geht’s.«
»Hat das Mäulchen auch fleißig gearbeitet? Wirst du immer besser im Blasen?«
»Salvù, laß deine blöden Witze. Wenn überhaupt, dann blase ich nicht selber, sondern lasse blasen, das weißt du ganz genau.«
»Bist du denn nicht der große Lehrmeister? Bringst du den bunten Vögelchen denn nicht bei, was sie mit den Lippen machen sollen, wie fest sie lutschen müssen?«
»Salvù, wenn es so wäre, wie du sagst, würden höchstens sie mir was beibringen. Wenn sie mit zehn Jahren kommen, wissen sie schon Bescheid, mit fünfzehn sind sie Profis. Ich hab’ da eine vierzehnjährige Albanerin, die …«
»Machst du jetzt Reklame für deine Ware?«
»Hör zu, ich hab’ keine Zeit für solchen Quatsch. Ich muß dir was geben, ein Päckchen.«
»Jetzt? Geht das nicht morgen früh?«
»Morgen bin ich nicht da.«
»Weißt du denn, was drin ist?«
»Klar weiß ich das. Mostazzoli di vino cotto, die magst du doch so gern. Meine Schwester Mariannina hat sie extra für dich gemacht.«
»Wie geht’s Marianninas Augen?«
»Viel besser. In Barcelona haben sie wahre Wunder vollbracht.«
»In Barcelona schreiben sie auch gute Bücher.«
»Was hast du gesagt?«
»Nichts, vergiß es. Wo treffen wir uns?«
»An der üblichen Stelle, in einer Stunde.«
Die übliche Stelle war der kleine Puntasecca-Strand, ein kurzer Sandstreifen unterhalb eines Hügels aus weißem Mergel, der auf dem Landweg eigentlich nicht zu erreichen war; das heißt, zu erreichen war er nur für Montalbano und Gegè, denn sie hatten bereits als Schulkinder einen Weg entdeckt, den zu Fuß zurückzulegen schon mühsam, mit dem Auto jedoch ein wirkliches Abenteuer war.
Puntasecca war nur ein paar Kilometer von dem kleinen Haus am Meer außerhalb Vigàtas entfernt, in dem Montalbano wohnte, er konnte sich also Zeit lassen. Doch gerade, als er aus dem Haus gehen wollte, um zu dem Treffpunkt zu fahren, klingelte das Telefon.
»Ciao, amore, siehst du, ich bin ganz pünktlich. Wie war dein Tag?«
»Wie immer. Und deiner?«
»Genauso. Du, Salvo, ich habe lange über das nachgedacht, was …«
»Livia, entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe wenig Zeit, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit. Ich war schon fast aus der Tür, ich muß noch mal weg.«
»Dann geh, gute Nacht.«
Livia legte auf, und Montalbano behielt den Hörer in der Hand. Da fiel ihm ein, daß er Livia am Abend zuvor gesagt hatte, sie solle ihn Punkt Mitternacht anrufen, dann wäre genug Zeit für ein langes Gespräch. Er war unentschlossen, ob er seine Freundin nicht besser gleich in Boccadasse anrufen sollte oder erst nachher, wenn er von dem Treffen mit Gegè zurück war. Mit leisen Gewissensbissen legte er den Hörer auf und machte sich auf den Weg.
Als er mit ein paar Minuten Verspätung ankam, wartete Gegè schon auf ihn und ging nervös neben seinem Auto auf und ab. Sie umarmten und küßten einander, denn sie hatten sich schon lang nicht mehr gesehen.
»Komm, wir setzen uns in mein Auto, ganz schön kühl heut nacht«, sagte der Commissario.
»Ich bin da in was reingezogen worden«, fing Gegè an, sobald er saß.
»Von wem?«
»Von Leuten, die ich nicht abblitzen lassen kann. Du weißt ja, daß ich wie jeder Geschäftsmann Schutzgeld zahle, damit ich in Ruhe arbeiten kann und mir niemand einen Strich durch meinen Straßenstrich macht. Jeden Monat, den der liebe Gott uns schenkt, kommt einer vorbei und kassiert.«
»In wessen Auftrag? Kannst du mir das sagen?«
»Im Auftrag von Tano u Grecu.«
Montalbano war überrascht, ließ sich aber nichts anmerken. Gaetano Bennici, »u grecu«, hatte Griechenland noch nicht mal durchs Fernglas gesehen, und von Hellas hatte er keinen blassen Schimmer, aber er wurde wegen eines gewissen Lasters so genannt, das im Umkreis der Akropolis als außerordentlich populär galt. Er hatte mindestens drei Morde auf dem Gewissen, in seinen Kreisen stand er eine Stufe unter den Oberbossen, aber daß er in Vigàta und Umgebung operierte, war nicht bekannt gewesen, hier stritten sich die Familien Cuffaro und Sinagra um das Terrain. Tano gehörte zu einem anderen Clan.
»Was hat denn Tano u Grecu hier verloren?«
»Du fragst vielleicht blöd! Bist ja ein großartiger Bulle! Weißt du etwa nichts von der Abmachung, daß es für Tano u Grecu keine bestimmte Gegend gibt, keine Zonen, wenn es um Frauen geht? Er kontrolliert die ganze Hurenbagage der Insel und kriegt die Kohle dafür.«
»Das wußte ich nicht. Sprich weiter.«
»Gestern abend gegen acht kam wie immer der Typ zum Kassieren, es war der Tag, an dem ich das Schutzgeld zahlen mußte. Ich hab’ ihm das Geld gegeben, und er hat es genommen, aber anstatt wieder wegzufahren, macht er die Autotür auf und sagt, ich soll einsteigen.«
»Und was hast du gemacht?«
»Ich bin erschrocken, mir ist der kalte Schweiß ausgebrochen. Was blieb mir denn anderes übrig? Ich steige also ein, und er fährt los. Kurz und gut, er biegt in die Straße nach Fela ein, hält nach einer knappen halben Stunde und …«
»Hast du ihn gefragt, wo ihr hinfahrt?«
»Klar.«
»Und, was hat er geantwortet?«
»Kein Wort, als hätte ich nichts gesagt. Nach einer halben Stunde läßt er mich an einer gottverlassenen Stelle aussteigen und macht mir ein Zeichen, daß ich einen Feldweg entlanggehen soll. Da war nicht mal ein Hund, nichts. Plötzlich steht Tano u Grecu vor mir, keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Mich hat fast der Schlag getroffen, ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Versteh mich richtig, das war nicht Feigheit, aber der Kerl hat fünf Morde begangen.«
»Wie bitte? Fünf ?«
»Warum, von wie vielen wißt ihr denn?«
»Von dreien.«
»Nein, mein Lieber, es sind genau fünf, das garantier’ ich dir.«
»Schon gut, erzähl weiter.«
»Ich hab’ schnell hin und her überlegt. Nachdem ich immer regelmäßig gezahlt habe, dachte ich, Tano wollte den Preis erhöhen. Über das Geschäft kann ich mich nicht beklagen, und das wissen sie. Aber es war ein Irrtum, es ging nicht um Geld.«
»Was wollte er dann?«
»Er hat mich nicht mal begrüßt, er hat gefragt, ob ich dich kenne.«
Montalbano glaubte, nicht recht gehört zu haben.
»Ob du wen kennst?«
»Dich, Salvù, dich.«
»Und, was hast du ihm gesagt?«
»Ich hab’ mir fast in die Hosen gemacht, ich hab’ gesagt, daß ich dich schon kenne, aber nur so, vom Sehen, hallo und auf Wiedersehen. Er hat mich angeschaut, und seine Augen waren wie bei einer Statue, starr und tot, glaub mir, und dann hat er den Kopf in den Nacken gelegt und gekichert und mich gefragt, ob ich wissen wollte, wie viele Haare ich am Arsch habe, und daß er höchstens um zwei danebenliegen würde. Das heißt, daß er alles von mir weiß, Leben, Wundertaten und Tod, der hoffentlich noch lang auf sich warten läßt. Ich hab’ also auf den Boden geschaut und meinen Mund gehalten. Dann hat er gesagt, ich soll dir sagen, daß er dich treffen will.«
»Wann und wo?«
»Heute noch, bei Tagesanbruch. Wo, erklär’ ich dir gleich.«
»Weißt du, was er von mir will?«
»Das weiß ich nicht, und ich will es auch gar nicht wissen. Er hat gesagt, ich soll dir versichern, daß du ihm wie einem Bruder vertrauen kannst.«
Wie einem Bruder: Diese Worte beruhigten Montalbano ganz und gar nicht, sondern jagten ihm einen kalten Schauder über den Rücken; jedermann wußte, daß der erste von Tanos drei – oder fünf – Morden der Mord an seinem älteren Bruder Nicolino gewesen war, den er erst erwürgt und dann, nach einem mysteriösen Gesetz der Semiotik, fein säuberlich gehäutet hatte. Er verfiel in düstere Gedanken, die, wenn das überhaupt ging, noch düsterer wurden, als Gegè ihm eine Hand auf die Schulter legte und flüsterte:
»Sei vorsichtig, Salvù, der Grecu ist ein übler Typ.«
Salvo Montalbano fuhr langsam in Richtung seines Hauses, als Gegè, der ihm folgte, mehrmals mit den Scheinwerfern auf blendete. Der Commissario stoppte am Straßenrand, Gegè hielt neben ihm, beugte sich weit zu ihm hinüber und reichte ihm ein Päckchen durchs Fenster.
»Ich hab’ die mostazzoli vergessen.«
»Danke. Ich dachte schon, die wären eine faule Ausrede.« »Wofür hältst du mich? Glaubst du, ich mache dir was vor?«
Beleidigt gab er Gas.
Der Commissario verbrachte eine fürchterliche Nacht. Sein erster Gedanke war, den Questore per Telefon zu wecken und ihn zu informieren, um sich gegen jede Entwicklung abzusichern, die die Geschichte nehmen konnte. Aber Tano u Grecu hatte eindeutige Anweisungen gegeben, wie Gegè berichtet hatte: Montalbano durfte niemanden etwas wissen lassen, und zu dem Treffen mußte er allein kommen. Doch das hier war kein Räuber-und-Gendarm-Spiel, und er mußte seine Pflicht tun. Das hieß, er mußte seine Vorgesetzten verständigen und zusammen mit ihnen die taktische Maßnahme der Verhaftung, eventuell mit Hilfe massiver Verstärkung, bis in die kleinsten Details vorbereiten.
Tano war seit fast zehn Jahren flüchtig, und er sollte ihn seelenruhig und gutgelaunt besuchen, wie einen Freund, der aus Amerika zurück ist? Das kam gar nicht in Frage, es war völlig unmöglich, der Questore mußte unbedingt davon in Kenntnis gesetzt werden. Er wählte die Privatnummer seines Vorgesetzten in Montelusa, der Hauptstadt der Provinz.
»Bist du es, Liebling?« vernahm er da Livias Stimme aus Boccadasse, Genua.
Montalbano stockte einen Moment lang der Atem, instinktiv hatte er wohl die falsche Nummer gewählt, um das Gespräch mit dem Questore zu vermeiden.
»Entschuldige wegen vorhin, ich hatte einen unvorhergesehenen Anruf bekommen und mußte weg.«
»Ist schon gut, Salvo, ich weiß ja, was du für einen Beruf hast. Entschuldige du, daß ich so schnell aufgelegt habe, ich war einfach enttäuscht.«
Montalbano sah auf die Uhr, es waren noch mindestens drei Stunden bis zu dem Treffen mit Tano.
»Wenn du magst, können wir ja jetzt reden.«
»Jetzt? Entschuldige, Salvo, ich will mich nicht rächen, aber lieber nicht. Ich habe ein Schlafmittel genommen und kann die Augen kaum offen halten.«
»In Ordnung. Bis morgen dann. Ich liebe dich, Livia.«
Livias Stimme klang plötzlich ganz anders, hellwach und besorgt: »He, was ist los? Was ist mit dir, Salvo?«
»Nichts, was soll denn sein?«
»Nein, nein, mein Lieber, du schwindelst. Hast du was Gefährliches vor? Mach mir keinen Kummer, Salvo.«
»Wie kommst du denn auf so was?«
»Sag die Wahrheit, Salvo.«
»Ich habe nichts Gefährliches vor.«
»Ich glaub’ dir nicht.«
»Aber warum denn nicht, Herrgott noch mal?«
»Weil du ›ich liebe dich‹ gesagt hast, und das hast du erst dreimal gesagt, seit wir uns kennen, ich hab’ mitgezählt, und jedesmal war irgendwas Besonderes.«
Er mußte das Gespräch unbedingt beenden, Livia würde sonst bis zum nächsten Morgen keine Ruhe geben.
»Ciao, Liebling, schlaf gut. Sei kein Kindskopf. Ciao, ich muß noch mal weg.«
Wie sollte er sich jetzt die Zeit vertreiben? Er duschte, las ein paar Seiten in dem Buch von Montalbán und begriff wenig, wanderte von Zimmer zu Zimmer, rückte hier ein Bild gerade, las dort einen Brief, eine Rechnung, eine Notiz und griff nach allem, was in Reichweite lag. Er duschte noch einmal, rasierte sich und schnitt sich mitten am Kinn. Er schaltete den Fernseher ein und machte ihn sofort wieder aus, weil ihm davon übel wurde. Endlich war es soweit. Er war schon an der Tür, als er sich noch ein mostazzolo di vino cotto in den Mund stecken wollte. Sehr erstaunt stellte er fest, daß die Schachtel auf dem Tisch offen und kein einziges Stück mehr darin war. Vor lauter Nervosität hatte er gar nicht gemerkt, daß er alles aufgegessen hatte. Und das schlimmste war: Er hatte es gar nicht genossen.
Zwei
Montalbano wandte sich langsam um, als wollte er so die plötzliche stille Wut darüber ausgleichen, daß er sich wie ein blutiger Anfänger von hinten hatte erwischen lassen. Er war doch so wachsam gewesen, und jetzt hatte er nicht das geringste Geräusch gehört.
Eins zu null für dich, du Scheißkerl! dachte er.
Obwohl er ihn nie persönlich gesehen hatte, erkannte er ihn sofort: Tano hatte sich, verglichen mit ein paar Jahren zuvor, zwar verändert und trug jetzt einen Bart, aber seine Augen waren immer noch dieselben, ganz und gar ausdruckslos, wie von einer Statue, das hatte Gegè ganz treffend beschrieben. Tano u Grecu verbeugte sich leicht, und in seiner Geste war keine Spur von Provokation oder Spott. Unwillkürlich erwiderte Montalbano die angedeutete Verbeugung. Tano warf den Kopf zurück und lachte.
»Wir sind wie zwei Japaner, diese japanischen Krieger mit Schwert und Rüstung. Wie heißen die doch gleich?«
»Samurai.«
Tano breitete die Arme aus, als wollte er den Mann, der vor ihm stand, an sich drücken.
»Es ist mir eine Freude, daß ich den berühmten Commissario Montalbano persönlich kennenlernen darf.«
Montalbano beschloß, den Förmlichkeiten gleich ein Ende zu setzen und zur Sache zu kommen, damit über die Zusammenkunft von vornherein Klarheit bestand.
»Ich wüßte nicht, warum Sie sich über meine Bekanntschaft freuen sollten.«
»Eine Freude haben Sie mir jetzt schon gemacht.«
»Und die wäre?«
»Sie siezen mich, ist das etwa nichts? Noch nie hat ein richtiger Bulle, und ich habe schon viele getroffen, ›Sie‹ zu mir gesagt.«
»Sie sind sich hoffentlich im klaren darüber, daß ich das Gesetz vertrete, während Sie ein gefährlicher mehrfacher Mörder sind, der von der Polizei gesucht wird? Und jetzt stehen wir uns hier gegenüber.«
»Ich bin unbewaffnet. Und Sie?«
»Ich auch.«
Tano warf wieder den Kopf zurück und lachte schallend.
»Ich habe mich noch nie in jemandem getäuscht, noch nie!«
»Bewaffnet oder nicht, ich muß Sie verhaften.«
»Hier bin ich, Commissario, verhaften Sie mich. Deswegen wollte ich Sie ja treffen.«
Er war zweifellos aufrichtig, aber gerade weil er so unverblümt aufrichtig war, war Montalbano besonders auf der Hut, denn ihm war überhaupt nicht klar, worauf Tano hinauswollte.
»Sie hätten ins Kommissariat kommen und sich stellen können. Hier oder in Vigàta, das kommt doch auf dasselbe raus.«
»O nein, Duttureddru, das kommt nicht auf dasselbe raus. Ich muß mich über Sie wundern, wo Sie doch lesen und schreiben können, die Wörter sind nicht gleich. Ich stelle mich nicht, sondern lasse mich verhaften. Holen Sie Ihr Jackett, wir reden drinnen, ich schließe inzwischen das Haus auf.«
Montalbano nahm seine Jacke vom Olivenbaum, legte sie sich über den Arm und folgte Tano ins Haus. Darin war es vollkommen dunkel. Der Grecu zündete eine Petroleumlampe an und deutete einladend auf einen der beiden Stühle, die neben einem kleinen Tisch standen.
In dem Zimmer gab es eine Pritsche nur mit einer Matratze, ohne Kissen und Leintuch, und eine kleine Vitrine mit Flaschen, Gläsern, Zwieback, Tellern, Nudelpackungen, Büchsen mit Tomatensauce, allen möglichen Konserven. Auf einem Holzherd standen Keramikschüsseln und Töpfe. Eine morsche Holztreppe führte ins obere Stockwerk. Aber der Blick des Commissario blieb an einem Tier hängen, das weitaus gefährlicher war als die Eidechse, die im Handschuhfach seines Wagens schlief; das hier war eine richtige Giftschlange, eine Maschinenpistole, die neben dem Feldbett an der Wand lehnte und im Stehen schlief.
»Ich habe guten Wein«, sagte Tano, wie es sich für einen ordentlichen Gastgeber gehörte.
»Ja, gern«, sagte Montalbano.
Nach einer solchen Nacht, bei dieser Kälte, bei der Anspannung und dem Kilo mostazzoli, das er verdrückt hatte, konnte er ein Glas Wein gut vertragen.
Der Grecu goß ein und hob das Glas.
»Auf Ihr Wohl.«
Der Commissario hob ebenfalls das Glas und erwiderte den Wunsch.
»Auf Ihr Wohl.«
Der Wein war ausgezeichnet, er floß die Kehle hinab, daß es ein Vergnügen war, er stärkte und wärmte.
»Er ist wirklich gut«, lobte Montalbano.
»Noch ein Glas?«
Um nicht der Versuchung zu erliegen, schob der Commissario das Glas entschieden von sich.
»Reden wir jetzt?«
»Gut. Also, ich sagte, ich hätte beschlossen, mich festnehmen zu lassen …«
»Warum?«
Montalbanos Frage, die wie aus der Pistole geschossen kam, verdutzte den anderen. Doch nach einem Augenblick hatte er sich wieder gefaßt.
»Ich muß in ärztliche Behandlung, ich bin krank.«
»Wie bitte? Sie glauben doch, mich gut zu kennen, dann werden Sie auch wissen, daß ich mich nicht verarschen lasse.«
»Davon bin ich überzeugt.«
»Warum behandeln Sie mich dann nicht dementsprechend und hören mit dem Quatsch auf ?«
»Glauben Sie mir denn nicht, daß ich krank bin?«
»Ich glaube es schon. Aber Sie wollen mir doch nicht weismachen, daß Sie sich festnehmen lassen müssen, um sich in ärztliche Behandlung begeben zu können. Ich kann Ihnen das erklären, wenn Sie wollen. Sie lagen sechs Wochen lang in der Klinik Madonna di Lourdes in Palermo und dann drei Monate in der Gethsemane-Klinik in Trapani, wo Professor Amerigo Guarnera Sie sogar operiert hat. Auch wenn die Dinge etwas anders liegen als noch vor ein paar Jahren, finden Sie, wenn Sie wollen, sofort mehr als eine Klinik, die bereit ist, ein Auge zuzudrücken und Ihre Anwesenheit nicht der Polizei zu melden. Der Grund, weswegen Sie sich festnehmen lassen wollen, ist also nicht Ihre Krankheit.«
»Und wenn ich Ihnen sagen würde, daß sich die Zeiten ändern und sich das Rad immer schneller dreht?«
»Das klingt schon besser.«
»Sehen Sie, mein Vater selig, der ein Ehrenmann war in Zeiten, in denen das Wort ›Ehre‹ noch etwas galt, erklärte mir als Kind, daß der Pferdewagen, den die Ehrenmänner fuhren, viel Schmierfett brauchte, damit die Räder liefen, damit sie sich schnell drehten. Und dann, eine Generation später, als ich selbst fuhr, sagte jemand aus unserer Familie: Warum sollen wir das Schmierfett, das wir benötigen, eigentlich bei den Politikern, den Bürgermeistern, bei den Bankchefs und all den Leuten jener erlesenen Gesellschaft kaufen? Wir stellen unser Schmierfett selber her! Gut! Bravo! Alle einverstanden. Natürlich gab es immer mal jemanden, der seinem Freund das Pferd gestohlen, seinem Partner Steine in den Weg gelegt oder blindlings auf Wagen, Pferd und Reiter eines anderen Clans geschossen hat … Aber das waren alles Dinge, die wir unter uns regeln konnten. Es gab immer mehr Wagen und immer mehr Straßen zum Fahren. Da kam ein kluger Kopf auf eine gute Idee, er hat sich gefragt, warum wir eigentlich immer noch mit dem Pferdewagen fuhren. Wir sind zu langsam, erklärte er, die überholen uns doch, alle Welt fährt jetzt Auto, man darf sich dem Fortschritt nicht verschließen. Gut! Bravo! Da tauschten alle schnell ihren Pferdewagen gegen ein Auto und machten den Führerschein. Aber manche schafften die Fahrprüfung nicht und waren weg vom Fenster. Man hatte nicht mal genug Zeit, mit dem neuen Auto vertraut zu werden, da machten uns die Jüngeren, die ihr ganzes Leben lang Auto gefahren sind und in den Staaten oder in Deutschland Jura oder Wirtschaft studiert hatten, auch schon klar, daß unsere Autos zu langsam waren, daß man heutzutage einen Rennwagen fahren mußte, einen Ferrari, einen Maserati mit Funktelefon und all solchem Zeug, und daß man wie der Blitz starten können mußte. Diese jungen Leute sind ganz up to date, sie reden mit Apparaten und nicht mit Menschen, sie kennen dich nicht mal, sie haben keine Ahnung, wer du warst, und wenn sie es wissen, dann ist es ihnen scheißegal, sie kennen sich nicht mal untereinander, sondern tauschen sich nur per Computer aus. Kurzum, diese Jungen schauen niemanden an, und sobald sie sehen, daß du Schwierigkeiten mit einem langsamen Auto hast, fackeln sie nicht lang und drängen dich von der Straße, und du findest dich mit gebrochenem Genick im Graben wieder.«
»Und Sie können einen Ferrari nicht fahren.«
»So ist es. Und bevor ich im Straßengraben sterbe, ziehe ich mich lieber zurück.«
»Sie wirken aber nicht wie jemand, der sich freiwillig zurückzieht.«
»Freiwillig, ich schwör’s, Commissario, ganz freiwillig. Natürlich gibt es die eine oder andere Möglichkeit, jemanden dazu zu bringen, daß er etwas freiwillig tut. Mir hat mal ein Freund, der sehr belesen war und viel wußte, eine Geschichte erzählt, die ich Ihnen jetzt wortwörtlich wiedergebe. Er hatte sie aus einem deutschen Buch. Ein Mann sagt zu seinem Freund: ›Wetten, daß meine Katze scharfen Senf frißt, den ganz scharfen, der dir ein Loch in den Bauch brennt?‹ ›Katzen mögen keinen Senf‹, sagt der Freund. ›Meine Katze frißt ihn‹, sagt der Mann. ›Mit einer Tracht Prügel vielleicht?‹ fragt der Freund. ›Nein, mein Lieber, ohne Zwang, sie frißt ihn von sich aus, ganz freiwillig‹, antwortet der Mann. Sie wetten also, und der Mann nimmt einen Löffel voll Senf, den Senf, bei dessen Anblick einem schon der Mund brennt, packt die Katze und zack! schmiert er ihr den Senf an den Hintern. Die arme Katze, der der Hintern wie Feuer brennt, fängt an, sich zu lecken. Sie leckt, was das Zeug hält, und frißt den ganzen Senf, freiwillig. So, das wär’s, mein verehrter Herr.«
»Ich verstehe. Und jetzt fangen wir ganz von vorn an.«
»Ich sagte, ich würde mich festnehmen lassen, aber ich will das Gesicht nicht verlieren. Wir werden also ein bißchen Theater spielen müssen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich erklär’s Ihnen.«
Er redete lange und trank dabei ab und zu ein Glas Wein. Am Ende war Montalbano von Tanos Argumenten überzeugt. Aber konnte er ihm trauen? Das war der Haken an der Sache. Montalbano war in seiner Jugend leidenschaftlicher Kartenspieler gewesen, was er, Gott sei Dank, in den Griff bekommen hatte. Er spürte, daß der andere ohne Tricks und gezinkte Karten spielte. Er mußte diesem Gefühl vertrauen und konnte nur hoffen, daß er sich nicht täuschte. Sorgfältig tüftelten sie die Festnahme bis ins kleinste Detail aus, um zu vermeiden, daß irgend etwas schiefging.
Als sie alles besprochen hatten, stand die Sonne schon hoch. Bevor der Commissario das kleine Haus verließ und mit der Theatervorstellung begann, sah er Tano fest in die Augen.
»Sagen Sie mir die Wahrheit.«
»Zu Befehl, Dutturi Montalbano.«
»Warum haben Sie sich ausgerechnet mich ausgesucht?«
»Weil Sie jemand sind, der begreift, worum es geht, wie Sie gerade bewiesen haben.«
Als Montalbano Hals über Kopf den Pfad zwischen den Weinreben hinunterrannte, fiel ihm ein, daß ausgerechnet Agatino Catarella im Kommissariat Wache hatte und das Telefongespräch, das er jetzt gleich führen wollte, in jedem Fall schwierig, wenn nicht sogar ein Quell verhängnisvoller und gefährlicher Mißverständnisse sein würde. Dieser Catarella war zu gar nichts zu gebrauchen. Er war schwer von Begriff und träge und bestimmt nur deswegen bei der Polizei angenommen worden, weil er ein entfernter Verwandter des ehemals allmächtigen Abgeordneten Cusumano war; dieser hatte nach einem im Ucciardone-Gefängnis verbrachten Sommer auch mit den neuen Machthabern wieder Kontakte geknüpft und sich auf diese Weise ein dickes Stück von jenem Kuchen gesichert, der sich wie von Zauberhand immer wieder erneuerte, man mußte nur ein paar kandierte Früchte austauschen oder frische Kerzen an die Stelle der heruntergebrannten stecken. Mit Catarella wurde alles noch komplizierter, wenn er, was oft vorkam, plötzlich auf die Idee kam, das zu sprechen, was er Italienisch nannte.
Eines Tages war er bei Montalbano aufgetaucht und fragte mit besorgter Miene:
»Dottori, kennen Sie vielleicht zufällig einen Arzt, so einen Spezialisten?«
»Spezialist für was, Catarè?«
»Für Geschlechtskrankheiten.«
Montalbano war vor Staunen der Mund offen stehengeblieben.
»Du?! Eine Geschlechtskrankheit? Wo hast du dir denn die eingefangen?«
»Ich weiß noch, daß ich krank geworden bin, als ich noch klein war, höchstens sechs oder sieben.«
»Was redest du da für einen Mist, Catarè? Bist du sicher, daß es eine Geschlechtskrankheit ist?«
»Klar, Dottori. Erst geht’s mir gut, und dann geht’s mir plötzlich schlecht. Eine Geschlechtskrankheit.«
Als Montalbano im Auto zu einer Telefonzelle unterwegs war, die vor der Abzweigung nach Torresanta stehen mußte (sie mußte da stehen, falls nicht der Hörer abgeschnitten und mitgenommen, der ganze Apparat geklaut, die Telefonzelle komplett verschwunden war), beschloß er, nicht einmal seinen Vice Mimì Augello anzurufen, denn dieser – da war nichts zu wollen – war fähig, erst den Journalisten Bescheid zu sagen und dann so zu tun, als wundere er sich über ihre Anwesenheit. So blieben nur Fazio und Tortorella, die beiden Brigadieri oder wie, zum Teufel, sie sich jetzt nannten. Er entschied sich für Fazio, Tortorella hatte vor einiger Zeit einen Bauchschuß abgekriegt; er war noch nicht wieder ganz auf dem Damm und hatte manchmal Schmerzen in der Wunde.
Wie durch ein Wunder war die Telefonzelle noch da, wie durch ein Wunder funktionierte auch das Telefon, und Fazio meldete sich schon beim zweiten Klingelton.
»Fazio, bist du etwa schon wach um diese Zeit?«
»Sissi. Vor einer halben Minute hat Catarella angerufen.«
»Was wollte er?«
»Ich hab’ nicht viel verstanden, er hat italienisch geredet. Aber es sieht so aus, als hätten sie letzte Nacht den Supermarkt von Carmelo Ingrassia ausgeräumt, den großen außerhalb der Stadt. Und zwar mindestens mit einem T.I.R. oder einem ähnlich großen Laster.«
»War der Nachtwächter denn nicht da?«
»Er war da, ist aber nirgends zu finden.«
»Wolltest du hinfahren?«
»Sissi.«
»Überlaß es den anderen. Ruf gleich Tortorella an, sag ihm, er soll Augello Bescheid sagen. Die beiden sollen hinfahren. Sag, du kannst nicht kommen, erzähl ihnen irgendeinen Schwachsinn, daß du aus dem Bett gefallen und dir den Kopf angehauen hast oder so was. Halt, nein: Sag, daß die Carabinieri dich verhaftet haben. Oder noch besser, ruf ihn an und sag, er soll die Arma informieren, es ist ja nichts Großartiges, nur ein blöder Diebstahl, und die Arma freut sich, wenn wir sie bitten, mit uns zusammenzuarbeiten. Jetzt hör zu: Wenn du Tortorella, Augello und der Arma Bescheid gegeben hast, ruf Gallo und Galluzzo an – meine Güte, das ist ja zum Gallensteinekriegen – und Germanà auch, und dann kommt ihr zu der Stelle, die ich dir gleich beschreibe. Bewaffnet euch mit Maschinenpistolen.«
»Ach du Scheiße!«
»Scheiße, genau. Es geht um eine große Sache, wir müssen vorsichtig sein, und daß mir keiner auch nur ein Sterbenswörtchen darüber verliert, vor allem nichts zu Galluzzo mit seinem Schwager, dem Journalisten. Und sag dem Hohlkopf Gallo, er soll gefälligst nicht fahren wie in Indianapolis. Keine Sirene, kein Blaulicht. Wenn es Wirbel gibt und der Teich Wellen schlägt, schwimmt der Fisch davon. Jetzt erklär’ ich dir, wo du hin mußt, hör gut zu.«
Seit dem Telefongespräch war nicht mal eine halbe Stunde vergangen, als sie leise vorfuhren; man konnte sie für eine normale Streife halten. Sie stiegen aus dem Wagen und gingen auf Montalbano zu, der ihnen ein Zeichen gab, ihm zu folgen. Hinter einem halbverfallenen Haus, wo man sie von der Provinciale aus nicht sehen konnte, blieben sie stehen.
»Ich hab’ eine MP für Sie im Auto«, sagte Fazio.
»Steck sie dir sonstwohin. Hört gut zu: Wenn wir uns schlau anstellen, könnte es sein, daß wir Tano u Grecu hoppnehmen.«
Montalbano konnte förmlich spüren, wie seine Leute für einen Augenblick den Atem anhielten.
»Tano u Grecu ist hier?« fragte Fazio, der sich als erster wieder gefaßt hatte, erstaunt.
»Ich hab’ ihn gesehen, er ist es höchstpersönlich, er hat sich zwar einen Bart wachsen lassen, aber man erkennt ihn trotzdem.«
»Und wie kommt es, daß Sie ihn getroffen haben?«
»Fazio, nerv nicht, ich erklär’s dir später. Tano ist in einem kleinen Haus oben auf diesem Hügel, von hier sieht man’s nicht. Es ist von Olivenbäumen umgeben. Das Haus hat zwei Zimmer, eins oben und eins unten. Vorn gibt es eine Tür und ein Fenster, ein zweites Fenster ist im oberen Zimmer, aber es geht nach hinten raus. Ist das klar? Habt ihr alles verstanden? Tano kann nur vorn raus oder höchstens noch aus dem oberen Fenster springen, aber dann rammt er sich wahrscheinlich die Beine in den Bauch. Wir tun folgendes: Fazio und Gallo gehen nach hinten, ich, Germanà und Galluzzo brechen vorn die Tür auf und gehen rein.«
Fazio sah ihn zweifelnd an.
»Was ist los? Bist du etwa nicht einverstanden?«
»Sollten wir nicht lieber das Haus umstellen und ihm sagen, daß er sich ergeben soll? Wir sind fünf gegen einen, der hat doch keine Chance.«
»Bist du denn sicher, daß Tano allein im Haus ist?«
Fazio schwieg.
»Hört auf mich«, sagte Montalbano und schloß damit den kurzen Kriegsrat, »er soll ruhig ein dickes Überraschungsei finden.«
Drei
Nach Montalbanos Einschätzung durften Fazio und Gallo vor mindestens fünf Minuten hinter dem Haus Stellung bezogen haben; er selbst lag auf dem Bauch im Gras, hatte die Pistole in der Hand – ein Stein drückte ihm unangenehm genau auf den Magen – und kam sich furchtbar lächerlich vor, wie ein Typ aus einem Gangsterfilm. Daher konnte er es gar nicht erwarten, das Zeichen zum Öffnen des Kinovorhangs zu geben. Er sah Galluzzo an, der neben ihm lag – Germanà war weiter weg, rechts von ihnen –, und flüsterte:
»Bist du bereit?«
»Ja«, antwortete der Beamte, der ein einziges Nervenbündel war und sichtlich schwitzte. Montalbano hatte durchaus Mitleid, aber er konnte ihm ja schlecht erzählen, daß es sich hier um eine Inszenierung handelte, mit ungewissem Ausgang zwar, aber trotzdem um reines Theater.
»Los!« befahl er ihm.
Wie von einer restlos zusammengedrückten Feder weggeschleudert, fast ohne den Boden zu berühren, erreichte Galluzzo mit drei Sprüngen das Haus und drückte sich links von der Tür an die Mauer. Der erstaunliche Bewegungsablauf wirkte recht mühlos, aber der Commissario sah, wie sich nun die Brust seines Kollegen unter schweren Atemzügen hob und senkte. Galluzzo legte die Maschinenpistole an und gab dem Commissario mit einem Zeichen zu verstehen, daß er für Teil zwei bereit sei. Montalbano warf einen Blick zu Germanà hinüber, der guter Dinge und ganz entspannt zu sein schien.
»Ich geh’ jetzt los«, formte der Commissario lautlos mit den Lippen.
»Ich decke Sie«, antwortete Germanà auf die gleiche Weise und wies mit dem Kopf auf die Maschinenpistole, die er in den Händen hielt.
Der erste Satz des Commissario nach vorn war mindestens wie aus dem Handbuch, wenn nicht sogar aus einem Lehrwerk: ein entschiedenes und ausbalanciertes Abheben vom Boden – eines Hochsprungsportlers würdig –, ein luftigleichtes Schweben, eine saubere und gekonnt vollendete Landung, die einen Tänzer entzückt hätte. Galluzzo und Germanà, die ihn von verschiedenen Stellen aus beobachteten, beglückwünschten sich beide zu ihrem sportlichen Chef. Der zweite Satz begann gemessener als der erste, doch als Montalbano aufrecht in der Luft stand, klappte irgendwas nicht, und er neigte sich plötzlich wie der schiefe Turm von Pisa zur Seite, so daß die Landung eine echte Lachnummer wurde. Erst schwankte er und breitete auf der Suche nach einem nicht vorhandenen Halt die Arme aus, dann plumpste er auf die Seite. Galluzzo wollte ihm instinktiv zu Hilfe kommen, beherrschte sich aber gerade noch und drückte sich wieder gegen die Mauer. Auch Germanà schnellte hoch, legte sich aber sofort wieder hin. Gott sei Dank war die ganze Sache nur inszeniert, dachte der Commissario, sonst hätte Tano sie in diesem Augenblick wie Kegel umschießen können. Montalbano stieß die herzhaftesten Flüche seines umfassenden Repertoires aus und suchte, auf allen vieren krabbelnd, seine Pistole, die ihm bei dem Sturz aus der Hand gefallen war.
Endlich sah er sie unter einem Strauch Eselsgurken, aber als er mit seinem Arm hineinlangte, um sie an sich zu nehmen, platzten die Früchte auf, und die kleinen Kerne spritzten ihm ins Gesicht. Frustriert und verärgert gestand sich der Commissario ein, daß er vom Gangsterhelden zu einem billigen Slapstickdarsteller abgestiegen war. Er hatte keine Lust mehr, noch weiter den Athleten oder Tänzer zu spielen, also legte er die wenigen Meter, die ihn vom Haus trennten, mit schnellen Schritten in nur leicht gebückter Haltung zurück.
Montalbano und Galluzzo blickten sich an und verständigten sich wortlos. Sie stellten sich drei Schritte vor der Haustür auf, die nicht sehr stabil aussah, holten tief Luft und warfen sich mit ihrem ganzen Körpergewicht dagegen. Die Tür, kaum dicker als Papier, hätte wahrscheinlich schon bei einem Schlag mit der Hand nachgegeben, und so flogen die beiden mit Schwung ins Hausinnere. Der Commissario schaffte es erstaunlicherweise zu bremsen, doch Galluzzo hatte einen solchen Schwung, daß er durch das ganze Zimmer sauste und mit dem Gesicht gegen die Wand knallte, wobei er sich die Nase aufschlug und halb im Blut erstickte, das in Strömen lief. Im schwachen Licht der Petroleumlampe, die Tano angelassen hatte, hatte der Commissario Gelegenheit, die schauspielerischen Fähigkeiten des Grecu zu bewundern, der tat, als sei er im Schlaf überrascht worden, fluchend aufsprang und in Richtung seiner Kalaschnikow stürzte, die jetzt am Tisch, also nicht mehr neben dem Feldbett lehnte. Montalbano war bereit, seine Chargenrolle zu spielen, wie es im Theater heißt.
»Stehenbleiben! Im Namen des Gesetzes, stehenbleiben, oder ich schieße!« schrie er, so laut er konnte, und schoß viermal an die Decke. Tano blieb reglos stehen und hob die Arme. Galluzzo, der fürchtete, daß sich im oberen Zimmer jemand versteckte, gab eine Salve auf die Holztreppe ab. Als Fazio und Gallo draußen die Schüsse hörten, feuerten sie zur Abschreckung in Richtung Fenster. Im Haus waren alle schon ganz betäubt von dem Krach, als Germanà angerannt kam und noch eins draufsetzte:
»Stehenbleiben, oder ich schieße!«
Er hatte seine Drohung noch nicht ganz ausgesprochen, da schoben Fazio und Gallo ihn auch schon mit festem Griff zwischen Montalbano und Galluzzo, der seine Maschinenpistole abgelegt und ein Taschentuch aus der Hosentasche gezogen hatte, mit dem er versuchte, sich die Nase zuzudrücken; sein Hemd, seine Krawatte, seine Jacke – alles war voller Blut. Gallo erschrak, als er ihn so sah.
»Hat er auf dich geschossen? Hat er auf dich geschossen, dieser Scheißkerl?« zischte er wütend und wandte sich Tano zu, der immer noch mit Engelsgeduld und erhobenen Händen darauf wartete, daß die Ordnungshüter Ordnung in das Chaos brachten, das sie angerichtet hatten.
»Nein, er hat nicht auf mich geschossen. Ich bin gegen die Wand geknallt«, brachte Galluzzo kläglich hervor. Tano sah niemanden an, sondern blickte konzentriert auf seine Schuhspitzen.
Jetzt muß er gleich lachen, dachte Montalbano und befahl Galluzzo barsch: »Leg ihm Handschellen an.«
»Ist er es?« fragte Fazio leise.
»Natürlich ist er es, erkennst du ihn nicht?« erwiderte Montalbano.
»Was machen wir jetzt?«
»Setzt ihn ins Auto, und bringt ihn nach Montelusa in die Questura. Unterwegs rufst du den Questore an, erklärst ihm alles und läßt dir sagen, was zu tun ist. Schaut, daß ihn niemand sieht und ihn erkennt. Vorerst muß die Verhaftung absolut geheim bleiben. Los jetzt.«
»Und Sie?«
»Ich schau’ mir mal das Haus an, ich durchsuche es, man kann nie wissen.«
Fazio und seine Kollegen nahmen den gefesselten Tano in die Mitte und gingen Richtung Tür, Germanà trug die Kalaschnikow des Gefangenen. Erst da hob Tano den Kopf und warf Montalbano einen Blick zu. Der Commissario stellte fest, daß seine Augen nicht mehr statuenhaft waren, sie waren beseelt, fast belustigt.
Als die fünf am Ende des Weges aus seinem Blickfeld verschwunden waren, kehrte Montalbano ins Haus zurück, um mit der Durchsuchung zu beginnen. Er öffnete die Kredenz, nahm die Weinflasche heraus, die noch halbvoll war, und ließ sich mit ihr im Schatten eines Olivenbaumes nieder, um sie sich in aller Ruhe zu Gemüte zu führen. Die Verhaftung des gefährlichen gesuchten Mörders war glücklich zu Ende gebracht.
Mimì Augello schien der Teufel in den Leib gefahren zu sein – kaum hatte Montalbano das Büro betreten, stürzte er sich auf ihn.
»Wo, um Himmels willen, warst du? Wo hast du dich versteckt? Was ist mit den anderen? Findest du das etwa in Ordnung, du Arschloch?«
Wenn er derart ausrastete, dann war er wirklich in Rage: In den drei Jahren, die sie jetzt zusammenarbeiteten, hatte der Commissario von seinem Vice noch nie ein derbes Wort gehört. Nein, das stimmte nicht ganz: Als so ein Idiot Tortorella in den Bauch geschossen hatte, hatte er genauso reagiert.
»Mimì, was ist denn mit dir los?«
»Was mit mir los ist? Ich hatte Angst!«
»Angst? Weswegen denn?«
»Hier haben mindestens sechs Leute angerufen. Alle haben unterschiedliche Details erzählt, aber in der Hauptsache waren sie einig: eine Schießerei mit Toten und Verletzten. Einer hat sogar von einem Blutbad geredet. Du warst nicht zu Haus, Fazio und die anderen waren mit dem Auto weg, ohne auch nur einen Ton zu sagen … Ich hab’ einfach zwei und zwei zusammengezählt. War das etwa verkehrt?«
»Nein, nein. Aber du brauchst nicht auf mich sauer zu sein, höchstens auf das Telefon, das ist schuld dran.«
»Was hat denn das Telefon damit zu tun?«