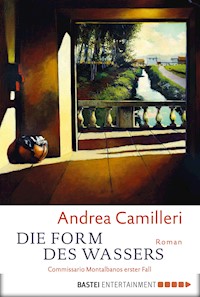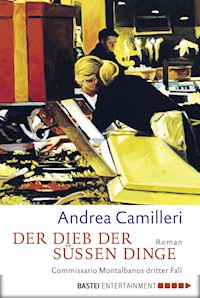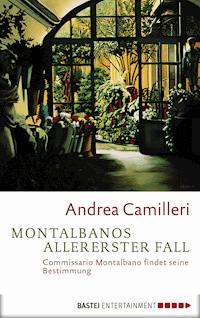9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Schöne Frauen machen das Leben eines Sizilianers erst interessant. Das kann Commissario Montalbano nur bestätigen, denn es sind gleich drei junge Damen, die ihm den Schlaf rauben: Michela, die in ihrer Villa ermordet aufgefunden wird, ihre Freundin Anna, die Montalbano bei seinen Ermittlungen zur Seite steht und die sein Herz höher schlagen lässt, als es ihm gut tut, und natürlich Livia, die Dritte im Bunde, die Frau, die er liebt, die jedoch etwas von ihm einfordert, was er ihr in einem schwachen Moment versprochen hat, die Ehe ... Da fällt es Montalbano nicht nur schwer, einen klaren Kopf zu behalten - es ist auch noch ausgerechnet eine Violine, die den höchst unmusikalischen Commisssario auf die richtige Spur bringen soll...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Anmerkung des Autors
Anmerkungen der Übersetzerin
Im Text erwähnte kulinarische Köstlichkeiten
Über den Autor
Andrea Camilleri, 1925 in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle geboren, ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und lehrt seit über zwanzig Jahren an der Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. Mit seinem vielfach ausgezeichneten literarischen Werk löste er in Italien eine Begeisterung aus, die DIE WELT treffend als »Camillerimania« bezeichnete. Vor allem die Kriminalromane um Commissario Salvo Montalbano haben Andrea Camilleri mittlerweile auch in Deutschland eine große Fangemeinde beschert.
Andrea Camilleri
Die Stimme der Violine
Commissario Montalbano löst seinen vierten Fall
Aus dem Italienischen vonChristiane von Bechtolsheim
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der italienischen Originalausgabe:
LA VOCE DEL VIOLINO,
erschienen bei Sellerio Editore, Via Siracusa 50, Palermo
© 1997 by Sellerio Editore
© für die deutschsprachige Ausgabe 2000 by:
Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Copyright Cover © corbis/A. Belov
Umschlaggestaltung: Marina Boda
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0326-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
Mit diesem Tag war überhaupt nichts anzufangen, das wusste der Commissario sofort, als er die Fensterläden des Schlafzimmers öffnete. Es war dunkel, bis zum Morgengrauen dauerte es mindestens noch eine Stunde, doch war die Dunkelheit nicht mehr ganz so undurchdringlich, immerhin war schon, voller dicker Regenwolken, der Himmel zu erkennen und jenseits des hellen Sandstrands das Meer, das aussah wie ein Pekinese. Seit ihn einmal ein winziges, mit Schleifchen verziertes Exemplar dieser Hunderasse nach einem wütenden, als Bellen ausgegebenen geifernden Krächzen schmerzhaft in die Wade gebissen hatte, nannte Montalbano das Meer so, wenn es von kurzen, kalten Windstößen aufgewühlt wurde und auf den unzähligen kleinen Wellen lächerliche Schaumbüschel saßen. Und da er an diesem Vormittag etwas Unangenehmes zu tun hatte, wurde seine Laune noch schlechter. Er musste nämlich auf eine Beerdigung.
Am Abend zuvor hatte er im Kühlschrank von seiner Haushälterin gekaufte frische Sardinen vorgefunden, sie als Salat mit viel Zitronensaft, Olivenöl und frisch gemahlenem Pfeffer zubereitet und mit großem Appetit verdrückt. Er hatte es sich so richtig schmecken lassen, aber dann hatte ein Telefonanruf ihm alles verdorben.
»Pronti, Dottori? Dottori, sind Sie’s wirklich selber?«
»Ich bin’s wirklich selber, Catarè. Was gibt’s denn?«
Im Kommissariat hatten sie Catarella, in der irrigen Annahme, er werde dort weniger Schaden anrichten als anderswo, in die Telefonvermittlung verbannt. Nach einigen saftigen Wutanfällen hatte Montalbano begriffen, dass die einzige Chance, mit Catarella ein Gespräch zu führen, ohne an den Rand des Deliriums zu geraten, darin bestand, sich derselben Redeweise zu bedienen.
»Domando pirdonanza e compressione, dottori.«
Oje. Er bat um Verzeihung und Verständnis. Montalbano spitzte die Ohren – wenn Catarellas so genanntes Italienisch förmlich und gespreizt daherkam, konnte es sich nur um ein größeres Problem handeln.
»Sag nur, was los ist, Catarè.«
»Vor drei Tagen, da wollte jemand Sie ganz persönlich sprechen, Dottori, aber Sie waren gar nicht da, und ich hab vergessen, es Ihnen auszurichten.«
»Woher kam der Anruf?«
»Aus Florida, Dottori.«
Montalbano erstarrte vor Schreck. Augenblicklich sah er sich selbst im Jogginganzug auf Trimmpfaden trainieren, zusammen mit athletisch gebauten, strammen amerikanischen Beamten von der Drogenbekämpfung, mit denen er in einem komplizierten Fall von Rauschgifthandel ermittelte.
»Sag mal, Catarè, wie habt ihr denn miteinander geredet?«
»Wie wir geredet haben? In taliàno, Dottori, italienisch.« »Hat der Anrufer dir gesagt, was er wollte?«
»Klar, alles hat er mir gesagt. Er hat gesagt, dass die Frau vom Vicequestore Tamburrano gestorben ist.«
Montalbano konnte einen Seufzer der Erleichterung nicht zurückhalten. Der Anruf war nicht aus Florida, sondern aus dem Kommissariat von Florìdia bei Syrakus gekommen. Caterina Tamburrano war schon seit langem schwer krank gewesen, und die Nachricht kam nicht überraschend.
»Dottori, sind Sie immer noch dran, Sie selber?«
»Ich bin immer noch dran, Catarè, ich bin kein anderer geworden.«
»Der Anrufer hat noch gesagt, dass die Beerdigung Donnerstagmorgen um neun ist.«
»Donnerstag? Morgen früh also?«
»Sissi, Dottori.«
Montalbano war mit Michele Tamburrano zu eng befreundet, als dass er der Beerdigung hätte fernbleiben können; so konnte er auch wieder gutmachen, dass er nicht mal bei ihm angerufen hatte. Von Vigàta nach Florìdia brauchte man mit dem Auto mindestens dreieinhalb Stunden.
»Hör zu, Catarè, mein Auto ist in der Werkstatt. Ich brauch morgen früh pünktlich um fünf einen Streifenwagen hier bei mir in Marinella. Sag Dottor Augello Bescheid, dass ich nicht ins Büro komm und erst am frühen Nachmittag zurück bin. Hast du alles richtig verstanden?«
Als er aus der Dusche kam, war seine Haut rot wie eine Languste: Um das Frösteln wettzumachen, das er beim Anblick des Meeres gespürt hatte, hatte er zu lange zu heiß geduscht. Er fing gerade an, sich zu rasieren, als er den Streifenwagen kommen hörte. Dessen Ankunft war im Umkreis von zehn Kilometern auch kaum zu überhören. Mit Überschallgeschwindigkeit schoss er daher, bremste kreischend, wobei er Salven von Kies abfeuerte, der in alle Richtungen spritzte, dann hörte man das verzweifelte Geheul eines überdrehten Motors, gequältes Gangschalten, schrilles Reifengequietsche und noch mal spritzenden Kies. Der Fahrer hatte den Wagen gewendet und startbereit hingestellt.
Als Montalbano reisefertig das Haus verließ, stand Gallo da, der Fahrer des Kommissariats, und juchzte.
»Taliasse ccà, Dottore! Schauen Sie sich diese Reifenspuren an! Fabelhaft gewendet! Ich hab den Wagen um sich selbst gedreht!«
»Toll«, sagte Montalbano finster.
»Soll ich das Martinshorn anmachen?«, fragte Gallo, als sie losfuhren.
»Steck’s dir sonstwohin«, gab Montalbano giftig zurück und schloss die Augen. Er hatte keine Lust zu reden.
Als Gallo, der am Indianapolis-Syndrom litt, sah, dass sein Chef die Augen zugemacht hatte, drückte er aufs Gas, um auf einen Kilometerschnitt gemäß den Fahrerqualitäten, die er zu haben glaubte, zu kommen. Sie waren noch keine Viertelstunde unterwegs, da krachte es schon. Als die Bremsen quietschten, öffnete Montalbano die Augen, sah aber überhaupt nichts; sein Kopf wurde erst heftig nach vorn geschleudert und dann durch den Sicherheitsgurt wieder nach hinten gedrückt. Es folgte das verheerende Geräusch, wenn Blech gegen Blech knallt, und dann Stille, eine Stille wie im Märchen, mit Vogelgezwitscher und Hundegebell.
»Hast du dir weh getan?«, fragte der Commissario, als er sah, dass Gallo sich die Brust massierte.
»Nein. Und Sie?«
»Ich auch nicht. Wie ist denn das passiert?«
»Una gaddrina, ein Huhn ist mir reingelaufen.«
»Ich hab noch nie erlebt, dass ein Huhn die Straße überquert, wenn ein Auto kommt. Sehen wir mal nach, was kaputt ist.«
Sie stiegen aus. Keine Menschenseele fuhr vorbei. Der lange Bremsweg hatte Spuren auf dem Asphalt hinterlassen: Da, wo sie anfingen, war ein dunkler Klumpen zu sehen. Gallo ging hin und wandte sich dann triumphierend dem Commissario zu.
»Was hab ich gesagt? Ein Huhn war’s.«
Eindeutig Selbstmord. Das Auto, das sie gerammt hatten und dessen Heck völlig zertrümmert war, war wohl ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt gewesen, aber nach dem Aufprall stand es etwas schräg. Es war ein flaschengrüner Renault Twingo, der anscheinend die Zufahrt zu einem Weg versperren sollte; dieser Weg führte nach etwa dreißig Metern zu einer kleinen zweistöckigen Villa, deren Tür und Fenster verriegelt waren. An dem Streifenwagen waren nur ein Scheinwerfer zersplittert und der rechte Kotflügel verbeult.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Gallo zerknirscht.
»Wir fahren weiter. Glaubst du, unser Auto geht noch?«
»Ich probier’s mal.«
Knirschend löste sich der Wagen im Rückwärtsgang aus dem anderen Auto, in das er sich verkeilt hatte. Auch jetzt zeigte sich niemand an einem der Fenster der Villa. Die Leute hatten offenbar einen guten Schlaf, denn der Twingo gehörte sicher jemandem, der hier wohnte, es gab keine anderen Häuser in der Umgebung. Während Gallo mit beiden Händen versuchte, den Kotflügel anzuheben, der am Reifen schleifte, schrieb Montalbano die Telefonnummer des Kommissariats auf einen Zettel und steckte ihn hinter den Scheibenwischer.
Wenn ein Tag schon so anfängt … Eine halbe Stunde nachdem sie weitergefahren waren, massierte Gallo sich erneut die Brust und verzog hin und wieder vor Schmerz das Gesicht.
»Lass mich fahren«, sagte der Commissario, und Gallo hatte nichts dagegen.
Als sie auf der Höhe von Fela waren, fuhr Montalbano nicht die Superstrada weiter, sondern bog in eine Abzweigung ein, die in die Stadtmitte führte. Gallo merkte es nicht, er hatte seine Augen geschlossen und den Kopf ans Seitenfenster gelehnt.
»Wo sind wir?«, fragte er und machte sofort die Augen auf, als er merkte, dass der Wagen hielt.
»In Fela, ich bring dich ins Krankenhaus. Steig aus.«
»Aber es ist nichts, Commissario.«
»Steig aus. Sie sollen dich wenigstens kurz anschauen.«
»Dann bleib ich hier, und Sie fahren weiter. Auf der Rückfahrt holen Sie mich wieder ab.«
»Red keinen Stuss. Komm.«
Der kurze Blick, den man auf Gallo warf, dauerte mit Abhören, dreimaligem Blutdruckmessen, Röntgen und so weiter über zwei Stunden. Am Ende lautete die Diagnose, dass Gallo sich nichts gebrochen hatte, die Schmerzen rührten daher, dass er bös ans Lenkrad geknallt war, und der Schwächezustand war auf den Schreck zurückzuführen, den er bekommen hatte.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Gallo noch zerknirschter.
»Was wohl, wir fahren weiter. Aber ich setz mich ans Steuer.«
Er war schon zwei- oder dreimal in Florìdia gewesen und wusste auch noch, wo Tamburrano wohnte. Also fuhr er in Richtung Chiesa della Madonna delle Grazie, der Kirche, die praktisch an das Haus seines Kollegen angrenzte. Als er auf die Piazza kam, sah er die schwarzbehängte Kirche und Leute, die hineinhasteten. Der Gottesdienst hatte wohl mit Verspätung angefangen, nicht nur Montalbano kam eben manchmal etwas dazwischen.
»Ich fahr in die Werkstatt des Kommissariats und lass den Wagen anschauen«, sagte Gallo. »Nachher hol ich Sie wieder ab.«
Montalbano betrat die überfüllte Kirche, der Gottesdienst hatte gerade begonnen. Er sah sich um, kannte aber niemanden. Tamburrano saß bestimmt in der ersten Reihe, in der Nähe des Sarges vor dem Hochaltar. Der Commissario beschloss zu bleiben, wo er war, neben dem Portal: Er würde Tamburrano die Hand schütteln, wenn der Sarg aus der Kirche getragen wurde. Bei den ersten Worten des Pfarrers, eine ganze Zeit lang nach Beginn der Messe, schrak er zusammen. Er hatte richtig gehört, da war er ganz sicher. Der Pfarrer hatte gerade angefangen zu sagen:
»Unser geliebter Nicola hat dieses irdische Jammertal verlassen …«
Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und tippte einer alten Frau auf die Schulter.
»Entschuldigen Sie, Signora, für wen ist diese Trauerfeier?«
»Für den armen Ragioniere Pecorato. Pirchì? Warum?«
»Ich dachte, sie sei für Signora Tamburrano.«
»Ah. Die war in der Chiesa di Sant’Anna.«
Zu Fuß – er rannte fast – brauchte er zur Chiesa di Sant’ Anna eine Viertelstunde. Außer Atem und schwitzend traf er den Pfarrer in der ansonsten menschenleeren Kirche an. »Verzeihen Sie, die Trauerfeier für Signora Tamburrano?« »Die ist schon seit bald zwei Stunden vorbei«, sagte der Pfarrer und musterte ihn streng.
»Wissen Sie, ob sie hier beerdigt wird?«, fragte Montalbano und wich dem Blick des Pfarrers aus.
»Aber nein! Sie haben sie nach der Trauerfeier nach Vibo Valentia mitgenommen. Sie wird dort im Familiengrab bestattet. Ihr Mann, der Witwer, wollte mit seinem Auto hinterherfahren.«
Es war also alles umsonst gewesen. An der Piazza della Madonna delle Grazie hatte er ein Café mit Tischen im Freien gesehen. Als Gallo mit dem notdürftig reparierten Wagen ankam, war es fast zwei Uhr. Montalbano erzählte ihm, was passiert war.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Gallo, mittlerweile vollends zerknirscht, zum dritten Mal an diesem Vormittag.
»Iss eine brioscia mit einer granita, die machen sie hier gut, und dann fahren wir zurück. Wenn il Signore uns beisteht und la Madonna uns begleitet, sind wir abends um sechs in Vigàta.«
Die Bitte wurde erhört, sie brausten dahin, dass es ein Vergnügen war.
»Das Auto steht immer noch da«, sagte Gallo, als Vigàta schon in Sicht war.
Der Twingo stand genau so da, wie sie ihn am Morgen verlassen hatten, etwas schräg an der Einmündung zu der Auffahrt.
»Die haben bestimmt schon im Kommissariat angerufen«, sagte Montalbano.
Aber er machte sich selbst was vor: Der Anblick des Autos und der kleinen Villa mit den verriegelten Fenstern bereitete ihm Unbehagen.
»Fahr zurück!«, befahl er Gallo plötzlich.
Gallo machte eine verwegene Kehrtwendung, die ein Hupkonzert auslöste, in Höhe des Twingos machte er wieder eine, die noch verwegener war, und bremste hinter dem beschädigten Auto.
Montalbano stieg schnell aus. Er hatte im Rückspiegel schon richtig gesehen, als sie vorbeigefahren waren: Der Zettel mit der Telefonnummer steckte noch am Scheibenwischer, niemand hatte ihn angerührt.
»Da stimmt was nicht«, sagte der Commissario zu Gallo, der ihm gefolgt war. Er ging den Weg entlang. Die Villa musste erst kürzlich gebaut worden sein, das Gras vor der Haustür war noch vom Kalk verbrannt. Auch neue Dachziegel waren in einem Winkel vor dem Haus gestapelt. Der Commissario sah aufmerksam die Fenster an, kein Licht drang nach außen.
Er ging an die Tür und klingelte. Er wartete ein bisschen und klingelte dann noch mal.
»Weißt du, wem das Haus gehört?«, fragte er Gallo.
»Nonsi, Dottore.«
Was sollte er tun? Es wurde Abend, er war mittlerweile ziemlich müde, dieser anstrengende und nutzlose Tag saß ihm in den Knochen.
»Komm, wir fahren«, sagte er und fügte, weil er sich das vergeblich einzureden suchte, hinzu: »Die haben bestimmt schon angerufen.«
Gallo sah ihn zweifelnd an, sagte aber nichts.
Der Commissario ließ Gallo gar nicht erst ins Büro, sondern schickte ihn sofort nach Hause, damit er sich ausruhen konnte. Sein Vice, Mimì Augello, war nicht da, er war zur Berichterstattung beim neuen Questore von Montelusa, Luca Bonetti-Alderighi, einem eifrigen jungen Mann aus Bergamo, der es innerhalb eines Monats geschafft hatte, sich überall hochgradig unbeliebt zu machen.
»Der Questore«, berichtete ihm Fazio, der Beamte, mit dem Montalbano am ehesten freundschaftlich verbunden war, »war schon ganz nervös, weil er Sie in Vigàta nicht erreicht hat. Deswegen musste Dottor Augello hin.«
»Er musste hin?«, gab der Commissario zurück. »Der hat bestimmt die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, um sich in Szene zu setzen!«
Er erzählte Fazio von dem Unfall am Morgen und fragte ihn, ob er wisse, wem das Haus gehöre. Fazio wusste es nicht, versprach seinem Chef aber, am nächsten Morgen ins Rathaus zu gehen und sich zu erkundigen.
»Ach ja, Ihr Wagen ist in unserer Werkstatt.«
Bevor er heimfuhr, befragte der Commissario noch Catarella.
»Hör zu, und denk gut nach. Hat zufällig jemand wegen einem Auto angerufen, das wir angefahren haben?«
Kein Anruf.
»Ich verstehe nicht recht«, sagte Livia mit gereizter Stimme am Telefon in Boccadasse, Genua.
»Was gibt es da zu verstehen, Livia? Ich hab’s dir doch gesagt, jetzt sag ich’s noch mal. Die Unterlagen für François’ Adoption sind noch nicht fertig, es sind unvorhergesehene Probleme aufgetreten, und ich habe den alten Questore nicht mehr hinter mir, der jederzeit bereit war, alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Wir müssen uns eben gedulden.«
»Ich rede nicht von der Adoption«, sagte Livia frostig.
»Ach nein? Wovon denn dann?«
»Von unserer Hochzeit rede ich. Während die Probleme mit der Adoption gelöst werden, können wir heiraten. Es hängt ja nicht das eine vom anderen ab.«
»Natürlich nicht«, sagte Montalbano, der sich gehetzt und in die Enge getrieben fühlte.
»Ich will eine klare Antwort auf die Frage, die ich dir jetzt stelle«, fuhr Livia unerbittlich fort. »Angenommen, die Adoption ist nicht möglich. Was tun wir deiner Meinung nach dann, heiraten wir trotzdem oder nicht?«
Ein plötzlicher ohrenbetäubender Donnerschlag rettete ihn. »Was war das?«, fragte Livia.
»Es donnert. Da ist ein irrsinniges Gewitt…«
Er legte auf und zog den Stecker aus der Wand.
Montalbano konnte nicht einschlafen. Er wälzte sich im Bett hin und her und wickelte sich in die Laken ein. Gegen zwei Uhr morgens begriff er, dass seine Einschlafversuche für die Katz waren. Er stand wieder auf, zog sich an, nahm einen Lederbeutel, den ihm vor langer Zeit ein Einbrecher geschenkt hatte, der dann sein Freund geworden war, setzte sich ins Auto und fuhr los. Das Gewitter war noch heftiger als vorher, Blitze erleuchteten alles taghell. Als er bei dem Twingo ankam, versteckte er sein Auto hinter den Büschen und schaltete die Scheinwerfer aus. Aus dem Handschuhfach nahm er seine Pistole, ein Paar Handschuhe und eine Taschenlampe. Er wartete, bis der Regen etwas nachließ, dann sprang er mit langen Schritten über die Straße, rannte den Weg hinauf und drückte sich gegen die Tür. Er klingelte lange, niemand antwortete. Er zog die Handschuhe an und nahm einen dicken Schlüsselring aus dem Lederbeutel, an dem ein Dutzend unterschiedlich geformter Dietriche hingen. Beim dritten Versuch ging die Tür auf, sie war nur zugeschnappt und nicht abgeschlossen gewesen. Er ging hinein und schloss die Tür hinter sich. Im Dunkeln bückte er sich, schlüpfte aus seinen durchnässten Schuhen und stand in Strümpfen da. Er schaltete die Taschenlampe ein und hielt sie auf den Boden gerichtet. Er befand sich in einem geräumigen Esszimmer mit anschließendem Salon. Die Möbel rochen nach Lack, alles war neu, sauber und ordentlich. Eine Tür führte in eine Küche, die so blitzblank war, dass sie einer Reklame entnommen schien; eine andere Tür ging in ein derart auf Hochglanz poliertes Bad, dass man meinen konnte, es sei noch nie betreten worden. Langsam stieg er die Treppe hinauf, die in das obere Stockwerk führte. Dort waren drei geschlossene Türen. Die erste, die er öffnete, gab den Blick auf ein sauberes kleines Gastzimmer frei; die zweite führte in ein Bad, das größer war als das im Erdgeschoss, im Gegensatz zu dem unteren herrschte hier allerdings ziemliche Unordnung. Ein rosa Frotteebademantel lag auf dem Boden, als hätte ihn derjenige, der ihn getragen hatte, einfach fallen lassen. Das dritte Zimmer war das Schlafzimmer der Hausbewohner. Und gewiss war das die junge blonde Hausherrin, dieser nackte, fast kniende Körper, der mit dem Bauch über der Bettkante lag, die Arme ausgebreitet, das Gesicht im Leintuch vergraben, das von den Fingernägeln der Frau zerfetzt worden war, als sie sich, offenbar in den Krämpfen des Erstickungstodes, daran festgeklammert hatte. Montalbano trat zu der Leiche, zog einen Handschuh aus und berührte sie leicht: Sie war eiskalt und starr. Die Frau musste bildschön gewesen sein. Der Commissario ging die Treppe hinunter, schlüpfte wieder in seine Schuhe, wischte mit dem Taschentuch die kleine Pfütze auf, die sie auf dem Fußboden hinterlassen hatten, ging aus dem Haus, machte die Tür zu, überquerte die Straße, setzte sich ins Auto und fuhr los. Auf der Fahrt nach Marinella dachte er fieberhaft nach. Was sollte er tun, damit das Verbrechen entdeckt wurde? Er konnte dem Richter ja schlecht erzählen, was er angestellt hatte. Der Richter, der Dottor Lo Bianco vertrat – dieser hatte sich in den vorläufigen Ruhestand versetzen lassen, um sich verstärkt der nicht enden wollenden Forschungsarbeit über zwei historische Gestalten widmen zu können, die er für seine Vorfahren hielt –, war Venezianer, hieß mit Vornamen Nicolò und mit Nachnamen Tommaseo und brachte bei jeder Gelegenheit seine »unabdingbaren Vorrechte« zur Sprache. Er hatte ein Gesichtchen wie ein schwindsüchtiges Kind, das er unter seinem Belfiore-Märtyrerbart versteckte. Als Montalbano seine Haustür öffnete, fiel ihm endlich die Lösung des Problems ein. So kam es, dass er selig schlafen konnte.
Zwei
Ausgeruht und geschniegelt kam er um halb neun ins Büro.
»Wusstest du, dass der Questore was Besseres ist?«, fragte Mimì Augello ihn gleich, als er ihn sah.
»Ist das ein moralisches Urteil, oder ist es heraldisch belegt?«
»Heraldisch belegt.«
»Das habe ich schon an dem Bindestrich zwischen den beiden Nachnamen gesehen. Und du, Mimì, was hast du gemacht? Hast du ihn mit Conte, Barone, Marchese angeredet? Hast du ihm Honig ums Maul geschmiert?«
»Komm, Salvo, das bildest du dir immer ein!«
»Ich?! Fazio hat mir gesagt, dass du dich am Telefon beim Questore lieb Kind gemacht hast und dann wie eine Rakete abgezischt bist, um ihn zu besuchen.«
»Jetzt hör mal zu, der Questore hat wörtlich zu mir gesagt: ›Wenn Commissario Montalbano unauffindbar ist, dann kommen Sie sofort.‹ Was sollte ich denn tun? Ihm antworten, ich könnte nicht, weil mein Chef sonst stinkig wird?«
»Was wollte er denn?«
»Ich war nicht allein bei ihm. Die halbe Provincia war da. Er hat uns mitgeteilt, dass er die Absicht hat, zu verjüngen und zu modernisieren. Er hat gesagt, wer nicht in der Lage sei, bei seinem schnelleren Tempo mitzuhalten, könnte ja Schrotthändler werden. Genau das hat er gesagt: Schrotthändler. Allen war klar, dass er dabei dich und Sandro Turri aus Calascibetta im Auge hatte.«
»Wie seid ihr denn darauf gekommen?«
»Als er ›Schrotthändler‹ sagte, hat er lange erst Turri und dann mich angeschaut.«
»Könnte es nicht sein, dass er dich gemeint hat?«
»Komm, Salvo, alle wissen doch, dass er dich nicht besonders schätzt.«
»Was wollte unser Principe denn?«
»Uns sagen, dass wir demnächst supermoderne Computer kriegen, alle Kommissariate werden damit ausgestattet. Er wollte von jedem von uns den Namen eines Beamten, der in Datenverarbeitung besonders versiert ist. Und ich habe ihm einen genannt.«
»Spinnst du? Bei uns hat doch kein Schwein irgendeine Ahnung von dem Zeug! Welchen Namen hast du ihm denn genannt?«
»Catarella«, sagte Mimì Augello ernst und verzog keine Miene.
Die Tat eines geborenen Saboteurs. Montalbano sprang vom Stuhl auf und umarmte seinen Vice.
»Ich weiß alles über die kleine Villa, die Sie interessiert«, sagte Fazio und setzte sich auf den Stuhl vor Montalbanos Schreibtisch. »Ich habe mit dem Sekretär im Rathaus gesprochen, und der weiß alles von jedem Menschen in Vigàta, Leben, Wundertaten und Tod.«
»Und?«
»Also, das Grundstück, auf dem die Villa steht, gehörte Dottor Rosario Licalzi.«
»Was für ein Dottore?«
»Richtiger Dottore, Arzt. Er ist vor etwa fünfzehn Jahren gestorben und hat es seinem ältesten Sohn Emanuele vererbt, der auch Arzt ist.«
»Wohnt er in Vigàta?«
»Nonsi. Er lebt und arbeitet in Bologna. Vor zwei Jahren hat dieser Emanuele Licalzi ein Mädchen aus der Gegend dort geheiratet. Sie haben ihre Hochzeitsreise nach Sizilien gemacht. Die Frau hat das Grundstück gesehen und sich sofort in den Kopf gesetzt, da eine Villa bauen zu lassen. Das ist alles.«
»Weißt du, wo die Licalzis zurzeit sind?«
»Er ist in Bologna, sie wurde bis vor drei Tagen hier in der Stadt beim Einkaufen gesehen, sie ist dabei, die Villa einzurichten. Sie hat einen flaschengrünen Twingo.«
»Das ist der, den Gallo angefahren hat.«
»Genau. Der Sekretär hat gesagt, dass man sie gar nicht übersehen kann. Sie muss sehr schön sein.«
»Ich verstehe nicht, warum die Signora noch nicht angerufen hat«, sagte Montalbano, der, wenn er es darauf anlegte, glänzend schauspielern konnte.
»Ich könnte mir schon was denken«, sagte Fazio. »Der Sekretär hat gesagt, die Signora sei, wie soll ich sagen, amicionàra, sie hat viele Freundschaften.«
»Mit Frauen?«
»Und Männern«, betonte Fazio vielsagend. »Vielleicht ist die Signora bei irgendeiner Familie zu Besuch und wurde von den Leuten abgeholt. Sie kann den Schaden erst sehen, wenn sie wieder da ist.«
»Klingt plausibel«, beendete Montalbano, sein Theater weiterspielend, das Gespräch.
Sobald Fazio gegangen war, rief der Commissario Signora Clementina Vasile Cozzo an.
»Liebe Signora, wie geht es Ihnen?«
»Commissario! Was für eine schöne Überraschung! Es geht schon, Gott sei Dank.«
»Könnte ich auf einen Sprung bei Ihnen vorbeikommen?« »Sie sind jederzeit willkommen.«
Signora Clementina Vasile Cozzo war eine gelähmte alte Dame, eine ehemalige Grundschullehrerin, die mit Intelligenz gesegnet war und eine natürliche, zurückhaltende Würde besaß. Der Commissario hatte sie vor drei Monaten kennen gelernt, als er in einem komplizierten Fall ermittelte, und war ihr wie ein Sohn verbunden geblieben. Montalbano gestand es sich zwar nicht offen ein, aber Signora Clementina war die Frau, die er sich als Mutter gewünscht hätte; als er seine eigene Mutter verlor, war er noch zu klein gewesen, er hatte nur eine Art goldenes Strahlen von ihr in Erinnerung.
»A mamà era biunna? War Mama blond?«, hatte er, auf der Suche nach einer Erklärung, warum die Erinnerung an die Mutter nur in einem verschwommenen Leuchten bestand, seinen Vater einmal gefragt.
»Frumento sutta u suli. Weizen unter der Sonne«, hatte die trockene Antwort des Vaters gelautet.
Montalbano hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, Signora Clementina mindestens einmal in der Woche zu besuchen; er erzählte ihr von dem einen oder anderen Fall, mit dem er gerade beschäftigt war, und die Frau lud ihn, dankbar für den Besuch, der die Eintönigkeit ihrer Tage unterbrach, zum Essen ein. Pina, das Hausmädchen der Signora, war eine mürrische Person, außerdem war Montalbano ihr unsympathisch: Allerdings konnte sie Gerichte von raffinierter, entwaffnender Einfachheit zubereiten.
Signora Clementina empfing ihn im Wohnzimmer; sie war sehr elegant gekleidet und trug einen indischen Seidenschal um die Schultern.
»Heute ist Konzert«, flüsterte sie, »aber es ist gleich zu Ende.«
Vier Jahre zuvor hatte Signora Clementina von ihrem Mädchen Pina – die wiederum wusste es von Jolanda, der Hausdame von Maestro Cataldo Barbera – erfahren, dass der berühmte Geiger, der in der Wohnung über ihr lebte, ernste Schwierigkeiten mit dem Fiskus hatte. Sie sprach daraufhin mit ihrem Sohn, der in Montelusa im Finanzamt arbeitete, und das Problem, das im Wesentlichen von einem Missverständnis herrührte, wurde gelöst. Etwa zehn Tage später überbrachte Jolanda, die Haushälterin, Signora Clementina eine Nachricht: »Sehr geehrte Signora, um mich ein wenig erkenntlich zu zeigen, werde ich jeden Freitagvormittag von halb zehn bis halb elf für Sie spielen. Ihr sehr ergebener Cataldo Barbera.«
So warf sich die Signora jeden Freitagmorgen in Schale, um ihrerseits dem Maestro ihre Ehrerbietung zu bezeigen, und begab sich in eine Art Wohnzimmerchen, in dem man die Musik am besten hörte. Und im Stockwerk darüber fing der Maestro Punkt halb zehn mit seinem Geigenspiel an.
In Vigàta wusste jedermann von der Existenz des Maestro Cataldo Barbera, aber nur die wenigsten hatten ihn je zu Gesicht bekommen. Als Sohn eines Eisenbahners hatte der zukünftige Maestro vor fünfundsechzig Jahren in Vigàta das Licht der Welt erblickt, die Stadt, als er noch keine zehn Jahre alt war, jedoch verlassen, weil sein Vater nach Catania versetzt wurde. Von seiner Karriere hatten die Vigatesi aus der Zeitung erfahren: Cataldo Barbera hatte Violine studiert und war innerhalb kurzer Zeit ein weltberühmter Konzertgeiger geworden. Doch auf dem Höhepunkt seines Ruhmes hatte er sich aus unerfindlichen Gründen nach Vigàta zurückgezogen und sich dort eine Wohnung gekauft, in der er als freiwilliger Gefangener lebte.
»Was spielt er denn?«, fragte Montalbano.
Signora Clementina reichte ihm ein kariertes Blatt Papier. Der Maestro pflegte der Signora am Tag vor dem Konzert das mit Bleistift geschriebene Programm zu schicken. Die Stücke jenes Tages waren die Danza spagnola von Sarasate und die Scherzo-Tarantella op. 16 von Wieniawski. Als das Konzert zu Ende war, steckte Signora Vasile Cozzo das Telefon wieder ein, wählte eine Nummer, legte den Hörer auf die Ablage an ihrem Rollstuhl und applaudierte. Montalbano tat es ihr von ganzem Herzen nach: Er verstand nichts von Musik, aber eines wusste er sicher: dass Cataldo Barbera ein großer Künstler war.
»Signora«, fing der Commissario an, »mein Besuch bei Ihnen ist eigennützig, ich muss Sie um einen Gefallen bitten.«
Er fuhr fort und erzählte ihr alles, was ihm tags zuvor passiert war – der Unfall, das verwechselte Begräbnis, der heimliche nächtliche Besuch in der kleinen Villa, die Entdeckung der Leiche. Als er fertig war, zögerte der Commissario, er wusste nicht, wie er seine Bitte formulieren sollte.
Signora Clementina, die abwechselnd amüsiert und erschüttert war, ermutigte ihn:
»Nur zu, Commissario, raus mit der Sprache. Was wollen Sie von mir?«
»Ich möchte, dass Sie einen anonymen Anruf tätigen«, sagte Montalbano in einem Atemzug.
Er war seit zehn Minuten wieder im Büro, als Catarella ihm einen Anruf von Dottor Lattes, dem Chef des Stabes in der Questura, durchstellte.
»Mein lieber Montalbano, wie geht’s? Wie geht es Ihnen?« »Gut«, sagte Montalbano kühl.
»Ich freue mich, dass Sie bei guter Gesundheit sind«, sagte der Chef des Stabes, nur um seinem Spitznamen Lattes e Mieles gerecht zu werden, mit dem ihn jemand wegen seiner honigsüßen Gefährlichkeit bedacht hatte.
»Zu Ihren Diensten«, drängte Montalbano ihn.
»Ecco. Vor einer knappen Viertelstunde hat eine Frau in der Telefonzentrale der Questura angerufen und wollte persönlich mit Signor Questore sprechen. Sie ließ sich nicht abwimmeln. Aber der Questore war beschäftigt und hat mich angewiesen, den Anruf entgegenzunehmen. Die Frau war ganz hysterisch, sie schrie, in einer Villa in der Contrada Tre Fontane sei ein Verbrechen verübt worden. Dann hat sie wieder aufgelegt. Der Questore bittet Sie, auf alle Fälle mal hinzufahren und ihm zu berichten. Die Signora sagte auch, die kleine Villa sei leicht zu erkennen, weil ein flaschengrüner Twingo davorsteht.«
»O Dio!«, rief Montalbano – jetzt begann Teil zwei seiner Rolle, denn Signora Clementina Vasile Cozzo hatte die ihre mit Bravour gespielt.
»Was ist denn?«, fragte Dottor Lattes neugierig.
»Was für ein merkwürdiger Zufall!«, rief Montalbano und legte Erstaunen in seine Stimme. »Ich berichte Ihnen später.«
»Pronto? Hier ist Commissario Montalbano. Spreche ich mit Giudice Tommaseo?«
»Ja. Buongiorno. Was kann ich für Sie tun?«
»Dottor Tommaseo, der Stabschef des Questore hat mir eben mitgeteilt, dass eine anonyme Anruferin ein Verbrechen in einer Villa in der Gemarkung von Vigàta gemeldet hat. Er hat mich beauftragt, mal nachzuschauen. Ich will gerade hinfahren.«
»Ist das nicht möglicherweise nur ein schlechter Scherz?« »Möglich ist alles. Ich wollte Sie in Anerkennung Ihrer unabdingbaren Vorrechte in Kenntnis setzen.«
»Natürlich«, sagte Giudice Tommaseo zufrieden.
»Geben Sie mir Handlungsfreiheit?«
»Selbstverständlich. Und wenn dort wirklich ein Verbrechen begangen wurde, dann benachrichtigen Sie mich umgehend und warten, bis ich komme.«
Er rief Fazio, Gallo und Galluzzo zu sich und teilte ihnen mit, sie müssten mit ihm in die Contrada Tre Fontane fahren und nachsehen, ob dort ein Mord begangen wurde.
»Ist es das Haus, über das ich mich informieren sollte?«, fragte Fazio erstaunt.
Gallo setzte noch eins drauf: »Dasselbe, vor dem wir den Twingo zusammengefahren haben?« Er sah seinen Chef verdutzt an.
»Ja«, antwortete der Commissario allen beiden und setzte ein bescheidenes Gesicht auf.
»Sie haben aber einen guten Riecher!«, rief Fazio bewundernd aus.
Sie hatten sich gerade erst auf den Weg gemacht, doch Montalbano war bereits genervt: genervt von der Farce, die er würde spielen müssen, indem er sich beim Anblick der Leiche überrascht gab, genervt, weil der Richter, der Gerichtsmediziner, die Spurensicherung imstande waren, erst nach Stunden am Tatort zu erscheinen, und er dadurch viel Zeit verlieren würde. Er beschloss, die Zeit etwas zu raffen.
»Gib mir das Handy«, sagte er zu Galluzzo, der vor ihm saß. Am Steuer saß natürlich Gallo.
Er wählte die Nummer von Giudice Tommaseo.
»Hier ist Montalbano. Signor Giudice, der anonyme Anruf war kein Scherz. Wir haben in der Villa leider eine weibliche Leiche gefunden.«
Seine Mitfahrer reagierten unterschiedlich. Gallo geriet ins Schleudern, raste auf die Gegenfahrbahn, streifte einen mit Betoneisenstangen beladenen Laster, fluchte und fuhr wieder auf seine Straßenseite zurück. Galluzzo schrak hoch, riss die Augen auf, verrenkte sich über die Rückenlehne zu seinem Chef hin und glotzte ihn mit offenem Mund an. Fazio erstarrte spürbar und stierte ausdruckslos vor sich hin.
»Ich komme sofort«, sagte Giudice Tommaseo. »Sagen Sie mir genau, wo das Haus ist.«
Montalbano war immer mehr genervt und gab Gallo das Handy.