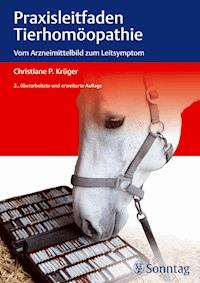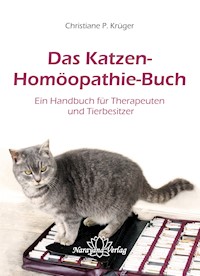
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Narayana
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Anschmiegsame Kuschelkatze, scheues Mimöschen oder erhabene Majestät – jede Katze ist einzigartig. So auch die Behandlung im Krankheitsfall. Das „Katzen-Homöopathie-Buch“ von Christiane P. Krüger ist weit mehr als ein Ratgeber für Krankheitsmomente, in denen die Schulmedizin nicht weiterkommt. Es ist das mit Abstand wohl umfassendste Werk über die homöopathischen Behandlungsmöglichkeiten der Katze – und den sensiblen Stubentiger an sich. Von akuten Beschwerden bis zu schweren chronischen Erkrankungen, von Verletzungen, Sturz aus dem Fenster, inneren Blutungen, Infektionen, speziellen Katzenkrankheiten wie Leukose und Toxoplasmose, Entzündungen der Augen und Ohren, neurologischen Beschwerden, Erkrankungen des Verdauungssystems und des Bewegungsapparates, Fell- und Hautbehandlungen, Krebserkrankungen bis zur besonderen Unterstützung von jungen und Senioren-Katzen – es gibt kaum einen Bereich, den Christiane P. Krüger nicht thematisiert und verständlich zur Sprache bringt. Die Tierärztin schöpft aus 40 Jahren Praxiserfahrungen. Und zeigt an vielen Beispielen praxisnah, wie Homöopathie erfolgreich Anwendung findet. Auch, wenn die Situation ausweglos erscheint. Dem Behandlungsteil ist ein ausführlicher Bereich zu den Grundlagen der Homöopathie und dem Wesen der Katze vorgeschaltet. Das Buch ist systematisch aufgebaut, gut strukturiert und ansprechend gestaltet. Es vermittelt hilfreiches Fachwissen auf leichte und verständliche Weise. Katzentypologien wie der vierbeinige Haustyrann Lycopodium und das misstrauische Arsenicum sowie eindrückliche „Katzenfälle“ aus der Praxis runden das Buch ab. "Das Werk ist jeden Tag der 4 Jahre Wartezeit seit Bestellung wert. Wer es als Therapeut nicht im Bücherbestand hat, ist um eines der meines Erachtens besten Tierhomöopathiebücher ärmer ! Und solche Bemerkungen gebe ich nicht leichtfertig ab ! Ein absolutes Must-have für die Praktiker! Ich habe Christiane auf einem Kongress in Badenweiler kennengelernt und später eine Fortbildung bei ihr gemacht. Sie hat unglaubliches Fachwissen und Erfahrung zusammengetragen und man kann ihr nur auf Knien danken, dass sie beides gewillt ist, weiterzugeben." Sybille Traum – Tierheilpraktikerin "Christiane P. Krügers „Katzen-Homöopathie-Buch“ ist kompetente Fachliteratur und eine Liebeserklärung an die Katze zugleich. Eine echte Fundgrube für alle, die mit Katzen zu tun haben – privat oder beruflich. Möge es den Samtpfoten schnell wieder besser gehen! „Dieses Buch bringt die homöopathische Behandlung der Katzen auf ein neues Niveau.” Dr. med. vet. Brigitta Monhart
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1386
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christiane P. Krüger
Das Katzen- Homöopathie-Buch
Ein Handbuch für Therapeuten und Tierbesitzer
Impressum
Christiane P. Krüger
Das Katzen-Homöopathie-Buch
Ein Handbuch für Therapeuten und Tierbesitzer
1. Auflage 2017
2. überarbeitete Auflage 2021
ISBN: 978-3-95582-149-4
© 2017 Narayana Verlag GmbH
Coverabbildungen: Christiane P. Krüger
Herausgeber: Narayana Verlag,
Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Tel.: +49 7626 974970-0
E-Mail: [email protected], Homepage: www.narayana-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Inhalt
Vorwort
Huldigung an DIE KATZE
SEKTION 1
KAPITEL 1EINFÜHRUNG
Allgemeine Einleitung
Aufbau des Buches
Kurze Anleitung zum homöopathischen Vorgehen
Studium der Grundlagen
Fallaufnahme
Herausfinden des Simile
Richtlinien für die Therapie
Die Katze – Wesen – physiologische Daten
Wesen und Konstitution der Katze
Physiologische Daten der Katze
Sinnessystem der Katze
Körpersprache und Ausdrucksverhalten
Lieblingsplätze der Katze
Das Verhalten und der »7. Sinn« der Katze
Die Katze und ihre Bezugspersonen
Katzen und Homöopathie
Die Fütterung der Katze
KAPITEL 2HOMÖOPATHISCHE GRUNDLAGEN
Allgemeines zur Homöopathie
Die Lebenskraft
Grundprinzip der Homöopathie
Arzneimittelprüfung – Arzneimittelbild – Materia medica
Tierhomöopathie
Medizinverständnis in Homöopathie und Hochschulmedizin
Das homöopathische Symptom
Die homöopathische Arznei
Herkunft der homöopathischen Arzneien
Potenzierung
Arten der Potenzierung
Beitrag zum Verständnis homöopathischer Potenzen
Verabreichung homöopathischer Arzneien an die Katze
Kriterien der Ähnlichkeit: Arten von Erkrankungen
Chronische Erkrankungen
Entstehung chronischer Krankheiten
Entwicklung und Verlauf chronischer Krankheiten
Therapie chronischer Krankheiten
Ablauf der Therapie chronischer Krankheiten
Kausal bedingte Erkrankungen
Akute Erkrankungen
Klinische Homöopathie für lokalisierte Krankheiten
»Einseitige Krankheiten«
»Unähnliche Erkrankungen«: Schäden durch Pharma-Präparate
Miasmen
Anwendung der Homöopathie: Die »drei Säulen« der Homöopathie
Die Erste Säule der Homöopathie: Der Patient
Anamnese für die chronisch kranke Katze – »Gesamtheit der Symptome«
Die Zweite Säule: Die homöopathische Arznei
Komplexmittel
Die Dritte Säule: Der Vorgang der Heilung
Auswertung der Anamnese und Auswahl der Arznei
Auswahl der Potenz-Art und Dosierung
Reaktion des Patienten auf die Arznei
Falsche Anwendung der Homöopathie
Fehler und deren Folgen
Fall-Beispiel: Homöopathisch falsch behandelter Hund
Grenzen der Homöopathie
Testverfahren
Äußerliche Maßnahmen
Beispiele für den Gebrauch dieses Buches
Praktische Beispiele
Erstes Beispiel
Zweites Beispiel
SEKTION 2 - DIE HOMÖOPATHISCHE BEHANDLUNG VON KATZEN
KAPITEL 3TRAUMA – VERLETZUNGEN UND WUNDEN
Allgemeines
Verletzungen bei der Katze
Anamnese/Fallaufnahme zur homöopathischen Therapie von Verletzungen der Katze
Schnellorientierung zu Verletzungen allgemein
Schnellorientierung über die wichtigsten homöopathischen »Verletzungsmittel«
Schnellorientierung für Blutungen
Schnellorientierung für die Wundgangrän
Schnellorientierung für Knochenbrüche
Verzeichnis und Kurz-Repertorium für spezielle Arten von Verletzungen
Chronische Folgen von Verletzungen
Sonderfälle von Verletzungen
Die Unfallkatze
Sturz aus dem Fenster
Die »Kippfenster-Katze«
Rippenfraktur
Beckenfraktur
Hüftgelenksluxation
Verletzungen durch eingeklemmte Körperteile (Schwanz, Pfote, Zunge)
Insektenstiche – Zeckenbisse
Chirurgische Verletzungen
Fuchsfalle
Psychische Auffälligkeiten während oder nach Unfallverletzungen
Beschreibung der wichtigsten homöopathischen »Verletzungsmittel«
KAPITEL 4INFEKTIONEN UND ENTZÜNDUNGEN
Allgemeines zum Thema »Infektionen« und »Entzündungen«
Wundinfektionen
Anamnese für infizierte Wunden
Die wichtigsten homöopathischen Mittel für Wundinfektionen
Akute Allgemeininfektionen
Anamnese zu akuten Allgemeininfektionen
Beschreibung der Arzneien für akute Allgemeininfektionen
Akute und chronische Entzündungen der Tonsillen bzw. des lymphatischen Rachenrings
Peritonitis
Spezielle systemische Infektionskrankheiten der Katze
Leukose – Felines Leukämie-Virus (FeLV) – Panleukopenie
Übersicht zu den möglichen Homöopathika für die Leukose der Katze
Immundefizienz-Syndrom – Felines Immundefizienz-Virus (FIV) – »Katzen-AIDS«
Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)
Infektiöse Anämie – Hämobartonellen
Toxoplasmose
Reaktionen auf Impfungen
KAPITEL 5ERKRANKUNGEN DER AUGEN
Allgemeines
Anamnese bei Erkrankungen der Augen
Homöopathie für Augenverletzungen
Kurz-Repertorium für Verletzungen am Auge
Beschreibung der wichtigsten Arzneien für Augenverletzungen
Weitere Erkrankungen am Auge
Entzündungen am und im Auge
Verstopfter Tränen-Nasen-Gang
Kurz-Repertorium für Augenerkrankungen der Katze
Beschreibung der wichtigsten Arzneien für Erkrankungen am oder im Auge
Krebserkrankungen am Auge
KAPITEL 6ERKRANKUNGEN DER KATZEN-OHREN
Allgemeines zu Erkrankungen am Katzenohr
Anamnese bei Ohrenerkrankungen
Kurz-Repertorium: Ohrenerkrankungen der Katze
Beschreibung der wichtigsten Homöopathika für Ohrenerkrankungen der Katze
Äußerliche Anwendung zum Spülen des Gehörgangs
KAPITEL 7NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN
Allgemeines
Infektionen und Entzündungen des Nervensystems
Lähmungen
Krampfanfälle, Konvulsionen
Schwindel
Meningitis – Enzephalitis – Myelitis
Anamnese Meningitis, Enzephalitis, Myelitis
Kurz-Repertorium zum Thema Meningitis, Enzephalitis, Myelitis
Die häufigsten Homöopathika für Meningitis, Enzephalitis, Myelitis
Lähmungen – Neurologisch bedingte Bewegungsstörungen
Anamnese zu neurologisch bedingten Bewegungsstörungen
Kurz-Repertorium für die häufigsten Mittel für Lähmungserscheinungen
Die wichtigsten Homöopathika für Lähmungen
Arzneien für überwiegend akute oder neu aufgetretene Lähmungen
Chronische oder fortschreitende Lähmungen
Konvulsionen – Krampfanfälle – Anfallsleiden – Epilepsie
Allgemeines zum Thema »Krampfanfälle«
Homöopathische Therapie von Konvulsionen/Epilepsie
Allgemeines
Konvulsionen Anamnese
Kurz-Repertorium zum Thema »Krampfanfälle«
Die wichtigsten Homöopathika für Krampfanfälle – Konvulsionen – Epilepsie
Schwindel
Anamnese zum Syndrom »Schwindel«
Einige Schwindel-Rubriken des Mac-Repertory mit den wichtigsten Homöopathika
Beschreibung einiger Homöopathika für Schwindel
Schwindel – »Reisekrankheit«
Die wichtigsten Homöopathika für die akute Reisekrankheit
KAPITEL 8ERKRANKUNGEN DER ATEMWEGE
Allgemeines
Fallaufnahme – Anamnese – für Erkrankungen der Atemwege:
Beschreibung der Erkrankungen der Atemwege der Katze
Plötzlich perakut beginnende Infektionen der Atemwege
Rhinitis (Schnupfen), Sinusitis (Stirnhöhlen, Kieferhöhlen)
Rhinitis
Fremdkörper im Nasenraum
Sinusitis durch Zahnwurzelabszess
Angina – Entzündung von Rachen und/oder Tuba eustachica
Kehlkopfentzündung
Bronchitis
Lungenwürmer
Pneumonie
Lungenfibrose
Asthma
Lungenödem
Beschreibung der wichtigsten Homöopathika für Atemwegserkrankungen der Katze
Rhinitis – Arzneien für den akuten oder beginnenden Schnupfen
Der chronische Katzenschnupfen
Allgemeines
Vorschlag für den Therapieablauf des chronischen Katzenschnupfens
Kurz-Repertorium für die klinische und konstitutionelle Therapie des chronischen Katzenschnupfens
Klinische Mittel für den chronischen Katzenschnupfen
Nosoden für den Katzenschnupfen
Konstitutionelle Mittel für den chronischen Katzenschnupfen
Weitere Homöopathika für Atemwegserkrankungen der Katze
Übersicht zu den wichtigsten Symptomen der Atemwege (außer Schnupfen)
Beschreibung der wichtigsten Homöopathika für die Atemwege (außer Schnupfen)
KAPITEL 9ERKRANKUNGEN VON HERZ-KREISLAUF, BLUT UND LYMPHORGANEN
Herzerkrankungen
Kurz-Repertorium zu den wichtigsten Herzerkrankungen mit den häufigsten Arzneien
Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) der Katze
Weitere Homöopathika für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Erkrankungen von Blut und Blutgefäßen
Übersicht und Beschreibung der häufigsten Arzneien bei Blut- und Kreislauferkrankungen
Lymphsystem
KAPITEL 10VERDAUUNGSAPPARAT
Erkrankungen der Lippen: Eosinophiles Ulcus
Erkrankungen von Maulhöhle und Rachen
Verletzungen der Maulhöhle
Erkrankungen von Zahn und Zahnfleisch
Zahnstein
»Zahnschmerzen«
Zahnwurzelabszess – Zahnfistel
Maulfäule – Stomatitis ulcerosa – Stomakaze – Geschwüre der Zunge
FORL – Feline Odontoklastic Resorptive Lesions
Entzündungen und Geschwüre der Zunge
Entzündungen und Geschwüre im Rachen
Kurz-Repertorium für entzündliche und degenerative Erkrankungen im Katzenmaul
Beschreibung der wichtigsten Arzneien für Erkrankungen in Maul und Rachen der Katze
Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
Symptomenkomplex »Inappetenz, Übelkeit, Erbrechen und Gastritis«
Allgemeines
Homöopathische Anamnese zum Thema »Inappetenz, Übelkeit, Erbrechen und Gastritis«
Die wichtigsten Mittel für Inappetenz, Übelkeit, Erbrechen und Gastritis
Kurz-Repertorium zum Erbrechen
Gastroenteritis – Durchfall
Allgemeines zum Thema »Gastroenteritis und Durchfall«
Anamnese zur Gastroenteritis
Kurz-Repertorium zum Thema »Durchfall« und »Gastroenteritis«
Die wichtigsten und häufigsten Mittel für die Gastroenteritis bzw. Enteritis
Weitere Mittel für Magenbeschwerden, Erbrechen bzw. Gastroenteritis
Seltener vorkommende Mittel für Magenbeschwerden, Erbrechen bzw. Gastroenteritis
Obstipation
Kurz-Repertorium Obstipation
Die wichtigsten Mittel für die Obstipation
Wurmbefall
KAPITEL 11ERKRANKUNGEN VON LEBER, STOFFWECHSEL UND ENDOKRINIUM
Allgemeines
Die Leber
Die Schilddrüse
Diabetes mellitus
Vergiftungen
Die Adipositas (Fettsucht)
Beschreibung der wichtigsten Arzneien für Leber- und Stoffwechselerkrankungen
Spezielle Homöopathika für den Diabetes mellitus bei der Katze
KAPITEL 12ERKRANKUNGEN DER HARNWEGE
Allgemeines
Chronische Niereninsuffizienz (CNI)
Erkrankungen der abführenden Harnwege (FLUTD)
Anamnese für Erkrankungen der Harnwege
Kurz-Repertorium einiger Symptome von Harnwegserkrankungen
Beschreibung der wichtigsten Arzneien für Erkrankungen der Harnwege
KAPITEL 13BEWEGUNGSSTÖRUNGEN DER KATZE
Allgemeines zum Thema »Bewegungsstörungen der Katze«
Arten und Ursachen von Bewegungsstörungen der Katze
Anamnese für Bewegungsstörungen der Katze
Kurz-Repertorium für Bewegungsstörungen der Katze
Beschreibung der Arzneien für Bewegungsstörungen der Katze
KAPITEL 14HAUTERKRANKUNGEN DER KATZE
Allgemeines
Besonderheiten zum Thema »Hauterkrankungen«
Hauterkrankungen bei der Katze
Haarausfall
Haarbruch
Verbesserung der Fellqualität:
Pigmentstörungen
Juckreiz
Räudemilben – »Krätze«
Floh- und Zeckenbefall
Vorbeuge gegen Ektoparasiten
Leckekzem
Allergien
Chronische Ekzeme
Eosinophiler Granulom-Komplex der Katze
Leishmaniose der Katze
Homöopathische Therapie von Hauterkrankungen der Katze
Fallaufnahme – Anamnese von Hauterkrankungen
Anamnese für Hauterkrankungen
Übersicht, Schlüsselsymptome und Kurz-Repertorium
Beschreibung der wichtigsten Homöopathika für Hauterkrankungen der Katze
Homöopathisches Vorgehen und Dosierung der Arzneien für Hauterkrankungen
Chronische Hautausschläge
Akute Hautreaktionen – Kontaktallergie – Urticaria u. Ä.
Eitrige oder septisch infizierte Hautausschläge
KAPITEL 15KREBS- UND TUMORERKRANKUNGEN DER KATZE
Allgemeines zu Tumorerkrankungen der Katze
Tumorarten bei der Katze
Tumoren des Lymphsystems
Schulmedizinische Therapie
Probleme alternativer Heilmethoden mit Krebs
Homöopathische Krebstherapie
Kurz-Repertorium der wichtigsten Mittel für Krebserkrankungen der Katze
Beschreibung der wichtigsten Homöopathika bei Tumorerkrankungen der Katze
Weitere Möglichkeiten der alternativen Krebstherapie
KAPITEL 16GYNÄKOLOGIE UND ANDROLOGIE
Gynäkologie – Übersicht zu Geschlechtszyklus, Trächtigkeit und Geburt der Katze
Störungen in Geschlechtszyklus, Trächtigkeit und Geburt der Katze
Übersicht zu Arzneien für Sterilität und Zyklusstörungen
Arzneimittelbeschreibungen für Zyklusstörungen, Nymphomanie und Sterilität
Verhaltensprobleme während der Rolligkeit
Trächtigkeit und Geburt
Abort, Frühgeburt
Übertragen, zu später Geburtstermin
Gestörter Geburtsverlauf
Beschreibung der wichtigsten Mittel
Abgestorbener oder nicht ausgetriebener Fötus
Probleme nach der Geburt
Nachgeburtsverhaltung (Plazentaretention)
Septische Zustände nach der Geburt mit oder ohne Plazentaretention
Verletzungen – Kaiserschnitt – Kastration
Metritis – Endometritis – Pyometra
Gestörtes Mutterverhalten
Erkrankungen des Gesäuges
Männliches Genital – Andrologie des Katers
KAPITEL 17ERKRANKUNGEN JUNGER KATZEN
Allgemeine Daten für Katzenwelpen
Kurz-Repertorium für Probleme mit Katzenwelpen
Lebensschwäche
Arzneien für weitere Erkrankungen bei jungen Katzen
Prophylaxe von erblichen Schäden
KAPITEL 18DIE ALTE ODER REKONVALESZENTE KATZE
Allgemeines
Beschreibung der wichtigsten Arzneien für alte oder rekonvaleszente Tiere
Zusätzliche Möglichkeiten einer Therapie
Präparate der Koch'schen Molekulartherapie
Präparate für den Intermediärstoffwechsel
Einsatz von Sarkoden
Die sterbende Katze – homöopathische Sterbehilfe
KAPITEL 19NOTFÄLLE
Schock
Beschreibung der Arzneien für das Schockgeschehen
Blutungen
Austrocknung (Dehydration)
Vergiftungen
Beschreibung der wichtigsten Arzneien für Vergiftungen
Hitzschlag – Sonnenstich
Ertrinken
Verbrennungen
Schmerzen
KAPITEL 20VERHALTEN – GEMÜTSSYMPTOME
Allgemeines zum Thema »Verhaltenssymptome« in der Homöopathie
Übersicht über die wichtigsten Homöopathika für unerwünschtes Verhalten
Gemütssymptome – Verhaltenssymptome und Arzneimittelbild
Einige homöopathische Portraits von Katzen-Persönlichkeiten
Die Aconitum-Katze
Die Arsenicum-Katze
Die Calcarea-carbonica-Katze
Die Ignatia-Katze
Die Lachesis-Katze
Die Lycopodium-Katze
Die Natrium-muriaticum-Katze
Die Phosphorus-Katze
Die Pulsatilla-Katze
Die Silicea-Katze
Die Staphysagria-Katze
Kurzbeschreibung einiger Mittel zum Thema »unerwünschtes« Verhalten
KAPITEL 21KATZEN-KASUISTIK
Miezi – Blutungen aus der Harnblase
Minka – chronisches »Erbrechen«
Cäsar – aggressives Verhalten
Katzendramen mit Happy End
Ein beinahe menschliches Katzen-Missverständnis
Feger – Harnwegsbeschwerden
Kasimir – Furcht, verlassen zu werden
Kater Clinton – Fieber
Wiggy – Schnupfen und röchelnde Atmung
Jule – septische Peritonitis
Fando – Epileptische Anfälle
Max – Erkrankung der Harnwege
Minchen – Metritis
Anna – 25-jährige Katze mit erstickender Atmung
Mia – Leukose
Chiko – Leukose
Paddy – Verdacht auf FIP
Bonny – Katzenschnupfen
Pussy – chronischer Durchfall
Lucky – Eosinophiler Granulom-Komplex und Durchfälle
Murrlis Panikattacke
Mimi – verhärtete Mamma
Felix – Eosinophiles Lippengranulom und Stomatitis
Kater Gismo: „Immunschwäche“
Das Katerchen Hallo – Ohrmilben-Otitis
SEKTION 3
ARZNEIMITTELLEHRE FÜR DIE KATZE
Allgemeines zur Arzneimittellehre für die Katze
Verzeichnis der beschriebenen Arzneimittel
Nosoden
Allgemeines zur Verordnung von Nosoden
Kriterien zur Verordnung von Nosoden
Darmnosoden – Bowel-Nosoden
Anwendung dieser Nosoden
Die häufigsten Darmnosoden
Nosoden für spezielle Katzenkrankheiten
Andere krankheitsspezifische Nosoden
VERZEICHNISSE
Glossar medizinischer und homöopathischer Fachbegriffe
Arzneimittelverzeichnis mit Abkürzungen
Verzeichnis der beschriebenen Katzenkrankheiten
Sachverzeichnis der homöopathischen Grundlagen (Kapitel 2)
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
ÜBER DIE AUTORIN
Vorwort
Katzen sind einzigartig!
Katzenpersönlichkeiten zeigen eine breite Vielfalt an Wesensarten – vom liebenswürdigen „Kuscheltier“, über den rabiaten Mäusefänger, die witzige Spielkatze bis zum krallenbewehrten, charmanten „Teufel“. Gerade dieses faszinierende Spektrum an Temperamenten bezaubert die Katzenliebhaber.
Umso schmerzlicher ist es, wenn die Gesundheit unserer kleinen Raubtiere mit der üblichen Medizin oft nicht befriedigend unterstützt oder wiederhergestellt werden kann.
Daher suchen zunehmend mehr Tierbesitzer Hilfe bei der Homöopathie.
Die homöopathische Medizin ist eine seit über 200 Jahren bestehende Wissenschaft, die weder einfach anzuwenden, noch im Schnellkurs zu erlernen ist. Ihr Studium erfordert jahrelanges Bemühen; und schließlich stellt uns jeder Patient vor neue, individuelle Fragen: Der Homöopath hat niemals ausgelernt!
Dieses Fachbuch wendet sich an interessierte Tierbesitzer und an Studenten der Homöopathie, aber auch der versierte Praktiker wird viele neue Anregungen für die Therapie schwieriger Pathologien finden.
Die kurz gefasste Einführung in das Wesen der Homöopathie und ihre Anwendung bildet die Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz dieses Buches.
Die angegebenen Indikationen entsprechen dem Wissensstand einer 40-jährigen Erfahrung. Sie sind dennoch nicht als endgültig anzusehen, sondern müssen fortlaufend durch weitere Erkenntnisse ergänzt und erweitert werden.
Zwischen den Zeilen der trockenen fachlichen Informationen schimmern manchmal die amüsanten und liebenswerten Züge der Katze hervor.
Das „Katzen-Homöopathie-Buch“ gibt keine fixen Rezeptanweisungen, sondern es will zum eigenen Arbeiten und Erkennen von therapeutischen Möglichkeiten anleiten. Der Leser wird so zum Studenten und kann sich hier grundlegende Kenntnisse der homöopathischen Medizin erarbeiten.
Die Angaben in diesem Buch können jedoch dem angehenden professionellen Homöopathen nicht in vollem Maße das spezielle Studium der homöopathischen Theorie, der Arzneimittelehre und den Gebrauch des Repertoriums etc. ersetzen. Für eine eigene therapeutische Praxis muss zusätzliches Wissen erworben werden.
Vorausgesetzt ist immer der gewissenhafte und wohl überlegte Einsatz der homöopathischen Medizin.
Zum Entstehen dieses Buches gilt mein Dank in erster Linie den Patienten und den daraus erworbenen homöopathischen Erfahrungen. Erst daraus lassen sich Erkenntnisse sammeln für eine passende Arzneimittelwahl.
Mein Dank geht ganz besonders an meine Tochter Ina für Inspirationen, Korrekturen und Zeichnungen, sowie an meinen Sohn für die technische Unterstützung. Weiterhin danke ich der Tierärztin Dr. Brigitta Monhart und dem homöopathischen Tierarzt Ulrich Stach für medizinische Beratungen.
Und nicht zuletzt danke ich dem Narayana Verlag für seine Geduld und insbesondere Frau Cynthia Ewert und Frau Katja Kappeler für die freundliche Kooperation und Begleitung.
Möge das „Katzen-Homöopathie-Buch“ allen Katzen- und Tierliebhabern sowie ihren Therapeuten Impulse vermitteln, dass es in vielen Fällen – auch bei scheinbar aussichtslosen Krankheiten – doch noch eine Lösung geben kann!
Viele der angesprochenen Themen lassen sich auch auf den Hund und andere Lebewesen anwenden.
Christiane P. Krüger, August 2016
Huldigung an DIE KATZE – in all ihren Facetten (cum grano salis)
Dieses Buch sei ihrem Wohlergehen in gutenund der Heilung in weniger guten Lebensphasen gewidmet -für
die erhabene Majestät
das schüchterne Häschen
das attraktive Biest
das anschmiegsame Kuschelkätzchen
die obszöne Sängerin
die aufdringliche Schmusekatze
das scheue Mimöschen
das durchsichtige Engelchen
die zierliche Primaballerina
die geliebte Mia
die bequeme Sofa-Kissen-Katze
die freche Neugierige
das einfache Dorfkind
die unnahbare Prinzessin
die eigensinnige Charakterkatze
das eitle Mädchen
das naive Stubenkätzchen
die unerziehbare Straßenkatze
die wilde Hexe mit den Leuchtaugen
die angstvoll-aggressive Neurotische
die arrogante Schönheit
die psychotisch Sensible
die eifersüchtige Zicke
der possessive Alleinherrscher
die liebevolle Supermutter
die widersprüchliche Kratzbürste
den listigen Dieb
die autarke Einzelgängerin
die Gepflegte mit dem Waschzwang
die erotisch-affektierte Nutte
die mitfühlende Helferin
die elastische Athletin
das herzige Spielkätzchen
den pfiffigen Frechdachs
die unbelehrbare Panikerin
den durchtriebenen Schmuseteufel
den robusten Rocky
den mächtigen Zorro
den rabiaten Kämpfer
den pedantischen Dickkopf
den schnurrenden Schmeichler
den braven Peter
den Lautlosen mit den Samtpfoten
den gerissenen Tunichtgut
den emotionalen Liebhaber
den erhabenen Pascha
den gerissenen Schlauberger
den opportunistischen Lebenskünstler
den unverschämten Eindringling
den unwiderstehlichen Gigolo
den skrupellosen Vogelmörder
den destruktiven Teufel
den unsteten Herumtreiber
und alle anderen exklusiven Persönlichkeiten,
wie sie sonst noch heißen mögen,
…immer ehrlich engagiert in ihren verschiedenen Rollen, denen wir alle zu Diensten sein dürfen.
»DIE KATZE« gilt für alle Geschlechter!
1
KAPITEL 1
EINFÜHRUNG
Allgemeine Einleitung
Die Homöopathie erfordert ein gründliches Umdenken hinsichtlich Verständnis von Gesundheit und Krankheit:
Nicht das Beseitigen von definierten Krankheiten, Symptomen, Erregern oder das Korrigieren von Laborbefunden steht im Vordergrund, sondern der gesamte Organismus soll in seiner Eigenregulation derart gestärkt werden, dass er Krankheiten aus eigener Kraft überwinden kann.
Daher gibt es kein spezifisches Homöopathikum »gegen« Durchfall oder Katzenschnupfen, es muss vielmehr ein spezielles Mittel für den jeweiligen Patienten mit seinen individuellen Beschwerden verordnet werden.
Das therapeutische Angebot der Homöopathie ist ungleich viel umfangreicher als das der akademischen Medizin: Hier stehen weit mehr als 1000 geprüfte Arzneimittel zur Verfügung, die jedoch nur mit genauer Sachkenntnis erfolgreich eingesetzt werden können.
Daher ist auch die Ausbildung zum Homöopathen wesentlich umfangreicher als die des Hochschul-Mediziners: Neben der klinischen Medizin muss er die genauen Einzelheiten von zahlreichen verschiedenen Homöopathika und deren Anwendung genau kennen.
Die therapeutischen Möglichkeiten durch die Homöopathie sind bis heute noch kaum erkannt, geschweige ausgeschöpft; es gibt gerade für die Tierhomöopathie noch unendlich viel zu erforschen.
Die homöopathische Medizin wird noch heute häufig verunglimpft, belächelt und nicht ernst genommen. Die Ursache dafür wurzelt in mangelndem Verständnis: Die akademische Medizin denkt überwiegend pauschal in Paradigmen des materialistischen, kartesianischen Denksystems: Wenn die Bakterien beseitigt sind oder wenn die Laborbefunde stimmen, sei der Patient gesund. Dass dieses Postulat keineswegs immer stimmt, haben viele Menschen am eigenen Leib oder bei ihren Tieren bereits erlebt.
Mit der Homöopathie werden die selbstgesteuerten, vernetzten und rückgekoppelten Lebensvorgänge reorganisiert; damit dient sie als eine Regulationstherapie der Erhaltung oder Wiederherstellung des Lebens.
Den Krankheitserregern wird durch das aktivierte Immunsystem ihre Tätigkeit und Auswirkung entzogen, die Hormondrüsen werden zur normalen Funktion stimuliert und das erkrankte Gewebe regeneriert.
Die Homöopathie zielt damit nicht primär auf mechanische Reparaturen, sondern stellt die übergeordnete energetische Steuerung wieder her. Durch die optimierte Selbstregulation werden z. B. Infektionen oder organische Funktionsstörungen überwunden.
Auch die Heilung nach chirurgischen Maßnahmen kann durch passende Homöopathika wesentlich unterstützt werden.
Die Grenzen der Homöopathie bestehen im Reaktionsmangel des schwerstkranken Organismus, wenn eine Selbstregulation eingeschränkt oder nicht mehr möglich ist:
Bei erschöpfter Lebenskraft in hohem Alter, bei irreparablen Schäden organischer Art oder im bereits fortgeschrittenen Krankheitsgeschehen ist keine Wiederherstellung der Gesundheit möglich.
Hier kann die Homöopathie bestenfalls noch lindernd eingreifen.
Mitunter ist es schwierig, das optimal passende Homöopathikum zu finden. Wenn im lebensbedrohlichen Zustand kein Simile identifiziert werden kann, muss zunächst schulmedizinisch behandelt werden; erst anschließend können weitere homöopathische Überlegungen zum Herausfinden des geeigneten Mittels getroffen werden, das die Regeneration des Patienten ermöglicht.
Aufbau des Buches
Kapitel 1 – Einführung
In diesem Kapitel geht es um Angaben zum Inhalt und Gebrauch des Buches, um Daten und Bedürfnisse der Katze.
Kapitel 2 – Homöopathische Grundlagen
Die Basis jeder homöopathischen Behandlung ist durch ihre theoretischen Grundlagen gegeben.
Ohne Kenntnis dieser Grundlagen fehlt das Verständnis für eine sinnvolle Anwendung der homöopathischen Medizin!
Die erfolgreiche homöopathische Therapie setzt nicht nur die genauen Kenntnisse der Medizin und der homöopathischen Arzneien voraus, sondern auch die Kenntnis des therapeutischen Vorgehens!
In mangelnden Grundkenntnissen wurzeln die Ursachen für falsche Verordnungen, die dem Patienten möglicherweise mehr schaden als nutzen.
Das Studium der kurz gefassten Einführung in das Wesen der Homöopathie und Anwendung ihrer Arzneien bildet die Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz dieses Buches.
Der fundiert ausgebildete Homöopath muss jedoch über weitaus differenziertere Kenntnisse verfügen, als sie im Rahmen dieses Buches erklärt werden können (Literatur 6, 20, 22, 23, 24, 31, 50, 58 u. a.).
Dieses Kapitel kann und will also keineswegs das gesamte eigene Grundlagen-Studium der homöopathischen Medizin ersetzen!
Sektion 2 – Die homöopathische Behandlung von Katzen
Das Kapitel umfasst die Darstellungen der wichtigsten Erkrankungen der Katze mit den häufigsten infrage kommenden homöopathischen Arzneien.
Für die Anwendung dieser Arzneien sind entsprechende Indikationen, Modalitäten und Vorschläge für Dosierung und Potenzen angegeben. Letztere sind keineswegs bindend, sondern als ungefähre Richtlinien anzusehen; Abweichungen sind nach Art der individuellen Reaktion des Patienten immer möglich und in jedem Fall besonders zu bedenken.
Speziell die großen Kapitel (z. B. Verletzungen, Verdauungsapparat) sind folgendermaßen gegliedert:
• Kurze allgemein verständliche Erklärungen der jeweiligen Erkrankungen
• Fragestellungen zur Fallaufnahme (Anamnese)
• Übersicht und Kurz-Repertorium zu den wichtigsten infrage kommenden Arzneien
• Beschreibung der einzelnen Arzneien
Sektion 3: Arzneimittellehre für die Katze
Diese Sektion enthält die Beschreibung der wichtigsten homöopathischen Arzneien in Form einer kurz gefassten Arzneimittellehre, speziell ausgerichtet auf die Katze.
Es ist nicht möglich, alle erwähnten Homöopathika erschöpfend darzustellen; darum sei hier auf die homöopathischen Arzneimittellehren der Human-Homöopathie verwiesen sowie auf die der Veterinär-Homöopathie.
Für präzise Arzneimittelwahl benötigt jeder Homöopath ein Repertorium.
Sektion 4: Verzeichnisse
Dieser Abschnitt liefert Verzeichnisse mit Seitenangaben zu bestimmten Themenbereichen:
Ein ausführliches Glossar mit Erklärungen von medizinischen und homöopathischen Fachbegriffen, ferner zwei Sachverzeichnisse, ein Arzneimittelverzeichnis, ein Abbildungsverzeichnis sowie Literaturangaben
Kurze Anleitung zum homöopathischen Vorgehen
Die folgenden Empfehlungen richten sich speziell an Tierbesitzer und angehende Homöopathen, die noch über wenig eigene Erfahrung verfügen:
STUDIUM DER GRUNDLAGEN
Studieren Sie bitte das Kapitel 1, Einführung, Abschnitt Die Katze – Wesen – physiologische Daten, Seite 7, und anschließend das Kapitel 2, Homöopathische Grundlagen, Seite 20, damit Sie sich mit dem Denken der Homöopathie vertraut machen.
Vielleicht haben Sie bereits mit homöopathischen Arzneien behandelt.
Dennoch ist es für die erfolgreiche Therapie unbedingt notwendig, sich genauestens mit den Regeln und Gesetzmäßigkeiten der Homöopathie vertraut zu machen.
Falsch eingesetzte und zu häufig gegebene homöopathische Arzneien können den Patienten kränker werden lassen als zuvor (siehe Kapitel 2, Abschnitt Falsche Anwendung der Homöopathie, Seite 70).
Jede Medizin hat ihre Vorschriften und Regeln hinsichtlich Anwendung und Dosierung von Arzneien.
Ohne Kenntnis der homöopathischen Grundlagen sind Sie in der Therapie des Patienten verloren.
Die homöopathische Medizin behandelt den individuellen Patienten, das individuelle Kranksein, mit einer individuell gewählten und individuell dosierten Arznei; sie behandelt nicht eine Krankheit nach pauschaler Bezeichnung mit einem pauschal dafür gewählten Präparat – dessen Indikation vielleicht auf dem Beipackzettel, auf einer Indikationsliste des Herstellers oder in manch einer Tierzeitschrift angegeben ist.
FALLAUFNAHME
Nachdem Sie diese Einführung im Kapitel 2, Homöopathische Grundlagen, Seite 20, studiert haben, schreiben Sie gemäß den angegebenen Fragen zur Anamnese (Fallaufnahme) Ihre Beobachtungen nieder und sortieren sie anschließend nach Themen, Schwerpunkten und besonders auffallenden Merkmalen.
Vielleicht gehen Sie anschließend direkt zu Ihrem Patienten und untersuchen oder beobachten gezielt gewisse Besonderheiten gemäß den Angaben des betreffenden Kapitels zur Anamnese bzw. der Arzneimittellehre. Dabei beachten Sie besonders das, was Ihnen jetzt ungewöhnlich oder »komisch« erscheint oder was Ihre Katze von einer anderen unterscheidet.
Vergegenwärtigen Sie sich auch – gemäß Anleitung – zusätzlich den Charakter und das Verhalten Ihrer Katze. Schreiben Sie diese Beobachtungen nieder!
Das Aufschreiben ist deshalb wichtig, weil der niedergeschriebene Text Ihnen die Problematik wesentlich gründlicher vor Augen führt, als wenn Sie sich diese nur »denken« und anschließend »nicht vergessen wollen«.
Wenn das geschehen ist, ziehen Sie im schwierigen Fall eine zweite Person zu und gehen Sie mit dieser nochmals Ihre Beobachtungen durch. Ihre Wahrnehmungen werden sich vertiefen und präzisieren, andere verlieren möglicherweise an Bedeutung.
HERAUSFINDEN DES SIMILE
Jetzt erst machen Sie sich auf die Suche nach einer passenden Arznei!
Wenn eine brisante oder lebensgefährliche Situation vorliegt, ist es sehr nützlich, wenn Sie bereits vor der Therapie über die Homöopathie und ihre Vorgehensweise informiert sind.
Es ist schwierig, im Akutfall den »eigenen Angehörigen« – das eigene Haustier – selbst homöopathisch zu behandeln.
Darum arbeiten Sie am besten mit einer ruhigen, besonnenen Person zusammen, die ihre kranke Katze in diesem Fall nicht unbedingt kennen muss, jedoch ein wenig »Katzenverstand« mitbringen sollte.
RICHTLINIEN FÜR DIE THERAPIE
Das erste Gebot lautet:
Nerven behalten, Abstand gewinnen, das eigene Tier wie ein fremdes ansehen, sonst sieht man »den Wald vor Bäumen« nicht mehr!
Was ist im Akutfall jetzt aktuell? Was muss als erstes besser werden?
Bitte betrachten Sie dies aus der Sicht der Katze, nicht aus der Sicht der Ansprüche des Besitzers oder seiner Kinder! Die kranke Katze möchte Ruhe haben und nicht z. B. von anderen Haustieren, von Kindern oder überbesorgten Besitzern belästigt werden!
Das zweite Gebot:
Beobachtungen aufschreiben, diese dann genau und kritisch überdenken, am besten gemeinsam mit einer zusätzlichen Person!
Dann erst überlegen Sie das passende Arzneimittel und geben es dem Patienten.
Bitte notieren Sie sich die gegebene Arznei, deren Potenz, Dosierung sowie Datum und evtl. Uhrzeit!
Das dritte Gebot:
Der weitere Verlauf muss genau beobachtet werden.
Im Akutfall registrieren Sie – je nach Situation – stündlich oder alle 6 bis 12 Stunden, ob und was sich verändert hat.
Die Reaktion des Patienten ist ausschlaggebend für die weitere Dosierung der Arznei.
Wenn sich im Akutfall gar keine Besserung zeigt, wurde wahrscheinlich ein nicht passendes Homöopathikum gegeben. Dann schreitet die ursprüngliche Krankheit weiter fort und gibt dann umso deutlichere Anhaltspunkte für die Wahl eines besser passenden Arzneimittels.
Im chronischen Fall sollte der Verlauf der Heilung ebenfalls in gewissen Abständen – ebenfalls am besten schriftlich – verfolgt werden. Dazu führen Sie am besten eine Kartei und schreiben auf, wann, aufgrund welcher Symptome welches homöopathische Arzneimittel in welcher Dosierung gegeben wurde und wie der Patient reagiert hat.
Ein größerer Katzenbestand bzw. eine homöopathische Praxis setzt das Führen eines genauen Dossiers von jedem einzelnen Tier voraus.
Falls sich dieselbe Erkrankung irgendwann wiederholen sollte, dann lässt sich nachvollziehen, welches Mittel bei welchem Tier bzw. bei welcher individuellen Erkrankung wirksam gewesen ist.
Zusätzlich wächst durch rekapitulierte Erfahrungen Ihr Vertrauen und Fachkenntnis in der Homöopathie.
Und wenn Sie einen homöopathischen Spezialisten hinzuziehen, wird Ihre Aufzeichnung seine Arbeit ungemein erleichtern.
Das erste Verbot:
Lassen Sie sich nicht von ängstlichen Mitmenschen beeinflussen und in Panik versetzen. Im Zweifelsfall sollten Sie natürlich den Tierarzt hinzuziehen; dennoch können Sie im kritischen Fall bis dahin bereits homöopathische Erste Hilfe einleiten.
Berücksichtigen Sie, dass Sie eine Pharmakotherapie, die Ihnen widerstrebt, ablehnen dürfen, sofern sie nicht zur Erhaltung des Lebens unbedingt notwendig ist.
Das zweite Verbot:
Geben Sie niemals in panischer Angst Hals über Kopf die nächstbeste homöopathische Arznei – und dann noch eine, weil Sie vielleicht meinen, »viel hilft viel«: Der Organismus kann nicht auf mehrere Reize gleichzeitig adäquat reagieren und Sie können dann weder seine Reaktion einschätzen, noch einen beginnenden Heilungsvorgang beurteilen. Die Symptome verschwimmen und eine wirksame homöopathische Therapie ist nicht mehr möglich.
Solche aus homöopathischer Sicht »verdorbenen Fälle« sind entweder gar nicht oder erst nach mehreren Wochen des Abwartens homöopathisch zu therapieren.
In solchen Fällen muss zunächst schulmedizinisch behandelt werden.
Eine sichere Arzneimittelwahl ist ebenfalls nicht möglich, wenn der Patient unter dem Einfluss starker »Schmerzmittel« bzw. »Entzündungshemmer« (NSAID, siehe Glossar) steht, weil diese die wahlanzeigenden Symptome verschleiern.
Die passende homöopathische Arznei wirkt besser als jedes »Schmerzmittel« und erzeugt keine zusätzlichen »unerwünschten Nebenwirkungen«.
Die Katze – Wesen – physiologische Daten
WESEN UND KONSTITUTION DER KATZE
Vor ca. 5000 Jahren begann die Wildkatze zum Freund des Menschen zu werden.
Im Gegensatz zum Gefährten »Hund« hat sie sich eine gewisse Eigenständigkeit erhalten: Sie kann durchaus ohne den Menschen in der freien Natur leben und sich ausschließlich von Feldmäusen oder Vögeln ernähren.
Die »zugelaufene« Katze sucht sich »ihren Menschen« selbst aus, nachdem sie sich (möglicherweise) ihren bis dahin unliebsamen Bezugspersonen entzogen hat.
Die reine Wohnungskatze ist jedoch »ihrem Menschen« und seinen Einflüssen meist zeitlebens »ausgeliefert«.
»Rassekatzen« verfügen häufig nicht mehr in vollem Masse über die ursprünglichen Katzen-Eigenschaften; sie sind auf das Leben mit Menschen angewiesen und damit im wahrsten Sinn zur »Hauskatze« geworden.
Verhalten und physiologische Daten sollten jedem homöopathischen Katzen-Therapeuten geläufig sein. Abweichende Besonderheiten zu beobachten und zu registrieren, bilden die wichtigsten Bestandteile der homöopathischen Anamnese.
Die Raubtiermerkmale der Katze sind unverkennbar: Das Raubtiergebiss, die spitzen Krallen, die rasante Reaktionsfähigkeit und die enorme Sprungkraft sind auf Beutefang ausgerichtet, sogar das scheinbar harmlose Spiel mit dem sprichwörtlichen Wollknäuel deutet Aggressivität an.
Eine Entsprechung zu dieser Aggressivität kann man in den »primär aggressiven« und destruktiven Erkrankungen vieler Katzen vermuten, die sich in Erkrankungen der »aggressiven Abwehr« des Immunsystems äußern können. Viele Erkrankungen der heutigen Katze verlaufen »primär aggressiv« und destruktiv.
PHYSIOLOGISCHE DATEN DER KATZE
Die Körpertemperatur der Katze sollte unter 39 °C liegen, oberhalb davon beginnt das Fieber.
Die Blutmenge der Katze beläuft sich auf ca. einen halben Liter Blut; das ist wichtig zu wissen im Fall einer starken Blutung.
Die Herzfrequenz beträgt ca. 120 bis 130 Schläge, die Atemfrequenz liegt bei 20 bis 30 Atemzügen pro Minute, im Tiefschlaf liegt die Atemfrequenz niedriger.
Das Haarkleid sollte geschmeidig, glatt und glänzend sein. Verfilzungen sind bei kurzhaarigen Katzen ein Zeichen mangelnder Gesundheit.
Die gesunde Katze pflegt sich täglich regelmäßig zu putzen, teilweise verbunden mit dem »zwanghaften« Bemühen, den eigenen Duft zu verbreiten und um quasi jedes einzelne Härchen zu sortieren.
Das Körpergewicht richtet sich nach der Größe der Katze (2,5 bis 8 Kg). Sie sollte jedoch nur so viel »Speck auf den Rippen« tragen, dass man problemlos beim Streicheln die Rippen tasten kann. Viele Hauskatzen leiden heute unter Adipositas (Fettsucht) – meist eine Folge von Bewegungsmangel oder / und übermäßiger Futteraufnahme.
Das »Depotfett« befindet sich – besonders ausgeprägt im Winter – als weiche, hängende Masse am Bauch.
Lebenserwartung der Katze: Gemäß Fachliteratur gilt die Katze zwischen 12 und 15 Jahren bereits als »alt«, viele Katzen werden jedoch wesentlich älter! Meine älteste Katzenpatientin starb im Alter von 26 Jahren eines natürlichen Todes (siehe Kapitel 21, Anna – 25-jährige Katze mit erstickender Atmung, Seite 622).
Katzen werden also im Durchschnitt etwas älter als die meisten Hunde.
Jeder Tierbesitzer – Katzenbesitzer – sollte sich beim Anschaffen eines solchen Hausgenossen bewusst sein, dass er für die nächsten eineinhalb Jahrzehnte die Verantwortung für dieses Tier zu tragen hat.
Bewegungspparat: Die Katze ist ein Zehengänger, im Vergleich zum Menschen läuft sie – wie der Hund – auf den unteren drei Finger- bzw. Zehengliedern. Die Krallen sind im Normalfall durch die Zugwirkung der Strecksehne eingezogen und nicht sichtbar. Bei alten und kranken Katzen beobachtet man in diesem Bereich eine Schwäche, indem zumeist die Krallen der Hinterzehen nicht mehr ganz eingezogen werden – ein möglicherweise wichtiges homöopathisches Symptom.
Die Gliedmaßen der Katze zeichnen sich durch eine starke Winkelung aus. Das verleiht der Katze einerseits die bekannte enorme Sprunkraft, begünstigt aber andererseits das Entstehen von Gelenkerkrankungen.
Nicht umsonst spielt die Katze im Bereich des Aberglaubens eine bedeutende Rolle.
Diese Katze hat all ihre »Antennen« »ausgefahren« und beobachtet neugierig ihre Umgebung.
In diesem Fall eine Phosphorus-Katze, aber auch andere Katzen können diesen Ausdruck zeigen.
Gespannter Ausdruck einer wilden, freilebenden Katze, hier in hektischer Eile und augenblicklich fluchtbereit.
Die eng stehenden Ohren zeigen Stress und Erregung des Tieres an.
Ich hatte für das halb verhungerte Tier gerade etwas Fisch zur Hand, was sie gierig verschlang. Während des Schluckens warf sie angstvolle Blicke in die Umgebung.
Kaum war der Teller leer, verschwand sie in hektischen Sprüngen.
Am nächsten Tag – um die gleiche Zeit – war sie wieder da und verlangte jetzt schreiend nach Futter. Ich musste erst den Teller mit Fisch parat machen. Währenddessen warf sie sich immer wieder gegen meine Beine, um sich daran zu reiben. Aber bereits vor der Berührung mit meiner Hand schlug sie augenblicklich aggressiv und knurrend mit den Krallen (Angst-Aggression).
Wahrscheinlich eine Arsenicum-Katze:
• Verlangen nach Gesellschaft, aber Abneigung dagegen
• Panische Angst, dass etwas passiert
• Angst verletzt zu werden (?)
Unten dagegen zwei neugierig angespannte junge Kätzchen auf dem Untersuchungstisch.
Geschlechtsreife: Der Kater kann schon ab einem Alter von 6 Monaten geschlechtsreif werden, die weibliche Katze erlebt meist im Alter von ca. 9 Monaten ihre erste Rolligkeit. Edelkatzen sind i. d. R. später geschlechtsreif.
Die Tragzeit der Katze beträgt ca. 61 bis 64 Tage. Sie wirft im Normalfall 3 bis 6 Welpen, anfangs noch kaum zur Fortbewegung fähige, zahnlose und blinde »Nesthocker«.
Die jungen Kätzchen sollten wegen prägender Sozialisierung durch Mutter und Geschwister erst ab der 12. Lebenswoche an ihre zukünftigen Besitzer abgegeben werden.
Eine frühere Abgabe bildet häufig die Voraussetzung für späteres unerwünschtes Verhalten.
Kastration: Kater sollten – wenn nicht zur Zucht vorgesehen – ab der Geschlechtsreife kastriert werden.
Weibliche Katzen sollten frühestens ca. 2 Wochen nach der ersten Rolligkeit kastriert werden.
Eine Kastration während der Rolligkeit bringt wegen erhöhter Blutungsneigung sowohl dem Chirurgen als auch der Katze unnötigen Stress.
Die Entwicklung der Geschlechtshormone leistet – auch bei der Katze – einen wichtigen Beitrag zum »Erwachsenwerden«.
SINNESSYSTEM DER KATZE
Das Jagd- und Raubtier »Katze« verfügt über ein äußerst sensibles Sinnessystem, dessen Wahrnehmungsvermögen das des Menschen in vieler Hinsicht bei Weitem übertrifft (Literatur: 37, 63):
Das Auge mit dem Sehvermögen ist der schärfste Sinn der Katze. Am besten sieht sie bei Tageslicht und in der Dämmerung.
Die Augen fungieren als eine Art hochsensibler »Bewegungsmelder«: Jede ungewöhnliche Bewegung eines Grashalms könnte ein verborgenes Beutetier signalisieren.
An der Netzhaut befindet sich – wie beim Hund – das Tapetum lucidum, das frontal einfallendes Licht hellgelb reflektiert. Im Dunkeln kann dieser Anblick durchaus gespenstisch wirken, wenn scheinbar aus dem Nichts plötzlich zwei hell leuchtende Augen auftauchen. Dieses Phänomen hat sicherlich zu dem mystischen bzw. abergläubischen Aspekt beigetragen, der bereits im Mittelalter der Katze zugeordnet wurde und als »Katzensabbat« viele Katzen das Leben gekostet hat.
Die Nickhaut, das dritte Augenlid, fungiert als eine Art »Scheibenwischer« für das Auge. Eine vorgefallene Nickhaut der wachen Katze ist fast immer ein Krankheitszeichen, z. B. für starken Wurmbefall oder für eine andere schwere Erkrankung.
Panische Angst kann sich auch im hellen Licht durch extrem weit gestellte Pupillen zeigen, die dann kaum noch auf das Licht der untersuchenden Taschenlampe reagieren.
Bei der entspannten Katze sind die Pupillen im hellen Licht nur als schmale, senkrechte schwarze Striche in der (zumeist) gelblichen Iris erkennbar.
Solche Beobachtungen sind für die homöopathische Fallaufnahme wichtig.
Gehör und Gleichgewichtssinn sind das zweitwichtige Sinnesorgan der Katze. Sie kann Frequenzen bis zu 650 kHz wahrnehmen, der Mensch nur bis ca. 25 kHz.
Der Ausdruck der entspannten Katze: Die Ohren sind seitlich gestellt, die Augen halb geschlossen.
Voll Vertrauen und schnurrend sitzt die Pulsatilla-Katze auf dem Untersuchungstisch.
Auf diese Weise versteht sie z. B. die »Unterhaltung« der Mäuse zu orten, um sie dann sicher für den Fang ins Visier nehmen.
Der ausgeprägte Gleichgewichtssinn verhindert – gemeinsam mit den kraftvollen, spitzen Krallen – das Herabfallen von schwankenden Baumästen. Bei einem Sturz aus der Höhe sorgt er dafür, dass die Katze fast immer auf den Pfoten landet.
Aber glatte oder glitschige Oberflächen – wie ein metallenes Fensterbrett oder die Behälter mit Altöl der Autowerkstatt – lassen jede noch so geschickte Katze stürzen. Vergiftungen mit Altöl sind nicht selten und können dieselben fatalen Vergiftungen auslösen, wie sie von der »Ölpest« der Meeresvögel bekannt sind.
Das Geruchsorgan ist ein weiterer Schwerpunkt im Katzen-Sinnes-System.
Alles Fremde, insbesondere etwas Fressbares, wird intensiv und äußerst misstrauisch berochen.
In der Praxis sind Katzen bei Weitem nicht so leicht durch Leckerli zu bestechen wie der Hund!
Tastsinn: Die Katze verfügt über einen ausgeprägten »Tast-Sinn«, entsprechende Organe finden sich nicht nur in den »Tasthaaren« (Schnurr- oder Sinushaaren), sondern auch an Ohren und Pfoten.
KÖRPERSPRACHE UND AUSDRUCKSVERHALTEN
Das Ausdrucksverhalten der Katze zu erkennen, bildet für die Bewertung der homöopathischen Anamnese einen wichtigen Gesichtspunkt.
Die Körperstellung dient der Kommunikation mit der Umwelt. Weil diese der des Hundes weitgehend widerspricht, kommt es infolge von »Missverständnissen« zu der sprichwörtlichen Feindschaft zwischen Hund und Katze.
Die Katze verfügt über eine ausgeprägte Mimik, die allerdings bei langhaarigen Tieren für den Menschen nicht immer leicht zu erkennen ist.
Die Stellungen von Ohren, Lippen, Schnurrhaaren und Schwanz signalisieren uns die »Stimmung« der Katze, die je nach Temperament unterschiedlich deutlich gezeigt werden:
Die »Schnurrhaare«, besser »Sinushaare«, wirken wie »Antennen« für Sinnesreize und dienen gleichzeitig dem Ausdrucksverhalten. Je nach Temperament der Katze können sie bei gespannter Aufmerksamkeit so weit nach vorn aufgestellt werden, dass sie die waagerechte Linie der Nasenspitze überragen. Bei besonders empfindsamen und temperamentvollen Katzen, die eines der übersensiblen, extrovertierten konstitutionellen Mittel (Phosphorus, Arsenicum, Ignatia, Lachesis, Tuberculinum o. a.) benötigen, kann dieses Phänomen besonders deutlich beobachtet werden.
Ruhigere oder phlegmatische Katzen zeigen diese Mimik seltener oder nur dann, wenn ganz besonderes Interesse geweckt wird.
Seitlich hängende Schnurrhaare signalisieren Gleichgültigkeit oder Desinteresse.
Auch die Stellung der Ohren vermittelt die Stimmung: Bei der »gestressten Katze« werden die Ohren zum engen Zusammenstehen ausgerichtet , bei der entspannten oder trägen Katze stehen sie eher seitlich vom Kopf ab.
Jeder kennt die furchterregende Mimik einer bösen Katze, die mit entblößten Zähnen, aufgerissenem Maul, mit flach angelegten Ohren und Schnurrhaaren giftig spuckende Aggression herausfaucht.
Die Mimik findet ferner ihren Ausdruck durch die Stellung des Schwanzes.
Auch er gehört zum »Stimmungsbarometer«. Jeder Katzenbesitzer kennt die buschig aufgestellten Schwanzhaare beim Imponiergehabe, den senkrecht erhobenen »Triumph-Schwanz« nach erfolgreichem Mäusefang oder den nervös »peitschenden« Schwanz bei Aufregung.
Der Schwanz-Stellreflex beim Kraulen der Kruppe gibt uns oft einen ersten Aufschluss, wie schwer krank unser Patient ist: Fehlt dieser Reflex, dann ist mit schwerer Krankheit zu rechnen.
Das Lautgeben umfasst ein weites Spektrum der Kommunikation mit der Umwelt – für die Homöopathie ein ebenfalls auffallendes Zeichen. Es gibt ausgesprochen »geschwätzige« Katzen, mit denen man sich regelrecht unterhalten kann (Lachesis, Phosphorus); andere Katzen müssen uns sofort mitteilen, dass sie jetzt »da« sind (Lycopodium, Pulsatilla); jammernde Katzen signalisieren uns: »Was soll ich machen?« (z. B. Pulsatilla). Auch die Stimmqualität kann uns wesentliche Hinweise auf die homöopathische Arznei geben: Es gibt heisere oder stimmlose Katzen (z. B. Phosphorus, Lachesis, Causticum), laute orgelnde Stimmen mit zunehmender Intensität (Lachesis); ärgerliche, fauchende Stimmen (z. B. Arsenicum, Nux vomica, Bryonia, Chamomilla, Staphysagria) und schließlich noch die schweigsamen Katzen wie z. B. Natrium muriaticum, Acidum phosphoricum, Ignatia oder Lachesis etc.
LIEBLINGSPLÅTZE DER KATZE
Katzen bevorzugen – ebenso wie z. B. Bienen und Ameisen – solche Sitz- und Liegeplätze, die für uns Menschen als »geopathisch« eingestuft werden. Das können Verwerfungen der Erde, Wasseradern oder Kreuzungen des Curry-Gitters o. ä. sein.
Hunde dagegen vermeiden solche geopathisch belasteten Orte.
Das Bett des Besitzers genießt jedoch – wie beim Hund – den größten Vorzug.
DAS VERHALTEN UND DER »7. SINN« DER KATZE
Schließlich verfügt die Katze zusätzlich zu ihren Sinnesorganen über einen »7. Sinn«. (Literatur 68).
Viele Katzen sind »hellsichtig« oder »hellfühlend«; d. h. sie nehmen Geschehnisse wahr, die uns unerklärlich erscheinen.
So besitzt sie einen »magnetischen Sinn«, der sie Magnetfelder oder Erdbeben vorausfühlen lässt. Nach einem Wohnungswechsel der Besitzer kann sie mit diesem Sinn sogar über große Distanzen zurück »nach Hause« finden, wo sich ihr persönliches – vielleicht bevorzugtes – Territorium befindet.
Rupert Sheldrake (Literatur 68) berichtet z. B., die Katze stehe daheim nachweislich immer dann von ihrem Liegeplatz auf und lege sich auf dem Fensterbrett in Warteposition, sobald ihr Besitzer im 300 km entfernten Büro den Entschluss fasst, in sein Auto zu steigen und nach Hause zu fahren.
Katzen sind über alle Maßen sensibel für alle Einflüsse und Energien, die von ihren Besitzern, engen Bezugspersonen und ihrer Umwelt ausgehen.
Diese übermäßige Sensibilität ist häufig der Auslöser für Verhaltensstörungen, die bei unerwarteten Veränderungen im Katzenleben auftreten können ( Kapitel 20, Seite 576).
Ursprünglich dienen Urinieren und Kot-Absetzen zum Kennzeichnen des jeweiligen Katzenreviers.
Fühlt sich die Katze in ihrem psychischen Gleichgewicht gestört, wird sie das am häufigsten durch Markieren zur Schau tragen: Urinieren oder Kot-Absetzen in der Wohnung oder in unserem Bett kann – wenn nicht durch klinische Krankheit bedingt – durch einen für uns nicht ersichtlichen störenden Einfluss ausgelöst werden: Lappalien wie z. B. ein umgestellter Sessel, ein renoviertes Zimmer, eine neue Katzenkiste, ungewohnte Katzenstreu, aber auch einschneidende Ereignisse im Katzenleben wie eine bevorstehende Reise der Besitzer, ein neuer zwei- oder vierbeiniger »Nebenbuhler«, oder Übergabe der Katze an einen neuen Besitzer, können Unsauberkeit oder andere Verhaltensprobleme nach sich ziehen.
Weitere Faktoren können in der Empfänglichkeit der Katze für psychische »Traumen« bestehen, z. B. Streit in der Bezugs-Familie, demütigende Äußerungen über die Katze (»dieses blöde Vieh«), abweisende Stimmung oder Verhalten eines Familienmitglieds gegen die Katze, ein versehentlicher Fußtritt oder – schlicht und einfach – wenn sich die Katze in ihrer Präsenz nicht als genügend »gewürdigt« fühlt.
Ebensolche »Hysterie« kann sich in Fellknabbern, Kratzen an Teppich, Sofa oder Tapete oder Zerstören von Gegenständen (z. B. Gläser, Blumenvase) äußern.
Die Katze »spürt« im Allgemeinen genau, was wir vorhaben: Viele Katzenbesitzer haben es immer wieder beobachtet: Wenn ein Besuch beim Tierarzt angesagt ist, verschwindet die Katze rechtzeitig und tritt erst wieder auf, wenn der Termin verstrichen ist. Dasselbe kann passieren, wenn ein der Katze nicht genehmer Besuch angekündigt ist – etc.
DIE KATZE UND IHRE BEZUGSPERSONEN
Die Sensibilität der Katze reagiert meist intensiver als andere Haustiere auf die »Ausstrahlung« ihrer Besitzer.
Generell ist es aus der Tierpsychologie bekannt, dass Haustiere das »Spiegelbild ihrer Besitzer« darstellen: Je enger die Beziehung zwischen Haustier und Mensch, desto intensiver wird das Tier durch das Energiefeld des Menschen beeinflusst. Störungen in der Lebenskraft der Katze resultieren häufig aus »unbewussten Sendungen« ihrer Bezugsperson.
Ärger und Nervosität der Besitzer – z. B. durch Stress im Beruf – reflektiert die Katze z. B. durch unmotiviertes Knabbern oder Kratzen – ähnlich einzuschätzen wie etwa das Fingernägelkauen der Kinder – oder im Extremfall die Automutilation (Selbstzerstörung) durch Knabbern an der Haut (z. B. Leckekzem).
Ein Beispiel
Ein junges Pärchen lebte in bester Beziehung zueinander und zu ihren 5 Katzen – beide berufsmäßige Musiker mit regelmäßigen Übungsstunden daheim.
Nach einem heftigen Streit ging die Partnerschaft auseinander. Er musste in eine andere Wohnung umziehen, doch mit ihr allein blieb der fünffache Katzenfrieden bestehen.
»Lieben« Katzen Homöopathie?
Katzen suchen gern die Nähe homöopathischer Arzneien.
Eines Tages mussten die beiden in ihrer Wohnung miteinander zum letzten Mal eine Geigensonate üben. Sein Geigenkasten stand geöffnet hinter ihm. Nun stiegen alle Katzen hinter seinem Rücken in den Geigenkasten, um dort ausgiebig zu urinieren – eine hässliche Bescherung – waren die Katzen nur das »ausführende Organ« der ärgerlichen Katzenbesitzerin?
Im früheren friedlichen Beisammensein der beiden Partner war so etwas nie vorgekommen!
Die Wohnungskatze ist den Einflüssen ihrer Besitzer – ihrem »morphogenetischen Feld« (Sheldrake, Literatur 68) – permanent ausgesetzt, was mitunter zum Entstehen von Krankheiten beiträgt. Die Freigängerkatze dagegen kann sich als einziges Haustier ihren unangenehmen Bezugspersonen entziehen und sympathischeren »zulaufen«.
KATZEN UND HOMÖOPATHIE
Katzen haben eine besondere Affinität für die Homöopathie, wie es das nebenstehende Foto und auch das Titelbild zeigt. Es handelt sich hier nicht um gestellte Aufnahmen! Es ist immer wieder zu beobachten, dass Katzen die Nähe von homöopathischen Arzneien suchen.
Für die Homöopathie ist es besonders bei der Katze eindrucksvoll, die Reaktion auf die Arzneigabe zu beobachten.
Homöopathische Globuli werden am besten oral (durchs Maul) verabreicht.
Die Katze ist jedoch den süßen Geschmack der Globuli nicht gewohnt. Oder empfindet sie diese als geschmacklose Fremdkörper? Daher wird fast jede Katze durch diesen »Spontanangriff« auf das Maul (Eingabe der Globuli) irritiert, verängstigt oder gereizt reagieren.
Nach der Eingabe der Globuli werden wir die Katze ausgiebig loben und mit sanft zugehaltenem Maul an der Kehle kraulen, damit ihre Maulschleimhaut inzwischen die Arznei aufnimmt.
Waren die Globuli die »Richtigen«, d. h. stimmte die Arzneiwahl, wird die Katze nach wenigen Sekunden der Irritation sich mit angenehmem Gesichtsausdruck die Lippen lecken und die Globuli »lutschen« oder schlucken.
War es dagegen eine »falsche Verordnung«, wird die Katze sehr wahrscheinlich die Kügelchen vehement und im hohen Bogen – wie auch Pharma-Präparate – ausspucken. (Arsenicum-Katzen mit ausgeprägter Angst-Aggression sind hier ausgenommen, da wir die Globuli meist gar nicht erst ins Maul geben können!)
Ein ähnliches Experiment ist möglich, wenn die Arzneiwahl für die Katze nicht sicher ist: Die Globuli werden in ein Stück Papier (z. B. Papiertaschentuch) gewickelt und dieses mit Klebestreifen verschlossen. Anschließend legt man das kleine Päckchen auf den Sitzplatz bzw. unter die Katze: Handelt es sich um die heilende Arznei, wird die Katze schnurrend darauf sitzen bleiben; anderenfalls steht sie auf und sucht einen anderen Platz.
Aus zahlreichen Berichten ist folgendes bekannt: Die »hellfühlende« Katze sucht ihren kranken Besitzer oder Familienangehörigen, legt sich immer wieder an dessen Seite bzw. in die Nähe der kranken oder schmerzenden Stelle, was der kranke Mensch als angenehm und wohltuend empfindet.
Einzelne Beobachtungen zeigen erstaunlicherweise folgendes Phänomen:
Manche Haustiere, die emotional sehr intensiv mit ihrer Bezugsperson verbunden sind, reagieren zusammen mit dem Menschen wie ein einziger Organismus. Dabei ist es möglich, dass die Katze bzw. das Haustier – anstelle seines Besitzers erkrankt, sodass dieser gesund bleibt.
Wenn nun die kranke Katze stirbt oder euthanasiert wird, erkrankt erst dann der Besitzer selbst.
Das ist ein Phänomen, welches die »morphische Resonanz« (Literatur 67) bestätigt.
Jeder verständnisvolle Tierbesitzer mag sich vorstellen, welche Folgen nicht nur der Entschluss zur (nicht indizierten) Euthanasie, sondern auch dessen Durchführung nach sich ziehen!
DIE FÜTTERUNG DER KATZE
Die Katze ist grundsätzlich ein Fleischfresser: Sie hat einen höheren Eiweißbedarf als beispielsweise der Hund. Dagegen benötigt sie weder pflanzliche Stoffe, noch andere Kohlenhydrate. Die Magensäure der Katze ist schärfer als die des Menschen; sie ermöglicht es, auch die knöchernen Bestandteile einer Maus oder eines Vogels zu verdauen. Im Gegensatz zum Hund wird es nicht gelingen, die Katze rein vegetarisch zu ernähren, da einige für sie essentiellen Bestandteile des Fleisches nicht über pflanzliche Nahrung gedeckt werden können.
Wer seine Katze zum Vegetarier machen möchte, sollte sich besser einen Pflanzenfresser halten, nicht aber den kleinen »Tiger«!
Diese Tatsache steht häufig im Widerspruch zum konfektionierten Katzenfutter, das zum großen Teil aus pflanzlichen Stoffen besteht.
Zu diesem Thema gibt es ein sehr empfehlenswertes Büchlein von E. Grimm: »Katzen würden Mäuse kaufen« – kein Märchenbuch, sondern das »Schwarzbuch« des Tierfutters (Literatur 21). Hier wird nicht nur über Ernährung und Zusammensetzung des gängigen Katzenfutters, sondern auch über die chemische Zusatzstoffe im Futter für Hunde und Menschen informiert.
Wenn die »glückliche Katze« ihre Maus fangen darf, erlebt sie dabei aufbauenden »Eustress« (»Wohlfühlstress«): Sie lauert und starrt voller Faszination eine Ewigkeit auf das Mauseloch, die Sinne sind auf volle Aufmerksamkeit »geschaltet«, und wenn die Maus dann endlich auftaucht, wird sie voll intensiver Freude langsam und begeistert zu Tode gespielt. Das verletzt zwar unsere ethischen Gefühle, aber wenn wir die Maus »retten«, entgeht der Katze der Spaß, das stolze »Siegesgefühl« und damit die »emotionale Befriedigung«, ein essenzielles Bedürfnis aller Lebewesen.
Zum Schluss wird die sterbende Maus wollüstig zerbissen und – oft zum größten Teil – verspeist; oder sie wird uns als Siegestrophäe in stolzer Haltung mit »Triumphgeschrei« vor die Füße gelegt.
Wenn die Maus gesund und groß genug für die Sättigung war, legt sich die Katze für die nächsten Stunden zum »Verdauungsschlaf« nieder.
Wenn erneuter »Appetit« auf Mäuse aufkommt, wird die nächste Maus »verspielt«.
Weniger »sadistisch« veranlagte Katzen können sich auch mit einer Wollmaus zufrieden geben, erleben aber nicht das »Siegesgefühl« der erfolgreichen Jagd.
Der Fertigfutter-Katze dagegen entgehen solche Eustressfaktoren, ein zusätzlicher Anlass zum Faul- und Dickwerden:
Für sie stehen die als »lecker« beworbenen und katzengerecht »parfümierten« Trocken- oder Nassfutter (fachlich ausgedrückt: das »maskierte« Futter) meist permanent im Fressnapf zur Verfügung. Es ist für alle Beteiligten »bequem«, zwischendurch ein paar Maulvoll von diesen mit künstlichen Duftstoffen angereicherten Bröckchen zu nehmen, die Katze braucht sich nicht anzustrengen, bringt keine schmutzigen oder blutigen Pfoten nach Hause und schläft mit ihrem satten Bauch, bis der Appetit auf die nächsten »Katzen-Delikatessen« wieder angeregt wird.
Katzen sind jedoch keine »Dauerfresser« wie das Pferd.
Für die Katze bedeutet die immerdar bereitstehende Fertignahrung denselben Futteranreiz, den Kinder erleben, wenn ihnen ständig ein Buffet mit Schokolade, Eiscreme, Gummibärchen, Milchshakes oder die leckersten Fast-Food-Burger mit künstlich aufbereiteten Soßen (Geschmacksverstärker, Farbstoff) und synthetischen, »wertvollen« Vitaminen zur Verfügung stehen.
Das Ergebnis ist dasselbe wie für die Fertigfutter-Katzen: Trägheit, Fettsucht (»die 10-Kilo-Katze«), schließlich Stoffwechselstörungen mit Nierenerkrankungen, Leber- und Herzverfettung, ganz zu schweigen von Hormonstörungen, die u. a. durch Zusatzstoffe (z. B. auch Jod) oder mangelnde Lebensfreude gefördert werden.
Natürlich ist nicht jeder Katze der Zugang »zur Maus« möglich. Es gibt jedoch Alternativen, die aber »die Maus« dennoch nicht vollkommen ersetzen können:
Katzen lieben es, mit dem Futter »Beute-Fang-Spiele« zu veranstalten. Dafür eignen sich in der Wohnung z. B. gesäuberte rohe Hühnerherzen oder Hühnermägen, die – wenn sie genügend »tot gespielt« sind – mit den Reißzähnen zerschnitten und zerbissen werden können. Sie erfüllen so gleichzeitig den Sinn des »Zähneputzens« gegen Zahnstein-Ablagerungen.
Im Gegensatz dazu werden die zum »Zähneputzen« vorgesehenen konfektionierten »Bröckchen« meist nur einmal zerbissen und dann gierig im Stück abgeschluckt – und belasten dann Magen und Darm.
Als weitere Alternativen zum Fertigfutter könnte anderes Muskelfleisch (möglichst roh), Innereien, Fisch (am besten ebenfalls roh, auch aufgetauter Gefrierfisch), Hüttenkäse (ohne Jodsalz!) oder gekochtes Ei angeboten werden. Die Katze ist wählerisch und anspruchsvoll: Sie legt Wert auf wechselnde Geschmacksrichtungen, denn schließlich schmeckt auch jede Maus oder jeder Vogel ein wenig anders.
Dagegen ist das raffiniert beworbene Trockenfutter alles andere als artgemäß: Katzenmagen und -dünndarm sind nicht dafür konstruiert (ebenso wenig wie beim Hund), Trockenfutter stundenlang aufzuweichen. Dabei werden wertvolle Verdauungssäfte (z. B. Pankreasenzyme, Gallenflüssigkeit) sinnlos »verschwendet«; solche unnötigen Belastungen des Organismus führen zu vermehrter – allerdings individueller – Anfälligkeit für Erkrankungen. Eine gute Konstitution kann jedoch vieles ertragen!
Fleisch – bzw. »die Maus« – enthält ca. 70 bis 90 % Wasser; wie viel enthält das Trockenfutter?
Die Katze deckt ihren Flüssigkeitsbedarf normalerweise überwiegend aus ihrer fleischlichen Nahrung; insgesamt sollte sie täglich wenigstens 150 ml Wasser zu sich nehmen.
Das Trockenfutter benötigt aber zum Aufweichen zusätzliche Flüssigkeit, um auf das 3- bis 5-fache Volumen aufzuquellen; das ist oft mehr als die Katze durchschnittlich trinkt; die Folge ist eine negative Flüssigkeitsbilanz und harter Kot. Latenter Mangel an Flüssigkeit vermindert zusätzlich die Filtrationsleistung der Nieren und kann der Entstehung von Nierenkrankheiten und Blasensteinen Vorschub leisten.
Ein fadenscheiniges Argument, die Katze könne ja mehr trinken, wenn sie es brauche!
Das industriell hergestellte Nassfutter ist – was den Wassergehalt anbetrifft – das kleinere Übel, aber abgesehen von Wasser und Gelatine unterscheidet es sich inhaltsmäßig kaum vom Trockenfutter.
Auf dem 100 g-Katzenfutter-Döschen steht z. B. als besonders betontes Qualitätsmerkmal geschrieben: »Mit 5 % Rindfleisch« – 5 g sind ein halber Teelöffel; das übrige sind Pflanzenfasern (Kohlenhydrate), minderwertige Fette und »Nebenprodukte tierischer Herkunft«: Mehl aus Federn, Köpfen und Füßen von Hühnern, zermahlene Kuhklauen, Fischmehl (Restprodukte aus Fischfang und Fischverarbeitung) etc. Früher nannte man diese Stoffe »Abfall«.
Eine Katze würde niemals freiwillig Mehl aus Federn oder Klauenhorn anrühren! Unverdauliches aus der gefangenen Beute wird entweder gleich »ausgespuckt« oder später erbrochen.
Nach dem Tierfuttergesetz müssen die Herkunft der »Nebenerzeugnisse tierischer Herkunft« oder die (möglicherweise) gentechnisch hergestellten Produkte ebenso wenig wie Geschmacksverstärker (Glutamat) und andere Aroma- oder Farbstoffe deklariert werden.
Mit diesen »Nebenprodukten« kann logischerweise der Bedarf an natürlichen Vitaminen, Mineralstoffen und anderen essentiellen Stoffen nicht gedeckt werden, darum sind hier entsprechende Zusätze – z. B.Aminosäuren, Taurin u. a. – notwendig, die dann aber als besonders werbewirksam ausdrücklich definiert werden. Künstliche, rotbraune, fleischfarbene Farbstoffe übertünchen das ursprünglich fahlweiße synthetische Gemisch.
Diese Futtermittel sind der Gesundheit der Katze alles andere als zuträglich!
Das ebenfalls künstlich zusammengesetzte, teure »Diätfutter« soll dann den entgleisten Stoffwechsel regenerieren oder den Appetit zügeln – womit sich die »Katze in den Schwanz beißt«: Künstliche Duftstoffe regen den Katzenappetit an, deren Ergebnis – Fettsucht und Stoffwechselstörungen – soll das »Diätfutter« wieder in Ordnung bringen.
Das zugesetzte Jodsalz soll den faulen, verlangsamten Stoffwechsel bzw. die Schilddrüsenfunktion unterstützen. Aber gerade das leistet Vorschub für Schilddrüsen-Erkrankungen mit Unruhe, sinnlos aufgeregtem Verhalten und Abmagerung trotz vermehrter Futteraufnahme.
Viele Katzen verabscheuen Diätfutter und fressen dann lieber gar nichts – der beste Diätplan für die überfettete Katze.
Hier klinken sich dann die besorgten Katzenbesitzer ein und füttern wieder das vorgängige konfektionierte Futter – bedauernswerte kranke Katzen!
Viele Katzenbesitzer glauben fälschlicherweise der Werbung, das synthetisierte Futter sei besser als Fleisch- oder Fischfütterung! Folglich gab es noch nie so viele kranke Katzen (und andere kranke Haustiere) und noch nie so viele Tierärzte wie heute! Erkrankungen des Immunsystems waren vor 30 Jahren noch kaum bekannt!
Das »ausgewogene« und künstlich synthetisierte Futter kann als »Summe der Teile« bei weitem nicht das »Ganze« – die natürliche Nahrung – ersetzen.
Alle Stoffe, die der Katzennahrung heute als lebensnotwendig zugesetzt werden, kommen natürlicherweise auch im rohen Fleisch und Fisch vor und das in gut verfügbarer Form und natürlicher Zusammensetzung. Der gesunde Organismus resorbiert alles aus der natürlichen Nahrung was er braucht.
Katzen leben seit Jahrtausenden mit dem Menschen zusammen und bekamen noch nie eine derart »ausgewogene« Ernährung. Hätten die Hauskatzen ohne diese nicht schon seit Generationen Schaden nehmen müssen oder wären längst ausgestorben? Haben sie nicht schon seit jeher im Kuhstall von Milch und Mäusen gelebt?
Das konfektionierte Futter und speziell das Trockenfutter »ernährt« also nicht nur die Katze und die Futtermittelindustrie, sondern auch den Tierarzt und die Pharma-Hersteller.
Konfektioniertes Futter, insbesondere Trockenfutter, ist ein wesentlicher und unterschätzter pathogener Faktor für die Katze! Gleichzeitig zur homöopathischen Behandlung muss die Ernährung auf artgemäßes Futter eingestellt werden.
Dennoch sei ausdrücklich erwähnt:
Es gibt – vereinzelt – heute sehr gute Tierfutterzubereitungen, welche durchaus die physiologischen Bedürfnisse der Katze befriedigen – aber leider nicht das »Erlebnis Maus«.
KAPITEL 2
HOMÖOPATHISCHE GRUNDLAGEN
Allgemeines zur Homöopathie
Die homöopathische Medizin wurde vor mehr als 200 Jahren von dem Arzt, Pharmakologen und Chemiker Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) entwickelt.
Sie bildet ein eigenständiges medizinisches System mit Diagnose und Therapie und folgt – ebenso wie andere klassische Naturheilverfahren – einem Naturgesetz.
Das Grundgesetz aller Homöopathen gilt heute wie damals:
»Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt.«Lateinisch:»Similia Similibus Curentur.«Griechisch:»Homoion Pathos« – Homöopathie – »Ähnliches Leiden«
Das Kriterium der Ähnlichkeit bezeichnet also eine Beziehung zwischen dem pathogenen (die Krankheit erzeugenden) Reiz und dem therapeutischen Reiz durch die Arznei.
Mit anderen Worten ausgedrückt, bedeutet homöopathische Behandlung:
»Wähle in jedem Fall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden hervorrufen kann, als sie heilen soll!«.
Daraus folgt: Die Auswahl der Arznei für den Patienten geschieht nach individuellen Kriterien, welche die Charakteristik der Arznei zu den individuellen Krankheitszeichen und den persönlichen Eigenheiten des Patienten in Beziehung setzt.
Für die Wahl des geeigneten homöopathischen Mittels ist die medizinische Bezeichnung einer Krankheit also weitaus weniger wichtig als die subjektiven und objektiven Krankheitszeichen des Patienten.
Die Leitidee der »Heilung durch Ähnlichkeit« gab es bereits im Altertum bei Hippokrates (ca. 400 v. Chr.) und im Mittelalter bei dem berühmten Arzt Paracelsus (1494-1541), aber erst Hahnemann formulierte bindende Gesetze und Vorschriften für die praktische Anwendung der homöopathischen Medizin.
Die Homöopathie unterliegt damit nicht unklaren Spekulationen, sondern wissenschaftlich reproduzierbaren Kriterien.
Hahnemann’s Postulat:
»Die Heilung soll »schnell, angenehm, dauerhaft, sicher und nach deutlich einzusehenden Gründen geschehen«,
gilt als ethisches Grundprinzip eines jeden solide arbeitenden Homöopathen – gleichgültig, ob er Menschen, Tiere oder Pflanzen behandelt.
Dieses Ähnlichkeitsgesetz entspricht dem Jahrtausende alten Naturgesetz der Resonanz bzw. dem der Entsprechung, das bereits von dem weisen Hermes Trismegistos im Alten Ägypten oder früher – »bevor Abraham war« – beschrieben wurde.
Die Erfolge Hahnemanns sprechen für die Homöopathie: Er heilte schwerste Krankheiten wie Cholera, Ruhr, Malaria, Tuberkulose, schwerste Infektionen, Geisteskrankheiten und vieles mehr – wohlgemerkt ohne die heute üblichen Pharma-Präparate.
Werden die Prinzipien der Homöopathie richtig verstanden und angewendet, ruht in ihr für die Heilung vielfältigster Erkrankungen ein gewaltiges Potential, welches noch immer unterschätzt wird.
Negative Vorurteile, Fehlinterpretationen und mangelnde Kenntnisse führen dazu, die Homöopathie zu verunglimpfen und sogar lächerlich zu machen.
Wer sich jedoch um ihr Verständnis bemüht und ihre Grundlagen studiert, wird sie nicht mehr ablehnen können. Es gab zahlreiche Gegner der Homöopathie, die bei ihrem Studium »vom Saulus zum Paulus« wurden, d. h. vom radikalen Gegner zum einzigartigen Verfechter der homöopathischen Medizin.
Die Homöopathie erlebte ihre Blütezeit bis zum Beginn der Ära der Antibiotika, in der damals überraschend und ohne viel Überlegung des Therapeuten akute Krankheitssymptome beseitigt werden konnten, jedoch ohne damit eine grundlegende und dauerhafte Heilung zu erzielen.
Seit den letzten 50 bis 60 Jahren erfährt die Homöopathie erneut einen deutlichen Aufschwung: Viele Patienten bemerken, dass sich nach Pharma-Behandlung ihrer akuten Symptome anschließend chronische Krankheiten entwickeln. Diese widersetzen sich oftmals nachhaltig der weiteren schulmedizinischen Therapie – trotz aller aufwendigen Diagnostik. Darum verlangen viele Patienten vermehrt nach der Homöopathie.
Um die heilsame Wirkung der Homöopathie vollends zu erzielen, ist ihre genaue Anwendung, die den stringenten Gesetzen und Regeln von Hahnemann folgen, notwendig.
Er sagte dazu: »Macht’s nach, aber macht’s genau nach!«
Wer Hahnemann‘s Vorschriften vernachlässigt oder ignoriert, wird Misserfolge ernten oder Schäden verursachen.
Samuel Hahnemann schrieb sein wissenschaftliches Konzept in dem ORGANON der Heilkunst (Literatur 24) nieder, das in 291 Paragraphen die bindenden Richtlinien für die Anwendung der homöopathischen Medizin am Patienten in allen Einzelheiten beschreibt. J.T. Kent (1849-1916), einer seiner wichtigsten Nachfolger, schrieb dazu seine Kommentare, deren Lektüre grundlegend für jede ernstzunehmende Homöopathie-Ausbildung ist (Literatur 31); ferner gehören dazu die Werke »Die reine Arzneimittellehre« und »Die chronischen Krankheiten« von Hahnemann (Literatur 22 und 23).
Hahnemann hat bei seinem Schaffen und der Darlegung und Praktizierung der Homöopathie in erster Linie den Menschen im Blick. Aber er plädierte von Anfang an auch für die Anwendung am Tier. In neuester Zeit werden homöopathische Mittel sogar bei Pflanzen erfolgreich eingesetzt (Literatur 30, 42).
Für die Therapie hält die Homöopathie einen unerschöpflichen Schatz an Heilmitteln bereit, das gesamte Spektrum der Natur, um Krankheiten aller Art zu behandeln: Die Bandbreite reicht von Verletzungen und deren Folgen, Infektionen, Infektionskrankheiten, organischen Funktionsstörungen oder Organschäden, immunologischen Erkrankungen, psychischen bzw. Verhaltensstörungen bis zum Krebs.
Gerade bei der Behandlung von Krankheiten, die von der modernen Hochschulmedizin nicht geheilt werden können, wächst die Nachfrage nach der Homöopathie bei Menschen und Tieren.
Darüber hinaus sei erwähnt, dass es in der Homöopathie kein Problem mit »multiresistenten Erregern« gibt!
Die Lebenskraft
Die »Lebenskraft« wird seit jeher in allen traditionellen Medizin-Formen als Fundament des Lebens betrachtet.
Sie lenkt als oberste organisierende Instanz alle körpereigenen Vorgänge und hält jeden Organismus durch eine reaktionsfähige, ausgleichende Eigenregulation in gesunder Balance. Die Ziele sind Lebenserhaltung sowie psychisches und körperliches Wohlbefinden.
Bei Hahnemann heißt es dazu im ORGANON § 9:
»Im gesunden Zustand des Menschen – des Organismus – (Anmerkung d. Verfasserin) waltet die geistartige, als Dynamis den materiellen Körper belebende Lebenskraft unumschränkt und hält alle Teile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgang…«
Die Lebenskraft nutzt energetische Quantenphänomene für die Kommunikation mit den Zellen: Zahlreiche in Körperorganen verteilte Sensoren vermitteln der Lebenskraft – vergleichbar einer Steuerungszentrale – die Signale des Körpers; sie veranlassen entsprechende Regulations- und Reparaturvorgänge, die den Organismus gesund erhalten sollen.
Wenn pro Sekunde im menschlichen Körper 10 Millionen Zellen absterben und gleichzeitig wieder ersetzt werden, ist es angemessen, die Lebenskraft als eine mächtige, intelligente und formgebende Entität zu verstehen.
Sie gewährleistet damit die grundlegenden Vitalfunktionen (Bewusstsein, Atmung, Herz und Kreislauf, Ernährung und Ausscheidung), das Immunsystem (die körpereigene Abwehr) und regeneriert Schäden, die im Krankheitsfall oder im Laufe des Lebens eingetreten sein können; sie hält auch die Psyche in einem ausgeglichenen Wohlgefühl und sorgt für ein angemessenes Sozialverhalten.
Mit diesem Verständnis stellt jeder lebende Organismus ein selbst gesteuertes und selbstregulierendes System dar, das ein stabiles Gleichgewicht in seinen Körperfunktionen und seiner Gemütsverfassung anstrebt (Literatur 20, 50, 53, 77, 78).
Gerät die Lebenskraft durch schädliche Einflüsse (»Noxen«) aus dem Gleichgewicht, dann entstehen Störungen im geschädigten Bereich; Regulationsvorgänge geraten ins Stocken; der betroffene Organismus empfindet anfangs ein Unwohlsein und später lokalisierbare Beschwerden. Das Resultat sind letztlich schwer heilbare chronische Krankheiten.
Solche »Noxen« können in psychischen (z. B. Schreck, Angst, Kummer) oder physischen Einflüssen (z. B. Kälte, Verletzung, Vergiftung u. Ä.) bestehen. Ein solcher vorgeschädigter Organismus ist empfänglich für Krankheitserreger verschiedenartigster Ausprägung und damit ist der Weg z. B. für Infektionen bereitet.
Verliert die Lebenskraft ihr regulierendes Gleichgewicht, beginnt der Organismus Krankheitssymptome zu entwickeln. Diese Symptome erhalten lateinische oder griechische Namen, z. B. den des Entdeckers oder schlicht die Bezeichnung »Syndrom«, ein Sammelbegriff für ein komplexes Krankheitsgeschehen.
Wird die Lebenskraft durch Noxen aus dem Gleichgewicht gebracht, dann versucht sie zunächst, mit sinnvollen »Verteidigungsmaßnahmen« gegenzusteuern bzw. zu regulieren.
Zielgerichtete Reaktionen können sein:
• Formen der Ausscheidungen sollen schädliche Substanzen eliminieren, z. B. durch Erbrechen, Durchfall oder Haut-Ausscheidungen etc.
• Fieber beschleunigt alle Stoffwechselvorgänge mit dem Bemühen, vermehrt Abbauprodukte des Stoffwechsels (Toxine) auszuscheiden. Ab einer Körpertemperatur von 40 °C sterben Viren ab
• eine erhöhte Zahl an weißen Blutkörperchen (Leukozyten) ermöglicht das Abtöten von Krankheitserregern. Leukozyten fungieren als »Fresszellen« (Phagozytose) und gehen dabei zugrunde; die abgestorbenen Reste werden als Eiter ausgeschieden
• ein »Anschwellen« und »Verdicken« der erkrankten Region ist eine Strategie, die das weitere Ausbreiten von Krankheitserregern verhindern soll
• Hinken oder Lahmheit aufgrund von Schmerzen zeigen an, dass der erkrankte Körperteil geschont werden muss.
Viele – als krankhaft bezeichnete – Symptome resultieren also aus dem sinnvollen Bedürfnis der Lebenskraft, sich schädlichen Einflüssen zu widersetzen und eine Selbstheilung einzuleiten.
Symptome sind nie die Krankheit selbst, sondern nur die Folge oder der Ausdruck der Regulation durch die Lebenskraft.
Eine Therapie ist erst dann notwendig, wenn diese »Verteidigungsmaßnahmen« nicht ausreichen, bzw. wenn die Eigenregulation die Fähigkeit verloren hat, die Wiederherstellung zu erzielen.
Die Lebenskraft stellt die übergeordnete Instanz für die Gesundheit dar – gemäß Definition der World-Health-Organization:
»Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.«
Die heutige Hochschulmedizin berücksichtigt die Lebenskraft kaum: Sie ist materiell nicht messbar, sondern nur subjektiv am mehr oder weniger guten Wohlbefinden des Patienten zu erkennen.
Mit diesem Verständnis ist es nachvollziehbar, dass ein Beseitigen der Symptome nicht zur Gesundung führen kann. Erst wenn die Grundlage der Erkrankung, die gestörte Lebenskraft, sich wieder in Balance befindet, kann der Patient als geheilt betrachtet werden. Vorausgesetzt ist allerdings, dass schädigende Einflüsse beseitigt werden (z. B. schlechte Lebensbedingungen, falsche Ernährung, Kälte, Nässe, Ärger, Kummer etc.).
In einer zur Heilung führenden Therapie kann es daher nicht darum gehen, die Symptome zu beseitigen; vielmehr sollte die Lebenskraft in die Lage versetzt werden, die Ordnung im Organismus wieder herzustellen und aufrecht zu erhalten.
Voraussetzung für eine Genesung bildet in jedem Fall sowohl beim Menschen als auch beim Tier eine »gesunde Lebensweise«, die frei ist von krankmachenden Einflüssen.
Der entscheidende Unterschied zwischen Homöopathie und der derzeit anerkannten Hochschulmedizin ist also darin zu sehen: Die Hochschulmedizin richtet die Behandlung auf Symptome und Krankheitserreger; sie behandelt und beseitigt diese durch physische oder chemische Maßnahmen. Die Lebenskraft mit ihren körpereigenen Regulationsvorgängen bleibt davon jedoch weitgehend unberührt.