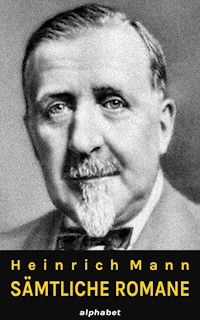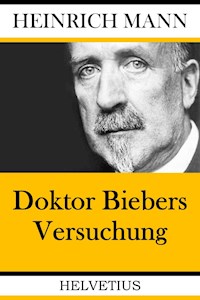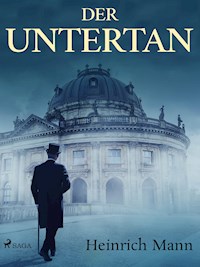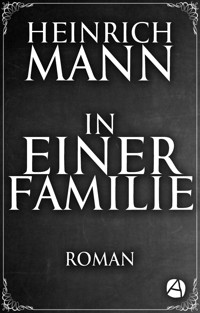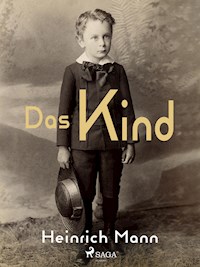
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinrich Mann über seine weltbekannte Familie: Anhand literarischer Texte sowie Briefe bekommen wir einen Einblick in die Lübecker Schriftstellerfamilie aus Sicht des älteren Bruders von Thomas Mann. Heinrich Mann teilt seine Kindheitserinnerungen sowie Ansichten über die Eltern, die Geschwister und deren Nachkommen, zeigt Blickwinkel und familiäre Beziehungen auf und lässt einen teilhaben an dem Leben und den Geschichten dieser Familie, aus der so viele namenhafte Schriftsteller*innen hervorgegangen sind.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Das Kind
Saga
Das Kind
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1929, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726885194
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
I. Der Maskenball.
Kindheitserinnerungen haben gewiß auch mein Leben beeinflußt, aber ich kann es nicht wissen, ich habe sie nicht in Form eines Katechismus gesammelt. Wenn mir eine einfallen soll, fallen mir viele ein. Ich wähle eine.
Winternachmittag im Lübeck der siebziger Jahre. Ich sehe eine Straße steil abfallen. Sie ist glatt gefroren und fast dunkel. Jede Gaslaterne beleuchtet nur das Haus, vor dem sie steht. Eine entfernte Flurglocke verkündet klappernd, daß jemand jenes Haus betrat. Ein Mädchen führt den kleinen Jungen, der ich bin. Ich reiße mich aber los, die Straße ist so eine herrliche Schlitterbahn. Ich gleite sie hinab, ich gleite schneller. Die Querstraße naht. Den Augenblick, bevor ich dort bin, tritt eine ganz vermummte Frau heraus, unter ihrem Tuch trägt sie etwas. Ich kann mich im Lauf nicht halten, ich fahre gegen sie, sie war nicht gefaßt auf den Anprall. Da es glatt ist, fällt sie. Da es dunkel ist, entkomme ich.
Aber ich habe Geschirr zerbrechen gehört. Die Frau trug unter ihrem Tuch Geschirr. Was habe ich angerichtet! Ich stehe, mir klopft das Herz. Das Mädchen ist endlich nachgekommen, ich sage: »Ich kann nichts dafür.«
»Die Frau hat nun kein Essen mehr«, sagt das Mädchen. »Ihr kleiner Junge auch nicht.«
»Kennst du sie, Stine?«
»Sie kennt dich«, behauptet Stine.
»Wird sie kommen und es meinen Eltern sagen?«
Stine bejaht es drohend, ich erschrecke.
Wir machen unsere Besorgungen, denn morgen wird zu Hause ein Fest sein, außerordentlicher sogar als jedes andere Fest: ein Maskenball. Dennoch vergesse ich den Rest des Tages nie ganz die Drohung, die hinter mir ist. Noch in meinem Bett horche ich, oh es läutet, ob die Frau kommt. Sie hat nun kein Geschirr mehr, ihr Junge kein Essen. Aber auch mir ist nicht wohl.
Nächsten Tages, als Stine mich aus der Schule holt, ist das erste, daß ich nach der Frau frage. »War sie da?« Das Mädchen besinnt sich, sagt nein, verheißt mir aber, die Frau werde mich sicher finden … Bis zum Abend fürchte ich es noch, dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses, das den Ball erwartet. Es ist überhell und es duftet nach Blumen, nach ungewöhnlichen Gerichten. Ich darf Mama bewundern. Schon kommen als erste Gäste ihre jungen Freundinnen samt dem Fräulein aus Bremen, das eigens herbeireiste, das bei uns wohnt und das ich nicht missen möchte. Später werden sie Larven tragen, ich aber fühle mich eingeweiht, ich weiß, wer diese Zigeunerin und wer Cœurdame ist.
Jetzt muß ich schlafen gehen, schleiche aber dann nochmals, wenig bekleidet, über die Treppe. Der Ball hat angefangen. Die vorderen Räume sind leer, dennoch erkenne ich sie kaum wieder, der Ball hat alles verändert. Tritt jemand ein, entweiche ich unhörbar in das nächste Zimmer. So mache ich die Runde, phantastisch angezogen von dem Fest im Saal, dem farbigen Glanz, der hervorströmt, von der Musik, dem Scharren auf Parkett, von Stimmengewirr und warmen Düften. Endlich gelange ich bis hinter die Tür des Saales, es ist gewagt, aber es lohnt. Nackte Schultern, mild vom Licht überzogen, Haare, schimmernd wie Schmuck und Juwelen, die blitzen vom Leben, wenden sich mühelos im Tanz. Mein Vater ist ein fremder Offizier, gepudert, mit Degen, ich bin durchaus stolz auf ihn. Mama Cœurdame schmeichelt ihm mehr als je. Aber mein Urteil erstirbt vor dem Fräulein aus Bremen, ich fühle nur, daß sie dahingleitet, an einen Herrn geschmiegt, der hoffentlich nicht weiß, wer sie ist. Ich weiß es. Ich stehe mit sieben Jahren hinter der Tür des Ballsaales, ratlos ergriffen von dem Glück, dem alle nachtanzen.
Der Saal hat einen zarten, hellen Geschmack, später werde ich wissen, daß dies Rokoko heißt und gut zehn Jahre vor dieser Zeit sich von Paris aus verbreitet hat. Auch die Masken gingen von dort aus, auch die Tänze, die Quadrillen, der Galopp. Jede Einzelheit ist nachträgliche Ausstrahlung des kaiserlichen Hofes Napoleons III. und der schönen Eugenie. Ihr Hof ist verschwunden, aber ihre gesellschaftlichen Sitten haben Zeit gehabt, bis in nordische Kleinstädte zu dringen. Die Kultur des Salons war nie wichtiger als damals, Höflichkeit nie wieder so bekannt. Man spielte Scharaden, gab Rätsel auf, die Damen bemalten die Fächer ihrer Freundinnen mit Aquarellen, Herren, die sie verehrten, schrieben ihre Namen darauf. Jene Welt unterhielt sich mit Schreibspielen, sonderbaren Erfindungen, ich habe sie erst verstanden, als ich las, daß in dem engsten Kreise Napoleons zuweilen jemand einen Aufsatz diktierte. Das Spiel war, zu entdecken, wer am wenigsten orthographische Fehler machte. Bürgerliche Spiele, sie paßten auch nach Lübeck.
Glanz und Höhe aber war der Maskenball. Die Sucht, sich zu verkleiden, lag nicht nur den glücklichen Abenteurern, die bisher in Paris geherrscht hatten, auch deutsche Honoratioren waren von ihr gepackt. Zuletzt kamen immer »lebende Bilder«, zur Schaustellung der eigenen Schönheit und Bedeutung in Situationen, die endlich ihrer würdig waren … Der Knabe hinter seiner Tür wartete angstvoll, ob es ihm gelingen werde, auch noch die lebenden Bilder zu sehen.
Plötzlich wird die Tür von mir fortgezogen, jemand hat mich gefunden. Es ist einer der Lohndiener, er ruft mir zu, drunten frage nach mir eine Frau. Meines bleichen Schreckens achtet er nicht, seine Frackschöße eilen weiter. Ich bin allein und Herr meiner Entschlüsse. Bin ich es? Wenn ich nicht zu der Frau hinuntergehe, wer weiß, sie dränge vielleicht bis in den Ballsaal. Offene Katastrophe, lieber noch opfere ich mich.
Die Frau steht beim Hauseingang, wo wenig Licht ist. Hinter sich hat sie ein dunkles Zimmer. Sie ist vermummt wie gestern, sie rührt sich nicht. Sie ist die Statue des Gewissens, aufgestanden aus der Nacht. Ich nähere mich immer langsamer, ich will fragen, was sie von mir verlangt, aber die Stimme versagt mir. »Du hast mir mein Geschirr zerbrochen«, sagt sie von selbst, und ganz dumpf: »Mein kleiner Junge hat nichts zu essen.« Ich schluchze auf, ergriffen sowohl von dem Geschick des anderen Jungen wie von dem meinen, das mich hierherbrachte.
Wenn ich ihr aus der Küche zu essen holte?
Aber die Küche ist voll von Mädchen und Dienern, ich würde unerträgliches Aufsehen erregen. »Warten Sie«, stammele ich und mache mich auf in das dunkle Zimmer hinter ihr. Dort lagen die Mäntel der Gäste. Ich wühle mich hindurch, ich gelange zu Dingen, die mein sind, Soldaten und Bücher. Ich nehme sie, gern nähme ich sogar die geliebte Vase, die ein Schwan mit ausgebreiteten Flügeln ist. Aber die Vase ist nicht mein. Ich bringe alles der Frau, sie packt es in ihren Korb, sie geht. Schon bin ich gelaufen, schon in meinem Bett.
Ich schlafe ruhiger ein als am vorigen Abend … Rätselhaft ist nur, daß bei meiner nächsten Rückkehr aus der Schule alle verschenkten Sachen wieder an ihrem Platze sind. Ich begreife es nicht. Auch Stine, die ich einweihe, ist scheinbar erstaunt. Aber sie muß lachen. Verdacht auf Stine ist mir erst lange nachher gekommen, und auch dann nur, weil sie gelacht hatte. Sie selbst war der nächtliche Besuch gewesen, die Statue des Gewissens, die unglückliche Mutter des durch meine Schuld hungernden Jungen.
Wahrscheinlich hat in Wirklichkeit niemand gehungert. Wer weiß, ob auch nur Geschirr zerbrochen war. Stine, als gute Schauspielerin, hat der von ihr geschaffenen Gestalt gesteigerte Tragik mitgegeben. Ich habe dennoch nicht vergessen, daß ich, sieben Jahre alt, aus glücklicher Versunkenheit in den äußeren Glanz des Lebens jäh gerissen wurde, um hinzutreten vor die Armut und meine eigene Schuld.
Ein Eindruck. Auch eine Lehre? Damals kaum, Armut ward nicht oft sichtbar im Lübeck der siebziger Jahre. Wenn ich mit meiner Großmutter spazierenging, saßen am Rande der Landstraße manchmal Steinklopfer oder ähnliche Männer und aßen aus einem Topf. »Guten Appetit, Leute!« sagte meine Großmutter herzlich und ermunternd. Die »Leute« stutzten kurz, dieser Ton war immerhin schon ungewohnt. Dann aber dankten sie.
II. Die beiden Gesichter
Mitte der siebziger Jahre war meine Mutter eine ganz junge, ahnungslose Frau. Ich sitze vor ihrem Schreibtisch, spiele mit einer kleinen Truhe aus Bronze, das violett gepolsterte Innere duftet bezaubernd. Plötzlich legt meine Mutter von hinten den Arm um mich, sie flüstert mir zu: »Wir sind nicht reich, aber sehr wohlhabend.« Sie mußte es gerade erst erfahren haben, und zwar mit genau diesen Worten.