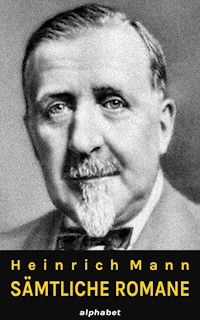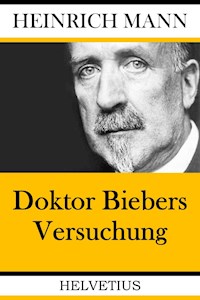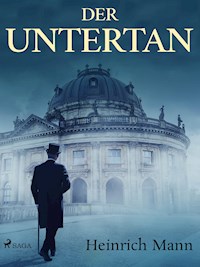Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zweite Teil über eine bedeutende historische Person, mit der sich Heinrich Mann vier Jahrzehnte lang beschäftigte: Der Lebensweg des französischen Königs Heinrich IV. (1553-1610), der in die Geschichte einging als der Einiger von Frankreich. Henri Quatre stand für Menschlichkeit und kämpfte für die Freiheit seines Heimatlandes. Doch der beliebteste König Frankreichs scheiterte schließlich, da die Zeit noch nicht reif war für seine Vorhaben. Mit einer visionären Ansprache an sein Volk endet dieses Meisterwerk Heinrich Manns.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1309
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Die Vollendung des Königs Henri Quatre
Saga
Die Vollendung des Königs Henri QuatreCoverbild / Illustration: http://polona.pl Copyright © 1938, 2020 Heinrich Mann und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726482881
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
IDAS KRIEGSGLÜCK
Das Gerücht
Der König hat gesiegt. Das eine Mal hat er den Feind zurückgeworfen und gedemütigt. Er hat die Übermacht weder vernichtet noch entscheidend aufgehalten. Nach wie vor ist sein Königreich in Lebensgefahr, gehört auch noch gar nicht ihm. Es gehört bis jetzt der „Liga“, da die Zuchtlosigkeit der vorhandenen Menschen, ihr Widerstand gegen die Ordnung und Vernunft seit den Jahrzehnten der inneren Kämpfe schon bis zum Wahnsinn gediehen sind. Oder, noch schlimmer als der offene Wahnsinn, die platte Gewöhnung an den vernunftund zuchtlosen Zustand hat die Menschen ergriffen, die traurige Ergebung in ihre Schande hat sich bei ihnen festgesetzt.
Der einmalige Sieg des Königs kann das keineswegs ändern. Ein vereiteltes vereinzeltes Gelingen — wieviel ist daran Zufall und wieviel ist Bestimmung? Es überzeugt noch keine Mehrheit von ihrem Unrecht. Wie denn? Dieser Protestant aus dem Süden wäre kein Räuberhauptmann, er wäre der wahrhafte König! Was müßten dann alle großen Führer der Liga sein: sie, von denen jeder eine Provinz beherrscht oder einen Gau leitet, und zwar mit wirklicher Gegenwart und voller Gewalt. Der König gebietet beinahe nur dort, wo sein Heer steht. Der König hat für sich den Gedanken des Königreiches: soviel erkennen manche, und nicht ohne Unruhe oder Wehmut. Ein Gedanke ist weniger als die wirkliche Gewalt, und ist auch mehr. Das Königreich, das ist mehr als ein Raum und Gebiet, es ist dasselbe wie die Freiheit und ist eins mit dem Recht.
Wenn die ewige Gerechtigkeit auf uns herabblickt, muß sie sehen, daß wir furchtbar erniedrigt, und schlimmer noch, daß wir ein Moder und getünchtes Grab sind. Wir haben uns um der täglichen Notdurft willen den ärgsten Verrätern unterworfen und sollen durch sie an die Weltmacht Spanien kommen. Aus bloßer Menschenfurcht dulden wir im Lande die Knechtschaft, geistige Verwahrlosung und verzichten auf das erhabenste Gut, die Gewissensfreiheit. Wir armen Edelleute, die in den Heeren der Liga dienen oder Staatsstellen bekleiden, und wir ehrbaren Leute, die ihr Waren liefern, und wir niederes Volk, das mitmacht: wir sind nicht immer dumm und manchmal nicht ehrlos. Was sollen wir aber tun? Ein Geflüster unter Vertrauten, ein heimliches Gebet zu Gott, und nach dem unverhofften Sieg des Königs bei Arques schwillt für kurze Zeit unsere Hoffnung an, daß der Tag kommt!
Höchst merkwürdig, die Weitentfernten machen sich von den Ereignissen meistens einen größeren Begriff als die nahe Wohnenden. Der Sieg des Königs geschah an der Küste der Nordsee: im Umfang von zwei oder drei Tagereisen hätte man staunen sollen. Besonders in Paris hätten sie sich prüfen und ihre hartnäckigen Irrtümer endlich berichtigen müssen. Durchaus nicht. Dort im Norden sahen wohl viele mit Augen, wie das geschlagene Riesenheer der Liga durch zersprengte Banden das Land unsicher machte — was ihnen aber nicht in den Kopf ging. Die Liga blieb für sie unbesiegt; der König hatte vermöge des dichten Nebels, den das Meer verbreitete, und dank anderen Umständen des Kriegsglücks ein unbedeutendes Stück Landes behauptet, das war alles.
Für den innersten Teil des Königreiches hatten dagegen die erhofften Entscheidungen sich wirklich angekündigt. Am Flusse La Loire und in der Stadt Tours glaubten sie nach alten Erfahrungen, daß zuletzt doch immer der König in Person bei ihnen einkehrte. Manchmal als armen Flüchtling, aber endlich als den Herrn, so hatten sie ihn seit Jahrhunderten empfangen. Wie nun erst die entlegenen Provinzen des Westens und des Südens! Dort sahen sie diese Schlacht bei Arques, als ob sie vor ihren Blicken nochmals geschlagen würde und wäre ein Machtwort des Himmels selbst. Die stürmischen Protestanten der Festung La Rochelle am Ozean sangen: „O Gott, so zeige Dich doch nur“ — denselben Psalm, mit dem ihr König gesiegt hatte. Von Bordeaux schräg abwärts, der ganze Süden nahm aus ungemessener Begeisterung vieles als geschehen vorweg, was in weitem Felde stand, die Unterwerfung der Hauptstadt, die Bestrafung mächtiger Verräter und ruhmvolle Einigung des Königreiches durch ihren Henri, geboren bei ihnen, ausgezogen von hier, und jetzt so groß!
Gingen seine Landsleute wirklich weiter als alle anderen? Groß — nennt man am leichtesten den Mann, den man nicht einmal von Angesicht kennt. Seine Landsleute im Süden wissen aus eigenen Begegnungen, daß er nur gerade mittleren Wuchses ist, den Filzhut zum abgewetzten Wams trägt und niemals Geld hat. Sie erinnern sich seiner sanften Augen: sprechen diese eigentlich vom heiteren Gemüt oder von manch erlebter Trauer? Jedenfalls ist er schlagfertig und versteht sich auf den Ton des gemeinen Mannes — versteht sich noch besser auf die Art der Frauen. Von ihnen könnten viele, niemand ermißt die Zahl, seine Geheimnisse verraten. Aber sonst so plauderhaft, auf einmal schweigen sie. Genug, hier kennt man ihn von Angesicht und war nur nicht bei seiner vorigen Arbeit mit, dort oben, wo Nebel lag, wo die Unseren den Psalm sangen, als sie angriffen und das gewaltige Heer schlugen. Das war eine sehr große Arbeit, und während sie getan wurde, haben Himmel und Erde den Atem angehalten.
Jetzt haben auch ganz ferne Länder den Ausgang erfahren. Über seine Person wurde ihnen bisher nichts berichtet. Ein so neuer Ruhm ist auf große Entfernungen unirdisch und fleckenlos. Um so größer steht einer da, auf den Schlag. Die Welt hat ihn erwartet, sie hatte es gründlich satt, als einzigen Herrn und Meister ihren Philipp von Spanien zu ertragen, immer und ewig den trostlosen Philipp. Die bedrückte Welt hatte längst um den Befreier gefleht: nun sieh, hier ist er! Sein Sieg: eine kleine Schlacht, nichts von jähem Umsturz der Lage, und dennoch bedeutender als vorher der Untergang der Flotte Armada. Hier hat einer ganz durch seine Kraft den Thron des Weltherrschers erbeben gemacht. Wenn noch so leise, das Beben wird verspürt über den Grenzen, über den Bergen und bis an das andere Ufer des Meeres. Sie sollen in einer berühmten Stadt hinter dem Meer — sie sollen ein Bild mit Prozession durch die Straßen getragen haben. Stellte das Bild ihn auch nur vor? Es war schon nachgedunkelt, sie haben es beim Trödler ans Licht gezogen, es abgewaschen. „Der König von Frankreich!“ rief das Volk und veranstaltete den Umzug, sogar die Pfaffen sind mitgegangen. Das Gerücht weiß alles und es fliegt.
Die Wirklichkeit
Er selbst in Person hielt keine Siegesfeier. Denn eine gelungene Arbeit zieht sogleich die nächste nach sich; und wer seinen Erfolg nicht erlistet, sondern redlich gewinnt, weiß eigentlich nichts von Sieg und gewiß nichts von Berauschung. Der König dachte nur daran, seine Hauptstadt Paris überraschend einzunehmen, solange der Herzog von Mayenne mit dem geschlagenen Heer der Liga sie noch nicht erreicht hatte. Der König war der schnellere; außerdem ließen sie in Paris sich einreden, daß er von ihrem Mayenne besiegt und in voller Flucht wäre; das gab ihm noch mehr Vorsprung. Bevor er aber ankam, hatte Paris sich gefaßt und auf seine Verteidigung eingerichtet — übrigens unklug. Anstatt nur die festen Mauern und Wälle um die innere Stadt, beschlossen sie, auch die Vororte zu halten. Das war nach dem Sinn des Königs, der sie draußen zu überrennen dachte, und mit den Fliehenden wäre er in die Tore eingedrungen.
Er stürmte die Außenwerke leicht, die Tore indessen konnten gerade noch geschlossen werden. So blieb es dabei, daß seine Truppen, alle diese Schweizer, deutschen Landsknechte, vier Kompanien von Abenteurern, viertausend Engländer, sechzehn französische Regimenter — daß alle zusammen stürmten, metzelten, plünderten. Sonst führte es zu nichts. Der König wurde zwar mit Hochrufen empfangen, aber inmitten von Plündern und Metzeln. Er ließ wohl über die Mauer hineinschießen und wußte doch schon, seine Hauptstadt bekäme er auch diesmal nicht. Jetzt begibt er sich zur Ruhe in einem Palast, der nach seiner Familie benannt ist: Klein-Bourbon heißt er; Henri hat hier eindringen müssen wie ein Fremder, findet auch wenig, um sich zu betten, nur frisches Stroh. Drei Stunden bleiben ihm für den Schlaf, ein Teil vergeht mit vergleichenden Gedanken.
,In der Stadt steht Schloß Louvre, dort brachte ich mich durch als Gefangener in mehreren lehrreichen Jahren, ich trag ihre Spur. Soll ich als freier Mann und König die Stadt nie wiedersehn? Einst in der Bartholomäusnacht fielen am Hofe fast alle meine Freunde und in der Stadt die meisten meines Glaubens. Nach achtzehn Jahren seid ihr gerächt worden! An einem einzigen Kreuzweg haben heute meine Soldaten achthundert Feinde niedergemacht und dabei gerufen: Sankt Bartholomäus! Schrecklich ist, daß alles wiederkehrt und nichts, nichts kann je aus der Welt kommen. Ich wäre für Vergessen und Vergeben, ich wäre für Menschlichkeit. Was ist von unseren Streitfragen denn wahr? Was weiß ich? Gewiß bleibt, daß wir töten, draußen wie drinnen. Wäre ich doch durch das Tor gelangt, bevor sie es schlossen! Ich hätte ihnen den milden Sieger und wahren König gezeigt. Das Königreich hätte seine Hauptstadt, die Menschen das Ziel, worauf sie in Güte würden hinblicken können. Aber nein! Nur etwas gesättigte Rache, und das gewohnte Töten, und das Kriegsglück.‘
Henri, ein Sechsunddreißigjähriger, der hinter sich viele Schrecken und geduldige Mühen hat, aber auch Freuden ohne Zahl hat er genossen vermöge seiner inneren Heiterkeit, hier liegt er auf frischem Stroh, am Fuße eines großen Eßtisches. Noch einmal fährt er hoch: der König befiehlt, daß die Kirchen verschont werden sollen — „und auch die Menschen!“ ruft er dem Hauptmann nach. Dann schläft er wirklich ein, da er sich beherrschen gelernt hat, bei Fehlschlägen und Betrübnis nicht weniger als in Fällen erstaunlicher Schicksalsgunst. Der Schlaf ist sein guter Freund, erscheint pünktlich und bringt meistens mit, wessen Henri bedarf, keine Ängste, eher Gesichte von guter Vorbedeutung. In seinem Traum dieser Nacht sah Henri Schiffe herbeifahren. Sie schwebten zuerst in den Schleiern des Horizontes, wurden groß und nahmen das besonnte Meer ein, Gebäude voll Macht und Glanz: sie näherten sich, ihn suchten sie. Sein Herz schlug, dem Bewußtlosen fiel wieder ein, was der Besuch bedeutete. Man hatte wirklich dergleichen besprochen bald nach seiner gewonnenen Schlacht. Er hatte nicht hingehört wegen gegenwärtiger, höchst dringlicher Arbeit und Mühe. Da hört man nicht auf Märchen. Beim Erwachen aus seinem dreistündigen Schlaf blieb von den erblickten Schiffen in seinem Gedächtnis abermals keine Spur.
Der Tag Allerheiligen war angebrochen; die königliche Armee, alles, was in ihr katholisch war, ging in die Kirchen der Vorstädte. Hinter den Mauern hatten sie nicht den Mut, das Fest zu feiern, sondern jammerten um ihre Toten und fürchteten für sich selbst. Gegen Abend aber waren sie gerettet, denn die Truppen der Liga rückten an, und der König konnte sie jetzt nicht mehr hindern, von drüben her die Stadt zu besetzen; das war versäumt. Er ließ zu, daß noch einmal eine Abtei von den Seinen erobert und dreihundert Pariser niedergemacht wurden. Das war der Abschied, und kein schöner, wie er am besten wußte. Er bezahlte ihn auch, — bestieg, um die Stadt zu sehen, einen Kirchturm und nahm als Führer einen Mönch. Droben in der Enge, allein mit dem Mönch, überfiel ihn ein großes Elend, da Henri des vorigen Königs gedachte. Den hatte ein Mönch ermordet. Ihn selbst hatte schon mehrmals aus den Ärmeln einer Kutte ein Messer angeblickt. Schnell trat er hinter seinen Begleiter und hielt ihn an beiden Armen fest. Der Ordensbruder, obwohl groß und stark, rührte sich nicht. Henri blickte nicht lange auf seine Hauptstadt hinunter; beim Abstieg ließ er den Verdächtigen vorangehen, er selbst blieb um einige Stufen zurück. Drunten traf er seinen Marschall Biron. „Sire“, sagte Biron. „Ihr Mönch kam herausgestürzt und ist entsprungen.“
In diesem Augenblick erscholl das Freudengeschrei der Pariser, ihr Feldherr Mayenne war persönlich eingetroffen, sie bewirteten seine Truppe auf den Straßen. Der König stellte des nächsten Tages sein Heer in Schlachtordnung auf und ließ dem Feinde drei Stunden Zeit, um hervorzukommen. Vergebens, Mayenne hütete sich; da zog der König ab. Unterwegs nahm er befestigte Plätze ein, aber da ihr Sold ausblieb, lösten einige seiner Regimenter sich auf. Mit den übrigen ritt der König nach seiner Stadt Tours, um dort die Gesandten Venedigs zu empfangen. Die alte Republik hatte aus weiter Ferne ihre Schiffe geschickt, das Gerücht beglaubigte sich nun. Die Gesandtschaft war an Land gestiegen und langsam, indes der König kleine Städte unterwarf, reiste sie das Königreich hinauf, um ihm zu huldigen.
Ein Märchen
Er hörte von ihrem Herannahen täglich und war davon beunruhigt, darum machte er sich lustig. „Es regnet! Den Weisen aus dem Morgenlande wird ihr Weihrauch naß werden.“ Er fürchtete eher, daß die Liga sie gefangennehmen und ihm wegschnappen könnte, bevor sie zur Stelle waren mit aller großen Ehre und sichtbarem Ruhm, die sie ihm darbringen wollten. Als sie von der Loire noch mehrere Tagereisen entfernt waren, schickte er ihnen zahlreiche Truppen entgegen, scheinbar als Ehrengeleit, aber er meinte es ernster. Hierauf erwartete er sie in seinem Schlosse zu Tours, und das dauerte. Unterwegs war einer der bejahrten venezianischen Herren von Unpäßlichkeit befallen. „Es ist eine recht alte Republik“, sagte Henri zu seinem Diplomaten, Philipp Du Plessis-Mornay.
„Sire, die älteste in Europa. Sie war unter den mächtigsten, jetzt aber ist sie die erfahrenste. Wer Erfahrung sagt, weiß gewöhnlich nicht, daß er Verfall meint. Denen, die jetzt kommen, ist auch das bekannt. Nun ermessen Sie dies Ereignis! Die klügste Regierung, sie ist nur darauf noch bedacht, die Gebrechen des Alters mit Würde zu tragen und den Tod hinauszuschieben, sie hat an allen Höfen die besten Beobachter und liest Berichte, Berichte: plötzlich rafft sie sich auf, sie handelt. Venedig fordert die Weltmacht heraus, es huldigt Ihnen nach Ihrem Sieg über die Weltmacht. Wie groß muß Ihr Sieg sein!“
„Ich habe angefangen, über meinen Sieg nachzudenken. Der Sieg, Herr de Mornay“, begann Henri, stockte und lief erst einmal hin und her durch den steinernen Saal des Schlosses von Tours. Sein Jugendgefährte sah ihm nach; wie schon oftmals fand er, daß er seinen Fürsten richtig gewählt habe. Der gibt für seinen Sieg nur Gott die Ehre! Der strenge Protestant nahm bei dieser Wahrnehmung den Hut ab. Da stand er, ein Vierzigjähriger in dunkler Kleidung, der weiße Kragen einfach umgelegt nach Art seiner Glaubensgenossen, ein sokratisches Untergesicht, die Stirne hoch, besonders glatt und empfänglich für allerlei Licht.
„Mornay!“ Henri hielt vor ihm an. „Der Sieg ist nicht mehr, was er war. Wir beide kannten ihn sonst anders.“
„Sire!“ erwiderte der Gesandte klar und ohne Unruhe. „Sie haben in Ihrem früheren Amt als König von Navarra einige böse Städte, die Ihnen widerstanden, zur Vernunft gebracht. Zehn Jahre der Mühe und Arbeit und eine namhafte Schlacht; dann hatte Fama Sie berühmt genug gemacht, daß Sie Erbe der Krone wurden. Der König von Frankreich, der Sie jetzt sind, wird weniger mühselig kämpfen, wird größer siegen, und Fama soll, um seinetwegen, stärker die Flügel rühren.“
„Wenn das der ganze Unterschied wäre! Mornay, seit meinem Sieg, wegen dessen die Venezianer herbeireisen, habe ich Paris belagert und bin unverrichteterdinge abgezogen. Wissen das die Venezianer nicht?“
„Es ist weit bis Venedig, und sie waren schon auf der Reise.“
„Sie könnten umkehren. Sind es nicht kluge Leute? Solche begreifen, was es heißt, wenn ein König seine eigene Hauptstadt belagern muß, und noch dazu vergeblich. Metzeln, plündern — und abziehen, nachdem ich von einem Turm in die Stadt geblickt und mich vor einem Mönch gefürchtet hatte.“
„Sire, das Kriegsglück.“
„So nennen wir’s. Aber was ist es? Während ich das eine der Tore bewache, zieht Mayenne durch das andere ein. Ist über eine Brücke herbeigekommen: nach meinem Befehl hätte sie abgebrochen sein sollen, war es aber nicht. So sieht das Kriegsglück aus. Ich habe den Verdacht: nicht anders sieht es aus, wenn ich siege.“
„Sire, Menschenwerk.“
„Gleichviel, es soll Feldherren geben —“, Henri brach ab: er dachte an einen Feldherrn, Parma genannt, der verließ sich nach dem Ruf von seiner Kunst auf kein Kriegsglück, und redete sich auf Menschenwerk nicht aus.
„Mornay!“ rief Henri und schüttelte seinen Berater. „Ein Wort! Kann ich denn siegen? Mein Beruf ist, dies Königreich zu retten; aber zufriedener war mein Geist, als noch niemand herbeireiste, um mir vor der Zeit zu huldigen.“
„Venedig will, daß Sie gesiegt haben, Sire. Es würde seine Gesandten nicht zurückrufen und wenn Ihr Heer in voller Auflösung wäre.“
Henri sagte: „So erfahre ich denn, daß der Ruhm ein Mißverständnis ist. Ich verdiene ihn und bekomme ihn dennoch ohne mein Verdienst.“
Hierauf veränderte sein Gesicht sich, er wippte auf den Absätzen herum, höchst aufgeräumt empfing er die Personen, die soeben bei ihm eintraten. Zahlreiche seiner besten Herren, auch hübsch und neu gekleidet waren sie. „Brav, de la Noue!“ rief Henri. „Ein eiserner Arm, und sind über den Fluß geschwommen! Brav, Rosny! Ihre Juwelen sind aus guten Häusern, obwohl nicht aus Ihrem eigenen, und wieviel Geld erst werden Sie in den Pariser Vorstädten gefunden und mitgenommen haben! Wenn ich Sie zu meinem Finanzminister machte anstatt des dicken d’O?“
Er sah sich um, da sie ihm nicht genug lachten. „Ich fürchte nichts so sehr wie traurige Leute und mißtraue ihnen.“
Sie schwiegen. Er betrachtete sie abwechselnd, bis er alles erraten hatte. Da nickte sein alter d’Aubigné ihm zu, einst sein Mitgefangener, nachher sein Kampfgefährte, und immer kühn und immer fromm, in Versen wie in Taten. Dies befreundete Gesicht nickte und sagte: „Sire! So ist es. Ein ganz durchnäßter Bote traf ein, als wir uns gerade schön gemacht hatten für den Empfang.“
Der Schrecken durchlief Henri. Er ließ es vorbeigehen. Als die Stimme ihm wieder völlig gehorchte, antwortete er munter dem alten Freund. „Agrippa, was willst du, das Kriegsglück. Die Gesandten sind umgekehrt. Sie werden sich aber nochmals anders besinnen, denn bald schlag ich wieder eine Schlacht.“
Hinter der Tür geschah ein großes Gepolter. Sie wurde aufgestoßen; zwischen Wachen erschien ein ganz durchnäßter Bote, der außer Atem und unfähig zu sprechen war. Man ließ ihn hinsitzen und gab ihm zu trinken. „Es ist ein anderer“, bemerkte Agrippa d’Aubigné.
Endlich sprach der Mann. „In einer halben Stunde sind die Gesandten hier.“
Henri dies hören, und er griff sich an das Herz. „Jetzt laß ich sie bis morgen warten.“ Damit ging er schnell ab.
Nun geschah über Nacht ein Wunder, und von November wurde es Mai. Eine weiche Luft wehte aus Süden, vertrieb alle Wolken, der Himmel spannte sich hell und weit über den Park des Schlosses von Tours, über den Fluß, der breit und langsam vorbeizog an den Feldern in der Mitte des Königreiches. Die Birken standen hoch und sehr entlaubt; vom Schloß her folgte man dem Landen der Schiffe, mit denen die Gesandten übersetzten. Ihre Wohnungen waren in Landhäusern drüben. Unter Fenstern, die bis zum Boden reichten, wartete zu ebener Erde der Hof, Herren und Damen so reich gekleidet als sie vermochten oder für anständig hielten. Roquelaure war der geschmackvollste. Agrippa hatte die größten Federn, Frontenac stand im Wettbewerb mit Rosny. Dieser trug am Hut und Kragen mehr Schmuck, als auf die Kleider der Frauen genäht war. Indessen zeigte sein noch junges, glattes Gesicht den verständigen Ernst wie sonst. Die Schwester des Königs erschien bei ihrem Eintritt sogleich als die schönste Frau. Gegen den hohen Kragen aus Spitzen und Diamanten lehnte ihr feiner blonder Kopf; das Damengesicht von höflicher Strenge verriet dennoch eine innere Kindlichkeit, die unvergänglich ist. Sie war noch in der Tür, als ihr golddurchwirkter Schleier hängenblieb. Oder machte ihr ungleicher Fuß ihr Verlegenheit? Der ganze Hof hatte sich an ihrem Weg aufgestellt. In diesem Augenblick sieht sie durch die entgegengesetzte Tür ihren Bruder, den König, kommen. Ein kleiner Jubellaut — sie achtet nicht mehr auf sich, einige Schritte läuft sie, es macht plötzlich gar keine Schwierigkeit. „Henri!“
Inmitten trafen sie einander. Catherine von Bourbon beugte das Knie vor ihrem Bruder — sie hatten zusammen gespielt am Anfang des Lebens, sie waren in schweren alten Kutschen durch das Land gereist mit ihrer Mutter Jeanne. ,Unsere liebe Mutter war wohl krank und ruhelos, aber wie stark durch den Glauben, den sie uns lehrte! Hat endlich recht behalten, obwohl sie zuerst sterben mußte an dem Gift der bösen alten Königin, und auch uns waren Schrecken und viel Mühe beschieden. Dennoch stehen wir jetzt wirklich in einem Saal in der Mitte des Königreiches, sind selbst der König mit seiner Schwester und werden die Gesandten Venedigs empfangen.‘ — „Kathrin!“ brachte der Bruder unter Tränen hervor, hob die Schwester aus ihrem Kniefall auf und küßte sie. Der Hof gab fröhlichen Beifall.
Der König in weißer Seide, blauer Schärpe, rotem Mäntelchen, führte die Prinzessin an schwebender Hand, der Hof wich auseinander, aber hinter den Herrschaften schloß er sich wieder. Sie hielten unter dem höchsten der Fenster, um sie her drängte man sich — und wer nach vorn gelangte, war nicht immer von den Besten. Die Schwester sagte dem Bruder ins Ohr: „Ich mag deinen Kanzler Villeroy nicht. Ich mag noch weniger deinen Schatzmeister d’O. Und du hast noch Schlechtere. Henri, lieber Bruder, könnten doch alle, die dir dienen, von unserem Glauben sein!“
„Ich wollte es auch“, sagte er seiner Schwester ins Ohr; hierauf aber winkte er gerade den beiden Höflingen, die sie genannt hatte. Sie wendete sich unwillig nach hinten: je weiter fort, um so befreundeter die Gesichter. An der Wand stieß Kathrin zu einem ganzen Haufen alter Freunde: Waffengefährten ihres Bruders, die Kavaliere des einstigen Hofes von Navarra, damals trugen sie meistens rauhe Lederkoller. „Ihr habt euch fein gemacht, meine Herren! Baron de Rosny, als ich Sie tanzen lehrte, hatten Sie noch keine Diamanten. Herr de la Noue, Ihre Hand!“ Sie nahm die eiserne Hand des Hugenotten — nicht seine lebende, die eiserne nahm sie und sagte, allein für ihn, Agrippa d’Aubigné und den langen Du Bartas:
„Gott hätte auf unserem Wege nur ein einziges Sandkorn anders rinnen lassen müssen als es wirklich vom Hügel rann: wir wären nicht hier. Wißt ihr’s wohl?“
Sie nickten. In dem verdüsterten Gesicht des langen Du Bartas standen schon die geistlichen Verse, die er sprechen wollte: da setzten draußen die Trompeten ein. Sie kommen! Geben wir uns Haltung und stellen einen mächtigen Hof vor! Die meisten Gesichter wurden alsbald von einer glänzenden Feierlichkeit, gemildert durch Neugier; die Gestalten strafften sich, auch die Prinzessin von Bourbon. Sie suchte unter den Damen, es waren wenige zu finden an diesem unsteten Hof und Feldlager. Schnell entschlossen nahm sie eine Hand und ging nach vorn mit Charlotte Arbaleste, der Frau des Protestanten Mornay. Plötzlich entstand eine Pause.
Die Gesandten dort hinten fanden wohl nicht die rechte Ordnung ihres Zuges. Verfrüht, der Trompetenstoß. Der Weg nach dem Ufer fiel ab; waren die Herren aus Venedig zu alt, ihn zu ersteigen? Es schien, daß der König sich belustigte, wenigstens lachte seine Umgebung. Die Prinzessin, seine Schwester, führte ihre Begleiterin an ein anderes Fenster: sie war erschrocken, neben ihrem königlichen Bruder stand Vetter Soissons, den sie liebte. ,Hätte ich nicht gerade diese sittenstrenge Protestantin am Arm!‘ dachte Catherine, als wäre sie selbst keine. Ja, sie vergaß sich — vergaß sich ihr ganzes kurzes Leben lang, beim unerwarteten Anblick ihres Geliebten. Ihr Herz klopfte, ihr Atem wurde kurz, zu ihrem Schutz machte sie ihr hochmütigstes Gesicht, wußte aber kaum, was sie ihrer Nachbarin noch sagte. „Herzklopfen“, sagte sie. „Madame de Mornay, litten Sie daran nicht? Schon in Navarra, als Sie es mit dem Konsistorium zu tun bekamen wegen Ihrer schönen Haare?“
Charlotte Arbaleste hatte den Kopf in eine Haube geschlossen; diese reichte bis nahe an die Augen, die flüssig glänzten und Menschenscheu nicht kannten. Ruhig bestätigte die tugendhafte Frau des Protestanten Mornay: „Man warf mir Unbescheidenheit vor, weil ich falsche Locken trug, und der Pastor schloß mich vom Abendmahl aus. Sogar Herrn de Mornay verweigerte er es. Von den Aufregungen habe ich allerdings noch heute, nach so vielen Jahren, ein sehr empfindliches Herz behalten.“
„So unrecht kann unsere Kirche uns tun“, beeilte die Prinzessin sich festzustellen. „Sie hatten doch für unsere Religion die Verbannung und die Armut auf sich genommen, nachdem Sie der Bartholomäusnacht entronnen waren. Wir alle, die hier die Gesandten erwarten, waren einst Gefangene oder Verbannte um des Glaubens willen: Sie selbst wie Herr de Mornay, der König, mein Bruder, und auch ich.“
„Und auch Sie“, wiederholte Charlotte; ihr heller, flüssiger Blick fiel genau in die Augen Kathrins, die vor Unruhe zitterte. Reden hilft nichts, begriff sie. Die Frau durchschaut mich.
„Sie haben trotz den Pastoren Ihre rötlichen Locken noch lange behalten.“ Darauf verharrte die arme Catherine. „Mit Recht, sage ich. Wie denn? Zuerst Verfolgung, das Exil, und endlich zurück in der Heimat, wird Ihr Opfer nicht angenommen, bloß wegen Ihrer Haare.“
„Ich hatte unrecht“, gestand die Frau des Protestanten. „Es war Unbescheidenheit.“ Womit sie allerdings ihr eigenes Gebrechen preisgab, aber eigentlich erinnerte sie die Prinzessin an sich selbst und ihr noch schwereres Vergehen. Sie machte dies ganz deutlich. „Meine Unbescheidenheit war nicht bloß läßlich: sie war vorsätzlich und widerstand allen Warnungen. Indessen empfing ich die Erleuchtung im Gebet, legte endlich ab, was Unrecht war, trage seitdem auch bescheiden die Haube.“
„Und habe Herzklopfen“, sagte Kathrin. Zornig überflog sie das Gesicht der anderen, bleich, fromm und länglich wie es nun geworden war. ,Früher, als sie hübsch war, gingen wir beide auf den Ball‘, dachte sie. Davon legte sich ihr Zorn. Ihr kam Mitgefühl, bald sollte es Reue sein. ,Ich seh noch aus wie damals — und meine Sünde auch. Ich kenne mich, ich bin belehrt, aber unverbesserlich; vergeben wird mir nicht‘, dachte sie mit Reue. „Herr, hilf mir, daß auch ich heute abend die Haube anlege für immer!“ betete sie leise und dringend, wenn auch ohne rechte Hoffnung auf Erhörung.
Der Graf von Soissons stand vor ihnen, er sagte: „Meine Damen, es wird nach Ihnen verlangt von seiner Majestät.“ Beide neigten gehorsam die Gesichter, das eine war so still wie das andere. Er nahm ihre Fingerspitzen und führte die Damen an den erhobenen Händen. Die Hand seiner Cousine versuchte er leise zu drücken. Sie erwiderte nicht, und das Gesicht hielt sie abgewendet. Höflich übergab er sie ihrem königlichen Bruder.
Zwischen den Pappeln erglänzte Metall: zuerst dachten alle an Waffen oder Kriegsgerät. „Nein“, sagten die Frauen, „wir wissen wohl, wie Edelsteine aufleuchten. Zum wenigsten sind es Stickereien.“ Es war aber dies alles und noch mehr: staunend erblickte man ein Schiff aus Silber, es schwamm herbei durch die Luft — so schien es, und war dem übrigen Zuge voran, als er kaum erst in Sicht kam. Das silberne Schiff war so groß, daß Menschen es hätten besteigen können — und wirklich, Hände setzen ein Segel, aber es sind Kinderhände. Das Schiff ist mit Knaben bemannt, die sich anstellen wie Seeleute und derart auch singen. Ein wenig Kling und Klang begleitet sie, wer weiß woher, und übrigens, wovon bewegt sich dies Zauberschiff?
Zwanzig Schritte vor der Front des Schlosses hielt es an — wurde vielmehr niedergesetzt, und unter den prächtigen Geweben, die von seinem Bug hingen, sprangen Zwerge hervor: die hatten es getragen. Bucklige Zwerge, ganz in Rot, und nahmen Reißaus wie der Teufel, da lachte der Hof. Indessen nahte eine Sänfte. Wie? Das ist ein Thron. Noch soeben knapp über den Boden hingeführt, steigt das Gebäude an, nur die besten Maschinen können es so geräuschlos in die Lüfte erheben, und wird ein Thron. Die Lüfte aber sind blau und kreisen frei um das blonde Haupt der Frau auf dem Thron. Das blonde Haupt steht hoch in Locken und großen Perlen. Der Thron ist Purpur, die Frau: ein stolzes Weib mit goldenen Gewändern, so wie es Paolo Veronese malte. Wer ist das? Um die Augen liegt ihr eine Maske aus schwarzem Samt; wer ist das? Der Hof wurde ganz still. Der König entblößte den Kopf und alle mit ihm.
Neben den hohen Thron traten oder stampften verwegene Gestalten, schwarze Panzer, die Trachten von düsterer Buntheit, ihre Köpfe zeigten unbedeckt das rötliche oder schwarze Gestrüpp der fremdartigen Haare. Aber sie wurden erkannt an den furchtbaren Gebissen: Sklavonen, eroberte Untertanen Venedigs. Fischer lösten diese ab, die echten Söhne der Seestadt, unverschönt, mit ihren geflickten Kleidern und abgewetzten Rudern, nicht anders als sie von der Brücke eines Kanals waren fortgeholt worden. Diese nun sangen — sehr klare Stimmen, kein Geheimnis zu vermuten, trotz der Sprache, die nicht jeder kannte. Es machte sich feierlich, obwohl so heiter. Der Hof dachte an eine Kirche, wenn er sie nicht sogar sah, die fernher funkelnde Kirche über dem Meer.
Die Sänger brachen ab — mitten in einem so schönen Klang, da die Dame auf dem Thron die Hand ausstreckte. Das war eine außerordentliche Hand, der Rücken voll, die Finger zugespitzt und leicht aufwärts gebogen. Sie war ohne Schmuck, von der Farbe des Rosenblattes, und winkte, großartig, aber lockend, wie für einen Liebhaber, den eine so große Dame gnädig zuließe. Der Gesandte! begriff der Hof; und der König von Frankreich als einziger trat hinaus auf die Rampe, ihn zu empfangen.
Gleichzeitig bewegten sich die Fischer von dem Thron fort und knieten hin. Bewegten sich fort und knieten hin die kriegerischen Sklavonen. Die Kinder knieten in dem silbernen Schiff, unter den hintersten Büschen die roten Zwerge. Der Weg neben dem Thron lag frei, ihn beschritt ein magerer Mann in schwarzem Talar und Barett: ein Gelehrter, vermeinte der Hof. Warum ein Gelehrter? Schickt die Republik als Höchsten einen Gelehrten? Die beiden anderen, graubärtige Heerführer, lassen ihm den Vortritt.
Agrippa d’Aubigné und Du Bartas, zwei Humanisten, die aus alten und neuen Schlachten viele Narben an ihren Leibern trugen, berieten sich eilig, indessen der Gesandte sehr langsam dem König nahte. Herr Mocenigo, ein Verwandter des Dogen und selbst ganz alt. Hat einst bei Lepanto gekämpft, der berühmte Seesieg über die Türken. Jetzt lehrt er Latein zu Padua, davon kennt ihn erst die Christenheit. „Welch eine große Ehre!“ jubelte der Dichter Agrippa. „Herr Mocenigo huldigt unserem König, ich aber könnte aus lauter Freude die Schlacht bei Lepanto in Versen beschreiben, als wär ich dabei gewesen!“
„Beschreibe statt dessen unsere nächste Schlacht“, verlangte in düsterem Ton der lange Du Bartas. ,Ich selbst werde verstummt sein‘, sprach er in sich hinein zu seinem ahnungsvollen Herzen.
Der König hatte jetzt wieder seinen Federhut mit der aufgeschlagenen Krempe, darunter waren seine unbeschatteten Augen aufgerissen, um nichts zu verlieren. Er war aber bewegt, vielleicht wären Tränen in seine Augen gestiegen: eigentlich darum hielt er sie soweit offen, rührte die Lider sowenig wie Hand oder Fuß. Der Gesandte neigte zur Begrüßung den Kopf auf die Brust. Dann erhob er ihn, legte ihn in den Nacken, und da sah man erst. Da sah man, daß ein Auge geschlossen war, und eine rote Narbe lief darüber.
Er begann zu sprechen, ein Latein von merkwürdigem Wohllaut — glatt, obwohl hart. Der Hof dachte an Marmor. Auch erkannte man jetzt, welch ein Gesicht dies war — knochiger Umriß, scharfe Nase, gesenkter Mund, alles wie an Büsten Dantes, eines alten Weisen. Der Hof verstand nicht jeden Satz, die gewohnte Sprache kam aus fremdem Mund. Dem Gesicht merkten sie an, daß ihr König hoch gefeiert wurde: gemessen wurde er am Beispiel der römischen Feldherren und ihrer würdig befunden.
Henri, er ganz allein, begreift jedes Wort, nicht nur, was es obenhin sagen will: viel tiefer. ,Deine Sache wird verhandelt. Wer bist du? Das erfährst du aus dieser Anrede, oder glaubst es zu ahnen, solange sie noch währt. Der einäugige Weise vergleicht dich zum Schein mit dem ersten Eroberer dieses Königreiches, dem Römer Cäsar, deinem Vorgänger. In Wahrheit warnt er dich, zu bleiben wie bisher, ein Kampfhahn und kühner Reitersmann, groß im Kleinen, an hohen Taten unbewährt. Ich weiß, wen er mir vorzieht: es ist sein Landsmann, Farnese, Herzog von Parma, der berühmteste Stratege des Zeitalters. Das bin ich nicht, bin nur ein Kampfhahn ohne große Kunst.‘
Davon wurde ihm schwül, er riß die Augen noch weiter auf. Der Hergereiste, der ihn so plötzlich mit der Wahrheit angesprochen hatte, beurteilte auf einmal ernst, jetzt erst ernst, dies Gesicht — fand es schmaler als jedes erblickte; und gerade die Abgezehrtheit bezeugte seine Inbrunst und Hingabe, ihresgleichen hatte der Gesandte hier nicht erwartet. Er hielt seine Rede an, er faltete die Hände.
Als er wieder anfing, klang seine Stimme gedeckt, nicht mehr glatt und hart; auch sagte er nur noch wenige Worte, das hauptsächliche hieß „Liebe“. „Und wär einer kunst- und siegreich, hätt aber der Liebe nicht —“ Das Evangelium, anstatt des Cäsars: es war nicht vorgesehen, es überraschte jeden, und am meisten den Redner, der daraufhin abschloß. So tat auch Henri etwas Unerwartetes. Er reichte nicht, wie vorher verabredet, dem Gesandten die Hand, damit der Gesandte auf die Rampe käme: er selbst sprang hinab und gab ihm auch schon die Akkolade, Umhalsung, Kuß auf beide Wangen. Der Hof sah es, geräuschvoll bekundete er seine Zufriedenheit. Die Kinder in dem silbernen Schiff sahen es, die thronende Frau mit goldenen Gewändern sah es — und da sie die Tochter eines der Fischer in geflickten Kleidern war, vergaß sie alle Hoheit und schlug in die Hände. In die Hände schlugen die kriegerischen Sklavonen, das Fischervolk und die beiden graubärtigen Heerführer.
Henri blickte umher und lachte fröhlich — obwohl zugleich ein unbekannter Schauder ihm die Schulter berührte. ,Nicht, wie wenn hinter dir der Mörder steht, nein, diesmal war es die Ahnung eines Fittichs. Dich streift der Ruhm, zum erstenmal, da du den Vierzig nahe bist, der große Ruhm der Welt. Ist anzusehen wie die Märchen aus Morgenland, wird sogleich verfliegen, macht unheimlich erschaudern.‘
„Herr Gesandter, wenn die Zeremonie vorbei ist, sprechen Sie zu mir allein.“
„Sire! Worüber?“
„Über den Herzog von Parma.“
Das Wappentier
,Ich muß meine Schlacht haben‘, dachte Henri, kaum daß die Gesandten Venedigs abgereist waren; eigentlich aber hatte er schon bei ihrem ruhmreichen Erscheinen so zu sich gesprochen. Gerade der unheimliche Ruhm machte ihm seine Lage klar. Er war noch immer ein König ohne Krone, dem seine Hauptstadt fehlt. Ein Feldherr seinesgleichen hat kein Geld, und damit sein Heer ihm nicht auseinander läuft, muß er möglichst oft eine Stadt erobern: diese zahlt für ihn. Es sind die Städte seines Königreiches; eine schwere Sache, der Vater des Vaterlandes und recht volkstümlich zu bleiben, während er im Umherziehen seine Feinde unterwirft und Abgaben eintreibt. Keine Woche seit dem festlichen Märchen von Tours, da war er wie vorher mitten im harten Leben.
Er reinigte sowohl die Touraine wie die nächsten Provinzen vom Feind und drang in die Normandie ein — hatte dort aber schon gestanden, als er bei Arques den Sieg errang. Wohin war der Sieg gekommen? Die eroberten Plätze, die er hinter sich gelassen hatte, waren inzwischen abgefallen. Sein Feind, das war kein Mensch wie er: eine Hydra mit vielen Köpfen war es. ,Du schlägst sieben ab, acht wachsen nach. So geht es mir mit der Liga. Straßenweise bekehren sich meine Untertanen zu mir, wenn ich in ihrem Nest der Herr hin. Wollen nie gegen mich die Waffen getragen haben — obwohl ich nur ihren Garten müßte umgraben lassen, dort liegen die Musketen. Alles das wäre unterhaltend, ich wäre gemacht, in dieser Art das Leben zu verbringen. Und wenn ich in Wirklichkeit nicht dafür gemacht bin, sondern für Größeres, so tu ich doch klug, davon zu schweigen.‘
„Meine Gesundheit ist so gut wie noch nie“, erklärte er jedem in diesem Winter bei häufigem Schneefall und dem Nächtigen auf gefrorenem Erdboden. „Auch mein Heer hat keine Krankheiten, und es wird immer größer, da allein dies Nest mir sechzigtausend Taler zahlt. Wetten, das nächste am Wege ergibt sich bis Donnerstag!“
Wirklich schloß er mit der Stadt Honfleur einen solchen Vertrag. Waren Mayenne oder sein Sohn Nemours bis Donnerstag nicht zur Stelle, dann sollte das Tor ihm geöffnet werden, und richtig, so kam es. Der Führer Mayenne ließ seine Liga eine Liga sein und ruhte sich in Paris aus, „wo auch ich es mir einmal so sanft tun werde“, äußerte Henri zuversichtlich. Für sich dachte er: ,Ich muß meine Schlacht haben.‘ Er erwog dies abwechselnd wie einen fröhlichen Streich — oder auch wie die Entscheidung seines Lebens.
In seinem Gepäck führte er ein seltenes Stück mit eine Weckuhr, die er sorgfältig stellte. Mit Schlafen verging ihm weniger Zeit als dem dicken Mayenne bei Tisch. Eine Neuigkeit für seine gute Natur: zuweilen versäumte er sogar die wenigen Stunden. Aufgestützt sann er. ,Ich muß meine Schlacht haben — und nicht wie sonst, als ich sie gewinnen oder verlieren konnte. Ich darf sie nicht verlieren, darf diese nicht verlieren: dann wär es aus. Mich beobachten nachgerade zu viele, die Welt sieht mir zu, meine Verbündeten, die mir vor der Zeit gehuldigt haben, aber besonders der König von Spanien, der dies Königreich begehrt. Würde es auch haben, sobald ich nicht mehr da wäre. Wer sollte ihn noch hindern. Dies Volk streitet sich um seine Religion. Hätten nur alle die wahre, dann könnte sogar Don Philipp ihnen nicht an. Indessen was weiß ich, jeder hat die seine, ich bin Hugenott und lieg auf hart gefrorener Erde. Soll Don Philipp kommen, soll er mit viel Macht anrücken — all eins, ob meine Religion die rechte ist, hier gilt nicht das Bekenntnis, es geht um das Königreich, das in jedem Fall von Gott ist. Diese Sache spielt zwischen mir und Gott‘ — wurde dem König leuchtend klar, in einer ganz finsteren Nacht, indessen unter dem Zelt eine Ölfunzel knisterte und erlosch.
Der Wecker schlug an, der König stand auf und rief nach seinen Offizieren. An diesem Tag war viel zu tun und lange zu reiten. Ein Wassergraben mußte trockengelegt werden, damit die Belagerer bis unter die Mauer der Festung vordrängen. Dies vollbracht, wurde hin und her geschossen, bis der frühe Abend fiel. Henri war zu Pferd schon unterwegs wegen anderer Arbeiten im weiten Umkreis. Sehr hungrig, erreichte er um die Zeit des Nachtessens die Stadt Alençon und begab sich mit wenig Begleitung nach dem Hause eines ergebenen Hauptmannes, fand ihn indessen nicht vor. Der Frau war der König unbekannt, sie hielt ihn für einen der königlichen Heerführer und empfing ihn nach Gebühr, wenn auch mit merklicher Verlegenheit.
„Fall ich Ihnen lästig, meine Dame? Reden Sie frei weg, ich will keine Umstände machen.“
„Mein Herr, dann sag ich es lieber gleich. Heute ist Donnerstag; ich hab in der ganzen Stadt umhergeschickt: nichts aufzutreiben, ich bin einfach verzweifelt. Nur ein braver Handwerker hier nebenan sagt, er hab am Haken eine fette Pute hängen; will sie aber durchaus nicht anders hergeben, als wenn er mitessen darf.“
„Ist er denn in Gesellschaft zu brauchen?“
„Ja, mein Herr, in unserem Viertel macht keiner soviel Witze. Sonst ein anständiger Mann, Feuer und Flamme für den König, und sein Geschäft geht ganz gut.“
„Dann lassen Sie ihn nur kommen, liebe Dame. Ich habe wirklich Appetit; und wenn er auch langweilig wäre, lieber eß ich mit ihm, als gar nicht.“
Hierauf wurde der Handwerker geholt und erschien in seinem Sonntagsrock mit der Pute. Während nun diese briet, unterhielt er den König, schien ihn aber gleichfalls nicht zu kennen: sonst hätte er schwerlich mit dieser Unbefangenheit dahergeredet, Nachbarsklatsch, Einfälle, Scherze, alles so gut, daß Henri für die Weile den Hunger vergaß. Alsbald verfiel er selbst in den Ton seines Gesellschafters — ohne Absicht, und merkte es nicht einmal. Keine schwere Sache, der Vater des Vaterlandes und recht volkstümlich zu bleiben, während er doch Untertanen zum Gehorsam zwingt und Abgaben eintreibt. Das ganze Geheimnis ist sein gutes Gewissen, wegen des ehrlichen Geschäftes, das er betreibt. Ohne Umschweife und List seine Landsleute zur Vernunft bringen und dies Königreich retten. Dessen gedenkt er im Grunde fortwährend, im Schlaf und auch beim munteren Gespräch. Der ordentliche Handwerker ihm gegenüber erzählt, vergißt aber gleichfalls seine Werkstatt nicht.
Der König denkt: ,Ich muß meine Schlacht haben. Jetzt ist sie nicht mehr weit. Ich habe genug feste Plätze eingenommen, daß den Dicken die Ruhe verläßt. Mein Vetter Marschall Biron macht seinerseits der Liga viel Verdruß, und alle unsere Erfolge laß ich der Königin von England melden. Jetzt wollen wir die Stadt Dreux belagern: das wird Mayenne nicht mit ansehen können, er muß herbeirücken und sich zum Kampf stellen. Auch die Spanier werden es von ihm verlangen. Wozu sonst hätte er ihre Hilfstruppen, die ersten, die Philipp der Liga gewährt. Kommen aus den Niederlanden, vom Gouverneur, Farnese. Und ihn selbst sollt ich nicht zu sehen kriegen, den großen Strategen und berühmtesten Künstler des Krieges? Möchte wissen, was er von mir sagt, Farnese.‘
Bei diesem Namen mußte Henri vom Sitz auf. Der Handwerker behielt den Mund offen. Henri wiederholte ihm aber richtig, was er erzählt hatte. „Als der Handschuhmacher den gewaltigen Hufschmied bei seiner Frau fand, da streckte er versöhnlich die Hand hin und sprach: ,Von dir, Freund, kann ich es nicht glauben.‘“ Henri lachte. „Gevatter! Das ist komisch.“
„Sehr komisch, Gevatter!“ wiederholte der gute Mann und war über das stürmische Benehmen seines Genossen beruhigt. In diesem Augenblick rief die Hausfrau ihre Gäste zu Tisch. Selbdritt verzehrten sie das große Geflügel, aber die Hausfrau und der Handwerker hielten sich zurück, der Gast bekam das meiste, und so reichlich er aß, soviel lachte er über die Geschichten seines Nachbarn, davon wurde dieser immer besserer Laune. Daher war es erstaunlich anzusehen, wie er nach dem letzten Glase, als man aufstehen sollte, das runde Gesicht ganz lang zog und furchtsam die Augen schloß. Der König hätte auch das für einen Spaß gehalten, da lag ihm aber der Mann zu Füßen und bat: „Verzeiht, o Herr, verzeiht! Dies ist der schönste Tag meines Lebens gewesen. Ich kannte Eure Majestät, ich hab gedient und bei Arques gekämpft für meinen König; hab meine Lust gebüßt, an Ihrem Tisch zu sitzen. Vergebung nochmals, Sire, ich mußte mich dumm stellen, damit Sie über meine Scherze ein bißchen lachten. Jetzt ist das Unglück geschehen, ein Knecht wie ich hat mit Ihnen zu Abend gegessen.“
„Was machen wir nur dabei?“ fragte der König.
„Ich sehe ein einziges Mittel.“
„Nun?“
„Sie müssen mich in den Adelsstand erheben.“
„Dich?“
„Warum nicht, Sire? Ich arbeite mit meinen Händen, trag aber meine Gesinnung im Kopf und im Herzen meinen König.“
„Ausgezeichnet, lieber Freund, und dein Wappen wäre?“
„Meine Pute. Ihr verdank ich alle Ehre.“
„Dein bester Witz. Steh auf als ,Ritter von der Pute‘!“
Ein Ritterroman
Der neue Ritter sorgte selbst dafür, daß sein Erlebnis sich herumsprach und dem König beim Volk viel Nutzen brachte. Endlich ein braver Mann wie wir! Nicht stolz, läßt mit sich reden, obwohl ihm als Ketzer die Verdammnis gewiß ist. Ein Ketzer, der König, auch daran würde man sich gewöhnen, sofern Gott es bestimmt. Wird er ihn siegen lassen?
Der König fragte sich dies gleichfalls. Noch keine seiner Schlachten hat er so umsichtig vorbereitet. Er hebt die Belagerung von Dreux wieder auf, ja, zieht von überall seine Truppen ab, und läßt sich zurückdrängen bis an die Grenze der Provinz Normandie: nicht aber bis hinein. Er hält bei Ivry. Das ist noch Ile de France, das Herzstück, das Paris birgt.
Der Herzog von Mayenne aus dem Hause Lothringen hatte schon geglaubt, diesmal würde seine Überzahl allein genügen, und den Kampf brauchte es nicht. Der spanische General Farnese, Herzog von Parma, mußte ihm auf Befehl Don Philipps die Blüte seiner Armee überlassen, sechstausend Musketiere, zwölfhundert wallonische Lanzen; im ganzen befehligte Mayenne fünfundzwanzigtausend Mann. Was will dagegen ein König ohne Land, dessen Heer nicht ein Drittel so stark ist, und ihm gegenüber stehen Regimenter Spaniens! Das sind die nie besiegten Waffen der Weltmacht. Aber der König hält bei Ivry.
Es war der zwölfte März des Jahres 1590. Diesen Tag und die Nacht verbrachte Henri ganz anders als sonst die Stunden vor einem Kampf. Er ritt nicht von einer seiner Truppen zur anderen, um Mut zu verbreiten, man sah ihn nicht selbst mit Hand anlegen bei den Verschanzungen. Es gab keine, wurden auch keine gegraben. Weites Land, ein kleiner Fluß, jenseits die Übermacht, und hier ein Mann, der seinen Plan macht.
Er lag am Boden und zeichnete. Seine Marschälle Biron und d’Aumont erkannten ihn nicht wieder, indessen war er besessen von dem Gedanken an Parma. Der berühmte Feldherr kam nicht selbst, so wichtig schien ihm die Sache nicht — diese noch nicht; aber nachher wird Don Philipp ihn hersenden als den letzten Retter. ,Das gebe Gott. Herr! Dich rufen wir.‘
Henri betete auch. Sooft er von seinen Plänen aufstand, vertauschte er den Ehrgeiz, ein Stratege zu sein, mit der Inbrunst vor dem höchsten Ratschluß. Er betete mit seinen Truppen, hatte zwar denen von der anderen Religion freigestellt, in ihren Kirchen das Sakrament zu empfangen, und viele gingen dahin, die Kirchen der Umgegend waren voll. Die meisten Soldaten, ihres Glaubens ungeachtet, wollten den König das Gebet sprechen hören — und das tat er in der Mitte eines weiten Kreises von Truppen, führte das Gesicht über sie hin und hob es dann gegen die fliegenden Wolken, als brächte er Dem, der in der Höhe thronte, alles dar, was hier das Menschenherz bewegt. Es war aber das Menschenherz sein eigenes und erschütterte seine Brust. Davon trug seine Stimme weiter als jemals vorher. Dann wieder versagte sie vor großer Bewegtheit oder wurde entführt vom Wind. Seine Hugenotten der vorderen Reihen knieten, hielten die verwitterten Köpfe gesenkt, und fiel die Träne, sie ließen sie fallen.
Nach diesem himmlischen Umgang war Henri besonders fröhlich und gab allen von seiner Zuversicht. Die wurde auch anerkannt von dem hohen Umgang über der Wolke: fortwährend kamen Hugenotten weit hergeritten, um die Schlacht gewinnen zu helfen. In der Nacht regnete es, was nur für den Feind von Nachteil war: die Königlichen lagen in den Dörfern. Am Morgen stellte der König sie nach seinen Plänen auf; Mayenne, der von drüben zusah, verfolgte mit Staunen, wie alles pünktlich ging. Erst der dreizehnte, Mayenne will die Schlacht so schnell nicht liefern. Der Kampfhahn drüben soll vom Warten die Fassung verlieren; Husarenstreiche, damit verdirbt er die teure Zeit; holt einen Schweizer Obersten unter einem Apfelbaum hervor und fängt ein paar Landsknechte. Deswegen muß der Kampfhahn doch am Abend die kunstvolle Ordnung seines Heeres auseinandernehmen, war ganz umsonst getan.
Der vierzehnte. Geduldig stellt Henri alles wieder auf: die Reiterei des Marschalls d’Aumont, die des Herzogs von Montpensier, im Zentrum seine eigene, daneben Baron Biron, Sohn des alten Marschalls — und jede berittene Truppe sorgfältig gesichert durch Fußvolk, französische Regimenter, Schweizer Regimenter, sogar Landsknechte von jenseits des Rheins. Macht alles zusammen immer nur sechs- oder siebentausend Mann zu Fuß, zweitausendfünfhundert zu Pferd. Eng formiert wie sie stehen, hält der Feind sie von fern für noch weniger. Der Feind zieht seine Linie im Gegenteil recht lang, um seine Übermacht hervorzukehren. So groß diese war, sie hat inzwischen abgenommen. Erstens, weil der König fortwährend Zulauf bekommt, der neue Ritter von der Pute und tausend seinesgleichen, die um des Vertrauens willen kommen, und ihr Gewissen führt sie her. Auf der anderen Seite aber sind der Liga letzthin viele entlaufen — nicht allein wegen des Regens und anderen Ungemachs, auch aus nackter Furcht. Sie haben erfahren, unbekannt woher, daß der König den Sieg haben wird.
Er selbst blieb bei der Vernunft und hoffte nur, mit ihr werde auch Gott sein. Zwischen neun und zehn war seine Schlachtordnung instand wie gestern, nur etwas gedreht mit Rücksicht auf Wind und Sonne und den Rauch der Arkebusen. Henri erging sich ganz in der himmlischen Fröhlichkeit wie immer vor seinen Schlachten, wenn das Gebet getan ist und nur der Kampf bleibt. Daran erkannte allerdings jeder den Sieg. Ein Dichter unter seinen Offizieren, Du Bartas, acht Jahre älter als Henri von Navarra, sein Gefährte seit der Jugend durch viele Höhen und Tiefen, die Bartholomäusnacht, die lange Gefangenschaft im Louvre, die Kämpfe, die Siege, der Aufstieg zum Thron, das Schwanken des Kriegsglückes — Du Bartas, ein langer Mensch mit verdüstertem Gesicht, der mehr vom Tod als vom Leben hielt und je länger, um so weniger vom Leben, um so mehr vom Tod: er sah damals Henri. Erblickte ihn noch einmal mit voller Liebe und so starker Zuversicht, wie einst in ihrer Jugend, als sie in einem engen Haufen, Pferd an Pferd, durch das Land ritten. Hugenotten, in ihren beschwingten Geistern war dies Land das heilige, sie hielten sich bereit, daß an der nächsten Wegbiegung Herr Jesus leiblich zu ihnen stieße, sie hätten ihn angerufen: Sire! Sie wären ihm nachgefolgt und hätten für ihn gesiegt. So stand es zuletzt nochmals für Du Bartas, als er den König erblickte bei Ivry.
Henri blieb stehen, weil dieser Blick ihn festhielt. „So sollen wir denn wieder für die Religion kämpfen“, sagte er. „Du warst immer in Sorge, Du Bartas, wegen der Verblendung und Bosheit der Menschen. Wird unser Sieg und Königreich sie vielleicht belehren?“
„Vielleicht“, sagte diese Brust voll Vorgefühl. „Ich hoffe es. Die wenigstens, die berufen sind, den Sieg in Gottes Auge zu sehen. Sire! Sie müssen mich entlassen.“
„Nein“, bestimmte Henri und senkte den Ton. „Das wär ein Stück Leben, die alten Freunde, die Zeit der glücklichen Dunkelheit. Ich will’s nicht missen und verlieren. Bleibt bei mir, was würde sonst aus mir. Du Bartas, früher schickte ich dich insgeheim an die Höfe. Wie hab ich deine Reisen bezahlt?“
„Einmal hundertfünfzig Taler, einmal fünfundachtzig.“
„Das nächste Mal wirst du Gouverneur einer großen Stadt.“
„Das alles war“, sagte Du Bartas. „Herr! Heute diene ich noch Ihnen, morgen schon einem Größeren. Hab auch das Lied gemacht, das Sie singen sollen, zum Dank für Ihren Sieg.“ Er gab es hin. „Und ist nicht meines, sondern Ihres, gedacht und erfunden von Ihnen selbst. Das sollen Sie laut sagen, damit in Ihrem Ruhm ein Rest von mir auf Erden fortlebt.“
Hier wurden sie unterbrochen, was Henri nicht ungern sah. Allerdings war es der Schweizer Oberst Tisch, und kam wegen des Soldes für seine Leute. So kurz vor der Schlacht war der rechte Augenblick. Der König hatte es ihm sofort angesehen und brach in Zorn aus — machte sogar mehr daraus, als er wirklich fühlte, damit Tisch das Geld vergäße über diesen großen Zorn. Der Schweizer bekam auch einen dunkelroten Kopf und hielt den Mund gepreßt, sonst hätte er auf die starken Worte des Königs erwidern müssen. Zuletzt sah Henri ihm nach, wie er abging in seinen großen Stiefeln, und dachte, daß es für die Schweizer zu spät wäre, ihn zu verlassen. Sie mußten nun kämpfen, und um so besser, je mehr die Beute ihre ganze Hoffnung war, daß sie zu ihrem Gelde kämen.
Unerläßlich aber ist wenigstens der Entschluß zu kämpfen. Die anderen Schweizer drüben beim Feind, die auch nicht bezahlt waren, wußten überdies, daß der König von Frankreich der Verbündete ihrer Eidgenossen war, und wollten keinen Streich tun in dieser Schlacht. Das war ihr Wort, beide kannten es, Henri so gut als sein Oberst Tisch, darum war keiner wegen des anderen ernstlich in Sorge. Sie sollten gewinnen. Henri hatte einen riesigen weißen Federbusch an seinen Hut gesteckt, ein ebenso großer nickte auf dem Kopf seines Pferdes. Er ritt vor die Front seines Heeres hin und sprach: „Kameraden! Gott ist für uns, dort unser Feind, hier euer König! Drauf! Und weht die Standarte euch nicht mehr voran, sucht meinen weißen Federbusch, ihn findet ihr, wo immer es zu Sieg und Ehre geht!“
Reckt sich, denkt hinter seinem schmalen Gesicht, den aufgerissenen Augen: ,Habt ihr doch was zum Staunen. Mein Hut! Mich kostet er hundert Taler mit dem weißen Amethysten und den Perlen. Der Federbusch ist außerdem. Und die Schweizer werden kämpfen!‘ — denkt er noch, erkennt aber schon, wie das feindliche Heer in Bewegung kommt, vornweg ein Mönch: der hat dem Feinde versprochen, vor seinem großen Kreuz würden die Ketzer davonlaufen. Henri, den Befehl zum Angriff auf den Lippen, jagt diese letzte Minute die Front hin, bis vor seine Schweizer. „Oberst Tisch!“ Umarmt ihn von Pferd zu Pferd. „Ihnen hab ich unrecht getan, will aber alles gutmachen.“
„Ach! Sire, Ihre Güte wird mich das Leben kosten“, entgegnete der alte Oberst. Da trennten sie sich und jagte schon jeder seiner Truppe voran gegen den Feind. Zuallererst stieß auf ihn der Marschall d’Aumont, er schlug die leichte Reiterei des Feindes zurück. Gleich nachher warfen deutsche Reiter die Schwadronen des Königs in Unordnung gegen sein Fußvolk, was große Verwirrung bei den Königlichen anrichtete. Zu allem Unglück fällt jetzt auch Graf Egmont mit seinen Wallonen die Königlichen an, auf einmal begegnen diese Spanien und Haus Habsburg, haben aber noch niemals der unbesiegten Weltmacht so nah ins Auge gesehen. Das ist furchtbar, und aus dem ersten unglücklichen Zusammenstoß könnten alsbald die Flucht und das Ende werden. Ein Königlicher im Getümmel zum anderen, schnell bevor es ihn weiterschiebt:
„Na, alter Ketzer, wer gewinnt die Schlacht?“
„Ist für den König verloren. Bliebe er nur leben!“
Rosny, sonst ein unbeirrter Ritter, urteilt nicht günstiger — hat schon fünf Verwundungen, sowohl von Pistolen wie von Schwertern und Lanzen, hält es für genug und schleppt sich aus dem Getümmel fort, bis unter einen Birnbaum. Hängen noch Zweige schützend über ihm. So voll Wunden, will niemand den Schlachtenlärm hören, und Rosny, später Sully genannt, fällt erst einmal in Ohnmacht. Kein Donner der Kanonen weckt ihn.
Wie in seinen anderen Schlachten hatte der König für sich die Kanonen und verstand es, sie richtig zu gebrauchen. Die feindlichen schossen über ihn weg, die seinen trafen. Als erster riß der Mönch aus, der zuviel versprochen hatte. Nun war das Heer der Liga ein Heer des Aberglaubens und der unwahrhaftigen Vermessenheit: mit seinen Lügen zugleich wurde es selbst erschüttert, wie es vorher durch sie zu großmächtig gewesen war. Das taten die Kanonen des Königs. Aus bloßem Haß machte Graf Egmont mit Spaniern und Landsknechten einen Todesritt gegen die Kanonen. Stieß den Hintern seines Pferdes in eines der feuerspeienden Rohre, um dieses zu demütigen, da es nach seiner Meinung die Waffe der Ketzer und Feiglinge war. Indessen spie es gerade nicht. Statt dessen fielen die Reiter des Königs über den unbedachten Feind her und hieben ihn in Stücke, auch Egmont selbst. Der Herzog von Braunschweig fiel beim Angriff seiner deutschen Reiter, die alsbald flüchteten. Henri! Übersieh nicht im Drang der Vorgänge, daß die flüchtenden Deutschen sehr plump gegen ihre eigene Front prallen: rechts wankt sie.
Ein Augenblick, unmeßbar, unwägbar, versäum ihn, es ist aus. Der König hält, er steht in den Steigbügeln auf. Als müßte der Augenblick dennoch gemessen werden, faßt er nach seiner Taschenuhr, hat sie aber verloren: achtzig Taler, und der Augenblick unmeßbar. Sein Plan war anders; wahrhaftig hat der ehrgeizige Stratege niemals aufgezeichnet oder vorgesehen, was er jetzt unternehmen wird. Ein Blick rückwärts, wo alles schweigt, plötzlich tief schweigt: „Dreht das Gesicht her! Und wollt ihr nicht kämpfen, seht mich sterben.“ Schon schnellt er vor um zwei Pferdelängen, dringt wütend in den Wald der feindlichen Lanzen, packt sie mit den Händen, hält die Feinde auf, bis seine Reiter da sind. Hält sie nicht nur mit seinen Händen auf, sondern zeigt ihnen sein Gesicht, das Macht und Hoheit spricht: sonst vielleicht anderes, hier Hoheit und Macht. Zuerst die Beschämung mit dem Mönch, dann ihr Schrecken vor den Kanonen, jetzt aber das Gesicht des Königs. Sie haben den Augenblick versäumt, die Spanier, Franzosen, deutschen Reiter! Königliche über ihnen, zerhauen sie, versprengen sie, durchstoßen die gelichtete Front des soeben noch furchtbaren Feindes. Ein Reiter bringt dem König seine Uhr zurück, was besonders erstaunlich ist, und sagt dazu:
„Sire! Vor weniger als einer Viertelstunde waren wir geschlagen.“
„Schont die Franzosen!“ rief der König den Verfolgenden nach. Die Schweizer der Liga ergaben sich, sie hatten keinen Streich getan. Der König selbst, an der Spitze von nur fünfzehn oder zwanzig Pferden verfolgte eine Schar von mehr als achtzig Flüchtenden. Als er anhielt, hatte er eigenhändig sieben getötet und eine Fahne erobert. Auf der Stelle, wo er anhielt, endeten Schlacht und Sieg von Ivry. Der König stieg vom Pferd und kniete hin. Seinen Hut warf er zu Boden: Niemand mehr sollte sich nach dem großen weißen Federbusch richten, gern wäre er allein und allen fern gewesen; viel versprengtes Getümmel erscholl aber allseits aus der Ebene. Der König, kniend, zog aus der Brust ein Blatt Papier, das Danklied, geschrieben von seinem alten Gefährten Du Bartas.
Ganz entfernt mühte sich Mayenne aus dem Hause Lothringen, Führer der großmächtigen Liga, mühte sich, so beleibt er war, verzweifelt mit nur zwei der Seinen, ob er nicht doch noch eine Streitmacht sammeln könnte. Ganz entfernt, in anderer Richtung, erwachte ein übel zugerichteter Ritter — sollte aber dereinst der berühmte Herzog von Sully sein — aus seiner Ohnmacht unter einem Birnbaum.
Rosny betastete seine Glieder und Körperteile, keines war ganz, Schwerter, Pistolen und Lanzen, alle hatten ihn zugerichtet, und war auch noch mit dem Pferd gestürzt: mit seinem ersten, als diesem der Bauch aufgeschlitzt worden war. Auf sein zweites besann er sich gar nicht mehr. Wo er an sich hingriff, war geronnenes Blut. ,Jämmerlich muß ich aussehen‘, dachte der Baron, dem viel an seinem glatten Gesicht lag. Der Abend sank. ,Mein Schwert in Stücken, mein Helm verbeult, den Panzer muß ich ausziehen, schrecklich drückt das verbogene Eisen meinen wunden Leib.‘ — „He! Arkebusier, wohin so eilig? Komm näher, fünfzig Taler für den Gaul, den du am Zügel führst! Aber du mußt mir hinaufhelfen.“
Kaum hat der Kerl das Geld, läuft er. Der Ritter, im Sattel schwankend vor Blutverlust, Hunger, Durst und Schwäche, findet die Richtung nicht, irrt über das Schlachtfeld: da stößt er auch noch auf den Feind — andere Ritter, ihre Standarte besät mit den schwarzen Kreuzen von Lothringen. Wollen mich gewiß gefangennehmen, die Schlacht haben wir nun einmal verloren.
„Wer da?“ rief einer der Edelleute von der Liga.
„Herr de Rosny, im königlichen Dienst.“
„Wie, was, Sie kennen wir doch. Erlauben Sie, Herr de Rosny, daß wir uns Ihnen vorstellen. Wollen Sie die Höflichkeit haben, uns gegen Lösegeld gefangenzunehmen?“
„Wie, was“, sagte zuerst auch er. Aber das Wort „Lösegeld“ klärte ihm alsbald den Kopf auf. Fünf vermögende Edelleute, und jeder wollte nach seinem Wert bezahlen. Da erfaßte Rosny die Lage. Unter seinem Birnbaum war er unversehens zum Sieger geworden.
Danklied
Sein König inzwischen kniete auf dem Schlachtfeld, seine Gesellschaft waren weithin nur Tote, zu mehreren oder vereinzelt, und es wurde dunkel um ihn. Seine Reiter vom letzten Treffen hatten ihn verlassen, da sie bemerkten, daß er von einem Blatt ablas und die Lippen bewegte. Es war Nacht, er steckte das Papier weg, das allerdings ein Danklied übermittelte — ihm klang es zu prachtvoll und auch wieder zu traurig. Sein eigener Dank an Gott den Herrn war, daß er ihn vernünftig nannte. „Gott ist immer auf Seiten der Vernunft“, sagte Henri, hier kniend nach der Schlacht; später aber aufrecht auf dem Thron sprach er dasselbe.
Meine Feinde haben armselige, aufgeblasene Köpfe voll Lug und Trug: darum. Sie vermessen sich eines Ehrgeizes und Machtdünkels, die ihnen nicht zukommen: darum der Zorn des Herrn. Ihr Glaube ist bestimmt falsch, schon weil es der ihre ist; und gegen sie arbeitet die Vernunft Gottes. Denn die ist für das Königreich.
So hieß sein Bekenntnis und klang ihm klar wie nie in der Schattenstille eines verlassenen Schlachtfeldes. Darum berührte ihn zum erstenmal kein Mitleid mit den Geschlagenen. Tausend von ihnen mußten niedergemacht sein, gewiß fünfhundert gefangen, und im Fluß ertrunken wer weiß wie viele. ,Indessen hat die Geduld des Herrn ihre Grenzen. Verlieren auch all ihr Gepäck an uns, wir setzen ihnen nach, und so erleichtert sie dahinfliehen, diesmal wollen wir früher als sie in Paris sein. Das gib, o Herr, denn Deine Geduld hat ihre Grenzen.‘
So lautete seine Andacht nach dem Siege, anstatt daß er sonst um jedes seiner getöteten Landeskinder Tränen vergoß. Das Böse wird aber zuletzt unverzeihlich, was Henri hier durchaus empfand, und den dicken Mayenne würde er aufgehängt haben.
Jetzt wurden dort hinten einige Lichter von Fleck zu Fleck bewegt. Der König ging zu seinen Edelleuten, die unter den Toten die Ihren suchten. „Das ist Herr de Fouquières“, stellte er fest. „Er hätte nicht fallen sollen, ich brauchte ihn noch.“
Sie sagten ihm, daß der Gefallene eine Frau hinterlasse, und diese erwarte ein Kind.
Der König verfügte: „Seine Pension geb ich dem Bauch.“