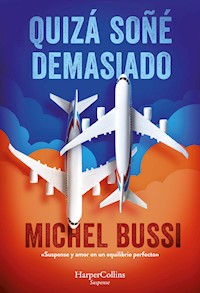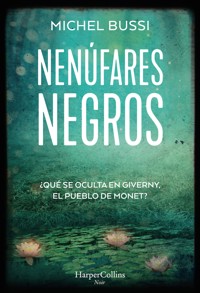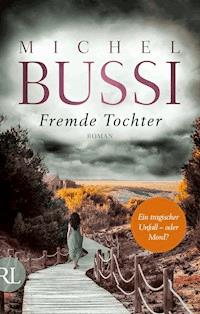13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Junge verschwindet, zehn Jahre später taucht sein Doppelgänger auf.
Zehn Jahre ist es her, dass Maddis Sohn Esteban spurlos am Strand verschwand. Zum Jahrestag des Unglücks kehrt sie zurück, will einen Abschluss finden. Doch dann sieht sie einen Jungen, der Esteban zum Verwechseln ähnelt. Je länger Maddi ihn über die Tage beobachtet, desto mehr Parallelen fallen ihr auf. Verliert sie, die sonst so rational denkende Ärztin, den Verstand? Oder wiederholt sich die Geschichte, und der Junge schwebt in Gefahr? Eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit beginnt, und plötzlich befindet sich Maddi in einem Strudel aus Ereignissen, den sie nicht mehr zu beherrschen vermag ...
Ein hochemotionales Spiel um Identität von Bestsellerautor Michel Bussi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Maddi hat Jahre gebraucht, um nach dem Verschwinden ihres Sohnes Esteban wieder halbwegs im Leben Fuß zu fassen, doch der Schmerz und die Fassungslosigkeit bleiben. Zum zehnten Jahrestag kehrt sie in die kleine Stadt im Baskenland zurück. Sie hofft auf diese Art, einen Abschluss zu finden. Doch dann sieht sie am Strand einen Jungen, der Esteban zum Verwechseln ähnelt. Doch wie kann das sein? Ihr Sohn wäre mittlerweile 20 Jahre alt. Eine fieberhafte Suche nach der Identität des Jungen beginnt, während der Maddi immer tiefer in einen Strudel aus Schein und Wirklichkeit gerät und schließlich um ihr Leben fürchten muss.
Über Michel Bussi
Michel Bussi, geboren 1965, Politologe und Geograph, lehrt an der Universität in Rouen. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren Frankreichs. Seine Bestseller wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und sind internationale Bestseller.
Im Aufbau Taschenbuch liegen seine Romane „Das Mädchen mit den blauen Augen“, „Die Frau mit dem roten Schal“, „Beim Leben meiner Tochter“, „Das verlorene Kind“, „Fremde Tochter“, „Nächte des Schweigens“ und „Tage des Zorns“ vor.
Mehr zum Autor unter www.michel-bussi.fr
Eliane Hagedorn studierte Germanistik an der LMU München und Französisch an der Sorbonne. Sie übersetzt seit 30 Jahren aus dem Französischen und lebt in Deutschland und Frankreich. Sie übertrug u. a. Guillaume Musso und Marc Levy ins Deutsche.
Barbara Reitz absolvierte ihr Studium am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Uni Heidelberg. Seit 30 Jahren übersetzt sie hauptsächlich aus dem Französischen, aber auch aus dem Spanischen und Englischen. Sie übertrug u. a. Elena Sender und María Dueñas ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michel Bussi
Das Kind in den Wellen
Thriller
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
DAS ERSTE LEBEN — DIE KINDLICHE SEELE
I: DAS VERSCHWINDEN — Esteban
1
2
ZEHN JAHRE SPÄTER
3
4
DAS ZWEITE LEBEN — DIE KINDLICHE SEELE
II: DER UMZUG — Willkommen in Murol
5
6
7
12:45 Uhr
8
III: DIE ERSCHEINUNG — Bio-Lauch
9
10
DREI TAGE SPÄTER
11
12
13
DAS DRITTE ALTER — DIE JUNGE SEELE
IV: DIE INTUITION — Apiphobie
14
15
16
17
18
17:30 Uhr.
19
20
21
V: DIE ADOPTION — Der Wolfssprung
22
23
24
25
26
27
28
VI: DIE FESTNAHME — Die Rückkehr des Surfers
29
30
31
32
33
34
35
36
37
VII: DIE VORAHNUNG — Essen in der Suppenküche
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
DAS VIERTE LEBEN — DIE REIFE SEELE
VIII: DAS ZIEL — Eine Barke auf dem See
48
49
50
51
8:32 Uhr.
52
53
54
IX: DIE FESTNAHME — Les Grottes de Jonas
55
56
57
58
59
X: DIE GEFANGENSCHAFT — Der Brunnen der Seelen
60
61
62
63
64
65
66
67
XI: DIE AUFLÖSUNG — KidControl
68
69
70
71
XII: Die Exekution — Das Sterbezimmer
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
XIII: DIE REINKARNATION — Engelsstaub
85
86
87
Quellennachweis:
Impressum
Wer von diesem spannenden Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Isabelle und Marie-Claude in Erinnerung an die Auvergne
Wenn ich seine Flügel gestutzt hätte, wäre er ganz mein gewesen wäre niemals davongeflogen. Ja, aber dann … Wäre er kein Vogel gewesen, Und ich, ich habe ihn doch geliebt, den Vogel.
Txoria Txori von Joxean Artze, Aus dem Baskischen von Michel Bussi ins Französische übersetzt
Professor Ian Stevenson von der University of St Andrews hat Tausende Berichte von Kindern aus aller Welt ausgewertet, die behaupten, sich an ihre Reinkarnation zu erinnern. Dank diesen Studien spricht man heute vom »Stevenson-Modell«, denn die untersuchten Fälle weisen erstaunliche Übereinstimmungen auf: Mit einer Rate von fünf Prozent ist eine Änderung des Geschlechts eher selten; das Kind beginnt mit etwa zwei Jahren, sich über sein früheres Leben zu äußern. Für gewöhnlich hört das mit dem zehnten Lebensjahr auf; das vorherige Leben endete meist gewaltsam und frühzeitig; körperliche, somatische und psychische Anomalien wie Narben, Geburtsmale, Phobien oder unerklärliche Begabungen treten daher gehäuft auf.
»Und ist dieser Professor Stevenson ein ernstzunehmender Forscher? Ich meine, ist er Wissenschaftler? Arbeitet er an einem Institut? Also ist das alles Humbug oder kann man ihm Glauben schenken?«
»Was meinst du mit ›Kann man ihm Glauben schenken‹?«
»Naja, seinen Behauptungen. Entsprechen sie der Wahrheit oder nicht?«
»Wie soll man deiner Meinung nach bestimmen, ob etwas der Wahrheit entspricht oder nicht?«
»Ich … ich weiß nicht … Ich denke, wenn die Mehrheit der Menschen etwas für wahr hält, dann muss es doch wohl eher richtig als falsch sein.«
»Also, wenn man die Hindus, die Buddhisten, aber auch ein Viertel der Europäer und fast ein Drittel der Amerikaner zusammenzählt, so glaubt eine Mehrheit der Weltbevölkerung an die Reinkarnation, und somit daran, dass unser Körper nur ein Kleidungsstück ist …, welches unsere Seele überdauert.«
»Und dass die Seele es austauscht, wenn es zu abgenutzt ist, ja? Ist das Reinkarnation? Die Seele ist wie ein Floh, der von einem Menschen zum anderen hüpft oder von einem Menschen zu einem Hund, von einem Hund auf eine Katze und dann von einer Katze auf eine Ratte – so einfach ist das?«
»Nein, so einfach ist das nicht. Im Gegenteil, es ist eine lange Reise. Eine Reise, an die wir im Allgemeinen keine Erinnerung haben. Es sei denn, sie schlägt fehl …«
»Was soll das heißen, sie schlägt fehl?«
DAS ERSTE LEBEN
DIE KINDLICHE SEELE
Lass es mich dir erklären, Maddi. Das ist gar nicht so kompliziert. Die kindlichen Seelen sind diejenigen Seelen, die ihre Reise beginnen. Sie entdecken das Leben und den Tod. In diesem Stadium ist es ihr einziges Ziel, zu lernen, wie man überlebt.
I
DAS VERSCHWINDEN
Esteban
1
Ich bin sehr rational. Aus tiefster Überzeugung unabhängig. Absolut frei. Relativ wohlhabend.
So, hoffe ich, sieht mich Esteban mit seinen zehn Jahren. Dieses Bild, so glaube ich zumindest, vermittle ich auch meinen Patienten. Doktor Maddi Libéri, Allgemeinmedizinerin, 29 Boulevard Thiers in Saint-Jean-de-Luz. Vertrauenswürdig, stark, ehrlich. Niemand soll meine Schwächen, meine Zweifel, mein tiefstes Inneres kennen. Vor allem nicht mein Sohn.
Meine Wohnung im dritten Stock in der Rue Etchegaray bietet einen der schönsten Blicke auf den großen Strand, die Grande Plage, etwa hundertfünfzig Steinwälzer-Flugmeter – das ist der typische Vogel der baskischen Küste – entfernt oder einen fünfundvierzig Sekunden-Sprint meines kleinen Sohnes.
Das lassen wir uns nicht nehmen. Es ist unser – Esteban und mein – morgendliches Ritual, vor meiner ersten Sprechstunde und seinem Aufbruch zur Schule, sogar vor unserem gemeinsamen Frühstück: Wir ziehen an, was wir vor unserem Bett auf dem Boden finden, und laufen zum Strand hinunter. Und sobald im Frühling das Wasser wärmer als siebzehn Grad ist, gehen wir auch schwimmen. Alle Straßen von Saint-Jean-de-Luz führen zum Meer, als wäre die Stadt von Anfang an so konzipiert worden, dass man von jedem Balkon aus einen Zipfel des Atlantiks sehen kann.
Es ist kurz vor acht Uhr. Der Strand ist noch fast menschenleer. Ich zähle etwa zwanzig Touristen auf dem langgezogenen Abschnitt zwischen dem Damm von Chevaux und dem Hafendamm. Wir haben uns gegenüber der Terrasse des Toki Goxoa, dem Panorama-Restaurant mit den bunten Kacheln, niedergelassen. Nun ja, niedergelassen ist ein großes Wort. Esteban hat sein rotes Strandtuch, das er à la Superman um den Hals trug, in den Sand fallen lassen, seinen Sweater von Biarritz Olympique über den Kopf gezogen und die grünen Leinenschuhe abgestreift.
»Gehen wir schwimmen, Maman?«
»Eine Sekunde, mein Großer.«
Berufsbedingter Reflex. Ich prüfe erst alles mit wachsamem Blick. Zunächst Esteban: sein magerer Körper, seine vorstehenden Knochen, seine Schienbeine, die aus einer übergroßen indigoblauen Badehose ragen – dieselbe Farbe wie der baskische Himmel an diesem Morgen – und geschmückt von einem weißen Wal, der auf das linke Bein gedruckt ist. Esteban liegt, was Größe und Körpergewicht angeht, genau im Durchschnitt für sein Alter. Jeden Samstag nach meiner letzten Sprechstunde wird er gemessen und gewogen. Ein weiteres unserer Rituale. Den wöchentlichen Kebab-Teller gibt es nur, wenn die rote Filzstiftkurve nicht von der Norm abweicht.
»Also gehen wir jetzt endlich, Maman?«
Esteban wartet ungeduldig, dass ich mich ausziehe. Vor Verlassen der Wohnung habe ich eine einfache Häkeltunika übergestreift. Damit man auch die Farbe meines Bikinis sieht. Ich liebe diesen leichten, netzartigen Stoff auf meiner Haut, der meinen Bauch und die Hälfte der Oberschenkel bedeckt. Ich liebe es, mich mit fast vierzig Jahren noch begehrenswert zu fühlen und das nicht nur in den Augen der Rentner, die ihre Pudel auf dem Quai de l’Infante Gassi führen.
Dann suche ich den Horizont ab. In der Ferne, Richtung Hendaye und der Plage de Socoa, kämpfen Surfer in ihren schwarzen Neoprenanzügen, aufgereiht wie Kolonien von Ameisen, mit den hohen Wellen. Hinter uns lässt der Wind des Atlantiks die Ikurriñas, die baskischen Flaggen, am Rand der Mole, geräuschvoll flattern.
»Nein, heute nicht, mein Großer. Die Brandung ist zu stark!«
»Wie bitte?«
Esteban starrt ungläubig aufs Meer. Die Wellen sind mehrere Meter hoch. Er ist nicht blöd. Er weiß, dass Schwimmen unter diesen Umständen unmöglich ist. Trotzdem insistiert er, wohl mehr der Form halber.
»Maman, heut’ ist mein Geburtstag!«
»Ich weiß. Und? Was ändert das? Wir wollen doch nicht ertrinken, weil heute der Tag deiner Geburt ist!«
Esteban lächelt mich an – dieses unwiderstehliche Petit-Prince-Lächeln, das jede Mutter schwach werden lässt. In seinen hellen Augen blitzt ein Hauch von Traurigkeit auf, wie ein Kratzer auf seinem Herzen. Ich fahre mit der Hand durch sein blondes Haar, um ihn zu trösten, aber auch um es ein wenig zu zerzausen. Ich mag ihn so, meinen kleinen Prinzen. Halb Träumer, halb Rebell. Und jeden Abend auf meinem Balkon, wenn Esteban wie ein Baby schläft, danke ich dem Planeten, von dem er gefallen ist.
»Wir schwimmen morgen, mein Großer! Oder noch heute Abend, wenn ich früh genug fertig bin …«
Er tut so, als würde er mir glauben.
»Okay, Maman.«
Er weiß genau, dass es nicht meine Art ist, meine Patienten rasch abzufertigen. Wir beide verstehen uns, ohne uns ausdrücklich erklären zu müssen. Es reicht ein Blick, Vertrauen, Einverständnis. Kein Mann könnte sich jemals zwischen uns stellen! Ich muss einen leeren Platz neben mir im Bett behalten, für Esteban, wenn er im Morgengrauen zu mir kommt. Niemals könnte ein Liebhaber mich morgens mit einem so kristallklaren Ich hab dich lieb wecken.
Ich krame rasch in meiner Tasche und reiche Esteban eine Ein-Euro-Münze.
»Du holst uns trotzdem ein Baguette?«
Noch eines von unseren Ritualen, eingeführt als Esteban in die fünfte Grundschulklasse kam, zu den Großen! Nach unserem morgendlichen Bad trocknet er sich ab, zieht seinen Pulli über und rennt los, zum Bäcker. Allein! Eine Minute und fünfunddreißig Sekunden im vollen Galopp. So hat er sogar noch genügend Zeit, den Frühstückstisch zu decken, während ich dusche: Schwarzkirschmarmelade, Schafsmilchjoghurt, Fruchtsaft tags zuvor gepresst. Wir frühstücken zusammen, er duscht, während ich mich schminke, und wir machen uns beide, Hand in Hand auf den Weg – ich in meine Praxis, er zur Schule.
Esteban schließt die Hand zur Faust um die Geldmünze.
Warum habe ich es an diesem Morgen so eilig, nach Hause zu kommen?
Ohne das Schwimmen haben wir alle Zeit der Welt.
Warum habe ich mich damit begnügt, ein paar Sandkörner von seiner Schulter abzuwischen, meinen Blick bis zum oberen Saum seiner Badehose gleiten zu lassen, reflexartig die Entwicklung seines Angioms an seiner Leiste zu kontrollieren, bevor ich ihn habe loslaufen lassen?
Warum habe ich mich nicht umgedreht? Warum habe ich mich nicht vergewissert, dass er sein Strandtuch aufhebt? Dass er seinen Pulli überzieht? Dass er zum Bäcker über die Rue de la Corderie läuft?
Weil man Rituale dafür erfindet? Um sich sicher zu fühlen? Um alles zu kontrollieren? Um sich einzureden, dass nichts passieren kann? Weil man sich in Sicherheit wähnt, wenn man immer dieselbe Routine hat?
In Wirklichkeit ist man nur weniger wachsam. Aus Faulheit lässt man es an Vorsicht mangeln. Und an Verantwortung.
•••
»Esteban?«
Ich strecke nur den Kopf aus der Dusche und lasse das heiße Wasser dabei weiter über meine Haut laufen. Die Wand des Badezimmers, die sich auf einige türkisfarbene marokkanische Kacheln rund um einen zwei auf drei Meter großen Spiegel beschränkt, wirft mir das Bild meines nach den ersten Frühlingsausflügen gebräunten Körpers zurück – der Aufstieg zu La Rhune, die Wildwassertour auf dem Fluss Nive, die ersten ungeschickten Stand-up-Paddling-Versuche auf dem Lac de Saint-Pée, das Surfen südlich von Guéthary, das baskische Pelota-Spiel in Arcangues. Wir haben noch das ganze Leben vor uns, um Champions zu werden, Esteban.
»Esteban?«
Meine Hand tastet nach dem Hahn, mir gelingt es ihn zuzudrehen, ohne alles nass zu spritzen. Ich wickele mich in ein Badetuch. Den Spiegel im Rücken. Die Inspektion meiner Mängel kann warten.
»Esteban, bist du zurück?«
Nur Patrick Cohen antwortet mir, es ist 8:30 Uhr auf France Inter, und der Journalist beginnt seine Sendung mit der Mitteilung, dass die französische Fußballmannschaft sich in Südafrika geweigert hat, den Bus zum Training zu verlassen. Passiert nichts Wichtigeres auf den fünf Kontinenten? Und übrigens, was hat Patrick Cohen in meinem Wohnzimmer zu suchen?
»Esteban?«
Morgens, wenn er vom Bäcker zurückkommt, und ich unter der Dusche stehe, nutzt er die Gelegenheit, um den Sender zu wechseln, Fun, Sky, NRJ, oder, öfter noch, schaltet er sogar das Radio aus, um ein paar Gitarrenakkorde zu improvisieren. Bisweilen kritzelt er etwas in den Partituren seiner eigenen Kompositionen herum. Esteban ist begabt, ich bin sicher, dass sein Gehör perfekt ist, auch wenn ich mir nie die Zeit genommen habe, ihn testen zu lassen.
Ich trete aus dem Badezimmer. Meine nackten Füße hinterlassen Pfützen auf dem Parkett aus Pappelholz, dieses Holz, das man nicht nass wischen und schon gar nicht befeuchten darf. Der kleinste Tropfen bildet für immer einen Wasserfleck … Soll mir egal sein! Eine dumpfe Angst packt mich. Ich mache einen Schritt in Richtung offen stehender Küche, bevor ich wie versteinert stehen bleibe.
Die Abdrücke meiner Füße werden für immer auf dem Rohholz zu sehen sein. Ich bin außerstande mich zu bewegen. Außerstande, auf etwas anderes zu starren als auf den leeren Küchentisch. Auf die Gitarre, die brav auf ihrem Ständer steht.
Esteban ist nicht nach Hause zurückgekommen.
Ich unterdrücke einen Schrei. Ich versuche mir einzureden, dass er sich vielleicht einen Scherz mit mir erlaubt. Ich öffne die Türen unserer Zimmer, unserer Wandschränke, der Toilette, ich schaue unter die Betten, ich klettere auf einen Hocker, um oben auf dem Schrank nachzusehen, wäre dabei beinahe umgekippt, ist mir doch egal, ich öffne erneut die Türen aller Möbel, des Kühlschranks, des Backofens, mein Herz ist kurz davor zu explodieren, ich erkenne inzwischen sehr gut die Anfänge einer Angstattacke.
Wo kann Esteban nur sein? Heute! Am Tag seines Geb…
Plötzlich kommt mir eine Idee!
Ich stürze ins Bad. Ich weiß nicht, wie er’s gemacht haben könnte, aber Esteban ist gewieft; er hat gewartet, bis ich unter der Dusche stand, um sich zu verstecken. Oder genauer gesagt, um zu suchen, was ich dort versteckt haben könnte! Ich kauere mich nieder, halte den Atem an und öffne den Schrank unter dem Waschbecken.
Es ist da …
Sein Geburtstagsgeschenk! Eine Lyra-Gitarre, ein seltenes Instrument, bei dessen Anblick Esteban jedes Mal vor dem Schaufenster von Atlantic Guitar ins Träumen gerät: Sie hat den Sound einer elektrischen Rockgitarre und die Form eines antiken Instruments. Esteban hätte sich nie vorstellen können, dass seine Maman ihm …
Ich kappe den Strom meiner Gedanken.
Esteban ist nicht da!
Esteban hat nicht versucht, sein Geschenk zu finden. Esteban ist nirgendwo in der Wohnung. Esteban ist nicht nach Hause gekommen.
Das ist noch nie passiert!
Mit verschwommenem Blick und zitterndem Handgelenk schaue ich auf meine Uhr. Ich habe ihn vor etwa fünfundzwanzig Minuten losgeschickt. Er braucht höchstens drei, um zur Bäckerei zu laufen, zu bezahlen und zurückzukommen …
Mein Badetuch gleitet zu Boden, ohne dass ich den Knoten lösen muss. Ich ziehe das nächste herumliegende Kleidungsstück über, ein langes T-Shirt, und laufe die Treppe hinunter. Ich überquere die Rue Etchegaray, dann die Rue Saint-Jacques. Die meisten Läden sind geschlossen, nur ein paar Achtzigjährige schlendern durch die Fußgängerzone. Sie kommen mir entgegen, ohne Zeit zu haben, sich umzudrehen, und die Form meines Hinterns unter dem zu kurzen T-Shirt zu begutachten und sich zu fragen, ob sie richtig gesehen haben.
Mit vollem Schwung stoße ich die Glastür des Fournil de Lamia auf und halte sie gerade noch fest, ehe sie in tausend Stücke zerspringt.
»Haben Sie meinen Sohn gesehen?«
Ich nehme mir nicht die Zeit, um mich zu vergewissern, ob noch andere Kunden im Laden sind. Die Bäckersfrau starrt mein leichenblasses Gesicht an.
»Nein … Nein, nicht heute Morgen, Madame Libéri. Aber …«
Ich bin schon wieder draußen. Der Strand ist nur eine Minute entfernt. Ein Dauerlauf von vierzig Sekunden, selbst in meinem Zustand. Vor mir bindet eine Großmutter ihren Hund fest, ein Opa verstaut seinen Stock. Außer Atem komme ich am Toki Goxoa an. Touristen nehmen auf der großen hölzernen Terrasse mit Blick aufs Meer ihr Frühstück ein. Ich laufe weiter, visiere einen kleinen roten Punkt gerade vor mir.
Mein Ziel. Meine Hoffnung.
Bei jedem Schritt meines verrückten Laufs wirbele ich Sandwolken auf, die den wenigen Touristen auf meinem Weg kurz die Sicht versperren.
Schließlich bleibe ich stehen.
Das Superman-Strandtuch liegt vor mir im Sand, genauso zerknüllt, wie er es vor knapp einer halben Stunde hingeworfen hat. Der Sweater von Biarritz Olympique daneben. Esteban hat ihn nicht übergezogen.
Mein Blick sucht den ganzen Strand ab, das Meer von der Digue aux Chevaux bis zum Fort de Socoa und bleibt dann vor mir im Sand haften: sind das eventuell Spuren? Oder nur kleine Hügel, die der Wind schon hundertmal verschoben hat.
Keine Spur von Esteban!
Die gewaltigen Brandungswellen des entfesselten Meeres tosen vor mir und beißen sich am Strand fest. Ich will nicht daran glauben, ich will sie nicht sehen, ich will mich den weißen Fassaden zuwenden, den malerischen baskischen Häusern mit ihrem bunten Fachwerk, den Blumenkästen vor den Fenstern, den Läden mit Spezialitäten, den gutbetuchten Touristen, einem Hund, mit dem Esteban gern gespielt hätte, einem Mädchen oder Jungen seines Alters, der kleinsten Sandburg oder Boje, doch meine Augen können sich nicht vom Meer lösen.
Die Wellen sind jetzt höher als drei Meter.
Ich höre meine mahnenden Worte:
»Nein, heute nicht, mein Großer. Die Brandung ist zu stark!«
Ich werde sie mein Leben lang hören.
Niemals! Niemals wäre Esteban ungehorsam gewesen.
2
Ihr Sohn trägt also Badeshorts? Stimmt das so?«
Die beiden Polizeibeamten sitzen vor mir. Der erste fixiert mich ungerührt mit seinen wie auf Glas gemalten, sepiabraunen Augen. Sie blinzeln nur in unregelmäßigen Abständen nach einem langen, starren Blick. Die Farbe der Augen des zweiten erkenne ich nicht, er hat sie seit meinem Eintreten nicht gehoben, zu sehr damit beschäftigt, mit der Geschwindigkeit einer Maschinenpistole Notizen auf seinem Computer zu machen, sobald ich den Mund öffne.
»Ja. Nur seine Badehose. Sein Pullover und sein Badetuch lagen noch am Strand.«
Der Blick des Lieutenants bleibt ausdruckslos. Die Finger des Protokollanten huschen weiter über die Tastatur.
»Blaue Badeshorts also?«, fährt der Lieutenant fort und fixiert mich weiter mit seinen sepiabraunen Augen.
Ich versuche, mich möglichst kurz, möglichst präzise auszudrücken. Ich weiß, dass genau in diesem Moment die Feuerwehrleute den Strand absuchen, und dass Lieutenant Lazarbal die Wasserwacht eingeschaltet hat. Drei Zodiac-Schlauchboote fahren trotz Sturms und starker Brandung die Küste auf und ab.
»Eher indigoblau.«
»Indigo?«
Das Klappern der Tastatur verstummt augenblicklich. Ich vermute, dass der Protokollant im Internet nach der Farbe Indigo sucht. Was für eine Zeitverschwendung. Ich habe bereits mit mindestens fünf verschiedenen uniformierten Typen über die Farbe dieser Badehose gesprochen. Ich schreie fast.
»Ja, indigo! Das ist keine Wissenschaft. Ein Blau, das leicht ins Violette übergeht!«
Lazarbal blinzelt dreimal mit den Augen – sicher ein Zeichen von großer Anspannung, bevor er den Blick erneut auf mich heftet.
»Okay, Madame Libéri. Eine indigoblaue Badehose. Gibt es neben der Farbe noch ein anderes Detail, das uns weiterhelfen könnte?«
Ich muss Ruhe bewahren. Das habe ich mir fest vorgenommen. Mehr als zwanzig Retter sind auf der Suche nach Esteban. Diese Männer tun ihre Arbeit, so gut sie können, das darf ich nicht vergessen. Ich muss mit ihnen kooperieren. Auf ihre Fragen antworten. Immer wieder. Und hoffen.
»Auf dem linken Hosenbein seiner Badeshorts ist ein kleiner weißer Wal gedruckt.«
Die Tastatur des Protokollanten beginnt wieder zu klappern. Die Augen von Lazarbal scheinen sich zum ersten Mal zu beleben, was sich in schnellen und langsamen Bewegungen seiner Lider äußert. Vielleicht sind das Morsezeichen und Hilferufe? Oder sie übermitteln mir ganz im Gegenteil eine unterschwellige beruhigende Botschaft.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Madame Libéri. Unsere Leute verfügen über ein Foto ihres Sohnes. Sie kennen ihren Job. Versuchen wir, noch einmal alles in Ruhe zu überdenken. Ihr Sohn ist … zehn Jahre alt?«
»Ja … Heute ist sein Geburtstag …«
Die Augen von Lazarbal nehmen wieder den starren Kameramodus an.
»Also genau zehn Jahre?«
Mir missfällt die Art, wie er sein »genau« so gedehnt ausspricht. Was will er damit andeuten? Dass ihn der Zufall überrascht? Welchen Zusammenhang kann es zwischen Estebans Verschwinden und seinem Geburtstag geben?
»Zehn Jahre«, wiederholt er. »Entschuldigen Sie, Madame Libéri, aber ist das nicht ein wenig zu jung, um ihn allein am Strand zu lassen?«
Ich belle mehr als dass ich antworte, um den Tango der Finger des Protokollanten zu übertönen.
»Ich wohne in der Rue Etchegaray, hundert Meter vom Strand entfernt. Alle Straßen sind Fußgängerzone. Esteban kennt sich aus. Er ist reif für sein Alter. Ausgeglichen. Verantwortungsvoll.«
Der Blick von Lazarbal ist leer. Hat er mir überhaupt zugehört? Ist er da, um mir zu helfen? Oder hat er schon begonnen, mir den Prozess zu machen?
»Ist Ihr Sohn ein guter Schwimmer?«
Ich sehe, worauf der kleine Mistkerl hinauswill! Ich werde nicht auf sein Spiel eingehen. Der Protokollant kann alles mitschreiben – in Großbuchstaben und Fettschrift.
»ESTEBAN IST NICHT SCHWIMMEN GEGANGEN. ICH HABE ES IHM VERBOTEN!
MEIN SOHN IST NICHT ERTRUNKEN.
ER WURDE … ER WURDE ENTFÜHRT!«
Die toten Augen von Lazarbal widersprechen mir nicht. Ein Punkt für ihn.
»Das Ertrinken Ihres Sohnes ist nur eine Hypothese, Madame Libéri. Man muss vorerst alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Selbst wenn …«
»Selbst wenn was?«, brüllt eine Stimme in meinem Kopf.
»Selbst wenn der Strand heute Morgen weiß Gott nicht leer war. Wir haben mehr als dreißig potenzielle Zeugen gezählt. Ganz abgesehen von den Touristen, die auf der Terrasse des Toki Goxoa ihr Frühstück eingenommen haben. Sie, Madame Libéri, haben mir bestätigt, dass Ihr Sohn intelligent und gehorsam ist. Er wäre keinem Fremden gefolgt, ohne sich zu wehren, und wenn er sich gewehrt hätte, so hätte ihn jemand gesehen oder gehört.«
»So hätte ihn jemand gesehen … oder gehört«, ich begnüge mich damit, die unwiderlegbaren Argumente von Lieutenant Lazarbal in meinem Kopf zu wiederholen. Mein Schädel scheint ebenso leer wie sein glasiger Blick.
»Jeder Tourist am Strand wurde verhört«, insistiert der Kommissar. »Niemand hat Ihren Sohn den Strand verlassen oder einem Fremden folgen sehen.«
»Und niemand hat gesehen, dass er schwimmen gegangen ist!«
Lazarbal hat reagiert. Drei kurze Wimpernschläge, zwei etwas längere. Seine Augen wagen eine Bewegung zum Bildschirm des Protokollanten, bevor sie erneut erstarren.
»Sie haben recht. Die ersten Zeugen waren mehr als hundert Meter entfernt und hatten nicht den geringsten Anlass, Ihren Sohn weiter zu beobachten. Tatsächlich erinnert sich niemand an irgendetwas, nicht einmal an seine Anwesenheit am Strand. Wir verlassen uns einzig und allein auf Ihre Zeugenaussage.«
Volltrottel!
»Und sein Badetuch? Sein Sweatshirt?«
Lazarbal hebt beschwichtigend die Hand, wie ein Polizist am Straßenrand, der einem allzu nervösen Autofahrer bedeutet, sich zu beruhigen.
»Niemand bezweifelt Ihre Aussage, Madame Libéri. Ganz im Gegenteil. Tatsächlich haben wir sein Strandtuch und seinen Pullover genau an der Stelle gefunden, wo Sie ihn allein gelassen haben. Alles scheint also darauf hinzudeuten, dass er …« Lazarbals Augen verraten schließlich ein Beben der Sorge, ein unkontrollierbares Zucken. »Dass er Ihnen nicht gehorcht hat. Dass … Dass er, sobald Sie ihm den Rücken gekehrt haben, zum Meer gerannt ist.«
NEIN!
Großbuchstaben, lieber Protokollant! Fett gedruckt und unterstrichen!
Ich wiederhole noch lauter:
»NEIN, das hat er sicher NICHT getan! Ich kenne Esteban. Heute ist sein Geburtstag. Er war ungeduldig, nach Hause zu kommen, sein Geschenk in Empfang zu nehmen. Er wäre niemals ungehorsam gewesen, heute schon gar nicht. Es muss etwas anderes passiert sein!«
Der starre Blick von Lazarbal macht mich rasend. In einem flüchtigen und albernen beruflichen Reflex sage ich mir, dass er vielleicht am Tunnelblick leidet, einem Augenleiden, das eine Einengung des Gesichtsfelds nach sich zieht, was erklären würde, warum er in einem Büro eingesperrt ist, statt wie die anderen Polizisten, meinen Sohn zu suchen.
»Wenn ich Ihrem Gedankengang folge, Madame Libéri, wenn wir der Hypothese nachgehen, dass Ihr Sohn entführt wurde, so hat er seinen Entführer zwangsläufig gekannt, er ist ihm vertrauensvoll gefolgt. Haben Sie eine Vermutung? Ein Nahestehender? Ein Verwandter? Sein … Sein Vater?«
»Esteban hat keinen Vater! Ich bin alleinerziehend. Und wenn Sie es genau wissen wollen, es war kein Unfall – ich habe mich bewusst dafür entschieden.«
Seine mit Scheuklappen versehenen Augen urteilen nicht über mich. Das ist schon mal was. Oder es ist ihm einfach nur egal. Seine Hand tastet nach einem Stapel Blätter, ohne dass sein Blick ihnen folgt. Vielleicht verfügt er über ein hyperentwickeltes peripheres Sehen. Wie alle Raubtiere …
»Wer dann?«, fragt Lazarbal.
»Ich weiß es nicht.«
Er breitet etliche Fotos vor mir aus.
»Wir werden es prüfen. Wir suchen. Wir haben schon ein Dutzend Aufnahmen bekommen. Vor allem von Kunden des Toki Goxoa. Sie, Madame Libéry, sind oft drauf zu sehen. Die meisten wurden aufgenommen, als Sie zurückkamen, um Ihren Sohn zu suchen.«
Mein Blick gleitet über die Bilder, mein zu kurzes T-Shirt, meine nackten Schenkel. Schielt er auch mit seinem Wanderfalken-Blick nach meinem Hintern? Soll er seinen Spaß haben! Soll er die dreckigen Fotos dieser am Tisch sitzenden Voyeure auslegen, wenn man nur meinen Sohn findet. Der weniger diskrete Protokollant kann es sich nicht verkneifen, den Kopf zu drehen, aber Lazarbal sammelt die Fotos gleich wieder ein.
»Wir werden Vergrößerungen anfertigen lassen«, erklärt Lazarbal, »und Sie bitten, sie alle genau zu studieren, für den Fall, dass Sie jemanden erkennen. Wir haben ebenfalls Fotos vom Strand erhalten, kurz bevor Sie zurückgekommen sind, doch Esteban ist auf keinem zu sehen. Auch auf den Straßen von Saint-Jean-de-Luz ist er niemandem aufgefallen. In Ermangelung anderer Hinweise bleibt die Hypothese, die sich aufdrängt …«
Du kannst die Tastatur deines Computers zerhämmern, Protokollant.
»ESTEBAN IST NICHT ERTRUNKEN! Wie oft muss ich das noch wiederholen? Prüfen Sie Ihre vergrößerten Fotos, und Sie sehen, dass Esteban sein Badetuch, seinen Pullover und die Espadrilles zurückgelassen hat. Wo sind übrigens seine Schuhe? Esteban ist sicher nicht mit ihnen schwimmen gegangen!«
Ich will mich an diese Hoffnung klammern, an jede mögliche Hoffnung – alles, außer mir vorzustellen, dass der Körper meines Sohnes vom Meer davongetragen wurde.
»Es tut mir leid, Madame Libéri, ich muss Ihnen wie ein Monster erscheinen, wenn ich die schlimmste aller Möglichkeiten in den Raum stelle, nämlich die, dass Ihr Sohn mit seinen Espadrilles bis zum Wasser gelaufen ist, sie dann abgestreift hat und die Wellen sie ins Meer gespült haben. Oder dass jemand sie einfach mitgenommen hat …«
»Und warum nicht gleich auch Pulli und Badetuch?«
»Das ist möglich. Sie können auch irgendwo im Sand vergraben sein. Wir werden danach suchen.«
Der Protokollant hat schon länger mit seinem Geklapper aufgehört, als würden ihn meine Argumente nicht interessieren, als hätte er schon alle Antworten getippt, die Lazarbal ihm suggeriert hat. Trotzdem bleibt mir ein letztes Argument.
»Der Pullover von Biarritz Olympique hat keine Tasche.«
»Wie?«
»Seine Badeshorts haben auch keine Tasche.«
Zum ersten Mal sind die Augen von Lazarbal hellwach. Die Lider beginnen zu flattern wie aufgeregte Bienen.
»Ja und?«
»Ich habe Esteban, wie jeden Morgen, eine Ein-Euro-Münze gegeben, damit er zur Bäckerei Fournil de Lamia läuft. Wenn er schwimmen gegangen wäre, hätte er sie zwangsläufig am Strand zurückgelassen. Man schwimmt nicht mit einer Geldmünze in der Hand!«
»Wir werden suchen, Madame Libéri. Wir werden den gesamten Strand nach ihr absuchen, das verspreche ich Ihnen.«
»Ich habe schon damit begonnen, Lieutenant. Und ich werde weitersuchen.«
Und ich bete und flehe zu Gott, sie nicht zu finden.
Wenn ich sie nicht finde, heißt das, dass Esteban nicht schwimmen gegangen ist. Dass er diese Ein-Euro-Münze irgendwo noch immer in seiner Hand hält.
Diese Münze zu finden, bedeutet ihn aufzugeben; sie zu suchen bedeutet … hoffen.
•••
Ich habe sie all die Jahre über gesucht.
Ich habe all die Jahre gehofft.
Ich habe sie nicht gefunden.
Weder die Münze.
Noch Esteban.
ZEHN JAHRE SPÄTER
3
Der Sand am Strand von Saint-Jean-de-Luz, von der Sonne fast weiß geblichen, rieselt durch meine Zehen. Nach einem Schritt bleibe ich stehen und blicke mich um. Ich versuche, einen Orientierungspunkt zu finden, etwa die Digue aux Chevaux, das Restaurant Toki Goxoa, und grabe dabei meinen Fuß so tief wie möglich in den Sand, bevor ich ihn hochziehe und damit eine winzige Kaskade feiner Körner hervorrufe. Ein weiterer Schritt, ich fange von vorne an.
Wonach suche ich?
Was erhoffe ich mir?
Esteban ist schon so lange verschwunden. Seit genau zehn Jahren.
»Lass gut sein«, höre ich hinter mir die Stimme von Gabriel.
Ich mache mir nicht die Mühe, mich umzudrehen, ihm zuzulächeln.
Esteban wäre heute zwanzig geworden.
»Sieh nur«, fährt Gabriel fort. »Wir sind gerade erst gekommen, und der Wind löscht schon die Spuren unserer Schritte aus.«
Er hat recht, wie immer. Nichts hat sich in den letzten zehn Jahren verändert. Derselbe Wind fegt über den Strand von Saint-Jean-de-Luz, dieselben Ikurriñas flattern über der Mole, dieselben Surfer kämpfen mit denselben Brandungswellen, dieselben Kellner arbeiten in denselben Cafés, dieselben Touristen, wenige zwar, teilen sich den Strand. Und doch ist kein Detail identisch, keine Welle ist haargenau wie die vorherige, keine Wolke hält inne, keiner der Komparsen dieser Szenerie hört auf zu altern.
Gabriel kommt näher, legt die Arme um meine Taille und drückt mir einen Kuss auf die Wange. Ich betrachte unser beider Schatten, die sich auf dem Sand ausdehnen, dicht beieinander, wie die umschlungenen Paare in alten Schwarz-Weiß-Filmen.
Ein idyllisches Bild.
Doch ich mache mich frei.
Tut mir leid, Gabriel. Ich verspreche dir, es wird andere, noch magischere Morgen geben.
Esteban wäre heute zwanzig geworden.
Esteban wäre ein brillanter Student gewesen. Esteban hätte sein Abitur mit Auszeichnung bestanden, was wir in einem noblen Restaurant an der baskischen Küste, im Jardins de Bakea vielleicht, gefeiert hätten. Esteban wäre Spitzensportler im Schwimmen gewesen, mit den Jahren wäre sein Körper der eines Athleten geworden, Esteban hätte weiter Gitarre gespielt, Esteban hätte sicher seine blonden Haare wachsen lassen, Esteban hätte mich an seinem Geburtstag an diesem Strand bei der Hand genommen, und ich wäre so unendlich stolz auf ihn gewesen.
Du nimmst meine Hand, Gabriel. Ich lasse sie nicht los.
Es ist das erste Mal, dass ich an die Grande Plage zurückkehre.
Ich musste einfach fort von hier, vor zehn Jahren, als die Polizei einen Monat nach Estebans Verschwinden die Suche einstellte. Weit, sehr weit weg. Ich eröffnete eine Praxis an einem anderen Meer, das kälter, aber weniger wild ist, im Norden, in Etretat, zwischen zwei Kreidefelsen. Ich musste alles neu aufbauen. Und dann kam Gabriel in mein Leben.
Doch ich musste einfach nach zehn Jahren zurückkommen.
Gabriels Hand ist warm, kräftig … und leer. Sie umschließt nur einen toten Zweig. Fünf hölzerne Finger.
Ich erinnere mich an jeden meiner Gedanken, an diesem 21. Juni 2010, als ich Esteban allein am Strand zurückgelassen habe.
Kein Mann könnte sich jemals zwischen uns stellen! Ich muss einen leeren Platz neben mir im Bett behalten, für Esteban, wenn er im Morgengrauen zu mir kommt. Niemals könnte ein Liebhaber mich morgens mit einem so kristallklaren Ich hab dich lieb wecken.
Nie wieder wird Esteban im Morgengrauen zu mir kommen. Es ist Gabriel, der fortan den leeren Platz neben mir im Bett einnimmt, aber keines seiner Ich liebe dich beim Aufwachen wird jemals die Kraft von Estebans Ich hab dich lieb haben.
Gabriel küsst mich erneut.
Und auch keiner seiner Küsse wird diese Kraft haben, selbst wenn sie mir heute Morgen so guttun.
Ich habe Gabriel vorgeschlagen, für eine Woche mit mir nach Saint-Jean-de-Luz zu kommen, ohne ihm den Grund der Reise zu verheimlichen. Er war sofort einverstanden. Ich habe ein Zimmer im Hotel La Caravelle gebucht, ganz in der Nähe meiner damaligen Wohnung. Das schönste, mit den Ausmaßen einer Suite, um Gabriel eine Freude zu machen. Ich verfüge über die Mittel, verdiene recht gut in der neuen Praxis, habe aber fast keine kostspieligen Bedürfnisse.
Ich lasse meine Füße weiter durch den Sand schleifen, durchwühle ihn mit den Zehen, so als wollte ich nach zehn Jahren eine Ein-Euro-Münze darin entdecken. Jene, die Esteban zurückgelassen hätte, bevor er zum Meer gelaufen wäre, um darin zu ertrinken. So als würde ich hoffen, dass endlich Schluss mit dem Geheimnis wäre. Mit den Tausenden von Fragen ohne Antwort. Gleichungen mit Unbekannten, die niemals gelöst wurden.
Was ist an diesem Strand damals am 21. Juni 2010 passiert?
Gabriel lässt meine Hand los und legt seinen Arm erneut um meine Taille. So laufen wir Seite an Seite, eng umschlungen.
Der Strand ist lang, mehr als einen Kilometer, und wir kommen nur langsam voran. Gabriel hält oft an, um mich zu küssen. Ich füge mich einfach, um nicht zu distanziert zu wirken, und zwinge mich, seinen verführerisch finsteren Blick zu bewundern, sein dunkles Haar, seine Haut, die selbst im normannischen Winter gebräunt bleibt.
Kein Mann könnte sich jemals zwischen uns stellen!
Niemals hätte ich geglaubt, dass jemand Esteban ersetzen könnte. Im Übrigen ersetzt Gabriel ihn nicht! Er begnügt sich damit, den leeren Platz zu füllen. Von Anfang an kennt er meinen Schmerz, meine Stimmungsschwankungen, meine Tränen, meine Ängste, dass ich nie Freunde treffe, außer einem Psychiater, mein Schweigen, meine Therapiesitzungen. Er hat mich davor bewahrt, verrückt zu werden. Ohne sich zu beklagen, ohne Fragen zu stellen, er hat sich damit begnügt, ein wenig Aufmerksamkeit zu verlangen, ein paar Zärtlichkeiten. Wie ein freundliches, hübsches Haustier.
Tut mir leid, Gabriel, ich kann so grausam sein.
Wir laufen aufs Geratewohl. Am Ende der Bucht erkenne ich die Mauern vom Fort de Socoa, den runden Turm, der es überragt, die bunten Boote, die davor in den Wellen schaukeln. Aus der Ferne betrachtet, hält man es eher für ein Lego-Schloss als für eine einst uneinnehmbare Festung.
Die wenigen Leute, die uns, Gaby und mich, kennen, glauben, ich sei die Stärkere. Bin ich nicht Frau Doktor Maddi Libéri? Die Bewunderung verdient. Der es gelungen ist, sich ihr Leben neu aufzubauen, während Gabriel das Bild eines verträumten Poeten abgibt.
Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Die Leute haben keine Ahnung. Seit all diesen Jahren ist es Gabriel, der mich stützt.
•••
Ich sehe ihn zuerst nur aus der Ferne.
Ich erkenne nur einen Farbfleck, ganz vage, auf dem schon sonnenüberfluteten Strand. So früh am Morgen sind erst wenige Touristen unterwegs: ein paar Jogger, ein paar Hundehalter, ein paar Familien, ein paar Verliebte.
Gabriel im Schlepptau steuere ich auf diesen Fleck zu. Meter für Meter wird er schärfer umrissen, die Farbe deutlicher.
Indigoblaue Badeshorts.
Ich empfinde zunächst nur ein Prickeln. Jedes Mal, wenn ich den Fuß auf einen Sand- oder Kiesstrand setze, wenn ich am Boden ausgebreitete Badetücher sehe, einem geworfenen Ball ausweiche, das Lachen von Kindern höre, die zum Schwimmen ins Wasser laufen, schnürt sich mir das Herz mit demselben Schmerz zusammen. Und das seit zehn Jahren. Ich kann es nicht lassen, den Gestalten zehnjähriger Jungen mit den Blicken zu folgen, die zu mager sind in ihren weiten Badeshorts, noch meinem Herzen verbieten, höher zu schlagen, wenn ich sehe, dass einer von ihnen eine blaue Badehose trägt. An den Stränden von Etretat, Deauville, Cabourg oder Honfleur bin ich zehnmal, hundertmal in diese Situation gekommen.
Ich lasse Gabriels Hand los.
Ich nähere mich dem Hafendeich. Eine Gruppe junger Leute spielt Beachvolleyball. Die Knaben sind muskulös, die Mädchen schlank, der Ball berührt nie den Boden.
Gabriel ist stehen geblieben, um ihnen zuzuschauen, ich laufe weiter.
Dieses Prickeln entwickelt sich zu giftigen Insektenstichen.
Ich sehe den Jungen mit der blauen Badehose jetzt ganz deutlich vor mir, auch wenn er mir den Rücken zukehrt.
Er muss zehn Jahre alt sein. Er hat sein Strandtuch neben das seiner Mutter gelegt, eine Blondine von etwa dreißig Jahren, sehr schlank, ohne Hinterteil und Brüste.
Meine Gedanken überschlagen sich, aber ich versuche, mich zur Vernunft zu bringen.
Zehnjährigen in indigoblauen Badeshorts bin ich natürlich schon häufig begegnet und werde es noch öfter tun. Eine skeptische Stimme in meinem Kopf ist jedoch nicht zufrieden.
Zugegebenermaßen verkauft so gut wie jede Boutique Badehosen in dieser Farbe, aber einem Jungen heute zu begegnen, am Tag, an dem …
Ich unterdrücke einen Schrei.
Der Junge sitzt auf seinem Strandtuch, ich kann sein Gesicht noch immer nicht sehen, dafür aber seine angewinkelten Beine, die Badeshorts, die über seine Oberschenkel fallen …
Und das Motiv …
Gedruckt auf dem indigoblauen Stoff seines linken Beins.
Ein kleiner weißer Wal.
Die Stachel in meinem Herzen werden zu Dolchen.
Die Badeshorts, die dieser Junge trägt, sind die gleichen wie die von Esteban vor zehn Jahren.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Zufall sich heute hier ereignet? Ich versuche, rational zu denken, um nicht in dem Abgrund zu versinken, der sich vor mir auftut. Sicher werden Hunderte, nein, Tausende völlig identische Badehosen von Hunderten, Tausenden Jungen getragen.
Aber hier? Ausgerechnet heute?
Gabriel ist mir nicht gefolgt. Er ist zurückgeblieben, die Volleyball-Spielerinnen, nach denen er schielt, scheinen wichtiger zu sein. Soll er machen, was er will; ich werde nicht eifersüchtig sein auf Mädchen, die dreißig Jahre jünger sind als ich.
Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass er nicht dabei ist. Dass ich ihm nicht erklären muss, warum ich mich weiter diesem Jungen und seiner Mutter nähern will, auch wenn meine Beine nachzugeben drohen.
Ich will nicht, dass er sieht, wie meine Hände sich verkrampfen. Ich will nicht, dass er sieht, wie hypnotisiert ich bin vom blonden zerzausten Haar des Jungen auf seinem Badetuch, von seinen mageren Beinen.
Inzwischen habe ich mich nahe genug herangepirscht, auf etwa zehn Meter, um ihn mit seiner Mutter reden hören zu können.
»Gehen wir schwimmen, Maman?«
Seine Mutter antwortet ihm nicht. Sie begnügt sich damit, eine Zeitschrift aufzuschlagen.
Was dann folgt, spielt sich in Zeitlupe ab. Der Junge dreht ganz langsam den Kopf und sieht seine Mutter flehentlich an.
Er nimmt mich nicht wahr. Ich existiere nicht für ihn.
Und ich sehe nur noch ihn.
Ich erkenne jede Nuance seines Gesichts wieder, jede Falte seines Lächelns, jeden blauen Stern seiner Iris, jede Wölbung von seiner Stirn bis zum Kinn, jedes Grübchen, jede Wimper, jeden Gesichtsausdruck.
Das ist er!
Es ist nicht ein Kind, das ihm ähnelt, es ist kein Doppelgänger.
Das ist mein kleiner Prinz!
Esteban.
Egal, ob er heute zwanzig Jahre alt geworden wäre, ob es überhaupt keinen Sinn macht, ob es reiner Wahnsinn ist, es zu glauben.
Ich weiß, dass er es ist.
•••
Der Junge mit der indigoblauen Badehose geht jeden Morgen zum Strand von Saint-Jean-de-Luz. Zwischen der Mole und der Terrasse des Toki Goxoa. Immer genau an derselben Stelle. Immer mit seiner Mutter.
Ich sitze acht Meter hinter ihm. Ich nähere mich ihm nach und nach, Meter für Meter, mit jener Geduld, die es braucht, wenn man einen Vogel zähmen will.
Weder er noch seine Mutter haben mich bemerkt. Seine Mutter ist ständig in die Lektüre eines Buches oder einer Zeitschrift vertieft, und der Blick des Jungen, wenn er auf mich trifft, durchdringt mich, als wäre ich durchsichtig oder aus Staub. Als wäre die Sanduhr meines Lebens umgedreht worden, als wäre mein kleiner Prinz lebendig und ich das Phantom.
Ich bin kein Phantom! Ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, ich weiß es, ich fühle es, und jeder seiner gleichgültigen Blicke zerreißt mich, als würde ein Schwert mich durchbohren.
Ich habe Gabriel nichts gesagt.
Wie könnte er mir glauben?
Er wartet im Bett unseres Hotelzimmers auf mich. Er sieht gerne abends lange fern und steht dann am nächsten Tag spät auf. Und er hasst es, morgens schwimmen zu gehen.
Ehrlich gesagt, bin ich ihm dafür dankbar.
Seitdem wir hier sind, konnte ich diesen Jungen und seine Mutter heimlich ausspionieren, ohne mich erklären zu müssen. Nur eine Stunde, dann verlassen sie den Strand, und ich kehre zu Gabriel ins Hotel zurück.
Der Junge heißt Tom.
Er ist eher ruhig und gehorsam. Manchmal kommt er mir ein wenig traurig vor.
Ich glaube, er langweilt sich. Er geht oft schwimmen.
Er ist ein sehr guter Schwimmer, so wie Esteban.
Seine Mutter geht nicht ins Wasser. Sie passt auch kaum auf ihn auf. Sie ermahnt ihn nur kurz, ohne die Augen von ihren Büchern zu heben. Lauf nicht zu weit weg, trockne dich ab, zieh dir was über. Regelmäßig bittet Tom seine Mutter, mit ihm zu spielen. Dann widmet sie sich ihm für ein paar Minuten und überlässt ihn wieder sich selbst. Und seiner Langeweile.
Tom hat nicht ganz dieselbe Stimme wie Esteban. Und seine Haut ist etwas heller. Aber diese beiden winzigen Unterschiede sind nichts im Vergleich zu ihrer unglaublichen Ähnlichkeit. Würden Tom und Esteban nebeneinander stehen, wäre es unmöglich zu sagen, wer wer ist.
Perfekte Zwillinge.
Seit drei Tagen versuche ich, mich zur Vernunft zu bringen. Ich bin Wissenschaftlerin, habe Medizin studiert, ich glaube weder an einen Gott noch an irgendein Paradies, Esteban wäre heute zwanzig geworden, Tom ist erst zehn, auch wenn Tom so lächelt wie Esteban, lacht wie Esteban, schwimmt wie Esteban, die gleichen Badeshorts trägt …
Tom kann nicht Esteban sein.
Daraufhin habe ich mich an einen Beweis geklammert, den einzigen, der mich noch überzeugen könnte, nicht in einem endlos tiefen Brunnen von Vermutungen zu versinken und mich so einer absurden Illusion hinzugeben.
Das Angiom von Esteban. Sein Geburtsmal, gut sichtbar, an der Leiste über dem Rand seiner Badehose.
Jedes Mal, wenn Tom aufstand, sich auszog, sich wieder anzog, habe ich heimlich danach Ausschau gehalten. Und auch jedes seltene Mal, wenn seine Mutter ein paar Sandkörner von seiner Schulter strich. Hin- und hergerissen zwischen zwei widersprüchlichen Gefühlen, habe ich den Jungen angestarrt. Auf der einen Seite war da die Vernunft, die Hoffnung, diesen dunklen Fleck nicht zu entdecken, um der übertriebenen Obsession ein Ende zu bereiten. Und auf der anderen war da mein Herz und die Hoffnung, das Geburtsmal auf seiner rechten Leiste auszumachen. Denn das wäre der Beweis dafür, dass hier Esteban lebendig vor mir stand.
Auch wenn er innerhalb von zehn Jahren nicht um einen Tag gealtert ist! Auch wenn er sich nicht an mich erinnert, einen anderen Namen trägt und eine andere Mutter hat. Egal, wohin er verschwunden ist, und was er erlebt hat während all dieser Jahre.
Er ist zurückgekehrt.
Trotz all meiner Bemühungen ist es mir nicht gelungen. Ich habe nie einen Blick auf den unbekleideten Tom werfen können. Schamhaft wickelt er sich in sein Strandtuch, sobald er die Badehose auszieht. Ich habe auch nichts sehen können, wenn er aus dem Meer kam, und seine vom Wasser schwereren Shorts ein wenig tiefer rutschten. Ich habe seine Mutter verflucht, die es innerhalb von drei Tagen nicht einmal für nötig befunden hat, eine Tube Sonnencreme aus der Badetasche zu holen. Toms helle Haut ist seit dem ersten Morgen gerötet. Er beklagt sich kein einziges Mal, aber der Sonnenbrand macht es für mich noch schwerer, eine dunklere Stelle auf seiner Haut zu entdecken.
So als hätte seine Mutter sie verbergen wollen, indem sie den Jungen von der Sonne verbrennen lässt.
»Maman, kommst du?«
Tom ist schon im Wasser, das ihm bis zur Taille reicht, doch wenige Meter weiter draußen sind die Brandungswellen bereits richtig stark. Jede höhere Welle könnte ihn umwerfen. Ich widerstehe dem Drang, laut zu schreien, ihm zu befehlen, aus dem Wasser zu kommen, seine Mutter zu beschimpfen. Widerwillig hebt sie die Augen von ihrem Buch.
»Kommst du, Maman?«, beharrt Tom. »Nicht zum Schwimmen. Du sollst nur ein Foto von mir machen. Schau!«
Mit aller Kraft springt er hoch, ehe eine Welle ihn im Rücken trifft, fällt in den Schaum, spuckt Salzwasser aus, lacht, versucht, sein Gleichgewicht wiederzufinden, bevor ihn die nächste Welle erwischt.
Esteban hat auch gerne so getobt. Aber ich war bei ihm.
»Maman!«
Wider Erwarten steht seine Mutter diesmal auf. Sie greift nach ihrem Handy und läuft zum Meer.
Ich bin höchstens sieben Meter von ihrem Platz entfernt. Jetzt oder nie!
Ich lasse die Dreißigjährige nicht aus den Augen. Das Handy in Augenhöhe, läuft sie zum Meer.
Eine bessere Gelegenheit wird sich niemals bieten.
In der Nähe ist niemand außer einem älteren schlafenden Paar und ihren Enkelkindern, die eifrig an einer Sandburg bauen.
Ich robbe langsam vorwärts. Mit einer gezielten Bewegung greife ich nach der Strandtasche von Toms Mutter. Zwischen Büchern, Stiften, Schlüsseln und verschiedenen undefinierbaren Flakons entdecke ich ihr Portemonnaie.
Ein schneller Blick zum Wasser hin – Toms Mutter kehrt mir noch immer den Rücken zu.
Meine Finger umschließen das Portemonnaie, und ich klappe es so schnell wie möglich auf. Die Selbstvorwürfe verschiebe ich auf später: Ich bin verrückt, ich wühle in den privaten Sachen einer Unbekannten herum, wenn ich erwischt werde, wenn …
Ich ziehe einen Personalausweis heraus. Ich muss mir die Daten so schnell wie möglich einprägen, ich habe nur eine Sekunde Zeit, dann muss ich alles wieder einräumen, mich entfernen, unsichtbar werden.
Meine Finger zittern, die Kunststoffkarte entgleitet ihnen, fällt in den Sand.
Verdammt!
Ein flehender Blick Richtung Meer. Tom ist immer noch im Wasser. Seine Mutter steht mit ihrem Smartphone in der Hand da und wartet, bis er mit seinem Delphinspiel fertig ist.
Ich greife nach dem Ausweis, wische den Sand mit dem kleinen Finger weg und lese.
Amandine Fontaine
La Souille
Hameau de Froidefond
63790 Murol
4
Die Ausstattung des Sprechzimmers von Doktor Wayan Balik Kuning ist eine Mischung aus nüchterner Sachlichkeit – der Beweis seiner Seriosität für seine exklusive Klientel – und einem Hauch Exotik, der für eine entspannte, ruhige Atmosphäre und Vertrauen sorgt. Alles ist in harmonischen Gelbtönen gehalten: safrangelbe Wandbespannung, topasfarbener Teppich, Sessel und Sofa in maisgelbem Leder, das Mobiliar ist aus Rohholz. Dazu ein minimalistisches Interieur in Kupfertönen – eine Wanduhr, zwei Lampen, ein paar Skulpturen balinesischer Gottheiten.
Wayan Balik Kuning zündet ein Räucherstäbchen mit Sandelholzduft an, während ich mich auf der Couch ausstrecke. Dann schaltet er bedächtig das Diktiergerät ein und nimmt in dem Sessel aus Heveaholz Platz.
Mir gegenüber.
Es ist mir lieber so.
Bei unseren ersten Sitzungen saß er hinter mir. Aber mir war es unangenehm, ihn nicht sehen zu können, den Eindruck zu haben, mit einer Wand zu sprechen, nicht kontrollieren zu können, ob er nicht vielleicht eingeschlafen war oder auf seinem Samsung Candy Crush spielte. Noch dazu ist Wayan Balik Kuning nicht gerade unattraktiv. Er ist das erlesene Ergebnis seiner balinesisch-französischen Vorfahren. Karamellfarbener Teint, pechschwarzes Haar mit silbrigen Strähnen, Dackelblick, aber die Schulterbreite eines Rugbyspielers. Der Psychiater Doktor Kuning, Absolvent der Medizinischen Fakultät Paris-Descartes, hat nichts mit jenen Scharlatanen gemein, die ihre Praxen mit den Statuen von Wischnu, Shiva oder Brahma dekorieren.
»Maddi, Sie sagen also, dass dieser Junge, Tom Fontaine, Esteban ähnelt?«
»Nein, Wayan, das habe ich nicht gesagt. Seien wir genauer, ›ähneln‹ ist zu wenig. Ich habe Ihnen gesagt … Das war er!«
Wayan sinkt immer tiefer in seinen Sessel und klammert sich an die geschnitzten Armlehnen. Er bereitet sich auf eine schwierige Sitzung vor. Er ahnt noch nicht, wie schwierig …
»Maddi, Sie wissen genau, das ist unmöglich. Esteban wäre mittlerweile zwanzig Jahre alt. Schon diese einfache Feststellung schließt jede andere Debatte, jede Illusion eines Identitätsdiebstahls aus. Tom ist nicht Esteban.«
Ich will widersprechen, doch Wayan hebt die Hand, um mir zu bedeuten, dass ich ihn nicht unterbrechen soll.
»Wir müssen das Problem also anders betrachten und uns eine andere Frage stellen. Warum sind Sie überzeugt, dass dieser Junge, von dem Sie rein gar nichts wissen, derart Ihrem Sohn ähnelt? Wir erhalten keine Antwort, ohne Ihnen weitere, noch unangenehmere Fragen zu stellen. Zunächst einmal: Warum hatten Sie das Bedürfnis zehn Jahre nach dem Verschwinden Ihres Sohnes nach Saint-Jean-de-Luz zurückzukehren? Verstehen Sie mich bitte richtig, Maddi, was zählt, ist nicht, was Sie an diesem Strand gefunden, sondern wonach Sie dort gesucht haben.«
Ich zwinge mich, auf der maisgelben ledernen Couch ausgestreckt liegen zu bleiben. Ich kontrolliere meinen Atem, um mich so ruhig wie möglich ausdrücken zu können.
»Nicht dieses Mal, Wayan! Okay, die anderen Male, als ich Esteban in Cabourg, in Deauville oder in Honfleur wiedererkannt zu haben glaubte, war es mein Gehirn, das sich weigerte, meine Wunden heilen zu lassen. Es handelte sich zugegebenermaßen nur um Ähnlichkeiten, davon haben Sie mich überzeugt. Aber dieses Mal ist es anders. Diesmal … ist er es wirklich!«
Wayan drückt sich noch ruhiger aus als ich. Sein Tonfall gibt mir zu verstehen, dass er in seiner Therapie jede irrationelle Erklärung ausschalten will.
»Gut. Wir haben viel Arbeit vor uns, Maddi, sind Sie sich dessen bewusst?«
»Ja, natürlich. Aber … wir müssen die Sitzungen beenden.«
Ich habe mich leicht aufgesetzt, um seine Reaktion beobachten zu können. Das attraktive Gesicht von Wayan ist erstarrt.
»Wie bitte? Sagen Sie mir bitte, Maddi, dass ich Sie falsch verstanden habe?«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln. Lange betrachte ich die Plakate von Angkor, von Borobudor und von Wat Saket an den Wänden, das Poster vom Mount Batur und den Reisfeldern.
»Ich werde Sie vermissen, Wayan. Sie haben mir in all den Jahren wirklich sehr geholfen. Ich würde meine Therapie gerne fortsetzen, aber …«
Wayan Balik Kuning, der Kaiser der Selbstkontrolle, vermag seine Panik kaum zu verbergen.
»Sind Sie enttäuscht von mir? War ich ungeschickt? Sollte es eine Frage des Geldes sein, dann könnte ich …«
»Nein, ganz und gar nicht. Die Sache ist nur … Ich werde umziehen!«
Es herrscht Stille. Die Sandelholzwolke verteilt sich langsam im Raum. Der Rüssel eines in Lavagestein gehauenen Ganesha scheint sich ein Niesen zu verkneifen.
»Wa… Warum … Wo … wohin wollen Sie umziehen?«
»In die Auvergne. Sie suchen dort in einer kleinen Gemeinde mit fünfhundert Einwohnern einen Allgemeinmediziner – und das schon seit fast drei Jahren. Sie werden mich dort mit mehr Ehrfurcht empfangen, als wenn ich die größte Heilerin des hinduistischen Pantheons wäre.«
Seitdem ich Wayan kenne, habe ich noch nie einen solchen Ausdruck in seinem Gesicht gesehen. Ich finde ihn unwiderstehlich, mit seinen feuchten Augen. Wie viele seiner Patientinnen haben sich wohl in ihn verliebt?
»Und in diesem Ort wohnt Tom Fontaine, nicht wahr?«
Unwiderstehlich und noch dazu intelligent.
»Ja. Es tut mir sehr leid, Wayan. Aber … ich muss der Sache nachgehen.«
»Was wollen Sie überprüfen? Sein Geburtsmal, ist es das? Das Angiom von Esteban. Und dann? Sie freunden sich mit der Mutter von Tom Fontaine an? Sie mischen sich in die Angelegenheiten der Familie ein, natürlich ohne von Ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie werden die Mutter ersetzen? Nur weil dieser Junge dem Sohn ähnelt, den Sie verloren haben?«
»Ich habe ihn nicht verloren! Man hat ihn mir gestohlen!«
Kurz verliere ich die Kontrolle über meine Stimme, aber es gelingt mir, sie erneut zu mäßigen. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass meine letzte Sitzung in einer Konfrontation endet.
»Es … es tut mir leid, Wayan. Ich muss einfach dorthin. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich habe meine Praxis in Etretat gekündigt. Sie erwarten mich schon in Murol.«
Wayan steht auf, was während einer Sitzung noch nie vorgekommen ist.
»Darf ich rauchen?«
Ich lächle.
»Sicher – es ist schließlich Ihre Praxis.«
Er öffnet eine Schublade und zündet sich eine lange, dünne Zigarette an. Der Duft vom Sandelholz überdeckt den des Zigarettenrauchs für die nächsten Patienten.
»Sie haben hier wieder zu sich gefunden, Maddi. Sie leben nicht allein.« Er zögert einen Moment. Noch nie habe ich ihn so lange nach Worten ringen sehen. »Sind Sie sicher, dass Ihr …, dass äh … Gabriel bereit ist, alles aufzugeben, um Ihnen zu folgen?«
Ich lächele wieder.
»Ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen, aber ich glaube, er würde mir überallhin folgen, vorausgesetzt es gibt einen Internetzugang.«
Ein flüchtiger Ausdruck von Schmerz huscht über Wayans schönes Gesicht. Über mein Privatleben zu sprechen, war schon immer am schwierigsten gewesen. Ich weiß, dass er nicht ganz unempfänglich ist für mein blondes Haar, meine Energie oder meinen Tränen gegenüber, die ich in all den Jahren an seiner Seite vergossen habe. Aber vielleicht war es auch genau umgekehrt, und ich bin es, die sich nach all den Jahren unbewusst in ihn verliebt hat.
Und selbst wenn es so wäre, was würde das ändern? Ich habe eine Wahl getroffen, er auch, wir sind vernünftige Erwachsene, die in der Lage sind, mit unseren Frustrationen und Widersprüchen umzugehen. Ich antworte mit möglichst großer Unbeschwertheit.
»Und wenn Gabriel nicht einverstanden ist, dann eben nicht, das ändert nichts an meiner Entscheidung. Sie kennen mich, Wayan, ich bin eine entschlossene Frau … und noch dazu frei!«
»Nein, Maddi, oh nein, so kann man Freiheit nicht definieren.«
Wayans Zigarette riecht ekelhaft nach Gewürznelken. Ich habe keine Lust, mit Wayan zu philosophieren. Nicht heute. Und auch nicht, mir eine Moralpredigt anhören zu müssen. Und noch weniger eine Diagnose meiner geistigen Gesundheit.
»Ich möchte Sie um einen letzten Gefallen bitten, Wayan. Könnte ich die Aufzeichnungen all unserer Sitzungen bekommen? Ich würde sie mir gerne noch einmal anhören.«
Er zieht lange an seiner Zigarette. Er wird seinen ganzen Vorrat an Räucherstäbchen aufbrauchen müssen, um den Geruch zu übertünchen.
»Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist?«
»Nein, nicht wirklich. Ich bin mir nur weniger Dinge sicher. Und genau deshalb möchte ich sie mitnehmen.«
Wayan geht zögernd zu seinem Schreibtisch.
»Wenn Sie darauf bestehen. Ich kann es Ihnen nicht verwehren, schließlich gehören sie Ihnen. Sie hatten darauf bestanden, dass alle Sitzungen aufgenommen werden. Ich kopiere sie Ihnen auf einen USB-Stick. Wünschen Sie nur die, die in dieser Praxis stattfanden, oder auch die … davor?«
»Alle Sitzungen, Wayan. Bitte.«
Ich höre ihn nervös auf den Tasten seines Computers klimpern.
»Wann ziehen Sie um?«
»In sechs Monaten. Ich verbringe ein letztes Weihnachten am Fuß der Felsen und gehe im Februar ins Land der Vulkane, wenn sie mit Schnee bedeckt sind.«
Er fixiert weiter den Bildschirm und sieht die Liste unserer vergangenen Sitzungen vorüberziehen. Seine feuchten Augen nehmen einen melancholischen Ausdruck an.
»Maddi, darf ich Sie meinerseits um einen Gefallen bitten?«
»O … Sie machen mir Angst.«
Sein Blick verharrt weiter auf der Abfolge unserer Gespräche, zusammengefasst in dreiundachtzig Dateien.
»Wenn Sie durch diese Tür gegangen sind, dann sind Sie nicht mehr meine Patientin. Wir werden, sozusagen, wieder Kollegen sein. Hätten Sie Lust, bevor Sie abreisen, ein Glas mit mir zu trinken? Einen Abend ins Restaurant zu gehen und …«
Er zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette. Ich sehe ihn voller Zärtlichkeit an.
»Wie Sie gesagt haben, Wayan, ich lebe nicht allein. Da gibt es immer noch Gabriel.«
»Aber Sie sind eine freie Frau …«
»Ja. Sie aber sind es nicht.«
»Was nicht?«
»Frei!«
»Frei? Niemand ist freier als ich, Maddi. Ich habe weder Frau noch Kind, noch …«
Ich unterbreche ihn mit größtmöglicher Behutsamkeit.
»Nein, Wayan, das sind Sie nicht. Sie sind nicht so frei, dass Sie alles verlassen, alles opfern. Ich glaube, ich kann nur mit einem Mann leben, der dazu in der Lage ist. Ich bin egoistisch, nicht wahr? Sie haben alle positiven Eigenschaften dieser Welt, aber Sie sind nicht die Art von Mann, der alles hinter sich lassen, alles aufgeben kann, um der Frau zu folgen, die er liebt.«
DAS ZWEITE LEBEN
DIE KINDLICHE SEELE
Das zweite Leben der Seele, Maddi, ist die Phase, in der man begreift, dass man nicht nur für sich lebt. Die anderen zählen, gewinnen an Bedeutung. Die Seele muss lernen, ihren Impulsen nicht nachzugeben oder sie zumindest zu kontrollieren, zu tricksen, zu spielen, zu betrügen, zu verführen, zu lieben.
II
DER UMZUG
Willkommen in Murol
5
Ich öffne die Fensterläden meiner Praxis. Beste Sicht auf die Chaîne des Puys, die Burg Murol, die auf dem nächstgelegenen Hügel thront und den Bergkamm des Sancy, der sich am Horizont abzeichnet. Durch die offenen Fenster drängt die Sonne in den Raum, als suche auch sie die Kühle der alten Granitsteine.
Einen solchen Empfang habe ich nicht erwartet!
Sechs Monate, bevor ich in die Auvergne zog, hatte ich mich innerlich auf Grau, tiefhängende Wolken, verschneite Straßen, nasse Rinnsteine, das kalte Gemäuer der Häuser und rauchende Schornsteine vorbereitet, auf menschenleere Straßen, auf Schals und Mützen, auf ein zurückgezogenes Leben … Seit ich in Murol bin, ist genau das Gegenteil der Fall.
Niemand hier kann sich daran erinnern, jemals einen so milden Winter erlebt zu haben. Fünfzehn Grad mitten im Februar. Über fünfundzwanzig Grad auf den sonnenbeschienenen Hängen der Vulkane. Und die Windschutzscheiben der Autos sind morgens kaum vereist.
Meine Praxis befindet sich im Zentrum von Murol, nur wenige Schritte vom Pont de Lave entfernt, der den Fluss Couze Chambon überspannt. In den Straßen des Dorfes herrscht zwar nicht das geschäftige Treiben der Rue Gambetta von Saint-Jean-de-Luz, aber es ist auch keine Geisterstadt mit all den Touristen, die dieses Jahr ums Skifahren gebracht wurden und sich hierher verirrt haben, den Wanderern, die dastehen wie die Orgelpfeifen, und den lärmenden Schülern, die aus der Schule stürmen und die kleinen alten Damen wecken, die von der Sonne genauso benommen sind wie die schläfrigen Katzen hinter den Spitzenvorhängen.
Ich lebe jetzt seit drei Wochen in Murol und bereue nichts. Drei lange Jahre haben sie hier auf ärztliche Versorgung gewartet! Ich wurde empfangen, als wäre ich aus Amerika heimgekehrt und hätte Goldbarren mitgebracht. Alle haben in meiner Praxis vorbeigeschaut, die Bürgermeisterin, die Lehrerin, der Klempner, der Metzger, der Wärter des kleinen Heimatmuseums. Alle haben mich beruhigt: Hier sind das ganze Jahr über viele Leute. Alle haben mich gelobt, als sie merkten, dass ich meine Arbeitsstunden nicht zähle. Alle haben mir ihre Hilfe angeboten, und ich zögere nicht, sie anzunehmen. Wenn man hier bereit ist, seine Tür zu öffnen oder bei anderen anzuklopfen, bleibt man nicht lange allein.
Danke, Freunde, aber ich bin nicht allein.
Ich schalte den Computer an und checke meine Termine für den heutigen Tag auf Planyo, dem Buchungsportal für Arzttermine. Heutzutage läuft alles übers Internet, sogar in der tiefsten Auvergne. Dafür braucht man keine Rezeptionskraft. Geistesabwesend überfliege ich die Patientenliste, die Augen leicht zusammengekniffen, weil mich die sich auf dem Bildschirm spiegelnde Sonne blendet.
Bevor ich sie weit aufreiße. Zwei riesige Murmeln.
Ich versuche, die Aufregung, die in mir hochsteigt, in den Griff zu bekommen und tief durchzuatmen.
Ich wusste, dass die Zeit für mich arbeiten würde! Ich bin die einzige Ärztin im Umkreis von zehn Kilometern. Ich musste nur geduldig darauf warten, dass er zu mir kommt. Alles, was ich in den letzten sechs Monaten unternommen habe – die Normandie zu verlassen, ans andere Ende Frankreichs zu ziehen, mich im Moulin de Chaudefour niederzulassen und diese Praxis zu eröffnen –, hatte nur ein Ziel: dass wir uns begegnen.
Dennoch zittere ich jetzt vor Überraschung.
Mélanie Pelat: 9 Uhr
Gérard Fraisse: 9:15 Uhr
Yvette Mory: 9:30 Uhr
Tom Fontaine: 9:45 Uhr
•••
»Sie sind dran, Madame.«