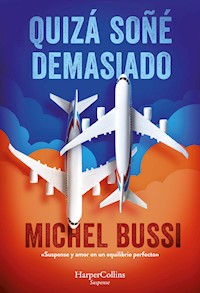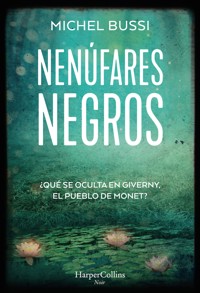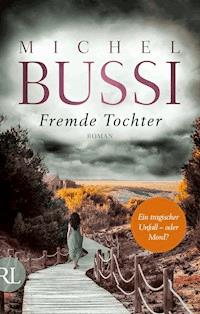9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Mord – und Millionen schauen zu. Bei einer Marine-Veranstaltung in Rouen wird ein Matrose getötet – unter den Augen von Millionen von Zuschauern. Kommissar Gustave Paturel und seine Kollegin Colette, seit 30 Jahren ein eingespieltes Team, stehen vor dem schwersten Fall ihrer Karriere. Wie konnte der Mörder unerkannt entkommen? Und gibt es eine Verbindung zwischen dem Toten und dem geheimen Schatz, nach dem in den Wassern der Seine gesucht wird? Alles deutet darauf hin, dass durch die Vorfälle ein Skandal vertuscht werden soll, und schon bald beginnt ein Wettlauf mit der Zeit auf der Suche nach dem geheimnisvollen Mörder … Atmosphärisch und spannend: ein packender Thriller aus der Normandie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Michel Bussi
Michel Bussi, geboren 1965, Politologe und Geograph, lehrt an der Universität in Rouen. Er ist einer der drei erfolgreichsten Autoren Frankreichs. Seine Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und sind internationale Bestseller.
Bei Rütten & Loening und im Aufbau Taschenbuch liegen seine Romane »Das Mädchen mit den blauen Augen«, »Die Frau mit dem roten Schal«, »Beim Leben meiner Tochter«, »Das verlorene Kind«, »Fremde Tochter«, »Nächte des Schweigens« und »Tage des Zorns« vor.
Mehr zum Autor unter www.michel-bussi.fr
Informationen zum Buch
Ein Mord – und Millionen schauen zu.
Bei einer Marine-Veranstaltung in Rouen wird ein Matrose getötet – unter den Augen von Millionen von Zuschauern. Kommissar Gustave Paturel und seine Kollegin Colette, seit 30 Jahren ein eingespieltes Team, stehen vor dem schwersten Fall ihrer Karriere. Wie konnte der Mörder unerkannt entkommen? Und gibt es eine Verbindung zwischen dem Toten und dem geheimen Schatz, nach dem in den Wassern der Seine gesucht wird? Alles deutet darauf hin, dass durch die Vorfälle ein Skandal vertuscht werden soll, und schon bald beginnt ein Wettlauf mit der Zeit auf der Suche nach dem geheimnisvollen Mörder …
Atmosphärisch und spannend: ein packender Thriller aus der Normandie
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michel Bussi
Nächte des Schweigens
Thriller
Aus dem Französischen von Ina Böhme
Inhaltsübersicht
Über Michel Bussi
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1: Abdrift
Kapitel 2: Tanz der Uniform
Kapitel 3: Still-Leben
Kapitel 4: Ufer des Verbrechens
Kapitel 5: Fachwerk und Brummschädel
Kapitel 6: Ovides Theorie
Kapitel 7: Koks mit Waffe
Kapitel 8: Nachruf in der SeinoMarin
Kapitel 9: Eine besondere Leiche
Kapitel 10: Im Son du Cor
Kapitel 11: Versteckte Kameras
Kapitel 12: Ein herrschaftliches Stadthaus
Kapitel 13: Standbild
Kapitel 14: Miss Armada
Kapitel 15: Nicolas Neufville
Kapitel 16: Der fallende Adler
Kapitel 17: Rougemare
Kapitel 18: Das Gras muss sprießen, und die Kinder müssen sterben
Kapitel 19: Abholzeit
Kapitel 20: Cocktailparty auf der Bodega
Kapitel 21: Chasse-Partie
Kapitel 22: Der letzte Pirat
Kapitel 23: Die Finte
Kapitel 24: Gold meiner Nacht
Kapitel 25: Der Schatz der Azteken
Kapitel 26: Oreste … hängt fest
Kapitel 27: Kaltes Buffet
Kapitel 28: Hugoland
Kapitel 29: CYRFAN SARL
Kapitel 30: Modus
Kapitel 31: Verrazzanos Geheimnis
Kapitel 32: Taube, Krokodil und Hai
Kapitel 33: Hygienekontrolle
Kapitel 34: Zimmer 25
Kapitel 35: Tod auf Kredit
Kapitel 36: (Tödliche) Verabredung vor der Kapelle
Kapitel 37: Der Weg der Mir
Kapitel 38: Altwasser
Kapitel 39: Kopfzerbrechen über einen Doppelmord
Kapitel 40: Der Untergang der Télémaque
Kapitel 41: Die Stunde des Profilers
Kapitel 42: Panik am Ufer
Kapitel 43: Treibjagd
Kapitel 44: Leichenzug, Totentanz
Kapitel 45: Jagd auf Blonde
Kapitel 46: Verabredung in der Libertalia
Kapitel 47: Platz 32
Kapitel 48: Ganz unauffällig …
Kapitel 49: La Buse!
Kapitel 50: Die Enterung
Kapitel 51: Vorzeitiger Ruhestand
Kapitel 52: Informatik
Kapitel 53: Sackgasse
Kapitel 54: Ramphastos’ Geheimnis
Kapitel 55: Totenpanorama
Kapitel 56: Pokerspiel
Kapitel 57: Die Suche
Kapitel 58: Rollos goldener Ring
Kapitel 59: Durch die Maschen
Kapitel 60: Kalter Kaffee
Kapitel 61: Zwischen Himmel und Seine
Kapitel 62: Fünf Geister
Kapitel 63: Ufer des Abschieds
Kapitel 64: Der letzte Hüter der Beute
Epilog – Kapitel 65: Parade
Historische und geografische Angaben
Quellennachweis
Impressum
Für die Liebesbande, die unter Segeln entstanden sind
O, ich erinnere mich jetzt, ich erinnere mich des wunderschönen brasilianischen Dreimasters, der am letzten 8.Mai die Seine herauf unter meinen Fenstern vorüberfuhr. Ich fand ihn damals so hübsch, so hell, so freundlich. Das Wesen war darauf. Es kam von da drüben, wo es herstammt, es hat mich gesehen, hat mein weißes Haus gesehen und ist vom Schiff in den Strom gesprungen. Omein Gott! Mein Gott!
Nun weiß ich alles. Nun errate ich es. Die Zeit, da der Mensch herrschte, ist vorüber.
Guy de Maupassant, Der Horla
Deutsch von Georg von Ompteda
1 Abdrift
Oktober 1983, 7Uhr 45, Marais Vernier
Die zaghafte Morgensonne färbte den Horizont an der Baie de Seine allmählich rot. Es wurde Tag über dem Marais Vernier. Aus dem Fluss stieg ein sanfter Nebel auf, hin zu der Steilküste La Roque. In dieser Mondlandschaft wirkte die Straße wie eine sich windende silberne Schlange.
Der Geländewagen war allein, fast geräuschlos, auf der verschlungenen Landstraße unterwegs. Einige Kilometer vor dem Pont de Tancarville wurde der Wagen langsamer, bis er im rechten Winkel in einen schmalen Pfad einbog.
Der Weg war voller Schlaglöcher und zu beiden Seiten von einer breiten, überschwemmten Böschung gesäumt, welcher auch die zahlreichen Erlen und Kopfweiden nicht das Wasser zu entziehen vermochten. Links wie rechts erstreckten sich seltsame, lange flache Streifen Land von der Straße bis zur Seine.
Muriel blinzelte. Der Widerschein der aufgehenden Sonne, die zwischen den Bäumen scheinbar Versteck spielte, störte sie. Im Rückspiegel sah sie den blassen Lichtstrahl des Leuchtturms von La Roque, der hoch oben auf seinem merkwürdigen Fels thronte und wie der Bergfried einer Ritterburg über die Flussmündung wachte.
Trotz der Stoßdämpfer des Geländefahrzeugs wurden die Erschütterungen unangenehm. Muriel warf ihrem Mann, der neben ihr saß, einen Blick zu. Er fuhr vorsichtig.
Konzentriert.
Dennoch fühlte Muriel sich nicht sicher.
Diese Spritztour an die Baie de Seine war keine gute Idee.
Sie hatte ein ungutes Gefühl. Vielleicht lag das nur an der gespenstischen Stimmung in der Bucht am Morgen. An der Stille. Dem Zwitschern der Vögel. Den zahllosen Vögeln, die sie gerade unsanft weckten.
Ja, der Tauchsport in der Seine beunruhigte sie! Zunächst war sie von dem sonderbaren Hobby amüsiert gewesen. Den Legenden. Den Tauchgängen im Meer. Doch inzwischen wurde all das immer mehr zur Besessenheit. Sie sah erneut zu ihrem Mann. Er spürte ihren Blick nicht einmal. Die Aufmerksamkeit blieb auf das Steuer gerichtet, die Hände fest am Lenkrad, die Augen starr …
Er war anderswo. In seinem Universum.
Das Radio übertrug ein Lied, das Muriel gefiel. Morgane de toi, diesen Hit von Renaud.
Muriel drehte sich zu ihrer Tochter Marine um, die auf dem Rücksitz noch immer schlief.
Der Kopf an die Wagentür gelehnt. Ein engelhaftes Lächeln. Leise, regelmäßige Atemzüge. Leicht beschlagene Fensterscheiben. Das hübsche Puppengesicht eines zehnjährigen Mädchens. Die Unschuld in Person. Marine war heute Morgen sehr früh aufgestanden. Mit welch einer Begeisterung! Die Aussicht auf einen Tauchgang versetzte sie stets in Hochstimmung. Sie war nicht eingeschlafen, bevor sie die Autobahn erreicht hatten. Und doch wurde Muriel das ungute Gefühl nicht los.
Warum solche Risiken eingehen?
Solche Risiken?
Ihr Mann war da natürlich ganz anderer Meinung.
Risiken? Welche Risiken? Er war ein erfahrener Taucher. Er hatte alle Weltmeere ergründet. Er war ausgebildeter Tauchlehrer und besaß sogar den Open Water Diver, eine Art internationalen Tauchschein. Unter Wasser zu sein war seither fast Routine für ihn. Es gab keinen Grund zur Panik! Auch Marine hatte ein bisschen Erfahrung. Sie tauchte seit ihrem achten Lebensjahr. O nein, natürlich nicht besonders tief. Drei bis fünf Meter. Diesen Sommer auf Korsika war sie beinah jeden Tag getaucht.
Marine liebte es.
Ja … Aber das Mittelmeer, die türkise See, die Schulferien … Es war nicht das Gleiche, in der kalten, trüben Seine zu tauchen, dem verschmutzten Wasser, den Strudeln der Schiffsschrauben.
Allein!
Im Radio stimmte Renaud die letzten Akkorde an. Der Geländewagen bremste und kam auf einem kleinen Parkplatz gegenüber einem Lichtsignal zum Stehen. Auf dem weiß-grünen Betonpfosten las Muriel »Leuchtbake«. Sie befanden sich auf einer Lichtung an der Kreuzung mehrerer Wanderwege. Muriel fühlte sich ein bisschen besser. Ihr Mann fand sich offenbar gut zurecht. Niemand kannte die abgelegenen Stellen am Fluss besser als er. Er war versessen auf die Seine und ihre Geheimnisse. Sie stiegen aus.
Marine erwachte fröstelnd, reckte sich und warf ihren Eltern ein zufriedenes Lächeln zu. Muriel umarmte sie und strich ihr kräftig über den Rücken.
Es war in Ordnung.
Sie näherten sich der Seine, erklommen die wenigen Stufen zu dem Lichtsignal, dessen schwacher Schein sich in der hereinbrechenden Dämmerung verlor.
Eine ganze Weile standen sie dort zu dritt, schweigend, von der Landschaft bezaubert. Ein paar Hundert Meter zu ihrer Rechten zeichneten sich die eleganten Konturen des Pont de Tancarville ab, des einzigen Menschengemachten im morgendlichen Schimmer der Flussmündung, zwischen Himmel und Meer. Vor ihnen der glatte Spiegel des breiten Flusses. Wie ein riesiges, kaltes, abgründiges, bodenloses Quecksilberbecken.
Muriel übermannte abermals das unbehagliche Gefühl.
Dorthinein tauchen?
»Seht!«, zerriss Marines Stimme die Stille.
Ein riesiger Schwarm Fischadler ließ sich in ihrer Nähe nieder.
Muriel überblickte die unermessliche Weite. Vögel, Hunderte Vögel, so weit das Auge reichte: Knäkenten, Löffler, Möwen, sie kannte nicht alle mit Namen.
Ein einzigartiges Naturschauspiel, das musste Muriel zugeben.
Doch die Angst blieb.
Sie wandte sich um, durchsuchte den Kofferraum und bot ihrem Mann eine heiße Tasse Kaffee aus der Isolierkanne an.
Er trank langsam.
Er war vollkommen ruhig, selbstgewiss. Bestimmt auch glücklich. Marine aß ein Croissant. Sie schenkte ihrer Mutter ein strahlendes Lächeln. Das beruhigte Muriel. Ein bisschen.
Als er ausgetrunken hatte, rieb sich ihr Mann die Hände und durchbrach seinerseits die Stille der Flussmündung:
»An die Arbeit!«
Das waren fast seine ersten Worte. Er hatte wohl eine beinah religiöse Furcht, die behagliche Atmosphäre zu zerstören. Erneut durchforsteten sie das Heck des Wagens. Jeder half beim Tragen der schweren, umfangreichen Tauchausrüstung: Flaschen, Anzüge, Flossen.
Muriel beobachtete das präzise Vorgehen ihres Mannes. Er war ein durchaus gewissenhafter Ehepartner und Vater. Auf dem Boden kniend überprüfte er sorgfältig die Druckventile und Kompressoren. Sie bewunderte ihn. Natürlich liebte sie ihn. Auch wenn sich manchmal dieses alles verzehrende Hobby zwischen sie drängte. Wie eine Geliebte, die immer besitzergreifender wurde. Eine Geliebte, die ihr den Mann wegnahm. Muriel zwang sich wie immer, an etwas anderes zu denken, die Eifersucht aus ihren Gedanken zu vertreiben. Sie würde nicht wie all die Frauen werden, die an den nutzlosen Hobbys ihrer Männer verzweifelten, die versuchten, deren Eigenheiten und Persönlichkeiten herabzusetzen und nach ihrem Ideal zu formen. Nein, so eine war sie nicht! Sie akzeptierte ihren Mann, wie er war.
Und doch …
Und doch, es wollte ihr nicht gelingen, einen quälenden Gedanken zu verscheuchen: Das Hobby ihres Mannes, seine Besessenheit, seine sinnlosen Untersuchungen würden sich allmählich seines Verstandes bemächtigen, ihn verschlingen, ihn zu einem anderen Menschen machen.
Nein! Muriel schüttelte sich. Sie argumentierte wie ein eifersüchtiges Mädchen. Ihr Mann tauchte gern und mochte das Geheimnisvolle. Das war alles! Ihre Tochter übrigens auch, und Muriel konnte schlicht und ergreifend schwer akzeptieren, dass sie bei dieser Gemeinsamkeit außen vor war. Schließlich war sie es, die nicht tauchen lernen wollte.
Marine dagegen war von dem Hobby ihres Vaters begeistert. Hingerissen. Sie schlüpfte in ihren schwarz-lila Neoprenanzug. Sie schulterten die Tauchausrüstung, Muriel folgte Marine und ihrem Vater in eine kleine, nur wenige Schritte von dem Geländewagen entfernte Bucht mit einem sanft abfallenden Strand, der aus großen Gesteinsbrocken künstlich angelegt worden war.
Anfangs hatte Muriel bei dem Gedanken an einen Tauchgang in der Seine vor allem die Schiffe gefürchtet: Die Seine war ein schiffbarer Fluss. Ohne Erlaubnis zu tauchen war wegen der Passagierschiffe verboten. Doch in der Bucht bestand offenbar keine Gefahr.
Dennoch wurde die schlimme Vorahnung, das beklemmende Gefühl immer stärker, dass sich ein Drama abspielen würde, hier im nächsten Augenblick.
Es ergab überhaupt keinen Sinn.
»Wir sind nur fünfzehn, höchstens zwanzig Minuten unter Wasser«, erklärte ihr Mann ruhig. »Es dauert nicht lange.«
Muriel wartete für gewöhnlich an der Küste, überblickte den Wasserspiegel und hielt ängstlich nach einem Gesicht Ausschau, das die Oberfläche durchdringen sollte. Sie selbst tauchte nicht. Sie schwamm auch nur selten, es war nicht ihr Ding. Sie ging lieber spazieren oder wandern.
»Seid vorsichtig«, murmelte sie.
Ihr Mann hörte sie nicht. Ebenso wenig Marine, längst auf die kleinsten Details konzentriert, die ihr Vater bereits bis zum Überdruss wiederholt hatte. Das Atmen, die sanften Bewegungen, die Unterwasserzeichen.
Kurz spürte Muriel erneut ihre Eifersucht auf die Verbundenheit zwischen Vater und Tochter, auf seine Begabung, Marine durch Geschichten, Abenteuer, kontrollierte Risiken zu verzaubern.
Sie lächelte die beiden Taucher liebevoll an.
Nein, sie war nicht eifersüchtig. Auch sie hatte ihren Platz. Ihren Platz, wenn sie der Tochter, die zitternd aus der Seine steigen würde, das warme Handtuch reichen, sie in den Arm nehmen, ihren begeisterten Bericht anhören würde. Ihren Platz als Mutter. Genau hier, am Ufer.
»Was machst du solange?«, frage ihr Mann.
»Auf euch warten … Vielleicht ein bisschen herumschlendern.«
Sie küsste ihn flüchtig auf die Lippen und fügte hinzu: »Du hast das Talent, immer wieder kleine Wanderparadiese zu entdecken.«
Mit einer Angst, die sie nicht zurückdrängen konnte, sah sie die beiden in das Totwasser eintauchen.
Als sich die Seine wieder über ihnen zutat, hob sie ungewollt den Blick. Zwei Graureiher folgten einander in einem anmutigen Flug entlang der eleganten Wölbungen des Pont de Tancarville.
Die kommenden Augenblicke kamen Muriel wie eine Ewigkeit vor. Sie brachte es nicht fertig, am Wasser zu bleiben. Sie würde ein paar Schritte gehen, einen Abstecher in den Sumpf machen, die Vögel aus der Nähe beobachten, vielleicht auf ein Hochlandrind oder Camargue-Pferd stoßen, die seit einigen Jahren wieder im Marais heimisch waren.
Gedankenversunken, auf den mütterlichen und ehelichen Beschützerinstinkt konzentriert, hörte sie nicht die Schüsse weitab im Moor.
Seit fast einer Woche war die Jagdsaison eröffnet. Aber Muriel wusste nichts davon.
Nach ihrer Mutter Ausschau zu halten war wie immer das Erste, was Marine tat, wenn sie aus dem Wasser stieg. Sie suchte das Steilufer nach der tröstlichen Gestalt ab.
Nichts.
Marine blickte zu ihrem Vater. Auch er sah sich nach Muriel um.
Sie schritten nur langsam vorwärts. Der matschige Schlamm am Strand erschwerte ihr Fortkommen. Sie zogen die Flossen aus und gelangten ans Ufer.
»Ist Maman nicht da?«, fragte Marine.
»Sie ist spazieren gegangen«, beruhigte sie der Vater. »Sie kommt bestimmt gleich. Zuallererst müssen wir uns abtrocknen und anziehen.«
Marine war enttäuscht. Soweit sie denken konnte, war Maman immer dagewesen, wenn sie mit Papa tauchen gewesen war, hatte an der Küste mit einem strahlenden Lächeln, einem dicken Handtuch und, wenn es sehr heiß gewesen war, einer Flasche frischen Wassers auf sie gewartet.
Nicht so an diesem Morgen.
Doch dann hatte Marine zum Nachdenken nicht mehr viel Zeit. Ihr Vater zog kraftvoll an dem Reißverschluss ihrer Montur. Das konnte Marine nicht ausstehen. Den Tauchanzug abzustreifen fühlte sich an, als ob einem jemand eine zweite Haut abziehen würde, vor allem an Armen und Beinen. Und Papa zog heftiger, brutaler an dem Neopren, als in der Regel Maman es tat. Marine kam zu dem Schluss, dass es normalerweise weniger schmerzhaft war. Aber sie beschwerte sich nicht, wenn sie mit Papa zusammen war.
Plötzlich war sie in ein riesiges Handtuch gewickelt.
»Schlüpf schnell in deine Sachen«, befahl ihr Vater.
Das ließ sich Marine nicht zweimal sagen. Es war wirklich sehr kalt! Nicht zu vergleichen mit Korsika. Während der Vater sich umzog, griff sie nach ihrer Kleidung. Allmählich wurde ihr wärmer. Sie streifte den Pullover über und vergaß auch nicht, die naturweiße Wollmütze mit den malvenfarbenen Blumen aufzusetzen. Marine dachte an Mamans Rat: Immer den Kopf bedecken, wenn man aus dem Wasser kam oder wenn es kalt war.
Und es war kalt! Außerdem mochte Marine die Mütze, deren Wolle sie selbst ausgesucht hatte, bevor Maman sie ihr gestrickt hatte. Aus der gleichen Wolle war der Pullover, den Maman trug.
Maman?
Wo blieb sie denn? Was machte sie?
Ihr Vater verstaute die Sauerstoff-Flaschen und Tauchanzüge im Wagen. Marine trat näher, um die Seine zu betrachten. Man konnte jetzt gut die beiden Brücken erkennen.
Mit einem Mal nahm sie etwas Seltsames in der Landschaft wahr, etwas Ungewöhnliches. Sie dachte nach, kam aber nicht darauf, was nicht stimmte.
Der Kofferraum schlug zu. Ihr Vater war fertig. Marine hatte einen Geistesblitz.
Die Vögel!
Es gab kein Vogelgezwitscher mehr! Da war überhaupt kein Vogel mehr, weder im Wasser noch auf den Bäumen. Nur ein paar wenige, fern am Himmel.
Warum nur?
Marine warf ihrem Vater einen leicht beunruhigten Blick zu. Der antwortete mit einem beschwichtigenden Lächeln. Er war angezogen. Er reichte ihr seine große Hand:
»Sollen wir Maman entgegenlaufen?«
Die Schüsse hörten sie kaum. Es waren vor allem die dicht über ihren Köpfen hinwegfliegenden Saatkrähen, die sie erstaunten.
»Was war das?«, fragte Marine.
»Jäger«, erwiderte ihr Vater sanft. »Die Jagd ist wohl eröffnet. Aber keine Sorge, sie sind weit weg. Es gibt im Marais bestimmte, für sie ausgewiesene Gebiete …«
»Sie erschießen die Vögel?«
»Sie versuchen es.«
Marine hatte ihre Erklärung für das Verschwinden der Vögel, aber das beruhigte sie nicht. Sie wollte gern mehr über diese Jagdgebiete erfahren, spürte aber, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt war. Papas Hand war feucht. Das war ungewöhnlich. Er schwitzte normalerweise kaum. Ohne zu wissen warum, hatte Marine das Gefühl, dass ihr Vater anders war als sonst, dass er Angst hatte und die Angst vor ihr verbergen wollte. Noch dazu lief er immer schneller.
Marine konnte kaum Schritt halten.
»Papa! Nicht so schnell!«
Ihr Vater wurde nicht langsamer. Sie folgten immer demselben Weg. Er war in einem schlechten Zustand. Hohe Gräser, noch feucht vom Morgentau, machten Marines Jeans bis zu den Knien nass. Sie beklagte sich nicht. Es war nicht der Zeitpunkt dafür.
»Wir könnten sie rufen«, schlug Marine vor.
Nicht weit entfernt knallte es erneut zweimal. Die Entfernung war schwer abzuschätzen. Zu ihrer Rechten sah sie einen Weg, der zu einem von Röhricht gesäumten Wattenmeer führte. Der Boden wurde immer sumpfiger. Kurz befürchtete sie, ihr Vater würde rechts abbiegen. Ihre Schuhe waren durchnässt. Sie fror. Sie hatte genug von alldem.
Ihr Vater änderte die Richtung nicht.
Er blieb stehen.
Marine spürte, wie Papas Hand auf einmal schlaff wurde, als ob sie schlagartig keine Knochen mehr hätte. Marine konnte nichts sehen, sie war zu klein, die Gräser waren zu hoch.
Sie stellte sich auf Zehenspitzen.
Zuerst sah sie im Schilf die malvenfarbenen Blumen des Wollpullovers.
Sie schüttelte die reglose Hand ihres Vaters ab und machte ein paar Schritte nach vorn.
Ihre Mutter lag im Gras.
Die Augen weit geöffnet. In einer Pfütze aus Schlamm und Blut. In ihrem Bauch ein furchtbares schwarzes Loch.
Der Vater fasste Marines Hand so brutal, dass ihre Fingerglieder brachen. Marine spürte keinen Schmerz. Mit der anderen Hand hielt er seiner Tochter die Augen zu.
Zu spät.
Sie hatte genug Zeit gehabt, um den Blick auf das Entsetzliche zu richten, um die furchtbare Tragödie für immer in ihr Gedächtnis zu brennen.
Ein weiterer Schuss erschütterte den wattigen Himmel über der Bucht. Rund zwanzig Meter von ihnen entfernt stoben ein Dutzend Drosseln aus einem Holunder.
Der feste Druck seiner Hände löste sich weder an ihrer Hand noch vor ihren Augen.
Marine war in Schwärze gehüllt, in tiefste Schwärze.
Nur noch der Pulsschlag in den Fingerspitzen ihres Vaters verband sie mit dem Leben, der Zeit, dem Rest der Welt.
Der Pulsschlag ihres Vaters.
An jenem Morgen nahm Marine nichts anderes mehr wahr.
Sie sah nicht, wie sich der Blick des Vaters trübte, wie seine Augen ihren menschlichen Ausdruck verloren, wie ein Stück seiner selbst für immer verschwand. Gefangen in der Dunkelheit, umgeben von der beschützenden Wärme des Vaters, bemerkte sie mit ihren zehn Jahren nicht, wie er die Linie überschritt.
Den schmalen Grat.
Zwischen Vernunft und Wahnsinn.
Wie der kleine Hebel umschlug.
Marine konnte gar nichts ahnen, nichts bemerken.
Doch an jenem Morgen glitt ihr Vater langsam und unweigerlich den Hang des Unverstands hinab.
Dem Bild des Schreckens, das ihn die darauffolgenden Monate bis Jahre immer wieder heimsuchte, sollten eine Wahnvorstellung, falsche Gewissheiten und die unaufhaltsame Spirale des Irrsinns entspringen …
Sobald die Ereignisse selbst außer Kontrolle gerieten, sollte dieser Irrsinn tödlich werden.
All das konnte Marine nicht wissen.
Die Hand, die sie noch mit der Welt verband, die ihre kindlichen Finger zerquetschte, die eiserne Faust des Vaters würde sie niemals loslassen, würde auch sie in den Abgrund treiben.
Fünfundzwanzig Jahre später
2 Tanz der Uniform
Freitag, 4.Juli 2008, Quillebeuf-sur-Seine
Es war fast Mittag, als in der letzten Flussschleife vor Quillebeuf der Umriss der Cuauhtémoc auftauchte.
Jubel erhob sich an beiden Seineufern. Die Cuauhtémoc war nicht das erste Schiff der Armada 2008, das stromaufwärts nach Rouen fuhr, aber gewiss eines der erhabensten. Der Dreimaster, weiß vom Rumpf bis zu den trapezförmigen Segeln, näherte sich den gut tausend Zuschauern, die sich an den Kais versammelten. Die Kleinstadt Quillebeuf am linken Flussufer schien ihren Glanz von damals, als sie noch der wichtigste Hafen der Flussmündung gewesen war, wiedererlangt zu haben. Die sonnigen Straßencafés waren bis auf den letzten Platz besetzt. An den Anlegestellen bildeten sich Menschentrauben.
Genau gegenüber, am rechten Flussufer, hatte sich die Raffinerie Port-Jérôme schlagartig geleert. Sekretärinnen, Arbeiter und Führungskräfte nutzten die Mittagspause, um ein spontanes Picknick und die Parade der Großsegler zu genießen. Alle Schiffe gelangten mithilfe der Gezeiten die Seine hinauf, sodass die alten Takelagen eine nach der anderen einen kompakten Festzug bildeten.
Cuauhtémoc, letzter aztekischer Herrscher, beeindruckende Galionsfigur des mexikanischen Schiffes, die stolze Miene dem Horizont zugewandt, schien von der Begeisterung des Publikums unberührt. Nicht so die mexikanischen Matrosen. Quillebeuf und Port-Jérôme waren nach Le Havre die ersten Ortschaften an der Seine. Ihr erstes Bad in der Menge … Um ihren Bewunderern Ehre zu erweisen, hatten sich etliche Seemänner durch einen spektakulären Trapezakt auf die Rahen gehievt. Wie Seiltänzer mehrere Dutzend Meter über der Seine, dem Schwindel trotzend, winkten sie dem Publikum zu, als wäre es das Normalste der Welt.
Die gebräunten Gesichter der jungen Mexikaner und ihre tadellosen, schwarz-weiß gestreiften Hemden verliehen dem Schauspiel zusätzlich etwas Exotisches. Die Matrosen lächelten, einige waren von dem überschwänglichen Empfang überrascht, andere, die bereits vorher an Armadas teilgenommen hatten, kannten das herzliche Publikum schon und schätzten es umso mehr.
Sie wussten, dass Hunderte Amateurfotografen den Augenblick für die Ewigkeit festhalten würden. Und ahnten die bewundernden Blicke des schönen Geschlechts.
»Seht!«, rief plötzlich eine Stimme am Quai de Saint-Jérôme.
Ein Finger reckte sich.
Die Blicke richteten sich auf eine Stelle am Fockmast, dem vordersten der drei Masten.
»Das macht er jetzt nicht ernsthaft«, gluckste eine hübsche kleine Blondine, an zwei Kolleginnen geklammert.
»Doch!«, entgegnete eine der beiden, während sie das Objektiv ihres Mobiltelefons einstellte.
Auf der ersten Rah des Fockmasts lüpfte einer der Mexikaner langsam sein Hemd.
Die anderen Matrosen der Cuauhtémoc schienen ebenso verwundert wie die Zuschauer an Land. Der Striptease war im offiziellen Programm wohl nicht vorgesehen … Ohne das Gleichgewicht zu verlieren, zog sich der junge Matrose das Hemd über den Kopf, hielt es eine Weile am Ärmel fest, wirbelte es im Kreis herum und ließ es schließlich auf das Deck fallen.
Ungeniert stellte der Mexikaner seinen perfekten, muskulösen, braunen, unbehaarten Oberkörper zur Schau. Das Publikum überlief ein Schauer. Ein paar Frauen pfiffen oder applaudierten. Manche waren so beflügelt, dass sie ihre Ferngläser auf den Adonis richteten. Während die Menschen am Ufer ein leichter Sinnentaumel befiel, schien die Posse auf dem Schiff wenig Beifall zu finden, und eine Gruppe von Offizieren begann geschäftig hin- und herzueilen.
»Er springt!«, schrie es plötzlich aus der Menge.
Das Publikum erschauderte.
Allmählich wich das Gelächter einer gewissen Beunruhigung.
Etwas Ungewöhnliches geschah! Das war auch in den ungläubigen Blicken der anderen Matrosen zu lesen.
Alle rissen sie die Augen auf. Es gab keinen Zweifel mehr: Der junge Mexikaner hatte den Sicherheitshaken entfernt, mit dem er an der Rah festgemacht gewesen war. Er blickte zum Himmel, sprach ein paar Worte, vielleicht ein Gebet, und spähte erneut zu den Kais, als ob er die verführerischste seiner Bewunderinnen ausmachen wollte.
Mit einem Mal grüßte er wie ein Torero das Publikum und schwang sich empor.
Ein paar unwirkliche Momente lang bot er Himmel und Seine die Stirn, mit seitlich ausgestreckten Armen, wie die gespreizten Flügel eines riesigen Vogels.
Entsetzensschreie gingen durch die Reihen. Fotoapparate klickten.
Es war noch keine Sekunde vergangen, da streckte der mexikanische Matrose die Arme nach vorn. Der Körper des Tauchers neigte sich in eine formvollendete Kurve.
Wie ein Torpedo durchstieß er das graue Wasser der Seine.
Nahezu ohne einen Spritzer.
Ein Kopfsprung aus über fünfzehn Metern Höhe. Ästhetisch von absoluter Perfektion.
Die Zuschauer an Land, fassungslos, wussten nicht recht, wie sie sich verhalten sollten. Kaum jemand applaudierte. Alle sahen sie zu der wieder glatten Wasseroberfläche. Die Zoomobjektive der Fotoapparate und Ferngläser wurden neu ausgerichtet und lauerten dem geringsten Wellengang. Dutzende mexikanische Seekadetten, allesamt genauso beunruhigt, eilten auf der Cuauhtémoc zum Freibord. Der mexikanische Dreimaster verlangsamte die Fahrt, bis er fast zum Stillstand kam.
Lange Sekunden verstrichen. Die Anspannung erreichte ihren Höhepunkt.
Es war bereits über eine Minute her, seit der Matrose in der Seine verschwunden war.
An Deck der Cuauhtémoc wurde hastig ein Beiboot losgemacht.
Am Ufer wurde die Stille unerträglich.
Eine weitere Minute verging.
»Wir müssen etwas tun!«, rief eine Stimme.
Ein paar Zuschauer hatten kurzerhand den Notarzt oder die Polizei gerufen. Andere waren nahe daran, ins Wasser zu springen.
Zwei Minuten und siebzehn Sekunden.
Plötzlich wirbelte die Oberfläche auf, und das feine Gesicht des mexikanischen Matrosen tauchte hervor. Auf den Lippen ein Lächeln.
Einen Augenblick später waren beide Seiten des Flusses von gewaltigem Lärm erfüllt, vereint in derselben freudigen Erregung. Auf der Cuauhtémoc wurde das Boot doch nicht zu Wasser gelassen. Der junge Held grüßte erneut in die Menge und gelangte mit einem tadellosen Kraulschlag zu dem Segelschiff zurück. Während er die Strickleiter emporkletterte, winkte er ein letztes Mal seinen Bewunderern zu, die im Übrigen vornehmlich Bewunderinnen waren.
Ein paar Hundert Fotos verewigten ein letztes Mal die glänzende Brust und die triefnasse weiße Leinenhose, die fast durchsichtig an seinen Oberschenkeln klebte.
Der Taucher verschwand an Deck. Die Cuauhtémoc setzte ihren Kurs fort, und die Menschen verstreuten sich, nicht ohne sich darüber Gedanken zu machen, was die soeben erlebte Vorstellung zu bedeuten hatte.
Eine blöde Wette? Ein Wahnsinnsakt? Eine Provokation? Eine kindische Verführungsaktion?
Kein Zuschauer kam der Wahrheit nahe.
Keiner konnte ahnen, dass das, was er gesehen hatte, vollkommen belanglos war. In Wirklichkeit lag die Vorstellung in etwas begründet, was niemand bemerkt hatte.
Niemand außer dem mexikanischen Matrosen.
Carlos Jésus Aquileras Mungaray, genannt Aquilero.
Er wusste, was er riskierte: eine Beurlaubung, einen Verweis, nicht enden wollende Frondienste. Auf jeden Fall ein paar Tage Arrest auf dem Schiff. Mit striktem Ausgangsverbot.
All das wusste er, und er akzeptierte es.
Das Spiel war den Einsatz wert gewesen.
All das, diese ganze Inszenierung, hatte nur ein Ziel gehabt. Zwei Minuten und siebzehn Sekunden lang vor Quillebeuf unter der Oberfläche der Seine zu sein.
***
Am Mittwoch, dem 9. Juli, um Punkt 18 Uhr, also fünf Tage nach seiner »Glanzleistung« vor Quillebeuf, durfte Carlos Jésus Aquileras Mungaray die Cuauhtémoc zum ersten Mal wieder verlassen. Der Kopfsprung von Quillebeuf hatte ein paar Tage lang viel Aufsehen erregt. Von den höchsten Dienstgraden bis zu den Zimmergenossen hatten alle versucht zu verstehen, warum er das getan hatte. Vergeblich.
Um Druck auszuüben, hatte die oberste Befehlsgewalt der Cuauhtémoc die Angehörigen des jungen Mexikaners benachrichtigt. Aber jeder auf dem Segelschiff wusste, dass die Mungarays eine reiche und mächtige Familie mexikanischer Waldbesitzer waren, die durch den Handel mit Tropenholz über mehrere Generationen hinweg zu Geld gekommen war. Carlos Jésus, der darauf bestand, ausschließlich bei seinem Spitznamen Aquilero genannt zu werden, war jung, schön, reich … und arrogant.
Die Drohungen seiner Vorgesetzten kümmerten ihn nicht.
Um kurz nach 18 Uhr verließ Aquilero gemeinsam mit drei anderen mexikanischen Matrosen das Schiff, fest entschlossen, die verlorene Zeit nachzuholen. Gut sitzende weiße Mützen, makellose weiße Hemden, Offizierstressen an den Schultern und akkurate Hosen: Die vier Matrosen, unter ihnen drei, die bereits an früheren Armadas teilgenommen hatten, wussten, dass die Nacht lang werden würde. Sie kannten die Wirkung ihrer Uniform. In den darauf folgenden Stunden streiften sie durch die mittelalterlichen Gassen von Rouen. Sie erwiderten das charmante Lächeln der Sommerurlauberinnen, schäkerten auf Spanisch, ließen sich widerstandslos fotografieren, tauschten gegenseitig die Mützen, ließen sich in den Straßencafés nieder, bestellten Corona und bewunderten die Beine der Passantinnen.
Die Zeit verging wie im Flug. Als beinah zehn Biere später die Dunkelheit hereinbrach, beschlossen die vier Mexikaner, zur Sache zu kommen.
La Cantina!
Nicht nur, weil es dort ermäßigte Preise für Seefahrer gab, sondern vor allem, weil sich allabendlich fast zweitausend Tanzende in dem riesigen Zelt versammelten. Nacht für Nacht eine unglaubliche, nicht enden wollende Party. Ein Fest, auf dem die Matrosen natürlich die Könige waren …
Die vier Matrosen der Cuauhtémoc wussten, dass sie bei dem kleinen Konkurrenzspiel zwischen den Mannschaften wenig zu befürchten hatten. Sie waren am beliebtesten. Sie hatten einen guten Ruf, den sie sich im Zuge der Armadas seit 1989 erarbeitet und verteidigt hatten.
Die Latinlover der Armada!
Aquilero hatte sich vier Nächte lang wie ein Adler in einer Voliere gewunden und sich die fantastischen Eroberungen der Zimmergenossen immer begieriger angehört.
Es war so einfach!
So einfach, wenn man zu südländischen Rhythmen tanzen, eine Uniform tragen und mit lateinamerikanischem Akzent ein paar nette französische Komplimente aufsagen konnte.
Als sie ankamen, war die Cantina bereits zum Bersten voll. Die Hitze war drückend, die Warteschlange am Biertresen beeindruckend lang. Die vier Mexikaner wünschten einander viel Glück und gingen auseinander.
Aquilero bahnte sich einen Weg durch die schwitzende Menge. Auf Timba folgte Salsa. Die meisten Tänzer bemerkten den Unterschied nicht.
Bevor er sich auf die Tanzfläche begab, beobachtete er kurz das Geschehen: Die Röcke schwangen hin und her, die völlig enthemmten Mädchen wanderten von Hand zu Hand, tanzten und lachten.
Die Leiber schmiegten sich aneinander und lösten sich wieder. Die Hemdenknöpfe der Matrosen sprangen einer nach dem anderen auf. Belustigt sah Aquilero ein paar jungen Einheimischen dabei zu, wie sie versuchten, gegen die südamerikanischen Seemänner anzukommen – wie sie das Tanzbein schwangen und sich bemühten, Hüfte, Gesäß und Lenden so natürlich wie möglich zu kreisen … Wahrscheinlich übten sie nur. Aquilero grinste. Nicht nur die Uniform fehlte ihnen, sondern vor allem Attitüde, Gewandtheit, etwas, das man nicht lernen konnte.
Auf Salsa folgte Tango. Aquilero beschloss mitzutanzen. Er hatte eine kleine Brünette von klassischer Schönheit entdeckt, deren Haar fast länger als ihr Rock war. Er bahnte sich einen Weg durch die Menge, und schon landete die junge Frau wie durch Zauberei in seinen starken Armen. Es dauerte nicht lange, bis sich ein Kreis um die zwei Tanzenden bildete. Die verschmolzenen Körper wirbelten eine Weile herum, bis Aquilero seine Partnerin erschöpft durch eine andere Französin austauschte, die ihn nicht mehr aus den Augen ließ.
Mädchen jeden Alters, mehr oder weniger angetan, mehr oder weniger gute Tänzerinnen, wechselten sich stundenlang in seinen Armen ab.
Der Schweiß lief ihm den Rücken hinab und durchtränkte sein dünnes weißes Hemd. Nach einem glühenden Salsa mit einer jungen Frau, die doppelt so schwer sein musste wie er, kehrte Aquilero zu der Bar zurück, trank ein Bier und überließ es den anderen Matrosen der Cuauhtémoc, für Stimmung zu sorgen.
Er blieb eine Weile dort stehen, um wieder zu Atem zu kommen.
Kurz dachte er an das, was er wirklich suchte. An den wahren Grund, aus dem er nach Rouen gekommen war, obwohl er das Matrosenleben schon vor langer Zeit hätte aufgeben und mit der Jeunesse dorée von Cancún von dem Geld seiner Familie hätte leben können. Er dachte an die Mission, die er seit Monaten bis zum Überdruss gedanklich wiederholte. An diese wenigen Tage, die er bereits seit fünf Jahren plante. Er würde vorsichtig sein. Er hatte nur begrenztes Vertrauen in andere. Alles, was er über dieses Fleckchen Erde, das Seinetal, wusste, hatte er sich angelesen und sorgfältig einstudiert.
Sein Blick blieb an dem flachen Bauch einer Tänzerin hängen, die nur eine Schrittlänge von ihm entfernt hin und her wogte.
Die Mission konnte bis morgen warten! Heute Abend würde er leben, mit ganzer Seele, bis zum Ende der Nacht. Dann würde er wieder Kontakt mit den anderen aufnehmen müssen. An die Beute denken. Zeichen suchen. Tauchen. Er wusste, was zu tun war.
Er leerte sein Bierglas in einem Zug und verschwand in der Menge.
Sein Hemd war jetzt bis zum Bauchnabel hin geöffnet. Die meisten Mädchen, denen er sich näherte, wandten sich ab. Wenige andere hielten seinem Adlerblick stand. Manchmal streifte ihn bei einem Richtungswechsel eine Brust, wagten sich ein paar Hände an seinen nackten Oberkörper.
Aquilero tanzte weiter, mit immer neuen Partnerinnen, allerdings auch mit nachlassendem Elan. Die Reihen lichteten sich. Die Matrosen wurden weniger. Oft in Begleitung machten sie sich davon.
Aquilero richtete sich an der Bar ein und unterhielt sich auf Englisch oder Spanisch mit den Mädchen um ihn herum.
Gegen zwei Uhr morgens verließ Aquilero die Cantina mit einer hübschen Blondine.
Niemand bemerkte sie.
Die wenigen Zeugen erinnerten sich erst tags darauf, als die Polizei sie befragte. Aquilero war vielen aufgefallen. Keiner aber war in der Lage, das Gesicht der jungen Frau zu beschreiben, mit der er die Cantina verlassen hatte.
Nur ein paar Zeugen erwähnten die perfekten Kurven des Mädchens, das dem mexikanischen Matrosen in den Armen gelegen hatte.
Donnerstag, 10.Juli 2008:
Die schwarzen Engel der Utopie
3 Still-Leben
5Uhr 45, Quai Boisguilbert, Rouen
Mit der Staffelei unter dem Arm erreichte Maxime Cacheux das Seineufer um kurz vor sechs Uhr früh. Die Sonne war gerade aufgegangen. Er gehörte zu den wenigen Malern, die tagtäglich in der Morgendämmerung aufstanden, um eine menschenleere Sicht auf die Großsegler zu haben.
Er ließ sich gegenüber der Cuauhtémoc nieder, um das Aquarell fertigzustellen, das er tags zuvor skizziert hatte. Etwa zehn Bilder wollte er während der Armada malen. Er hatte sich die Zeit daher gut eingeteilt. Sein Vorgesetzter von der Regionalen Wirtschaftskammer hatte ihm genehmigt, dass er diese Woche nur halbtags arbeitete.
Er stellte seine Staffelei auf, platzierte die Palette und suchte die exakte Stelle, an der er gestern gestanden hatte. Er schimpfte.
Das Licht war nicht das gleiche! Wie dumm von ihm. Er durfte nur ein Bild pro Tag zeichnen, und damit basta. Nicht ein zweites anfangen. Er dachte sehnsüchtig an die Galerie in Honfleur, die ihm so gut wie versprochen hatte, im August seine Werke auszustellen. Er wusste sehr wohl, dass seine Gemälde nicht besonders originell waren. Er wusste aber auch, dass sich das Motiv der Armada verkaufte … Er sah in den Himmel und seufzte. Es war bereits zu hell. Er war fünf Minuten zu spät gekommen. Gestern war der Himmel besonders eindrucksvoll gewesen.
Egal. Er griff nach einem Pinsel und machte sich daran, gründlich die Landschaft in Augenschein zu nehmen.
Die Kais waren wie leer gefegt.
Dumm sind die Leute, dachte Maxime. Jetzt ist doch die beste Zeit.
Er fuhr in seiner Betrachtung fort. Ein Detail erregte seine Aufmerksamkeit. Eigentlich mehr als nur ein Detail.
Rechts des Bildrands, etwa zehn Meter von der Cuauhtémoc entfernt, lag ein Mann auf dem Boden.
Maxime lächelte. Der arme Kerl hatte wohl gestern zu viel getrunken.
Dann entdeckten seine nunmehr wachen Augen eine ungewöhnliche Komponente.
Unter dem Körper befand sich eine rote Pfütze.
»Scheiße«, schimpfte Maxime Cacheux.
Er dachte daran, dass er wertvolle Zeit verlieren würde, den flüchtigen Augenblick, bevor die Ufer sich belebten. Er zögerte. Widerwillig traf er einen Entschluss und ging auf den ausgestreckten Körper zu.
Maxime Cacheux hat nie vergessen, was er an jenem Morgen gesehen hat. Es heißt, dass seine Aquarelle seitdem wesentlich besser sind. Dunkler, tiefgründiger.
Maxime beugte sich über den reglosen Körper. Es war kein Clochard.
Es war ein Matrose, ein mexikanischer Matrose. Er erkannte das weiße Hemd, das Abzeichen.
Ein mexikanischer Matrose, der zu viel Tequila getrunken hatte, um auf sein Schiff zurückzufinden?
Nein, leider nicht.
Die Augen des jungen Mexikaners waren verdreht und weit aufgerissen.
Eine tiefe, klaffende, blutrote Schnittwunde befleckte sein Hemd, genau an der Stelle des Herzens.
Carlos Jésus Aquileras Mungaray, genannt Aquilero, lag tot da, erstochen am Ufer der Seine, direkt vor der Cuauhtémoc.
4 Ufer des Verbrechens
7Uhr 15, Quai Boisguilbert, Rouen
Entschieden bahnte sich Kommissar Gustave Paturel einen Weg durch den Pulk. Seine neunzig Kilo Körpergewicht halfen ihm dabei, die zähe Masse der Schaulustigen zu durchdringen. Seine dröhnende Stimme erledigte den Rest:
»Polizei! Aus dem Weg!«
Wie er vermutet hatte, war die Besucherdichte bereits jetzt beeindruckend.
Wie würde es erst im Laufe des Vormittags sein?
Der Fall musste schnell gelöst werden. Schnell, aber ohne ein Risiko einzugehen.
Als er weiterging, fuhr er mit seiner Bestandsaufnahme fort. Eine Leiche am Ufer, auf der Armada, das war eine Premiere! Wenn man es sich aber recht überlegte, dann musste so etwas früher oder später passieren. Der Alkohol, das Zusammentreffen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, die Aufregung. Obwohl überall Polizisten und Kameras postiert worden waren, war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein Streit eskalieren würde. Die Ermittlungen machten dem Kommissar wenig Sorgen. Da der Andrang tags wie nachts groß war, würde es nicht schwer sein, Zeugen zu finden. Der Mörder des Matrosen würde sich vielleicht sogar selbst anzeigen, wenn er erst einmal wieder nüchtern war. Nein, am meisten beschäftigte Kommissar Paturel der Umgang der Medien mit dem Fall. Die Armada von Rouen mit ihren Millionen Touristen war inzwischen die zweitgrößte Veranstaltung Frankreichs, nach der Tour de France. Sogar die größte, wenn man bedachte, dass die Tour de France drei Wochen lang und im ganzen Land stattfand.
Als Sicherheitsbeauftragter der Armada musste er behutsam zu Werke gehen. Er musste alles direkt mit dem Präfekten, mit der Crème de la Crème von Rouen besprechen. Ein solcher Zwischenfall sollte so wenig Wirbel wie möglich machen … Es würde für Schlagzeilen sorgen … Er sah die weißen Segel der Cuauhtémoc.
Er war da!
Beherzt schob er die letzten paar Schaulustigen zur Seite.
»Polizei. Machen Sie Platz.«
Er schritt über das orange Band, das nachlässig rund um den Leichnam aufgespannt worden war. Langsam begriff er, warum es sich am Kai derart staute. Neben den Touristen, die eine Art morbide Neugier befriedigten, nahm die Absperrung um den ausgestreckten Leichnam drei Viertel des Ufers ein und bildete vor der Cuauhtémoc ein Nadelöhr.
Kommissar Paturel tupfte sich die Stirn. Er überblickte den Tatort und entspannte sich. Seine beiden wichtigsten Assistenten, die Inspektoren Colette Cadinot und Ovide Stepanu, waren bereits vor Ort.
Colette Cadinot, durch die Ankunft ihres Chefs sichtlich beruhigt, kam dem Kommissar als Erste entgegen.
»Hallo, Gustave. Endlich … Wir haben auf dich gewartet.«
Die Inspektorin sah unmissverständlich auf ihre Armbanduhr. Der Kommissar überhörte die Anspielung auf seine Verspätung. Er würde doch der Kollegin nicht anvertrauen, dass er mit seinen beiden Kindern allein zu Hause gewesen war, als er gegen sechs Uhr früh angerufen worden war, und dass er lange gebraucht hatte, um das Problem zu lösen, diesmal durch das Telefonat mit einem Online-Netzwerk von Babysittern. Im Juli hatte er die Kinder an der Backe, da hatte ihm dieser Mord gerade noch gefehlt!
Kommissar Paturel musterte die Inspektorin. Je älter sie wurde, desto mehr ähnelte sie Miss Ratched, der Krankenschwester aus Einer flog über das Kuckucksnest. Eine kleine, strenge Frau mit klarem Blick. Der Kommissar kannte sie seit bald dreißig Jahren. Schwer zu glauben, dass die Fünfzigerin einmal jung, anziehend und zu Beginn ihrer Karriere beinah witzig gewesen war. Seitdem hatte der lange Kampf um ihren Platz bei der Polizei die zierliche Person ernst und verbittert werden lassen. Kommissar Paturel mochte sie trotzdem. Zwischen ihnen bestand eine lange Verbundenheit. Außerdem schätzte er, dass sie eine unbescholtene, kompetente und sehr sorgfältige Mitarbeiterin war. Zwar ein bisschen anstrengend, aber eine verdammt gute Fachfrau, auf die er sich verlassen konnte. Das war die Hauptsache.
»Schafft mir die Leute fort«, befahl er.
Ein Dutzend Polizeibeamte in Uniform versuchten, die Schaulustigen zurückzudrängen, ohne großen Erfolg.
»Colette, gibst du mir einen Lagebericht?«, fuhr Paturel fort, leise genug, um keine Details nach außen zu lassen.
»Okay. Wir sind seit ungefähr einer Stunde da. Gefunden hat die Leiche ein Hobbymaler, um 5 Uhr 45. Ein gewisser Maxime Cacheux. Er arbeitet bei der Rechnungskammer. Er wird derzeit vernommen, aber da wird nichts zu holen sein.«
»Und das Opfer?«
»Wir haben ihn identifiziert. Es war nicht schwierig: Er hatte seine Papiere bei sich. Er war hier in der Gegend ein kleiner Star.«
Sie sah in ihre Notizen und las vor:
»Carlos Jésus Aquileras Mungaray. Seit fünf Jahren Matrose auf der Cuauhtémoc. Einer der Offiziere auf dem Segelschiff, nachdem er bis vor vier Jahren Seekadett war. Soweit wir wissen, gehört er einer einflussreichen mexikanischen Familie an. Wir haben diesbezüglich Nachforschungen eingeleitet. Der Kapitän der Cuauhtémoc kümmert sich darum, die Angehörigen zu verständigen. Mungaray war anscheinend ein ziemlicher Hitzkopf. Er nannte sich Aquilero. Ein Held des Rouener Nachtlebens, von der Sorte Playboy, Draufgänger … Vor einer Woche hatte er seinen Spaß daran, bei Quillebeuf vom Mast der Cuauhtémoc in die Seine zu springen, um seine Teilnahme bei der Armada zu feiern …«
All die Informationen beruhigten den Kommissar. Das Opfer war ein eingefleischter Verführer, ein Provokateur. Bestimmt hatte er bei einem beschwipsten Rivalen den Bogen überspannt. Paturel warf einen Blick auf die mexikanische Flagge, die über der Cuauhtémoc wehte. Da kam einer von so weit her, nur um sich im Morgengrauen einfach umbringen zu lassen …
»Und der Mord?«, fuhr der Kommissar fort, »irgendwelche Details?«
»Mungaray hat den gestrigen Abend in der Stadt verbracht, gemeinsam mit ein paar anderen Matrosen von der Cuauhtémoc. Sie waren dann tanzen in der Cantina, bis ungefähr zwei Uhr morgens. Den ersten Zeugenberichten zufolge hat man ihn Arm in Arm mit einer Blondine weggehen sehen, die niemand identifizieren konnte.«
»Und dann?«
»Nichts. Nichts, bis der Maler die Leiche gefunden hat … Ein Stich mitten durchs Herz. Wahrscheinlich ein Dolch, aber es gibt in der Nähe der Leiche keinerlei Spuren der Tatwaffe.«
Der Kommissar sah zu den dicht gedrängten, zehn Meter entfernt versammelten Zuschauerreihen, deren Vorrücken die Absperrung lediglich ein bisschen zurückhielt.
Er dachte kurz nach.
Vielleicht wäre es besser, die Ufer während der Ermittlungen für ein paar Stunden vollständig zu sperren. Er dachte sofort an die Folgen eines solchen Unterfangens. An die Proteste, die Beschwerden. Vielleicht konnte man eine Art Umleitung für die Touristen einrichten.
Er seufzte.
Er hatte dafür keine Zeit. Sie mussten sich beeilen. In weniger als vielleicht einer Stunde würde der Tatort geräumt und der Leichnam fortgeschafft sein. Es war wohl am besten, die Masse durch das Absperrband ausreichend auf Distanz zu halten. Das war die gängigste Methode, die auch bei Verkehrsunfällen angewendet wurde, es musste nur schnell gehen. Die Journalisten würden auch jeden Moment aufkreuzen. Vielleicht waren sie schon da. Kommissar Paturel wusste aber auch, dass er keinerlei Risiken eingehen durfte, dass er die Kriminalpolizei ihre Arbeit machen lassen musste. Jeden einzelnen Schritt musste er genauestens befolgen, auch wenn die Umstände außergewöhnlich waren. Sollte sich der Sachverhalt je als schwierig erweisen, wäre er im Falle eines Verfahrensfehlers als Erster gefeuert.
»Und was hältst du von dem Ganzen, Colette?«, fragte Paturel.
Die Inspektorin antwortete mit sachlicher Genauigkeit:
»Wenn man von der Armada, den Touristen und dem ganzen Druck einmal absieht, den der Mord ausüben wird, dann würde ich sagen, dass wir es mit einem Kriminalfall aus der Rubrik ›Vermischtes‹ zu tun haben. Einem Streit, der böse ausgegangen ist.«
»Wurde der Alkoholpegel des Opfers gemessen?«
»Wir sind dabei. Aber laut Zeugenaussagen hat er im Laufe des Abends über zehn Biere getrunken.«
Der Kommissar lächelte erleichtert. Der Fall würde sich schnell lösen lassen. Er drehte sich um und erblickte einen Seekadetten, der sich auf den Klüverbaum der Cuauhtémoc schwang, um die grün-weiß-rote Fahne des mexikanischen Segelschiffs auf halbmast zu setzen.
Schon!
Er drehte sich wieder zur Inspektorin.
»Du bist bestimmt auf der richtigen Fährte, Colette. Hatte Mungaray Geld bei sich? Wurde ihm etwas gestohlen?«
»Offenbar nicht. Er hatte nur ein paar Euros.«
»Hm … Wir müssen dieses Mädchen finden. Die Blondine. Sie ist der Schlüssel. Ohne psychologisieren zu wollen, würde ich an eine Liebelei denken, die ein böses Ende genommen hat. Der schöne Südamerikaner verdreht der jungen Frau den Kopf und schleift sie in eine dunkle Ecke. Die Hübsche hat einen hiesigen Liebhaber, der den unlauteren Wettbewerb nicht gerade toll findet. Er verfolgt Mungaray und seine Eroberung. Die Aussprache läuft schief … Leuchtet dir das ein, Colette?«
»Gut möglich …«
An der mangelnden Begeisterung der Inspektorin merkte Kommissar Paturel, dass ihm eine ganze Reihe von Details fehlte. Colette Cadinot hatte ihm noch nicht alles gesagt. Er stellte eine Frage, die ihm unbedeutend vorkam.
Aber sie war es nicht.
»Was wissen wir über den Todeszeitpunkt?«
Colette Cadinot holte tief Luft. Paturel erkannte sofort, dass es ein Problem gab.
»Der Gerichtsmediziner arbeitet daran«, erwiderte sie. »Ihm zufolge ist der Tod sofort eingetreten. Um kurz nach zwei Uhr morgens. Aber die Angabe wird noch konkretisiert.«
Der Kommissar verzog das Gesicht.
»Um zwei Uhr morgens? Und die Leiche wurde um sechs Uhr gefunden?«
Er warf einen Blick auf die überfüllten Ufer. Er wurde unruhig. Dieser Fall nahm eine böse Wendung. Er brüllte die Polizisten an, die taten, was sie konnten:
»Herrgott, schafft mir doch diese Leute weg! Sie trampeln noch auf uns herum!«
Wieder zu Colette gewandt fuhr er etwas ruhiger fort:
»Es ist unmöglich, dass zwischen zwei und sechs Uhr morgens niemand die Leiche am Kai gesehen hat. Es sind die ganze Nacht über Leute vorbeigekommen! Ist sich der Gerichtsmediziner da ganz sicher? Kann es nicht sein, dass Mungaray bloß verletzt war und versucht hat, sich zur Cuauhtémoc zu schleppen?«
Colette Cadinot schüttelte den Kopf.
»Es ist eindeutig. Der Stich war tödlich. Kurz nach zwei Uhr früh.«
»Scheiße! Du weißt, was das heißt, Colette?«
»Ja«, erwiderte die Inspektorin gelassen. »Dass Mungaray woanders getötet wurde und erst danach, vier Stunden später, in die Nähe der Cuauhtémoc gebracht wurde. Das scheinen die Experten übrigens zu bestätigen. Mungaray wurde nicht am Ufer ermordet … Das macht die Theorie von dem Eifersuchtsdrama ein wenig problematisch …«
»Wir werden sehen«, beruhigte sich der Kommissar. »Wir werden sehen. Der Mörder wollte die Leiche vielleicht verstecken. Sie zur Cuauhtémoc zurückbringen. Es gibt bestimmt eine vernünftige Erklärung.«
»Die gibt’s immer …«
Der Kommissar hüstelte. Er starrte zu einem Mann, der zwischen zwei Uniformen hindurch ein Foto schießen wollte, und ließ seinen Ärger an ihm aus:
»Fotografieren verboten! Noch einmal und das Ding wird beschlagnahmt!«
Der Mann trat widerspruchslos zurück. Der Kommissar tupfte sich die Stirn.
»Okay, gut. Die Gerichtsmediziner sollen sich sputen. Der Tatort muss geräumt sein, bevor es Krawall gibt. Ich setze mich mit dem Bundeskriminalamt in Verbindung, die sollen die Leiche untersuchen. DNA und der ganze Firlefanz. Wir wollen kein Risiko eingehen.«
Der Kommissar trat näher und beugte sich über den ausgestreckten Leichnam des jungen Matrosen. Mehrere Polizisten in Zivil, gewappnet mit Spezialgeräten, machten sich an ihm zu schaffen, nutzten eine forensische Lichtquelle, um mögliche Fingerabdrücke auszumachen, griffen mit einer winzigen Pinzette nach jedem noch so kleinen Haar und legten es in Tütchen, nahmen mit langen Wattestäbchen das Blut vom Asphalt auf.
Kein Wunder, dass die Leute sich drängelten, um die Szene zu beobachten.
Die Profis live!
Der Kommissar wandte sich genervt ab und herrschte einen weiteren Zaungast an, der sich für eine Aufnahme anschlich:
»Der Saint-Romain-Jahrmarkt ist gegenüber!«
Der Tourist machte sich sang- und klanglos aus dem Staub.
Eine Hand berührte die Schulter des Kommissars. Paturel drehte sich um und erkannte Ovide Stepanu, den zweiten Inspektor, den er mit dem Fall beauftragt hatte. Ovide Stepanu war rumänischer Herkunft und lebte seit rund zwanzig Jahren in Frankreich. Er war ein bemerkenswerter Polizist mit außergewöhnlicher Intuition und Einbildungskraft.
Manchmal zu außergewöhnlich.
Auf dem Polizeirevier von Rouen wurde er hinter seinem Rücken »Inspektor Kassandra« genannt. Als praktizierender und abergläubischer orthodoxer Christ schien er das Elend der Welt auf seinen Schultern zu tragen, und er hatte die Gabe, jedes Mal eine Trauermiene aufzusetzen, wenn er schwere Unglücke oder fürchterliche Erklärungen für Verbrechen zu melden hatte … die sich häufig als richtig erwiesen!
Seiner Beliebtheit war das nicht gerade zuträglich. Ebenso wenig sein trauriges Erscheinungsbild eines alten Junggesellen, die formlose Kleidung – als hätte er sich seit der Ankunft aus Rumänien nicht mehr umgezogen – oder das meist ausbleibende Lächeln. Kommissar Paturel hatte Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum Stepanu nicht lächelte. Es war keineswegs eine Frage des Charakters. Es war Scham. Stepanu hatte aus Rumänien ein hässliches Gebiss mitgebracht. Mit der Zeit hatte er sich eine Grimasse antrainiert, mit der er seine gelben Zähne so wenig wie möglich zeigen und insbesondere nicht unnötig lächeln musste.
Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hatte der Kommissar verstanden, dass Inspektor Stepanu kein blasierter Mensch war, der ununterbrochen schmollte, sondern im Gegenteil ein anständiger Kerl, brillant, schüchtern und verklemmt.
»Das ist scheiße, Gustave«, fing Stepanu an, mit seiner unnachahmlichen Eigenart zu sprechen, ohne die Lippen zu bewegen.
Ein brillanter, schüchterner und verklemmter Kerl … der außerdem das Wort nur ergriff, um für einen Haufen Ärger zu sorgen!
Paturel seufzte.
»Was gibt’s, Ovide?«
»Ich will ja kein Spielverderber sein. Ich habe Ihre Theorie mitbekommen, Commissaire. Eifersuchtsdrama … Tut mir leid, aber das haut nicht ganz hin …«
Der Kommissar bemerkte den ebenso freudlosen Blick der Inspektorin.
»Ich muss Ihnen etwas zeigen, Commissaire«, fuhr Ovide fort.
Der Inspektor beugte sich über den leblosen Körper des jungen Mexikaners, bat die Forensiker, ein wenig Platz zu machen, und knöpfte das Hemd der Leiche auf. Völlig ungeniert machte er eine Schulter frei und drehte leicht den Rumpf, um das ganze Schulterblatt zu demonstrieren.
»Sehen Sie sich das an.«
Der Kommissar und die Inspektorin bückten sich. Die Schulter, das Schulterblatt und der obere Rücken waren von Tätowierungen übersät. Sie sahen genauer hin. Es waren deutlich vier Tiere zu erkennen: eine Taube, ein Krokodil, ein Tiger und ein Hai. Die Tattoos waren schlicht, die tierischen Merkmale gut erkennbar.
»Na und?«, fragte der Kommissar. »Wo ist das Problem? Tätowierungen kommen unter Matrosen häufiger vor. Oder?«
»Hier liegt nicht das Problem, Gustave«, machte Ovide weiter, ohne seine Leichenbittermiene abzulegen. Er entblößte den Rücken des Matrosen noch ein bisschen mehr. Ein fünftes Tattoo kam zum Vorschein.
Das war aber nicht mehr erkennbar!
Die Tätowierung war verbrannt. Genau an der Stelle des fünften Tattoos bildete die Haut des Leichnams üble Brandblasen und begann sich zu lösen.
Colette Cadinot sah weg. Der Kommissar schluckte.
Himmeldonnerwetter! Das hatte er nicht erwartet!
»Ist, äh … ist diese Brandwunde frisch?«, brachte er hervor.
»Den Gerichtsmedizinern zufolge«, erwiderte Stepanu, »fällt sie mit dem Todeszeitpunkt ungefähr zusammen. Entweder kurz davor oder kurz danach … In ein paar Stunden wissen wir mehr. Sie haben recht, das Detail ist wichtig. Vor allem für den armen Jungen.«
Auf der Stirn des Kommissars bildeten sich erneut Schweißperlen.
Jetzt saß er also wirklich in der Scheiße!
Unter diesen Umständen war die Theorie von dem Eifersuchtsdrama oder dem Raubmord nicht länger haltbar. Er wagte kaum daran zu denken, dass ein Sadist frei herumlief. Ausgerechnet während der Armada, inmitten von Millionen Touristen.
Es musste ja gerade ihn treffen!
Die Summe der erwartbaren Probleme machte ihn schwindlig. Er traute sich nicht einmal mehr, den Blicken der Neugierigen zu begegnen. Mit etwas Pech hatte alles ein Journalist gesehen.
»Wissen wir, was die verbrannte Tätowierung abgebildet hat?«, fragte der Kommissar mit monotoner Stimme.
»Ja«, entgegnete Stepanu fast ausgelassen. »Es besteht kein Zweifel. Es war ein Adler.«
»Aquilero«, schaltete sich Inspektorin Cadinot ein. »Aquila heißt ›Adler‹ auf Spanisch. Er selbst ist der Adler … Ihn wollte man verbrennen … Ein Racheakt?«
Kommissar Paturel lief der Schweiß den Rücken hinab. Das ging ihm jetzt alles zu schnell. Stepanu ließ jedoch keine Atempause zu und hieb noch einmal in dieselbe Kerbe:
»Auf die Gefahr hin, eine Spaßbremse zu sein: Es gibt da noch etwas, Commissaire.«
Paturel hätte sich gewünscht, abgestumpft zu sein. Aber er war es nicht.
»Was denn?«
»Die Verbrennung … Sie ist ungewöhnlich. Das Fleisch sieht aus, als wäre es mit einem Brandzeichen versehen worden. Wie bei einem Tier … Außerdem …«
Er zögerte.
»Außerdem?«, beharrte der Kommissar, obwohl er es eigentlich gar nicht wissen wollte.
»Den Gerichtsmedizinern zufolge stellt die Brandwunde eine Art Signatur dar.«
Er zog eine aus seinem Terminkalender herausgerissene Seite aus der Hosentasche.
»So sieht sie aus.«
Paturel und Cadinot beugten sich über das Papier. Inspektor Stepanu streckte ihnen eine Zeichnung entgegen: M<.
Ein M und eine Art liegendes V …
»Ich habe das Symbol schon nach Paris gemailt«, erklärte Stepanu. »Dort wollen sie Vergleiche anstellen. Sie haben Kryptologen. Es handelt sich vielleicht um ein kabbalistisches Zeichen, etwas Religiöses, etwas von einer Sekte … Weiß der Teufel. Sie haben Symboldatenbanken …«
Kommissar Paturel hörte seinen Inspektor nicht mehr. Er musste diese Einzelheiten nicht kennen.
Er spürte, wie seine Füße über das Kopfsteinpflaster glitten.
Unverwandt sah er zu der auf halbmast wehenden Flagge, dann zu Colette Cadinot.
Auch sie hatte verstanden.
Wie der Kommissar lebte sie seit vielen Jahren im Pays de Caux. Sie kannte die Geschichte der Seinemündung. Die Legenden und Traditionen. Sie brauchten keine Datenbanken oder Experten aus Paris. Die Inspektorin wusste genauso wie er, was das rätselhafte Symbol zu bedeuten hatte.
M<.
Woher es kam und wofür es stand.
Doch anstatt Licht ins Dunkel zu bringen, verdunkelte es das Rätsel noch.
Machte es unergründlich. Unfassbar.
»Verdammter Mist«, sagte der Kommissar. »Kein Wort davon an die Presse! Absolute Nachrichtensperre. Offiziell gehen wir dem Eifersuchtsdrama nach – und den Zeugen, vor allem dieser Blondine, die Mungaray wahrscheinlich zuletzt lebend gesehen hat. Offiziell setzen wir alles daran!«
Der Kommissar glaubte, die Aufregung sei fürs Erste vorbei.
Er könne sich wieder fassen, sich die Arbeit einteilen.
Aber das Schlimmste kam erst noch.
Als sich die Spurensicherung erneut über die Leiche des jungen Mexikaners beugte, klingelte plötzlich ein Mobiltelefon.
Höchstens einen Meter von ihnen entfernt.
Alle sahen einander an. Niemand hob ab.
Lange Sekunden verstrichen, zu denen das beharrliche Klingeln den Takt schlug.
»Himmelherrgott noch mal«, rief der Kommissar, »kann sich der Besitzer dieses Telefons vielleicht die Mühe machen, den Anruf entgegenzunehmen?«
»Das wird schwierig«, sagte Ovide Stepanu trocken.
Der Kommissar stellte fest, dass alle Blicke auf den leblosen Körper am Seineufer gerichtet waren.
Das Klingeln kam aus der Hosentasche der Leiche.
Jemand versuchte, mit einem Toten zu kommunizieren!
5 Fachwerk und Brummschädel
7Uhr 30, Rue Saint-Romain 13, Rouen
Maline Abruzze schlief tief und fest, als das Telefon klingelte. Sie tastete nach dem Hörer. Eine heitere Stimme malträtierte ihr Trommelfell:
»Aufstehen, Mitbürgerin!«
Die Journalistin erkannte sofort die Stimme des Chefredakteurs Christian Decultot. Sie antwortete gar nicht erst, sondern ließ seine Tirade über sich ergehen:
»Maline? Bist du da? Ich habe dich doch nicht geweckt, oder? Na los! Hopp, hopp! Beweg dich in die Redaktion. In einer halben Stunde in meinem Büro. Ich habe einen Scoop für dich!«
»Hä?«, war alles, was Malines verschlafene Stimme hervorbrachte.
»Komm schon, Schätzchen. Einmal duschen und dann ab zur Meldung. Einen Scoop, ich sag’s dir. Wir haben es mit einem Mord zu tun! Dem Mord an einem Matrosen, heute Nacht am Ufer, mitten in Rouen.«
Der Chefredakteur legte auf.
Maline konnte sich nur schwer aus ihrer Erstarrung lösen.
Ein Mord? An einem Matrosen? Am Ufer?
Wahrscheinlich ein schlichter Vergeltungsakt … Nichts, worüber man sich aufregen musste.
Sie versuchte, sich aufzurichten. Sie hatte furchtbare Kopfschmerzen. Sie schob die Decke beiseite und setzte sich auf die Bettkante. Maline fühlte sich leer.
In ihrem Kopf spielte noch immer das Blasorchester. Die Fortsetzung des gestrigen Konzerts. Die Gedanken der Journalistin schweiften einen Augenblick zu der vergangenen Nacht. Nach dem großen Konzert am Ufer von Rouen und dem traditionellen Feuerwerk hatte sie den Abend in einem kleinen Pub in Déville-lès-Rouen ausklingen lassen. Das Rahmenprogramm der Armada. Eine örtliche Bluesband, Rock en Stock, hatte bis zum Morgengrauen einen Hit nach dem anderen gespielt.
Maline versuchte aufzustehen. Sie schwankte ein bisschen. Sie ging zum Fenster, ihre Nacktheit kümmerte sie nicht. Es war brütend heiß in den Altstadtwohnungen. Die gespenstischen Schreie in ihrem Kopf kamen einem Höllentanz gleich. Das Spiel des Schlagzeugs schien gegen ihre Schädelwand zu prallen.
Der Bandleader hatte nach etwa zehn Stücken einen letzten Titel gespielt, eine Hommage an den Austragungsort. Déville … Die berühmte Sympathy for the devil von den Stones. Vor diesem Abend hatte Maline nie darüber nachgedacht, dass die Gemeinde am Cailly den Namen des Teufels trug … lustig. Die Variationen über den Hit der Rolling Stones dauerten fast eine Dreiviertelstunde. Sämtliche Kneipengäste begleiteten die Musiker durch lautstarke »Huh«-Rufe und schnappten sich alle möglichen Gegenstände, mit denen man Lärm machen konnte, um das Voodoo-Getrommel zu begleiten. Improvisierte Maracas, Löffel, die gegen Gläser schlugen, Finger und Hände auf den Tischen … Junge Frauen, Tigerinnen gleich, das Haar zerzaust, in katzenhaften Posen, hatten auf Stühlen vor jungen Männern gestanden, die sich an den Hüftschwüngen haitianischer Zombies versucht hatten.
Maline drückte ihr Gesicht an das Fenster. Das Wetter war bereits schön. Sie gab ein Aspirin in ein Wasserglas und seufzte.
Mit ihren fünfunddreißig, fast sechsunddreißig Jahren fiel es ihr wahrhaftig schwer, sich von solchen Partynächten zu erholen.
Sie schleppte sich zur Dusche. Der lauwarme Wasserstrahl machte sie ein bisschen wacher. Sie musste feststellen: Bereits am fünften Tag der Armada war sie am Ende.
Völlig erschöpft.
Sie wusste, dass sie vernünftiger sein musste.
Alles klar! Als ob ihr Vater zu ihr sprechen würde. Das Problem war, dass die Armada erst wieder in vier oder fünf Jahren stattfinden würde. Zehn Tage, zehn Nächte, einmal in fünf Jahren! Warum sollte sie das nicht genießen? Diese paar Tage, in denen Rouen, das Dornröschen, zum Leben erwachte, bevor es erneut in tiefen Schlaf fiel – warum sollte Maline sie nicht in vollen Zügen genießen?
Der Duschstrahl wechselte von lauwarm zu eiskalt. Natürlich. Der Boiler war kaputt.
Maline dachte an ihre erste Armada 1989 zurück. Damals war sie gerade achtzehn geworden. Jene Woche behielt sie als endlose Party in Erinnerung, das erste Mal frei, das erste Mal Herzklopfen … Wie alle anderen Bürger von Rouen hatte sie mit ungläubigem Blick beobachtet, wie sich die brave Hauptstadt der Normandie in einen riesigen multikulturellen Marktplatz verwandelte. In den Mittelpunkt der Welt, wo alles erlaubt war. Eine kulturelle Revolution. Ein wundervolles Geschenk zu ihrer Volljährigkeit! Wer zur Armada von 1989 noch keine achtzehn Jahre alt war, der würde das nicht verstehen. Zum Glück hatte ihr Vater nie das Geringste von den Kneipentouren erfahren, zu denen sie und ihre Freundinnen sich in jenen verrückten Tagen hatten verleiten lassen. In kürzester Zeit hatte sie ein Dutzend Sprachen gelernt. Zumindest das Grundvokabular. Bestimmt kam daher ihre Reiselust. Zwölf Jahre lang war sie für die größten Zeitungen Reporterin auf Weltreise gewesen. Selbst wenn die Lust sich unterdessen in Luft aufgelöst hatte und Maline wieder in ihrer Heimatstadt Rouen gelandet war …
Als Journalistin bei der SeinoMarin. Der größten Wochenzeitung in der Region.
Maline stieg ohne Abtrocknen aus der Dusche und überschwemmte den abgewetzten Linoleumboden.
Zwischen 1989 und 2008 hatte Maline, wenn auch am anderen Ende der Welt, nie eine Armada verpasst. Immer wieder war sie nach Rouen zurückgekehrt, sogar 1994, als sie wenige Wochen zuvor von dem Völkermord in Ruanda berichtet hatte. Die letzten drei Armadas, 1999, 2003 und 2008, hatte sie als offizielle Lokaljournalistin bei der SeinoMarin erlebt. Mit jeder Armada vergrößerte sich ihr Freundeskreis. Die Freundinnen aus dem gesegneten Jahr 1989! Fast alle waren sie inzwischen verheiratet, Mutter, geschieden, deprimiert, verblüht … Alt! Maline fühlte sich anders. Anders und allein. Was für ein Theater, wenn man seine Handvoll Freundinnen aus ihrem Alltag holen wollte …
War sie so sonderbar?
Fast sechsunddreißig? Single?
Maline nahm ein zusammengerolltes Handtuch und wischte über den ovalen Badezimmerspiegel. Sie betrachtete einen Augenblick ihr Spiegelbild.
Na schön, sie war eher klein, aber sie fand sich immer noch gut aussehend, wohlgeformt, sogar mehr als mit zwanzig. Weiblicher … Üppiger …
»Das liegt daran, dass du fett wirst, meine Liebe!«, spöttelte Maline über sich selbst. »Du bist wohl stolz auf deine Kurven, auf deinen Hintern und deine Brüste, aber dir ist hoffentlich klar, dass das die letzten Jahre, die letzten Monate vor dem Verfall sind. Du musst unbedingt wieder Sport treiben, meine Hübsche!«
Flüchtig dachte sie an die Zeit zurück, als sie beinah jeden Tag zum Sport gegangen war, fünfmal pro Woche! Heute eher einmal im Monat. Vielleicht noch nicht einmal das. Schwimmen oder joggen. Allein laufen zu gehen und dabei Pärchen zu begegnen war ihr inzwischen unerträglich.
Maline zog vor dem Spiegel eine Schnute. Als Lockmittel diente jedenfalls nicht ihr kleiner Puppenkörper, sondern ihr Gesicht. Ihr Clownsgesicht. Ihre spitzbübische Erscheinung, wenn man so wollte. Schwarze Knopfaugen, runde Pausbacken, Wuschelkopf. Derzeit brünett. In den letzten zwanzig Jahren hatte sie alle Haarfarben ausprobiert.
Sie musterte ihr Gesicht in dem beschlagenen Spiegel. Marke Drew Barrymore oder Audrey Tautou … lustiges kleines Luder. Sie beruhigte sich wieder. Männer verknallten sich nicht nur in blonde Häschen mit langen Beinen. Sie mochten auch die sexy Bauart.