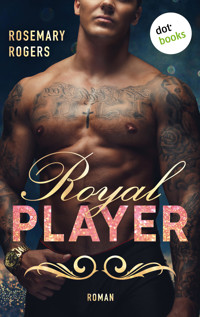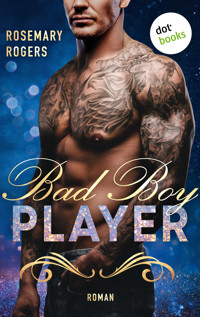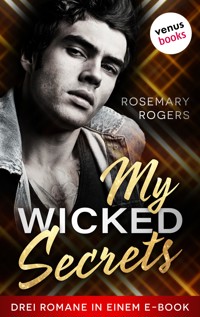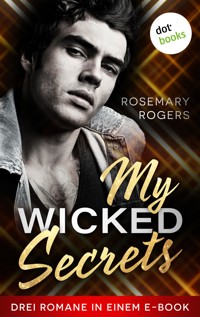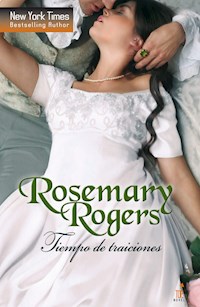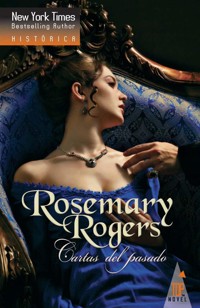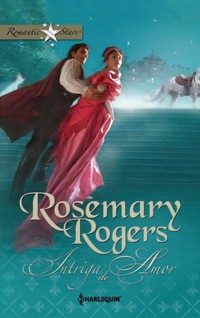4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist wild und unabhängig – er kennt nur die Pflicht: Der schwelgerische Roman »Das Land der Mandelblüten« von Rosemary Rogers als eBook bei dotbooks. Das Land der Mandelblüten im 19. Jahrhundert. Voller Hoffnung kehrt die junge Trista nach ihrem Medizinstudium in Paris auf das kalifornische Anwesen ihrer Eltern zurück. Dort hat sich nichts verändert, noch immer versucht man ihren Drang nach Freiheit mit kalter Pflicht und starren Konventionen zu ersticken. Einzig Blaze Davenant, ein rätselhafter Freund ihres Vaters, scheint sie zu verstehen – die Sehnsucht, die er vor vielen Jahren in ihr entfacht hat, ist sofort wieder da … doch jedes Mal, wenn sie sich näherkommen, stößt Blaze sie wieder von sich. Als die Schatten des Bürgerkriegs über ihnen heraufziehen, beschleicht Trista der dunkle Verdacht, dass Blaze ein Spion sein könnte – und dass ihre Liebe sie beide in tödliche Gefahr bringt … Ein epischer Roman über eine mutige Frau, die im 19. Jahrhundert für das kämpft, was ihr Herz ihr sagt – und einen ebenso düsteren wie faszinierenden Mann, der bereit ist, alles für sie zu opfern! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Liebesroman »Das Land der Mandelblüten« von Rosemary Rogers. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Land der Mandelblüten im 19. Jahrhundert. Voller Hoffnung kehrt die junge Trista nach ihrem Medizinstudium in Paris auf das kalifornische Anwesen ihrer Eltern zurück. Dort hat sich nichts verändert, noch immer versucht man ihren Drang nach Freiheit mit kalter Pflicht und starren Konventionen zu ersticken. Einzig Blaze Davenant, ein rätselhafter Freund ihres Vaters, scheint sie zu verstehen – die Sehnsucht, die er vor vielen Jahren in ihr entfacht hat, ist sofort wieder da… doch jedes Mal, wenn sie sich näherkommen, stößt Blaze sie wieder von sich. Als die Schatten des Bürgerkriegs über ihnen heraufziehen, beschleicht Trista der dunkle Verdacht, dass Blaze ein Spion sein könnte – und dass ihre Liebe sie beide in tödliche Gefahr bringt …
Ein epischer Roman über eine mutige Frau, die im 19. Jahrhundert für das kämpft, was ihr Herz ihr sagt – und einen ebenso düsteren wie faszinierenden Mann, der bereit ist, alles für sie zu opfern!
Über die Autorin:
Rosemary Rogers (1932–2019) kann mit Fug und Recht als Legende gefeiert werden: Wie kaum eine andere hat sie das Genre der Liebesromane geprägt. Geboren in Ceylon, schrieb sie mit acht Jahren ihre erste längere Geschichte, der schon in ihrer Teenagerzeit erste Liebesromane folgten. Mit 22 Jahren wurde sie gegen den Willen ihrer Eltern Reporterin und zog nach London. Viele Jahre später zog es sie jedoch zurück nach Kalifornien, in das »Land der Mandelblüten«. Ihre zahlreichen Bücher haben sich weltweit über 50 Millionen Mal verkauft.
Bei dotbooks veröffentlicht Rosemary Rogers auch ihre Love-and-Landscape-Romane:
»Der Himmel über der Zimtinsel«
»Das Flüstern der Orangenblumen – Die große Exotiksaga 1«
»Im Land der Pelikane – Die große Exotiksaga 2««
»Die Insel der Tabakblüten – Die große Exotiksaga 3«
»Das Leuchten der Kaktusblüte – Die große Exotiksaga 4«
Außerdem erscheinen bei dotbooks ihre Dark-Romance-Romane:
»Royal Player«
»Bad Boy Player«
»Hollywood Player«
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe Februar 2021
Dieses Buch erschien bereits 1988 unter dem Titel »Die Leidenschaft des Blutes« bei Heyne und 2015 und 2017 unter den Titeln »Die Herrin der Begierde« und »Midnight Passion « bei dotbooks.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1985 unter dem Originaltitel »The Wanton« bei Avon Books, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1985 by Rosemary Rogers
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1988 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with Rosemary Rogers. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover 30161.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / AKaltykova / Vivvi Smak / ANCH / Stocker1970 / Neillrvine / Hank Shiffman / Zhao jiankang / Kichigan
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-086-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Land der Mandelblüten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rosemary Rogers
Das Land der Mandelblüten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Irene Holicki
dotbooks.
Für meine Männer:Mike und Adam – meine Söhne,und schließlich für Chris – meinen Mann,meinen Partner, meinen Liebhaberund meinen Gatten.
Prolog
Die alte Frau wohnte in einem Haus, das von Geräuschen und auch von Stille umgeben war. Die Geräusche kamen von Ochsenfröschen und Grillen und vom Wasser – es plätscherte gegen die Seitenwände der Piroge, und wenn das Ruder in die dicke, grüne Masse eintauchte, die eine Mischung aus Wasser und Pflanzen war. Die Stille schien von überall und nirgendwo zu kommen, sie drückte gegen die dünnen, verrotteten Wände des Hauses, das früher so etwas wie eine Villa gewesen war. Die meisten Leute hatten die Insel im Sumpf inzwischen vergessen; und wer sich daran erinnerte, tat lieber so, als habe er sie vergessen.
Die Menschen, die dort wohnten, waren Abkömmlinge von Piraten und ihrer weiblichen Gefangenen – oder Angehörige des Alten Volks, die hierher (wie auch überallhin sonst) in notdürftig zusammengebauten Holzbooten gekommen waren, ehe der Kontinent, den sie kannten, in die Luft flog und im Meer versank. Das waren die Legenden, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Geschichten, die man an erlöschenden Lagerfeuern erzählte. Volkssagen … Stoff für Balladen und Fabeln, sicher. Aber in den Sümpfen war nichts sicher, und alles war möglich, wenn man die Zauberkraft hatte und wußte, daß man sie hatte! Und dann … und dann …?
Die alte Frau sagte: »Du wirst die Antworten kennen, wenn du bereit bist, sie zu akzeptieren. Es ist nicht meine Aufgabe, sie dir zu geben, sondern deine, sie zu finden. Du wirst Scham und Stolz erfahren; Leid und Glück. Was obsiegen und was am Ende stehen wird, das liegt bei dir und bei dir allein. Das ist die ganze Hexerei, der ganze Zauber.«
Der Sumpf war gleichzeitig tot und lebendig – er schenkte Tod und Leben. In seinen unbewegten Wassern versickerte seufzend der Schlamm, und die winzigen Bächlein, die gelegentlich dem Würgegriff der Wasserpflanzen und des grünen Saugmooses entkamen und im Sonnenlicht glitzerten, lachten glucksend vor Freude, weil sie frei waren.
»Vergiß nie, was man dich gelehrt hat, mein Kind; und mißbrauche nie, was du gelernt hast. Nur eines sollst du anstreben – Verständnis.«
»Aber wofür? Bitte, sag es mir … wofür?«
»Trista! Trista!«
»Was …? Was soll ich verstehen?«
»Wenn jeder Mensch nur eine ewige Frage hat, dann muß dies die meine sein – besonders, seit ich den Sumpftraum träume, der jedesmal ein kleinwenig anders ist. Die Kulisse ist jedesmal die gleiche, und der Sumpf ist der gleiche, aber … aber jedesmal bekomme ich etwas anderes gesagt; es wird sozusagen etwas Neues hinzugefügt, über das ich nachgrübeln muß, wenn ich wach bin. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich mich stark genug fühle.
Heute fühle ich mich überhaupt nicht stark, obwohl ich im Inneren weiß, daß ich stark sein werde, wenn ich es sein muß. Heute, genau um die Mittagsstunde, soll meine beste Freundin Marie-Claire meinen Bruder Fernando heiraten, der gar nicht mein richtiger Bruder ist, und den ich immer …«
Glücklicherweise wurde das nächste Wort in diesem wohl letzten Eintrag, den ich in diesem speziellen Tagebuch gemacht habe, verwischt, vielleicht von einer Träne oder von einem Wassertropfen. Es könnte ›geliebt‹ oder durchaus auch ›gehaßt‹ geheißen haben. Ich glaube, damals empfand ich beides, außerdem war ich völlig am Boden zerstört, wie es bei Sechzehnjährigen oft vorkommt, wenn sie sich einbilden, ihr Herz sei gebrochen. Aber wer hat am Ende wem das Herz gebrochen? Ist es wichtig? Vor kurzem hat mir Fernando endlich mein zerfetztes, übel zugerichtetes Tagebuch zurückgegeben – auf dieser letzten, verwischten Seite aufgeschlagen, die ich geschrieben hatte. »Liebe oder Haß – kein Unterschied, was? Manchmal habe ich das Gefühl, als wäre beides dasselbe!« Hat er recht? Es wäre mir äußerst zuwider, wenn er recht hätte. Er lächelte auf eine bestimmte Art, während er diese Worte sagte … ein Lächeln, das mich ängstigte und im Rückblick immer noch ängstigt. Ich konnte Zorn und Gewalttätigkeit darin lesen … und noch etwas. Gott, etwas noch Entsetzlicheres, woran ich lieber nicht denken möchte – so lange nicht, bis ich vielleicht damit konfrontiert werde.
Ich bin eingesperrt, eine hilflose Gefangene. Zwischen diesen vier fensterlosen Wänden, die keinen Laut hereinlassen, und hinter einer schweren Holztür, die mit Metallbändern beschlagen ist und ein Schlüsselloch hat, in dem sich ein Schlüssel dreht, um mich daran zu erinnern, daß ich eingeschlossen bin. Und ich bin eine Gefangene meiner eigenen Ängste, die auch jetzt noch in meinem Kopf herumjagen wie Ratten in einer Tretmühle. Ich kann nicht mehr atmen. Mir ist, als müsse ich ersticken. Ich möchte hysterisch mit den Fäusten gegen die Wände trommeln, die plötzlich näher zu kommen scheinen; sie erdrücken mich, zermalmen mich … Nein! Ich muß Ruhe bewahren. Mich zwingen, einen kühlen Kopf zu behalten. Meine Gedanken von meinem Körper lösen, wenn es sein muß, um zu überleben.
Nachdenken – über die Vergangenheit. Sogar über Fernando, wie er früher war. Weißt du noch? Seufzend lehne ich mich mit dem Rücken gegen die Wand, schließe die Augen und zwinge meinen Geist, zurückzugehen in die Vergangenheit, nicht nach vorne, denn das könnte nur zu unerfreulichen Spekulationen führen. Die Vergangenheit … an wieviel davon erinnere ich mich wirklich? Zuerst kommt sie bruchstückhaft zurück … dann, plötzlich, ein Schwall von Erinnerungen, die mich überwältigen, und in denen ich beinahe ertrinke.
Es gibt Dinge, an die ich mich lieber nicht erinnern möchte; und andere, die möchte ich ständig wiederholen und genießen. Alles, um der unerfreulichen Gegenwart zu entkommen und dem, was mir vielleicht in unmittelbarer Zukunft bevorsteht. Ich kehre immer wieder zum Sumpf zurück und zu den Dingen, die mir die alte Frau mit ihrem Geist sagte; sie sind viel wichtiger als die gemurmelten Worte und Beschwörungen, die sie laut sprach, um Tante Ninette zufriedenzustellen, die mich zu ihr gebracht hatte. Ich beginne, als ich … vielleicht zwei Jahre alt war?
Erstes BuchTRISTA
Kapitel 1
Ich wurde in Louisiana geboren, und bin, wie man mir sagte, zur Hälfte Spanierin und zur Hälfte Französin. Meine Mutter war fünfzehn, als mein leiblicher Vater, selbst erst zwanzig, in einem Duell umkam und sie als Witwe und schwanger zurückließ. All dies hat man mir nur erzählt. Hingegen war der Mann, den ich immer als Papa kannte und auch in Gedanken so nannte, mein wirklicher Vater, und das erste und einzige Mal, daß er mich im Stich ließ und mich kränkte, war, als er starb.
Wir müssen nach Kalifornien gekommen sein, als ich etwa drei oder vier Jahre alt war, und weniger als ein Jahr später hatte ich das Gefühl, ich sei schon immer hier gewesen – habe das weitläufige, alte Haus und das Tal der sieben Bäche und die runden Hügel, die ringsum terrassenförmig anstiegen, immer schon gekannt. Ich hatte zwei ältere Brüder, Fernando und Miguel; und überall gab es Dienstboten, die mich verwöhnten und mir jeden Wunsch von den Augen ablasen. Damals fiel es mir nicht schwer, mir alles aus dem Kopf zu schlagen, worüber ich nicht nachdenken wollte, und mich nur auf die Gegenwart zu konzentrieren.
Am Anfang … brauchte ich mir niemals bohrende Fragen zu stellen, wie ich es jetzt tue! Warum sollte ich! Ich nahm alles so hin, wie es nach außen hin war und dachte nur an mich selbst, an meine Bedürfnisse und mein Wohlergehen. Man lehrte mich reiten, fast ehe ich laufen konnte; und als ich zehn war, konnte ich genauso gut mit einem Gewehr wie mit einem Messer umgehen (und hatte den nötigen Respekt davor). Ich lernte damals (wie auch heute noch) sehr schnell; Zahlen und Buchstaben ebenso wie schwimmen, und auch, wie man selbst den wildesten Stier einfing und in Schach hielt. In jenen Tagen wünschte ich mir immer, als Junge geboren zu sein. Nicht in die Schule fortzumüssen – und schon gar nicht in eine Klosterschule! Das war die Zeit, in der ich Fernando auf Schritt und Tritt folgte – und alle möglichen albernen, tollkühnen Dinge tat, in der Hoffnung, er würde von mir Notiz nehmen und mir vielleicht sogar ein widerwillig anerkennendes Wort schenken. Wie kindisch, wie dumm! Jetzt verachte ich mich dafür, wie ich damals war; und dafür, daß ich nicht sehen wollte, was doch die ganze Zeit vor meiner Nase passierte.
Papas Ehe mit meiner Mutter (wenn sie überhaupt je verheiratet waren) war seine zweite. Seine erste Frau, Fernandos und Miguels Mutter, war die einzige, verwöhnte Tochter einer prominenten spanisch-kalifornischen Familie gewesen. Papa war in jenen Tagen Kapitän eines Schiffes, das von Boston nach Monterey segelte und dort anlegte, um Felle einzutauschen. Und dann hatte ihn die schöne Josefa erblickt und ihrer besten Freundin zugeflüstert: »Das ist der Mann, den ich heiraten werde!« Aber das ist wohl nur eine romantische Geschichte!
Liebe … Romantik … Haß … Eifersucht … sind alle diese Gefühle wirklich miteinander verbunden? Man hat mich eine Hexe genannt, eine ›bruja‹, und zwar manchmal ohne das nervöse, abwehrende Lachen, das einer solchen Aussage im allgemeinen folgt. Na und? Wenigstens werden Hexen nicht mehr verbrannt. Vielleicht deshalb nicht, weil sie dazu neigen, sich selbst zu verbrennen – weil sie gewöhnlich zu dicht an die beiden Flammen, Gefahr und Herausforderung, heranfliegen.
Herausforderung – ich habe Herausforderungen und Wetten aller Art immer amüsant gefunden. Und vielleicht habe ich mich absichtlich blind gestellt gegenüber Dingen, die ich nicht sehen will. Warum habe ich zum Beispiel nicht bemerkt, daß Fernando meiner Mutter mehr oder weniger genauso nachlief wie ich ihm? Er belegte sie mit Schimpfnamen, nachdem sie mit einem rothaarigen Iren durchgebrannt war, der eine eigene Goldmine und mehrere Millionen Dollar besaß, die er verschleudern konnte, wie er wollte. »Puta! Hure!« Manchmal kam es mir vor, als sagte er diese Worte zu mir, als seien sie für mich bestimmt und hätten gar nichts mit meiner Mutter zu tun. Ich hatte Angst, ohne genau zu wissen, warum, und begann daher, Fernando aus dem Weg zu gehen, soweit ich konnte. Ich erklärte mich sogar freiwillig mit einer Klosterschule einverstanden; und als ich achtzehn Monate später nach Boston abreiste, um noch eine weitere Schule zu besuchen, war ich fast erleichtert. Ich brauchte Disziplin, eine geregelte Lebensweise – heute sehe ich das ein. Es gab soviel zu lernen für mich!
Marie-Claire brachte mir viel bei in diesen Jahren, in denen wir zusammen in der Schule waren. Wir hatten auch vieles gemeinsam. Ihr Vater war Franzose; ihre Mutter Amerikanerin. Und auch ihre Mutter war mit einem anderen Mann fortgegangen … Es hatte eine Scheidung mit allen Unerfreulichkeiten gegeben, dann hatte ihr Vater wieder geheiratet, und man wollte sie nicht zu Hause haben, sie war im Weg. Deshalb – war sie hier!
»Und es ist langweilig, langweilig, langweilig! Warum hat mein Papa mich in ein solches Gefängnis gesteckt? Ach ja, weil seine neue Frau eifersüchtig auf mich ist. Aber ich werde es ihr schon zeigen – und ihm auch! Ich werde den ersten Mann heiraten, der mir über den Weg läuft – ich schwöre es! Ich tue alles, um aus diesem häßlichen Kasten, aus diesem Gefängnis, herauszukommen!«
In dem Jahr, in dem ich sechzehn wurde, kam Papa nach Boston und brachte Fernando mit. Und noch in der gleichen Woche waren er und Marie-Claire verlobt. Sie konnte es nicht erwarten, frei zu sein, und er und ich waren als Bruder und Schwester aufgewachsen. Außerdem, ganz ehrlich, Marie-Claire ist hübsch, und ich bin es nicht. Ihr Haar hat die Farbe frisch gemünzten Goldes, sie hat große, blaue Augen und Brüste. Mein Haar ist nachtschwarz, und meine Augen sind silbergrau. Ich bin zu groß für eine Frau, und ich habe keine großen Brüste. Trotzdem hat man mich ›auffallend‹ genannt – was immer das bedeuten mag. Ich weiß nur, daß es nicht ›schön‹ heißt, nicht einmal ›hübsch‹! Mein Gesicht ist eher dreieckig als oval … meine Backenknochen sind zu hoch und zu breit … meine Augenbrauen zu weit nach oben gezogen. Aber was hat es für einen Sinn, sich mit all diesen Einzelheiten aufzuhalten. Ich bin, was ich in mir bin, und ich kann alles sein, was ich sein will. Hexe!
»Du bist deiner Mutter sehr ähnlich …«, hat man mir gesagt. Und ich fragte mich – in welcher Beziehung? Wir standen uns nie sehr nahe, aber wenn ich an sie denke, sehe ich eine schöne Frau vor mir, die immer im Glanz der Juwelen erstrahlte, die sie trug. Zeitweise haßte ich sie, und zeitweise liebte ich sie auch – aber habe ich sie jemals wirklich verstanden?
Wenn ich zurückdenke … ich habe überhaupt nicht sehr viel Zeit bei meiner Mutter verbracht. Ich ging ihr auf die Nerven … ich war zu wild und ungestüm. Oder war ich ihr nur im Weg? Gleichviel. Mir war es einerlei, ob sie da war oder nicht, denn ich hatte immer noch Papa, der mich liebte, und Miguel, der mich verstand.
Miguel heißt jetzt Pater Michael. Und es war kurz vor seinem Eintritt ins Seminar, als Papa mit Fernando nach Boston kam. Wir konnten soviel Zeit miteinander verbringen, wie wir wollten, weil ich das ›Windham-Pensionat für junge Damen‹ besuchte, und weil Miß Charity Windham Papas Schwester war.
Wir gingen in Museen, machten Spaziergänge und unternahmen Bootsfahrten. Jeden Abend führten Papa und ich lange Gespräche, an denen sich Miß Charity manchmal beteiligte. Fernando und Marie-Claire schauten sich nur an, während wir übrigen uns unterhielten. Vermutlich hatte ich den Ausgang schon erraten, noch ehe mir Marie-Claire eines Nachts spät, mit aufgeregter Flüsterstimme erzählte, daß sie und Fernando heiraten würden.
»Wirklich? Darauf wäre doch niemand gekommen …! Auf jeden Fall freue ich mich für euch beide.«
»Fernando und Captain Windham wollen morgen mit meinem Vater sprechen. Er wird sicher ja sagen und erleichtert sein, daß er mich vom Hals hat! Stell dir nur vor – bald bin ich eine ehrbare, verheiratete Frau, und dann sind wir wirklich wie Schwestern!«
»Weißt du, Fernando wird damit rechnen, daß du noch Jungfrau bist.« Ich hoffte, daß meine Stimme ganz sachlich klang. »Er ist in manchen Dingen sehr altmodisch, wie die meisten ›Californios‹.«
Marie-Claire lachte leise glucksend. »Ich weiß! Er hat mich bis jetzt erst zweimal geküßt – mehr nicht! Aber ich kann dir versprechen, daß in der Hochzeitsnacht Blut auf dem Laken sein wird, als Zeugnis meiner. Unberührtheit; und ich werde dafür sorgen, daß es ihm nicht leichtfällt, in mich einzudringen – jedenfalls beim erstenmal!«
Mich konnte nichts mehr schockieren, was Marie-Claire sagte. Sie hatte mir schon ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, in allen Einzelheiten. Reitknechte, Diener, jeder Mann, der gut gebaut und kräftig genug war, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Ich hoffte tatsächlich, Fernando möge in der Lage sein, sie zu befriedigen und auch zufrieden zu erhalten.
»Er hat ein furchtbar hitziges Temperament – sei vorsichtig, ja?«
»Pah! Natürlich werde ich vorsichtig sein – und sehr, sehr diskret, keine Angst! Nur – sag mir – ist er groß? Ist er gut in der Liebe?«
Ich war froh, daß die Dunkelheit die brennende Röte verbarg, die mir in die Wangen stieg. Manchmal ging sie wirklich zu weit!
»Du wirst das sicher bald selbst herausfinden!« fuhr ich sie an, kehrte ihr den Rücken zu und zog mir energisch die Decken über den Kopf, dann fügte ich mit gedämpft klingender Stimme noch hinzu: »Und überhaupt, wie sollte ich so etwas von Fernando wissen? Er ist mein Bruder, vergiß das nicht!«
»Nur dein Stiefbruder, und das heißt, daß ihr eigentlich überhaupt nicht verwandt seid! Ich würde es dir auch keineswegs übelnehmen, wenn … du mit dem bestaussehenden Mann, der zufällig auch noch verfügbar war, experimentiert hättest – ich weiß, daß ich das getan habe, und du bist dumm, wirklich dumm, wenn du es nicht gemacht hast!«
Nun, ich hatte es nicht getan, und damit Schluß. Marie-Claire genoß das Abenteuer des ›Experimentierens‹, wie sie es nannte, wohingegen ich – noch nie dazu aufgefordert worden war.
Es regnete den ganzen nächsten Tag, und ich erinnere mich, daß ich froh darüber war, weil das Wetter zu meiner Stimmung paßte und mir eine Ausrede lieferte, in der Bibliothek am Kamin zu sitzen und zu lesen. Dort stand mein Lieblingsstuhl – roter Plüsch mit abgewetztem Sitz, groß genug, daß ich die Beine hochziehen konnte. Man hatte mir gestattet, mit einem kleinen Glas Sherry auf das Wohl des glücklichen Paares anzustoßen, und vermutlich lag es am ungewohnten Alkohol, daß ich nach einer Weile schläfrig wurde. Ich hatte zu kämpfen, um die Augen offenzuhalten, und die Glieder wurden mir schwer.
Es wäre wirklich dumm, hier einzuschlafen, wo ich doch oben ein wunderbares Bett hatte. Ich sollte mich wohl wirklich aufraffen, dachte ich fast bedauernd, denn hier am Feuer war es angenehm warm und gemütlich. In meiner bequemen Stellung, halb eingeschlafen, wußte ich kaum, wie spät es war und wie die Zeit verging. Das flackernde Feuer schien mich hypnotisiert zu haben, ich glaubte, n etwas Neues, etwas anderes zu verwandeln.
»Aah!« Hatte ich laut geschrien? Ich konnte mich nicht erinnern. Aber ich weiß noch, daß ich ruckartig die Augen aufriß und Fernando erblickte, der mich aus schmalen Augen auf eine höchst sonderbare Weise ansah, so daß ich verlegen wurde und mich unbehaglich fühlte, als ich mich aufsetzte und versuchte, meine nackten Beine unter mir herauszuziehen.
»Ich … es tut mir leid, ich wollte hier nicht einschlafen! Du wolltest wahrscheinlich rauchen … und ich …«
Fernando unterbrach mein Gestammel mit einer Handbewegung, die mir verriet, daß er wahrscheinlich zuviel Alkohol intus hatte.
»Ich habe schon zu viele Zigarren geraucht und zu viele Flaschen Wein getrunken, glaube ich. Mein ehrenwerter ›padre‹ wurde von Tia sicher zu Bett gebracht – und auch meine ›novia‹ hat sich zurückgezogen. Sie meinte, ich würde dich vielleicht hier finden, wie üblich über einem lächerlichen Buch eingeschlafen. Medizinische Bücher anstelle von Romanen? Wenn du dabei bleibst, kleine Schwester, wirst du am Ende dastehen wie die arme Tia – ohne Mann!«
Ein paar Sekunden lang wurde ich von blindem Zorn fast überwältigt und hätte am liebsten mit jeder Waffe, die mir in den Sinn kam, nach ihm geschlagen, dann gelang es mir jedoch, so kalt wie irgend möglich zu sagen: »Ich glaube, für Tante Charity ist es ein Glück, daß sie nicht irgendeinen dummen, unvernünftigen Mann am Hals hat! Und was die Bücher angeht, die ich mir aussuche … ich bin nicht deine Schwester, Fernando, und ich bin dir keine Erklärungen schuldig!«
»Du bist jünger und natürlich nicht halb so schön, wie sie war«, sagte Fernando brutal, als hätte er gar nicht gehört, was ich gesagt hatte, dann fügte er nachdenklich hinzu: »Aber weißt du, manchmal gibt es Augenblicke, da bist du deiner Mutter fast zu ähnlich. Besonders jetzt, wenn ich die Feuerteufel in deinen Augen sehen kann. Hast du mich deshalb daran erinnert, daß du nicht meine Schwester bist? Bist du auch eine ›puta‹, so wie sie?«
Ich versuchte, auf die Beine zu kommen, aber ich war wütend, verängstigt und verwirrt, und meine Beine waren ganz lahm.
»Du antwortest nicht? Oder kannst es nicht leugnen, ist es das? Wie?«
Ich merkte gar nicht, daß ich mich wieder in meinen Stuhl gedrückt hatte, als wolle ich darin versinken, bis ich spürte, wie meine Wange brannte, weil er mit seinen Fingern dagegengeschnippt hatte, und ich keuchte laut auf vor Schreck und vor Schmerz.
»Du hast Angst, mir zu antworten, was, kleine Bruja? Oh, sí, ich habe sie alle flüstern hören, daß du genau das bist! Und glaube nicht, daß es mir entgangen ist, wie du mit den Pferden sprichst, um sie zu zähmen – sogar mit diesem wilden Stier, dem sonst niemand in die Nähe kommen durfte! Du hast Hexenaugen; früher habe ich versucht, ihnen zu entgehen, und dir! Wie lästig du doch warst, ständig hinter uns her …«
Ich hatte gespürt, wie Zorn in mir aufstieg und die Furcht auslöschte. Und dann kehrte, dem Himmel sei Dank, die Vernunft zurück. Fernando war betrunken. Er wußte nicht, was er heute abend gesagt und getan hatte, und würde sich wahrscheinlich auch nicht daran erinnern. Ich hatte schon früher erlebt, wie er gegen jedes Tier und jeden Menschen aggressiv wurde, die ihm in die Quere kamen – und unter dem Alkoholdunst konnte ich die kaum gebändigte Gewalttätigkeit fast riechen, die jetzt in ihm war. »Vorsicht!« warnte mich eine innere Stimme. »Du mußt sehr vorsichtig sein!«
Immer noch meine Wange reibend, flüchtete ich mich ins Offensichtliche. Verwirrung. Ungläubigkeit. So tun, als habe man das meiste von dem, was er gesagt hatte, nicht gehört oder verstanden.
»Fernando … warum hast du mir weh getan? Was meinst du mit all den schrecklichen Dingen, die du gesagt hast? Du weißt sehr gut, daß ich nichts dafür kann, wenn meine Mutter –«
Diesmal riß er mich richtiggehend hoch und hielt mich an den Oberarmen fest, während er mir ins Gesicht fauchte: »Und jetzt sag mir – wie viele Männer hast du schon gehabt? Hast du mit deiner Mutter bereits gleichgezogen?« Er schüttelte mich so fest, daß mein nachlässig hochgestecktes Haar sich löste und mir um Gesicht und Schultern hing; dann ließ er mich so plötzlich los, wie er mich gepackt hatte, lachte sonderbar und berührte mich auf andere Weise, knetete mit einer Hand schmerzhaft meine Brust, und mit der anderen …
»Nein!« Ich glaube, mein Zorn war ebenso heiß wie das Ende des Schürhakens, den ich plötzlich in der Hand hielt – und ich glaube, ich hielt Fernando damit in Schach, weil ihn etwas in meinen Augen und meinem Aussehen gewarnt haben mußte, daß ich ihn verstümmeln oder töten würde, wenn er noch einmal versuchte, mich anzurühren. »Nein und nochmals nein!« wiederholte ich fast atemlos, fast stimmlos vor Erniedrigung und Wut. »Merke dir eines, Fernando – ich bin nicht Laurette, nicht meine Mutter! Ich bin ich, verstanden? Ich bin Trista – und es ist mir egal, was du oder sonst jemand sagt oder denkt. Ich weiß, was ich getan und nicht getan habe, und das allein zählt für mich. Wenn ich.. . falls ich mich von einem Mann berühren … ihn nahe genug an mich heran lasse, um mich auch nur zu küssen, dann bin ich diejenige, die sich den Mann aussucht … und die Zeit.. . und den Ort! Aber im Augenblick glaube ich … weiß ich, daß ich viel lieber bleiben möchte, wie ich bin … oder Nonne werden wie Concepcion Arguello. Und wenn … wenn die Art, wie du mich eben behandelt hast, zwischen Mann und Frau üblich ist, dann habe ich keine Lust, das noch einmal zu erleben. Niemals!«
»Dann bist du also noch Jungfrau? Kein anderer Mann …«
Ich schniefte inzwischen vor Zorn und Frustration. Ich haßte mich wegen meiner Schwäche, und ich haßte Fernando für das, was er getan hatte, und empfand gleichzeitig Mitleid mit ihm, weil er meine Mutter, diesen Schmetterling, mit der ganzen Leidenschaft eines Knaben geliebt haben mußte.
»Fernando – bitte, geh! Du sollst in weniger als einer Woche Marie-Claire heiraten, meine beste Freundin; und nur an sie solltest du denken, nicht an mich!«
»Deine Waffe ist nicht mehr heiß genug, um mich zu verbrennen – und ich glaube nicht, daß dein neu entdeckter Trotz echt ist! Vielleicht sollte ich mich als dein älterer Bruder selbst vergewissern, ob das, was du eben angedeutet hast, auch wirklich wahr ist? Es hat schon Heiratsanträge für dich gegeben, wußtest du das? Ein Ehemann erwartet –«
»Wenn du noch einen Schritt näherkommst, Fernando, dann schlage ich dich zum Krüppel! Aus den ›lächerlichen‹ Büchern, die ich so gerne lese, habe ich eine Menge über Anatomie gelernt – und außerdem kann ich auch sehr laut schreien. Soll ich das jetzt tun?«
Meine Stimme mag gezittert haben, aber mir war es mit jedem Wort ernst, und ich glaube, Fernando wußte das. Er zögerte den Bruchteil einer Sekunde, ich wappnete mich; und dann zuckte er die Achseln und brachte sogar ein verzerrtes Lächeln zustande.
»Ich glaube, du würdest wirklich tun, was du mir eben angedroht hast! Na schön! Du bist eine richtige Teufelin geworden! Vielleicht hält es irgendwann ein Mann der Mühe wert, dich zu zähmen – wenn er den Mumm dazu hat!« Er verabschiedete sich mit einer sarkastisch übertriebenen Verbeugung, drehte sich um und ging, nicht sehr festen Schrittes, zur Tür.
Ich blieb, wo ich war, sah ihm nach, und ehe sich die Tür hinter ihm schloß, schaute er mich über die Schulter hinweg an und sagte mit einem seltsamen Lachen: »Hoffentlich hütest du deine Tugend weiterhin so sorgfältig, meine kleine Adoptivschwester! Denn eines Tages, wenn ich das Haupt der Familie bin, bestehe ich vielleicht darauf, mich zu vergewissern, daß ich nicht einem meiner Freunde eine beschädigte Ware zur Ehe übergebe. Du verstehst doch sicher, was ich meine? Buenas noches, Trista querida!«
Ich fiel fast gegen die Tür, so eilig hatte ich es, sie zu versperren, als er endlich draußen war; und danach konnte ich nicht mehr aufhören zu zittern, als ob ich einen Schüttelfrost hätte! Ich konnte den Rest der Nacht hier verbringen und am nächsten Morgen erklären, ich sei, wie üblich, über einem Buch eingeschlafen. Tante Charity würde es verstehen … und was Fernando dachte, oder wie er vielleicht feixen würde, war mir nicht mehr wichtig. Er würde Marie-Claire heiraten, und ich … was hielt die Zukunft wohl für mich bereit?
Kapitel 2
Ich weiß heute nicht mehr, wie lange ich an dieser Tür lehnte, als sei sie meine einzige Stütze auf der Welt, die Stirn fest dagegen gedrückt, als wolle ich alle Gedanken und Sehnsüchte abwehren, an die ich nicht denken wollte. Mein Atem klang selbst für mich viel zu laut, er übertönte fast das harte, regelmäßige Ticken der Seth-Thomas-Uhr, die behäbig auf dem Kaminsims thronte und hochmütig all den Krimskrams ignorierte, von dem sie umgeben war.
»Genau! Bleib distanziert. Die Uhr tickt, und die Zeit ist ewig. Augenblicke und Ereignisse gehen vorüber – und sind vorbei. Du lernst … oder auch nicht. Egal, denn die Zeit geht niemals rückwärts, nur vorwärts. Man darf sie nicht auf Reue verschwenden – sie ist zum Handeln da – zum Fühlen – das Jetzt verleiht dem Später Farbe … und den Erinnerungen.«
Ich dachte: O Gott, vielleicht bin ich doch eine Hexe! Warum sollte ich sonst die Stimme der alten Frau aus dem Sumpf in meinem bewußt leeren Kopf so deutlich hören? Die Bedeutung der Worte – Warnung vor Schwäche oder Bekräftigung? Denn insgeheim, verstohlen, fragte ich mich schon: »Was wäre, wenn ich nicht widerstanden hätte? Was hätte geschehen können? Würde er dann nächsten Monat immer noch Marie-Claire heiraten – oder mich?
»Ich glaube, Sie sind gut mit ihm fertiggeworden – und haben auch klug gehandelt, wenn Sie ihn später noch haben wollen. Er ist einer jener Männer, die immer nach dem Unerreichbaren streben – oder nach dem, was schwierig zu bekommen scheint! Wenn Sie also meinen Rat hören wollen, ich würde diese Tür nicht zu schnell aufschließen. Lassen Sie ihn auf Ihre Launen eingehen; ich kann Ihnen versichern, Verlangen und Neugier werden ihn um so mehr entflammen. Wenn es das ist, was Sie wirklich wollen …?«
Ich spürte, daß Hände mit leichtem und doch festem Druck auf meinen Schultern lagen, hörte und verstand jedes Wort, das zu mir gesprochen wurde – bekam jede Nuance mit, auch jenen seltsam fragenden Tonfall am Ende eines unvollendeten Satzes. Und doch war es – wenigstens für Augenblicke – als wäre die Zeit stehengeblieben und als hinge ich in einem gefrorenen Vakuum, wo ich allein weder zu einem Wort noch zu einer Bewegung fähig war. Ich konnte mich nur … erinnern. So etwas nennen die Franzosen ›déjà vu‹ – ›schon gesehen‹; und es kann beängstigend sein, wie alles, was man nicht ganz versteht und nicht ganz erklären kann.
Irgendwann löste sich dieser gewisse Moment auf, als habe es ihn nie gegeben. Er verschwand, als ich den bis dahin angehaltenen Atem ausstieß, ich wirbelte herum und ließ an die Stelle dessen, was noch vor ein paar Sekunden in meinen Gedanken gewesen war, Zorn treten.
»Wer … wie …?«
Ich wußte, daß ich stotterte wie ein Dorftrottel, und verachtete mich fast so sehr dafür, wie ich die Ursache für meine ganz begreifliche Verwirrung verabscheute – besonders, nachdem ich erkannt hatte, daß er, ein Fremder, der aus dem Nichts aufgetaucht war, es offenbar tatsächlich komisch fand, daß er mich erschreckt hatte. Selbst seine allzu flüchtige ›Entschuldigung‹ wurde so herablassend vorgebracht, als sei sie an ein Kind gerichtet!
»Was das ›wer‹ angeht – ich bin ein Freund von Charity. Und wie …? Natürlich über die Geheimtreppe aus dem Keller. Tut mir leid, daß ich Sie nicht durch lautes Husten oder etwas Ähnliches gewarnt habe, aber die kleine Szene, die ich unfreiwillig belauschte, hat mich zugegebenermaßen ziemlich … nun, ziemlich fasziniert. Ist er nicht ein wenig zu alt für Sie – dieser Nicht-ganz-Bruder?«
»Sie sind … wirklich abscheulich! Mit voller Absicht ein vertrauliches Gespräch zu belauschen und sich dann anzumaßen, mir einen Rat … in Angelegenheiten zu geben, die Sie nichts angehen … auch wenn Sie wirklich ein Freund von Tante – von Miß Windham, meine ich – sein sollten, kann das keinesfalls Ihren bedauerlichen Mangel an … an …«
»An Manieren oder an Takt? Ich muß gestehen, daß man mir schon früher vorgeworfen hat, nichts von beidem zu besitzen! Aber was Sie angeht, junges Fräulein … wenn Sie meine Nichte – oder, was Gott behüten möge, meine Tochter – wären, würde ich bestimmt dafür sorgen, daß Sie jede Nacht in Ihrem Schlafzimmer eingeschlossen würden wie eine spanische Jungfrau; und daß eine ›Dueña‹ sie untertags auf Schritt und Tritt überwacht. Ihr kostbarer Fernando hätte Sie entehren können, wenn er entschlossen genug und weniger betrunken gewesen wäre. Haben Sie das noch nicht begriffen? Oder war es das, was Sie eigentlich wollten?«
Unter diesen letzten Worten hörte man das Knurren eines Wolfs, und ich wollte zurückschlagen, war aber nicht erfahren genug, um das wirkungsvoll tun zu können – wenigstens damals noch nicht. Mit Fernando und meinem vagen Bedauern im nachhinein fertigwerden zu müssen, war schon schlimm genug gewesen; aber bösen, häßlichen Vorwürfen von einem Mann ausgesetzt zu sein, der mir völlig fremd war, das ging zu weit – ob er nun ein Freund von Tante Charity war oder nicht!
Ich merkte gar nicht, daß ich die Fäuste geballt hatte und nach ihm schlagen wollte, bis er meine Handgelenke packte.
»Nun?« wiederholte er aufreizend und grinste mir dabei ins Gesicht. Und dann sagte er das Schlimmste, was er überhaupt hätte sagen können: »Sind Sie nicht ein bißchen jung für die Art von Spielchen, wie Sie es mit dem unglücklichen – und so geduldigen – Fernando getrieben haben? In Gottes Namen, Sie können nicht mehr als höchstens zwölf oder dreizehn sein! Ich muß mit Charity über Sie sprechen – nachdem ich und die Freunde, die ich mitgebracht habe, etwas zu essen bekommen haben. Wo ist sie?«
Seine Augen waren von einem Goldgrün, das mich an die Sümpfe erinnerte, und sein Haar hatte die Farbe dunklen, fast schwarzen Mahagonis. Sein Kinn war gespalten, und kleine, sonnenverbrannte Linien an den Augenwinkeln bewiesen, daß er entweder ziemlich oft in die Sonne blinzelte oder ein finsteres Gesicht machte. Er war dunkelhäutig genug, um für einen Spanier gelten zu können, oder … was und wer war er überhaupt, dieser hochgewachsene, arrogante Mann, der sich viel zu viel herausnahm?
Ich hatte inzwischen meine sinnlosen Befreiungsversuche aufgegeben und flüchtete mich in hochmütige Verachtung, obwohl ich immer noch neugierig war auf den Mann – und sogar ein wenig Angst vor ihm hatte. Er war auf jeden Fall ganz anders als all die anderen sogenannten Kuriere der ›Freiheitslinie‹, wie man damals sagte, oder der ›Untergrundbahn‹. Tante Charitys exklusives Pensionat war nur eine der vielen Stationen auf dem schwierigen, verschlungenen Pfad in die Freiheit; und nur sie und ich (so hatte ich jedenfalls die ganze Zeit gedacht) wußten von dem kleinen, engen Raum unter dem Keller und von der schmalen, geheimen Wendeltreppe, die innerhalb der Wände verborgen war und vom Keller in die Bibliothek führte. Wenn er davon wußte und sie benützt hatte, konnte es ihm nur Tante Charity verraten haben – und warum hatte ich das Scheusal in diesem Fall nicht schon früher kennengelernt?
»Ich wünschte, Sie hätten … die Güte, Ihre Hände von mir zu lassen, Sir!« brachte ich als Antwort auf den schmerzhaften, warnenden Druck seiner Finger heraus, die sich ein klein wenig fester um meine Handgelenke legten. »Sie hätten mir gleich zu Anfang mitteilen müssen, wer Sie sind, und was Sie hier wollen, anstatt mir eine Predigt über meine Privatangelegenheiten zu halten.«
Wenigstens gab er mich frei; aber um meinen Ärger noch zu vergrößern, mußte er leise, aber spontan zu lachen anfangen.
Ich muß ihn wohl mit meinen Blicken erdolcht haben (und hätte es am liebsten in Wirklichkeit getan), denn er sagte mit erstickter Stimme: »›Haben Sie die Güte, Ihre Hände von mir zu lassen, Sir!‹ Ich hätte nie erwartet, diese Worte abseits der Bühne zu hören. Sie sind also eine aufblühende Thespisjüngerin, wie? Sie und ihr ach so leidenschaftlicher Fernando müßten eines Tages ein gutes Paar abgeben, ganz egal, ob er praktischerweise immer noch mit Ihrer Freundin verheiratet ist oder nicht. Aber Sie hatten ja recht – es geht mich wirklich nichts an! Und Sie haben sicher noch viel Zeit, um zur Frau heranzuwachsen – vielleicht.«
Ich war so wütend, daß ich ihn ohne die geringsten Skrupel hätte töten können, wenn ich den Schürhaken oder auch ein Gewehr zur Hand gehabt hätte. Besonders, als er auch noch die Dreistigkeit besaß, mir, als sei ich damit entlassen, zu sagen, ich solle hinauflaufen und Tante Charity mitteilen, daß er hier sei – und dann solle ich in die Küche gehen und ihm etwas zu essen besorgen. Falls ich fähig sei zu kochen …?
Ich wußte, daß er mich aus einem verborgenen, nur ihm bekannten Grund reizen wollte. Oder war das vielleicht nur ein Steckenpferd dieses Mannes – eine Art Katz-und-Maus-Spiel, dem er gelegentlich gerne frönte?
»Und jetzt beeilen Sie sich, mein Kind – ich bin hungrig wie ein Wolf, und meine Freunde auch! Es wundert mich, daß Charity nicht selbst hier war, wenn auch nur, um Ihre nächtlichen Abenteuer zu überwachen!«
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er verhungern können. Ich würde Tante Charity jedenfalls genau erzählen, was ich von diesem neuen Kurier und seinem Mangel an Manieren und guter Erziehung hielt. Wie konnte sie überhaupt mit so einem Menschen bekannt sein?
»Ich werde hinaufgehen und versuchen, Tante Charity zu wecken, aber natürlich nur, wenn es wirklich dringend ist. Wenn Sie jedoch lediglich Essen brauchen oder Anweisungen, wie Sie zum nächsten –«
Hier unterbrach er mich, und seine grüngoldenen Tieraugen wurden schmal, als er mich musterte wie ein armseliges, botanisches Exemplar.
»Ein wenig Feuer ist also doch unter dem Eis? Was für ein überraschendes Kind Sie doch sind!« Und dann schenkte er mir ganz überraschend ein ziemlich schiefes Lächeln, bei dem sich die Falten an seinem Mund vertieften, faßte mir mit einem Finger unter das Kinn und hob mein wütendes Gesicht zu sich empor.
»Ich bin kein Kind mehr, damit Sie es nur wissen!« Mein immer schon impulsives Temperament war jetzt nicht mehr zu halten. »Ich bin über sechzehn, alt genug, um zu heiraten und Kinder zu haben, wenn ich das wollte!« Wenn es nicht viel zu kindisch ausgesehen hätte, hätte ich mit dem Fuß aufgestampft, um meinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Und als Frau, Mister, wie immer Sie heißen mögen, will ich Ihnen sagen, daß Sie der rüdeste, ungehobeltste, ungezogenste und primitivste Mann sind, dem zu begegnen ich je das Unglück hatte! Und wenn Sie nicht ein Freund … ein Bekannter meiner Tante wären, würde ich …«
»Nach dem zu urteilen, was ich zufällig mitbekommen habe, kann ich mir gut vorstellen, daß Sie das tatsächlich tun würden!«
»Zufällig …? Sie haben absichtlich gelauscht! Und dann, als ob das noch nicht geschmacklos und verächtlich genug gewesen wäre, haben Sie auch noch angefangen, mich zu beleidigen und zu … zu verspotten und zu provozieren. Zum Teufel mit Ihnen und Ihrem heuchlerischen Lächeln, Ihren grausamen Wortspielen und Ihren häßlichen Andeutungen! Nette Sachen, die Sie da zu einem Kind gesagt haben, finden Sie nicht? Sie haben natürlich ganz deutlich gezeigt, daß Sie kein Gentleman sind; aber was noch schlimmer ist –«
»Halt … das genügt. Sie müssen lernen, eine einmal gemachte Aussage nicht zu zerreden. Und Ihr Wildkatzentemperament zu zügeln, wenn Sie etwas erreichen wollen.« Er war unverschämt genug, mich noch einmal anzulächeln, dann bekam seine Stimme zur Abwechslung einen einschmeichelnden Klang. »Na schön! Wenn Sie schon meinen wohlgemeinten Rat nicht zu schätzen wissen, könnte ich Sie dann vielleicht beschwichtigen, indem ich mich in aller Demut entschuldige? Meine Freunde und ich sind wirklich sehr hungrig und durstig! Ich glaube, es ist mehr als zwei Tage her, seit wir zum letztenmal gegessen haben … oder waren es drei? Hören Sie – wenn Ihr Fernando nicht immer noch irgendwo lauert, kann ich mir auch selbst etwas zu essen suchen. Ich glaube, ich weiß noch, wo die Küche ist. Oder soll vielleicht ich hinaufgehen und Charity wecken?«
Ich hatte mich, ohne es zu merken, mit dem Rücken gegen die Tür gestellt und drückte mit gespreizten Fingern auf beiden Seiten gegen die polierten Türtafeln. Der plötzliche Wandel seines Verhaltens wirkte nicht auf mich – ich traute ihm nicht im mindesten.
»Wenn Sie in den Keller zurückgehen, bringe ich Ihnen etwas zu essen, frisches Wasser und Milch hinunter. Aber ich werde nicht zulassen, daß Sie Tante Charity wecken; nicht, wenn sie schon eingeschlafen ist.« Ich sah ihn trotzig an, unverwandt diesmal, weil ich wußte, daß wenigstens in diesem Augenblick ich die Oberhand hatte.
»Ihre Augen erinnern mich im Moment an Blitze. Wahrscheinlich ist es gut, daß es keine sind!« Dann zuckte er auf eine Art die Achseln, daß ich dachte, er spiele immer noch mit mir … oder mache mein Spiel mit, aber nur so lange, wie es ihm paßte. »Würden Sie mich wirklich wieder in diesen Keller verbannen? Wenn Sie mich mit Wein bestechen würden, anstatt mit Wasser, dann vielleicht …«
»Ich würde nicht –«, hatte ich hitzig angesetzt, als von der anderen Seite der Tür ein leises Klopfen zu hören war und Tante Charitys Stimme gedämpft meinen Namen rief.
»Trista? Ich bitte dich, schließ auf, wenn du mich hörst, Trista, bitte …!«
»Es klingt, als mache sich Ihre Tante wirklich Sorgen. Glauben Sie nicht, Sie sollten aufmachen, wie Sie es verlangt?« Die Worte klangen plötzlich schleppend und ungebildet, aber der Blick, der mich unter trägen Lidern hervor aus den grün und bernsteinfarbenen Augen traf, schien mich einen Moment lang gegen die Tür zu pressen, ehe ich genügend Kraft sammeln konnte, um sie zu öffnen und meine Tante einzulassen.
»Meine liebe Trista! Ich habe auch Fernando zu Bett gebracht; und dann bemerkte ich, daß du nicht in deinem … Blaze?«
Tante Charitys Haar, das sie gewöhnlich in einem strengen Knoten trug, hing ihr offen über die Schultern herab. Als sie seinen Namen aussprach, sah sie aus wie ein junges Mädchen, das seine Reaktionen nicht unter Kontrolle hatte.
»Ja, Charity, mein Liebes, ich bin es wirklich.«
Es war, als ob ich, als ob meine Anwesenheit plötzlich ausgelöscht worden wäre wie ein Bild auf einer Schiefertafel.
»Du bist nicht …! Oh, Blaze, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, besonders nach dem letzten Mal …«
»Aber meine Liebe, das hättest du doch wissen müssen! Ich verstehe mich gut darauf, Verfolger abzuschütteln – und noch besser aufs Überleben. Du sollst dir keine Sorgen um mich machen – nie mehr.«
Seine Stimme, sogar die harten Linien seines Gesichts schienen weicher zu werden, als er meine Tante ansah, ihre impulsiv ausgestreckten Hände in die seinen nahm und sie festhielt; und sie konnte offenbar den Blick nicht von ihm wenden. Ich kam mir vor wie ein unerwünschter, unwillkommener Eindringling, der verlegen und wie angewurzelt dasteht.
Aber warum um Himmels willen? Ich. hatte doch schon entschieden, daß ich diesen Blaze – wenn er wirklich so hieß – nicht mochte. Warum also spürte ich dann einen Stich … fast wie Schmerz, wenn ich die beiden zusammen sah? Ich würde nicht – ich konnte es nicht ertragen, noch länger dazustehen, während sie sich in die Augen schauten und offenbar ein Zwiegespräch ohne Worte führten.
»Ich kann jetzt wohl hinaufgehen und mich schlafen legen, nachdem du auf bist, Tante Charity – es sei denn, du brauchst mich? Ich bin eingeschlafen. Es tut mir leid, wenn ich durch meine Gedankenlosigkeit dich am Schlaf gehindert habe.«
»Trista? Oh!« Tante Charity sah aus, als sei sie eben aus einer Trance erwacht, und ich hätte sie am liebsten geschüttelt.
Wenigstens begegnete ich Fernando in dieser Nacht nicht mehr; aber auch, als ich sicher in meinem Bett lag, brodelte in meinem Kopf eine sonderbare Mischung von Gefühlen, von denen ich einige nicht ganz verstand. Fernando … immer, solange ich mich erinnern konnte, war ich insgeheim (das glaubte ich jedenfalls) in ihn verliebt gewesen. Er sah auf fast klassische Weise gut aus und hatte das goldbraune Haar seiner Mutter und Papas blaue Augen. Mit seiner guten Figur und seinem schnellen Lächeln war er bei Frauen aller Altersklassen immer beliebt gewesen. Marie-Claire und er paßten in jeder Hinsicht zusammen und würden natürlich schöne Kinder haben. Von mir sagte man im allgemeinen, ich sähe ›ungewöhnlich‹ aus, wegen des überraschenden Kontrasts zwischen meinem Haar und meinen Augen, aber ›schön‹ hatte mich noch niemand genannt.
Aber bis zu diesem Abend hatte ich auch Tante Charity nie für eine noch junge, schöne Frau gehalten. Warum war sie unverheiratet geblieben? Wegen dieses Mannes, den sie Blaze nannte und der ihr Gesicht so zum Leuchten und ihre Augen so zum Glänzen bringen konnte, wie ich es nie zuvor gesehen hatte? Warum hatten sie nicht geheiratet, wenn sie sich liebten?
Ich warf mich unruhig in meinem schmalen Bett hin und her, strampelte die Decken und das Oberbett herunter und zog sie im nächsten Augenblick bis ans Kinn hoch. Ich wollte nicht darüber nachdenken, was hätte geschehen können, wenn Tante Charity nicht gekommen wäre, um nach mir zu suchen. Natürlich nichts, sagte ich mir zornig. Und weil ich nicht länger an ihn denken wollte, dachte ich statt dessen an Fernando und fragte mich … und wußte nicht, wie ich wirklich empfand, oder was ich wollte.
Kapitel 3
Wie seltsam! dachte ich am nächsten Tag, als alles und alle völlig unverändert schienen. Fernando behandelte mich genau wie immer, mit übertriebener Geduld – nichts in seinem Verhalten verriet, was zwischen uns vorgefallen war. Tante Charity hatte ihr Haar wie gewohnt in einem altjüngferlichen Knoten zurückgenommen, trug ihr strenges, hochgeschlossenes Wollkleid und hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der vitalen, strahlenden Frau, die ich in der Nacht zuvor plötzlich in der Bibliothek erblickt hatte. Ich vermutete, daß der Mann, den sie Blaze genannt hatte, inzwischen mit den ›Freunden‹, denen er zu Freiheit und Sicherheit verhalf, seiner Wege gegangen war. Wahrscheinlich würde ich ihn niemals wiedersehen, und ich wollte es auch gar nicht!
In den folgenden Tagen war ich froh über jede Kleinigkeit, die erledigt werden mußte, ehe die Hochzeit stattfand. Ich packte für Marie-Claire die Kleider ein, weil sie das selbst nie geschafft hätte, und ich hörte mir ihre Geständnisse an und beantwortete so viele Fragen über das Leben in Kalifornien, wie ich konnte. »Es hat sich sicher alles verändert«, warnte ich und erklärte, daß es dort zwar keine Sklaven gab, daß sie aber Dienstboten haben würde – so viel sie brauchte.
»Meine Stiefmutter ist aus Carolina – Nord oder Süd, das weiß ich nicht mehr genau! Aber ihre Familie ist sehr reich; sie haben Plantagen und viele Sklaven. Deshalb hat mein Vater sie wahrscheinlich geheiratet! Jedenfalls, solange ich Leute habe, die mich bedienen, und so viele schöne Kleider und Schmuck, wie ich mir wünsche, solange werde ich wohl ganz glücklich sein. Wenigstens werde ich eine gewisse Freiheit haben – einen Mann – eine Stellung …!«
»Und Kinder?« warf ich schroff dazwischen. »Weißt du, man wird von dir erwarten, daß du Erben hervorbringst, die den Familiennamen weitertragen. Miguel ist Priester, und ich bin nur eine Adoptivverwandte, also bleibt Fernando als einziger übrig.«
»Kinder? Ich möchte ausgehen, mich amüsieren und zur Abwechslung einmal tun, was mir gefällt! Ich bin erst siebzehn – ich will noch keine nassen, heulenden Babys haben! Wenn Fernando einen Erben haben muß, werde ich ihm Wohl einen schenken, aber erst, wenn ich will, und wenn ich sicher bin, daß ich ein Kindermädchen bekomme, das das Kind füttert und versorgt. Aber warum reden wir von so unerfreulichen Dingen? Denk doch nur – in zwei Wochen bin ich tatsächlich schon verheiratet, und mein Papa hat mir versprochen, daß ich mir meine Aussteuer in Paris kaufen darf, während wir in den Flitterwochen sind. Kleider von Worth – stell dir das vor! Und Papa wird es natürlich einrichten, daß wir dem Kaiser und der Kaiserin vorgestellt werden. Ach, Trista – ich wünschte, du könntest mitkommen! Ich brauche jemanden, mit dem ich das alles teilen kann, und du bist die einzige Frau, die ich je wirklich gern gehabt habe. Kannst du nicht mitkommen? Weißt du, wenn ich verheiratet bin, kann ich die Anstandsdame für dich spielen! Du könntest in Paris die Universität besuchen und Medizin studieren, wenn dein Herz immer noch an dem langweiligen Zeug hängt – und bei uns bleiben, solange du willst. Wäre das kein Spaß? Wenn Fernando mit seinen Freunden ausgeht, könnten wir uns gegenseitig begleiten – und uns gleichzeitig amüsieren. Ich werde mit deinem Papa und mit Fernando darüber sprechen. Er hätte nichts dagegen – von ihm könnte ich alles bekommen, was ich will!«
Marie-Claire war herumgewirbelt und hatte ihr Spiegelbild bewundert, während sie redete und ich versuchte, ihrem Geplapper nicht allzuviel Aufmerksamkeit zu schenken. Nach Paris fahren … an neue Orte reisen, andere Menschen kennenlernen und mehr über die Welt erfahren, in der ich lebte … Es war natürlich unmöglich; warum also an so etwas denken? Ich würde mich weiterhin für alle möglichen Sachen und für die Unterdrückten einsetzen, alle medizinischen Bücher lesen, die ich in die Finger bekam und wahrscheinlich als enttäuschte, scharfzüngige, alte Jungfer enden!
»Ja – ja! Du bist schließlich meine beste Freundin, und außerdem meine Schwägerin. Vielleicht brauchte ich dich!«
»Nun, in diesem Fall weißt du ja, wo ich zu finden bin. Aber in den Flitterwochen brauchst du keinen Dritten! Du kannst mich zu dir einladen, wenn du von Europa zurück bist und dich richtig eingelebt hast, ich verspreche dir auch, daß ich dann komme!«
»Wirklich? Weißt du, ich brauche jemanden, mit dem ich reden und dem ich vertrauen kann. Vermutlich wird es uns nach einiger Zeit langweilig werden, Fernando und mir. Und dann … wer weiß?«
Wie lebendig mir diese Zeit vor Augen steht! All die Vorbereitungen für unsere Abreise, noch dazu mit der Eisenbahn, nach Washington, wo uns Marie-Claires Eltern abholen sollten. Dann würden sie nach Richmond weiterreisen, wo die Hochzeit stattfinden sollte, und von dort nach Charleston in Süd-Carolina; und dann mit dem Schiff nach Frankreich.
»Wir fahren natürlich nach Italien. Ich wollte schon immer Rom sehen. Und dann nach England … Griechenland … und vielleicht auch nach Spanien. Ich will überallhin!«
Warum sollte ich meiner Freundin die Freude verderben, indem ich sie unangenehmerweise daran erinnerte, daß sie nicht ewig durch Europa reisen konnte, daß sie sich früher oder später irgendwo würde niederlassen müssen? Sie war wie ein fröhlicher, bunter Schmetterling, der gerade aus seinem Puppengefängnis ausschlüpfte und es nicht abwarten konnte, davonzufliegen und soviel Neues auszuprobieren wie nur möglich. Konnte ich es ihr denn verübeln? Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde nicht auch ich durch die ganze Welt reisen, ohne auf die Idee zu kommen, mich lange an einem Ort niederzulassen, wenn es doch immer neue Erlebnisse gab, auf die man sich freuen konnte?
Damals sagte ich nur: »Hoffentlich erinnerst du Fernando daran, daß du eine Zofe brauchst, die dich auf euren Reisen begleitet, denn du weißt sehr gut, daß du immer vergißt, wo du deine Sachen hingelegt hast – und was das Ein- und Auspacken angeht, so bist du ein hoffnungsloser Fall. Jetzt muß ich aber wissen, welche Kleider du für die Reise nach Washington mitnehmen willst, damit ich dafür sorgen kann, daß sie gebügelt werden und keine Knöpfe fehlen und kein Saum abgerissen ist.«
»Manchmal hörst du dich fast an wie Miß Charity, das schwöre ich dir! Fehlende Knöpfe … abgerissene Säume … denkst du denn nie an etwas … daran, etwas zu tun – was nicht im mindesten praktisch ist, sich aber durchaus als schrecklich aufregend erweisen könnte? Bist du je ein Risiko eingegangen? Nun, ich schon, wie du weißt! Und ich bereue nichts; wenigstens habe ich eine Menge über Männer gelernt – und ich glaube, daß mußt du auch noch, sonst endest du noch als alte Jungfer wie Miß Charity!«
Ich kann mich an diesen Tag sehr deutlich erinnern. Die Sonne schickte goldene Strahlen schräg durch das offene Fenster, und sie spiegelten sich so in den ebenso hellen Locken von Marie-Claire, als sie verzweifelt den Kopf schüttelte, daß man fast geblendet war. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil sie gewisse Dinge ausgesprochen hatte, die ich fast nicht zu denken wagte. Was wollte ich denn – und was bedeutete Wollen an sich? Und wenn ich es herausfand – was dann?
Vielleicht ist es ganz gut, daß ich während der folgenden Tage keine Minute Zeit für zuviel Selbsterforschung hatte. All die Dinge, um die man sich in letzter Minute noch kümmern mußte; und die lange, rußige Zugfahrt nach Washington mit den vielen Übernachtungspausen, ›eine Annehmlichkeit für den müden Reisenden‹ … so stand es jedenfalls in unserem Reiseführer. Ich jedenfalls war viel zu müde und erhitzt, um mehr an Annehmlichkeiten zu brauchen als ein kühles Bad und einen traumlosen Nachtschlaf. Sobald wir einmal in Washington sind, pflegte ich mich zu trösten, werde ich sicher nicht mehr mit Marie-Claire in einem Bett schlafen müssen, die sich soviel herumwirft, daß ich dabei keinen Schlaf finden kann.
An jenem ersten Abend in Washington verschlief ich das ganze Dinner, denn Papa, dieser Engel, ließ nicht zu, daß man mich störte. Ich glaube, ich schlief zehn Stunden und hätte wahrscheinlich noch länger geschlafen, wäre ich nicht mit einem Ruck aus tiefem Schlummer gerissen worden, weil mich jemand heftig an der Schulter rüttelte, und dann steckte ich auch schon mitten in einer verzwickten Intrige, von der ich nichts wußte und nichts verstand – obwohl man von mir erwartete, daß ich eine Rolle darin spielte.
»Still!« hörte ich Marie-Claire eindringlich aus der Dunkelheit flüstern, und ich spürte, wie sie in mein Bett glitt und mich wieder hinunterdrückte. »Bitte, Trista! Du mußt so tun, als ob du tief und fest schläfst, und als ob ich während der letzten paar Stunden hier bei dir gewesen wäre, weil ich gesagt habe, ich könnte nicht einschlafen und wollte mit dir plaudern. Versprichst du mir das? Ich schwöre dir, daß ich dir später alles erklären werde, aber jetzt …« So, wie sie die Worte heraussprudelte, überraschte es mich kaum, daß sie atemlos war. Und es dauerte auch nicht lange, bis ich merkte, daß sie nichts als ein dünnes Unterhemd unter dem Seidenmorgenmantel trug, den sie auszog, während sie redete, und einen Augenblick später achtlos zu Boden fallen ließ.
Ich bin nie besonders gut drauf, wenn ich aus dem Schlaf geweckt werde, und diesmal war keine Ausnahme, und so war ich nur zu einem unverständlichen Gemurmel fähig wie: »Wa … hm?«
»Schon gut! Wenn sie mich nicht in meinem Zimmer finden, nur meine überall verstreuten Kleider, und mein Bett ist … Scht! Weißt du noch, was du sagen mußt? Trista …!«
»Selber Scht!« murmelte ich ungnädig und wandte ihr den Rücken zu. »Ich schlafe doch angeblich fest, oder nicht?«
Kaum hatte ich das gesagt, als ganz flüchtig geklopft und dann meine Tür praktisch aufgerissen wurde, herein kamen nicht nur Marie-Claires Vater und ihre Stiefmutter, sondern auch ihr finster blickender Verlobter; mein armer Papa, den man offensichtlich gewaltsam mitgeschleppt hatte, hinkte so weit hinter dieser militanten Gruppe her, wie er nur konnte, und streichelte verlegen die Schulter einer Zofe, die in ihre Schürze schluchzte, das junge Fräulein habe ihr schon vor langer Zeit gesagt, sie solle zu Bett gehen – sie brauche keine Hilfe beim Auskleiden. Was für eine Szene!
»Ist Marie-Claire hier?«
Eine Kerze wurde hochgehalten und beleuchtete spähende Gesichter. Diesmal gab Marie-Claire ein angeblich schlaftrunkenes Gemurmel von sich, während ich wie ein Schachtelteufel erneut in die Höhe schoß, um mit meinen schauspielerischen Talenten an diesem Schauerdrama mitzuwirken.
»Gott im Himmel! Ist etwas geschehen! Brennt es? Oh!« Bei dem letzten Ausruf zog ich die Decken bis ans Kinn hoch und spielte, gebührend entrüstet, die Rolle der schamhaften Jungfrau.
»Es ist Marie-Claire!« sagte ihre Stiefmutter mit bebender Stimme. »Ich dachte, ich hätte auf der Treppe etwas … jemanden gehört … Vielleicht ging auch eine Tür zu? Und als ich nachsah, war sie nicht in ihrem Zimmer! Ich …«
Ich gab Marie-Claire unter der Decke einen Tritt, um sie darauf aufmerksam zu machen, daß dies ihr Stichwort war, und sie stützte sich mit einem unterdrückten Aufschrei auf den Ellbogen und fragte, was in aller Welt denn all die Leute hier wollten – es sei doch sicher noch nicht Morgen!
Nachdem allseits Erklärungen und Entschuldigungen abgegeben worden waren und die Tür sich wie der Vorhang in einem Theater hinter dem Rest der Truppe geschlossen hatte, ging ich wutentbrannt auf meine leichtsinnige Freundin los, nur um festzustellen, daß sie sich die Decken über den Kopf gezogen hatte.
»Na schön! Ich finde, du bist mir eine Erklärung schuldig! Und hoffentlich denkst du auch daran, was für ein albernes, gefährliches Risiko du eingehst und wieviel du zu verlieren hast – besonders jetzt. Wirklich, Marie-Claire!«
»Oh … jetzt schimpfst du schon wieder mit mir!« murmelte Marie-Claire schmollend mit gedämpfter Stimme. »Und überhaupt bin ich jetzt viel zu müde, um noch etwas zu erklären. Du hast seit unserer Ankunft schließlich nichts anderes getan, als zu schlafen, während ich … vorgeführt wurde, ich mußte ständig lächeln und zu den langweiligen Freunden meiner Eltern und zu entfernten Verwandten, von denen ich noch nie gehört hatte, reizend sein! Morgen erzähle ich dir alles, das verspreche ich dir, wenn du mich jetzt schlafen läßt, anstatt so … so kratzbürstig zu sein!«
›Kratzbürstig‹ hatte sie mich genannt. Sahen mich alle anderen auch so?
Ich legte mich wieder hin, mit steifem Rücken und so weit weg von Marie-Claire, wie es das Bett zuließ. Kratzbürstig war ich? Scharfzüngig … altjüngferlich, zu geradeheraus? … Das würden wir ja sehen!
Und laut, mit bemüht gleichgültiger Stimme sagte ich: »Du hast natürlich recht, es geht mich wirklich überhaupt nichts an, was du tust, nicht wahr?«
Nach kurzem Schweigen hörte ich Marie-Claire brummen: »Na schön! Du brauchst gar nicht so frostig zu sein … Ich werde dir alles erzählen, wenn du mir versprichst, mich hinterher schlafen zu lassen – und keine weiteren Predigten zu halten. Bitte?«
Fast zum erstenmal, seit wir Freundinnen waren, konnte ich diesem einschmeichelnden Kleinmädchentonfall gegenüber, der sich in ihre Stimme eingeschlichen hatte, hart bleiben.
»Nun schlaf schon, wenn du es brauchst! Ich will gar nichts über deine jüngste Eskapade hören, wenn ich es mir genau überlege – besonders wenn es wieder einer von den Lakaien oder ein muskulöser, junger Gärtner ist! Also verschone mich, ja?«
»Es war kein Diener oder jemand ähnliches. Und Fernando war es auch nicht – obwohl ich ihn ganz verrückt gemacht hatte, indem ich mich leidenschaftlich von ihm küssen ließ und mich gegen seinen Körper lehnte, als habe seine Leidenschaft mich ganz schwach gemacht!« Marie-Claire lachte leise und amüsiert, dann flüsterte sie triumphierend: »Nein, meine liebste Trista, der er,