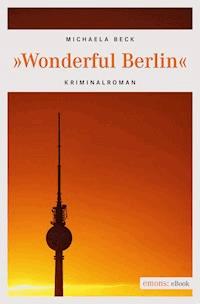19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weimar 1979. Als Renée zum Architekturstudium zugelassen wird, kann sie ihr Glück kaum fassen. Die Plätze sind heiß begehrt, die Zulassungsbedingungen hoch. Von Beginn an ist unter ihren Mitstudierenden ein Mädchen, das sie besonders fasziniert. Uta, die Tochter des erfolgreichen Rostocker Stadtarchitekten, ist das größte Zeichentalent des Jahrgangs und mit unbändiger Energie und überbordender Fantasie gesegnet. Renée, die aus einfachen Verhältnissen kommt, lässt sich nur zu gern von ihr zeigen, wie scheinbar unüberwindliche Grenzen zu sprengen sind. Doch etwas stimmt nicht in dieser Freundschaft. Über Uta scheint ein Schatten zu liegen, der immer größer wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
PROLOG
1. ENTTÄUSCHUNG
2. HOFFNUNG
3. ANKOMMEN
4. FASZINATION
5. VERUNSICHERUNG
6. FREUNDINNEN
7. AHNUNG
8. SOLLBRUCHSTELLE
9. VERRAT
10. ABKEHR
11. HINWEISE
12. BEGREIFEN
13. NEUAUSRICHTUNG
14. VERLUST
NACHSATZ
DANKSAGUNG
Über das Buch
Weimar 1979. Als Renée zum Architekturstudium zugelassen wird, kann sie ihr Glück kaum fassen. Die Plätze sind heiß begehrt, die Zulassungsbedingungen hoch. Von Beginn an ist unter ihren Mitstudierenden ein Mädchen, das sie besonders fasziniert. Uta, die Tochter des erfolgreichen Rostocker Stadtarchitekten, ist das größte Zeichentalent des Jahrgangs und mit unbändiger Energie und überbordender Fantasie gesegnet. Renée, die aus einfachen Verhältnissen kommt, lässt sich nur zu gern von ihr zeigen, wie scheinbar unüberwindliche Grenzen zu sprengen sind. Doch etwas stimmt nicht in dieser Freundschaft. Über Uta scheint ein Schatten zu liegen, der immer größer wird …
Über die Autorin
Michaela Beck ist freiberufliche Autorin, Dramaturgin und Dozentin - hauptsächlich im Bereich Drehbuch. Neben einem Kinofilm und Drehbüchern für verschiedene TV-Serien hat sie auch Radiofeatures, ein Hörspiel und einen Krimi veröffentlicht. Ihre Web-Graphik-Novel „Ninette“ war für den Grimme-Online-Award und ihr Manuskript „Ein Himmel voller Eskimos“ für den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert. Michaela Beck lebt mit ihrem Mann in Berlin.
Weitere Titel der Autorin:
Das Licht zwischen den Schatten
MICHAELA BECK
DAS LAUTE IM LEISEN
ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Anna Hahn, Trier Covergestaltung: Massimo Peter-Bille Covermotiv: © Rebecca Bernau, Grünwald E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7517-6100-0
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
Für alle, die uns für immer fehlen. Und für Gudrun († 1995)
PROLOG
Sie hatte vor nichts Angst, schon gar nicht vorm Fallen, sie war wie diese Indianer, die die Wolkenkratzer von Manhattan bauten. In größter Höhe absolut schwindelfrei. Wolkenkratzer hätte sie auch gern gebaut, wenigstens die Möglichkeit dazu gehabt, aber sie lebte in der DDR, also war ihre Fähigkeit nutzlos. Hier wurden keine Wolkenkratzer gebaut, auch nicht geplant. Nur PH16. Punkthochhäuser mit sechzehn Stockwerken. An deren Fassade hangelte sie sich in ihrem praktischen Jahr entlang und schloss die Fugen zwischen den Platten mit in Teer getränkten Tauen. Niemand aus ihrer Brigade wollte diese Arbeit ohne Absicherung, ohne Krahn und Hebebühne machen, keiner der harten Kerle. Sie aber saß zwanzig Meter über der Erde auf zwei vernagelten Brettern, gehalten und bewegt von einem simplen Flaschenzug. Sie schien keinerlei Angst zu haben, abstürzen zu können. Viele glaubten ihr das später nicht, hielten es für Angeberei, aber dann turnte sie auf der Attika eines Elfgeschossers herum, übte selbstvergessen Ballettschritte – und allen stockte der Atem.
1. ENTTÄUSCHUNG
Weimaor, Weimaor! Alles naushuppe!«, rief die Bahnsteigwärterin, doch ebenso wie Renée kämpften auch andere Fahrgäste mit den schweren Waggontüren. Ein korpulenter Mann hinter ihr schubste sie ungeduldig von der Tür weg. Er stemmte sofort sein ganzes Gewicht in den Hebel, bis die Tür tatsächlich aufflog und ihn gleich mit sich riss. Fast wäre er auf dem Bahnsteig der Länge nach hingeschlagen, konnte sich aber im letzten Moment abfangen und auf den Füßen landen. Auf denen eilte er erstaunlich flink davon, nicht ohne Renée noch einen wütenden Blick über die Schulter zuzuwerfen, als gäbe er ihr die Schuld an seinem Beinahe-Unfall.
Renée klemmte sich ihr A1-Reißbrett unter den Arm, hängte sich ihre schicke neue Zeichenrolle um, das Abschiedsgeschenk von Lilo, schulterte die überaus peinliche Reisetasche aus leuchtend orangerotem, furchtbar nach Plaste stinkendem Kunstleder – das Abschiedsgeschenk ihrer Eltern – und stieg die drei Stufen hinunter auf den Bahnsteig.
Da war sie also! Die junge, aufstrebende Architekturstudentin, die in fünf Jahren mit Bestnoten ihr Diplom in den Händen halten und Häuser, Brücken, sogar Paläste entwerfen würde. Sie brannte darauf, mit dem Studium beginnen zu können und ihre neuen Kommilitonen kennenzulernen, die sicher ganz anders wären als die langweiligen Mädchen und immer noch pubertierenden Jungs ihrer Abiturklasse. Überwunden die Lernbrigade, der Schulhengst, Miss Mundgeruch und das Mauerblümchen! Jetzt würde sie nur noch Menschen treffen, die sich wie sie für Bücher, das Theater und die Kunst interessierten und vielleicht sogar dieselbe Musik hörten.
»Ruhig, Brauner!«, hörte sie ihre Oma in Gedanken sagen, und deshalb atmete Renée erst einmal tief durch und versuchte sich auf dem Bahnsteig zu orientieren. In ihrem Rücken hob die Bahnsteigwärterin die Kelle, blies in die Trillerpfeife zur Abfahrt, und der Zug setzte sich in Bewegung, begann langsam aus dem Bahnhof zu rollen, einem neuen Ziel entgegen, erst Erfurt und dann Eisenach.
Der Verbindungsgang zwischen Treppe und Bahnhofshalle war dunkel, feucht, und es stank stechend nach frischem Urin. Widerlich. Einer der auf den nächsten Zug wartenden Männer, die sie aus dem Dunkeln heraus mürrisch anstarrten, musste sich kurz zuvor erleichtert haben. Angeekelt verzog Renée das Gesicht, ließ die Männer im Tunnel rasch hinter sich und schritt schwungvoll durch die verrußte Bahnhofshalle. Die war so hoch, dass unter ihrem Dach mehrere Tauben mühelos ihre Runden ziehen konnten, unbemerkt von den Reisenden auf den Bänken und den Warteschlangen an den Schaltern. Ihr hingegen fielen sie auf, weil eine von ihnen sich ausgerechnet Renée auserwählte und sie mit ungewolltem Glück bekleckerte. Renée deutete es als gutes Omen. Überhaupt war sie nur dann abergläubisch, wenn es auch eine positive Deutung gab. Negative Auslegungen tat sie hingegen kategorisch als Humbug ab.
Renée wischte sich also die Fäkalie mit fast triumphierendem Ekel von der Schulter – was für ein Beginn! – und schaute sich noch einmal um.
Sie hatte sich vorgenommen, sich alles, wirklich alles, was an ihrem ersten Tag geschah, genau einzuprägen, um sich später daran erinnern zu können, wie ihr neues Leben, ihr Erwachsenenleben, einst begonnen hatte. Auch wenn sie schon fast zwanzig war und bereits ein Jahr auf dem Bau, auf der Großbaustelle Berlin-Marzahn, gearbeitet hatte, war sie doch nach dem Abitur bei den Eltern wohnen geblieben und wurde von ihnen, trotz ihrer Volljährigkeit, weiterhin wie ein Kind behandelt. Aber ab dem heutigen Tag würden die Eltern nicht mehr über sie bestimmen können. Ab heute war sie auf sich gestellt und erwachsen!
Von außen entsprach das Bahnhofsgebäude nicht ganz ihren Vorstellungen von einem Kleinstadtbahnhof. Es war dafür zu groß, doch aus welcher Stilepoche es genau stammte, konnte Renée nicht sagen. Vielleicht aus dem Klassizismus? Die klare Gliederung der zweiflügligen Anlage mit dem prominenten Mittelbau, der die beiden Seitenflügel überragte, sprach dafür. Oder war das eher Neoklassizismus?
Seit sie die Zusage für den Studienplatz hatte, fragte sie sich bei fast jedem Gebäude, in welcher Epoche es gebaut worden war, denn immer, wenn sie jemandem von ihrer Zulassung erzählte, wurde sie sofort auf ihr architektonisches Wissen oder besser Vorwissen geprüft, das naturgemäß aber kaum vorhanden war, schließlich hatte sie ja noch nicht studiert.
Dennoch verunsicherten Renée solche Situationen. Hatte sie es überhaupt verdient, einen der wenigen begehrten Studienplätze für das Fach Architektur zu besetzen? In der gesamten DDR gab es pro Jahr nur einhundertzwanzig davon.
Doch! Doch, das hatte sie, redete sie sich dann immer wieder ein. Sie hatte diesen Studienplatz verdient. Sie hatte dafür sogar gekämpft. Und das gegen alle Widerstände!
Das Informationsblatt in den Studienunterlagen empfahl ihr, vom Bahnhof zu Fuß zum Jakobsplan Nr. 1 zu gehen. Dort sollte sie sich als Erstes melden, um einen Wohnheimplatz zugewiesen zu bekommen. Die Straßennamen auf der beiliegenden Wegskizze waren ihr nicht unbekannt, aber sie fand kein Straßenschild.
»Entschuldigen Sie, ist das hier die Leninstraße?«, sprach sie eine Passantin an.
»Wo wollen Sie denn hin?«
»Jakobsplan?«
Die Frau musterte sie skeptisch, dann aber gab sie Renée bereitwillig Auskunft.
»Gehen Sie geradeaus, bis da unten zur Ruine. Dort laufen Sie rechtsherum, vorbei am Gau-Forum …«
»Hier steht nichts von Gau-Forum.«
»Zeigen Sie mal her.« Die Frau schaute sich die Skizze an. »Ach, das Gau-Forum ist jetzt der Karl-Marx-Platz. Die Friedensstraße heißt aber noch so. Da gehen Sie links, und dann sehen Sie ihn schon, den Langen Jakob.« Sie bedachte Renée mit einem abschätzigen Blick. »Der ist ja nicht zu übersehen.«
Als nach etwa zehn Minuten eine elfgeschossige Neubauscheibe links von ihr auftauchte, vor der die umliegenden Häuser winzig wirkten, verstand sie, warum die Frau sie so angesehen hatte. Das Gebäude war tatsächlich nicht zu übersehen und nahm die eine Seite des Jakobsplans ein, wie der mittelalterliche kleine Platz hieß, auf dem höchstens sechs Trabis parken konnten. Davon hatte Lilo offensichtlich nichts gewusst, als sie ihr vom Jakobsplan vorgeschwärmt hatte. Lilo, die Mutter ihres Freundes Robert, hatte selbst vor gut zwanzig Jahren in Weimar studiert und ihr den Jakobsplan als einen wirklich hübschen Platz beschrieben. Doch die alten schiefen Häuschen waren auf einer Seite fort und mit ihnen auch das mittelalterliche Flair, das Renée sich für ihren neuen Wohnort erhofft hatte. Stattdessen stand dort besagter zweigeteilter Elfgeschosser, dessen Eingangsschild ihn als Studentenwohnheim der HAB, der Hochschule für Architektur und Bauwesen, auswies.
Das musste ja noch nichts bedeuten: Hier sollte sie ja nur erfahren, wo sie von nun an wohnen würde. Sicher nicht in dieser Platte mit Zentralheizung und warmem Wasser aus der Wand, in einer Art Studenten-Intensivhaltung, wie es Lilo vielleicht in Anlehnung an die Arbeiter-Intensivhaltung in den Neubauvierteln von Marzahn und Hohenschönhausen nennen würde. Lilo hatte ja gut lachen. Sie lebte in einer tollen, großen Altbauwohnung in Prenzlauer Berg, während Renée mit ihren Eltern und ihrem Bruder die letzten zwei Jahre bereits genau in so einer überheizten Scheibe gewohnt hatte, weil die kleine Zweiraumwohnung in Prenzlauer Berg für vier Erwachsene, ihr Bruder war auch schon siebzehn, mit dem Einzug des Stiefvaters zu eng geworden war.
Und nicht nur deshalb hatte Renée zum Studium nach Weimar, in die Kleinstadt, gewollt. Aufgewachsen in der Schönhauser Allee, mit einer U-Bahn vor dem Fenster und einer vierspurigen Straße mit Straßenbahnen und der S-Bahn ganz in der Nähe, hatte Renée für ihren Geschmack bereits genug Großstadtleben gehabt. Sie sehnte sich vielmehr nach einer Kleinstadt, wie sie sie aus ihren Kinderbüchern kannte, und Lilo hatte ihr Weimar genau so beschrieben. Mit windschiefen, schmalen Fachwerkhäusern, die sich entlang krummer, enger Gassen aneinanderschmiegten und gegenseitig vorm Umfallen zu stützen schienen. Mit kleinen, sich plötzlich öffnenden Plätzen dazwischen, auf denen mal eine Statue und mal ein Brunnen stand, dessen Plätschern von den Wänden widerhallte und Lilo damals in ihren ersten Nächten kaum schlafen ließ. Doch das war mehr als zwanzig Jahre her, und nun stand da diese weiße Wand.
Als Renée das geräumige Vestibül des LangenJakobs betrat, fühlte sie sich sofort an Roberts Erzählungen über die Asche erinnert, wie die meisten die Nationale Volksarmee abfällig nannten. Zwei Studentenschlangen mäanderten durch das geräumige Foyer auf einen erhöhten Glaskasten zu, von dem ein Mann übellaunig auf sie herabschaute. Das weithin sichtbare Namensschild auf seiner Brust wies ihn als Leiter des Wohnheims aus. Er war ein großer, schwerer Mann von jugendlichem Aussehen und mit noch vollem Haar, obwohl er bestimmt schon die vierzig überschritten hatte. Auf den ersten Blick konnte sich Renée leicht vorstellen, dass er bei den jungen Studentinnen noch gut ankam, aber als sie seine ersten Worte, die einem hysterischen Bellen glichen, vernahm, verwarf sie diesen Gedanken. Der Mann leitete dieses Wohnheim offensichtlich nicht wegen der Nähe zu den jungen Studentinnen, sondern weil er hier völlig unkontrolliert seine Gelüste nach Macht und Dominanz stillen konnte. Die unzähligen in ungelenker Handschrift geschriebenen Zettel, die links und rechts von seinem Guckfenster an den Scheiben klebten, enthielten ausnahmslos Befehle in fehlerhafter Grammatik und Rechtschreibung, darunter Drohungen, die beschrieben, was demjenigen blühen würde, der diese Befehle – Pfeile gaben die Richtung an, welche gemeint waren – nicht befolgte. Sie waren zusätzlich von so vielen Unterstreichungen und Ausrufezeichen flankiert, dass Renée sie im ersten Moment für Ironie hielt. Auch diesen Gedanken verwarf sie sofort, als der Heimleiter im schrillen Ton eines Zimmerspießes zusätzliche Anweisungen brüllte und – vor unbeherrschter Wut dunkelrot angelaufen – sich darüber aufregte, dass die neu hinzugekommenen Studenten nicht das taten, was er ihnen seit dem Vormittag bereits an die einhundert Mal erklärt hätte.
»Ihr Idioten begreift das einfach nicht, was?«, schrie er ein hübsches Mädchen vor seinem Glaskasten an. »Aber studieren wollen!«, höhnte er und wies sie mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger – wie einst Lenin seinen revolutionären Massen den Weg in den Kommunismus – den Weg zurück ans Ende der anderen Schlange.
»Ich war heute Vormittag noch gar nicht hier«, erwiderte das Mädchen selbstbewusst und blieb einfach stehen. »Wie soll ich da wissen, was Sie gesagt haben?«
»Dann erkundige dich gefälligst«, bellte der Wohnheimleiter zurück, »ihr quatscht doch sonst auch pausenlos.« Er zeigte erneut mit ausgestrecktem Arm auf die andere Schlange, an der sich Renée gerade angestellt hatte.
»Was meint er denn?«, wollte sie von dem Mädchen wissen, als es sich schließlich hinter ihr einreihte.
»Dass das da drüben die Schlange für die Bauingenieure und Baustoffverfahrenstechniker ist und die hier für die Architekten, Städtebauer und Gebietsplaner«, flüsterte das Mädchen so leise, dass Renée es kaum verstehen konnte.
»Ist doch egal, wenn er da vorn sowieso allein ist«, sagte Renée und schöpfte Hoffnung. Vielleicht war ihre Schlange für die, die hier nicht wohnen mussten.
»Ruhe!«, schrie der Heimleiter vorn in seiner Kanzel, und nicht nur Renée und das hübsche Mädchen, sondern auch ein paar ältere Studenten, die gerade plaudernd das Foyer betraten, verstummten auf der Stelle. Mit gesenktem Blick schlängelten sie sich an ihnen und dem Glaskasten vorbei zu den Fahrstühlen. Nur nicht seine Aufmerksamkeit erregen, schienen sie zu hoffen und mussten sich gleich doppelt gedemütigt fühlen. Einerseits durch den Heimleiter und andererseits durch die erstaunten Blicke der neuen Studenten, die sie so duckmäuserisch erlebten.
Renée hatte in der richtigen Schlange gestanden und war vom Heimleiter anstandslos, ohne seinen Zorn zu erregen, mit drei Zetteln voll weiterer Ermahnungen, der Hausordnung, einem Zimmer- und einem Briefkastenschlüssel sowie einem Packen verwaschener, labbriger Bettwäsche ausgestattet worden. Sie würde also doch hier wohnen. Was für eine Enttäuschung! Sie hatte sich vorgestellt, in einem alten schiefen Fachwerkhaus mit knarrenden Dielen und Treppen und winzigen, mit Holzläden versehenen Kastenfenstern zu leben, die zwischen den Fensterscheiben gerade mal Platz für ein verkümmertes Stiefmütterchen im Topf bieten würden. Klar, manchmal ging die Fantasie mit ihr durch. Aber sie hatte sich in einem etwas dunklen, romantisch verwinkelten Zimmer gesehen, in dem sogar sie, die nicht besonders groß gewachsen war, den Kopf wegen der zu niedrigen Geschosshöhe und den tief durchlaufenden Deckenbalken würde einziehen müssen. Hier aber, in dieser Hochhausscheibe, in der sie die folgenden fünf Jahre verbringen sollte, müsste sie den Kopf nicht einziehen, allerdings im übertragenen Sinne, wenn sie an den Befehlshaber in der Glaskanzel dachte.
Renée fuhr mit einem der beiden Fahrstühle in den fünften Stock und klopfte in einem fensterlosen Mittelgang an eine Tür mit ihrer Zimmernummer und noch drei weiteren darüber. Sie würde mit drei anderen Studentinnen zusammenwohnen, hatte der Heimleiter ihr erklärt, und alle drei waren schon seit dem Vormittag da. Niemand öffnete, und als sie aufschließen wollte, bemerkte sie, dass die Tür offen war, denn das hier war nur einer der beiden Zugänge zu ihrer zukünftigen Wohneinheit, die in einen u-förmigen Flur um eine Sanitäreinheit mit drei Waschbecken, einer Toilette und einer Dusche führte. Von hier gingen vier weitere Türen ab. Eine hatte ihre Zimmernummer. Wieder klopfte sie und betrat nach einem dreistimmigen »Herein!« den Raum. Das war die nächste Enttäuschung.
Drei Mädchen in ihrem Alter schauten ihr neugierig entgegen, zwei davon trugen diese bunten Nylon-Kittelschürzen, wie sie sich ihre Oma jedes Jahr zu Weihnachten von Renées Mutter wünschte; zwei, eine davon ohne Kittelschürze, hatten eine frische Dauerwelle, die dritte Naturlocken. Sie stellten sich ihr als Susi, Marion und Ulrike vor.
»Und wie heißt du?«
Diese Frage fürchtete Renée stets mehr als die Möglichkeit, für ihr Gegenüber eine Namenlose zu bleiben. Es war jedes Mal aufs Neue eine Überwindung, also nuschelte sie ihren Namen und hoffte, dass die anderen darüber hinweggingen.
»Wie?«
Was hatte sich ihre Mutter nur dabei gedacht, ihr einen solchen Namen zu geben? Ihren Vater konnte Renée von jeder Schuld freisprechen. Er war damals bei der Armee gewesen und hatte weder gewusst, dass seine junge Frau nur einen Jungennamen für die Geburt ihres ersten Kindes parat hatte, noch hatte er geahnt, was aus diesem Namen geworden war, nachdem Renée die Hoffnungen der Mutter auf einen Jungen so bitter enttäuschte. Diese Enttäuschung spielte in einer Anekdote zu ihrer Namensgebung, die Renées Mutter gern auf Familienfesten zum Besten gab, eine deutlich größere Rolle als Renées seltsamer Vorname selbst und wie sie zu ihm gekommen war. An den von ihrer Mutter vorbereiteten Namen für einen Sohn ein weiteres E anzuhängen, »für das, was sie als Mädchen nicht hat«, habe ihr nämlich der Arzt mit etwas anzüglichem Unterton vorgeschlagen, was Renées Mutter ebenso anzüglich auf den vielen Familienfesten nachahmen konnte und gern auch wiederholte, einmal, zweimal, bis es denn auch der letzte Idiot kapierte und das Gelächter endlich alle überkam, sogar Renée, die aus irgendeinem Grund lange Zeit stolz auf diese Anekdote gewesen war. Bis dann eine neue angeheiratete Tante nicht mitlachte, sondern Renée voller Mitleid betrachtete und sagte: »Aber das ist doch schrecklich!«
»Ist das nicht ein Jungenname?«, fragte Ulrike jetzt wie so viele vor ihr, auch die beiden anderen Mädchen blickten irritiert, und Renée erwiderte reflexartig das, was sie schon an die tausend Mal in ihrem kurzen Leben erklärt hatte: »Nein, ein Mädchenname, weil ich mit zwei E geschrieben werde.«
Die drei schauten verständnislos.
»Also mit drei insgesamt.« Diese Information machte es selten besser, verhinderte jedoch weiteres Nachfragen. Die kollektive Rumpelkammer-Erinnerung an Heinz Rühmanns Ausspruch »Pfeiffer mit drei F« füllte still den Raum, was Renée zu nutzen verstand: »Und woher kommt ihr so?«
Alle drei stammten aus der Nähe von Leipzig, aus verschiedenen Kreisstädten, also Kleinstädten, von denen sie noch nie etwas gehört hatte, außer vielleicht dem Geburtsort von Ulrike, da klingelte etwas bei ihr:
»Da kommen die Kekse her«, fiel Renée ein, und Ulrike nickte erfreut. Wurzener Dauerbackwaren waren ein Begriff in der Republik, und vielleicht hatte Ulrike ja Beziehungen und konnte diese feinen schokolierten Waffelblättchen oder gar die Wurzener Gebäckmischung besorgen.
»Ja, hoi, Altenburg ist auch bekannt«, sagte Marion, und eine kleine Pause entstand. »Für Spielkarten«, half sie aus. »Für Skat. Rommé. Doppelkopf. Bridge«, zählte sie nicht ohne Stolz auf, worauf nun alle Susi ansahen: Was zeichnete ihre Heimatstadt aus?
»Und du bist aus Berlin«, stellte Susi stattdessen mit einem Lächeln fest, und Renée nickte vage. Gleich nach ihrem Vornamen hätte sie auch gern ihre Herkunft noch etwas für sich behalten, aber sie berlinerte nun mal, so wie diese Kleinstadtmädchen eben sächselten. Berlin, die Hauptstadt der DDR, kannten sie natürlich, da waren sie mit ihrer Klasse bestimmt zur Jugendweihe gewesen, sicherlich auch auf dem Fernsehturm, doch wahrscheinlich erinnerten sie sich gerade daran, wie sie mit einer Liste ihrer Verwandten durch die Geschäfte gerannt waren, um all das einzukaufen, was es sonst nicht in der Republik gab. Oder warum musterten alle drei sie jetzt so unverhohlen neidisch? Sollte sie ihnen irgendetwas beschaffen, oder entsprach sie nicht dem Bild, das sie von den großmäuligen Berlinerinnen hatten?
»Du schläfst oben«, unterbrach Ulrike Renées Überlegungen, »und das da sind dein Schrank und dein Tisch.«
Fünf Jahre würde sie mit diesen drei Mädchen zusammenwohnen. Fünf lange Jahre zu viert auf zwölf Quadratmetern mit zwei Doppelstockbetten, vier doppeltürigen Schränken, vier quadratischen Sprelacat-Tischen so groß wie ihr A1-Reißbrett. Dazu vier Stühle und vier Regalfächer, die jeweils über den Tischen an der Wand hingen. Damit war das Zimmer voll, übervoll, man konnte sich kaum um die eigene Achse drehen, wie Renée entsetzt realisierte, besonders wenn alle Bewohnerinnen wie jetzt gleichzeitig im Raum herumstanden. Renée überschlug schnell, wie viele Quadratmeter Grundfläche allein durch die nicht beweglichen Möbel wie Betten, Tische, Schränke belegt waren, und kam auf gut neun Quadratmeter, von denen folglich drei zum Stehen und Laufen blieben. Das jedoch nur, wenn die Stühle unter die Tische geschoben wurden. Saßen sie auf ihren Stühlen, war noch weniger Platz.
Erschwerend kam hinzu, dass sie alle vier nicht nur im selben Studienjahr, sondern auch noch in derselben Seminargruppe waren. Das bedeutete, dass sie immer zur selben Zeit Vorlesungen und Seminare hätten, zur selben Zeit würden aufstehen und losgehen müssen, also kurz gesagt auch immer zur selben Zeit in diesem winzigen Zimmer anwesend oder abwesend sein würden. Dagegen war ihr Zimmer in Berlin der pure Luxus, geradezu ein Palast, wenn auch nur neun Quadratmeter groß, so doch ein Zimmer für sie allein, während sich ihre Eltern weiterhin jeden Abend mit der Klappcouch mühten, Tisch und Sessel beiseiteräumten und das Wohnzimmer zum Schlafzimmer umbauten, nur damit sie und ihr Bruder je ein eigenes Zimmer hatten.
Panik stieg in Renée auf. Wie sollte sie das nur aushalten? Wie sollte sie hier überhaupt…
»Keine Angst, am Wochenende fahren wir immer nach Hause«, sagte Susi schelmisch lächelnd. Offensichtlich konnte sie wie Renées Mutter Gedanken lesen.
Marion und Ulrike nickten zustimmend und erklärten, dass Weimar zum Glück nur etwas mehr als eine Bahnstunde von ihrem jeweiligen Zuhause und ihren Verlobten entfernt lag. Sie würden deshalb selbst an jedem zweiten Samstag, an dem sie laut Studienplan bis 13 Uhr Vorlesungen hätten, fürs restliche Wochenende nach Hause fahren.
Die drei waren bereits verlobt? Und kannten schon den Studienplan? Renée erfasste neuerliche Panik. Würden ihre anderen Kommilitonen ebenfalls Kittelschürzen und Dauerwelle tragen und verlobt sein? Renée kannte niemanden sonst in ihrer Altersgruppe, der verlobt war, geschweige denn Kittelschürzen trug. Nicht mal ihre Mutter war noch verlobt gewesen. War auch keine Zeit mehr dazu. Auf dem Hochzeitsfoto ihrer Eltern war deutlich der gewölbte Bauch unterm Spitzenkleid zu erkennen, der der eigentliche Grund für die vorschnelle Vermählung gewesen war. Renée würde jedenfalls niemals heiraten, das war spießig!
Dennoch beruhigte sie die Vorstellung, das Zimmer ein bis zwei Abende pro Woche für sich zu haben. Auf keinen Fall würde sie ständig nach Berlin fahren, schon gar nicht gleich am ersten Wochenende, obwohl sie hier noch niemanden kannte. »Frühestens in sechs Wochen, vielleicht auch noch später«, hatte Renée ihrer Mutter und auch Lilo angekündigt, denn sie wollte das Studentenleben an den Wochenenden in vollen, aber nicht in überfüllten Zügen genießen.
Doch schon an ihrem ersten Abend im Wohnheim fragte sich Renée, ob es nicht ein riesiger Fehler gewesen war, dass sie sich für Weimar entschieden hatte. Denn nicht nur das Wohnheim hatte so gar nichts mit dem Bild gemein, das sie sich zuvor von ihrer Unterkunft gemacht hatte, auch ihre Mitbewohnerinnen und neuen Kommilitoninnen waren kein bisschen anders als die Mädchen aus ihrer Abiturklasse, die sich nur für die neuesten Schlager und wo es was zu kaufen gab interessierten, und denen hatte sie doch entkommen wollen. Diese Mädchen hier unterschieden sich von ihren alten Klassenkameradinnen nur im Dialekt, den Renée zwar nach mehreren Wiederholungen zunehmend besser verstand, der die Dinge jedoch durch eine ungewöhnliche Wortwahl inhaltlich zu verdrehen schien. Schon in den ersten Stunden reizte es sie zu Widerspruch und Korrektur.
»Machen ma ma in die Stadt nei?«, hatte Ulrike gefragt und damit offenbar einen Bummel durch die Stadt vorgeschlagen, obwohl der Lange Jakob mitten in Weimar, also in der Stadt, stand. Da aber Marion sofort mit einem beherzten »Ja, hoi!« zustimmte, das anscheinend dem berlinerischen »Klar, wa!« entsprach, und Susi auch nichts entgegnete, schluckte Renée ihren Einwand herunter und beschloss, zunächst im Erdgeschoss ihre Fachbücher abzuholen und danach die Reisetasche auszupacken.
Als die Tür zehn Minuten später hinter den dreien zuschlug, atmete Renée erst einmal durch und genoss die Leere des Zimmers. Wie oft würde sie in den nächsten Jahren solche Momente des Alleinseins wohl haben? Und würden die Wochenenden überhaupt ausreichen, sich zu erholen? Anstatt sich die offensichtliche Antwort einzugestehen, wagte sie einen Blick aus dem Fenster, das fast die gesamte Breite des Zimmers einnahm.
Die Aussicht auf Weimar, wenn auch nur aus der fünften Etage, war immerhin keine Enttäuschung. Vor ihr lag die von ihr ersehnte Bilderbuchkleinstadt mit krummen Häuserreihen und verwinkelten Straßenzügen, überspannt von buckligen, rot geschuppten Dächern in allen Farbnuancen, dazwischen ein schiefergedeckter Kirchturm, der sich über grünen Baumkronen erhob, die wahrscheinlich ein paar verfallenen Grabsteinen auf dem zur Kirche gehörenden Friedhof Schatten spendeten. Weiter rechts, weit im Hintergrund, das musste der Ettersberg mit dem Glockenturm des KZs Buchenwald sein. Und direkt unter ihr befand sich der winzige Parkplatz, der Jakobsplan, um den sich eng an eng ein paar Häuser duckten. Sie wohnte nun zwar in einer Neubauscheibe, aber sie hatte von hier aus den besten Blick auf die Stadt und musste nicht auf diese hässliche Wohnscheibe selbst schauen wie etwa die Menschen in den Häuschen da unter ihr, deren Aussicht für immer verstellt war. Wer war nur auf die Idee gekommen, mitten in die Altstadt solch einen riesigen Plattenbau zu setzen? Sie würde so etwas jedenfalls nie zulassen, wenn sie erst selbst Architektin wäre und das zu entscheiden hätte.
Beim gemeinsamen Abendbrot auf dem Zimmer erfuhr Renée, dass Susi und Ulrike bereits seit der zehnten Klasse mit ihren jeweiligen Verlobten zusammen waren, und Hois Verlobter – so nannte sie Marion bereits heimlich für sich, weil sie das Wort Hoi ständig benutzte – war sogar eine Buddelkastenliebe. Er war ein Jahr älter als Hoi und bei den Fallschirmspringern, eine der gefürchtetsten Eliteeinheiten der Armee mit hohen Anforderungen an Gesundheit, sportlichem Vermögen und politisch korrekter Überzeugung, die offensichtlich auch schon auf Hoi abgefärbt hatte.
»Ja, hoi, für eine gute Stelle würde ich auch in die Partei eintreten«, meinte sie zwischen zwei Bissen Brot, weil sie Renées ironischen Unterton nach der Gesinnung ihres Verlobten anscheinend nicht herausgehört hatte. Vielleicht zum Glück, denn wie konnte Renée nur annehmen, dass Hoi nicht hinter dem stand, was ihr Verlobter bekanntermaßen verkörperte: eine Kampfmaschine für den Sozialismus. Sie alle starrten Hoi für ihre freimütige Aussage entsetzt an. Doch es verbot sich von selbst, darauf zu antworten, es sei denn, man war klar der gleichen Meinung, und das waren Susi und Ulrike offenbar nicht.
Nachdem Renée ebenso wie die anderen brav ihre Tasse, ihr Besteck und den Teller abgewaschen hatte, zog sie sich zum Rauchen in den Waschtrakt zurück, wo sie aber nicht lange allein blieb. Plötzlich in Schlafanzug und Flatterhemd nahmen Susi, Ulrike und Hoi vor den drei Waschbecken Aufstellung und ließen sich Wasser ein, während Renée erstaunt auf ihre Armbanduhr linste. Hatte sie sich getäuscht …? Nein, es war wirklich erst kurz vor 19 Uhr! Wollten die drei etwa schon ins Bett gehen? Am ersten Abend ihres neuen, aufregenden Studentenlebens? Da konnten sie doch nicht schlafen gehen!
Doch, sie konnten. Aber nicht ohne vorher ausgiebig die Waschlappen für oben und unten zu benutzen, auch Yvette intim. Renée saß rauchend auf dem Hocker im Sanitärtrakt und schaute ihnen, Qualm in die Luft blasend, verwundert zu, wie sie Arien in den höchsten Tönen gurgelten und sich unten herum schrubbten, als gäbe es kein Morgen, als säße ihnen der Feind direkt zwischen den Beinen oder etwas, das da auf jeden Fall auszumerzen war. So gereinigt – und vermutlich, ohne einen einzigen erotischen Gedanken an ihre Verlobten zu verschwenden – stiegen sie ins Bett und packten ihr Strickzeug aus, kein neues, sondern eins, an dem sie offenbar schon Wochen werkelten. Dazu dudelte aus Hois mitgebrachtem Kofferradio DT64, der einzige Jugendsender des Landes, und das schon seit Renées Ankunft.
War es möglich, dass die drei ihr bisheriges heimatliches Leben hier einfach nur fortzusetzen gedachten?, fragte sich Renée erschüttert. Dass sie all ihre Gewohnheiten mit nach Weimar gebracht hatten und nichts davon ändern wollten?
Renée hatte keines der Mädchen dazu überreden können, mit ihr noch »in die Stadt nei zu machen«, auf ein Glas Wein oder – ja auch das schlug sie vor – auf eine Limonade. Deshalb versuchte sie zu lesen, aber die Musik störte den Leserhythmus von Hundert Jahre Einsamkeit, dem Roman von Márquez, den ihr Robert zum Abschied geschenkt hatte, und überhaupt nervte Renée die Mucke. Noch nie hatte sie an einem einzigen Tag so viel DDR-Musik gehört wie an diesem. Die drei kannten sämtliche Rockgruppen, politische Liedermacher und besonders die schnulzigen Schlagersänger der DDR und hatten am Nachmittag jedes Mal lustvoll aufgestöhnt, wenn einer ihrer Lieblinge im Radio angekündigt wurde. Renée fand das befremdlich, und sie fühlte sich im Beisein der drei geradezu absonderlich und nicht dazugehörig. Ein paar dieser Lieder kannte sie natürlich auch, manche davon mochte sie sogar. Wenn man in der DDR aufwuchs, kam man ja nicht drum herum, überall in den Kneipen, Betriebsgaststätten, Kulturhäusern und Diskotheken war 60/40 vorgeschrieben: Sechzig Prozent Ostlieder, und nur vierzig Prozent durften maximal aus dem Westen, aus dem nichtsozialistischen Ausland, sein. Dabei hörten Renée und ihre Eltern in Berlin nur RIAS oder SFB, doch hier in Weimar würde man diese Sender wohl kaum empfangen.
Er war jedenfalls unerträglich gewesen, dieser erste Abend ihres neuen, aufregenden Lebens mit diesen drei Kleinstadt-Mädchen auf einem Zimmer! Deshalb zog sich Renée, als Hoi um 20 Uhr ihr Radio und das Licht ausschaltete, in die gemauerte Duschecke des Sanitärtrakts zurück. Zwar maß diese nur achtzig auf achtzig Zentimeter und war mit ihren von Kalk und schwarzem Schimmel überzogenen ehemals orangenen Kacheln nicht gerade einladend, aber dieser winzige, schlecht beleuchtete Raum gab Renée nach einem Abend zu viert auf zwölf Quadratmetern immerhin das Gefühl, für einen Moment für sich zu sein.
Das war natürlich eine Illusion, ein unerfüllbarer Wunsch, denn kaum hatte Renée ihr Buch ausgepackt und sich darin vertieft, wollte ein älteres Mädchen aus einem der Nachbarzimmer des Wohntrakts duschen. Bestimmt hatte es durch die kalten Betonwände hindurch gespürt, dass Renée sich schon am ersten Tag vom Kollektiv entfernen wollte und schleunigst zurückgeholt werden musste. Renée blieb nur, schlafen zu gehen oder zu fliehen. Deshalb war sie dann doch noch »in die Stadt ’nei’ gegangen«, war durch die dunklen herbstlichen Gassen gelaufen und hatte sich schließlich todunglücklich an einem Brunnen niedergelassen, über dessen Becken eine bronzene Mutter mit zwei Kleinkindern thronte. Niemals hätte Renée gedacht, dass sie sich schon an ihrem ersten Abend zurück in die Hupe sehnen würde, der kleinen Bar am Alex, in der sie sich seit der elften Klasse jeden Samstagabend mit ihrer Clique gleich nach der Muppet-Show getroffen hatte. Was hatte sie nur getan? Wieso hatte sie unbedingt in Weimar studieren wollen?, fragte sie sich auf den Stufen des Brunnens sitzend. Wieso war sie nicht nach Dresden gegangen, wo sie ebenfalls die Eignungsprüfung bestanden hatte? Das war wenigstens eine Großstadt, zwar auch hinterm Mond, weil ohne jeden Westempfang ein Tal der Ahnungslosen, aber immerhin eine Großstadt. Oder wäre sie doch am besten gleich in Berlin geblieben!
Nein, Berlin war keine Option gewesen. Keine einzige Woche länger hätte sie es mit ihrer Mutter unter einem Dach ausgehalten, das wäre nicht gut gegangen. Klar, Renée hätte sich alternativ irgendwo in Prenzlauer Berg eine leer stehende, heruntergekommene Wohnung suchen und sie besetzen können, so wie es Robert getan hatte, weil er eben auch nicht so gut mit seiner Mutter auskam, was Renée überhaupt nicht verstehen konnte. Sie hätte Lilo sehr gern zur Mutter gehabt.
Auf dem Weg zurück zum Wohnheim musste Renée falsch abgebogen sein, denn plötzlich stand sie auf der Schillerstraße, einem Fußgängerboulevard, wie sie in den letzten Jahren fast in jeder Stadt entstanden waren, um das Einkaufen – in der Mangelwirtschaft – zu einem noch größeren Erlebnis werden zu lassen. Renée geriet trotzdem nicht in Panik. Sie war davon überzeugt, dass sie recht schnell auf die Neubauscheibe treffen, sie zumindest von vielen Punkten in der Stadt aus sehen müsste, denn gerade im Dunkeln würden all ihre Fenster hell erleuchtet sein. Wie immer täuschte sie sich. Obwohl sie sich in ihrem bisherigen Leben schon mehrmals verlaufen hatte, erinnerte sie sich in den Momenten, in denen sie neue Wege beschritt, nie daran, dass sie sich fast immer um 180 Grad in der Richtung täuschte, also das Ziel in genau entgegengesetzter Richtung vermutete. Es war eine Art genetischer Geburtsfehler, ein Webfehler, wie ihre Oma das nannte.
So irrte sie auch an ihrem ersten Abend durch die ihr noch fremde Stadt, bog mal links, mal rechts in irgendwelche verwinkelten Gassen ab, überzeugt davon, dass sie schon nach der nächsten Biegung das Wohnheim über den Dächern am Himmel entdecken würde, so wie in Berlin den Fernsehturm, der ihr oft den Weg nach Hause gezeigt hatte. Doch hier in Weimar war der Himmel schlicht schwarz, dichter Nebel hing über den Straßen und schluckte alles, das Licht, die Geräusche, anscheinend sogar die Bewohner. Da war niemand, den sie nach dem Weg hätte fragen können, die Straßen waren wie leer gefegt. Dabei war es nicht mal 21 Uhr!
Aber plötzlich war da Musik. Schöne Musik. Selbstgemachte Musik, allem Anschein nach sogar Live-Musik. Denn das, was Renée da über den kleinen Platz in musikalischen Fetzen entgegenwehte, war nicht die Band Jethro Tull, nicht der echte Ian Anderson, der locomotiv-breath zum Besten gab, es war nur einer seiner vielen Nachahmer, doch ein sehr guter. Renée kannte das Lied, die Platte, auf dem der Track zu finden war, in- und auswendig, Robert hatte sie von seiner West-Oma vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und in den vergangenen Jahren hatte Renée genügend Nachahmer auf Feten, Aula-Festen und Jazz-Sessions gehört und gesehen, am ehesten war ihnen allen das Stehen auf einem Bein gelungen, nicht jedoch das pochende, pulsierende Flötenspiel, dessen Klänge sie nun hörte.
Die Töne kamen aus einem dicken runden, mittelalterlichen Turm, auf dessen Hof sie irgendwie geraten war. Vor ihr ein Kolonnadengang, der den Hof zu einer größeren Straße hin begrenzte, wo gerade ein O-Bus, den gelenkigen Arm an der Oberleitung, nebelgedämpft vorbeischnurrte. Die Tür des Turms, eine ungewöhnlich modern wirkende Stahltür, stand offen, was Renée als Einladung hineinzugehen verstand.
»Halt, halt, halt!«, rief ein Junge mit fusseligem Bärtchen, der neben der Tür auf einem Hocker saß, und zog sie an ihrer Jacke zurück zu sich heran. »Das ist ein Studentenklub, Zutritt erst ab achtzehn.«
Wie sie das hasste! Auch das noch! Zum Glück hatte sie vorsorglich ihren Ausweis eingesteckt, weil sie noch Zigaretten brauchte und es ihr in den Kneipen schon mehrmals passiert war, dass man ihr keine gab. »Zigaretten gibt es schon ab sechzehn«, belehrte sie die Verkäufer dann jedes Mal, aber die antworteten nur »Eben!« und gaben ihr keine.
»Ich hätte dich auf fünfzehn geschätzt«, sagte der Student, nachdem er ihr Geburtsdatum gesehen hatte.
Es war so entwürdigend. Dabei war sie schon neunzehn! »Na, auf dem Foto siehst du jedenfalls älter aus.«
»Da war ich vierzehn, als das gemacht wurde«, erwiderte sie, aber der Typ ließ sie trotzdem nicht durch, sondern verglich weiterhin grinsend ihr Lichtbild mit ihr, dem Original.
»Kann ich nun rein?«
»Und dein Studentenausweis?«
Sie holte tief Luft. Der lag auf dem Bücherstapel im Wohnheim. Warum hatte sie ihn nicht auch eingesteckt?
»Weißt du deine Matrikel?«
»Hä?«
Er rollte genervt die Augen. »Welche Fachrichtung?«
»Architektur?« Kaum ausgesprochen, verfluchte sie sich für das Fragezeichen, doch es schien ihn nicht zu stören.
»Architektur ist Sektion 1«, belehrte er sie, »und wir haben 1979. Also lautet deine Matrikel 1/79/…?«
»C!«, fiel ihr ein, während das Flötenspiel drinnen leiser und leiser wurde und schließlich verstummte.
»C ist dann deine Seminargruppe.«
»Ach so, und ich dachte, die Eins steht für erstes Studienjahr.«
»Quatsch, dann hättest du ja jedes Jahr ’ne neue Matrikel.« Er winkte sie ungeduldig mit der Hand durch, als stünden hinter ihr noch andere, die es zu kontrollieren galt.
»Und ich habe geglaubt, Architekten könnten logisch denken«, murmelte er in ihrem Rücken. Er ist selbst also keiner, dachte Renée. Aber das behielt sie besser für sich. Applaus und vereinzelte bewundernde Rufe und Pfiffe drangen aus der Tiefe des Gebäudes an ihr Ohr. Der Track war leider vorbei.
2. HOFFNUNG
Wenig später schaute Renée von ein paar Stufen herab in einen kreisrunden, ziemlich verqualmten Gewölbekeller, in dem mehrere Leute in lockeren Grüppchen mit gläsernen Bierhumpen herumstanden und sich angeregt unterhielten. Das war also der Studentenklub Kasseturm, Lilo hatte ihr auch von ihm vorgeschwärmt, von den Festen, den Konzerten, den Lesungen, und erzählt, dass sich hier früher vorzugsweise die Architekturstudenten getroffen hatten. Das Gewölbe war aus grob behauenen Quadern gemauert, und unter der Decke hingen alte, verbeulte Emailleschilder mit den bekannten Aufforderungen, die Schuhe sauber abzuputzen, die Hausordnung zu beachten und die Türen geschlossen zu halten. Oder mit den üblichen kategorischen Verboten gegenüber Hausierern, Musikanten und Bettlern. Solche Schilder hatte auch Robert in seiner Bude an den Wänden hängen. Auf nächtlichen Streifzügen heimlich aus den alten Hauseingängen der Mietskasernen in Prenzlauer Berg abgeschraubt und in witzigen Zimmerschmuck umfunktioniert, manchmal auch an Leute verhökert, die sich selbst nicht trauten, sie zu klauen.
Zu ihrer Rechten befand sich ein hoher, langer Tresen. In einer Art Nische, die das meterdicke Mauerwerk des Turms offenbarte, war ein kleines Podium eingebaut, darauf ein verlassenes Schlagzeug, und ein paar Gitarren und Rasseln lagen auch herum. Großartig bewegen würden sich die Musiker auf der kleinen Bühne nicht können. Auf einem Bein stehen schon.
Renée wusste nicht, was sie tun sollte. Sie konnte nicht ewig hier oben auf dem Absatz stehen bleiben und im wahrsten Sinne des Wortes auf die anderen herabschauen. Sie wollte unbedingt da runter, doch sie kannte niemanden und bis zum Ausschank am Tresen erschien es ihr unendlich weit. Sie müsste sich durch all die lässigen Leute schlängeln und darum bitten, sie vorbeizulassen. Bestimmt würde man sie wie einen Fremdkörper anstarren, wenn man sie überhaupt eines Blickes würdigte, feindlich und abweisend. Was will die denn hier?
Vor lauter Aufregung begann sie zu schwitzen. Sie hatte das noch nie gekonnt, unter Beobachtung anderer etwas zu tun, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Deshalb war sie beim Sport gescheitert, bei dem sie vor einer Schwimmhalle voller Zuschauer ganz allein einen Sprung hatte vorführen müssen. Und deshalb konnte sie auch nicht vorsingen oder gar Gedichte in der Öffentlichkeit rezitieren. Allein die Vorstellung, auf einer Bühne zu stehen, ließ ihre Haut heiß werden und kribbeln, und sie bekam butterweiche Knie. In der Schule war ihr sogar regelmäßig die Stimme versagt, wenn der Chorleiter sie bei der Probe nur angesehen hatte. Jedes Mal glaubte sie, dass das ein Hinweis war, zu laut oder falsch zu singen, und sie rechnete fest damit, hinterher zu ihm gerufen und rausgeschmissen zu werden.
Irgendwann sah sie endlich eine Chance, unbeobachtet zum Ausschank zu gelangen. Hinter ihr war ein Mädchen aus den Toiletten gekommen und wahnsinnig selbstsicher an ihr vorbei die Treppe hinunter in den Keller gegangen. Sofort richteten sich alle Augen auf sie, folgten ihr zu einem Grüppchen Männer, anscheinend die Musiker, denn einer hatte ein Mundharmonikagestell um den Hals und ein anderer einen Gitarrengurt quer über der Brust hängen. Sollten sie nicht eigentlich diejenigen sein, die von den anderen bewundert und ehrfürchtig angestarrt wurden?
Renée setzte sich in Bewegung, nahm Stufe um Stufe hinab in den Keller, das Herz schlug ihr bis zum Hals. Doch alle Blicke waren weiterhin nur auf eine einzige Person gerichtet, auf das schlanke, brünette Mädchen, das sich zu den Musikern gestellt hatte. Sie war in Renées Alter und hatte, wie Renée jetzt vom Tresen aus sehen konnte, sehr ebenmäßige Züge in einem hübschen ovalen Gesicht, das ganz offensichtlich das Objekt der Begierde aller Anwesenden war, besonders von einem der Musiker. Er kroch fast in das Mädchen hinein, während es ihm aufgeregt etwas zu erklären versuchte, dazu wild mit seinen schönen, schmalen Händen gestikulierte und jedes Mal hell auflachte, wenn der Musiker ihr etwas ins Ohr flüsterte. Dabei warf das Mädchen übermütig den Kopf nach hinten und zeigte eine Reihe gerader, strahlend weißer Zähne und zartes rosa Zahnfleisch, rollte aber gleichzeitig belustigt die Augen, als würde der Musiker kompletten Nonsens von sich geben.
Das Mädchen war der faszinierende Mittelpunkt des Kellers, links und rechts hätten Bomben niedergehen können, keiner hätte es mitbekommen, und alle, einschließlich Renée, schauten gebannt auf dieses Mädchen, das sich so ungezwungen mit den Musikern unterhielt. Renée konnte gar nicht anders, als wieder einmal diesen Neid zu spüren, der sie häufig beim Anblick solch gut aussehender, selbstbewusster Mädchen überkam. Wie mochte es sich wohl anfühlen, so makellos, so anziehend, sich seiner selbst so sicher zu sein und damit die Aufmerksamkeit sämtlicher Männer zu erregen?
Renée wollte jedoch nicht mehr neidisch sein. Schließlich war sie jetzt selbst jemand, der zu beneiden war. Eine Architekturstudentin. Bald schon würde sie Häuser entwerfen und auch bauen. Sie hatte immerhin ihren Traum gegen den großen Widerstand ihrer Lehrer und deren Planzahlen durchgesetzt. Architekten bräuchte der Sozialismus nicht, hatten sie allesamt behauptet, Lehrerinnen oder Offiziere hingegen schon.
Auch ihre Mutter war anfangs von ihrem Berufswunsch nicht begeistert gewesen. Sie hätte es viel lieber gesehen, wenn Renée eine Friseurin geworden wäre, sodass sie nicht jedes Mal erneut um einen Termin »bei diesen hochnäsigen Friseusen« betteln müsste. Nun aber schien sie stolz auf sie zu sein, hatte mit Renées Studienplatz im Friseursalon angegeben, und wenn es Renée genau bedachte, hatte ihre Mutter ihr mit dem ungeliebten Vornamen sogar ein bisschen dabei geholfen.
Renée hatte endlich ein Bier in der Hand. An dem würde sie sich festhalten, bis die Aufregung in ihrem Körper nachließ. Sie suchte sich einen Platz am Rand des Kellers, von dem sie einen guten Überblick hatte, und schaute sich um. Erstaunt betrachtete sie die Schlipse und seidenen Krawatten, die zwischen den verbeulten Emailleschildern von der Decke hingen, und überlegte, was es damit auf sich hatte. Das wäre vielleicht eine Frage, über die sie mit dem Mädchen dort ins Gespräch kommen könnte, wenn die Musiker wieder zu spielen begannen. Doch da sah sie, dass das Mädchen den Musikern auf das Podium folgte und die Querflöte zur Hand nahm. Es blickte sich lächelnd nach dem Schlagzeuger um, nickte ihm zu, offensichtlich das Zeichen für ihn, den Takt einzuzählen. Dann holte es tief Luft, setzte die silberne Flöte an die Lippen und blies, wie Ian Anderson höchstpersönlich, hinein. Nicht nur Renée war sofort verzaubert. My God, sie improvisiert tatsächlich My God, dachte Renée. Niemals hätte sie gedacht, dass eine Frau so gut Flöte spielen konnte!
Wahrscheinlich war sie eine Musikstudentin. Ein Junge aus Renées Parallelklasse hatte sich damals an der Musikhochschule Weimar beworben und war nicht angenommen worden, obwohl er in der Schule lange Jahre als Wunderknabe an der Geige galt. Dieses Mädchen hier hatte die Aufnahmeprüfung bestimmt mit Leichtigkeit bestanden und die Aufnahmekommission sofort in ihren Bann gezogen, nicht nur mit ihrem Spiel, sondern mit ihrem ganzen Wesen. Ihr Körper bog sich zu den Flötentönen so leicht und folgerichtig, als bestünde er statt aus Knochen und Muskeln aus einem besonderen Stoff, durch den die Musik wie Wasser hindurchfloss.
Der Applaus war gewaltig. Weitere Zugaben wurden gefordert. So spielten die Musiker mehrmals erneut locomotiv breath an, um sich gleich darauf wieder zu verneigen. Aber der Applaus wurde nur stärker und forderte erneute Zugaben, bis das Mädchen einfach ihre Querflöte auseinanderdrehte und die sich darin angesammelte Spucke unter allgemeinem Gelächter und Gegröle demonstrativ in einen leeren Bierhumpen kippte. Der Gewölbekeller hatte sich weiter gut gefüllt, und Renée fragte sich, wieso so viele zu spät zu diesem Konzert gekommen waren. Doch es stellte sich heraus, dass das gar kein Konzert war, sondern nur eine für alle offene Probe, bei der sich jeden Sonntagabend Studenten in anderer Zusammensetzung trafen, um gemeinsam zu musizieren.
»Jeder, der ein Instrument spielen oder singen kann, ist eingeladen«, sagte der Bassist ins Mikrofon und sah zu einem blonden, schlaksigen Typ am Tresen, neben dem ein Geigenkasten lag.
»Nee! Danke, ich verzichte, blamier mich doch nicht freiwillig nach so ’ner professionellen Nummer«, erklärte er abwinkend, und alle johlten auf, während das Mädchen mit ihrem Flötenetui unter erneutem Jubel und Geklatsche vom Podium stieg und sich zum Ausschank begab. Der Junge hinterm Tresen zeigte auf ein paar Humpen frisch gezapften Biers, die bereits auf die Musiker warteten.
Renée versuchte, das Mädchen im Auge zu behalten, sie war wie gefesselt, konnte sich einfach nicht losreißen, aber es war inzwischen so voll, dass ihr die Leute den Blick verstellten. Deshalb drängelte sie sich, nun schon mutiger, zur Treppe durch. Zwei Stufen über dem Boden hatte sie wieder einen guten Überblick auf den Raum und den Tresen, wo das Mädchen gerade mit großer Geste einen halben Liter Bier hinunterstürzte, als hätte sie tagelang nichts getrunken. Und gleich darauf nahm sie ein weiteres Bier in Angriff. Dafür bekam das Mädchen ebenfalls anerkennende Pfiffe, und als würde sie das noch mehr anfeuern, griff sie nach einem dritten Humpen und nahm einen tiefen Zug, trank ihn aber diesmal nicht vollends aus, sondern knallte das halb volle Glas so fest auf den Tresen, dass ein Teil seines Inhalts überschwappte. Anschließend wischte sie sich mit großer Geste, also mit dem Handrücken, den imaginären Schaum von der Oberlippe, als ahmte sie Hans Albers in der Großen Freiheit nach, und dann … dann rülpste sie laut.
Einen Moment erstarrten alle irritiert, weil das so gar nicht zu diesem zarten, wirbellosen Wesen, das wie eine Elfe Flöte spielte, zu passen schien. Auch Renée glaubte, es wäre ihr aus Versehen rausgerutscht – wie peinlich, sie selbst würde vor Scham im Erdboden versinken! –, aber das Mädchen lachte nur schallend und leerte schließlich auch den dritten Humpen bis auf den letzten Tropfen.
Renée hatte noch nie ein Mädchen so viel und so schnell Bier trinken sehen – sie selbst hielt sich immer noch an ihrem ersten Glas fest. Gleich beim ersten Schluck hatte sie festgestellt, dass das Weimarer Bier im Gegensatz zum Berliner Pilsner fade und dünn wie Plörre schmeckte. Doch das Erstaunlichste war, dass dem Mädchen das Bier, es waren immerhin anderthalb Liter gewesen, überhaupt nichts anzuhaben schien – Renée wäre nach solch einer Menge sturzbetrunken gewesen und hätte nur noch gelallt. Aber das Mädchen sprach sehr ruhig und ernsthaft mit dem Bassisten über ihre Musikvorlieben. Renée konnte das auf ihrem Stehplatz klar und deutlich hören, denn der Schall nahm den Weg über die gewölbte Decke zu ihrem Ohr. Es interessierte sich vorrangig für Jazz, besonders Free-Jazz, sagte es, während der Bassist ihren Körper eingehend taxierte und anscheinend darüber nachdachte, wie er sie in sein Bett bekommen könnte. Und das Mädchen nannte Namen, die Renée nicht unbekannt waren. Gumpert, Sommer, Bauer, Petrowski. Sie hatte alle schon in Free-Jazz-Konzerten gesehen.
Das waren auch Renées Idole. Wegen ihnen war sie in den letzten drei Sommern mit Robert und ihrer Clique nach Peitz getrampt, und erst im Juni war sie mit einer Freundin dort zum ersten Open-Air-Konzert gewesen. War sie dem Mädchen vielleicht auf der großen Wiese vor der Bühne begegnet?
Die anderen Musiker stellten sich nun zu dem Bassisten und bekamen von den Jungs hinterm Tresen weiteres Freibier gereicht. Renée wusste natürlich, dass es eigentlich unschicklich war zu lauschen, aber das Mädchen und die Musiker standen für Renées Ohren nun mal sehr günstig. Deshalb entging ihr auch nicht, wie das Mädchen ihren vierten Bierhumpen anhob und die Musiker fragte, ob sie einen russischen Trinkspruch vortragen dürfe. Die Jungs schauten sich fragend an, zuckten unentschlossen die Schultern und nahmen sich jeder ein volles Glas vom Tresen.
»Dann leg mal los«, sagte der Bassist und hielt ihr bereits seinen Humpen zum Anstoßen hin.
»Nicht so hastig, russische Trinksprüche dauern etwas«, erwiderte sie lächelnd und sah alle der Reihe nach ernst an. »Es war einmal ein kleines Vöglein …«
»Ich dachte, das wird ein Trinkspruch … ich habe Durst!«, nölte der Schlagzeuger, worauf der Bassist ihn mit einem »Pssst!« zurechtwies.
»Also, dieses kleine Vögelein«, fuhr das Mädchen fort, »hatte es eines Tages satt, immer nur im Schwarm zu fliegen. Denn es wollte endlich mal etwas anderes als nur die Schwanzfedern der anderen sehen.«
Die Musiker wechselten Blicke, schienen sich zu fragen, wohin das führen könnte.
»Also entfernte sich das Vöglein heimlich von seinem Schwarm und stieg hoch in die Lüfte und noch höher und höher, sodass es wirklich etwas Neues sehen konnte. Doch in der großen Höhe wurde es immer kälter, sehr kalt sogar, aber das Vöglein wollte trotzdem noch höher. Da erstarrte es plötzlich zu Eis und fiel als dicker Eisklumpen zurück auf die Erde …«
»Das ist kein Trinkspruch, das ist ’ne Parabel, Mann!«
»Frau!«, korrigierte ihn das Mädchen kühl, und Renée musste lachen. Dann sprach das Mädchen weiter. »Dort, auf der Erde, liegt nun das Vögelein, erstarrt zum Eisklumpen, steif vor Kälte und ganz allein. Und es beklagt gar bitterlich sein trauriges Los: ›Hätte ich mich doch nur nicht von meinem Schwarm entfernt …‹«
Mittlerweile war es ringsum still geworden, alle hörten dem Mädchen gebannt zu.
»Da kam eine Kuh vorbei, und das Vöglein bat sie, ihm zu helfen. Doch die Kuh lässt nur, direkt über dem Vöglein, einen dicken, arschwarmen Kuhfladen fallen und geht weiter.«
Grinsen ringsum. Die Leute hingen dem Mädchen förmlich an den Lippen.
»Das Vöglein ist empört, doch es taut auch ein wenig auf, und schon reckt und streckt es die noch steifen Flügel der Sonne entgegen. Leider kann es sich nicht aus dem klebrigen Kuhfladen befreien, um endlich seinem Schwarm wieder hinterherzufliegen. So bittet es schließlich einen vorbeikommenden Fuchs, es aus der Scheiße zu ziehen. Der Fuchs tut wie geheißen, aber kaum hat er das Vöglein befreit, frisst er es in einem Stück.«
Unbehagen breitete sich in den Gesichtern der Umstehenden aus. Das Mädchen lächelte listig, erhob seinen Bierhumpen und mit ihm die Stimme. »So erhebt nun das Glas, und lasst uns darauf trinken, dass der, der auf uns scheißt, uns nicht immer nur Böses will … Und dass der, der uns aus der Scheiße zieht, es nicht immer gut mit uns meint. Sa starowje!«
Alle starrten das Mädchen an. Anstatt mit ihren Humpen anzustoßen, nahmen sie nur stumm einen kräftigen Schluck von ihrem Bier, während das Mädchen grinsend mit einem allgemeinen »Prost!« in den Raum ihr viertes Bier in einem Zug hinunterkippte.
»Tja, Leute, ich muss dann mal los.« Der Bassist war offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass das Mädchen doch nicht zu ihm und in sein Bett zu passen schien, und die anderen trollten sich auch. Das Mädchen stand übermütig – oder verächtlich? – grinsend gegen den Tresen gelehnt. Es ließ seinen Blick kreisen, aber plötzlich schaute keiner mehr zurück, und niemand nahm mehr Notiz von ihr.
Außer Renée. Fieberhaft überlegte sie, ob sie nicht hinuntergehen und das Mädchen auf das Jazz-Fest in Peitz ansprechen sollte. Sie könnte ja einfach so tun, als hätte sie es dort gesehen. »Warst du nicht letztens auf dem Festival in Peitz?«, könnte sie auf dem Weg zum Ausschank, um sich ein frisches Bier zu holen, so ganz nebenbei fragen und bei ihm stehen bleiben. Selbst wenn das Mädchen nicht auf dem Free-Jazz-Fest gewesen war, hätte Renée ihr damit angedeutet, dass sie eine gemeinsame Leidenschaft besäßen, und sie würden eventuell ins Gespräch kommen. Sie hätte eine erste Verbündete gefunden und wäre nicht mehr auf die langweiligen Mädels in ihrem Zimmer angewiesen! Zuvor jedoch musste sie noch ihren halb vollen Bierhumpen loswerden, und deshalb schaute sich Renée nach einem günstigen Platz für ihn um. Sie fand keinen, und das Naheliegendste schien ihr, das Glas auf der Toilette zu leeren.
Doch als Renée von dort zurückkam, war das Mädchen verschwunden. Sie suchte den ganzen Keller nach ihm ab, konnte es aber nirgendwo entdecken. Enttäuscht beschloss sie deshalb, nach Hause zu gehen. Der Jakobsplan sei ganz in der Nähe, versicherte ihr der Fusselbart am Einlass, und so lief sie in die Richtung, die er ihr wies. Sie hatte sich schon ein paar Meter entfernt, da wandte sie sich abrupt um und ging zurück, um ihn zu fragen, ob er das Mädchen mit der Querflöte kannte.
»Ist auch erstes Studienjahr«, sagte er und musterte Renée eingehend.
»An der Musikhochschule?«
»Nee, nicht an der Liszt. Die war auch HAB.«
Das war die Abkürzung für die Hochschule für Architektur und Bauwesen. An welcher Sektion sie war, daran erinnerte sich der Fusselbart aber nicht. Trotzdem war es für Renée eine gute Nachricht. Vielleicht studierte das Mädchen ja wie sie Architektur, war vielleicht sogar in ihrer Seminargruppe. Bisher hatte sie doch nur die drei in ihrem Zimmer kennengelernt. Und selbst wenn das Mädchen eine andere Fachrichtung studierte, sie würden Freundinnen werden, davon war Renée auf einmal überzeugt, ohne dass sie einen Grund dafür hätte nennen können. Die Welt – und damit ihr aufregendes neues Studentenleben – sah gleich schon etwas besser aus.
Keine zehn Minuten später war sie im Wohnheim und kletterte im Dunkeln zufrieden in ihr Bett. Ohne Zähne zu putzen. Ohne waschen oben und unten.
Es war ein Flüstern, ein leises Klappern, Geraschel. Tür auf. Licht rein. Tür zu. Wo war sie? Irgendwo fiel eine Tür krachend ins Schloss. Vielleicht zwei, drei Stockwerke höher. Dann noch eine und noch eine. Der Lärm breitete sich wie ein Geschwür aus, fraß sich durch die dünnen Betonwände bis an ihr Ohr und war der Startschuss für eine Folge von Geräuschen, die ab sofort zu ihrem Alltag gehören würden. Tür auf. Tür zu. Geraschel. Klappern. Flüstern.
Es war acht Uhr, und Renée linste mit zusammengekniffenen Augen vom Stockbett herunter, betrachtete den runden Rücken von Hoi, die sich über ihren Kulturbeutel beugte und irgendetwas darin suchte, es fand, schüttelte und sprühte. Grüner Apfel! Es nahm Renée den Atem. Hörte das denn niemals auf? Überall rochen die Mädchen nach Grünem Apfel, dank Leuna und DDR-Chemie.
Drüben hinterm Schrank, dessen Rückwand Renées Bett begrenzte und der die Sicht auf den Rest des Zimmers verhinderte, knarrte eine Tür. Das war Ulrike, die den Geräuschen nach ihren Zahnputzbecher im Schrank verstaute. Das unverkennbare Geräusch eines Plastebechers, in dem hohl und dennoch gedämpft die Zahnbürste klapperte. Ferienlagergeräusche. Die waren Renée seit ihrem sechsten Lebensjahr vertraut – seit der Abschlussfahrt ihrer Kindergartengruppe an die Ostsee. Seitdem war sie ihnen jeden Sommer sowie jeden Winter in den Ferienlagern, Jugendherbergen und Trainingslagern immer wieder ausgesetzt gewesen. Geräusche, die zu ihrer Kindheit und Jugend gehörten wie das Zähneputzen, und die sie nun für die folgenden fünf Jahre Tag für Tag begleiten würden, obwohl sie mit neunzehn Jahren endgültig aus dem Ferienlageralter heraus war.
Die Tür ging erneut auf, und herein huschte Susi, die Kleinste von ihnen. Sie schlief ebenfalls oben, in dem Stockbett neben Renée, nur durch einen schmalen Gang getrennt, was Renée das Ins-Bett-Kommen am vorigen Abend erleichtert hatte, denn sie hatte sich einfach nur links und rechts, wie im Sportunterricht am Barren, statt auf die Holme, auf die oberen Betten gestützt und dann ihre Beine links oben in ihr Bett geschwungen – eine Leiter, wie es sie damals bei ihnen zu Hause am Doppelstockbett für ihren Bruder gegeben hatte, fehlte hier.
Laut Studienplan würde Renée heute die anderen Studenten aus ihrer Seminargruppe kennenlernen, doch zuvor sollte es eine Einführungsvorlesung im Oberlichtsaal mit all ihren zukünftigen Professoren geben. Renée war gespannt, ob sie das Mädchen vom Vorabend dort wiedersehen würde, und hielt bereits auf dem zwanzigminütigen Weg zur Hochschule die Augen offen. Es ging einmal quer durch die ganze Stadt. Über den Herderplatz zum Markt, bis zur Schillerstraße, den Frauenplan, dann über den Wielandplatz bis in die Geschwister-Scholl-Straße, wo das Hauptgebäude der HAB stand. Dort, in einem der Atelierräume mit den großen Fenstern, hatte Renée damals den schriftlichen Eignungstest absolviert, der mit allerhand Logik-Fragen, mathematischen Knobeleien und geometrischen Zeichenaufgaben zum räumlichen Verstehen gespickt gewesen war. Erst danach war es zu einem Aufnahmegespräch bei einem Professor und zwei beisitzenden Studentinnen gegangen, wo sie ihre am Morgen abgegebene Zeichenmappe mit ein paar lobenden Worten zurückbekam und die Ernsthaftigkeit ihres Studienwunsches anhand von ziemlich durchsichtigen Fangfragen überprüft wurde.
»Was tun Sie, wenn Sie die Eignungsprüfung nicht bestehen?«
»Ich würde es nächstes Jahr erneut versuchen«, antwortete sie fest und ganz anders als das Mädchen und der Junge zuvor, die mit ihr zusammen im Eignungsgespräch saßen. Beide hatten sehr bescheiden geantwortet, dass sie dann vielleicht nicht für die Architektur geeignet seien und sich für ein anderes Studienfach bewerben würden, was Renée besonders bei dem Jungen verwunderte, der als Zweites drangekommen war. Hatte er denn nicht bemerkt, wie sich die bis dahin freundlichen Gesichter des Professors und seiner studentischen Beisitzer bei ebendieser Antwort des Mädchens verfinstert hatten?
Der Oberlichtsaal lag im dritten Stock des Hauptgebäudes, war halb so groß wie die Aula ihrer alten Schule in Prenzlauer Berg, hatte aber nur ein einziges großes Sprossenfenster. Mehr gleichmäßiges Licht konnte an der Decke, die eine in Quadrate aufgeteilte Glasfläche war und dem Saal seinen Namen gegeben hatte, hinzugeschaltet werden.
Obwohl Renée den Saal zusammen mit ihren Mitbewohnerinnen als eine der Ersten betrat und die Eingangstür die ganze Zeit im Auge behielt, konnte sie das Mädchen vom Vorabend nicht unter den hereinströmenden Kommilitonen entdecken, die sich auf drei Seminargruppen aufteilten, wie Hoi wusste. A, B und C. Das Mädchen musste also doch an einer der anderen Sektionen der HAB studieren. Renée hoffte auf die Veranstaltung nach der Mittagspause, die für den gesamten Jahrgang angesetzt war, nicht nur für die Architekten, sondern auch für die Städtebauer, Gebietsplaner, Bauingenieure und Baustoffverfahrenstechniker. Dort würden sich ihnen alle Lehrenden vorstellen, bei denen sie sektionsübergreifend Unterricht hätten, auch die Sport- und Russischlehrer und der Hochschularzt.