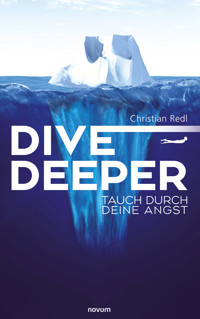16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Christian Redl hat sein Leben aufgeschrieben - ehrlich, aufrichtig, ungeschönt. Aufgewachsen in den fünfziger Jahren unter der Obhut eines kriegstraumatisierten Vaters, macht er gegen den Willen der Eltern eine Ausbildung zum Schauspieler. Schonungslos gegen sich selbst erzählt er von seiner rastlosen Suche nach Erfolg und Anerkennung, von Triumphen am Theater, fantastischen Auszeichnungen sowie von gefährlichen Beziehungen und der Macht des Alkohols, von tiefer Melancholie, Euphorie und Verzweiflung. Aber auch von einer beglückenden späten Liebe, mit der er nicht mehr gerechnet hatte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ebook Edition
Christian Redl
Das Leben hat kein Geländer
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-98791-003-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt / Main 2023
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Für Martina
To begin with the beginning
Dylan Thomas
1
Deutschland 1948. Ein strenger Winter hatte sich über das Land gelegt und die Erinnerung an den Krieg begann langsam zu verblassen. Niemand sprach mehr über ihn und fast hätte man glauben können, er wäre nie grausame Wirklichkeit gewesen.
Eine hochschwangere Frau verließ leise ihr Zimmer auf der Säuglingsstation des Kreiskrankenhauses der Stadt Schleswig, huschte unbemerkt über den Flur und stieg die Treppen hinauf in den vierten Stock des alten Gebäudes. Oben angekommen, hüpfte sie die Stufen hinunter bis ins Erdgeschoss, wiederholte das Ganze noch einmal und eilte dann zurück in ihr noch immer warmes Bett.
Nachdem seit nunmehr über zwei Wochen ihre hoffnungsfrohe Erwartung täglich aufs Neue enttäuscht worden war, sorgte ihr beherzter Einsatz im Treppenhaus nun doch dafür, dass ich endlich meinen sicheren Bau verließ und das Licht der Welt erblickte. Eine Ärztin durchschnitt meine Nabelschnur und bettete mich in die Arme der erschöpften Frau, der ich mein Leben verdankte und die sichtlich erleichtert schien, ihre scheinbar ewig währende Schwangerschaft glücklich überstanden zu haben. Der Oberarzt der Station wurde gerufen, er eilte herbei, trat an das Bett meiner Mutter, beugte sich über sie und sagte: »Na schauen Sie doch nur, liebe Frau Redl, was für ein schöner Soldat.«
Nachdem wir aus dem Krankenhaus entlassen worden waren, brachte meine Mutter mich zu meinem Vater. Herbert Redl war Lehrer in Hollingstedt, einem kleinen Dorf in der Nähe von Schleswig. Meine Eltern kannten sich noch nicht lange. Unwägbare Umstände einer sehr bewegten Zeit hatten sie zueinander finden lassen und ich war jetzt ihr erstes gemeinsames Kind.
Mein Vater war schon einmal verheiratet gewesen – mit einer Frau, die während des Krieges an der Ruhr erkrankt und im Alter von nur 28 Jahren gestorben war. Sie hinterließ ihm einen Sohn und eine Tochter mit Namen Wolf und Monika. Aus Furcht vor der täglich immer näher heranrückenden Roten Armee hatten beide Kinder Anfang 1945 aus Stargard, ihrer Heimatstadt in Pommern, fliehen müssen, und gemeinsam mit ihren beiden Großmüttern verschlug es sie in den Norden Deutschlands, in das bereits erwähnte Hollingstedt. Dort fanden sie Aufnahme in einem Flüchtlingsheim.
Schon bald nach Kriegsende begann mein Vater mit der Suche nach seinen Kindern und schon bald gelang es ihm, sie mit Hilfe des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes ausfindig zu machen. Es kam zu einem tränenreichen, herzzerreißenden Wiedersehen der Überlebenden, die sich fest aneinanderklammerten und fortan alles taten, um den Alptraum der zurückliegenden Jahre aus ihrem Leben zu verbannen.
Glückliche Umstände hatten es ermöglicht, dass sie eine Wohnung im alten Schulhaus von Hollingstedt beziehen konnten. Mein Vater stand jetzt als Witwer und Ernährer einer mutterlosen Familie vor. Neben dem normalen Unterricht, den er als Dorfschullehrer zu absolvieren hatte, gab er Nachhilfestunden in Englisch und erteilte darüber hinaus Klavierunterricht für musikalisch hoffnungslos unbegabte Töchter wohlhabender Bauern, welche seine meist vergeblichen Bemühungen mit reichlich Obst, Eiern und Speck vergüteten.
Meine Mutter stammte aus Danzig. Mit ihrer einjährigen Tochter Gisela auf dem Arm war auch sie in den letzten Kriegstagen vor dem Donner der russischen Kanonen in Richtung Westen geflohen. Unmittelbar vor ihrer Flucht im Januar 1945 hatte sich ihr damaliger Mann – ein fanatischer Anhänger Hitlers – aus Furcht vor der Rache der russischen Soldaten mit einer Zyankalikapsel das Leben genommen. Derart tragisch zur Witwe geworden, setzte sie auf ihrem Weg in die Freiheit nun alles daran, noch einen Platz auf der damals schon legendären »Gustloff« zu bekommen. Die aber war bereits seit Tagen überbucht und überladen mit verzweifelten Menschen, die auch alle ihre Heimat verlassen mussten – sodass meine Mutter und ihre Tochter keinen Platz mehr auf dem Schiff bekamen. Dieser schicksalhaften Entscheidung verdanke ich vermutlich mein Leben.
Die »Wilhelm Gustloff« war im Auftrag der NS-Organisation »Kraft durch Freude« nach Beginn des Zweiten Weltkriegs als Lazarettschiff unterwegs und wurde am 30. Januar 1945 vor der Küste Pommerns durch ein sowjetisches U-Boot versenkt. Mehr als 4 000 Menschen kamen um ihr Leben.
Nachdem sie der Katastrophe, die einem Massenbegräbnis in der Ostsee glich, also entgangen waren, gelang es den beiden Vertriebenen nur wenige Tage später doch noch, einen Platz auf einem der nachfolgenden Schiffe zu ergattern, mit dem sie zu guter Letzt und unversehrt die Küste von Schleswig-Holstein erreichten. In Hollingstedt wurden sie dann von der örtlichen Verwaltung bei freundlichen Bauersleuten einquartiert. Dem schon betagten Ehepaar war Nachwuchs versagt geblieben – umso mehr freuten sich die beiden Alten über das kleine Flüchtlingsmädchen Gisela, das sie als unerwartetes Geschenk betrachteten und in ihr Herz schlossen wie ein eigenes Kind.
Dass man in Hollingstedt Englisch lernen konnte, weckte das Interesse meiner Mutter, die eines Tages dann als Schülerin in der Klasse meines Vaters saß. Es dauerte nicht lange, da hatte der Lehrer Herbert Redl ein Auge auf seinen Neuzugang geworfen. Man verabredete sich und kam sich an einem lauen Sommerabend auf dem Tanzboden einer alten Scheune näher. Der Krieg war vorbei, beide waren jung und beide sehnten sich nach einer besseren Zukunft. Da sie als Alleinerziehende dasselbe Schicksal teilten, kamen sie zu dem Entschluss, sich gemeinsam mit ihren jeweiligen Kindern in neuer Konstellation zu einer amtlich beglaubigten Familie zu vereinigen und zu heiraten – was ein knappes Jahr später zu meiner Geburt führte.
Das Leben der Eltern ist dasBuch, in dem die Kinder lesen.Augustinus Aurelius
2
Mein Vater, meine Mutter, Oma Grete, meine drei Halbgeschwister und ich als Jüngster der Familie schauten nun einer ungewissen Zukunft entgegen. Oma Wiedenhaupt, die Mutter der früh verstorbenen ersten Frau meines Vaters, wohnte nicht bei uns, hatte aber die unangenehme Angewohnheit, ihre Verwandtschaft in Hollingstedt in regelmäßigen Abständen stets unangemeldet zu besuchen. Immer in tiefes Schwarz gekleidet, sah sie aus wie eine von bösen Gedanken zerfressene Vogelscheuche, die mit ihrem hässlichen Aussehen und ihrer keifenden Stimme Angst und Schrecken zu verbreiten wusste. Bei jeder ihrer familiären Heimsuchungen bestand sie als Erstes darauf, sich mit meinen Halbgeschwistern Wolf und Monika ins Schlafzimmer zurückzuziehen, wo sich die zwei dann auf den Boden knien mussten, um gut eine Stunde lang um ihre tote Mutter zu weinen.
Oma Wiedenhaupt duldete keinen Widerspruch. Als mein Vater es einmal gewagt hatte, sie darum zu bitten, den armen Kleinen die Trauertortur doch ab und an zu ersparen, fiel sie ihm derart barsch ins Wort, dass er zusammenzuckte und sich schuldbewusst zurückzog. Für meine bedauernswerte Mutter, die das Schicksal nicht nur mit der undankbaren Rolle einer Stiefmutter bedacht hatte, war es besonders schwer. Denn sie war ja zusätzlich noch die unerwünschte Schwiegertochter der Mutter der verstorbenen Frau ihres Mannes, weshalb Oma Wiedenhaupt sie als lästigen Fremdkörper betrachtete, den sie um nichts auf der Welt zu akzeptieren bereit war. Da meine Mutter aber nun mit deren Sohn verheiratet war, blieb der bösen Frau nichts anderes übrig, als sie mit inbrünstigem Hass und immerwährender Verachtung zu erdulden.
Bevor sich die verheulten und übermüdeten Kinder ins Bett legen durften, um endlich zu schlafen, mussten sie sich noch ein weiteres Mal dem Willen der Großmutter unterwerfen und sich furchterregende Geschichten über böse Stiefmütter anhören – die alles Hexen seien und in einem anständigen Hause nichts zu suchen hätten
Die von Oma Wiedenhaupt vergifteten Kinder Wolf und Monika begannen nun ihrerseits, ihre Stiefschwester Gisela zu traktieren. Denn die war ja, wie sie gerade gelernt hatten, die Tochter einer Hexe. Gisela setzte das ungeheuer zu und sie tat von nun an alles, um nur nicht weiter aufzufallen. Die familiären Machtverhältnisse entwickelten sich schon nach kurzer Zeit des gemeinsamen Zusammenlebens so zuungunsten meiner völlig überforderten Mutter, dass die sich nicht einmal mehr traute, ihr eigenes Kind in Schutz zu nehmen – aus Angst davor, es zu bevorzugen.
Unser in bester Absicht geknüpfter Familienverbund stand somit unter keinem guten Stern. Immer wieder kam es zu Missgunst und bösartigen Unterstellungen. Warum das so war, wurde nie hinterfragt, sondern verdrängt und stillschweigend hingenommen. Mich, den Jüngsten, mit den meist prallen und immer viel zu großen Windelpaketen in der Hose, hatten alle gern. Ich war ja nur das unschuldige Kind der lebenden Elternteile – und demzufolge unberührt von den Problemen unserer Allianz. Monika, die es nie versäumte, der gänzlich eingeschüchterten Gisela bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu verstehen zu geben, dass sie als ihre nicht leibliche Schwester in ihrer Familie nichts zu suchen habe und es besser für sie gewesen wäre, wenn irgendjemand sie adoptiert hätte, fuhr mich tagelang im Kinderwagen spazieren, ausdauernd und voller Begeisterung. Schon als Kind sah sie sich als zukünftige Mutter und mein Dasein verschaffte ihr eine anscheinend willkommene Gelegenheit, sich auf die ersehnte Rolle vorzubereiten.
Oma Grete, die sanfte und nachsichtige Mutter meines Vaters, hielt sich bei all dem Hin und Her klug zurück, versuchte immer die Ruhe zu bewahren und ersparte sich jeden Kommentar. Nur manchmal, wenn die familiären Konflikte die sich streitenden Parteien erschöpft zum Verstummen gebracht hatten, schüttelte sie den Kopf und seufzte still in sich hinein. Aber für mich war Oma Grete immer da, dachte sich Geschichten aus, die sie mir erzählte, und in ihrer Nähe fühlte ich mich wie in eine andere Welt versetzt. Die andere Oma, die immer nur kam, um häuslichen Unfrieden zu verbreiten, starb irgendwann im Laufe der fünfziger Jahre – wann, wo und wie, auch darüber ist nie gesprochen worden … Meine Eltern schienen einfach nur froh zu sein, dass sie uns endlich in Ruhe ließ.
3
Ferdinand Redl, Oma Gretes Mann und Vater meines Vaters, mein Großvater also, war Sohn verarmter österreichischer Bauern. Im Sommer 1896 hatte er sich zu Fuß auf den Weg von Wien nach Hamburg gemacht. Er suchte das Abenteuer und wollte zur See. Der bescheidenen Verhältnisse wegen, in denen er aufgewachsen war und denen er unter allen Umständen entfliehen wollte, musste er auf sein festes Schuhwerk vertrauen, denn eine Zugfahrt konnte er sich nicht leisten. Die Sehnsucht nach fernen Ländern, vor allem aber die Aussicht auf ein irgendwann besseres Leben, ließen ihn die Strapazen seiner Wanderung jedoch tapfer ertragen. Nach nur acht Wochen hatte er den Hamburger Hafen erreicht und schon kurz darauf war es ihm gelungen, als einfacher Matrose auf einem großen Überseedampfer anzuheuern.
Ich bedauere sehr, dass ich meinen Großvater nicht kennengelernt habe. Nach allem, was mir meine Eltern über ihn erzählt haben, muss er ein beeindruckender und ganz und gar unbürgerlicher Charakter gewesen sein. Ich besitze ein Foto von ihm, auf dem er in einem tadellos sitzenden, eleganten Anzug in formvollendeter Haltung vor der Kamera eines Hamburger Atelierfotografen posiert: ein Kapitän in Zivil, mit herausforderndem Blick und der Aura eines verwegenen, Wind und Wetter erprobten Mannes. Auf seinem kugelrunden Kopf trägt er einen großen Panamahut und zwischen zwei gespreizten Fingern seiner rechten Hand hält er, höchst raffiniert platziert, eine silberne Zigarettenspitze. Rein äußerlich bin ich meinem Großvater wie aus dem Gesicht geschnitten: In unserem Erscheinungsbild gibt es ganz erstaunliche Ähnlichkeiten: dieselbe Physiognomie, dieselbe Körperspannung und derselbe theatralische Hang zur Pose im Anblick einer Kamera.
Als welterfahrener und weit gereister Seemann hatte er in jedem Hafen eine Braut. Demnach muss er ein unwiderstehlicher Verführer gewesen sein, wenn ich den Geschichten meiner Oma Grete über ihn Glauben schenken darf. Manchmal erwähnte sie den Namen einer gewissen Lola, einer geheimnisumflorten Tänzerin aus Rio de Janeiro, die als eine seiner Geliebten mit beträchtlicher Ausdauer viele Jahre auf ihn gewartet zu haben schien. Auch die Namen der zahlreichen anderen, über alle Häfen der Welt verteilten Damen, auf die der Frauenschwarm sich eingelassen hatte, hörten sich aus dem Munde seiner wohl regelmäßig hintergangenen Ehefrau ausgesprochen exotisch an.
Immer wenn der treulose Kapitän auf Landurlaub zurück nach Barth an der Ostsee kam, wartete dort eine Überraschung auf ihn: ein ums andere Mal hatte seine daheimgebliebene Gattin während seiner Abwesenheit alle Möbel umgestellt. Der von so viel kreativem Eigensinn entnervte Ehemann wurde von Jahr zu Jahr wütender, wenn er sich in seiner eigenen Wohnung nicht mehr zurechtfand. Eines Tages löste er das Problem auf seine Weise. Als seine Frau für eine Weile außer Haus war, um Besorgungen zu machen, ritzte er mit einer Rasierklinge entlang der Konturen der Schränke, Bilder und Kommoden der Wohnung die Tapete auf, löste das akkurat getrennte Papier dahinter von der Wand – und schon war es seiner Frau nicht mehr möglich, irgendetwas zu verschieben oder umzuhängen, ohne die nun kahlen Stellen auf dem Gemäuer zur Besichtigung freizugeben. Als meine Großmutter das sah, trug sie es mit Fassung und unterließ es fortan, das Nervenkostüm ihres Mannes mit ihrem immer wiederkehrenden Aktionismus zu strapazieren. Seinen Traum, als Kapitän auf der Kommandobrücke eines Schiffes zu stehen, hatte er sich erfüllt. Dieser Traum währte aber nur wenige Jahre und fand ein jähes Ende bei einem Bombenangriff eines englischen Geschwaders, von dem der damals Zweiundsechzigjährige überrascht wurde, während er mit einem Handelsschiff die Nordsee überquerte. Die tödliche Fracht der Engländer hagelte auf ihn herab und versenkte sein Schiff mitsamt der Mannschaft. Keiner der Seeleute sollte überleben. Das ereignete sich im April 1945 – drei Jahre vor meiner Geburt.
Mein Großvater Ferdinand Redl hatte meinen Namen von Wien nach Deutschland getragen. Es ist seltsam, aber jedes Mal, wenn ich in der österreichischen Hauptstadt bin, überkommt mich eine fast abgründige Wehmut – eine überwältigende Sehnsucht nach einer Vergangenheit, von der ich eine nur sehr ungenaue Vorstellung habe. In Wien fühle ich mich zu Hause, obwohl ich dort nicht wohne und auch nie länger als ein paar Tage gewesen bin. Irgendwie kann ich mich dem morbiden Zauber der Stadt meiner Vorfahren nur schwer entziehen – und erst recht nicht den unerbittlichen Wahrheiten ihrer Lieder:
»Zeigt sich der Tod einst mit VerlaubUnd zupft mich: ›Brüderl, kumm!‹Da stell ich mich am Anfang taubUnd schau mich gar nicht um.Doch sagt er: ›Lieber Valentin,Mach’ keine Umständ’, geh!‹Da leg’ ich meinen Hobel hinUnd sag der Welt ade.«
Schon als Kind war Hans Moser, der dieses »Hobellied« unvergleichlich interpretiert hat, mein Lieblingsschauspieler – keinesfalls der ewig rührselige Heinz Rühmann und auch nicht der unerträglich outrierende und Grimassen schneidende Theo Lingen. Hans Moser war unvergleichlich: In seinen Rollen verlieh er den banalsten Dingen des Alltags eine existenzielle Dimension. Bei ihm ging es letzten Endes immer um Leben und Tod. Selbst wenn er nur einen Manschettenkopf nicht finden konnte, spielte er so, als drohe ein Weltuntergang. Dass ich ihn schon in jungen Jahren so sehr liebte, haben meine Freunde immer nur mit kopfschüttelndem Unverständnis zur Kenntnis genommen, sodass ich mir manchmal wie ein Fremder im eigenen Land vorkam …
4
Zurück nach Hollingstedt. Als Dorfschullehrer stand mein Vater vor der nicht ganz einfachen Aufgabe, acht Klassen in einem Raum zu unterrichten – die Erstklässler in der ersten Reihe und der achte Jahrgang in der letzten. Er muss ein guter Lehrer gewesen sein, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübte, das sagten jedenfalls alle, die mit ihm zu tun gehabt haben. Nach außen hin gab er sich forsch und energisch, innerlich aber schien der ehemalige Soldat der deutschen Wehrmacht ein gebrochener, von Kummer und Sorgen gepeinigter Mann zu sein.
Verstört und vollkommen desillusioniert war er aus einem verlorenen Krieg in einen Alltag zurückgekehrt, in dem er sich nur schwer zurechtfand. Über das Grauen, das ihm sechs Jahre lang an der Front widerfahren war, ein Grauen, das natürlich ebenso von ihm und seinen Kameraden ausging, konnte und wollte er nicht sprechen. Wer auch immer ihn nach seinen Kriegserlebnissen fragte – keinem gelang es, irgendetwas über dieses dunkle Kapitel seines Lebens zu erfahren. Sobald der Krieg auch nur erwähnt wurde, verstummte der einstige Unteroffizier des Heeres schlagartig und zog sich stundenlang in sein Arbeitszimmer zurück. Er trank, obwohl er den Alkohol nicht vertrug. Und er rauchte, obwohl er Asthmatiker war. Darüber hinaus litt er unter schweren Depressionen, die ihn oft über das Sterben nachdenken ließen. Der Krieg hatte ihm seine besten Jahre geraubt, bleierne Schuldgefühle lagen auf seiner Seele und nie sollte es ihm gelingen, sich von seinen traumatischen Erinnerungen zu befreien. Auf einem Foto, das ich in einem alten Familienalbum gefunden habe, steht er allein in unserem Garten in Hollingstedt mit hochgezogenen Schultern und schlaff herunterhängenden Armen – und er sieht aus wie ein vom Galgen geschnittenes Gespenst.
Erst sehr spät, als ich schon halbwegs erwachsen war, habe ich dieses Foto durch Zufall entdeckt. Meine Eltern hatten es offenbar vor mir versteckt und noch heute erschreckt mich der Anblick dieses Mannes, der mein Vater gewesen ist, zutiefst. Alles, was hinter ihm lag, schien sich in seinem Gesicht eingegraben zu haben – wie bei einem mit einem bösen Fluch Beladenen.
1951. Am ersten Weihnachtsfeiertag des neuen Jahrzehnts wurde meine Familie bei den Bauern, die meine Mutter und ihre Tochter Gisela so selbstlos bei sich aufgenommen hatten, zum Essen eingeladen. Die frohe Kunde einer geschlachteten Gans sorgte für große Vorfreude auf ein üppiges Mahl. Lange schon vor der verabredeten Zeit hatte mein Vater sich mit seinem hungrigen Anhang auf den Weg gemacht und alle mussten wir mehrere Male und bei klirrender Kälte die Dorfstraße rauf und wieder runter spazieren, um nicht zu früh bei den Gastgebern vor der Tür zu stehen.
Endlich war es dann so weit. Die erwartungsfrohen Besucher wurden freundlich begrüßt, betraten das bullig warme Wohnzimmer des Hauses, in dem ein Tannenbaum mit vielen brennenden Kerzen für eine weihnachtliche Stimmung sorgte, und wurden schließlich in die Küche gebeten. Kaum hatte man sie dort platziert, trauten sie ihren Augen nicht: Die Gans, die nun serviert wurde, war nicht, wie erhofft, kross und knusprig gebraten, sondern wurde aus dem kochend heißen Wasser eines riesigen Topfes gezogen und dann zerteilt. Fassungslos starrte meine Familie auf das fette Fleisch mit der schlabbrigen Haut, das auf den Tellern kraftlos vor sich hin schwitzte und nur darauf zu warten schien, verzehrt zu werden. Ein herzhaftes »guten Appetit« machte die Runde und die Bauern langten ordentlich zu. Ihnen mundete die gekochte Gans, die zu Lebzeiten auf den Namen Erna gehört hatte, offenbar ausgezeichnet. Genüsslich schmatzend und sich die Lippen leckend, genossen sie den gehaltvollen Festtagsschmaus, spülten ihn mit reichlich Schnaps hinunter und ermunterten ihre Gäste, denen diese Gans ein Graus war, es ihnen gleichzutun. Widerwillig, den Ekel nur mühsam verbergend – und um nicht unhöflich zu erscheinen –, folgten sie schließlich der gut gemeinten Aufforderung und überwanden sich allesamt, das mittlerweile lauwarme Gänsefleisch zu probieren. Es dauerte nicht lange, da sprangen sie einer nach dem anderen auf und verließen fluchtartig den reich gedeckten Tisch. Sie stürzten hinaus ins Freie hin zu dem kleinen Toilettenhäuschen im Hof des Hauses, und es war ein unglaublicher Anblick, wie sie der Reihe nach unter krampfhaften Verrenkungen und laut röchelnd alles wieder erbrachen, was sie soeben in sich hineingewürgt hatten. So sehr hatten sie sich nach Sättigung gesehnt, und nun waren sie hungriger als je zuvor. Das unerwartete Verhalten der von ihnen christlich Bewirteten versetzte die gutmütigen Bauern in ungläubiges Erstaunen. Sie gaben sich zutiefst besorgt, boten ihre Hilfe an und entschuldigten sich viele Male für die unbeabsichtigten Folgen eines Festessens, das doch so gut gemeint war.
Wie alles, was sich nach meiner Geburt in Hollingstedt ereignet hatte, kenne ich auch diese Geschichte nur vom Hörensagen. Sie ist mir über viele Jahre in unzähligen Varianten immer wieder erzählt worden und hat mich so beeindruckt, dass ich manchmal glaube, bei diesem Weihnachtsfest tatsächlich dabei gewesen zu sein.
Ich sehn mich nach Bildernaus Kindertagen – alsalles noch überschaubar schien.»Sehnsucht«
5
Anfang der fünfziger Jahre wurde mein Vater nach Ahrensbök, einer Kleinstadt in der Nähe von Lübeck, versetzt, um die Stelle eines Mittelschuldirektors anzutreten. Unser Umzug verursachte in dem neuen Heimatort beträchtliches Aufsehen. Die Ankunft einer orientierungslosen Familie, die Ausschau hielt nach der versprochenen Bleibe, mit all ihrem Hab und Gut und gackernden Hühnern auf einem von zwei Pferden gezogenen Leiterwagen, hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Zahlreiche neugierig gewordene Ahrensböker waren gekommen, um uns zu begaffen und ungebetene Ratschläge zu erteilen. Nach einer qualvoll langen Weile aufmerksamster Beobachtung war es meinem Vater dank der Auskunft des ortskundigen Pfarrers der Gemeinde letztendlich doch noch gelungen, uns aus dieser höchst unerfreulichen Lage zu befreien. Und so gelangten wir endlich zu unserem neuen Zuhause.
Ahrensbök – das ist der Ort meiner allerfrühesten Erinnerungen: Ich mache einen Spaziergang durch einen märchenhaft schönen, verschneiten Wald an der Hand meiner Oma Grete. Ich trage einen blauen Cordanzug und begleite sie als ein Hans-guck-in-die-Luft. Irgendwann bleibe ich stehen, streckte den Arm in den Himmel, zeige mit spitzem Zeigefinger auf den Wipfel eines riesigen Baumes und sage: »Morgen Titan obenhauf.« An den Satz selbst, der in der Familie zu einem geflügelten Wort werden sollte, erinnere ich mich natürlich nicht mehr. Aber diese kleine Episode mit meiner Großmutter im Wald macht deutlich, welche hochfliegenden Pläne mich bereits in jungen Jahren zu beschäftigen schienen. »Morgen Christian oben rauf« – immerhin waren die Bäume, die ich erklimmen wollte, mächtig im Umfang und mindestens zwanzig Meter hoch … und ihre Äste waren schlichtweg unerreichbar.
An einem eiskalten Winternachmittag also hatte mein Gedächtnis seine Arbeit aufgenommen. Fortan bemühte es sich, alles, was mir ab jetzt widerfahren sollte, zu sortieren, vieles wieder zu vergessen, anderes aber ein Leben lang zu speichern. Leider ist es mir nicht möglich, die Ereignisse der ersten Jahre meiner Vergangenheit chronologisch zu ordnen. Ebenso wenig bin ich in der Lage, den Zeitpunkt gravierender Erlebnisse meiner Kindheit zeitlich präzise zu bestimmen. Wichtig vor allem scheint mir aber die Intensität, mit der sie sich in mir eingebrannt haben.
Ausgerechnet meine frühesten Erinnerungen haben die schärfsten Konturen. Glasklar habe ich sie auch nach Jahrzehnten noch immer vor Augen. Je weniger weit bestimmte Ereignisse zurückliegen, desto mühsamer kommt es mir vor, sie gedanklich fassen und exakt wiedergeben zu können. Offenbar haben mich die allerersten Jahre meiner bewussten Wahrnehmung der Welt mehr beeinflusst als alles, was danach kam.
An den Todestag meiner geliebten Großmutter zum Beispiel erinnere ich mich noch sehr genau. Es war ein strahlend schöner Sonntagmorgen mit einem ungewöhnlich blauen Himmel. Die Familie saß beim Frühstück und es dauerte eine Weile, bis es uns auffiel: Oma Grete saß nicht mit am Tisch. Das war außergewöhnlich, denn normalerweise war sie eine der Ersten in unserer Runde. »Schau doch mal nach, wo sie bleibt«, sagte mein Vater, woraufhin ich seiner Aufforderung nachkam. Ich lief den Flur entlang, öffnete die Tür zu ihrem Zimmer, rief: »Oma, Frühstück!« und sah, dass sich die alte Frau am Fensterkreuz mit Hilfe einer Gardinenschnur erhängt hatte. Dieses Bild werde ich nie vergessen, denn der Anblick der Toten faszinierte mich sonderbarerweise weitaus mehr, als dass er mich erschrak. An die Reaktionen meiner Mutter oder meiner Geschwister kann ich mich seltsamerweise überhaupt nicht mehr erinnern. Als ich aber mitansehen musste, wie mein Vater hemmungslos weinend auf seinem Bett saß, bekam ich eine Ahnung davon, was sich da gerade ereignet hatte. Nie zuvor hatte ich meinen Vater weinen sehen und seine Hilflosigkeit machte mir Angst. Wer sollte mich jetzt beschützen? Ich fühlte mich alleingelassen und spürte, dass ich diesem mich existentiell bedrohenden Gefühl nicht gewachsen war.
Den Grund für den Suizid meiner Großmutter erfuhr ich erst viele Jahre nach ihrem Tod. Ein Leben lang hatte sie unter Schwermut gelitten und war wohl der Meinung gewesen, dass sie zu einer unerwünschten Last geworden war und dass die Familie sie aus dem Haus haben wollte, um sie in ein Altenheim abzuschieben.
In Sichtweite unseres Hauses befand sich eine alte Hufschmiede. Der Sohn des Hufschmieds war ungefähr genauso alt wie ich, ein kleiner Kerl mit roten Haaren und zahlreichen Sommersprossen im Gesicht. Er hatte scheinbar keine Freunde, denn immer, wenn ich ihn auf der Straße spielen sah, war er mit sich allein. Es kam auch vor, dass er mit jemandem sprach, der gar nicht da war – und manchmal sang er mit seltsam hoher Stimme einen Schlager, den ich aus dem Radio kannte:
»Tiritomba, Tiritomba,Einmal möcht’ ich nochIn deine Augen sehen –Tiritomba, Tiritomba,Denn die Liebe ist so schön.«
Sein Gesang berührte mich auf eine Weise, die ich mir nicht erklären konnte. Er klang so unsagbar traurig und je länger ich ihm zuhörte, um so hilfloser und verlorener kam mir der Junge vor. Er ging mir nie mehr aus dem Kopf.
Mein älterer Bruder Wolf war von meinem Vater beauftragt worden, alte Weinreben von der Außenwand unseres Hauses zu schneiden und sie zu entsorgen. Ich durfte ihm dabei helfen und musste die großen Büschel der abgeschnittenen Reben zu einer Jauchegrube hinter unserem Haus schleppen. Dort angekommen, schleuderte ich das trockene Gestrüpp mit Schwung in die Kloake und schaute ihm neugierig hinterher. Träge blubbernd versank es in der Grube und nachdem ich die Aktion ein paar Mal wiederholt hatte, begann ich mich zu langweilen und schon passierte es: Urplötzlich verlor ich den Halt und stürzte kopfüber in das eklige Gewässer. Ich tauchte unter, japste nach Luft und schluckte Unmengen der dunklen, bestialisch stinkenden Brühe. Ich tauchte wieder auf, schrie um Hilfe – und abermals zog es mich hinab in die Tiefe … Exakt in diesem Moment, in dem ich in rabenschwarzer Finsternis versank, sah ich jenen Film, von dem ich erst Jahre später erfahren sollte: Sterbende sehen kurz vor ihrem Ableben noch einmal ihr ganzes Leben an sich vorbeiziehen – als säßen sie im Kino und schauten auf eine Leinwand. Und es war tatsächlich so: Alle Ereignisse meines bis dahin doch recht kurzen Lebens flimmerten rasend schnell vor mir vorüber … Es war ein unglaublicher Moment und ich war gerade mal vier Jahre alt. Kurz vor dem endgültigen Abtauchen ins Ungewisse spürte ich den festen Griff meines Bruders, der meinen Arm umklammert hatte und mich im allerletzten Moment aus der tödlichen Kloake zurück ins Leben zerrte. Angewidert von dem Gestank, den ich verbreitete, ließ er mich auf den Boden fallen, nahm mich an den Füßen, hob mich hoch und trug mich kopfüber ins Haus zu meiner Mutter, die in der Küche stand und gerade den Teig für einen Pflaumenkuchen ausrollte. Mit einem lapidaren »da hast du deinen Sohn« übergab er mich der fassungslosen Frau, die nicht glauben konnte, was sich da soeben in ihrer unmittelbaren Nähe ereignet haben sollte.
Ein weiteres Erinnerungsstück taucht aus dem sich langsam lichtenden Nebel meiner Kindheit auf – es ist Herbst 53. Meine Mutter war außer Haus und mein Vater saß hinter seinem Schreibtisch. Er rief uns Kinder zu sich und wartete, bis wir uns vor ihm versammelt hatten. Während er sorgfältig die Papiere, die vor ihm lagen, sortierte, bemerkte ich, dass er getrunken hatte. Nochmals versicherte er sich, dass wir ihm alle zuhören würden, um uns dann mit feierlichem Vibrato in der Stimme ein Gedicht vorzulesen. Ein Gedicht, das er, wie ich es Jahre später von meiner Mutter erfahren sollte, im Krieg als Soldat am Abend vor einem Einsatz verfasst hatte. In dunklen bedeutungsschweren Versen nahm er Abschied von der Welt und prophezeite uns seinen baldigen Tod. Gelähmt vor Angst hingen wir an seinen Lippen. Wir konnten nicht glauben, was wir da zu hören bekamen, und weinend flehten wir ihn an, uns doch bitte nicht allein zu lassen. Mein Vater machte eine Pause, nestelte ein Taschentuch aus seiner Hosentasche, wischte sich – zutiefst gerührt von sich selber – die Tränen aus den Augen und ermahnte uns, unser künftiges Schicksal tapfer zu ertragen und ihn nie zu vergessen. Dann fuhr er fort mit seiner Rezitation, unbeirrt und wie berauscht, gefangen im Wahn einer diffusen Todessehnsucht und völlig unberührt davon, was er uns da antat. Obwohl ich noch sehr klein war, nahm ich etwas wahr, was mich zutiefst erschreckte und ich bis heute nicht vergessen kann: Der Anblick seiner verstörten Kinder schien ihm zu gefallen. Ein eigenartiges Funkeln in seinen Augen verriet es mir: Er wollte unser Mitleid, er wollte uns weinen sehen – und die bitteren Tränen, die wir um ihn vergossen, schienen ihn zu trösten.
Ein milder Spätsommertag. Wie so oft vertrieb ich mir die Zeit damit, rings um unser Haus durch mein Revier zu streifen. Plötzlich stand ein Mann vor mir – mit blutverschmiertem Gesicht und in einem offenen, ebenso mit Blut befleckten, weißen Hemd, der aussah wie mein Vater. Ja, es war mein Vater. Er war ganz unerwartet aufgetaucht. Sein Anblick war furchterregend, ich war zu Tode erschrocken und konnte vor Angst kaum atmen. Mit halboffenem Mund und hohlen Augen starrte er mich an, versuchte mir etwas zu sagen und stammelte Worte, die ich nicht verstand. Schon nach kurzer Zeit schien er zu begreifen, dass sie mich nicht erreichten. Er stöhnte leise, wandte sich von mir ab und ging davon. Einmal noch drehte er sich um, um dann endgültig hinter unserem alten Hühnerstall zu verschwinden.
Diese Begegnung hat sich tief in mir eingegraben und mich noch jahrelang in meinen Träumen verfolgt. Bis heute bin ich mir nicht sicher: War das ein Traum, oder habe ich das wirklich erlebt?
In jenem Hühnerstall sah ich auch in regelmäßigen Abständen dabei zu, wie mein Vater unsere Hühner schlachtete. Mit einer Axt in der Hand trat er zur Tür herein, griff sich das erstbeste ahnungslose Tier, drückte es auf einen Holzblock und hackte ihm den Kopf ab – was die anderen Hühner naturgemäß in Todesangst versetzte, sie aufscheuchte und panisch werden ließ. Das gerade erst geköpfte Huhn flatterte noch eine Weile durch die Luft, bevor es dann endgültig auf dem Boden aufschlug und zuckend verstarb.
Einmal tauchten zwei Männer bei uns auf, die wir noch nie gesehen hatten und die sich direkt auf unser Haus zu bewegten. Irritiert und seltsam unentschlossen ging mein Vater ihnen entgegen. Er sprach sie an und ich konnte sehen, wie er im Verlauf des Gesprächs mit ihnen förmlich in sich zusammensackte und immer mehr verstummte. Nach einer guten Viertelstunde verabschiedeten sich die beiden hageren Gestalten, grüßten noch einmal aus der Ferne und waren kurz darauf verschwunden. Zögernd kam mein Vater zu uns zurück und war plötzlich ein anderer Mensch. Er musste etwas Entsetzliches erfahren haben, etwas, das ihn nachhaltig zu beschäftigen schien, und ich konnte spüren, dass er viel zu schwach war für die zentnerschwere Last, die man ihm da gerade aufgeladen hatte. Viele Jahre später erzählte mir mein Bruder Wolf, dass unser Vater ihn einmal in einer schwachen Stunde und unter beträchtlichem Alkoholeinfluss ins Vertrauen gezogen hatte. Es ging um eine schwere Schuld, die der ehemalige Wehrmachtsangehörige wohl schon zu Beginn des Krieges auf sich geladen hatte, eine Schuld, die ihn Zeit seines Lebens verfolgen sollte. Nach diesem nächtlichen Geständnis musste der verängstigte Sohn schwören und feierlich versprechen, das ihm gerade Anvertraute nie zu verraten. Was dazu führte, dass der damals erst Siebenjährige fortan unter heftigen Gewissensqualen litt. Tatsächlich hielt sich mein zum Schweigen verpflichteter Bruder bis ins hohe Alter daran, das dunkle Geheimnis unseres Vaters für sich zu behalten. Selbst mir, seinem jüngeren Halbbruder, wollte er sich nicht anvertrauen. Nur manchmal, nach Jahrzehnten allerdings und in sehr seltenen Momenten, wenn wir unter vier Augen miteinander sprachen, konnte er es sich nicht verkneifen, mir nebulöse Bemerkungen zuzuraunen, die meine Neugier wecken sollten. Meine Schwester Monika wusste offensichtlich mehr. Sie äußerte die Vermutung, dass es um die Erschießung von holländischen Zivilisten gegangen sei, zu der man sich als Soldat habe freiwillig melden können – und dass die beiden Männer, die uns heimgesucht hatten, davon wussten und ihn erpressten. Ob mein Vater sich wirklich an einer dieser Exekutionen beteiligt hatte, konnte ich nicht herausfinden. Auffällig war nur, wie er sich während unserer späteren Urlaubsreisen, die er ausgiebig dazu nutzte, um ehemalige Kriegsschauplätze in Frankreich zu besuchen, verhielt. Wenn wir im Anschluss daran noch nach England zu seiner dort lebenden Schwester fuhren – das war in den frühen sechziger Jahren, also lange nach Kriegsende –, vermied er immer die Fahrt durch Holland. Dafür nahm er endlose Umwege über Belgien und Frankreich in Kauf. Wenn einer der Kinder das hinterfragte, sagte er nur, dass er seine Gründe habe und dass er darüber mit uns nicht sprechen wolle. Auch meine Mutter hüllte sich in Schweigen. Ihr Gesichtsausdruck verriet mir allerdings, dass sie irgendetwas wissen musste, was sie krampfhaft entschlossen für sich behielt.
6
Erlebnisse wie die meines Vaters sind mir in meinem Leben erspart geblieben. Ich wuchs auf in einem Land, das nichts mehr wissen wollte von Krieg und Vertreibung – in einer Zeit, in der sich die Davongekommenen um das eigene Wohlergehen kümmerten und Worte wie Schuld und Verantwortung nicht mehr in den Mund nahmen. Um uns herum erwachte das Wirtschaftswunder und anstatt ewig und drei Tage von einer unschönen Vergangenheit belästigt zu werden, ging man lieber ins Kino, wo der »Der Förster vom Silberwald« oder das »Schwarzwaldmädel« dafür sorgten, dass man auf andere Gedanken kam.
Wir waren arm, aber keiner war unzufrieden. Als Rektor verdiente mein Vater 300 D-Mark – das musste reichen für die nach dem Tod meiner Oma Grete nur noch sechsköpfige Familie. Fleisch gab es maximal einmal in der Woche, Butter wurde durch Margarine ersetzt und Weißbrot nur an Sonntagen zum Frühstück gereicht. Bei der akkuraten Verteilung der kostbaren Schnitten achtete meine Mutter stets genauestens darauf, dass keiner mehr als der andere bekam, und über die Woche mussten wir uns mit billigem Graubrot begnügen. Auch bei den Mittagsmahlzeiten wurde das Essen penibel portioniert und bis heute habe ich die Gewohnheit nicht abgelegt, in gemeinsamer Runde im Restaurant mit flüchtigem Blick zu kontrollieren, ob irgendjemand am Tisch eventuell mehr auf seinem Teller hat als ich. Und bis heute bin ich nicht in der Lage, altes Brot einfach wegzuschmeißen, da ich immer noch die Zeiten erinnere, in denen ich permanent Hunger hatte.
Ahrensbök, der Ort meiner Kindheit, ist ein Ort mit einer unheilvollen Vergangenheit, über die nach dem Krieg nicht gesprochen wurde und von der ich erst Ende der sechziger Jahre erfuhr. Wenige Kilometer außerhalb der Gemeinde hatte es ein Konzentrationslager gegeben. Es hatte Todesmärsche halb verhungerter Gefangener durch unser beschauliches Städtchen gegeben, was ein grauenvoller Anblick gewesen sein muss. Die Bewohner aber, die unmittelbaren Zeitzeugen dieses unbarmherzigen Geschehens, taten in Friedenszeiten so, als hätte das alles nicht stattgefunden. Was sie noch wussten und was sie gesehen hatten, behielten sie für sich. Sie konzentrierten sich einzig und allein aufs Verdrängen und Vergessen.
Doch zurück zu einem familiären Sonntag. Da unsere Toilette verstopft war, öffnete mein Vater die übervolle Fäkaliengrube direkt vor unserer Haustür, um sie mit Hilfe einer Schaufel zu entleeren. Sein Körper rebellierte heftig, und vergeblich versuchte er, sich gegen die Übelkeit aufzubäumen. Die röchelnden, fast schon animalischen Geräusche, die mein Vater von sich gab, hallen mir noch heute in den Ohren. Zu einer geradezu irrwitzigen Angelegenheit aber wurde das Ganze erst dadurch, dass er das unerfreuliche Geschäft über eine geschlagene Stunde lang in einem blütenweißem Hemd betrieb – wofür es einen einfachen Grund gab: Es war Sonntag, und am Sonntag trug man in den fünfziger Jahren immer ein weißes Hemd – unter allen Umständen.
An den Samstagabenden wiederum gab es ein festes Ritual: Es wurde gemeinsam gebadet. Wir besaßen eine Wanne mit einem großem Boiler, dessen Wasser mit Holzfeuer erhitzt werden musste. Der Erste, der ins Wasser stieg, war mein Vater, danach war meine Mutter dran und erst dann kam die Kinderschar an die Reihe. Wenn ich am Ende als Jüngster und Letzter in die fast schon kalte Brühe steigen durfte, konnte von einem Badevergnügen keine Rede mehr sein.
Es gibt gewiss auch schöne Erinnerungen an die frühen Jahre in Ahrensbök. Zum Beispiel, wenn ich meiner Mutter in der Küche beim Backen zusah. Wenn wir den fertigen, herrlich süß riechenden Kuchen aus unserem uralten, gusseisernen Herd holten und ich immer als Erster ein Stück davon probieren durfte. Oder wenn ich an kalten Tagen durch die Gegend streifte und die eisige Luft nach Schnee und verbrannter Kohle roch – und ich dann wieder nach Hause kam und mich eine wohlige Wärme empfing … Wenn mein Vater als Direktor der Mittelschule mich mit in die schuleigene Werkstatt nahm und wir gemeinsam bastelten und Spielzeug aus Holz anfertigten … Wenn wir Kinder an Weihnachten aus der Kirche kamen, durch den Schnee stapften und uns auf die bevorstehende Bescherung freuten … Wenn wir, weil wir es kaum erwarten konnten, einen Blick durch das Schlüsselloch wagten und im Wohnzimmer den festlich geschmückten Tannenbaum sahen, unter dem die bunt eingepackten Geschenke lagen. Wenn wir dann endlich, nach dem lang ersehnten Klingeln der Weihnachtsglocke, eintreten durften und ich restlos überwältigt war vom strahlenden Lichterglanz und der festlichen Atmosphäre – das waren Momente des Glücks, in denen ich mich geborgen fühlte.
7
Im Alter von sechs Jahren wurde ich eingeschult. Die Position meines Vater muss wohl der Grund dafür gewesen sein, dass mich alle Lehrer, mit denen ich es zu tun bekam, mit vorauseilendem Wohlwollen behandelten. Nur so nämlich konnte es geschehen, dass ich am Tag meines siebten Geburtstags mit Blumen beschenkt werden sollte. Doch der Reihe nach: Am Morgen meines Ehrentags machte ich mich wie immer auf den Weg. Kaum hatte ich die nahegelegene Allee erreicht, ließ mich der gellende Schrei einer Mädchenstimme zusammenzucken: Chriiiiistian! Ich drehte mich um und erblickte die dicke Astrid aus meiner Klasse nur wenige Meter hinter mir. Keuchend, mit ausgestrecktem Arm und einem Blumenstrauß in der Faust, versuchte sie mich einzuholen. Ihr Anblick versetzte mich derart in Panik, dass ich auf der Stelle losrannte, um dieser aufdringlichen Gratulantin zu entkommen. Als ich schließlich in der Schule angekommen war und das Klassenzimmer betrat, waren alle schon versammelt. Man gratulierte mir im Chor, ich stand verlegen herum, fühlte mich absolut nicht wohl – und der über und über mit Blumensträußen dekorierte Tisch gab mir den Rest. Kurz entschlossen beendete ich den improvisierten Festakt und wischte die liebevoll gestaltete Geburtstagsdekoration mit einer forschen Armbewegung vom Tisch. Erschrocken schauten meine Mitschüler auf die unschuldigen, misshandelten, am Boden liegenden Blumen, und tagelang sprach keiner auch nur ein Wort mehr mit mir.
Ein solches Verhalten meinerseits aber war eher die Ausnahme. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich immer ein sehr liebes Kind gewesen. Stets gehorchte ich meinen Eltern, ohne zu widersprechen oder auch nur zu murren. Ein einziges Mal jedoch konnte auch ich nicht an mich halten. Meine beiden Schwestern hatten mich zum wiederholten Male mit irgendetwas derart gepiesackt, dass ich mir in meiner Wut nicht mehr zu helfen wusste und mich in das neue Kleid von Gisela verbiss, um es mit den Zähnen zu zerfetzen. Dafür bekam ich dann von meinem Vater die schlimmste Tracht Prügel, die ich je über mich hatte ergehen lassen müssen.
»Hansi ist tot!«, rief meine Mutter eines Morgens und scheuchte damit die ganze Familie auf. Alle eilten ins Wohnzimmer und sahen das schreckliche Geschehen. Unser geliebter blauer Wellensittich war über Nacht von seiner Stange gefallen und lag nun regungslos auf dem Boden seines Käfigs. Allgemeine Erschütterung machte sich breit und viele Tränen flossen. Mein Vater verlor sich in Betrachtungen über die Endlichkeit des Daseins, meine Mutter trauerte um den freundlichen Gesang des Vogels und wir Kinder vermissten nun einen Freund, dem wir heimlich alles anvertrauen konnten.