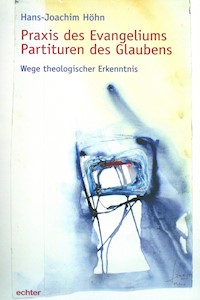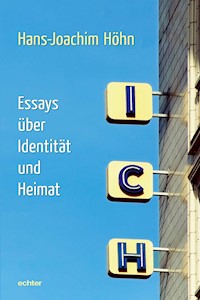Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
„Mach's gut!", das wünschen wir einander beim Abschied. Wie aber macht man es das Leben gut, wie bringt man sein Leben selbstbestimmt in Form? Die Moderne verspricht: Es ist leicht, ein eigener Mensch zu sein. Vom Ideal der Selbstbestimmung bleibt angesichts wirtschaftlicher Zwänge und biologischer Bedingtheiten allerdings oft nicht viel übrig. Gründe für dieses Ideal lassen sich aber finden, wenn man dem Leben auf den Grund geht. Eine solche Grundlagenreflexion bietet Höhn. Er reflektiert - gründlicher als gängige Lebenskunstkonzepte - wie ein vielfach begrenztes Leben zu einem gestaltbaren, gelingenden Dasein werden kann. Dabei entwickelt er ein Modell, wie man auf zeit- und sachgemäße Weise philosophische Aufklärung, religiöse Inspiration und praktische Lebenskönnerschaft verknüpfen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Joachim Höhn
Das Leben in Form bringen
Konturen einer neuen Tugendethik
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © grgroup/123RF Stock Photo
ISBN (E-Book) 978-3-451-80133-4
ISBN (Buch) 978-3-451-34035-2
Inhalt
Vorwort
I. Zeitdiagnose:Das Leben gut sein lassen!?
1. „Mach’s gut!“Mit einem Imperativ leben
1.1 Geht’s gut?Leben im Widerstreit von Leben und Tod
1.2 „Auf geht’s!“Vom guten Leben im richtigen
2. „So geht’s nicht!“(K)ein eigener Mensch sein können
2.1 Eigenes Leben?Individualisierung und Vergesellschaftung
2.2 Freies Leben?Zumutungen und Überforderungen
3. „Es geht doch!“Ermutigungen und Versprechungen
II. Sich auf das Leben einlassen:Anthropologie als Existentialpragmatik
1. Dasein – Sprache – Vernunft:Existentialpragmatische Anthropologie
2. Was es heißt, in der Welt zu sein:Existenz und Relation
2.1 Elementar:Selbst und Andersheit
2.2 Unabstreifbar:Zeit und Raum
2.3 Unabdingbar:Sprache und Bedeutung
2.4 Unhintergehbar:Existentiale relationalen Daseins
2.5 Unabweisbar:Gefühle und Stimmungen
3. Etwas aus sich machen:Limitationen des Daseins – Konturen der Vernunft
3.1 Endlich:Dasein am Limit
3.2 Basal:Weltbezüge – Handlungsinteressen – Werte
3.3 Regulativ:Rationalitätstypen und Reflexionsstufen
3.4 Normativ:Ethische Reflexionslogik
3.5 Operativ:Praktische Vernunft und vernünftige Praxis
3.6 Emergent:Natur – Kultur – Daseinsakzeptanz
III. Ein eigener Mensch sein:Ethik der Lebenskunst
1. Perspektivenwechsel:Ethik im cultural turn
2. Mensch sein können:Existentialpragmatik – Tugendethik – Lebenskunst
2.1 Haltungen, die Halt geben?Kritik und Aktualität klassischer Tugendkonzepte
2.2 Widerstrebendes in Balance bringen:Konturen einer existentialpragmatischen Tugendethik
2.3 Moralische Intelligenz:Die Vernunft der Tugenden
2.4 (K)eine Gefühlssache?Ethik und Lebenskunst
3. Wofür der Mensch nichts kann:Anfang und Ende der Moral
3.1 „Nichts zu machen“?Bestreitungen moralischer Autonomie
3.2 „Gut genug?“Sinnbedingungen eines guten Anfangs
3.3 „Inakzeptabel?“Das Leben annehmen – dem Unannehmbaren zum Trotz
3.4 Wollen ohne Können:Überforderte Vernunft?
IV. Was sollen wir tun? – Was dürfen wir hoffen?Die Moral der Transzendenz
1. Ethik im religious turn:Über die Vernunft hinaus?
1.1 Prekäre Beziehungen:Religion und moralische Autonomie
1.2 Kritische Koexistenz:Religion, Vernunft und Moral
2. Rettende Aneignung?Ethik und Eschatologie
2.1 Beeil dich!Der Anspruch des kinetischen Imperativs
2.2 Moralität und Endlichkeit:Im Widerstreit von Vernunft und Zeit
2.3 Endlich leben:Die Moral der Hoffnung – die Hoffnung der Moral?
2.3.1 Hoffnung im Widerstreit:Über die Wirklichkeit hinaus – an der Realität vorbei?
2.3.2 Dem Misslingen die Stirn bieten:Hoffnung als Postulat der Vernunft
3. Transzendenz und Moral:Ethik in theologischer Perspektive
V. Epilog:… und am Ende ein gnädiger Tod?
Auswahlbibliographie
Vorwort
„Na, dann mach’s mal gut!“ – Mit diesem Satz enden oft Abschiedsszenen. Dabei gibt ein Wort das andere: „Ja, du auch – mach’s gut!“ Danach trennen sich die Wege zweier Menschen. Andernorts und je für sich wollen sie etwas Neues anfangen. Sie setzen darauf, dass es ihnen dabei gut (er)gehen wird. Aber in ihren Abschiedsworten steckt auch eine Warnung: Ohne eigenes Zutun wird nichts Gutes aus diesem Anfang werden.
Eine solche Warnung auch an den Beginn einer längeren Abhandlung zu Schnittstellen zwischen Anthropologie und Ethik zu setzen, ist riskant. Sie weckt die Befürchtung, sich der strapaziösen Lektüre eines komplizierten Textes stellen zu müssen. Darum sei gleich eine Entwarnung erteilt. Das Thema der folgenden Erörterungen lässt sich recht einfach bestimmen: Es geht um die Frage, wie man es am besten anstellt, auf menschliche Weise am Leben zu sein. Wie man dies bewerkstelligt, ist allerdings nicht nur eine Angelegenheit der richtigen Praxis. Man muss vorher wissen, was man will und wie man’s macht. Zur richtigen Praxis anzuleiten, setzt daher durchdachte Anleitungen voraus. Diese zu durchdenken, verlangt Kopfarbeit, deren Ergebnis eine möglichst gute Theorie sein sollte. Für Theorie und Praxis ist dieselbe Frage zentral: Was kann ein Mensch tun, damit es ihm gut geht und sein Dasein möglichst gut ausgeht?
Auf einfache Fragen sind jedoch nur selten einfache Antworten möglich. Bei der Erkundigung nach einem guten Ausgang menschlichen Daseins ist dies nicht anders. Denn hier verläuft in Theorie und Praxis der Weg zu einem guten Ende nicht geradeaus. Mit unpassierbaren Abschnitten und Sperrungen ist zu rechnen. Oft sind Um- und Irrwege nicht zu unterscheiden. Man muss sich darauf gefasst machen, unterwegs merkwürdige Bekanntschaften zu machen und unliebsame Überraschungen zu erleben. Und immer wieder wird man die Route überprüfen, vielleicht sogar korrigieren müssen. Planung und Durchführung dieser Studie zu den Bedingungen und Umständen ethischer Lebenskönnerschaft machen davon keine Ausnahme – und bei der Lektüre dieses Buches wird es auch nicht anders sein.
Am Anfang stehen zeitdiagnostische und kulturkritische Beobachtungen zum Versprechen der Moderne, dass mit ihr die Zeit gekommen sei, in der es leicht falle, ein eigener Mensch zu sein (I.). Da es mit der Einlösung dieses Versprechens Schwierigkeiten gibt, bieten sich seit geraumer Zeit Anleitungen zur Lebenskunst als Problemlöser an. Sie wenden sich an Menschen, die angesichts politischer Unübersichtlichkeit und wirtschaftlicher Unsicherheit zum Trotz, aber auch im Wissen um tiefe Risse in ihrer Biographie das Projekt eines selbstbestimmten und sinnerfüllten Lebens nicht aufgeben wollen. Wer sich das Ideal eines geglückten Daseins durch keine Krisendiagnose ausreden lassen will, muss dafür gute Gründe haben. Diese lassen sich aber nur finden, wenn man dem Leben auf den Grund geht.
Für eine solche Grundlagenreflexion wird im Folgenden das Methoden- und Begriffsinstrumentarium einer philosophischen Existentialpragmatik zur Verfügung gestellt (II.). Die Frage, was es heißt, in der Welt zu sein und ein Leben angesichts vielfacher Begrenzungen führen zu müssen, wird hier mit einer Gründlichkeit gestellt, der Lebenskunstkonzepte meist ausweichen. Aber ohne ein Nachdenken über Grund und Grenzen des Daseins ist auf solche Konzepte wenig Verlass. Wer darauf verzichtet, die anthropologischen, rationalitäts- und handlungstheoretischen Parameter ethischer Lebenskönnerschaft zu rekonstruieren und dabei ihre gesellschaftlichen Bedingungen in den Blick zu nehmen, wird wenig ausrichten mit Ratschlägen, wie ein Mensch sich in den Nöten des Lebens behaupten kann. Es braucht dazu auch ein Wissen darüber, was es eigentlich heißt, als Mensch heute derart am Leben zu sein, dass es dabei vernünftig zugeht. Damit ist jedoch noch nicht gewährleistet, dass der Einsatz dieses Wissens zu einer Lebenspraxis führt, bei der alles gut geht.
Wenn das, was man vernünftig angeht, auch gut weitergehen soll, bedarf es des Zusammenspiels von Vernunft und Moral im konkreten Lebensvollzug. Lebenskönnerschaft lässt sich nicht von Generation zu Generation vererben. Sie muss je neu erworben werden. Wie man die hierfür notwendige Intelligenz entwickelt und anwendet, ist das zentrale Thema der klassischen Tugendethik. An ihr Niveau der Problembearbeitung reichen moderne Lebenskunstkonzepte bei weitem nicht heran. Sie verdecken aber diesen Mangel mit dem Gestus, die Enge des Räsonierens und Moralisierens überwunden zu haben. Will man sich dafür aber nicht neue Vagheiten in Sprache und Sache einhandeln, bedarf es einer doppelten Anstrengung. Es gilt, auf zeit- und sachgemäße Weise ethische Intelligenz und praktische Lebenskönnerschaft zu verknüpfen. Für diese Neuformatierung der Tugendethik wird ebenfalls ein existentialpragmatischer Zugang gewählt (III.).
Wenn das Vermögen, in und aus menschlichen Nöten jene Tugenden zu entwickeln, mit denen existenzielle Herausforderungen gemeistert werden können, von jedem Menschen neu zu erwerben ist, dann stellt sich Lebenskönnerschaft erst mit der Zeit ein. In der Moderne läuft dem Menschen jedoch die Zeit davon. Hier regiert der „kinetische Imperativ“. Angesichts befristeter Lebenszeit muss alles in der Welt immer schneller immer besser werden, damit das Leben für den Menschen in der Welt akzeptabel wird. Zugleich muss sich der Mensch beeilen, im Leben etwas vom Leben zu haben. Gerade eine befristete Lebenszeit nötigt dazu, nicht in den Tag hinein zu leben, sondern über den Tag hinaus zu planen. Aber wie weit soll diese zeitliche Orientierung gehen – auch über den eigenen letzten Tag hinaus? Warum soll man sich an Maßnahmen zur Daseinsoptimierung und Weltverbesserung beteiligen, wenn man nicht mehr zu jenen gehört, welche die Früchte eines solchen Einsatzes ernten? Der kinetische Imperativ hat dafür gesorgt, dass aus den Zeitsemantiken moderner Gesellschaften all jene Gehalte verschwunden sind, die Hoffnungen auf ein Ende der (Welt- und Lebens-)Zeit beschreiben, das nicht Abbruch, sondern Vollendung bedeutet. Sie finden sich nur noch in den Partituren eines religiösen Zukunftsverhältnisses. Die Tugend der Hoffnung entwirft dort das Modell einer Praxis, in der illusionslos die ernüchternden Umstände moralischen Handelns wahrgenommen werden und zugleich dagegen protestiert wird, aus diesen Widrigkeiten auf die Vergeblichkeit dieses Handelns zu schließen. Wer hofft, setzt „kontrafaktisch“ auf den guten Ausgang eines Tuns, dessen Gelingensbedingungen von den Umständen des Handelns her nicht einsichtig sind.
Religionskritiker wittern hier bereits den Konflikt mit einem Verständnis von Autonomie, wonach die Vernunft nicht zu Handlungen verleitet werden darf, die sich außerhalb der von ihr ermittelten Ermöglichungsbedingungen bewegen. Es kann aber durchaus sein, dass die Vernunft gerade um ihrer Rationalität und Moralität willen auf ein solches „Außerhalb“ Bezug nehmen muss. In welcher Weise hier ein Transzendenzbezug ins Spiel kommt, sucht eine existentialpragmatisch ansetzende „Ethico-Theologie“ (Immanuel Kant) zu ermitteln, für die Hoffnung kein Widerpart moralischer Autonomie, sondern ein Vollzugsmoment von Rationalität und Moralität darstellt (IV.).
Zur Einübung einer erfolgreichen Praxis anzuleiten, ist Anspruch einer jeden guten Theorie. Zugleich kommt damit ihre Beschränkung in den Blick. Gute Theorien allein bewirken noch nichts Gutes. Es bedarf des richtigen Tuns – und des eigenen Zutuns. Gute Theorien erkennt man daran, dass sie in diesem Sinne unfertig sind. Darum steht auch am Anfang dieses Buches die Einschränkung: Es handelt sich um eine Theorie, der noch eine Zutat fehlt. Ohne intellektuelle Eigenbeteiligung bereits beim Lesen wird aus ihr nichts Ganzes werden. Und ohne eigenes Zutun bei ihrer praktischen Umsetzung wird aus ihr auch nichts Gutes werden.
Köln im Herbst 2013
Hans-Joachim Höhn
I. Zeitdiagnose: Das Leben gut sein lassen!?
„Mach’s gut!“ – Mit diesem Imperativ kann man den Gegenstand der Ethik durchaus treffend definieren. Hier geht es um ein gutes Tun und um gute Taten. Dennoch handelt es sich hierbei um einen ungenauen Imperativ. Er lässt nämlich offen, was denn gut zu machen ist. Sucht man nach einer präziseren Bestimmung, so ist zu hören: Es geht um das Leben. Gegenstand der Ethik und Inhalt ihrer Imperative ist das gute Leben. Allerdings versteht sich auch diese Auskunft nicht von selbst. Es ist keineswegs ausgemacht, dass sie als ethischer Satz verstanden wird. Was heute „gut leben“ heißt, kann auch auf die gänzlich unmoralisch gemeinte Frage bezogen werden, wie man gut durchs Leben kommt. Hierbei ist der grammatische Status des Begriffs „gut“ aufschlussreich. Aus einem Adjektiv – das „gute“ Leben – wird ein Adverb: wie man „gut“ lebt. Die adverbiale Fassung der Frage nach dem Guten ist leichter zu beantworten als die adjektivische: Gut durch’s Leben kommen, kann heißen: „Lass es Dir gut gehen, mach es Dir bequem, statte Dein Dasein mit Annehmlichkeiten aus! Sieh zu, dass Du auch unter ungünstigen Bedingungen das Bestmögliche aus Dir und Deinem Leben machst! Handle so, dass Du, wenn Du stirbst, sagen kannst, dass du das Maximum aus Deiner Lebenszeit herausgeholt hast!“
1. „Mach’s gut!“ Mit einem Imperativ leben
Das bestmögliche Leben wird in der Moderne gleichgesetzt mit einem Maximum. Aber die moderne Welt kennt kein Maximum. Sie steht im Zeichen eines kategorischen Komparativs: schneller, höher, weiter! Alles, was es in dieser Welt gibt, steht unter einem Verbesserungs- und Optimierungsvorbehalt. Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Es gibt kein Optimum – selbst das Maximum ist kein Optimum. Denn optimal wäre nur jenes, das keine Verbesserungen mehr zulässt. Aber dafür ist in der modernen Welt kein Platz. Modern sein heißt: Raum lassen und Platz machen für das Neue, Bessere.
Was nicht mehr optimierbar ist, hat bereits seine beste Zeit hinter sich. Es muss ersetzt werden durch etwas, das noch Qualitätssteigerungen zulässt. Für die Moderne ist jene Welt die beste aller möglichen, in der es möglich ist, stets mehr zu wollen und zu werden als zuvor. Wachstum, Fortschritt, Wandel, Innovation – sämtliche Leitbegriffe der Moderne folgen einer Logik der Steigerung.1 Ihre Devise lautet nicht „Mach’s gut!“, sondern: „Mach’s besser!“ Das Bessere aber ist der Widerpart des Guten.
Darum fällt es auch viel leichter, moderne Antworten zu geben auf die Frage, wie ein besseres Leben aussieht, als zu sagen, was zu einem guten Leben gehört. An jedem Zeitungskiosk gibt es hierfür zahlreiche Angebote: „Schöner wohnen!“ – „Schöner essen!“ Diese Illustriertentitel zeigen, dass die Moderne auf die Fragen nach dem besseren Leben mit einem ästhetischen Imperativ reagiert: Besser wird’s, wenn’s schöner wird! Und damit man auf ein besseres, schöneres Leben nicht allzu lange warten muss, wird umgehend ein kinetischer Imperativ hinzugefügt: „Mach schneller mit der lebensverbessernden Daseinsverschönerung! Beeile Dich mit Verbesserungsverschönerungen!“2 Deswegen scheint auch eine Schlüsselqualifikation des modernen Menschen darin zu liegen, dass er flexibel, mobil und beschleunigungsfähig ist. Er muss in der Lage sein, sich und den Dingen um ihn herum Beine zu machen, damit sie in Bewegung kommen – zum Besseren hin.3
Für die unterschiedlichen Bestimmungen eines guten Lebens ist damit jedoch kein gemeinsamer Fluchtpunkt gefunden. Denn die Bewertungsstandards „gut“ und „besser“ sind vielfältig definierbar und einsetzbar. Die Bandbreite reicht von der funktionalen Eignung eines Mittels für das Bewirken von erwünschten Folgen (z. B. ein gutes Medikament für die Überwindung einer Krankheit) über die Bewertung einer Handlungsabsicht bzw. Motivation in Bezug auf ein Handlungsziel (z. B. ein guter Vorsatz, um sich ein Laster abzugewöhnen) bis hin zur Qualifizierung von Kompetenzen eines Handelnden (z. B. ein guter Arzt), der Art und Weise, eine Handlung zu vollziehen (z. B. guter Stil), oder zur Beschreibung der Qualität einer Handlungssituation im Ganzen (z. B. gute Atmosphäre). Für eine befriedigende Auskunft auf die Eingangsfrage reichen diese am Muster der Zweckmäßigkeit, Effizienz und Professionalität bzw. am Ideal ökonomisch-technischer und ästhetischer Optimierungsrationalität orientierten Auskünfte ohnehin nicht aus. So einfach lässt sich die adjektivische Fassung der Frage nach dem guten Leben nicht mit einer Antwort im Vorfeld der Ethik abgelten.4
Außerdem sind mit der Unterscheidung einer adjektivischen und adverbialen Fassung des guten Lebens die Möglichkeiten der Grammatik noch nicht ausgeschöpft. Es besteht ja auch die Möglichkeit einer Nominalbestimmung des Guten. Dann könnte man vielleicht sogar behaupten: Es tut dem Menschen gut, wenn er das Gute tut! Letztlich ist es die Orientierung an einem „höchsten Gut“, das ein Leben gut werden lässt! Aber welches Gut dient als letzter Bezugspunkt und verdient tatsächlich für unübertrefflich, vollkommen, unbedingt und „ohne Wenn und Aber“ erstrebenswert gehalten zu werden?5
Ist das gute Leben eine Frage des physisch-psychischen Wohlergehens oder des materiellen Wohlstandes? Oder kommt es auf beides an: Gesundheit und Geld? Hängt der Erwerb und Erhalt von beidem allein von unserem Tun ab oder braucht es für beides günstige Umstände, die herbeizuführen nicht eine Angelegenheit menschlicher Machbarkeit ist? Ist es in diesem Sinne (reine) Glückssache, ob man ein gutes Leben führen kann?
Ist ein Leben dann gut, wenn man darin genügend Gutes tut? Soll man sich im Großen wie im Kleinen für hehre Ziel einsetzen: Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit? Wenn allerdings auch beim Erreichen dieser Ziele nicht alles in der Macht des Menschen steht oder wenn hohe Ideale sich als unerreichbar erweisen, genügt dann wenigstens der gute Wille? Wenn schon widrige Umstände gute Taten verhindern, ist dann nicht das Wollen des Guten die einzige Möglichkeit, wie das Gute zu Bewusstsein und in die Welt kommt?
Genügt es nicht, sich darauf zu konzentrieren, was dem einzelnen Menschen „gut tut“: die Erfüllung von individuellen Wünschen, Bedürfnissen, Sehnsüchten? Sollte man nicht die Gesundheit ins Zentrum stellen, denn sie ist zwar bekanntlich nicht alles, aber ohne sie ist alles angeblich nichts bzw. nicht mehr viel wert?
Ist das Leben im Ganzen dann gut und gelungen, wenn in ihm mehr gelingt als missglückt? Was aber macht das Gute aus, das man wollen kann und tun soll, wenn die Kriterien des ästhetisch Ansehnlichen, psychisch Wohltuenden, sozial Gewinn- und individuell Nutzbringenden zu kurz greifen? Sollte man sich damit bescheiden, ein Leben „gut“ zu nennen, das mit einem Minimum an Schmerz, Leid, Enttäuschung und Entbehrung aufwartet? Soll man es mit der Vermeidung des machbaren Unglücks und der Linderung des schicksalhaften Unglücks gut und genug sein lassen?
Gibt es ein von allen bisherigen Bestimmungen verschiedenes „höchstes Gut“, das um seiner selbst willen anzustreben ist und unabhängig von einem unmittelbaren Handlungserfolg oder -misserfolg dabei dem Leben die Ausrichtung auf ein sinnstiftendes „Worumwillen“ ermöglicht? Liegt der entscheidende Maßstab im Blick auf das, worauf es einem Menschen
in
seinem Leben ankommt oder worauf er
mit
seinem Leben abzielt?
In all diesen Fragen stecken Thesen und darin wiederum Lebens- und Handlungsentwürfe. Und hinter diesen Entwürfen stehen durchaus imponierende Theorien einer Strebens-, Pflicht-, Güter-, Wert- und Nutzenethik.6 Wenn die Bevorzugung eines bestimmten Entwurfes allerdings nicht bloß ein dezisionistischer Akt sein soll, muss es Vorzugsregeln geben, die sich plausibel rechtfertigen lassen. Aber woran soll man Maß nehmen, um Maßstäbe zu entwickeln, mit denen sich ermessen lässt, eine gute Wahl (in Theorie und Praxis) getroffen zu haben?
Bei der Suche nach dem guten Leben und einer überzeugenden Ethik sind nur dann Erkenntnisgewinne zu erzielen, wenn man hierbei das Spezifikum der Qualität eines Menschenlebens bedenkt. Es ist also unumgänglich, Anthropologie und Ethik zueinander in Beziehung zu setzen. Unter dieser Rücksicht lautet die Ausgangsfrage an die philosophische Anthropologie bei dem Versuch, einen ethisch-anthropologischen Basiszusammenhang freizulegen, jedoch nicht: Was ist der Mensch? Vielmehr ist zu fragen: Wie geht es, ein Mensch zu sein? Wie stellen wir es an, damit es (uns dabei) gut (er)geht?
An die Stelle einer abstrakten Wesensbestimmung des Menschen setzt die Moderne ohnehin seit geraumer Zeit eine pragmatische Variante, die den Lebensvollzug ins Zentrum stellt und wissen will: Wer sind wir, wenn wir unser Dasein führen (müssen)? Was sagt es über den Menschen aus, wenn er sein Leben tätig zustande bringen muss – als animal laborans?7 Daran schließt sich die ethische Frage an: Was ist zu tun oder zu lassen, dass es gut geht, ein Mensch zu sein? Wie kann man auf gute Weise Mensch sein? Von Seiten einer theologischen Anthropologie und Ethik ist zu erwarten, dass sie noch weitere Fragen anschließt: Kann das menschliche Leben gut ausgehen? Gibt es ein gutes Ende, das vielleicht nur Gegenstand des Hoffens, aber nicht Ergebnis menschlichen Tuns und Lassens ist?8 Muss es dem Menschen um mehr als sich selbst gehen, damit es ihm gut ergeht – und dies nicht erst, wenn er am Ende ist? Lässt sich die These, dass etwas dann gut ausgeht, wenn es gelungen ist, überhaupt auf das endliche menschliche Leben anwenden? Wie lassen sich Kriterien und Ermöglichungsbedingungen eines guten Lebens identifizieren und seinem tödlichen Ende zum Trotz umsetzen?
1.1 Geht’s gut? Leben im Widerstreit von Leben und Tod
Am Ende eines jeden Lebens steht unausweichlich der Tod. Er dementiert mit Nachdruck die Hoffnung, dass menschliches Leben gelingen oder glücken könnte. Dass sich der Mensch damit nicht abfinden will, mag ein trotziger Ausdruck dieser Hoffnung sein. Aber er bestätigt lediglich die Einsicht, dass am Leben sein heißt: in der Gegensatz-Einheit von Leben und Tod existieren. Menschen kommen als Sterbliche zur Welt.9 Wer am Leben ist, muss seine Sterblichkeit akzeptieren – und bekämpfen. Beides – Akzeptanz und Widerstand – geschieht um des Lebens willen. Beides bestimmt grundlegend die Lebenspraxis des Menschen, der um des Lebens willen ein widerständiges Verhältnis zum Tod aufnehmen muss.
Darum sind sämtliche Anstrengungen darauf gerichtet zu entdecken, wo der Tod auf den Menschen lauert. Und zugleich geht es darum, ihn aufzuhalten oder sein Kommen zumindest zu verzögern.10 Denn am Leben sein heißt: den Unterschied zum eigenen Nichtsein wahren. Menschen sind nur solange am Leben, wie sie sich von ihrem eigenen Nichtsein unterscheiden. Und nichts wünschen sie sich mehr, als bleibend von diesem Nichts verschieden zu bleiben. Zeit ihres Lebens leben sie in der Opposition zum Tod, auch wenn sie gezwungen sind, um des Lebens willen die Gegensatz-Einheit von Leben und Sterben widerständig anzunehmen. Sie übernehmen und akzeptieren diese Gegensatz-Einheit, ohne darin die Opposition gegen den Tod aufzugeben.
Dieses Verhältnis zum Verhältnis von Leben und Tod wird bislang für jeden sterblichen Menschen letztlich jedoch zugunsten des Todes entschieden. Mit ihm enden alle Weltverbesserungs- und -verschönerungsunternehmen. Daher ist von vornherein die Opposition gegen den Tod zum Scheitern verurteilt. Am Ende ist immer der Tod der Stärkere. Was von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, ist eigentlich sinnlos. Damit bleibt auch unser Versuch, um des Lebens willen die Gegensatz-Einheit von Leben und Tod anzunehmen, letztlich nur ein Akt der Verzweiflung. Letztlich bleibt alles beim Alten. Der Tod ist der schlechthin Überlegene.
Dagegen wehrt sich der moderne Mensch und sucht nach Orten und Zeiten, wo dem Tod der Eintritt verwehrt ist – nach Orten, an denen wenigstens auf Zeit das Leben und die Lust daran erlebnisintensiv inszeniert werden. Die Tourismusbranche, die Unterhaltungsindustrie und die Betreiber von Vergnügungsparks tragen ihren Teil dazu bei. Am Ziel sind solche Bemühungen jedoch erst dann, wenn sie dem Tod derart den Zutritt ins Leben erschweren, dass auf Dauer der Gedanke an ihn gar nicht mehr aufkommt. Bis es dank des technisch-wissenschaftlichen und medizinischen Fortschrittes so weit kommt, wird noch geraume Zeit vergehen. Aber das bedeutet nicht, dass in dieser Zwischenzeit das Ziel nicht auch schon im Weg zu finden ist, sofern es gelingt, auf diesem Weg die Sterblichkeit des Menschen zu „dekonstruieren“.
Hierbei wird der große Kampf gegen den Tod in jeweils kleine Schlachten aufgelöst und das Leben mit der Abwehr nicht endgültiger, verhältnismäßig kleiner und somit lösbarer Fragen der Bewältigung von Todesrisiken ausgefüllt. Bekämpft wird nicht die Sterblichkeit; der Kampf gilt vielmehr möglichen Todesrisiken und Todesursachen. Gekämpft wird gegen bisher tödliche Krankheiten. Sie sind doch, wie leicht einzusehen ist, der konkrete Grund, warum ein Mensch sein Leben verliert. Jeder Sieg über bisher todbringende Infektionen und Tumore stärkt die Aussicht, dass es möglich ist, den erfolglosen Widerstand gegen den Tod zu transformieren in den erfolgreichen Kampf gegen die Ursachen des Sterbens. Die Kranken erfahren Stärkung und Ermutigung aus dem großen „noch nicht“ medizinischer Fortschritte. „Die nötigen Apparate wurden noch nicht entwickelt, der Impfstoff noch nicht entdeckt, die Technik noch nicht erprobt. Aber mit genügend Zeit und Geld wird dies möglich sein, und das sollte es auch“.11 Und wenn hier und jetzt alles doch nichts nützt bzw. zu spät kommt, hilft doch wieder die Hoffnung auf die Fortschritte der Technik: Die Palette reicht vom Tiefschlaf in Tiefkühlaggregaten, aus dem man erst in jenen Tagen auferweckt wird, wenn die heute noch tödliche Krankheit heilbar geworden ist, bis hin zur gentechnischen Reproduktion auf dem Weg der Klonierung, um bei Bedarf ein Duplikat des eigenen Organismus zur Verfügung zu haben, auf das über ein noch zu entwickelndes neuro-technologisches Verfahren die bis dato im Hirn gespeicherten Identitätsmuster überspielt werden können. In Zukunft soll niemand mehr sterben, nur weil die Menschen sterblich sind.
Diese Zukunftsvision unterstreicht: Gelingen und glücken kann offenbar nur ein Leben ohne den Tod – oder vor dem Tod. Da ein Leben ohne den Tod wohl eine Utopie bleiben wird, muss man sich darauf einstellen: Gelingen und glücken kann ein Leben nur auf Zeit. Dass es dem Menschen angesichts des Todes im Leben gut geht und dass es ein gutes Leben gibt, gilt nur unter dem Vorbehalt der Befristung des Guten und der Endlichkeit des Glücks. Unter diesem Vorzeichen kehren daher die Ausgangsfragen wieder zurück:
Wonach soll ich mich richten, damit ein endliches Leben als geglückt betrachtet werden kann?
Was kann ein befristetes Leben „gut“ machen? Inwieweit kommt es dabei auf das Tun und Lassen des Menschen an?
„Irgendwie geht’s schon!“ – Manchmal kann man sich auf die Maxime verständigen, dass sich im Leben zwar nicht alles nach eigenen Plänen und Kräften steuern lässt, es aber dennoch einen passablen Verlauf nimmt. Dahinter steht der Wunsch, dass das Gehen des Lebensweges selbst eine bestimmte Qualität haben soll: richtig gut! Erneut taucht die Frage auf, wonach sich ermessen lässt, wann es dem Menschen dabei so richtig gut geht. Hängt es davon ab, dass er einer bestimmten Richtung folgt und deswegen sein Weg richtig ist? Gibt es weitere Gesichtspunkte, die zu beachten sind, um auf dem richtigen Weg gut voranzukommen?
1.2 „Auf geht’s!“ Vom guten Leben im richtigen
Ob und wie man richtig gut durch das Leben kommt, ist nicht unabhängig von menschlichen Dispositionen und Qualitäten zu bestimmen. Gut voran kommen am ehesten Menschen mit entsprechender Kondition. Sie müssen gut in Form sein. Klassische bzw. antike Ethikentwürfe haben diesen Gedanken immer wieder betont. Es kommt darauf an, die Geistes-, Seelen- und Leibeskräfte des Menschen so in eine bestimmte Form zu bringen, dass daraus ein bestmögliches Format seiner Handlungen entstehen kann. Unter dieser Rücksicht werden auch adjektivische Bestimmungen eines guten Lebens möglich:12 Es ist gut für den Menschen, wenn er ein guter Mensch wird, indem er „richtig“ lebt und sich an eine geeignete Richtschnur hält, wobei er etwa
bestimmte Eigenschaften und Charakterzüge (Tugenden) erwirbt, die zur optimalen Ausformung dessen führen, was sein Menschsein ausmacht;
ein Leben gemäß seiner Wesensnatur führt, d. h. wenn er widernatürliche Neigungen und Praktiken meidet, und im Einklang mit seiner inneren und äußeren Natur lebt;
nicht nach Reichtum und Luxus, Karriere und Prestige, sondern nach höheren, immateriellen Gütern und Werten um ihrer selbst willen strebt;
bestimmte moralische (oder religiöse) Pflichten erfüllt, die über seinen Neigungen, subjektiven Interessen, Wünschen und Bedürfnissen stehen;
Tabus kennt und neben dem, was zu tun ist, auch lernt, was unbedingt zu unterlassen oder zu meiden ist.
In der Moderne hat sich die Ethik von adjektivischen Bestimmungen des guten und richtigen Lebens distanziert. Dies hat zu tun mit radikalen Umbrüchen in der Struktur von Kultur und Gesellschaft und mit ebenso radikalen Veränderungen der Zuordnung von Anthropologie und Ethik.13 Veränderte Lebensumstände schlagen durch auf eine Bestimmung gelingenden Lebens, die sich zunehmend an den Daseinsumständen orientiert und darum das Wort „gut“ adverbial versteht, d. h. mit den allgemeinen Umstandsbestimmungen individuell geglückten Daseins in Beziehung setzt und das Prädikat „gut“ selbst zu einer Umstandsbestimmung menschlicher Praxis macht, anstatt damit einen materialen Gehalt dieser Praxis auszuzeichnen.14
Je differenzierter und pluraler die Gesellschaft wird, umso schwieriger wird es festzustellen, was für alle gut ist. Bereits Immanuel Kant bezweifelte, dass eine inhaltliche Bestimmung des guten Lebens nach Vernunftprinzipien möglich sei. Es seien lediglich empirische Ratschläge zu erwarten, von denen die Erfahrung lehre, dass sie das Wohlbefinden am meisten befördern. Sie führten jedoch nicht zu sicheren und verallgemeinerungsfähigen Urteilen der Vernunft, denn wenn jemand Reichtum wolle, „wieviel Sorge, Neid und Nachstellungen, könnte er sich dadurch auf den Hals ziehen. Will er viel Erkenntnis und Einsicht, vielleicht könnte das ein nur um desto schärferes Auge werden, um die Übel, die sich für ihn jetzt noch verbergen und doch nicht vermieden werden können, ihm nur um desto schrecklicher zu zeigen … Will er ein langes Leben, wer steht ihm dafür, daß es nicht ein langes Elend sein würde.“15
Anstatt die Inhalte eines guten Lebens oder die Eigenschaften eines guten Menschseins zu bestimmen, werden in der Moderne Regeln, Verfahren und Strukturen ermittelt, die ein Arrangement ermöglichen, das unterschiedliche Vorstellungen vom guten Leben auf bestmögliche Weise zum Zuge kommen lässt. An die Stelle der materialen Bestimmung von Werten und Zielen, die alle Menschen realisieren sollten, tritt die Bestimmung von Regeln und Verfahren zur Bestimmung von Inhalten, denen möglichst alle zustimmen können. Favorisiert werden Ethikkonzeptionen, die sich auf Verfahren der Normenrechtfertigung konzentrieren, die allen Betroffenen die chancengleiche Teilnahme an Prozessen der Willensbildung und Entscheidungsfindung einräumen und alle Beteiligten auf das Erzielen eines rationalen Konsenses verpflichten.16 In der Ethik verlagert sich daher der Schwerpunkt vom „Guten“ und „Richtigen“ zum „Gerechten“:17
Wie muss eine Gesellschaft beschaffen sein, dass in ihr eine friedliche Koexistenz unterschiedlicher Vorstellungen vom guten Leben möglich ist?
Wie müssen unterschiedliche Vorstellungen vom guten Leben beschaffen sein, dass sie in einer Gesellschaft friedlich koexistieren können?
Die Moderne stellt nicht nur ein gelingendes Leben im Kontext eines gerecht organisierten sozialen Umfeldes in Aussicht. Sie verspricht dem Menschen auch, ein eigenes Leben führen zu können. Darin dürfte eine ethische Minimalbedingung eines guten Lebens überhaupt zu sehen sein: Nur ein eigenes Leben kann ein gutes Leben sein. Um dieser Eigenheit willen wird es auch als unangemessen empfunden, ein verallgemeinerbares Leitbild des Menschseins zu entwerfen oder Vorbilder, Ideale und Tugenden aufzulisten, denen man nacheifern soll. Um ein eigener Mensch sein zu können, will der moderne Mensch zunächst im Blick auf sich selbst (und allein) wissen: Was steckt eigentlich in mir? Was kann ich aus mir machen? Wie bringe ich es im Leben zu etwas? Wie komme ich in diesem Leben auf meine Kosten?
Allerdings erweisen sich naheliegende Vorschläge, wozu man es im Leben bringen könnte (eigenes Geld, eigenes Auto, eigene Wohnung), als noch nicht zureichend zur Bestimmung des eigenen Lebens. Auto, Geld, Wohnung wollen alle anderen ja auch!? Daher erweitert die Moderne das Versprechen eigenen Lebens: „Niemand hat Dir vorzuschreiben, wie Du leben sollst. Finde selbst heraus, was zu Dir passt! Führe kein Leben aus zweiter Hand. Schreibe Dir das Drehbuch Deiner Biographie selbst. Sei in einer Person Hauptdarsteller und Regisseur Deines Lebens! Such Dir selbst aus, was für Dich wichtig ist!“
Eine solche Aufforderung wird gern gehört. Zu einem guten Leben gehören zweifellos Freiheit und Selbstbestimmung. Zum eigenen Leben gehört auch, einen eigenen Willen zu haben und nach diesem Willen das Leben zu führen.18 Gleichwohl führt dieser Zusammenhang von Autonomie und eigenem Leben sogleich in neue Verlegenheiten: Wie findet man heraus, was man eigentlich und selbst will? Wonach soll man sich richten, um Maßstäbe der Selbstbestimmung zu gewinnen? Nur am Wollen, d. h. an der volitiven Qualität einer Handlung? Man sollte nichts tun, wenn man es nicht will? Folgt daraus, dass man nur tut, was man will und weil man es will? Ist der freie Wille die alleinige Quelle von Handlungsmotiven? Woran soll ein derart eigenwilliges, selbstbewusstes und freies Subjekt sonst noch Maß nehmen bei der Umsetzung eines selbstbestimmten Lebens? Sollte sich der Wille mit der Vernunft paaren, so dass ein vernünftiges Wollen entsteht? Aber kommt man beim Aufbau und bei der Umsetzung eines eigenen Willens allein mit der Vernunft aus? Kommt der Vernunft vielleicht nur ein Mitbestimmungsrecht (oder ein Vetorecht?) im Ensemble weiterer Faktoren und Antriebskräfte menschlichen Wollens und Tuns zu?19
Man hat wenig davon, ein eigener Mensch zu sein, wenn man nicht auch ein ganzer Mensch ist. Ganzheitlich Mensch zu sein, verlangt darum, auch das im Menschen wahrzunehmen, was diesseits und jenseits von Wille und Vernunft seinen Platz hat: Gefühle, Ängste, Sehnsüchte, Bedürfnisse, Triebe, Stimmungen. Diese Regungen im Blick habend, wird daher immer abzuwägen sein, inwieweit man sich von ihnen tatsächlich leiten lassen will. Selbstbestimmung verlangt innere und äußere Freiheit. Man wird gewiss kein eigener Mensch, wenn man die Bestimmung des eigenen Tuns und Lassens jeweils von Lust und Laune abhängig macht. Und ebenso wenig kann dies gelingen, wenn alles Selbstsein aufgesogen wird von Rollen und Funktionen, die dem Menschen von der Gesellschaft zugeteilt werden. Darum weist die Frage nach einem guten Leben, von dem bisher nur klar ist, dass es ein eigenes, freies und ganzheitliches Leben sein soll, in zwei Richtungen:
Wie kann man verhindern, dass man entweder Spielball gesellschaftlicher Zwänge und Moden wird oder an den Fäden der eigenen wechselnden Bedürfnisse und Lüste, Laster und Süchte hängt?
Wie muss eine Gesellschaft organisiert sein, dass sie es einem Menschen strukturell ermöglicht, ein eigenes und selbstbestimmtes Leben zu führen?
Diese doppelte Fragerichtung hat auch Folgen für Ansatz und Aufbau einer zeit- und sachgemäßen Ethik. Bei ihrer Sache ist die Ethik, wenn sie den Beitrag der Moral zum Projekt des „guten“ Lebens erörtert. Da sie diesen Beitrag derart ausarbeiten muss, dass er auf zeitgemäße Weise sachgerecht ausfällt, ist sie in der Moderne dazu übergegangen, die jeweiligen Zeitumstände in ihr Kalkül aufzunehmen. Dies könnte die Ethik zu einem Projekt des Zeitgeistes machen und sie von ihrer eigentlichen Sache entfernen. Bei der Abwehr dieses Verdachtes kommt ihr jedoch die Moderne zu Hilfe. Sie erklärt, dass sich der Geist dieser Zeit bereits selbst unter einen ethischen Anspruch gestellt hat. Die Moderne hat das Versprechen gegeben, dass mit ihr die Zeit gekommen ist, da nun jeder Mensch frei und für sich selbst bestimmen kann, welche Zwecke und Ziele er sich in seinem Leben setzen will. Verlangt ist nur, dass diese Zweck- und Zielbestimmungen vernunftgemäß erfolgen.20 Die Vernunft steht selbst unter dem sie unbedingt verpflichtenden Anspruch, in und mit der Zeit eine „moralische Weltordnung“ (Immanuel Kant) heraufzuführen, die einen Rahmen vorgibt für das Streben nach der Herstellung von Lebensverhältnissen, in denen es möglich ist, dass jedes Vernunftwesen als Zweck an sich selbst behandelt wird und zugleich eigene vernunftgemäße Zwecke jeweils für sich verfolgen kann.21
2. „So geht’s nicht!“ (K)ein eigener Mensch sein können
Es gibt Fragen, die sich immer wieder stellen. Dies liegt nicht daran, dass es für sie keine passenden Antworten gibt. Allerdings erweisen sich die Antworten nur unter einer bestimmten Hinsicht und zu einer bestimmten Zeit als überzeugend. Unter einer anderen Rücksicht und im Lauf der Zeit verlieren sie an Überzeugungskraft. Dies kann eine zweifache Ursache haben: Zum einen vermögen die Voraussetzungen, Herleitungen und Rechtfertigungen nicht mehr zu überzeugen, die zu einem bestimmten Entwurf guten Menschseins geführt haben.22 Zum anderen können sich die sozio-kulturellen Umstände und Bedingungen so verändert haben, dass diese Entwürfe nicht mehr praktikabel sind. Am Ende passen sie nicht mehr in die Zeit und stimmen mit anderen Einsichten nicht mehr überein. Lediglich die Fragen bleiben an der Zeit.
Genauso ergeht es dem großen Versprechen der Moderne: Eigenes Leben! Am besten kann man leben, wenn man ein eigener Mensch sein kann! Seit geraumer Zeit gibt es „im Westen der Welt wohl kaum einen verbreiteteren Wunsch als den, ein eigenes Leben zu führen. Wer heute herumreist und fragt, was die Menschen wirklich bewegt, was sie anstreben, wofür sie kämpfen, wo für sie der Spaß aufhört, wenn man es ihnen nehmen will, dann wird er auf Geld, Arbeitsplatz, Macht, Liebe, Gott usw. stoßen, aber mehr und mehr auf die Verheißungen des eigenen Lebens. Geld meint eigenes Geld, Raum meint eigenen Raum, eben im Sinne elementarer Voraussetzungen, ein eigenes Leben zu führen. Selbst Liebe, Ehe, Elternschaft, die mit Verfinsterung der Zukunft mehr denn je ersehnt werden, stehen unter dem Vorbehalt, eigene d. h. zentrifugale Biographien zusammenzubinden und zusammenzuhalten. Mit nur leichter Übertreibung kann man sagen: Das alltägliche Ringen um das eigene Leben ist zur Kollektiverfahrung der westlichen Welt geworden. In ihm drückt sich die Restgemeinschaft aller aus.“23
Dieser Trend hat seinen entsprechenden Niederschlag in zahlreichen soziologischen Zeitdiagnosen und Gesellschaftsanalysen gefunden. Hier hat in den 1980er Jahren die Karriere der Kategorie „Individualisierung“ begonnen.24 Sie fungiert quasi als Container für die Reflexion sozio-kultureller Tendenzen, die vor allem durch folgende Faktoren bestimmt sind:
Erosion und abnehmende Bindungswirkung traditioneller Sozialzusammenhänge, Verblassen lebensweltlicher Prägungen (z. B. Milieu, Konfession) und industriegesellschaftlicher Lebensformen (Klasse, Schicht);
Lösung von Lebenslauf und -situation aus überkommenen Standards und Ablösung dieser Standards über die zunehmende Bestimmtheit der Lebensführung (Wertpräferenzen, Lebensstil, Rollenverhalten) durch marktgesteuerte Austauschprozesse;
Pluralisierung von Lebensformen, Sinnsystemen (Weltanschauungen) und Verhaltensoptionen mit der Folge bzw. dem Zwang zur Selbstgestaltung der individuellen Lebensgeschichte aufgrund der erheblichen Zunahme entscheidungs- und auswahlabhängiger Biographieanteile;
Ausbildung einer „multiple choice“-Gesellschaft, wo es mehr als nur eine „richtige“ Verhaltensweise und mehr als nur einen Bewertungsset für ein Verhalten gibt.
Diese Faktoren bedingen sowohl einen Zuwachs an Entscheidungsmöglichkeiten und subjektiv wählbaren Optionen auf Seiten des Individuums als auch den Verlust einer kollektiv verbindlichen und plausiblen Sinn- und Identitätsmatrix im Raum des Sozialen. Sie nötigen das Individuum nicht nur zum Entwurf und zur Inszenierung der eigenen Biographie, sondern auch zu ihrer Einbindung in Beziehungen und soziale Netze. Was früher kollektiv vorentschieden war, muss nun vom Individuum eigens bedacht und bewusst übernommen werden. Alle notwendigen Auswahl-, Koordinations- und Integrationsleistungen von der Berufs- und Partnerwahl, der Mitgliedschaft in Vereinen über die Auswahl der passenden Schule für die Kinder und den Verbleib in einer Religionsgemeinschaft bis hin zur Verfügung über die Art der Bestattung hat das Subjekt zunehmend eigenhändig vorzunehmen. „Chancen, Gefahren, Unsicherheiten der Biographie, die früher im Familienverbund, in der dörflichen Gemeinschaft, im Rückgriff auf ständische Regeln oder soziale Klassen definiert waren, müssen nun von den einzelnen selbst wahrgenommen, interpretiert, entschieden und bearbeitet werden.“25 Das Leben verliert seine Selbstverständlichkeit, der soziale „Instinkt-Ersatz“, der es trägt und leitet, wird liquidiert, d. h. er verflüssigt sich, die Individuen und die Gesellschaft geraten ins Schwimmen.
2.1 Eigenes Leben? Individualisierung und Vergesellschaftung
Vordergründig erscheint die Individualisierung des sozialen Lebens als späte Einlösung eines Versprechens, das zu Beginn der Moderne gegeben wurde: Emanzipation von allen Autoritäten, Traditionen und Institutionen, von obrigkeitlich verordneten Formen der Existenz, die der kritischen Prüfung (und Auswahl) durch die autonome Vernunft nicht standhalten können. Der moderne Mensch sollte soweit wie möglich ein „homo optionis“ sein, der wird, was er wählt, und aus sich macht, was er auswählt. Der tatsächliche Lauf der Dinge hat jedoch kaum zur umfassenden Selbstermächtigung des Subjekts geführt. Die größeren individuellen Freiheitsräume sind eingelassen in eine spezifische Vergesellschaftung menschlicher Lebensverhältnisse und abhängig von den Leistungen sozialer Funktionssysteme (z. B. Wirtschaft, Bildung, Medizin).
Ohne einen Zugang zur bezahlten Erwerbsarbeit lässt sich mit den neuen Freiheiten wenig anfangen. Ohne den Erwerb formeller Berufs- und Bildungsabschlüsse bleibt der Zugang zum Arbeitsmarkt verschlossen. Und ohne eine frühzeitige Absicherung gegenüber Daseinsrisiken wird das Insistieren auf Unabhängigkeit bald selbst zu einem Daseinsrisiko. Die Erweiterung von Wahlmöglichkeiten und Handlungsoptionen in der Lebenswelt geht einher mit einer Vermehrung der Abhängigkeit von Regulativen, die auf gesamtgesellschaftlicher Ebene angesiedelt sind. Individuelles Leben ist weniger als zuvor eingezwängt in einen gemeinschaftlichen Komplex von Traditionen, Institutionen, Autoritäten und Rollen, aber gleichwohl nicht aus der Gesellschaft entlassen, sondern jetzt durch abstrakte und anonyme, an die Individuen adressierte Sozialbeziehungen bestimmt, die sich ihrerseits der individuellen Einflussnahme entziehen.26
Der gewonnenen Selbstverantwortlichkeit, Freiheit und Entscheidungskompetenz steht in komplexen Gesellschaften eine Abhängigkeit von ökonomisch, technisch und politisch definierten Lebensbedingungen gegenüber. Das „eigene“ Leben ist kein eigenes Leben im Sinne „eines freischwebenden, selbstbestimmten, allein dem Ich und seinen Vorlieben verpflichteten Lebens. Es ist vielmehr genau umgekehrt Ausdruck einer späten, geradezu paradoxen Form der Vergesellschaftung. Die Menschen müssen ein eigenes Leben führen unter Bedingungen, die sich weitgehend ihrer Kontrolle entziehen. Das eigene Leben hängt z. B. ab von Kindergartenöffnungszeiten, Verkehrsanbindungen, Stauzeiten, örtlichen Einkaufsmöglichkeiten usw., von den Vorgaben der großen Institutionen: Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, Sozialstaat; von den Krisen der Wirtschaft, der Zerstörung der Natur einmal ganz abgesehen.“27
Nur auf den ersten Blick offeriert die Individualisierung des Sozialen die Vorordnung des Subjekts vor der Gesellschaft. Bei genauerem Hinsehen erweist sie sich als Funktionsbedingung und -erfordernis moderner Gesellschaften. Sie sind geradezu darauf angewiesen, dass die Individuen nicht mit ihrer Individualität und dem Ganzen ihrer Persönlichkeit in ihre Teilsysteme eingebunden werden, sondern nur partiell und zeitweise. In dem Maße, in dem die Gesellschaft ihre Funktionen an einzelne Teilsysteme delegiert, werden die Menschen nur noch insofern in diese eingebunden, wie sie zum Handlungsträger der jeweils gültigen, untereinander aber differenten Verhaltenslogiken werden – in der Politik als Wähler/in, in der Wirtschaft als Produzent/in oder Konsument/in. Was vom Individuum aus betrachtet zunächst als Erweiterung seines Handlungsraumes erscheinen mag, erweist sich aus der Perspektive der Gesellschaft als funktionale Voraussetzung ihres Bestehens. Gefragt in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ist das mobile und flexible Subjekt. Zu viele und zu enge soziale Bindungen (z. B. Familie, Kinder) sind nicht nur hinderlich für das eigene Fortkommen (Karriere), sondern auch für die ökonomische (betriebliche wie volkswirtschaftliche) Produktivität. Flexible Arbeitszeiten nehmen auf feste Kinderbetreuungszeiten nur wenig Rücksicht. Flexibilität am Arbeitsplatz und beim freiwilligen oder erzwungenen Wechsel der Arbeitsstelle wird erwartet und belohnt. Nesthocker bleiben chancenlos, von Vorteil ist eine surfende Lebenseinstellung. Bindungen sind nur unter Vorbehalt einzugehen.28
Was also zunächst als Ausläufer und Spätfolge sozialer Erosion erscheinen mag, ist tatsächlich ein Mittel, um ihr entgegenzuwirken. Individualisierungsprozesse sind eine Voraussetzung für die Integration moderner Gesellschaften, die auf teilautonome Subjekte angewiesen sind. Integration ist weniger eine Leistung des sozialen Gesamtsystems oder die Funktion eines besonderen kulturellnormativen Subsystems, als vielmehr eine von den Individuen zu bewältigende Herausforderung. Denn sie müssen den Anforderungen eines flexiblen Arbeitsmarktes entsprechen, seine Asymmetrien austarieren und seine Unwägbarkeiten in ihren Lebenslauf eingliedern. Hier manifestiert sich alltagsweltlich, was Verlaufsform und Struktur der Moderne kennzeichnet. Hier muss zum großen Teil auch der Preis für Modernisierungen bezahlt werden. In der Alltagswelt warten viele Problemlagen auf ihre Bewältigung, für die es keine strukturelle Lösung, wohl aber strukturelle Ursachen gibt. Hier manifestieren sich die Ratlosigkeiten des großen „sowohl – als auch“, das inzwischen Modernisierungsprozesse kennzeichnet: In dem Maße, wie soziale Klassen verschwinden, bleibt soziale Ungleichheit bestehen oder nimmt zu – nun allerdings mit ihren Folgelasten allein den betroffenen Individuen aufgebürdet. In dem Maße, wie die funktionale Differenzierung der Gesellschaft – die Verteilung von Leistungen und Zuständigkeiten auf einzelne Teilsysteme, die Unlösbares wiederum auf die Individuen abwälzen – scheinbar alternativenlos voranschreitet, nehmen die Probleme gerade dieser Differenzierung zu, die sich mit ihren eigenen Instrumenten nicht mehr bewältigen lassen. Deutlich wird dies bei einer näheren Untersuchung, wie sich die Leitgrößen der technisch-industriellen Moderne – Entgrenzung und Deregulierung, Differenzierung und Pluralisierung – sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene als auch im Bereich der Lebenswelt auswirken.