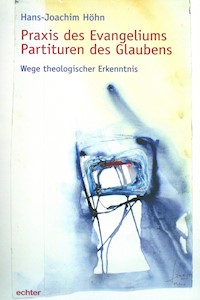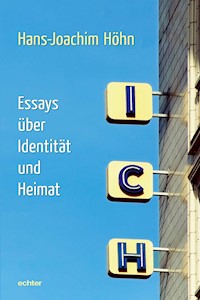Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Skandale, Reformstau, Abbruch religiöser Traditionen: Wie können die Kirchen unter sich rasant verändernden Umständen kreativ eine neue Sprache zu finden und Menschen eine wirkliche Heimat, wirkliche Nähe und Orientierung bieten? Höhn zeigt Schritte aus der Binnenfixierung - hin zu einem Christentum, das wirklich "Salz" der Gesellschaft wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Joachim Höhn
Fremde Heimat Kirche
Glauben in der Welt von heute
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2012
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
ISBN (E-Book): 978-3-451-33922-6
ISBN (Buch): 978-3-451-30540-5
Inhaltsübersicht
Vorwort
1. Problemskizze: Fremde Heimat Kirche
Provozierende Kirche
Christen im Zwiespalt
„Kirchenseufzer“
Beheimatung und Entfremdung
Heimat: eine religiöse Kategorie?
Menschenhaus als Gotteshaus?
Kirchen heute: Platzhalter und Wahrzeichen
2. In der Welt und für die Welt: Wie die Kirche über die Kirche denkt
Vaticanum II: Aufbruch in den Untergang?
Christlich handeln im Horizont der Zeit:
Leitideen von „Gaudium et spes“
Kritische Zeitgenossenschaft
Kirche im „conservative turn“
Psychogramm der postkonziliaren Generation
3. „Bürgerinitiative des Heiligen Geistes“: Kirche in der Zivilgesellschaft
Von der Mitte an den Rand
Kirche im sozialen Niemandsland?
Kirche in der Öffentlichkeit: Szene, Netzwerk, Bürgerinitiative
Kampagnenfähig: Allianzen für Solidarität und Gerechtigkeit
4. Diakonische Kirche: Vom verbindend Christlichen
Profilsuche: Die verfängliche Logik des Unterscheidens
Das entscheidend Christliche
McKinsey-Theologie
Soziale und kulturelle Diakonie
Unverzweckte Zuwendung
Kirche heute: kleiner, aber nicht kleinlicher werden!
Diakonisches Handeln jenseits der Caritas
5. Missionarische Kirche: Neue Formen kirchlicher Präsenz im Säkularen
Säkularität – Modernität – Religiosität
Urbanität: modern und säkular
Kirche in der Stadt und für die Stadt
Das Christliche im Spiegel des Urbanen
Passantenpastoral: Schritte in die falsche Richtung?
6. Freiheit (in) der Kirche: Die Jugend und der Geist Gottes
Jugend: Moratorium und/oder Laboratorium
Leben können lernen
Religion in der Pubertät: Mit der Kirche fremdeln
Geist Gottes – Geist der Jugend
Geistesgaben: Firmung und Lebenskönnerschaft
Kirche: Zumutung und Ermutigung
7. Kirche mit Sinn und Verstand: Symbole, Riten, Rituale
Die Sinne ansprechen – bei Sinnen sein!
Kult ist „kult“?
Inszenierter Glaube?
„Sensual turn“
Die Sinne und der Sinn
Ästhetik des Glaubens
8. Pilgernde Kirche: Glaubenswege unter freiem Himmel
Der flexible Mensch: Religion in Bewegung
Trend „Pilgern“
Transzendenz im Selbstversuch
Allein, aber nicht einsam
Auf eigenen Füßen
„… und etwas bewegt sich doch!“
9. Kirchenkrise – Gotteskrise: Bestreitungen
Beschädigte Glaubwürdigkeit: Das Credo der Kirche
Partitur der Zuwendung Gottes: Das Evangelium der Kirche
Unter leerem Himmel: Glauben in der Welt von heute
Gott: bestritten und vermisst
Vorwort
KRISEN HABEN KONJUNKTUR – und Bücher über Krisen auch. Ein Buch über die Kirche wird darum ein Buch über ihre Krise sein müssen. Ob es deswegen mit Enthüllungen und Entlarvungen aufwarten und der kirchlichen Skandalchronik ein weiteres Kapitel hinzufügen muss, um Aufmerksamkeit zu finden, ist eine andere Frage. Auch die Umstände der Entstehung des vorliegenden Buches sind die Krisen und Konflikte (in) der katholischen Kirche, deren Überwindung nicht absehbar ist. Aber es geht nicht noch einmal um die wiederholte Aufzählung der einzelnen Problemfälle. Es geht vielmehr um folgende Fragen, die immer wieder auftauchen: Woher können Christen, die in und mit der Kirche zum Glauben gekommen sind, jene Frustrationsresistenz beziehen, um allen Widrigkeiten zum Trotz in und mit der Kirche ihr Christsein praktizieren zu können? Was an und in der Kirche ist es überhaupt noch wert, dass man dafür Zeit und Energie investiert? Angesichts der faktischen Verweigerung weitreichender Kirchenreformen besinnt sich dieses Buch theologisch auf die Notwendigkeit, sich widerständig auf die Zerreißproben einzulassen, die sich daraus ergeben.
In Zeiten der Krise schlägt entweder die Stunde der Untergangsbeschwörer oder der Beschwichtiger. Gegen beide Versuchungen wird im Folgenden auf eine nüchterne Einschätzung der Faktenlage und auf eine ebenso nüchterne Betrachtung der Zukunftschancen gesetzt. Diese Nüchternheit soll sich allerdings nicht in einer temperamentlosen akademischen Abhandlung spiegeln. Mir geht es um ein entschiedenes Plädoyer für eine Fortsetzung der vom II.Vatikanischen Konzil angestoßenen Prozesse – vor allem hinsichtlich der Beziehungen zwischen Kirche und Gesellschaft.
Wenn sich die Kirche nach außen wie nach innen für Reformen öffnet, muss sie mit der Möglichkeit rechnen, dass die Zahl jener, die sie durch ihre offenen Türen verlassen, größer ist als die Zahl jener, die sie betreten. Wenn sich die Kirche aber nicht öffnet, findet sie sich mit der Realität ab, dass die Zahl jener, die außerhalb ihrer verschlossenen Türen leben, größer bleibt als die Zahl jener, die sie innerhalb ihrer Mauern antrifft. Wofür sich die Kirche entscheiden soll, ist derzeit Thema eines erbitterten Richtungsstreites. Wie dieser Streit ausgeht, steht keineswegs fest. Dass er jemals an ein Ende kommen kann, wenn die Kirche darum ringt, was es heute heißt, gelegen oder ungelegen die Sache Jesu zu vertreten, ist nicht zu erwarten. Ein Abbruch dieses „Kirchenstreits“ ist auch gar nicht wünschenswert. Schlimm wäre es, wenn man dabei nur auf der Stelle treten würde. Aber noch schlimmer wäre es, wenn sich jene Kräfte durchsetzen könnten, die mit der Androhung von Sanktionen für Kritiker oder mit der Durchsetzung von Denkverboten ein friedliches Streitgespräch über den weiteren Weg der Kirche verhindern wollen.
Mit solchen kirchlichen Streit- und Zeitfragen hat dieses Buch zu tun. Es erörtert, was für die Kirche in dieser Zeit an der Zeit ist. Allerdings wird man fast jedes der üblichen strittigen Kirchenthemen vermissen: Pflichtzölibat, Sexualmoral, Demokratiedefizit, Diskriminierung von wiederverheiratet Geschiedenen, Zugang von Frauen zu geistlichen Ämtern, Stillstand in der Ökumene etc. Diese Fehlanzeige ist nicht zu verstehen als Geringschätzung all jener, die sich für eine Lösung dieser Streitfragen einsetzen. Sie hat vielmehr mit den Reaktionen auf ihre Vorschläge und Forderungen zu tun. Die Kritiker entsprechender Reformvorhaben sind überzeugt, dass diese vergeblich sind. Ihre Diagnose lautet: Es gibt viel eher einen Gläubigen- als einen Priestermangel; bedrängender als jede Kirchenkrise ist die „Gotteskrise“ der Moderne; nachhaltiger als der Mangel an Innovationen wirkt sich der Traditionsverlust des Glaubens aus; die Anpassung an die Welt macht die Kirche nicht attraktiv, sondern konturenlos; Kritik an der Kirche verschärft die Risse und Spaltungen, denen sie ohnehin schon ausgesetzt ist; den Reformern fehlt theologische Tiefe, sie sind einem soziologischen Horizontalismus erlegen etc. Diese Einwände werden ständig mit einem beträchtlichen publizistischen Aufwand wiederholt und zeigen bereits in kirchlichen Führungsetagen Wirkung. Auch wenn man diese Einwände für Elemente eines Ablenkungsmanövers hält, ist das Körnchen Wahrheit zu beachten, das in ihnen steckt. Dass man Kritikern Recht geben muss, wo sie unstrittig Recht haben, sollte – gleichermaßen für Reformwillige wie für Reformverweigerer – selbstverständlich sein.
Vielleicht stimmen beide Seiten auch dem im Folgenden ausgearbeiteten Vorschlag zu, gemeinsam jenen Gründen nachzugehen, inwiefern die Kirche trotz ihrer Selbstblockaden und hausgemachten Probleme auch für säkulare Zeitgenossen noch interessant sein kann. Für diese Gründe Interesse zu wecken ist ein Zentralmotiv dieses Buches. Es führt zu den Schnittstellen von Säkularität und Religiosität in modernen Gesellschaften. An diesen Schnittstellen entscheidet sich nach meiner Überzeugung die gesellschaftliche Zukunft der Kirche. Die Kirche muss auf evangeliumsgemäße Weise den Erfordernissen der Zeit entsprechen. Aus diesem Grund muss sie nach zeitgemäßen Aktions- und Sozialformen suchen, in denen das Evangelium gesellschaftlich antreffbar wird. Darum geht es auf den folgenden Seiten. Aus welchen Gründen sollte in Zeiten der Krise sonst ein Buch über die Kirche geschrieben und gelesen werden?
Köln im Herbst 2011
Hans-Joachim Höhn
1.Problemskizze: Fremde Heimat Kirche
ES GEHÖRT ZU den Ritualen von Prominenteninterviews, dass bei der Gretchenfrage „Wie hältst Du’s mit der Religion?“ eine gewisse Offenheit für diverse Transzendenzvorstellungen geäußert wird – und man sogleich beteuert, kein Kirchenchrist zu sein. Sollten tatsächlich biografische Indizien für eine Konfessionszugehörigkeit ausgemacht werden, so werden sie in der Regel einer fernen Vergangenheit zugewiesen. Es ist schon so lange her, dass es fast nicht mehr wahr ist! Ausnahmen gibt es gleichwohl. Einige Zeitgenossen, die heute zu den Großen im Showgeschäft oder im politischen Establishment zählen, können auch ganz unverkrampft auf eine kirchliche Phase in ihrer Biografie verweisen. In Talkshows lassen sie sich bereitwillig das Geständnis entlocken, dass sie für eine Weile Ministranten waren oder in Jugendchören ihre musische Begabung erproben konnten. Die Kirche war für sie durchaus ein Ort, an dem sie sich heimisch fühlten und Wurzeln schlagen konnten. Aber mit der Zeit sind sie über diese Herkunft (und dabei auch über sich selbst) hinausgewachsen. Sie sind andere Wege gegangen und haben andernorts neue religiöse Bekanntschaften gemacht. Im Rückblick fällt ihr Urteil über die Kirche bisweilen bemerkenswert milde aus, wenngleich diese Milde stets auch einen Schuss Ironie enthält: Obligatorisch war die heimliche Messweinprobe in der Sakristei. Wurde das Weihrauchfass geschwenkt, sind dabei nicht nur fromme Gedanken geweckt worden. Man hat einiges gelernt, das später in ganz anderen Feldern wichtig wurde: ein Gespür für Ästhetik und Inszenierungen, Mut zum öffentlichen Auftreten. Manche Prominente geben zu, dass sie dieser Zeit auch eine eiserne Ration an moralischen Überzeugungen oder existenziellen Gewissheiten verdanken. Eine dauerhafte und intensive Kirchenbindung besteht jedoch oft nicht mehr. Die Kirche ist für sie eine Größe, deren man sich eigens erinnern muss. Über sie wird nicht in der Zeitform der Gegenwart, sondern der Vergangenheit gesprochen.
In der Zeitform der Vergangenheit wollen auch die erklärten Kritiker über die Kirche reden. In ihren Augen ist die Kirche selbst daran schuld, dass sich ihre Zukunft bereits in der Vergangenheit erledigt hat (weshalb eigentlich in der Zeitform des Plusquamperfekt über sie zu sprechen wäre). Ihre Zeit ist vorbei, weil sie als Institution des christlichen Glaubens längst allen Kredit verspielt hat. Zu oft hat sie den Menschen Steine statt Brot gegeben. Zu oft war sie ängstlich vor den Unterdrückern, schweigend vor den Ausbeutern, verschlossen vor den Zweifelnden, erbarmungslos gegenüber den Gestrauchelten.
Größer kann der Kontrast nicht sein gegenüber dem, was die Kirche ihrem Namen und Anspruch nach sein könnte: jener Ort, an dem Gott zur Sprache kommt und das Wort Gottes (Evangelium) in der Gemeinschaft der Glaubenden mutig und kreativ praktiziert wird: aufbegehrend für die Unterdrückten, einladend für die Ausgestoßenen, suchend nach den Ratlosen, barmherzig mit den Sündern. Ihr Ort ist bei den Menschen. Was diese von ihr zu erwarten haben, ist Solidarität – in den Worten des II.Vatikanischen Konzils: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“1
Weil die Kirche in ihrer Geschichte aber zahllose Scheußlichkeiten begangen hat, traut man ihr heute jede Scheußlichkeit zu. Zum Beweis ist es nicht nötig, die Bücher zur „Kriminalgeschichte“ des Christentums aufzuschlagen. Es genügen die Zeitungen vom Tage, um stets auf’s Neue zu lesen, dass die Kirche einen enormen Ansehensverlust erleidet – vor allem bei den Armen, Trauernden und Bedrängten.
Provozierende Kirche
Die Kirche steht häufiger in den Schlagzeilen als das Evangelium. Das muss nicht weiter schlimm sein, wenn der Zweck solcher Publicity wäre, das Evangelium in die Öffentlichkeit zu bringen. Die theologische Bestimmung der Kirche besteht ja gerade darin, dass sie Ort und Ereignis der Veröffentlichung der „Sache Gottes mit den Menschen“ ist. Hier geht es darum, wie Gott und Mensch gemeinsame Sache machen können. Sache der Kirche ist es, sich der Erwartungen der Menschen an ein sinnvolles Leben in einer vom Evangelium geprägten Lebenskultur anzunehmen. Sie schreibt dabei jene Geschichte fort, die im Evangelium erzählt wird, wie Gott sich der Nöte und Hoffnungen der Menschen annimmt. Mit dieser Geschichte soll die Kirche Geschichte machen – und zwar auf durchaus provokante Weise. Das Evangelium erzählt keinen geschichtslosen Mythos und entwirft auch nicht ein bloß weltjenseitiges Heilsideal. Es ist vielmehr Konsequenz eines Geschehens, in dem der Heilswille Gottes im Widerstreit von Leben und Tod, von Freiheit und Unterdrückung, von Macht und Ohnmacht erfahrbar geworden ist. Gott hat es im Leben und Sterben Jesu von Nazaret mit dem Tod aufgenommen, um das tödliche Verhältnis von Leben und Tod zugunsten des Lebens zu verändern (vgl. Joh 10,10). Als Konsequenz dieses Geschehens jenseits frommer Innerlichkeit und diesseits weltflüchtiger Jenseitigkeit ist das Evangelium selbst wiederum folgenreich – auch in jenen Feldern, die scheinbar abseits des Religiösen liegen.
Für die Praxis des christlichen Glaubens sind darum zwei Grundmotive leitend, die das Christentum von Grund auf und im Ganzen bestimmen: Politik und Mystik, Aktion und Kontemplation. Der politische Einsatz für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden sowie das Bemühen, die eigene Existenz in Gott zu verwurzeln, sind hier keine Alternative. Beides bedingt sich vielmehr wechselseitig. In eben diese Richtung weist auch das II.Vatikanische Konzil, wenn es die Kirche als „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“2bestimmt.
Nicht immer ist die Herausforderung dieser mystisch-politischen Doppelstruktur der Kirche unmissverständlich und klar wahrnehmbar. Meistens provoziert die Kirche genau dann die Aufmerksamkeit der Medien, wenn sie nach dem Urteil ihrer Beobachter gegen die Grundwerte des Evangeliums verstößt. Im „Jubeljahr 2000“ hatten Kirchenkritiker reichlich Gelegenheit, die kirchliche Skandalchronik wieder aufzublättern. Sie reicht von Judenverfolgungen, Kreuzzügen, Inquisition und Hexenverbrennungen über die Verquickung mit Kolonialismus und Imperialismus bis hin zur Verstrickung mit faschistischen Regimes. Mit der Aufdeckung zahlreicher Fälle sexuellen Missbrauches durch Priester und Ordensleute im Jahre 2010 erreichte das Ansehen der Kirche einen Tiefpunkt. Die schleppende Aufarbeitung dieses Skandals hat die Situation anfangs sogar weiter verschlimmert. Inzwischen ist mit Entschiedenheit begonnen worden, Unrecht aufzuarbeiten und Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Der Vorsatz, auch andere Missstände in der Kirche durch einschneidende Reformen zu überwinden, wurde jedoch nur halbherzig umgesetzt. Verlorenes Vertrauen wurde nicht zurückgewonnen. Ein im Frühjahr 2011 von mehr als 200 deutschen Theologinnen und Theologen unterzeichnetes Memorandum, das einen Abbau des Reformstaus anmahnte (u.a. Lockerung des Pflichtzölibates, Priesterweihe für „viri probati“, Stärkung synodaler Strukturen und der Beteiligung der „Laien“ an Entscheidungsprozessen, Zugang von Frauen zu kirchlichen Ämtern, veränderter Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen), hat ein zwiespältiges Echo gefunden. Die Kritik reichte von gelangweilten Feststellungen, dass das Papier nichts Neues enthalte und resignativer Ausdruck professoraler Ohnmacht sei, bis hin zu frömmelnden Verunglimpfungen der Unterzeichner. Es gab Aufrufe zu „Gebetsstürmen“, auf dass der Heilige Geist sie wieder zur Umkehr bewege. Offen legte man ihnen auch den Übertritt zur evangelischen Kirche nahe. Dort seien sämtliche ihrer Forderungen erfüllt. Gleichwohl stünde sie nicht besser da und somit sei die Sinnlosigkeit der Reformwünsche bereits empirisch erwiesen. Wurden zuvor unbequeme Reformpapiere zu Tode gelobt, machen sich ihre Kritiker nunmehr über sie lustig. Kirchenreform – ein Projekt zum Totlachen? Einige Bischöfe vermissten in dem Memorandum ein „sentire cum ecclesia“. Aber wieso schließt ein „Mitfühlen mit der Kirche“ jedes Mitgefühl mit den Menschen aus, die unter den Missständen in der Kirche leiden? Warum soll nur ein schweigendes Mitfühlen mit den Leidtragenden erlaubt sein? Ein solches Schweigen führt in die Komplizenschaft mit jenen Kräften, denen an Vertuschung und Verschleierung gelegen ist. Gilt nicht, dass die Wahrheit den Menschen frei macht und dass nur in Freiheit die Wahrheit eine Chance hat?
Immer wieder liefert die Kirche einen neuen Grund für den Vorwurf, dass sie sowohl gegenüber dem Freiheitsbewusstsein der Moderne als auch gegenüber den Grundwerten des Evangeliums im Verhältnis einer unproduktiven Ungleichzeitigkeit verharrt. Ist dies die Weise, wie die Gesellschaft mit dem Evangelium provoziert werden soll? Gibt die Kirche damit nicht häufiger Anlass zum Ärgernis als Anstoß zum Umdenken? Ist der Umstand, dass Frauen in der Kirche nicht wenigstens so viel an Gleichheit und Verantwortung haben, wie es ihnen in der Gesellschaft das Grundgesetz garantiert, nicht ein signifikantes Indiz für eine kulturelle Rückständigkeit der Kirche? Und sind nicht die regelmäßig wiederkehrenden Versuche, in Fragen der Sexualmoral neben dem persönlichen Gewissen eine weitere normative Instanz zu etablieren, Ausdruck eines tiefsitzenden Ressentiments gegen den Grundsatz der Gewissensfreiheit?
Christen im Zwiespalt
Für viele Zeitgenossen ist das Christentum als einstige „Leitreligion“ Europas zu einer Größe geworden, mit der sie fremdeln. Dies gilt erst recht für ihr Verhältnis zur Kirche als Sozialform und Institution des Christseins.3In ihren Augen ist deren Zeit schon lange abgelaufen. Sie gehöre eigentlich in die Museen der Kulturgeschichte. Jene Christen, die allen Skandalen und Verfehlungen zum Trotz der Kirche noch die Treue halten, müssen sich in ihren Augen wie Angehörige einer Minderheit vorkommen, „die als Fremde in der Zerstreuung leben“ (1Petr 1,1)?
Gegen Vereinzelung und Vereinsamung werden das Zusammenrücken der Verbliebenen und der enge Schulterschluss empfohlen. Ein Bild der Geschlossenheit soll dem Zerrbild der Kritik entgegengesetzt werden. Nicht Hohn und Spott verdient die Kirche – schon gar nicht aus ihren eigenen Reihen. Reformanliegen dürfen – wenn überhaupt – diskret und als bittendes Ersuchen an die Bischöfe adressiert werden, sollen aber nicht mit medialer Unterstützung als Forderung oder einklagbares Recht verlautbart werden. Dies hat ja den Effekt, dass in der Öffentlichkeit das Negativimage der Kirche als einer modernisierungsunwilligen Institution permanent bestätigt und bekräftigt wird. Man will aber in der Öffentlichkeit ein anderes Bild abgeben. Solidaritätskomitees konstituieren sich und sammeln Unterschriften unter Resolutionen, in denen von Liebe zur Kirche und von Treue zu ihren Oberhirten die Rede ist. Aber vielen Christen geht es mit der Kirche wie dem früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann mit seinem Vaterland. Angesprochen auf die seinerzeit als politische Tugend vermisste Liebe zu Vaterland und Staat pflegte er zu antworten: „Ich liebe nicht den Staat, sondern meine Frau!“ Bei einem schwierigen Vaterland, wie es Deutschland ist, wäre ein allzu inniges Verhältnis auch nicht angebracht. Und wie steht es mit „Mutter Kirche“ (und ihren Söhnen)? Auch hier machen es etliche Beziehungsprobleme fraglich, ob auf Dauer eine intensive emotionale Bindung bestehen bleiben kann.
Beziehungsprobleme werden heute vielfach dadurch überwunden, dass man nicht die Probleme, sondern die Beziehung löst: Man geht sich aus dem Weg, man trennt sich, man verliert sich aus den Augen. Vielen Christen geht es ähnlich mit ihrer Beziehung zur Kirche. Am Anfang reibt man sich noch an den Missständen in der Kirche, am Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, am Ausschluss der Frauen vom Priesteramt. Am Anfang kann man sich noch aufregen über eine ins Stocken gebrachte Ökumene oder über eine fortpflanzungsfixierte Sexualmoral. Am Anfang kann man sich noch entrüsten über Skandalschlagzeilen in der Presse, über Maßregelungen unbequemer Theologen und Gängelungen selbstbewusster „Laien“. Aber mit der Zeit wird der Wellenschlag der Aufregung geringer. Mit der Zeit hat man die Einflüsterungen der Kirchenkritiker im Ohr: „Hast Du etwas anderes erwartet von einer Institution, die nur auf Machterhalt und Gedankenkontrolle ausgerichtet ist? Hast Du wirklich geglaubt, man könne die Kirche erneuern – an Haupt und Gliedern? Hast Du gedacht, es könnte endlich ein Ruck durch die Kirche gehen, der ihren Reformstau auflöst?“ Mit der Zeit wird aus Empörung ein stummes Achselzucken. Übrig bleibt ein melancholisches Seufzen: „Ach ja, die Kirche…“
„Kirchenseufzer“
Das Seufzen muss aber nicht immer ein Akt der resignativen Melancholie sein. Es hat eine viel größere Bedeutungsvielfalt. Das Seufzen gehört sogar zu den variantenreichsten menschlichen Lauten. Es kann ein Ausdruck der Entlastung, aber auch der Belastung sein. Es kann einen kommenden und einen nachlassenden Schmerz andeuten. Es kann einen Anlass in der Vergangenheit und in der Zukunft haben. Es kann Zeichen weiser Gelassenheit und mühsam gebremster Ungeduld sein. Das Seufzen ist eine Umgangsform mit den Misslichkeiten des Lebens; es ist angebracht, wenn es anders kommt als gedacht oder erhofft. Das Seufzen gehört in den Alltag und in die große Literatur. Der berühmteste Seufzer steht in Goethes „Faust“ und ist dort nicht zuletzt auf die Theologie gemünzt („Habe nun, ach…“). Der bedeutendste Kirchenseufzer des 20.Jahrhunderts stammt von dem französischen Theologen Alfred Loisy. Im November 1902 erscheint sein Buch „Evangelium und Kirche“ und nach wenig mehr als hundert Seiten findet sich der Satz: „Jesus verkündete die Ankunft des Reiches Gottes, und gekommen ist die Kirche!“4Viele Leser haben diesen Satz kirchenkritisch und als Seufzer der Enttäuschung aufgefasst: Die Kirche ist das Überbleibsel einer getrogenen Hoffnung – eine verunglückte Gestalt dessen, was Jesus eigentlich wollte. Bestenfalls ist die Kirche eine Notlösung – geboren aus der Not, dass das von Jesus verkündete Reich Gottes ausblieb. Die Kirche ist das Resultat einer Enttäuschungsverarbeitung, sie ist die Konsequenz einer Weigerung der Jünger, sich mit dem Scheitern Jesu abzufinden; sie ist eine Ersatzlösung, ein Lückenbüßer für etwas Größeres und Besseres. In dieser Lesart ist A.Loisys Satz ein berühmt-berüchtigter Zitatlieferant für alle Kirchenkritiker geworden. Allerdings steht diese Lesart der Intention Loisys selbst entgegen; dessen Folgesatz lautet nämlich: „Die Kirche ist das fortgesetzte Evangelium, die Entwicklung des Christentums ist dem Evangelium weder äußerlich noch fremd!“
Offensichtlich gibt es (weniger für die Kirchenkritiker als für Loisy) doch ein Kontinuum zwischen der Verkündigung Jesu und der Existenz der Kirche. Die Daseinsberechtigung der Kirche muss sich an diesem Kontinuum erweisen. Und jede Kritik an der Kirche muss sich ebenso wie jede Gegenkritik an diesem Kontinuum theologisch ausweisen. Eine theologische Rechtfertigung der Kirche wird dann nicht zu einem ideologischen Überbau, wenn sie sich um dieses Kontinuum des Kircheseins bemüht. Hierbei geht es um mehr und anderes als um die Frage, ob es auf einzelne „kirchenstiftende“ Handlungen des historischen Jesus zurückgeführt werden kann. Gesucht wird auch nicht eine Kontinuität zwischen heutigen Strukturen in der Kirche und entsprechenden institutionellen Vorkehrungen, die der historische Jesus getroffen haben könnte. Ein solcher Aufweis ist historisch-kritisch kaum zu führen, wenn unter „Stiftung“ situativ ausgrenzbare, punktuelle Akte verstanden werden, mit denen Jesus verfügt hat, wie seine Botschaft vom Reich Gottes weitergegeben werden soll. An Päpste, Bischöfe und Konzilien hat er dabei gewiss nicht gedacht. Aussichtsreicher ist es – und zwar in historischer wie in theologischer Perspektive–, von einer „Grund-Legung“ zu sprechen, mit der für diese Weitergabe ein Anfang gemacht und etwas in Bewegung gesetzt wird, das von Dauer ist. Mit dieser Grundlegung werden Voraussetzungen geschaffen, wodurch die Verkündigung des Evangeliums in Gang kommt und sich einen Weg durch Zeit und Raum bahnt.
Wichtiger als eine formale Kontinuität von Strukturen und Institutionen ist ohnehin die Identität der Sache Jesu und der Sache der Kirche. Das Medium dieser Kontinuität ist das Evangelium selbst. Es erzählt von den „Kirchenträumen Gottes“5
. Das Evangelium ist das Zeugnis von „Gottes Volksbegehren“6
. Es handelt davon, wie Gott Menschen aufsucht, um sie zu einer Form des Zusammenlebens anzustiften, die menschliches Miteinander nicht als funktionales Zweckbündnis oder hierarchisch angelegte Organisation begreift und soziale Zugehörigkeiten nicht von zu erbringenden Leistungen oder Beitragszahlungen abhängig macht. Hier geht es um ein Miteinander, das nicht aus menschlicher Initiative herrührt (und daher von Menschen aufgekündigt werden könnte), sondern aus dem Heilswillen Gottes hervorgeht, der von unbedingter Anerkennung und Solidarität auch mit den Nichtskönnern und Habenichtsen bestimmt ist. Die Kirche ist eine Form menschlichen Miteinanders, die sich von anderen Institutionen und Organisationen grundlegend unterscheidet, d.h. sie hat einen anderen Grund als die übrigen Formen menschlichen Miteinanders. Sie ist gegründet im Entgegenkommen und Zuvorkommen Gottes und nicht allein im Zusammenkommen von Menschen. Insofern ist sie tatsächlich ganz in der Welt, ohne gänzlich von dieser Welt zu sein. Das Fundament der Kirche ist die unbedingte Zuwendung Gottes zum Menschen. In einer Zeit „betriebsbedingter“ Kündigungen bezeugt die Kirche die unverbrüchliche Treue Gottes zu seiner Schöpfung. In einer Welt, in der soziale Zugehörigkeiten durch Leistung verdient und mit Aufnahmegebühren bezahlt werden, bezeugt die Kirche eine Gotteszugehörigkeit des Menschen, die es gratis gibt. Sie ist darum kein Betrieb, der Gewinn machen muss, sondern hat den Status eines Non-Profit-Unternehmens. Sie besteht in einer Marktgesellschaft darauf, dass man nicht alle Güter und Werte zu Markte tragen darf und dass nicht allein Markt- oder Umfragewerte regieren.
Eine solche Gemeinschaftsvorstellung wirkt heute wie ein weltfremdes Idyll. Und die Sprache des Evangeliums, die von diesem Idyll erzählt, gilt vielen Zeitgenossen bereits als eine Fremdsprache. Für die Suche Gottes nach Menschen, die mit ihm gemeinsame Sache machen wollen, finden sich immer seltener die passenden Worte. Dabei wünschen sich viele Menschen nichts sehnlicher, als in einer Welt der befristeten und jederzeit kündbaren Beziehungen eine stabile und unkündbare soziale Zugehörigkeit ausbilden zu können, die Krisen aushält und durch Konflikte hindurchführt. Nichts ist notwendiger in einer Zeit, die alle sozialen Netze mit immer gröberen Maschen versieht, als die Erfahrung eines beständigen Rückhalts und solidarischen Aufgefangenwerdens. Aber leider ist die Kirche(ngemeinde), die ein Ort solcher Erfahrungen sein könnte, längst in den Mahlstrom dieser Zeit geraten. Im Flugsand der Individualisierung des sozialen Lebens kann auch sie nicht mehr lange Stand halten. Ein Raum der Beheimatung, ein Ort an dem man seine Bleibe hat – für wen und wie lange kann die Kirche das sein?
Beheimatung und Entfremdung
Wer über den Ort und die Bedeutung der Kirche in der modernen Gesellschaft nachdenkt, hat mit dem merkwürdigen Befund zu tun, dass hier zusammenzudenken ist, was auseinanderstrebt: Beheimatung und Entfremdung. Gleichwohl führt dieses Denken nicht in einen Selbstwiderspruch. Man kann die Gegenbegriffe „Fremde“ und „Heimat“ in unterschiedlichen Arrangements mit dem Begriff „Kirche“ verbinden, ohne dabei in Widersprüche zu geraten. Deutlich wird dabei vielmehr der Zwiespalt, der die aktuelle Lage der Kirche an Haupt und Gliedern kennzeichnet: Entfremdung und Beheimatung.
„Fremde Heimat Kirche“ kann bedeuten, dass die religiöse Herkunft einem Menschen mit der Zeit fremd wird, weil er/sie schon lange nicht mehr an jenem Ort lebt, von dem er/sie herkommt. „Heimat“ ist eine Bestimmungsmöglichkeit des eigenen Herkommens, aber auch eine Entfernungsangabe. Der Herkunftsort ist nicht identisch mit dem aktuellen Aufenthaltsort; man hat sich von ihm entfernt, andernorts ein neues Zuhause gefunden. Und wenn man gelegentlich besuchsweise in die alte Heimat zurückkehrt, wird jeweils klar, wie groß der Abstand zwischen „damals“ und „heute“ geworden ist. Mit den alten Freunden verbinden nur noch alte Geschichten. Neue sind nicht mehr hinzugekommen. Die allein noch mögliche Perspektive auf Gemeinsamkeiten ist die Rückschau.
„Fremde Heimat Kirche“ kann bedeuten, dass die religiöse Herkunft nur noch vom Hörensagen bekannt ist, – vergleichbar mit der zweiten und dritten Generation von Gastarbeitern, Asylanten, Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Auch sie kennen jene Ursprünge und Traditionen, die hintergründig ihr Leben mitbestimmen, nicht mehr aus eigenem Erleben. Es bedarf eines „Fremdenführers“, der ihnen ihr kulturelles Erbe wieder bewusst macht. Ob sie ihr religiöses Erbe bewusst annehmen, bleibt lange Zeit unklar oder wird von ihnen offen gelassen. Wie jedes Erbe kann es Mitgift oder Hypothek sein.
„Fremde Heimat Kirche“ kann bedeuten, dass die Kirche eine Zufluchtsstätte für jene geworden ist, die mit der modernen Welt nicht mehr mitkommen, die sich abgehängt fühlen vom Fortschritt und sich als Modernisierungsverlierer betrachten. Von der Kirche erwarten sich diejenigen Rückhalt und Verständnis, die die Welt nicht mehr verstehen. Die Kirche wird hier zum Rückzugsraum für Menschen, die mit der Moderne fremdeln und die nostalgische Sehnsucht nach besseren alten Zeiten pflegen.
„Fremde Heimat Kirche“ kann bedeuten, dass Menschen auf der Suche nach einer neuen spirituellen „Niederlassung“ sich schwer tun mit der Akzeptanz jener kirchenrechtlichen Normen und dogmatischen Bedingungen, an welche die Kirche die Teilhabe an ihrem religiösen Leben knüpft. Vieles mag Unbehagen und Befremden auslösen; an vieles typisch Katholische wird sich jemand, der aus der säkularen Welt kommt und in der Kirche eine neue religiöse Heimat finden will, vielleicht nie gewöhnen können.
„Fremde Heimat Kirche“ kann bedeuten, dass die Kirche Menschen verliert, weil sie pastoral verprellt werden, weil sie sich als wiederverheiratet Geschiedene kirchenrechtlich ausgegrenzt vorkommen, weil sie sich moralisch gegängelt fühlen oder weil sie spirituell obdachlos geworden sind in einer Gemeinde, in der eine für sie geist- und freudlose Liturgie gefeiert wird. Sie richten an die Kirche den Vorwurf, nur noch als „Heimatvertriebene“ ihr Christsein leben zu können.
„Fremde Heimat Kirche“ bedeutet schließlich auch, dass in einem sehr unmittelbaren Sinn Christen den architektonischen Ausdruck ihrer Religionszugehörigkeit verlieren. Kirchenschließungen, -umwidmungen und -profanierungen markieren den schmerzlichen Abschied von Gotteshäusern, die fortan nur noch als touristische Sehenswürdigkeiten gelten. Ob sie in dieser Eigenschaft aber noch ein lebendiges Wahrzeichen für die soziale und geschichtliche Identität einer Stadt oder einer Region sein können, wird höchst fraglich.