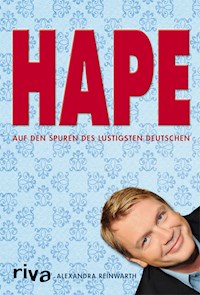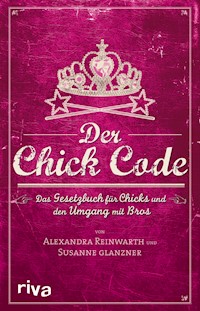Alexandra Reinwarth
Alexandra Reinwarth
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe, 11. Auflage 2019
© 2018 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Laura Osswald, München
Umschlagabbildung: Shutterstock/ksuklein
Satz: Satzwerk Huber, Germering
ISBN Print 978-3-86882-916-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-196-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-197-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Einleitung
Die Deadline
Alles, was man aus Stolz nicht tut/Alles, was man aus Peinlichkeit nicht tut
Freunde
Vorsicht, Fall(e)
Job
Kind(er) und Zeit
Zu Ende bringen
Verzeihen
Wie wir leben wollen
Man selbst sein / Wer ich bin und wer ich sein möchte
Zeige deine Wunde
Geld
… und Gutes tun
Nicht perfekt
Lasst uns Fehler machen
Zum Schluss
Nachwort
Über die Autorin
Für Daniela und Lotta und Saskia, für L., für Eva, für Niko und Hannes, für Oli, Petra, Koppi und Tasso, für Ramón und Sabine und Lucy und Nadja
We all have two livesThe second one beginsWhen you realizeThat you only have one
EINLEITUNG
Einen Tag nach meinem Todestag wache ich morgens auf und bin glücklich.
In der Küche höre ich L. und das Kind rumoren und Kaffeeduft liegt in der Luft. Es ist kein besonderer Tag, ein Freitag. Draußen ist es grau und es nieselt und ich höre das Kind maulen: »Ich WILL aber Nutella …!«
Normalerweise würde ich mir jetzt nochmal die Decke über den Kopf ziehen, leicht genervt von der Maulerei des Kindes und missgestimmt wegen des inakzeptablen Wetters.
Aber es ist nichts wie sonst, denn gestern war mein Todestag und heute bin ich glücklicherweise doch wieder aufgewacht. Ich habe noch einen Tag. Und dann noch einen und noch einen und so weiter eine ganze Zeit lang – zumindest, wenn alles gut läuft. Ich werde das Kind größer werden sehen. Ich werde wieder einen Frühling erleben, ich kann meine Lieben im Arm halten und wenn ich will, kann ich doch noch 100 Hunde adoptieren, einen Blumenladen eröffnen, nach Mexiko reisen und lernen, wie man diese leckeren kleinen Küchlein backt. Oder Gebärdensprache. Das kann ich alles, weil ich das große Glück habe, noch hier zu sein. Sie haben dieses Glück übrigens auch. Wie ich darauf komme, an so einem unspektakulären, verregneten Freitag derart unerhört glücklich im Bett zu liegen, das will ich Ihnen erzählen. Es hängt mit einem Gedanken-Experiment zusammen und hat vor ungefähr einem Jahr begonnen – und zwar so:
WIE ALLES KAM
Es gibt so Wochen, die sind echt für die Tonne. Das Kind trödelt jeden Morgen, in der Arbeit kommt man nicht hinterher, der Mann hat vergessen, die Strafzettel zu zahlen und jetzt kommt noch eine Strafe dazu, und dann geht auch noch der Drucker kaputt. Der zweite dieses Jahr. Ach so: Der Computer ist auch abgestürzt und die letzte Sicherungskopie ist natürlich aus dem Jahr 500 vor Christus.
Es gibt solche Wochen. Für mein Empfinden sogar deutlich zu viele.
»Endlich Freitag!«, sage ich nicht selten und schmeiße innerlich mit Konfetti, wenn endlich Wochenende ist. Die Woche ist geschafft, man kann sich gratulieren, Häkchen dahinter, und gern schütte ich mit gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen am Freitagnachmittag Prosecco in mich hinein. Wer auch immer diesen Brauch in deutschen Büros eingeführt hat, sei gepriesen in Ewigkeit. Es ist dann, als beglückwünschten wir uns alle, die Woche überstanden zu haben. Wieder eine, nach der wir nun endlich zwei Tage lang machen können, was wir wollen (die jüngeren Kollegen), beziehungsweise erledigen, was die Woche über so liegen geblieben ist (die mit Familie). Am Montagmorgen treffen wir uns dann wieder, nachdem wir in der Früh vor lauter Gähnen unter der Dusche beinahe ertrunken wären, und sehnen den Feierabend, das nächste Wochenende, den nächsten Urlaub, oder ganz Verzweifelte, sogar die Rente herbei.
Der Alltag kann einen echt mürbe machen. Dann fehlt noch so ein schlauer Spruch wie: »Weißt du noch, wie wir groß sein wollten, um all die aufregenden Dinge zu tun? Wie steht es damit?« und schon ist man am Grübeln, wo die großen Träume und die leidenschaftlichen Ziele eigentlich hingekommen sind und wie man nur in diesen Strudel aus Alltag, Gewöhnlichkeit und totaler Mittelmäßigkeit gelangen konnte. Wo man doch früher mal allen Ernstes Carpe diem in sein Poesiealbum geschrieben hat. Es steht da sogar noch, aber nur so »im Prinzip«, denn dass man danach lebt, davon kann keine Rede sein. Man kann ja schon froh sein, wenn man dieses improvisierte Leben so einigermaßen hinbekommt, wenn man sich über die kleinen Dinge freuen kann, über einen Sonntag im Bett, ein Lächeln, ein gutes Essen und ein selbst gemaltes Bild vom Kind. Aber zwischendurch läuft dann plötzlich im Radio »Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerriss’nen Jeans …« und während ich da so mitpfeife, fällt mir auf: ich auch nicht. Ich war höchstens mal auf Kreta, und das Alleraufregendste war, dass wir kein Hotel im Voraus gebucht hatten, sondern vor Ort erst eines suchen mussten. Der sogenannte Puls des Lebens ist zu so einem gleichbleibenden Rauschen geworden, das mich einlullt und ganz wunderbar dahin schlummern lässt.
An diesem mittelmäßigen, auf Sicherheit bedachten kleinen Leben bin ich natürlich selber schuld. Ich habe schließlich höchstpersönlich die Entscheidungen getroffen, die es ausmachen, und ein guter Teil davon war auch wirklich einsame Spitze. Der Mann zum Beispiel (also meistens zumindest) und das Kind. Da bin ich schon gut dabei, denn für viele ist schon die Entscheidung für den Partner eine, die sie nur deswegen nicht rückgängig machen, weil sie vor einem Leben ohne ihn zurückschrecken.
Was Entscheidungen die Arbeit betreffend angeht – na ja. Da war mein Ratgeber viel zu oft die Angst: lieber nichts riskieren, lieber keine Sicherheiten aufgeben, lieber keine Herausforderungen annehmen, an denen man scheitern könnte. Und auch sonst mache ich viel zu oft nicht das, was ich will, sondern das, was die meisten guten Gründe hinter sich versammelt. Manchmal ist es auch einfach schwer, überhaupt erst herauszufinden, was man eigentlich will. Während ich das alles bei einem Milchkaffee im Café Einstein vor meiner Freundin Jana so ausbreite, und schwadroniere über das Leben und wie man das Nebensächliche hinter sich lassen müsste, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren, wischt sie meine Sätze mit einer Handbewegung vom Tisch. »Du hast vielleicht Probleme«, sagt sie und schüttelt den Kopf. »Ich habe gestern Nadja getroffen«, daraufhin blickt sie auf den Boden und atmet tief durch. Nadja war einmal Janas Studienbetreuerin gewesen und ist ihr über die Jahre eine liebe Freundin geworden. »Ich habe doch erzählt, dass sie eine Stelle an ihrer Brust untersucht haben?« Und noch bevor Jana mich mit Tränen in den Augen ansieht, weiß ich, was jetzt kommt. »Nein«, schüttle ich den Kopf und nehme ihre Hände. »Doch«, schnieft Jana und wir sehen uns an. Nadjas Brustkrebs ist zurückgekehrt. Einmal hatte sie ihn schon überwunden, jetzt ist er, Jahre später, wieder da.
An dem Abend drücke ich den leicht verdutzten Mann und das sich wehrende Kind (»Heeey!«) besonders lang und eng an mich. Wir sind alle drei gesund und wir sind zusammen, das ist es, was wirklich wichtig ist – alles andere ist zweitrangig. »Was bin ich froh, euch zu haben«, flüstere ich in ihre Ohren, und drücke nochmal beide fest (»Heeeeeyyyyyy!«). »Ich liebe euch«, ich sage das viel zu selten.
Wir wissen natürlich, dass wir irgendwann in die Grube fahren, wir sind ja nicht bescheuert – aber im Alltag wird dieses Wissen im Hirn ganz hinten aufbewahrt, wo man es, wenn nötig, zwar findet, aber wo man eben auch nicht permanent drüber stolpert. Und dann benehmen wir uns weiterhin so, als wären wir unsterblich. Bis eine Freundin krank wird oder ein Kollege verunglückt und mit einem Mal wieder ganz klar ist: Wir sind nicht unsterblich.
Als ich L. an diesem Abend von Nadjas Diagnose erzähle, erinnern wir uns an einen gemeinsamen Abend bei Jana, an dem Nadja geklagt hatte, sie sähe vor lauter Arbeit ihre Kinder kaum – und dass sie daran auch gar nichts ändern könne, weil das Gehalt ihres Partners für die Hypothek nicht ausreicht. »Hätte sie nur mehr Zeit mit den Kindern verbracht«, rutscht es mir heraus, nicht weil ich schlaumeiern will, sondern weil es mir so leidtut.
»Und die Hypothek für das Haus?«, fragt L. »Scheiß auf das Haus«, finde ich. Auch die Weltreise fällt mir ein, die sie nicht angetreten hat, weil sie keinen unbezahlten Urlaub bekommen hat, und die sie schon plante, als sie noch studierte.
Und dass sie immer einen Hund haben wollte, dass sie davon geträumt hat, ein kleines Hotel irgendwo im Süden aufzumachen, und dass sie sich insgeheim gewünscht hat, ihr Freund und Vater ihrer Kinder würde sie fragen, ob sie ihn heiratet.
»Warum hat sie ihm das nie gesagt?«, fragt L. und sieht mich erstaunt an, und so genau kann ich ihm das auch nicht beantworten. »Vermutlich wollte sie eben gern gefragt werden, das ist etwas romantischer als es – vorzuschlagen«. Einen Moment lang herrscht eine komische Stille, in der L. mit Sicherheit überlegt, ob ich mir eventuell auch so etwas wünsche. Wir sehen beide etwas verlegen auf dem Tisch herum.
»Du wolltest auch mal ein kleines Hotel aufmachen, irgendwo im Süden, erinnerst du dich?«, lenkt L. glücklicherweise das Gespräch woanders hin und ich muss lächeln, denn, ja, das wollte ich tatsächlich mal. »Willst du das immer noch?«, fragt L.
»Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen«, kommt es aus meinem Herzen. Falls sich jemand fragt, warum ich noch nicht längst auf einem Klappstuhl vor meinem eigenen Bed & Breakfast in der Sonne hocke und Campari Orange schlürfe: Ich habe einen Job, ich habe L. und das Kind und allein der Gedanke daran, was für ein derartiges Vorhaben nötig wäre, treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Ich wische den Gedanken daran weg und frage L.: »Was würdest du denn machen, wenn du wüsstest, dass du nicht mehr lange Zeit hast?«, denn im Spießumdrehen bin ich ganz groß. »Ich wäre auf jeden Fall nicht sauer wegen ein paar Strafzetteln«, macht L. einen Versuch, sich herauszuwinden.
Dann wird es aber doch noch ernst, denn wie sich herausstellt, hilft der Gedanke daran, dass man das Zeitliche segnen wird – und das wird man ja nun mal definitiv – ungemein dabei, ein paar Dinge geradezurücken. Und wenn wir diesen Zeitpunkt nicht in weite Ferne schieben, ins unbestimmte Irgendwann, sondern ihn vor Augen haben, dann zeichnet sich sehr genau ab, was es tatsächlich wert ist, unsere Zeit und unsere Energie in Anspruch zu nehmen.
Kurz gesagt: Wenn ich weiß, dass ich nur noch ein paar Monate zu leben habe, würde ich dann die gleichen Entscheidungen treffen? Ärgere ich mich dann über die gleichen Dinge? Würde ich tun, was ich heute tue? Mit wem würde ich meine Zeit verbringen? Und wie? Was würde ich unbedingt noch machen wollen – und was als bedeutungslos am Weg stehen lassen? Wäre ich am Ende froh, dass meine Wohnung immer sauber war und ich alle Abgabetermine eingehalten habe? Warum stellt man sich diese Frage nicht viel öfter: Was ist wirklich wichtig?
Nicht zu fassen, wie schnell man das immer wieder aus den Augen verliert. Und wie man immer wieder von Woche zu Woche hetzt und am Ende doch so gern noch ein paar mehr davon hätte.
Wie absurd das ist, ist mir aufgefallen, als meine Mutter irgendwann im November sagte: »Wenn so ein Scheißwetter ist, bin ich froh, wenn der Tag schnell rum ist.« Jetzt muss man wissen, dass dort, wo sie wohnt, ganz schön oft Scheißwetter ist. Sie wohnt nämlich in Regensburg. Das ist zwar eine wirklich hübsche Stadt, liegt aber in einem Talkessel, zusammen mit viel Wasser in Form von ein paar Flüssen, und diese Mischung ergibt ab Herbst eine stabile Nebeldecke, die sich bis Mai auch nicht mehr auflöst. Die Mama sitzt also wirklich oft auf ihrem Sofa und wartet, dass der Tag vorbeigeht – zumal sie aufgrund körperlicher Widrigkeiten in ihrem Tun eingeschränkt ist.
Das ist doch krass – besonders, wenn man bedenkt, wie viele Tage man im Allgemeinen so zur Verfügung hat.
Ich mal Ihnen mal was auf:
1
Das, falls Sie sich schon gefragt haben, sind alle Jahre, die ein 90-jähriger Mensch so zur Verfügung hat. Im Durchschnitt haben Männer 78 Jahre zur Verfügung, Frauen 84. Wenn Sie da mal kurz alle Jahre ausstreichen, die Sie schon »geschafft« haben; also die noch leeren Kästchen – das ist, was Ihnen noch bleibt, dann sind Sie tot. Wenn man an den letzten Kästchen angekommen ist, und das kann weiß Gott früher sein als mit neunzig, was würde man dann bereuen, nicht gemacht zu haben?
Vermutlich deswegen hat Carlos Castaneda2 einmal gesagt, der Tod ist der einzige weise Ratgeber, den wir haben. Runtergebrochen heißt das: Wenn wir nicht sicher sind, wie wir in einer Sache entscheiden sollen, hilft es, sich für einen Moment vorzustellen, dass man nur noch kurze Zeit zu leben hat. Das schärft den Blick ungemein.
Halten Sie doch einen Moment inne und lassen Sie das Buch kurz sinken und stellen Sie sich vor, Sie wüssten nun, dass Sie demnächst sterben. Wie würden Sie Ihr bisheriges Leben dann bewerten? Lassen Sie das ruhig kurz wirken, wir haben Zeit.
………
……
…
.
Wären Sie glücklich mit Ihren Entscheidungen?
Und wenn Sie nach vorne sehen: Sind sie glücklich damit, wie Sie ihre Zeit verbringen? Und mit wem? Wen würden Sie anrufen und was würden Sie noch sagen wollen? Wären Sie noch sauer auf Ihre Kollegin (die blöde Gans), weil sie immer … oder wäre das unnütze Zeitverschwendung? Würden Sie zu diesem Ehemaligen-Treffen gehen, auf das Sie heute schon keine Lust haben, und wenn nicht: Was würden Sie stattdessen tun?
Oder andersherum gefragt: Wie würde sich unser Leben verändern, wenn wir unsere Entscheidungen mit dem Wissen fällen, morgen könnte der letzte Tag sein. Oder der letzte Monat, das letzte Jahr. Wenn wir aufhören würden, die Zeit zu vergeuden, in der Annahme, wir hätten ja noch so viel davon. Und warum sind die Antworten auf die Frage »Was ist noch wichtig?« nicht die gleichen Antworten, die einem einfallen, wenn man überlegt, um was man sich in seinem Leben so kümmert den lieben langen Tag? Obwohl wir sogar immer wieder die Erfahrung machen, dass wir besonders glücklich sind, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen und tun, was uns wirklich wichtig ist und nicht:
•wovor wir am wenigsten Angst haben,
•was am meisten Erfolg versprechend ist,
•was am leichtesten fällt,
•was die Familie erwartet,
•oder was irgendeine Religion, eine Partei, ein Chef oder sonst irgendjemand will, das man tut.
Wenn Sie brav das Buch haben sinken lassen und sich ein bisschen eingefühlt haben in den Gedanken, dass Ihr Leben eventuell bald vorbei ist, dann ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass sich die Bedeutung verschiedener Anlässe, Menschen und Tätigkeiten verschiebt. Und zwar in eine gesunde Richtung – wir sind plötzlich geneigt, so zu handeln, wie wir tatsächlich empfinden. Ohne Wenn und Aber, ohne Angst. Eben genau so, wie wir eigentlich handeln sollten. So, wie das Herz es will. Und das ist der Anfang. Der Anfang vom Ende, nämlich meinem.
Falls Sie schon mal ein Buch von mir gelesen haben sollten, schwant Ihnen vermutlich, was jetzt kommt: Wir probieren das jetzt mal. Also ich probiere und Sie dürfen zugucken. Vielleicht ist ja die eine oder andere Anregung für Sie dabei, wenn ich versuche:
DIESES JAHR SO ZU LEBEN,
ALS WÄRE ES DAS LETZTE,
DENN:
Das Leben ist zu kurz für später
Vorab eine Anmerkung:
In den folgenden Kapiteln wird es darum gehen, wie sich das Leben verändert. Es wird nicht um das Sterben gehen. In keinster Weise will ich mit diesem Gedankenxperiment jemanden vor den Kopf stoßen, niemanden, der einen geliebten Menschen verloren hat und niemanden, der vielleicht selbst schwer krank ist. Ich habe selbst liebe Menschen verloren und im Familien- und Freundeskreis Menschen mit unheilbaren Krankheiten. Auch in meinem Leben gibt es viele, die enge Angehörige verloren haben und deren Lieben völlig unerwartet verstorben sind. Durch einen Unfall, durch Krankheit, aber auch aus freien Stücken. Dieses Buch wird nicht trotz dieser Menschen und ihren Geschichten geschrieben, sondern wegen ihnen. Denn am meisten werden wir ihnen gerecht, wenn wir das Leben hoch halten und ehren, wenn wir es feiern und jeden Tag dankbar sind, dass wir es haben. Denn wir haben die Möglichkeit, unser Leben zu ändern, bevor es zu spät ist.
Gehen wir es an.
DIE DEADLINE
Die Idee steht. Ich werde so leben, als gäbe es eine konkrete Deadline. Einen Todestag. Und zwar einen ganz bestimmten, fassbaren, in naher Zukunft, nicht den reellen, den wir immer vergessen, weil er irgendwann ist und alles mit »irgend« vorne dran vergessen wir sowieso ständig.
Der 15. Februar zum Beispiel, der könnte es sein. Der ist so gut wie jeder andere Tag und das erste Datum, das mir einfällt. Am 15. Februar des kommenden Jahres ist es leider vorbei mit mir. Es bleibt mir nicht mal ein ganzes Jahr. Der erste Gedanke, der mir nach der Festlegung des Datums durch den Kopf schießt, ist:
›Die letzte Chance, einmal den Valentinstag zu zelebrieren, der ist ja einen Tag vorher.‹ Der zweite Gedanke ist: ›Was für ein bescheuerter, erster Gedanke.‹
L. und ich haben noch nie Valentinstag gefeiert. Kein Geschenk, keine Karte, noch nicht mal ein Essen, wir haben es einfach ignoriert. Es war uns zu albern, ein kitschiger, importierter Konsumfeiertag, was für US-Teenager, das Allerletzte. Wir laufen ja schließlich auch nicht an Halloween kostümiert um die Häuser, um von Nachbarn Süßigkeiten zu erpressen (was bei genauerem Nachdenken der deutlich reizvollere Feiertag wäre, wenn man sich schon einen aussucht).
Vor dem Hintergrund aber, dass der nächste mein letzter Valentinstag ist, ist meine ablehnende Haltung wie weggeblasen. Es ist noch fast ein Jahr hin, aber eins hab ich jetzt schon klar: Diesmal will ich Herz-Luftballons und Blumen, ein romantisches Essen bei Kerzenlicht und Geschenke und – alles. Ich will alles.
Ist das schon die erste Auswirkung der Deadline? Das kann ja heiter werden.
»Was würdet ihr tun, wenn ihr – sagen wir, noch ein Jahr zu leben hättet?«, frage ich an dem Abend Jana und Anne. Jana und Anne sind meine Freundinnen und wir sitzen im Café Einstein, so wie jede Woche. Meistens werden an diesen Abenden ein, zwei (sein wir ehrlich: vier, mindestens) Gläschen getrunken, man berichtet sich die Highlights sowie Tiefpunkte der Woche und es wird viel gelacht. Ein bisschen so wie die heute -show, nur zu dritt und mit Alkohol.
Wer also mit tiefsinnigen, rührenden und besinnlichen Antworten an dieser Stelle rechnet, der mag die nächsten Seiten überspringen.
»Also?«, frage ich. »Was wäre das?« Und aus dem Mund der lieben Anne kommt wie aus der Pistole geschossen: »Ich würde nach Disneyland fahren!« Jana und ich müssen sie ziemlich lange angestarrt haben, denn irgendwann in dieser Stille fängt Anne an, sich zu rechtfertigen: »Was denn?«, ruderte sie herum. »Ich mag nun mal die Disney-Filme, immer schon.« Und dann starren wir sie noch ein bisschen weiter an.
Man muss wissen, Anne ist das esoterischste, spirituellste und auch sonst alternativste Huhn, das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis zu finden ist. Schutzengel und Aura-Sprays, Schamanentänze und Kristalle zum Chakrapolieren: All das kann man bei Anne finden und mit ihr darüber diskutieren, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, kann man sie auch einfach mitsamt den Engeln, den Sprays und den Chakren nehmen, wie sie ist, sie ist nämlich auch noch wahnsinnig reizend.
Vielleicht kennen Sie auch so jemanden, jedenfalls ist »Disneyland« für Anne ungefähr so exotisch, wie wenn ich behaupten würde, ich möchte in diesem Leben unbedingt noch über die Pyrenäen wandern. Barfuß. Im Winter.
»Was ist denn dein Lieblingsfilm?«, grinst Jana und Anne errötet leicht. Arielle, die Meerju..., und weiter kommt sie nicht, denn Jana und ich prusten laut heraus.
Anne ist Gott sei Dank nur minimal sauer, was auch daran liegt, dass jede mit etwas aufwarten kann, was zur allgemeinen Erheiterung beiträgt: Jana würde – sofern sie ganz sicher den Löffel abgibt und auch explizit nur dann – den unverschämt gut aussehenden Mann ansprechen, der jeden Tag mit ihr in der U-Bahn fährt. Er hat eine rasierte Glatze, keinen Ehering, und sie vermutet, er heißt Ahmet, so hat er sich zumindest mal am Handy gemeldet. Er sieht sie nie an, er merkt nicht, wenn sie neben ihm sitzt, und Jana vergeht vor Schmachten. Fehlt er morgens in der U-Bahn, ist für Jana der Tag schon halb gelaufen.
Anne sieht sie ratlos an: »Aber du würdest ihn ansprechen, wenn du wüsstest, dass du den Löffel abgibst?« Jana nickt: »Dann hab ich ja nichts mehr zu verlieren.«
Jetzt ist natürlich die große Frage, was sie denn verlieren würde, wenn sie ihn ansprechen würde, solange sie besagten Löffel noch hat …
»Meinen Stolz, zum Beispiel!«, sagt Jana und fügt hinzu: »Stell dir nur mal vor, ich spreche ihn an und er will nichts von mir wissen!«
Dieser Stolz, stellt sich im Laufe des Abends heraus, löst sich sofort in Luft auf, sobald wir an die Deadline denken. Wenn ich demnächst sterbe, …
•… dann bin ich nicht zu stolz, Ahmet anzusprechen,
•… dann bin ich nicht zu stolz, Eifersucht zuzugeben,
•… dann bin ich nicht zu stolz, Unsicherheit und Verletztheit zu zeigen.
»… und es wäre mir scheißegal, wenn sich alle totlachen, weil ich im Meerjungfrauenkostüm durch Disneyland watschle.«, sagt Anne und leert ihr Glas entschlossen.
Wir fühlen alle drei sofort, dass so etwas wie Stolz total nebensächlich wird. Auch Peinlichkeiten, siehe Meerjungfrauenkostüm. Eigentlich alles, was damit zusammenhängt, was andere Leute von einem denken. Es ist unwichtig. Allein durch diesen kleinen Gedanken, wenn ….
Alles, was man aus Stolz nicht tutAlles, was man aus Peinlichkeit nicht tut
ALLES, WAS MAN AUS STOLZ NICHT TUT
ALLES, WAS MAN AUS PEINLICHKEIT NICHT TUT
»Alles, was man aus Stolz nicht tut« hat ein international anerkanntes Symbolbild: nämlich einen nach vorne gebeugten Menschen, der abwechselnd eine Nachricht ins Handy tippt (das war das Herz) und sie dann wieder löscht (das war der Stolz).
Ein falscher Stolz am falschen Ort kann einem mal so richtig was vermasseln. Falscher Stolz hat Millionen von Telefonnummern auf dem Gewissen, die nicht ausgetauscht wurden, und ist Schuld an Unmengen von Freundschaften, die in die Brüche gegangen sind.
So wird Jana aus Angst vor verletztem Stolz nie den schönen U-Bahn-Ahmet ansprechen. Sie wird nicht herausfinden, ob er eine große Liebe ist, eine heiße Affäre oder einfach nur ein Typ mit schönen Augen. Und ich werde nie wissen, was aus der Beziehung mit diesem Mann geworden wäre, der tatsächlich gegangen ist, als ich ihn weggeschickt habe und dem ich nicht hinterhergegangen bin, obwohl alles in mir danach gerufen hatte, ihn aufzuhalten.
Falscher Stolz ist ein Scheiß, er hält uns nämlich davon ab, das Richtige zu tun.
Wenn ich daran denke, dass in knapp elf Monaten alles aus ist und ich das Zeitliche segne, wird dieser Stolz tatsächlich sofort lächerlich. Worauf kommt es denn schließlich an am Ende? Nur auf das Herz.
Am Tag darauf sind das Kind und ich bei seinem Kindergartenkumpel Leo und seiner Mutter eingeladen. Die Jungs spielen im Garten, Leos Mutter und ich zwitschern Eierlikör und es ist richtig idyllisch. Da hören wir plötzlich Gebrüll. Nach einer winzigen vielleicht-ist-es-gleich-wiedervorbei-Pause gehen wir nachsehen: Die beiden Knallköpfe prügeln mit Plastikschaufeln aufeinander ein. Dazu Geschrei, hochrote Köpfe und ganz viel Drama. Leos Mutter und ich werfen uns einen Blick zu, verdrehen die Augen und versuchen, die Kampfküken zu trennen. Beide sind völlig außer sich und machen, immer noch tobend, ihrer jeweiligen Mutter klar, dass der andere gerade etwas ganz, ganz Schlimmes getan hat. Etwas so Unverzeihliches, dass man nie mehr befreundet sein kann.
Leos Mutter und ich teilen eine ähnlich pragmatische Vorgehensweise in Sachen Dramen und beruhigen A- und B-Hörnchen, ohne allzu groß auf die Sache einzugehen. Nach zehn Minuten, die Tränenspuren auf den Wangen sind noch zu sehen, spielen beide wieder, als wäre nichts gewesen. Sie lachen und haben Spaß und sind dahingehend zu beneiden – Kinder streiten sich und dann spielen sie trotzdem wieder miteinander. Vielleicht ist ihnen ihr Glück einfach wichtiger als ihr Stolz.
Auf dem Nachhauseweg muss ich an Sarah denken. Wir haben uns vor einem gefühlten Jahrhundert auch gestritten – gut, es waren keine Plastikschaufeln im Einsatz, aber durchaus Drama. Sie ist kurz darauf weggezogen und ich habe sie erst Jahre später zufällig wieder gesehen, wir waren freundlich zueinander und distanziert, ein bisschen zu vorsichtig, als dass man uns für Fremde halten könnte. Erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass unsere ganze Zwistigkeit darauf gründete, dass sich jede von der anderen zurückgestoßen gefühlt hatte. Sie hatte Jahre vor mir ein Baby bekommen und war dadurch wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Ich führte mein Leben weiter und gegenseitig warfen wir uns mangelndes Interesse vor. Ohne es auszusprechen, wohlgemerkt. Beide waren wir verletzt, dass sich die andere scheinbar abgewendet hatte und beide waren wir zu stolz zu sagen: Ich vermisse dich. Als sie schließlich mitsamt Kind und Mann die Stadt verließ, verloren wir uns endgültig aus den Augen. Ich denke immer noch manchmal an sie, wir hatten die lustigsten Nächte und anschließend die größten Kater, wir waren das großartigste Gespann seit Dick und Doof. Sarah ist groß, blond und blauäugig, ich bin klein und dunkelhaarig, eine wunderbare Mischung. Als uns im Urlaub am Strand ein Taschendieb beklauen wollte, drosch Sarah ihm von oben auf den Kopf und ich boxte ihm in den Bauch. Wir waren ein perfektes Team in jeder Beziehung.
Als ich Jahre später selbst ein Baby bekam und mir klar wurde, warum Sarah damals so plötzlich und so vollständig verschwand, verstand ich auch, wie sie sich gefühlt haben musste. Ich interessierte mich nämlich in dieser für sie so wichtigen Zeit nicht für ihr Baby (also nicht nur für ihres nicht, ich fand Babys generell gähnend langweilig), ich interessierte mich nicht für ihre Sorgen und ich war nur beleidigt, dass sie mich so schmählich vernachlässigte und sich von mir abwendete. Was war ich für ein Hohlkopf gewesen.
Und was hat mich all die Jahre davon abgehalten, ihr genau das zu sagen? Tatsache ist, es ist mir im Nachhinein peinlich, so eine beschissene Freundin gewesen zu sein. Es ist die pure Scham und es war leichter, so zu tun, als ob nichts passiert wäre, und einen fadenscheinigen Grund zu suchen, der mich ein wenig entlastete: Sie hätte ja schließlich auch etwas sagen können! Oh Mann.
Es wird Zeit, ein paar klärende Worte zu sprechen. Ich schicke Sarah eine Nachricht, ob wir mal reden wollen, mir läge da was auf dem Herzen. So hat sie genügend Zeit, sich darauf einzustellen, dass ich mit einer geballten Ladung Emotion im Anmarsch bin und wir verabreden uns auf ein Telefonat, ein paar Tage später.
»Was willst du ihr denn sagen?«, fragt L., als ich ihm am Abend davon erzähle. Aber so genau weiß ich das auch noch nicht. »Ich will mich dafür entschuldigen, wie blöd ich war,«, zucke ich mit den Achseln, »aber ich weiß auch noch nicht, wie.«