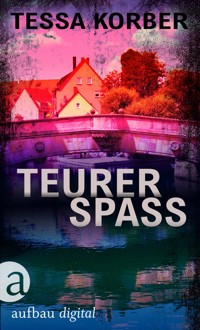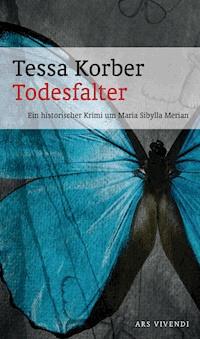6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die prachtvollsten historischen Romane von Tessa Korber
- Sprache: Deutsch
Südfrankreich, 13. Jh. Schon als Kinder wissen sie, dass sie füreinander bestimmt sind. Doch ihre Wege trennen sich. Amalric zieht als Troubadour durch die Lande, während sich Navenias ganz der Lehre der Katharer verschreibt. Sie möchte eine Perfecta werden, allein Gott nahe sein. Fast hat Amalric seine große Liebe aufgegeben, dann aber erfährt er, dass die Inquisition ihr auf der Spur ist. Er macht sich auf die verzweifelte Suche nach Navenias. Kann er sie retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
ERSTER TEIL - DER FRÜHLING DER KREUZFAHRER
1. - UNTERHALB DER FESTUNG LAVAUR, IM JAHR 1211
2. - DAS STÄDTCHEN LAVAUR, EINE STUNDE SPÄTER
ZWEITER TEIL - DER SOMMER DER KINDHEIT
1. - DAS DORF LAVAUR, IM JAHR 1203
2. - DIE BURG FOIX, IM JAHR 1204
3. - DIE BURG FOIX, IM JAHR 1205
4. - DAS DORF LAVAUR, AM SELBEN TAG
5. - DIE STADT TOULOUSE, IM JAHR 1205
6. - EIN WALD IN DER NÄHE VON LAVAUR, IM JAHR 1206
7. - LAVAUR, AM ABEND DESSELBEN TAGES
8. - AUF DEM HOCHUFER DES FLUSSES AGOUT IN DER NÄHE VON LAVAUR, IM JAHR 1207
9. - DIE BURG FOIX, IM JAHR 1207
10. - LAVAUR - ST. GILLES, IM JAHR 1208
11. - DIE STADT LYON, IM JAHR 1209
12. - LAVAUR, IM JAHR 1210
13. - DIE BURG VON LAVAUR, AM ANDEREN TAG - VOR DER FESTE TERMES
14. - DIE BURG VON LAVAUR BEI NACHT
15. - LAVAUR UND FOIX, IM WINTER 1210/11
16. - IN EINEM TAL BEI LAVAUR, EINE WOCHE SPÄTER
17. - DIE BURG VON LAVAUR, 1211
18. - MURET, 1213
19. - MURET, NACH DER SCHLACHT
20. - AN DER KÜSTE DER BRETAGNE, WENIGE WOCHEN NACH MURET
DRITTER TEIL - DER HERBST DES KRIEGES
1. - ROM, IM JAHR 1215
2. - DIE ENGELSBURG, AM 14. FEBRUAR 1215
3. - IM VATIKAN, IN DER NACHT DES 16. DEZEMBER 1215
4. - MONTSÉGUR, IM JAHR 1217
5. - TOULOUSE, IM JAHR 1218
6. - MONTSÉGUR, IM JAHR 1219
7. - DIE STADT MARMANDE, ZWEI WOCHEN SPÄTER
8. - PARIS, IM JAHR 1229
9. - TOULOUSE, IM JAHR 1230
VIERTER TEIL - DER WINTER DER BRÄNDE
1. - CARCASSONNE, IM JAHR 1240
2. - CARCASSONNE, AM SELBEN TAG
3. - AVIGNONET, IM JAHR 1242
4. - AVIGNONET, DEN ANDEREN TAG
5. - AVIGNONET
6. - CARCASSONNE, IM JAHR 1243
7. - BEI CANET, IM JAHR 1243
8. - CARCASSONNE, 1243
9. - MONTSÉGUR, IM JAHR 1243
10. - IM ARIÈGE NAHE MIREPOIX, IM JAHR 1243
11. - UNTERHALB MONTSÉGURS, IM JAHR 1243
12. - IN DEN WÄLDERN DES ARIÈGE, IM JAHR 1243
13. - IN DEN WÄLDERN DES ARIÈGE, IM JAHR 1243
14. - IN DEN WÄLDERN DER ARIÈGE, AM SELBEN ABEND
FÜNFTER TEIL - DER FLUG DER LERCHE
1. - MONTSÉGUR, IM JANUAR 1244
2. - IN DER NÄHE VON MIREPOIX, IM JANUAR 1244
3. - BEI MIREPOIX, EINIGE TAGE SPÄTER
4. - MONTSÉGUR, IM MÄRZ 1244
5. - MONTSÉGUR, IM MÄRZ 1244
NACHTRAG
Über die Autorin
Tessa Korber
DAS LETZTELIED DESTROUBADOURS
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Pour Christian,
comme toutes les autres choses aussi
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Textredaktion: Monika Hofko, München
Titelillustration: © The Lute-Player, French School/Hamburger Kunsthalle,
Hamburg, Germany/Bridgeman Berlin; © City of Foix, from ›Grand Atlas‹,
early 17th century, French School/Min. Defense – Service Historique de
l’Armee de Terre, France/Giraudon/Bridgeman Berlin
Umschlaggestaltung: Geviert – Büro für Kommunikationsdesign, München
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1085-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
ERSTER TEIL
DER FRÜHLINGDER KREUZFAHRER
1.UNTERHALBDER FESTUNG LAVAUR, IM JAHR 1211
»Navenias, Liebste«, flüsterte Amalric, »denk an mich. Vielleicht werde ich das hier nicht überleben.«
Seine Kehle war so trocken, dass er kaum schlucken konnte, doch er vermied es, sich zu räuspern, um kein Geräusch zu machen. Die deutschen Ritter konnten nicht mehr weit sein. Angestrengt starrte er in den Wald hinunter und zügelte dabei sein unruhig werdendes Pferd, das den Kopf schüttelte und mit den Nüstern durch einen Ginsterbusch zu schnobern suchte. Amalrics Langschwert klirrte leise gegen die Steigbügel.
Ein rascher Blick zum Vizegrafen von Foix verriet Amalric, dass auch sein Herr und Kommandant erregt war. Das schmale Gesicht des Grafen unter der Kettenhaube war noch bleicher als sonst, die Augen weit aufgerissen. Die Faust des Grafen umklammerte die Lanze, mit der er seinen zwischen Bäumen und Gestrüpp kauernden Männern das Zeichen zum Angriff geben wollte.
Gerade einmal sieben Ritter waren sie. Amalric biss sich auf die Lippen bei dem Gedanken. Sieben Gepanzerte hockten hier im Harnisch auf ihren mächtigen Gäulen, denen der Farn um die Fesseln strich. Mit ihren Kettenhemden, bunten Satteldecken und prächtig bestickten Wämsen sahen sie aus wie Fabelwesen, sie wirkten fehl am Platze im grünen Dickicht des Eichenwäldchens hier unter der Burg von Lavaur.
Sieben Kämpfer. Es wurden nicht mehr, je länger Amalric auch zählte. Der Rest ihrer Schar, wenn es auch nicht wenige waren, bestand bloß aus Bauern, aus Knechten und ein paar Handwerkern, jungen Burschen aus der Stadt, die sich ihnen angeschlossen hatten, allesamt mit mehr Mut als Verstand gesegnet. Und was sie in den Händen hielten, war ihr tägliches Arbeitsgerät: Da gab es Hämmer, Stangen, Brecheisen, Sicheln, Sensen, Dreschflegel – ein kleiner Wald von Gerätschaften ragte über die Köpfe der geduckt Wartenden, ein eiserner Hain des Todes, der nichtsdestotrotz eher wirr als beeindruckend aussah. Einheitlich wirkten an der zusammengewürfelten Truppe nur die frisch geschlagenen und zugespitzten Holzspieße, die sie trugen.
Amalric hatte sie mit den Männern gemeinsam angefertigt. Er war ihr Anführer gewesen und hatte in den letzten Wochen geduldig mit jedem Einzelnen geübt. »Gegen eine anreitende Front Gepanzerter«, hatte er ihnen erklärt, »hat man zu Fuß und ungedeckt nur eine Wahl: mit einem Wall langer Stangen, die ihr so halten müsst, seht ihr? So!«
Er hatte ihnen gezeigt, wie sie den Spieß vor sich in den Boden stemmen sollten, damit sich die Spitze den herangaloppierenden Pferden in die Brust rammte. »So kann man die Reiter zu Fall bringen, ehe ihre Lanzen einen erreichen.«
Mit großen Augen hatten sie ihm zugehört. Der Gedanke war ihnen neu, dass ein einfacher Mann gegen einen Gepanzerten überhaupt ankommen könnte. Und er gefiel ihnen. Bald jedoch begriffen sie, worin die Schwierigkeit bestand: Es brauchte dazu den Mut, stehen zu bleiben im Angesicht einer donnernd heranpreschenden Woge aus Muskeln und tödlichem Eisen. Man durfte nicht unruhig werden, wenn der Boden unter den nackten Füßen bebte, wenn der Stahl der Schwerter schon fast über den Köpfen zischte, und man durfte nicht einmal zurückzucken, wenn einem schon die Grassoden um die Ohren flogen, die von den Hufen der mächtigen Schlachtrösser aufgewühlt wurden.
»Von euch hängt es ab«, hatte Amalric ihnen gesagt und jedem Einzelnen tief in die Augen geschaut. »Von eurem Mut. Ihr könnt diese Schlacht entscheiden.« Amalric fragte sich, ob genau das heute dem Häuflein gelingen würde, das unter dem Befehl von Guillaume ihre Talflanke sicherte.
Die andere Wahl, die man ungepanzert gegen einen Ritter in vollem Harnisch hatte – er hatte die Lektion, die der Graf ihn gelehrt und die er selbst weitergegeben hatte, noch im Ohr –, bestand darin, sie auf Gelände zu locken, wo ein Reiter seine Stärke nicht ausspielen konnte. Deshalb lagen sie hier im Hinterhalt, an diesem bewaldeten Hang, an dessen Fuß sich der Weg entlangschlängelte, über den die deutschen Kreuzritter kommen mussten.
Weiter oben auf den Felsen schließlich hockte ihr dritter Trumpf: die Armbrustschützen, deren starke Bolzen die Rüstungen des Feindes durchschlagen würden, wenn er kam, wenn er denn endlich kam. Navenias! Er sandte ihren Namen als Stoßgebet gen Himmel. Ja, er war bereit zu kämpfen. Aber würde er das Warten überstehen?
Amalric sah aus den Augenwinkeln, wie einer der Jungen sich vorbeugte, die Hand auf den Boden legte und lauschend verharrte. Dann hob er den Kopf. Amalric fing den erschrockenen Blick auf, begriff und nickte. Die Erde bebte unter dem Schlag vieler Hufe; sie waren da.
»Herr«, flüsterte er.
Aber der Vizegraf von Foix hatte es bereits selbst bemerkt. Mit einer entschlossenen Bewegung hob er die lange Lanze über den Kopf. Alle hielten den Atem an. Manche bekreuzigten sich; gleich war es so weit.
Drunten zwischen den Bäumen wurden das bunte Wams und der Mantel des ersten Kreuzritters sichtbar. Gelassen saß er im Sattel und ließ sich im Schritt seines Tieres wiegen, ein großer, bärtiger Mann, die Hand in die Hüfte gestemmt und sich seiner Kraft gewiss. Dann kam der nächste. Und der nächste. Mann neben Mann zogen sie vorbei, geübte Krieger, erfahrene Orientkämpfer, so hatte man es ihnen berichtet. Amalric studierte ihre Wappen, die ihm unbekannt waren. Diese Männer hatten in Palästina gegen die Heiden gekämpft, und nun hatte der Papst sie gerufen, um hier, im Süden Frankreichs, die katharischen Ketzer zu besiegen.
Um uns zu besiegen, dachte Amalric und biss sich auf die Lippen. Mich, dich, Navenias, unsere Freunde und Familien. Uns nennen sie Ketzer, ein Christenmensch den anderen. Verflucht sollen sie sein, Papst, König und alle, die zu ihnen halten! Er hasste sie so glühend, dass er meinte, er hielte es nicht mehr aus. Amalric durchbohrte den Grafen förmlich mit seinem Blick; wollte er denn das Zeichen niemals geben?
Aber Foix blieb regungslos. Noch immer verharrten sie still in ihrem Versteck. Die Harnische der Deutschen drunten klirrten, ihr ungeniertes, ahnungsloses Lachen hallte zwischen den Bäumen wider. Sie fürchteten offenbar keinen Hinterhalt. Sogar eine Leier erklang und die Stimme eines Sängers, hie und da unterstützt von einem halbherzigen Chor. Die Hufe der Pferde schlugen einen gemächlichen Takt dazu. Die Reihe wurde länger und länger und riss nicht ab. Schon waren dreißig Ritter dort unten zu sehen, inmitten ihres wimmelnden Trosses, und kein Ende war in Sicht.
Wir sind wahnsinnig, schoss es Amalric durch den Kopf. Und im selben Augenblick durchströmte ihn eine glühende Kraft. Am liebsten hätte er laut herausgelacht. Alles an ihm bebte und brannte. Er war bereit für diesen Wahnsinn. Es konnte beginnen. Wie im Traum sah er Foix ausholen und werfen, verfolgte, wie die Lanze des Grafen die Luft durchschnitt, wie sie flog, dem Himmel entgegen, sich dann wieder der Erde entgegensenkte und mit einem Geräusch, dass er niemals vergessen würde, zitternd in der Brust eines deutschen Ritters stecken blieb. Er fühlte sich schwerelos, das Gewicht der Rüstung war mit einem Mal nicht mehr zu spüren, und als er losritt, war ihm, als würde er fliegen.
Amalric kam sich unverwundbar vor. Unwirklich erschien ihm der Hagel aus Geschossen, der im selben Moment über ihre Köpfe hinweg sirrend auf den Talweg niederging wie eine düstere Wolke. Er beachtete die Pfeile gar nicht. Das war nichts, was ihn anging. Die Schreie seiner getroffenen Freunde hörte er nur wie von ferne, wie etwas, das in einem Traum geschah, den ein anderer träumte.
Er nahm das Aufbäumen seines Pferdes wahr, als er zu scharf am Zügel riss, aber er fühlte weder Erregung noch Angst. Als wäre er unsterblich, trieb er das Tier, das unter der Gewalt seines Befehls in Panik geriet und mehr rutschte als lief, auf direktem Weg den Hang hinab. Steine und losgetretene Erde stoben um ihn herum. Amalric überlegte nicht, dass er stürzen und sich den Hals brechen könnte. Er verschwendete keinen Gedanken an die Armbrustbolzen, die auch sein Kettenhemd mühelos durchschlagen konnten und nicht fragten nach Freund oder Feind. Er hatte eingestimmt in das große Gebrüll aus allen Kehlen, spie mit seinem Atem seine Kraft, seinen Hass, alles, was in ihm war, dem Feind entgegen und hieb drein.
»Navenias!«, rief er. Auf einmal spürte er, wie heißes Blut über seinen Mund spritzte. Er schlug auf Arme und Leiber, stach in Fleisch, zerschlug Gesichter, zerfetzte Gliedmaßen. »Navenias!« Das war kein Kampf mehr, tausendfach im Duell geübt, das war ein Gemetzel; wie Raubtiere fielen sie einander an. Die zarte Gestalt seiner Freundin Navenias, der Sanften, die kein Fleisch aß und kein Tier schlachtete, die die Liebe predigte und die Vergebung, verschwand und verging wie ein Nebel über dem tobenden Schlachtfeld. Und doch tat Amalric das alles nur für sie. Es war ein Wahnsinn, und das Wissen darum trieb Amalric weiter und weiter. Der Boden wurde zu einem Sumpf aus Blut und Erde.
»Sieg! Sieg!«
Erst nach einer ganzen Weile wurde Amalric es gewahr, dass der Ruf erscholl – und dass er ihm selbst und den Seinen galt. Endlich hielt er inne.
Der Vizegraf kam ihm mit strahlendem Gesicht entgegen. Er hatte Helm und Kettenhaube abgestreift und tätschelte seinen schwitzenden Gaul. Als er Amalrics fragenden, verschleierten Blick sah, reckte er die Faust. »Sieg, junger Freund.«
Erst jetzt blickte der junge Ritter um sich. Die Seinen standen noch, diese bunt zusammengewürfelte, kleine, nun gänzlich zerraufte Schar, von deren Klingen und Stangen das Blut troff. Geschrumpft schien sie ihm, aber sie stand aufrecht, Entsetzen und Stolz in den bleichen Gesichtern. Und zwischen ihnen lagen die Kadaver der deutschen Pferde und die Leichen ihrer Reiter, verrenkt, kaum mehr kenntlich die Farben ihrer Wämser, hingeschlachtet, eine tote Landschaft aus Blut und Fleisch.
Noch immer schienen die wackeren Männer nicht glauben zu wollen, dass ihr Furor dies bewirkt hatte. »Mein Gott«, stammelte einer von ihnen, andere bekreuzigten sich. Nur einige Wohlgemute gingen pfeifend umher und hoben, wo immer sie noch einen am Leben fanden, ihren Spieß, um mit einem wohlgesetzten Stoß ein Ende zu machen.
Keine Gefangenen, das hatte der Vizegraf zuvor bestimmt. »Wir sind nicht auf Lösegeld aus. Wir üben keine Gnade. Wir werden ihnen einfach ein für alle Mal klarmachen, dass Lavaur und die Festung der Lauracs sich nicht ergeben. Und wer immer den Belagerern zu Hilfe kommt, den wird ein grausiges Schicksal ereilen.«
Diese Worte im Kopf, betrachtete Amalric das Schlachtfeld. Wahrlich, die Botschaft würde ankommen.
Dass sie sich schnell verbreitete, verrieten die ersten Lumpengestalten, die zwischen den Bäumen hervorkamen, um sich an den Toten zu schaffen zu machen. Beutelschneider, Schmuckdiebe waren die meisten, aber auch Waffen verschmähten sie nicht. Die Schmiede zahlten gut für das Eisen, und an Eisen herrschte derzeit Bedarf. Angeekelt wandte Amalric sich ab. Er kannte sie gut, sie kamen so unvermeidlich wie die Krähen, aber mit seinem Handwerk hatte das nichts mehr zu tun.
Plötzlich spürte er die Erschöpfung. Er ließ sich auf einem Baumstumpf nieder und schaute teilnahmslos zu, wie die Männer über das Leichenfeld streiften. In einem, der vorbeikam und ihn ehrfürchtig grüßte, erkannte Amalric einen Burschen, den er die letzten Tage an der Armbrust geschult hatte. Er mochte dreizehn sein oder vierzehn, die Haut war braun vor Schmutz, und die von der Sonne gebleichten Haare standen ihm wirr um den Kopf. Amalric hatte den Jungen gemocht wegen seines trotzigen Willens zu lernen. Die Verbissenheit, mit der er an sich gearbeitet hatte, hatte Amalric an sich selbst erinnert. Auch er war einmal aus der Gosse gekommen. Heute trug er ein Wappen und einen Namen. Wie war noch der Name des Burschen gewesen?
»Sei gegrüßt, Marcabrus«, rief er dem Jungen zu, als es ihm wieder einfiel, »ein gutes Tagwerk hast du vollbracht.«
Der Angesprochene errötete, aber das kurze Aufleuchten seiner Augen wich schnell wieder einem düsteren, eher bockigen Ausdruck.
Was hat der Kerl nur, überlegte Amalric. Er bemerkte, wie der andere etwas hinter seinem Rücken zu verbergen suchte. Dann schien Marcabrus sich zu besinnen und ließ den Arm langsam sinken. An seinem Gürtel baumelte eine Kette seltsamer Anhängsel. Es waren abgeschnittene menschliche Ohren.
Entsetzt starrte Amalric sie an. Marcabrus biss die Zähne so fest zusammen, dass die Kieferknochen hervortraten. Schließlich sagte er trotzig: »Ich stamme aus Béziers.«
»Béziers!« Amalric nickte. Béziers war die erste Stadt gewesen, die von den Kreuzfahrern belagert worden war. Sie hatte die Auslieferung von hundert gläubigen Katharern an die Krieger von Papst und König verweigert. Zur Strafe war die Bevölkerung ohne Ansicht von Person, Stand und Religion niedergemetzelt worden. »Béziers. Ich verstehe.«
»Gar nichts versteht Ihr!«, widersprach Marcabrus. »Sie hatten sich in die Kirche geflüchtet. Hört Ihr? In die Kirche!« Seine Stimme wurde lauter.
Amalric versuchte ruhig zu bleiben. »In St. Madelaine suchten sie Zuflucht, Marcabrus, ich weiß. Ganze siebentausend, wie es heißt.«
»Und die Kreuzfahrer haben keinen am Leben gelassen.«
»Ich weiß, aber …«
»Nichts wisst Ihr, gar nichts!« Marcabrus schrie jetzt. In seinen Augen standen Tränen. »Es waren ja nicht Eure Eltern, die in der Kirche verbluteten, es war nicht Euer Bruder, der in den Straßen von den Flüchtenden totgetreten wurde. Was habt Ihr schon gesehen? Was habt Ihr verloren? Sagt nicht noch einmal, dass Ihr irgendetwas versteht.«
Amalric sah den Jungen mit seinem blutverschmierten Gesicht, in dem das Weiße der Augen leuchtete, nur stumm an. Béziers war der Anfang gewesen. Der Auftakt, der dem Süden zeigen sollte, was auf ihn zukam. Und wir, dachte Amalric, wir haben es begriffen. Sein Blick wanderte über das Schlachtfeld. Heute haben wir zurückgeschlagen. Die Zeit der Wölfe hat begonnen. Er wollte etwas sagen, aber Marcabrus senkte den Kopf und stapfte davon.
Es werden niemals siebentausend werden, wollte er dem Jungen hinterherrufen. Schon sieben mal sieben solcher Trophäen werden deine Seele vernichten. Aber er ließ es sein. Wer war er, die Gefühle anderer zu verurteilen, wo er nicht einmal seiner eigenen Gefühle sicher war?
Navenias!
Wieder und wieder erklang ihr Name in ihm. Wie sehnte er sich danach, den Kopf in ihren Schoß zu legen, ihre Hand auf seiner Stirn zu fühlen und zu erleben, wie sich all die Wirrnis in ihm löste. Er hatte das hier für sie getan, nur für sie. Navenias sollte leben, sie sollte frei sein. »Navenias!«, stöhnte er. Er wollte sie umarmen, um zu spüren, dass alles, was er getan hatte, gut war, dass es sich gelohnt hatte, weil es sie noch gab, weil sie am Leben war und er weiterhin ihren Duft riechen und die Wärme ihrer Haut fühlen durfte. Weil er ihr über das Haar streichen durfte. Sie war es, die all dem hier einen Sinn geben würde. Würde sie ihn dafür lieben können?
»Herr?« Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Sein Knappe reichte ihm einen Lederschlauch mit Wasser. Amalric trank gierig. Dann begann er mit der Hilfe des Jungen, sich der blutigen Kettenteile zu entledigen. Langsam wurde ihm wohler, er dehnte und reckte sich und stapfte steifbeinig zu einem nahen Teich. Dort fasste er sein dunkles Haar zusammen und band es im Nacken auf, wusch sich das Gesicht und fühlte die Bartstoppeln. Zweifelnd neigte er sich über das Wasser. Seine Haut war braun gebrannt von der Sonne, das Gesicht hager, die dunklen Augen darin brannten.
Da legte sich ein Arm um seine Schulter; er wurde zurückgerissen und heftig umarmt.
»Amiel!«, rief Amalric. »Amiel, du bist hier!« Er erwiderte die ungestüme Umarmung mit Inbrunst.
»Noch, mein Freund, noch singt der Vogel.«
Amalric hielt den Gefährten auf Armeslänge von sich weg. Auch Amiels Gesicht wies Spuren des Kampfes auf, eine Augenbraue war aufgeplatzt und das strohfarben gebleichte blonde Haar mit dunklem Blut verklebt. Aber Amiels honigbraune Augen leuchteten wie eh und je. »Wir leben, ja.« Noch einmal zog Amalric ihn an sich, dann klopften sie einander auf die Schultern und gingen eng umschlungen zu den Feuerstellen, die von den Knechten errichtet wurden. »Und wir haben gewonnen!«
Amiel und Amalric kannten sich seit Kindertagen; sie hatten die Gassen unter der Burg von Lavaur unsicher gemacht und von großen Taten geträumt. Aber während Amalric immerhin die illegitime Vaterschaft eines Kleinadligen für sich beanspruchen konnte, hatte Amiel nichts vorzuweisen gehabt als den Mist zwischen seinen Zehen und seinen beweglichen Geist. Schon als Kind war er geschickt gewesen im Klettern und Ballspielen, im Herumturnen und Tanzen. Dazu hatte er eine schöne Stimme, die immer wieder bei Festen und Feiern erklang. Eines Tages dann war er verschwunden, ohne jede Vorwarnung, war einfach mitgelaufen mit einer Horde Gaukler. Als er wiederkam, beherrschte er Flicflac und Jonglieren, Feuerspucken sowie die Kunst, auf dem Seil zu tanzen und die Mädchen zu verführen. Und er sang noch immer so, dass alle sich nach ihm umdrehten.
Es geschah wie von selbst, dass er Amalrics Kompositionen vorzutragen begann. Wenig später wurden sie ein Paar, der Troubadour und sein Joglar, Dichter und Sänger, Grübler und Charmeur, Glut und Funkenflug, und zogen bald die Blicke der Damen am Hofe auf sich.
Gemeinsam suchten sie auf der Leier nach Tönen zu ihrer Kunst, gemeinsam schäkerten sie auf den Festen, und Arm in Arm zogen sie manches Mal danach trunken über die Höfe nach Hause, auf der Suche nach einem gnädigen Heuschober, der ihnen ein Lager bot für die Nacht.
»Mein Freund, wird dieser Sieg dich zu einem Lied anregen?«, fragte Amiel; er überlegte, dann leuchteten seine Augen. »Zu einer Estampida vielleicht?« Er trat zurück, hob die Hände über den Kopf, um zu klatschen, und stampfte mit den Füßen den Rhythmus des Liedes. »Eine Estampida, die erzählt, wie wir den Kreuzrittern beibrachten, höchst anmutig mit uns zu tanzen?«
Gelächter stieg auf von den Gruppen am Feuer. »Ja, Amiel, zeig’s ihnen.« Dann wandten sie sich dem Sänger zu. »Amalric, lass dich nicht lange bitten!« – »Komm schon, Amalric!« – »Eine Estampida, eine Estampida!« Ihr Händeklatschen wurde immer rhythmischer und legte den Takt unter Amiels gewagte Schrittfolgen und Sprünge. »Es-tam-pi-da! Es-tam-pi-da!«
Endlich konnte Amalric sich nicht mehr zieren. Er griff zu seiner Quinterne und dem Gänsekielplektrum. Als es beim ersten, noch ziemlich schiefen Ton mucksmäuschenstill wurde, grinste er. Zunächst gab er eine Strophe aus dem Stegreif zum Besten, in der er Amiel vorwarf, mit den Angebereien über seine Heldentaten nicht einmal durch die Tür des Gemachs seiner Angebeteten zu gelangen, geschweige denn in ihr Bett:
»Er zielte auf ihren Schoß und sank zu ihren Füßen.
Über ihn hinweg schritt sie. Blieb nur, die staubige Schwelle zu küssen.«
Das Gelächter war groß. Erwartungsvoll, mit vom Feuer und vor Erregung geröteten Gesichtern, wandten alle sich Amiel zu. Würde er dagegenhalten?
Der Joglar verneigte sich und schwenkte ironisch seine Mütze.
»Ein großer Kämpfer bist du zweifellos, mit Holz und Erz und Eisen.
Allein im Kampf mit Weiberarmen kannst du dich nicht als Held erweisen.
Ist der Feind nicht gut umzingelt,
reckt der Speer sich wohl vergebens,
ist das Scharmützel nicht gar kunstvoll –
Pech gehabt im Kampf des Lebens.
Feld und Bett sind beide weich,
doch es liegt sich drin nicht gleich.«
Die Männer lachten, klatschten und fielen in den Refrain ein, den sie bald auswendig konnten. Manchmal sprang einer auf, um einen eigenen Einfall in den Wechselgesang mit einzuflechten. Allmählich löste sich die blutige Erregung des Kampfes.
Da unterbrach der Ton ein Horns ihre Feier.
»Reiter von Osten!«, rief ein Wächter in die Stille. Sofort hob Foix den Arm, und alle verstummten. Am Waldrand tauchten Reiter auf.
»Seneschall«, rief der Vizegraf erfreut, als er die Farben des Neuankömmlings erkannte. Es war einer der Ihren. Die Ritter scharten sich um ihren Herrn, damit er den hohen Besuch würdig empfangen konnte. Foix vollführte eine spöttische Verbeugung, die vom Seneschall mit nachdrücklicher Hochachtung erwidert wurde.
»Ich beglückwünsche Euch, Vizegraf, zu Eurem Sieg«, erklärte er mit der klaren Stimme des geschulten Boten. »Und damit Euch künftig viele weitere Siege gelingen mögen, schickt mein Herr für Euch die Waffen, die Ihr verlangtet.« Er wies in Richtung des Waldes. »Die Karren stehen dort versteckt. Ihr mögt sie übernehmen.«
»Ich danke Euch und Eurem Herrn, dem edlen Grafen von Toulouse. Zwar kommt Ihr nach dem Kampf, aber immerhin, Ihr kommt.« Spott schwang mit in der Stimme des Vizegrafen. In seinem Gesicht war kein Lächeln, das die Schärfe seiner Worte gemindert hätte. Und er wies seine Ritter nicht zurecht, die so nahe an den Seneschall und seine Knechte herantraten, dass diese es gut für eine Drohung hätten halten können.
Der Name Toulouse wurde auf dem Gebiet der Foix nicht gern gehört in diesen Tagen. Als der Papst zum Kreuzzug gegen die Katharer aufgerufen hatte, ging es zunächst gegen die Herrschaftsgebiete der Grafen von Toulouse, der Vizegrafen von Foix und der Vizegrafschaft der Trencavel von Carcassonne. Damals war der Graf von Toulouse der erste Fürst gewesen, der von den heranrückenden Heeren bedroht worden war. Und er hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als den geforderten Eid zu leisten, dass er kein Ketzer sei, und sich auf die Seite der Angreifer zu schlagen. Durch diese Lüge verschonte er das eigene Land. Die Foix allerdings, die der Angriff an seiner statt traf, verübelten ihm diesen Schachzug, und selbst die heimliche Hilfe, die er ihnen zukommen ließ, behielt einen bitteren Beigeschmack.
»Er weiß, er wird die Hunde nicht ewig von seinem Hof fernhalten, nicht wahr?«, fragte der Vizegraf den Seneschall. »Bislang besorgen wir die Drecksarbeit für ihn, und wir danken schön, dass er uns die Schwerter dazu reicht. Aber früher oder später wird es ihn selbst treffen. Und dann muss er Farbe bekennen.«
Der Seneschall schüttelte den Kopf, dass die Bänder an seinem Hut wippten. »Der Papst hat vierzig Tage Teilnahme am Kreuzzug als ausreichend bestimmt, damit ein Mann in den Genuss des Sündenablasses kommt. Seit die Frist um ist, laufen den Kreuzfahrern die Truppen davon. Und der König hat seinen Strauß mit England zu fechten. Ihm ist an einem langen Krieg mit uns nicht gelegen. Der Spuk wird bald vorbei sein.«
Amiel stieß Amalric in die Seite. »Hörst du das?«, flüsterte er begeistert, »es wird bald vorbei sein.«
Amalric ballte die Faust. »Ja«, stieß er hervor, verstummte dann aber rasch unter dem tadelnden Seitenblick seines Herrn.
»Bislang stürmen sie jedenfalls gegen die Mauern meiner Burgen an«, gab der Vizegraf zurück. »Und wie es aussieht, sind sie auch um Nachschub nicht verlegen.« Er wies mit der Schwertspitze auf die noch nicht begrabenen Leichen. »Nun ja, man wird sehen. Diese jedenfalls werden der Dame de Laurac keinen Kummer mehr bereiten.«
Als Amalric sah, dass der Seneschall die Augenbrauen hochzog, konnte er nicht an sich halten: »Jawohl, die Herrin Gerauda, Aimery von Montréals Schwester, leitet selbst die Verteidigung der Feste Lavaur. Mit der Kraft einer Amazone und der Anmut eines Engels.«
Foix lachte über seinen Eifer. »Ihr seht hier«, sagte er und nötigte Amalric mit einer Geste zu einer Verneigung, die jener errötend vollführte, »den ersten Ritter und Minnesänger Geraudas de Laurac, der, obwohl er als Kämpfer in meinen Dienst getreten ist, es an Lob für sie niemals fehlen lässt. Ich danke Euch, Herr Amalric. Und so wie er es sagt, ist es auch, Seneschall: Nicht alle Frauen unserer edlen Familien dienen dem Herrn. Manche dienen auch unserem Land und unserem Namen.«
»Er möge hell leuchten«, sagte der Seneschall kleinlaut und neigte das Haupt. »In der Tat dachte ich eben an Eure Schwester, Esclarmonde, jene nahezu heilige Frau, die auch mein Herr so innig verehrt. Ich hoffe, sie befindet sich wohl?«
Der Vizegraf runzelte die Stirn. »Heilige, Seneschall, werden in diesen Tagen verbrannt. Was einst unser größter Stolz war, ist inzwischen unsere größte Sorge.« Er wollte weitersprechen, presste dann aber den Mund zu einem dünnen Strich zusammen. Schließlich rang er sich ein Lächeln ab. »Aber nun lasst uns sehen, was Ihr mitgebracht habt. Hilfe ist willkommen in dieser Zeit. Und auch die Gastfreundschaft soll nicht darunter leiden.«
Am anderen Morgen erwachte Amalric mit einem Kater. Metallischer Blutgeruch stieg von dem Schlachtfeld auf, neben dem sie lagerten, und die Fliegen waren unerträglich. Amalrics Kopf schmerzte vom Wein, den Toulouse neben Schwertern und Armbrustbolzen an sie hatte schicken lassen. Und seine Kehle schmerzte noch immer vom Gesang. Er räusperte sich mehrfach, spuckte aus und tastete nach dem Wasserschlauch. Gierig trank er, dann wanderte sein Blick über die schlafenden Gefährten. Später, wenn sie erwachten, würde der Rausch vorbei sein. Sie würden zur Festung zurückkehren und das Joch des täglichen Kampfes wieder auf sich nehmen, um die Übermacht der Belagerer von ihren Mauern fernzuhalten. Eingesperrt zwischen diesen Mauern würden sie kämpfen und töten und essen, scheißen und schlafen und wieder töten, jeden Tag aufs Neue.
Sein Blick wurde müde, wenn er daran dachte. Und in seinem Kopf reifte ein Entschluss. Er musste Navenias noch einmal sehen. Mit der Erinnerung an ein Wort, an eine Berührung von ihr würde alles leichter werden. Nur so könnte er ertragen, was auf ihn zukam. Ohne seinen Knappen zu wecken, machte Amalric sich daran, sein Pferd zu satteln.
»Du hast gehört, dass sie zurück ist, nicht wahr?«, fragte Amiel, der offenbar bemerkt hatte, dass sein Gefährte wach geworden war, unvermittelt und stützte den Kopf in die Hand.
Amalric zurrte den Sattelgurt energisch fest und schwieg.
Amiel versuchte es in einem leichteren Ton: »Freund, die Liebe sollte nie so heiß brennen, dass sie einem den Schlaf versengt.« Er gähnte ausgiebig und rekelte sich.
Amalric schwieg noch immer.
»Du willst tatsächlich zu ihr?« Amiel, endgültig wach nun, stand auf. Ratlos blinzelnd stellte er sich neben seinen Freund und schaute zu, wie Amalric sich reisefertig machte.
Er erntete bloß ein Nicken.
»Du weißt, dass das sinnlos ist?«, fragte er und hielt die Zügel von Amalrics Pferd. »Dass es sinnlos war von Anfang an?«
Amalric blickte ihn nicht an. Mit zusammengebissenen Zähnen machte er sich am Halfter zu schaffen.
Amiel schüttelte den Kopf. Er schien noch etwas sagen zu wollen, trat dann aber zurück und gab die Zügel frei. Das Pferd, von seinem Reiter herrisch angetrieben, preschte los. Amiel wedelte sich mit der Hand den aufgewirbelten Staub aus dem Gesicht. »Du Narr!«, schrie er dem Freund hinterher. »Was nützt es, eine Frau zu lieben, die deine Liebkosungen nicht zu schätzen weiß?«
Er erwartete keine Antwort. Noch einmal blickte er in die Richtung, in die Amalric so rasch verschwand. Warum nur nahm sein Freund Dinge, die man leichtnehmen sollte, so überaus ernst? Er würde sie bloß alle unglücklich machen damit. Das und nichts anderes würde am Ende herauskommen. Amiel schüttelte den Kopf und versuchte, sich eins zu pfeifen. Aber sein Gesicht nahm einen schuldbewussten Ausdruck an. »Verdammt, ich hätte es ihm sagen sollen.«
2.DAS STÄDTCHEN LAVAUR, EINE STUNDESPÄTER
Amalric band die Zügel an einen Ast des Olivenbaums, der den stillen Platz von Lavaur beherrschte. Der Lärm des Krieges und der Belagerung war noch nicht in das Herz des Ortes vorgedrungen. Hier war es still, nur das Laub rauschte sacht. Aus einem offenen Fenster drang das Klirren von Steingut, Frauenstimmen lachten leise. In den Ställen rumorte schläfrig das Vieh.
Die grauen Steinfassaden der Häuser ringsum wurden von der Sonne gewärmt. Dieselben alten Männer wie stets hockten auf der Bank und taten durch ein leichtes Nicken kund, dass sie Amalric noch immer erkannten, den Knaben von einst und den Mann, zu dem er geworden war.
Eine Katze räkelte sich im Staub und streckte die Krallen nach einer unreif herabgefallenen Olive. Ihre Augen waren von demselben klaren Grün wie die Frucht. Sie verfolgte Amalric mit ihrem Raubtierblick, als er zum Haus der Katharerinnen hinüberging. Wie lange war er nicht mehr hier gewesen?
Das Haus beherbergte eine Gemeinschaft, kein Kloster, auch wenn nur Frauen darin lebten und auch wenn sie sich der Keuschheit und dem Gebet verschrieben hatten und gute Werke taten im Namen des Herrn. Blanca de Laurac, die Mutter der Burgherrin Gerauda, führte sie an, wie eine Priorin es täte. Aber diese Frauen gingen ein und aus nach Belieben, keine Regel verschloss ihnen die Türen oder verbot ihnen Besuche, wie es in einem gewöhnlichen Kloster der Fall war. Sie verkauften ihrer Hände Arbeit auf dem Markt nach eigenem Gutdünken, wirtschafteten selbstständig und waren niemandem Rechenschaft schuldig. Kein Abt, kein Bischof mischte sich in ihre Angelegenheiten oder gab ihnen gar Weisungen, wenn sie dies nicht ausdrücklich wünschten. Die Geistlichen, die bisweilen zu ihnen kamen, Vorträge hielten und mit ihnen diskutierten, waren ihre Gäste – Ebenbürtige, keine Vorgesetzten.
»Ein Kloster«, pflegte Navenias zu sagen, »ist ein Gefängnis, in das Männer Frauen im Namen ihres Gottes einsperren. Wir dagegen sind eine freie Gemeinschaft. Blanca lehrt uns, dass wir nur Gott und uns selbst gehören. Wir arbeiten, wir lernen, wir denken, wir sprechen frei. Frei!«
Amalric hatte das Gefühl, als hörte er ihre Stimme erklingen, und noch einmal sah er ihre Gestalt in dem dunklen Gewand, wie sie sich froh und selbstvergessen drehte, den Kopf in den Nacken gelegt und die Hände zum Himmel erhoben, die Zöpfe fliegend.
Da lief ein kleines Mädchen lachend über den Platz, ein Junge von vielleicht acht Jahren kam hinter ihr her und rief: »Ich krieg dich.« Kreischend vor Vergnügen raffte sie ihr Kleid und rannte weiter. Amalric sah ihnen versonnen nach, bis sie im Schatten einer Gasse verschwunden waren. Mit einem Mal begrüßte ihn eine dunkle Stimme, und er zuckte zusammen.
»Oh, Dame de Laurac.« Er beeilte sich, eine Verbeugung anzudeuten. Und eine Dame war sie noch immer, diese Blanca de Laurac, trotz des schlichten schwarzen Gewandes und des Korbs auf ihrer Hüfte, in dem sich die gefaltete Leinwand stapelte, die sie mit ihren Gefährtinnen gewoben hatte, um sie auf den Markt zu bringen. Sie trug weder Schmuck noch edles Tuch. Aber ihr silbernes Haar, zu einem Knoten im Nacken geschlungen, leuchtete in der Sonne, und ihre Haltung war königlich. Am beeindruckendsten aber waren noch immer die klugen dunklen Augen und der Ausdruck milder, lächelnder Stärke in ihrem Gesicht. Als Amalric noch ein Junge gewesen war, pflegte sie sich über ihn zu beugen, um seine Schrammen und Prellungen zu begutachten, wenn er es in den Gassen wieder einmal zu wild getrieben hatte. Und egal, wie sie geschmerzt hatten, die äußeren Wunden ebenso wie diejenigen, die sein empfindlicher Stolz erlitten hatte, egal, wie aufgewühlt er gewesen war, wie wütend oder erregt, in ihrer Gegenwart war stets Ruhe über ihn gekommen und das Gefühl, dass auf irgendeine Weise alles gut würde.
»Amalric, mein Lieber.« Sie lächelte freundlich wie immer, heute jedoch lag etwas in ihren Zügen, das ihm das Herz abdrückte, ein verhaltenes Wissen, ein Mitgefühl, das die schlimmsten Befürchtungen in ihm weckte. So, als wäre ihm etwas Furchtbares zugestoßen und er wüsste es nur noch nicht. Amalric hatte das schon auf dem Schlachtfeld gesehen: Männer, die aufrecht dastanden, sogar redeten, lachten – bis sie die Klinge bemerkten, die tief in ihrem Leib steckte, und dann mit ungläubigem Gesicht langsam vornübersanken. Unwillkürlich schaute er an sich hinab. Er öffnete den Mund, um etwas zu fragen, doch er wusste nicht, wie er die Worte wählen sollte.
Blanca de Laurac kam ihm zuvor. »Wie schön, dass du zu Navenias’ Ehrentag kommst«, sagte sie. »Wir hatten nicht mehr damit gerechnet.«
Die Worte sackten in Amalrics Geist wie Steine in schlammiges Wasser. Ehrentag! Das konnte nur eines bedeuten: Sie erhielt das Consolamentum. Und das wiederum wäre das Ende all seiner Hoffnungen. Seine Hände, die während der Schlacht nicht einmal gezittert hatten, bebten mit einem Mal so sehr, dass er sie voller Scham verbarg. Das unwirkliche Gefühl breitete sich wieder in ihm aus, und mit einem Mal schien alles, der Platz, die Häuser, das silbergrüne Flirren des Baumes über ihren Köpfen, sich mit rasender Geschwindigkeit von ihm zu entfernen. »Ehrentag?«, hörte er sich fragen.
Blanca nickte. »Ja, es ist so weit. Heute wird sie eine von uns.«
»Was? Aber …« Um Amalric drehte sich alles. Eine von ihnen, Navenias wurde eine von ihnen, eine Geweihte, eine Perfecta! Wenn das stimmte, dann war sie nun eine lebende Heilige, kein Weib mehr, das je im Leben ein Mann berühren durfte! Nein!, dachte er. Nein, das durfte nicht sein. Wozu dann alles, wozu …?
Seine Gedanken verwirrten sich. Er suchte Blanca de Lauracs Blick. Die Priorin lächelte noch immer ihr ruhiges, starkes, unerschütterliches Lächeln. Sogar jetzt noch hatte es die Kraft, Amalric zu besänftigen.
Navenias wurde eine Perfecta! Immer schon hatte sie davon gesprochen. Aber er hatte nicht geglaubt, dass sie den Schritt jemals wirklich tun würde. Er hatte geglaubt, dass es nicht mehr war als eine romantische Mädchenschwärmerei. Hatte sie ihn nicht geküsst, damals, und damit die Hoffnung neu in ihm entfacht?
Die Finger wollten ihm nicht gehorchen, als er sie zur Faust ballte; sie waren mit einem Mal ganz kraftlos. Er hätte kein Schwert mehr zu halten vermocht. Da war er gekommen, ihr seinen Sieg zu Füßen zu legen, den Beweis, dass er bereit war, sein Leben für sie zu geben. Und dabei hatte er bereits verloren! Amalric hörte ein Schreien: »Ihr habt mir versprochen, dass sie sicher sein würde!« War er das gewesen? »Ihr habt es versprochen. Aber die Perfekten werden gejagt wie Aussätzige! Nennt Ihr das sicher sein?«
»Nennst du das Liebe?«, fragte Blanca nur zurück.
Amalric senkte den Kopf. Noch immer konnte sie in seiner Seele lesen. Wie er sie in diesem Moment dafür hasste. Liebe ist nicht Liebe, die nimmt und verlangt. Er wusste es, ohne dass sie es aussprach. Wie oft hatte er die Worte gehört! Aber wohin, dachte er, wohin mit meinem Verlangen? Zorn loderte in ihm auf. Er packte die Zügel.
»Sie hat es sich so sehr gewünscht.« Blanca versuchte, ihm die Hand auf den Arm zu legen. »Amalric, wohin willst du?«
Amalric wusste, wo er sie finden würde. Er kannte sie lange genug, besser als jeder andere Mensch auf der Welt.
Es war ein schöner Platz, ein Platz, wie Liebende ihn ausgesucht hätten, wie auch sie ihn einst ausgesucht hatten, zurückgezogen und still. Das kleine Tal lag einsam. Die Kuppen der felsigen Hügel ringsum leuchteten weiß im Sonnenglast, die Macchia duftete, und ein sanfter Wind raschelte in den Wipfeln der Steineichen. Zwischen gezackten Vorsprüngen hatte sich eine natürliche Terrasse gebildet, ein Steinblock lag dort wie ein Tisch, beschützt und beschattet von den ausladenden Zweigen einer Pinie. Die Glöckchen einer nahen Ziegenherde bimmelten durch die Mittagshitze.
»Die Natur«, hatte Navenias ihm erklärt, als er einmal über die Neigung ihrer Glaubensbrüder gespottet hatte, sich unter freiem Himmel zu versammeln, »ist die schönste Kirche überhaupt. Gott selbst hat sie erbaut. Wo sonst auf der Welt könnte man ihm näher sein?«
Verbittert betrachtete Amalric die kleine Versammlung dort drüben im schattigen Grün. Trotz all der Schönheit, die ihn umgab, hatte er sich seinem Schöpfer nie ferner gefühlt als in diesem Augenblick, da Navenias ihn verließ, so endgültig, als wäre sie gestorben. Und sie tat es aus freien Stücken, so leicht und so anmutig, dass ihm schien, sie wollte ihn mit jeder Geste verhöhnen.
Da stand sie, schlanker noch, als er sie in Erinnerung hatte, zerbrechlich fast nach der langen Fastenzeit. Amalric war sicher, dass er dunkle Ringe unter ihren schwarzen Augen sehen würde, wenn er ihr schmales Gesicht in seine Hände nehmen und mit den Fingern über ihre Wangenknochen streichen dürfte, die sich so deutlich unter ihrer olivfarbenen Haut abzeichneten. Ach, er kannte jeden Zug darin. Aber sie hatte sich abgewandt, jenen anderen zu, die sich jetzt so eng um sie scharten. Auch sie waren ihm nicht fremd, er kannte sie alle, kannte ihre Namen, ihre Familien, hatte seine Kindheit mit ihnen verbracht, sie geneckt, mit ihnen gefeiert. Aber er gehörte nicht zu ihnen.
Amalric ging nicht weiter, keinen Schritt. Nur ein kleiner Abstieg trennte ihn noch von Navenias, ein Geröllfeld und ein fast ausgetrockneter Bach, in dem sie zweifellos gemeinsam ihre Hände gereinigt hatten, ehe sie das Ritual begannen. Hernach waren sie zu dem Vorsprung aufgestiegen über flache Steine, bedeckt mit Piniennadeln, und über gewölbte Wurzelschlingen – er konnte die Tritte sehen, den Weg, den die kleine Prozession vor ihm genommen haben musste, eine natürliche Treppe, eine Einladung für diejenigen, die dazugehörten. Aber für ihn führte sie nirgendwohin.
Schwer ließ er sich gegen einen Felsen sinken, auf dem zitternd ein rosafarbenes Kraut blühte. Zwischen den Blättern hindurch sah er Navenias, wie sie sich hinkniete, eine ferne Miniatur. Sie senkte den Kopf unter dem Schleier, der über sie gelegt wurde. Für immer würde er nun zwischen ihr und der Welt stehen. Nur durch dieses Stück Stoff hindurch durfte ein Mann, und sei er ein Heiliger, sie ab heute noch berühren.
Amalric glaubte ihre Stimme zu hören über dem Rauschen der Wipfel, dem Läuten der Herdenglocken und dem Chor ihrer Gemeinde. Er konnte die Worte nicht verstehen, doch er wusste genau, was sie in diesem Augenblick sagte, so klar und so deutlich, als flüstere sie es ihm ins Ohr. Sie hatten die Szene als Kinder oft genug gespielt.
»Du bist der Bischof«, hatte Navenias damals verkündet, so klar und entschlossen, wie sie stets war, »und ich bin die Gläubige, die um deinen Segen bittet.«
Also hatte er sich aufgestellt, die Arme ausgebreitet, wie er es beim Pfarrer in der Sonntagspredigt manchmal sah, und hatte sich bemüht, würdevoll dreinzuschauen und irgendwie erleuchtet, während Navenias als Gemeinde, Anwärterin und Zuschauerin ihrer selbst zugleich lebhaft agiert hatte. »Segnet uns und erbarmet Euch unser«, hatte sie inbrünstig gefleht und ihn jedes Mal streng angesehen, wenn er nicht sofort begriff, was er zu tun hatte. »Nun segne schon«, hatte sie ihn angezischt, woraufhin er hastig mit den Händen herumgefuhrwerkt hatte. Navenias schien zufrieden. »Nach dem dritten Mal bin ich dran«, hatte sie sehr bestimmt erklärt und sich mit ernster Miene hingekniet, um zu singsangen: »Bittet Gott für mich Sünder, dass er mich zu einem guten Christen mache und zu einem guten Ende führe und vor einem schlechten Tod bewahre.«
Bei dem Wort vom schlechten Tod war Amalric immer ein wohliger Schauer über den Rücken gelaufen, und auch auf Navenias’ dünnen braunen Armen hatte sich der sonnengebleichte Flaum aufgestellt.
Ein schlechter Tod, das hatte Größe und Ahnung, das war wie ein Raunen von fernen, abenteuerlichen Dingen, von denen er nicht sicher wusste, ob er hoffen sollte, dass sie ihm eines Tages widerfuhren, oder ob man ihnen lieber, unter dem Schutz der heimatlichen Bettdecke, glücklich entging. Jedes Mal hatte er sich hin- und hergerissen gefühlt und sich dabei in köstlichen Fantasien verloren.
Ein schlechter Tod – wie sollte er nun jemals einen guten Tod finden, da er Navenias verlor? Der Gedanke schmerzte Amalric so sehr, dass er stöhnte.
Durch einen Tränenschleier hindurch beobachtete er, wie der Älteste Navenias das Evangelium zum Kuss hinhielt und es ihr dann auf den Kopf legte, um symbolisch den Heiligen Geist zu übertragen. Dann wurde ihm eine kleine Schale gereicht; Amalric wusste, dass er Navenias nun taufen würde. Es kam Bewegung in die Gruppe, als sie aufstand. Sie tauschten den Friedenskuss, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Untereinander berührten sich die Geschlechter nur sacht am Ellenbogen, reihum, bis alle eingeweiht waren.
Über Navenias’ stolzes Haupt, über ihre wie Rabenflügel so schwarz glänzenden Haare, war noch immer der dünne Schleier gebreitet, der ihr bis auf die Schultern fiel und nun sacht im Wind wehte. Wer den Friedensgruß mit ihr tauschen wollte, berührte sie dort durch das Gewebe hindurch. Durchscheinend und beweglich, dachte Amalric, und doch ein Gefängnis. Und doch ein Gefängnis! Er hieb mit der Faust auf den Fels. Aber nicht einmal der Schmerz konnte ihn beruhigen.
Dort stand die Frau, deren Hüften er mit seinen Armen umschlungen und deren Lippen er auf den seinen gespürt hatte. Die Frau, deren Geruch ihm vertraut war wie der eigene und deren Mienenspiel in all seinen Schattierungen er so gut kannte. Deren innerste Wünsche, Träume und Hoffnungen ihm kein Geheimnis waren und die treu die seinen hätte hüten sollen. Jetzt stand sie dort drüben. Und mit jedem Wort, das sie sprach, trennte sie sich unwiderruflich von ihm.
»Ich verspreche, mich Gott und seinem Evangelium zu weihen, nie zu lügen, nie zu schwören, nie einen Mann zu berühren, kein Tier zu töten, kein Fleisch zu essen und nur von Früchten zu leben. Ich verspreche weiterhin, nie ohne einen Mitbruder zu reisen, zu wohnen oder zu essen und, falls ich in die Hände unserer Feinde falle, nie meinen Glauben zu verraten, welches auch der mir angedrohte Tod sei.«
Amalric stieß einen Schrei aus, er konnte nicht anders.
Die Köpfe der Katharergemeinde fuhren herum.
»Und jetzt bist du glücklich, ja?«, schrie er. »Jetzt bist du endlich zufrieden, Herrgott verflucht noch mal. Und ich hasse dich dafür, jawohl, ich hasse dich! Ich hasse dich!«
Der Chor, der bereits eingesetzt hatte, vertröpfelte und verstummte.
Ja, ich hasse sie, bestätigte er sich selbst, ich habe sie immer gehasst im Grunde, von Anfang an, schon das hässliche, dürre, vorlaute Ding von sechs Jahren, das sogar den Straßenbengeln eine Plage gewesen war.
Die Lüge war so groß nicht. Er hatte es tatsächlich schon immer gewusst, vom ersten Moment an, als sie ihm in den Gassen seiner Heimatstadt begegnet war: dass sie sein Leben war und dass sie ihn würde retten oder zerstören können. Nicht ein einziges Mal hatte er ihr von einem Baum heruntergeholfen oder sie mit Steinwürfen gegen eine andere Bande verteidigt, hatte er mit ihr gestritten und sich wieder mit ihr versöhnt, ohne zu spüren, dass dies der tiefe Zweck seines Lebens war. Es war niemals nur ein Spiel gewesen.
Amalric hatte sie gerufen, und sie kam. Da stand sie vor ihm, mit ihrem Schleier, den er ihr am liebsten vom Kopf gezerrt und in Fetzen gerissen hätte vor Wut und Verzweiflung und den zu berühren er doch nicht wagte. Sie hat wirklich Augenringe, dachte er. Und sie war so dünn geworden, dass er ihre Taille mit einem Arm hätte umfassen können. Warum nur strahlten ihre Augen so, wenn sie ihn anschaute?
Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, da bemerkte er hinter ihr am Himmel die schwarze Wolke. Wie ein düsterer Heiligenschein legte sie sich um Navenias, quoll über den Horizont, wurde größer und größer, wie ein Turm, der in den Himmel wuchs.
Auch sie hatte den Rauch bemerkt. »Das ist …«, sagte sie statt einer Begrüßung. Furcht lag in ihrer Stimme.
»Ja«, erwiderte er.
»Die Burg!«
»Ja.«
Sie starrten einander an. Beide sprachen kein weiteres Wort. Sie wussten zu gut, was das bedeutete. Denn dort hinter den Bergen lag die Burg der Dame de Laurac. Sie war gefallen, ihrer beider Sache war verloren. Und nichts würde jemals wieder so werden, wie es war.
Ohne Navenias aus den Augen zu lassen, ging Amalric langsam rückwärts. Tastend setzte er einen Fuß hinter den anderen. Er musste sie verlassen, musste zu seinem Pferd, zu den Männern, die sich auf ihn verließen und auf ihn hofften. Und die vielleicht in diesem Moment schon starben. Amalric schämte sich mit einem Mal. Er hätte niemals hierherkommen dürfen. Der Sieg, den er Navenias hatte zu Füßen legen wollen, war nun noch weniger wert.
»Aber …«, begann sie. Die Sicherheit war aus ihrem Gesicht verschwunden.
Mit grimmiger Genugtuung las Amalric Furcht darin. Und vielleicht sogar ein leises Bedauern.
»Ich …«
Amalric legte den Finger auf die Lippen und schüttelte den Kopf. »Wir haben beide gewählt.« Er lächelte traurig. »Du hast gewählt.« Mit jedem Schritt entfernte er sich weiter von ihr. Schon musste er die Stimme heben. »Ich habe gewählt. Wünsch mir einen guten Tod.« Amalric drehte sich um und rannte. Er verstand nicht mehr, was sie ihm nachrief. Er wünschte sich nur, es würde noch eine Rolle spielen.
ZWEITER TEIL
DER SOMMERDER KINDHEIT
1.DAS DORF LAVAUR, IM JAHR 1203
Der zehnjährige Amalric hockte auf einem Mäuerchen am Rand der Gruppe von Jungen, die Steine in die Krone des großen Olivenbaums warfen. Eine magere graue Katze hatte sich in das Geäst geflüchtet und duckte sich fauchend vor den Geschossen der Angreifer. Die alten Männer auf ihrer Bank schüttelten nur den Kopf. Auch Amalric begnügte sich mit der Rolle des träge belustigten Beobachters. Eben noch hatte er den großen Peire verspottet, dessen dritter Wurf danebengegangen war. »He, Dicker, so wird das nie was!« Nebenbei summte er eine Melodie vor sich hin, die schon den ganzen Tag in seinem Kopf genistet hatte. Ihm schien, als könnte sie auf die Situation passen, aber ihm wollte einfach kein Reim auf Katze einfallen. Träge wippte er mit den Füßen. Da störte ein Ruf ihre Ruhe.
»Hört sofort auf damit, ihr gemeinen Mistkerle.«
Neugierig wandte Amalric sich um.
»Habt ihr Dreck in den Ohren? Ihr sollt aufhören!«
Auch seine Kameraden drehten sich um, stemmten die Hände in die Hüften und begannen zu pfeifen und anzügliche Bemerkungen zu machen. Amalric wusste, dass sie nur so großspurig taten und in Wahrheit sprachlos waren vor Staunen. Denn der kühne Ruf kam von einem kleinen Mädchen, das höchstens acht war.
Auch Amalric fand das erstaunlich. Dass so ein kleines dürres Ding es tatsächlich wagte, der ganzen Bande die Stirn zu bieten! Denn dünn war sie wahrhaftig, schmal wie eine Gerte, und ihr Zopf schwang ihr über den Rücken, so viel Mühe hatte sie, den schweren Eimer im Gleichgewicht zu halten, den sie mit beiden Händen heranschleppte. Sie wirkte wild entschlossen, aber kein bisschen ängstlich.
Sogar ich habe manchmal Angst vorm großen Peire, dachte Amalric, zumindest wenn er mit dem roten Arnold zusammen ist. Und Bertrand vom Metzger schlägt auch immer mit zu, wenn Peire es sagt. An ihrer Stelle hätte ich große Angst.
Er rutschte von der Mauer und wartete, was geschehen würde, schon halb entschlossen, ihr zu Hilfe zu kommen, wenn es nötig wäre.
»Ich habe gesagt, du sollst aufhören«, wiederholte sie, stellte den Eimer ab und stemmte die Hände in die Hüften.
»Gehört hab ich das schon«, erwiderte Peire herausfordernd langsam und wandte sich ihr zu, einen Stein in der Hand wiegend, als prüfe er, ob er auch zum Angriff auf kleine Mädchen tauge. Genüsslich spie er aus.
Sie ließ sich nicht einschüchtern. »Das Tier hat dir nichts getan. Es ist feige und grausam, es zu quälen.«
Amalric staunte über ihre direkte Art, vor allem schien es ihm mit einem Mal, als habe sie recht. Er warf einen Seitenblick auf das Kätzchen, das ängstlich auf seinem Ast hin und her balancierte und ihnen mit großen Augen zusah. Es hatte ihnen vertraut, hatte sich anlocken lassen und vor Schreck aufgeschrien, als sie plötzlich auf es losgegangen waren. Jetzt schämte Amalric sich dafür.
Peire aber ging auf das Mädchen zu. »Und wenn ich nicht …?«, fragte er. Statt einer Antwort traf ihn der Schwall aus dem Eimer mit voller Wucht.
»Dann dusche ich dich mit Pferdepisse«, sagte das Mädchen.
»Iiiiih!«, kreischten die Jungen und traten einen Schritt von Peire zurück, der prustete und spuckte und sich die Flüssigkeit aus dem Gesicht zu wischen suchte.
»Mit schön viel vergorenen Pferdeäpfeln.« Sie dämpfte ihre Stimme nicht, und sie lief auch nicht davon.
Amalric, der befürchtete, dass sein reizbarer Kumpan jeden Moment explodieren könnte, sprang zwischen Peire und dessen Opfer. Demonstrativ hielt er sich die Nase zu. »He, Peire, du stinkst!«, rief er und wedelte sich vor dem Gesicht herum. »Ich glaube, die Fliegen kommen schon.«
Einige lachten. Amalric feuerte sie an. »Fliegen-Peire«, skandierte er, »Pisse-Peire. He, ich glaube, dir stand vorhin der Mund offen. Hat’s geschmeckt?« Die Gruppe johlte und nahm den Spott mit Feuereifer auf.
Peire, rot im Gesicht und noch immer dabei, sich die tropfnassen Haare aus dem Gesicht zu streichen, warf Amalric einen feindseligen Blick zu. Aber er trat den Rückzug an. Angefeuert vom Singsang seiner vermeintlichen Freunde, stürmte er durch die Gasse davon.
Amalric trat auf das Mädchen zu und fragte: »Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis er bemerkt, dass es nur Wasser war?«
»Es wäre nicht recht, Menschen mit Unrat zu bewerfen«, gab sie zurück, »nicht einmal solche wie den da.« Einen Moment lang schaute sie ihn mit ihren schwarzen Augen an. Und Amalric hatte das Gefühl, als müsse sie das Herz in seiner Brust pochen sehen.
Dann trat sie an den Baum und lockte die Katze, die auf ihrem Ast hin und her strich und werbend maunzte. Endlich kam das Tier herunter und ließ sich von ihr kraulen. »Wie kann man einem so schönen Geschöpf nur wehtun wollen?«
»Ich heiße Amalric«, sagte er und streckte die Hand aus, um das Tier zu streicheln. »Und ich werde einmal ein Ritter.« Die Katze schnurrte.
»Ritter sind blöde«, verkündete das Mädchen. »Sie hantieren mit Waffen und jagen und töten.«
»Sie verteidigen die Schwachen«, widersprach Amalric. Seine Wangen wurden heiß vor Eifer. »Sie schützen das Recht. Sie kämpfen für die gute Sache.«
»Und gegen wen kämpfen sie?«, fragte das Mädchen. »Gegen andere Ritter, richtig? Also gibt es offenbar auch Ritter, die die Starken verteidigen, die das Unrecht schützen und die für die böse Sache zur Waffe greifen. Woher willst du wissen, dass du keiner von denen wirst? Wäre es nicht besser, man würde über Recht und Unrecht gar nicht erst mit der Waffe streiten?«
»Womit denn dann?«, fragte Amalric, verblüfft und gekränkt.
»Na, mit dem Wort natürlich«, antwortete sie und lachte ihn an. »Mit Argumenten und mit dem Verstand.«
»Das ist typisch Weiber«, ereiferte sich Amalric. »Nur weil ihr fix mit der Zunge seid.« Er war ehrlich empört, konnte sich aber nicht so aufregen, wie er es gern getan hätte. Denn wenn sie lachte, sah sie noch hübscher aus. Funken tanzten dann in ihren beinahe schwarzen Augen und machten sie noch lebendiger. Außerdem hatte sie so eine Art, auf dem Ende ihres Zopfes herumzukauen, die seinen Herzschlag beschleunigte, was immer sie dabei auch sagte. »Wie heißt du?«, fragte er.
»Navenias«, sagte sie. Sonst nichts. Navenias schien ihm der überwältigendste Klang zu sein, der jemals auf Gottes Erdboden vernommen worden war. »Navenias«, stotterte er.
Sie neigte den Kopf zur Seite. »Du scheinst nicht besonders schlau zu sein«, stellte sie fest.
Er schüttelte den Kopf. »Ritter müssen nicht schlau sein, sondern vor allem tapfer.«
Navenias zog die Brauen hoch. »Und bei wem wirst du Ritter?«, fragte sie.
Amalric blieb stumm. Da hatte sie seinen wunden Punkt berührt. Zwar war sein Vater von Adel und trug ein Wappen, aber er war nicht mit seiner Mutter verheiratet. Und es stand in den Sternen, ob er je gewillt sein würde, sich seines unehelichen Sohnes zu erinnern und ihm zu einem Knappenamt zu verhelfen. Und selbst dann würde er wohl sein Leben lang ein Knappe bleiben, die Waffen pflegen und die Pferde halten, ohne jemals weiter aufzusteigen. Er öffnete den Mund, fragte dann aber nur: »Und von woher stammst du?«
»Von da hinten.« Sie wies mit dem Kopf auf das Gebäude, das jeder in Lavaur kannte, das Haus der Katharerinnen. In der Gemeinschaft dort lebten viele Kinder, da nicht wenige der Frauen, die ihr beitraten, ihre minderjährigen Kinder, auch ihre Söhne, mitbrachten und sie bei sich behielten, bis sie für ihre weitere Erziehung in das Haus ihres Vaters oder eines Verwandten zurückkehrten. Manche wählten auch den Weg der Perfecti und blieben dort ihr Leben lang.
»Es ist das beste Zuhause der Welt«, fügte Navenias hinzu. »Ich lerne dort lesen und schreiben und alles über die Heiligen und über die Propheten.«
»Lebt deine Mutter dort?«, fragte Amalric, der nicht zugeben wollte, wie sehr ihn das beeindruckte. Das einzige Buch, das er bislang gesehen hatte, war die Bibel, aus der der Pfarrer sonntags in der Kirche las.
»Mehr so eine Art Tante«, erwiderte Navenias. Zum ersten Mal wurde ihr Blick ausweichend. Amalric wagte nicht, weiterzufragen. Er wusste, wie es war, wenn man sich seiner Herkunft nicht sicher sein konnte.
»Wollen wir etwas spielen?«, fragte Navenias unvermittelt.
Amalrics Herz schlug schneller. »Spielen wir Ritter«, schlug er vor. »Ich rette dich vor dem bösen Drachen, und dann stimmen wir einen Siegesgesang an.«
Navenias blickte zweifelnd drein. »Es gibt doch gar keine Drachen. Und was soll ich überhaupt dabei tun?«
Amalric erklärte ihr, dass in dem Ginstergestrüpp hinter dem Hof des alten Bernard wunderbare Drachen gebaut werden konnten aus abgebrochenen Ästen, Unkraut, Zweigen und Flusskieseln. Mit Feuereifer machten die beiden sich an die Arbeit. Bald waren sie ganz vertieft in ihr Tun. Binnen zwei Stunden hatten sie ein beachtliches Ungetüm gebaut. Amalric sang dabei zufrieden vor sich hin. »Dein Schuppenhaupt, dein Feuerstrahl, so Mal um Mal. Mhmmlalalal. Im tiefen Tal.«
»Was ist das für ein Lied?«, fragte Navenias. »Schon der Siegesgesang?«
Amalric errötete. »Nur so etwas, was ich mir ausgedacht habe. Es singt manchmal in meinem Kopf, weißt du. Und dann summe ich das vor mich hin, und manchmal finde ich auch Worte dafür. Nur so.« Verlegen arbeitete er weiter.
Zum Schluss pflückte Amalric einen Zweig Vogelbeeren und stopfte ihn dem Ungeheuer ins Maul. »Das ist die rote Flamme«, verkündete er, »mit der der Drache mich bedroht. Aber ich habe keine Angst, und ich zücke mein Schwert, und ich fordere ihn heraus und …«
»Und ich?«, fragte Navenias, noch ein wenig außer Atem vom Bauen, und wischte sich den Beerensaft von den Fingern.
Amalric überlegte kurz. »Du setzt dich am besten dort auf den Felsen, wo du gefangen bist, und wartest, bis ich dich befreie. Vielleicht ringst du auch ein wenig die Hände.«
Navenias gehorchte, hockte sich mit angezogenen Knien auf den Stein. Neugierig schaute sie eine Weile zu, wie Amalric mit viel »Ha« und »Ho« den hölzernen Drachen bekämpfte.
Navenias seufzte. Sie gab das Händeringen auf und betrachtete ihre Fingernägel. »Amalric?«
»Gleich«, keuchte er. »Der Drache ist schlau, aber ich bin ihm überlegen. Ich muss nur noch … da!«, rief er, hingerissen vom eigenen Spiel. »Und da, und da! Nimm das!«
Navenias seufzte wieder. Eine Weile beschäftigte sie sich mit einer Eidechse, einem smaragdfarben schillernden Tierchen, dessen Herz deutlich an seinem Hals klopfte und dessen dünner Schwanz lang über den Felsen herabhing. Geduldig und mit angehaltenem Atem versuchte sie, einen ausgerupften Grashalm so langsam an die Echse heranzubringen, dass die sich, obwohl ihr Kopf misstrauisch mitwanderte, davon berühren ließ. Am Ende ließ das Tier es sogar zu, dass der Halm ihm liebkosend über die Schuppenhaut strich. Wie schön sie war! »Dein Schuppenhaupt«, summte Navenias unwillkürlich und blickte auf. Amalric hieb noch immer mit rotem Kopf um sich und brachte das hölzerne Untier ins Wanken.
»Ksch«, machte Navenias sanft, damit die Eidechse dem herben Schicksal ihres großen Drachenbruders entging. Dann richtete sie sich auf, schaute sich um, fand einen Eichenknüttel, schwang ihn einmal durch die Luft und hieb dem Drachen mit einem Schlag den Kopf ab. In hohem Bogen flog er in den Bach.
Amalric schrie auf. »Nein! Was tust du?«
»Ich helfe dir«, erklärte Navenias und stieg von ihrem Felsen. »Und jetzt versorge ich deine Wunden.«
Betroffen schaute Amalric ihr entgegen. »Prinzessinnen helfen nicht. Sie rufen allenfalls um Hilfe. Das, das, das ist ihre … äh … Natur.«
»So ging es schneller«, meinte Navenias nur. »Halt still.« Sie nahm seinen Arm, der rot gesprenkelt war von Maulbeersaft. »Da wird ein Verband nötig sein.«
Amalric genoss die Berührung, aber er war noch nicht gänzlich versöhnt. »Es soll doch gar nicht schnell gehen. Und überhaupt darfst du keinem Lebewesen Schaden zufügen, dachte ich.« Er blickte sie triumphierend an.
In der Tat schien es sie einen Moment aus dem Gleichgewicht zu bringen. »Er war ja nicht echt«, erklärte sie dann. »Einen wirklich lebendigen Drachen hätte ich selbstverständlich nicht erschlagen.«
»Ach nein«, bemerkte Amalric ein wenig gallig. »Hättest du nicht? Wie hättest du ihn denn dann besiegt? Etwa mit klugen Reden?«
»Mit der Macht des Gebets natürlich.«
Amalric verschlug es die Sprache, so selbstgefällig sah sie aus. »Das will ich sehen, wenn es so weit ist«, meinte er. »Mit der Macht des Gebets, pah, da verlasse ich mich lieber auf mein Schwert.« Entschlossen packte er seinen Stock fester.
»Wir werden sehen«, sagte sie, aber es klang versöhnlich. Sie lächelte ihn an. »Wenn es so weit ist. Möchtest du jetzt etwas essen? Ich lade dich ein.«
Amalric hatte immer Hunger, wie alle Jungen seines Alters. Er nickte, wenn ihm auch ein wenig unbehaglich war bei dem Gedanken, das Katharerheim zu betreten. Es war ein wenig, wie in eine Kirche zu gehen. Und dort sollte er so etwas Profanes tun wie essen?
»Du, Navenias«, sagte er schüchtern, während sie sich auf den Weg machten. »Meinst du, du könntest mir dort eines von deinen Büchern zeigen?«
Zu Amalrics Erstaunen war sie so erfreut über den Vorschlag, dass sie ihn eifrig am Arm nahm und ihm so viel über Buchstaben und Grammatik vorschwatzte, dass ihm der Kopf schwirrte. Vielleicht lag das aber auch an ihrer Nähe und an dem sanften Duft von wildem Thymian und von Rosen, den ihre Haut verströmte. Noch nie war Amalric einem Mädchen begegnet, das so gut roch. Er war so betört, dass er kaum etwas wahrnahm vom Haus der Katharerinnen, als er es schließlich zum ersten Mal betrat.
Navenias schob ihn durch einen Seiteneingang in die um diese Zeit verwaiste Küche, wies ihm einen Hocker an und hantierte danach mit Kisten und Töpfen.