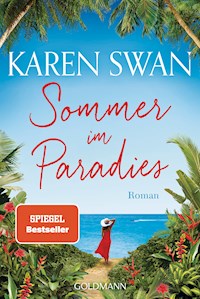9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine bezaubernde Geschichte über Liebe, Verlust und Neuanfang.« Marie Claire
Nur noch eine Woche, dann will Charlotte Fairfax ihren Verlobten Stephen heiraten. Doch zuvor soll sie im Auftrag einer Londoner Bank noch rasch nach Madrid fliegen und einen Erbschaftsstreit regeln: Der Multimillionär Carlos Mendoza liegt im Sterben und will sein gesamtes Vermögen einer fremden jungen Frau vermachen – zum Entsetzen seiner Familie. Die Angelegenheit erweist sich als deutlich komplizierter, als Charlotte angenommen hat. Schon bald stößt sie auf eine tragische Liebesgeschichte, die bis in die 1930er-Jahre zurückreicht. Und auch ihr eigenes Leben wird in diesem Sommer in Madrid gehörig auf den Kopf gestellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Nur noch eine Woche, dann will Charlotte Fairfax ihren Verlobten Stephen heiraten. Doch zuvor soll sie im Auftrag einer Londoner Bank noch rasch nach Madrid fliegen und einen Erbschaftsstreit regeln: Carlos Mendoza, einer der reichsten Männer Spaniens, liegt im Sterben. Zum Entsetzen seiner Familie will er sein gesamtes Vermögen einer fremden jungen Frau vermachen. In Madrid angekommen, muss Charlotte feststellen, dass der Fall komplizierter ist als gedacht: Die mysteriöse Fremde hat selbst keine Ahnung, wie sie zu dem Erbe kommt. Bei ihren Nachforschungen stößt Charlotte auf eine tragische Liebesgeschichte, die bis in die 1930er-Jahre zurückreicht. Und auch ihr eigenes Leben wird in diesem Sommer in Madrid gehörig auf den Kopf gestellt …
Weitere Informationen zu Karen Swan sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Karen Swan
Das Leuchten
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Spanish Promise« bei Pan Books, an imprint of Pan Macmillan, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2020 Copyright © der Originalausgabe 2019 by Karen Swan Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: Woman © Getty images; Background © Shutterstock/lunamarina, Shutterstock/arka38 Redaktion: Ann-Catherine Geuder LS · Herstellung: kw Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-25528-2V001 www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Trish – in Liebe und Dankbarkeit für die wunderschöne Aussicht beim Schreiben dieses Buchs!
Der echte Soldat kämpft aus Liebe für das, was er zurücklässt, und nicht aus Hass auf das, was vor ihm liegt.
G. K. Chesterton
Prolog
Madrid, März 1937
Sie standen dicht beisammen. Er hielt ihre Hände und starrte sie mit Augen an, die funkelten wie schwarze Sterne. Eine einzelne Kerze erhellte flackernd das Halbdunkel und tauchte ihre Gesichter in einen goldenen Schein. Mehr durften sie nicht riskieren, damit kein verräterischer Lichtschein nach außen drang.
»… erkläre ich euch kraft meines Amtes zu Mann und Frau.«
Sie wagte es kaum zu glauben. Ein seliges Lächeln huschte über ihr Gesicht. War sie nun wirklich und wahrhaftig seine Frau? Und er gehörte jetzt ihr, nur ihr allein? Er trat einen Schritt vor und nahm ihr Gesicht in beide Hände, blickte mit einem Ausdruck auf sie hinab, als sei sie ein Geschenk des Himmels. »Ich werde dich auf immer lieben und beschützen«, flüsterte er voller Inbrunst.
»Und ich dich.«
Da küsste er sie, und die Berührung seiner Lippen weckte etwas in ihr, als würde man eine Tür aufstoßen. Jetzt brauchte sie nie mehr Angst zu haben. Sie waren erst seit drei Tagen und vier Nächten wieder vereint, aber sie wusste jetzt schon, dass sie mit ihm an ihrer Seite mit allem fertig werden würde. Ihre Liebe war stärker als der Krieg. Wenn sie von jetzt an zum Himmel blickte, dann hielt sie nicht mehr nach Fliegerbomben Ausschau, sondern nur noch nach Vögeln oder Regenbögen oder nach Sternschnuppen, bei denen man sich etwas wünschen konnte.
Ein leises Quietschen ertönte, wie Metall auf Metall, wie die Bewegung eines Türriegels. Alle erstarrten.
»Was war das?« Der Kopf des Priesters fuhr herum.
Niemand antwortete, alle spitzten die Ohren. Und da war es: das leise, ganz leise Tappen sich entfernender Schritte. Beide Männer rückten schützend an die Frau heran. Sie musterten die hohen Buntglasfenster, auf der Suche nach aufflackerndem Licht, nach Seilen, die herabgelassen wurden, nach dem Schatten eines Flintenlaufs, den eiförmigen Umrissen einer Handgranate. Beide zogen ihre Waffen aus ihren Gürtelhalftern und ließen die Mündungen durch den Kirchenraum schweifen. In Zeiten wie diesen war jeder Mann ein Soldat – der Gemüsehändler, der Zimmermann, der Schlosser, der Geistliche.
Sie warteten, aber nichts regte sich. War die Gefahr tatsächlich vorbei? War es möglich, dass es nur ein spielendes Kind gewesen war?
Nein.
»Schnell, versteck dich.« Ihr frischgebackener Ehemann packte sie beim Handgelenk und zog sie so schnell, dass ihre Füße kaum den Boden berührten, hinter das wuchtige Chorgestühl, das an einer Seite den Altarraum dominierte. Die Zärtlichkeit von vorhin war verschwunden, als habe es sie nie gegeben, verdrängt von den Erfordernissen des Krieges. Sie kauerte sich hinter das Gestühl, und er huschte mit gezogener Waffe zum Altar zurück. Sie hätte ihn lieber bei sich behalten, doch sie vertraute ihm, sie wusste, wie geschickt er war, lautlos und geschmeidig wie eine Katze. Adrenalin rauschte durch ihre Adern, und ihr Atem kam hektisch. Sie schloss kurz die Augen, um sich wieder zu beruhigen, um ihre Angst vor dem, was drohen mochte, was möglicherweise um die Kirche herumschlich, zu verdrängen.
Da! Ihre Augen flogen auf. Sie hatte es ganz genau gehört, das leise Klicken, das verriet, dass irgendwo eine Waffe entsichert wird. Sie schaute sich panisch um. Und dann fiel ihr Blick auf den östlichen Seiteneingang. Die Tür hätte eigentlich verriegelt sein müssen, aber sie hatten den Riegel in ihrer Hast, einander zu heiraten, offenbar nicht ganz einrasten lassen, die Zunge ragte nur leicht in den Bolzen hinein.
Sie kam aus ihrer Deckung hervorgeschossen, flog auf den Flügeln der Angst zur Tür, die sich bereits einen Spalt weit öffnete …
»Nein!« Mit einem Aufschrei war sie dort, ihre Fingerspitzen berührten schon fast das rissige alte Holz, doch da flog die Tür auf und prallte gegen ihre Stirn. Sie wurde rückwärtsgeschleudert, ein Schuss pfiff über ihren Kopf hinweg. Aber sie sah noch sein Gesicht, ehe um sie herum alles schwarz wurde.
»Du!«
1. Kapitel
Canary Wharf, London, 9. Juli 2018
Gentlemen. Ms Fairfax. Wir haben ein Problem.«
Der Bankpräsident ging mit lautlosen Schritten über den dicken Teppich zu seinem Platz am Kopf der langen polierten Tischplatte aus schwerem Walnussholz. Er ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen, und Charlotte hatte das Gefühl, er müsse sich vorkommen wie in einer Art Spiegelkabinett: zwei identische Reihen dunkelblauer Maßanzüge, zwei identische Reihen sauberer männlicher Haarschnitte – kurz im Nacken und an den Seiten –, gespreizte Oberschenkel und kräftige Hände, säuberlich auf den Tisch gelegt. Sie allein fiel aus dem Rahmen: langes schwarzes, mit einer Chanel-Schleife im Nacken zusammengebundenes Haar, diskret manikürte Fingernägel, schmale Schultern, beigefarbenes Kleid.
»Carlos Mendoza.«
Sogar sie kannte den Namen. Man brauchte nicht zur Bank zu gehören, um zu wissen, dass es sich hier um den größten Fisch des diskreten Geldhauses handelte, das nur die Reichsten der Reichen zu seinen Kunden zählte. Die Familie gehörte zum spanischen Hochadel, mit mehreren Herzogtümern, und besaß in Andalusien weite Landstriche. Die Mendozas hatten den Grundstock für ihr Vermögen ursprünglich mit der Zucht von Kampfstieren für die Arena gelegt, doch hatte man die Geschäfte über die Jahre ausgeweitet, stark in den Obstanbau investiert und seit Neuestem auch in die Medizintechnik. Charlotte hatte erst vor Kurzem ein Profil der Familie in einer Wirtschaftszeitung gelesen, und soweit sie sich erinnern konnte, betrug ihr Nettovermögen um die 750 Millionen Pfund.
»Ich habe vorhin einen Anruf von seinem Sohn Mateo erhalten. Der alte Knabe hat leider Gottes nicht mehr lange zu leben: Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium.« Er schnalzte mitfühlend, aber Charlotte hörte noch etwas anderes heraus: dass sein Tod äußerst ungelegen kam.
Hugh Farrer ließ sich auf seinen Platz am Kopfende des Tisches sinken und blickte in die Runde. Mit vierundfünfzig Jahren war er der bisher jüngste Präsident der Bank – und der bei Weitem rücksichtsloseste. Die Profite waren in den letzten achtundzwanzig Monaten, seit er im Amt war, um ein Drittel gestiegen, aber das hatte seinen Preis: Einundzwanzig Prozent der Belegschaft waren entlassen worden, und während der Hauptsitz des Unternehmens in London ausgebaut worden war, hatte er zugleich vier der auf ganz Europa verteilten Zweigstellen schließen lassen.
»Die Ärzte geben ihm noch einen Monat, vielleicht auch sechs Wochen. Uns bleibt also nicht mehr viel Zeit.«
Uns? Charlotte bemerkte, wie sich Schultern strafften, Rücken aufrichteten. Sie dagegen neigte abwartend den Kopf zur Seite.
Farrer holte gereizt Luft. »Carlos hat am Freitagabend einen kleinen Herzinfarkt erlitten. Er wird derzeit im Krankenhaus behandelt und ist, soweit ich weiß, noch nicht wieder zu Bewusstsein gekommen. Die Ärzte sind vorsichtig optimistisch. Sie meinen, er würde sich aller Voraussicht nach wieder erholen. Mateo hat in der Zwischenzeit, wie in solchen Fällen üblich, Handlungsvollmacht. Doch bei der Durchsicht der Geschäfte seines Vaters stieß er unglücklicherweise auf den Entwurf eines Dokuments, in dem der alte Mann sein gesamtes Vermögen einer gewissen Marina Quincy überträgt.«
Farrer ließ das bei allen erst einmal einsickern. Sein scharfer Blick streifte jeden Einzelnen, wie ein Pianist, der seine Hände über die Tasten zieht. Marina Quincy. Marina Quincy. Dieser Name sagte keinem etwas. Es war kein berühmter Name, nicht wie Rockefeller, Rothschild, Spencer oder Goldsmith. Kein Name, den man automatisch kennen musste. Daher waren die Gründe für die Übertragung auch nicht unmittelbar klar.
»Selbst Mateo hat noch nie von ihr gehört. Ein vollständiger Bericht steht noch aus. Alles, was wir bisher wissen, ist, dass sie fünfundvierzig ist und als Kellnerin in einem Café in Madrid arbeitet«, erklärte Farrer.
Fünfundvierzig? Charlotte runzelte die Stirn. Carlos Mendoza war sehr alt, Ende neunzig, wenn sie sich recht erinnerte.
»Könnte sie eine uneheliche Tochter sein?«, schlug jemand vor.
Farrer schüttelte knapp den Kopf. »Mateo sagt, sein Vater habe mit Ende dreißig eine Vasektomie vornehmen lassen, die, soweit er weiß, erfolgreich war.«
»Dann also eine Mätresse«, bemerkte Dan Milton, der neben ihr saß, mit seiner typischen Unverblümtheit. Tatsächlich war das eine naheliegende Schlussfolgerung, und Milton liebte Naheliegendes. Mit seinen einunddreißig Jahren unterstand ihm bereits die Private-Banking-Abteilung für Festlandeuropa. Euphemismen waren ihm ebenso fremd wie Embolismen. Geboren in Chicago, besaß er einen Harvard-Wirtschaftsabschluss und einen MBA von INSEAD. Er war vor acht Monaten zum Londoner Team gestoßen, und man litt noch immer unter den Nachbeben seiner drakonischen Maßnahmen.
Farrers unangenehm durchdringender Blick haftete nun auf seinem Protegé. Der Präsident war blond wie ein Albino und besaß nahezu farblose Wimpern und Augenbrauen, was insgesamt einen fischähnlichen Eindruck hinterließ. Als würde man von einem Karpfen ins Visier genommen, hatte Milton einmal zu ihr gesagt, als sie gemeinsam im Lift standen. »Mateo Mendoza hat mir versichert, er wisse über alle Mätressen seines Vaters Bescheid. Er hat sofort Nachforschungen in Auftrag gegeben. Informationen werden gesammelt, aber dennoch: Es muss mehr an dieser Sache sein. Alte Männer, die im Sterben liegen, schenken doch nicht ihr ganzes Vermögen irgendeiner Frau, selbst wenn sie noch so heiß ist.«
»Falls sie tatsächlich eine Mätresse sein sollte, braucht sich die Familie keine allzu großen Sorgen zu machen.« Milton, der wieder einmal Stärke demonstrieren wollte, verwob zuversichtlich seine Finger. Er hatte Erfahrung mit dem Madrider Team, das er vor seiner Berufung in die Hauptzentrale kurz geleitet hatte. »Das spanische Erbgesetz stärkt die Rechte von direkten Angehörigen. Seiner gesetzlichen Frau stehen automatisch fünfzig Prozent zu. Der Rest wird in vorbestimmte Anteile oder legítimas aufgeteilt«, sagte er mit makelloser spanischer Aussprache, »und geht in gleichen Teilen an alle unmittelbaren Verwandten. Er kann nicht einfach hergehen und seinen Angehörigen das Geburtsrecht rauben und alles einer Geliebten in den Schoß werfen.«
Farrer hob eine bleiche Augenbraue. »Da haben Sie ganz recht, Dan, das kann er nicht – wenn es sich um ein Vermächtnis handeln würde.«
Milton riss verblüfft den Mund auf. Zu spät erkannte er, dass er in die Falle getappt, dass er, angestachelt von seinem Ego, zu schnell vorgeprescht war.
»Aber, wie gesagt, handelt es sich hier um eine Schenkung. Auch donación de bienes genannt«, sagte er mit einer ebenso makellosen spanischen Aussprache.
Verächtlich wandte er sich von ihm ab und wartete auf weitere Vorschläge, aber nun traute sich keiner mehr. Zu viele Fußangeln, zu viele Fallstricke. Farrer hatte ein Faible dafür, seine Mitarbeiter vorzuführen.
Sein Blick verhärtete sich. »Was das für uns bedeutet, versteht sich von selbst. Mendoza gehört zu unseren größten Investoren. Erschwerend kommt die Aktionärsversammlung im September hinzu sowie die Schwäche des Pfunds gegenüber dem Euro. Das Timing könnte nicht unvorteilhafter für uns sein! Unglücklicherweise hat Mendoza das Recht, so viel er will an wen er will zu verschenken – zu Lebzeiten«, betonte er und schwieg kurz und bedeutungsvoll. »Und wenn seiner Familie das Geld entgeht – dann wahrscheinlich auch uns.«
Die Anspannung nahm zu.
»Wie auch immer, Carlos bleibt nur noch wenig Zeit. Und das könnte sich zu einem Vorteil für uns auswirken. Möglicherweise müssen wir den Transfer einfach nur hinauszögern, und das Problem erledigt sich von selbst.«
Charlottes Lider zuckten angewidert. Deutete er im Ernst an, Carlos Mendoza würde ihnen den Gefallen tun und einfach sterben, während die Bank seinem letzten Wunsch so viele Hindernisse in den Weg stellte wie möglich und dann einfach abwartete? Nur ein gewöhnlicher Montagvormittag in der Bank, alles wie gehabt. Kein Wunder, dass sie sich hinterher jedes Mal beschmutzt fühlte. Charlotte rückte unbehaglich auf ihrem Sitz hin und her. Zum Glück wurde sie nicht oft herbestellt.
Farrers Blick richtete sich auf den Mann zu Charlottes Rechten, den Chef der juristischen Abteilung. »Paul, Sie holen sofort Ihr Team zusammen und gehen das Kleingedruckte durch. Suchen Sie nach Schlupflöchern, lassen Sie sich was einfallen. Wir müssen das aufhalten. Wenn er stirbt, bevor er die Schenkungsurkunde unterzeichnen kann, bleibt alles beim Alten.«
»Verstanden«, antwortete Paul brüsk, aber entschlossen.
Farrer blickte nun wieder Milton an. »Milton, stellen Sie alles zusammen, was wir über das Mendoza-Vermögen haben. Was lässt sich festnageln, was einfrieren? Was vergraben? Nur für den Fall, dass wir die Schenkung nicht verhindern können.«
Dan nickte. »Wird gemacht.«
»Ms Fairfax.«
Sie hob den Kopf und fand Farrers Blick auf sich gerichtet.
»Danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten.«
»Keine Ursache«, antwortete sie.
»Mateo Mendoza will uns bis heute Abend Bescheid geben, was man bis jetzt über diese Frau herausgefunden hat – ich brauche Sie daher in Madrid.«
Shit. »Okay.« Sie ließ sich nichts anmerken. Ihre Mutter würde ausflippen.
»Knüpfen Sie Kontakt mit ihr, forschen Sie sie behutsam aus, ziehen Sie sie auf unsere Seite. Es ist noch unklar, wie viel sie tatsächlich weiß. Die Familie hat keine Ahnung, was der Alte im Schilde führt. Es ist möglich – wenn auch unwahrscheinlich –, dass sie noch gar nichts von der beabsichtigten Schenkung weiß. Erwähnen Sie also besser nichts, schinden Sie erst mal Zeit und finden Sie mehr heraus. Andererseits kann es durchaus möglich sein, dass sie ganz genau weiß, was auf sie zukommt, und bereits die Hände aufhält. Wie auch immer, Sie werden unsere Augen und Ohren sein.«
Charlotte nickte. Gewöhnlich lief es andersherum, wenn sie zum Einsatz kam: zuerst die Erbschaft, dann das Counselling.
»Wenn es zum Schlimmsten kommen und Carlos den Großteil seines Vermögens aus der Familie herauslösen sollte, dann müssen wir schon in den Startlöchern stehen und dafür sorgen, dass das Geld trotzdem in unserer Bank bleibt. Suchen Sie die Freundschaft dieser Frau, gewinnen Sie ihr Vertrauen. Sie sollte auf Sie hören, sich von Ihnen leiten lassen. Wahrscheinlich hat sie zum derzeitigen Zeitpunkt keine Ahnung von Finanzmanagement. Ich will verhindern, dass die Konkurrenz Wind von einer frischgebackenen Millionenerbin bekommt.« Sein farbloser Blick bohrte sich in den ihren. »Tun Sie, was Sie am besten können.«
»Einen Zugang finden?«, fragte sie zynisch, was sie sich jedoch nicht am Tonfall, sondern höchstens ein wenig an den Augen anmerken ließ.
»Ganz genau«, erwiderte er. »Überreden Sie sie, zu uns an Bord zu kommen, Charlotte. Eine dreiviertel Milliarde Pfund verloren zu haben liest sich in keinem Lebenslauf gut.«
»Sollte das eine Drohung sein?«, fragte Milton, als sie zusammen durch den Korridor eilten.
»Selbstverständlich.«
Milton blieb die Spucke weg. Charlotte schmunzelte. Ihre Unerschütterlichkeit, ihre Coolness faszinierten ihn, standen sie doch in starkem Kontrast zu seinem eigenen prahlerischen, vorwärtsstürmenden Auftreten. »Stört es Sie nicht, dass er den Schwarzen Peter jetzt Ihnen zuschiebt? Wenn wir wegen dieser Frau unseren größten Kunden verlieren sollten, sind Sie geliefert.«
»Da irren Sie sich«, widersprach Charlotte. Sie schritt mit geradem Rücken, schwingenden Armen und hochgerecktem Kinn dahin. Gelegentlich nickten ihnen Vorbeigehende zu. »Ich bin nämlich der Meinung, dass es erst mal Ihnen an den Kragen gehen würde. Sie sind schließlich ein – wie nennt man die im American Football? Die Spieler, die den schützen müssen, der mit dem Ball in den Armen zum Tor rennt?«
»Die Blocker.«
»Genau. Mir geht’s nur dann an den Kragen, wenn die Firmenanwälte keine Möglichkeit finden, die Schenkung zu verhindern. Was bestimmt nicht der Fall sein wird. Außerdem wissen wir beide, dass Sie Mittel und Wege finden werden, um das ›flüssige‹ Vermögen unseres Kunden ins Eisfach zu bugsieren, nicht wahr? Ich bezweifle, dass noch viel übrig sein wird, was es zu retten gäbe, selbst wenn das mit der Schenkung durchgehen sollte.«
»Sie schmeicheln mir, Charlotte«, sagte er und lachte. Sie betraten sein Büro, von dem aus man einen fantastischen Blick auf die weiten Schleifen der Themse hatte, die unter einem diesigen Himmel träge dahinfloss. Ein großer, robuster Mann saß bereits auf Miltons samtbezogenem Sofa und blätterte lustlos im Economist. »Ah, Lord Finch, tut mir schrecklich leid, aber mein Meeting hat ein wenig länger gedauert!« Mit vier dynamischen Schritten durchquerte Milton den Raum und hielt dem anderen wichtigtuerisch eine fleischige Hand hin. »Freut mich, Sie zu sehen, freut mich, Sie zu sehen.« In seinen Augen leuchtete die Begeisterung darüber, es mit dem britischen Adel zu tun zu haben. »Ach ja, erlauben Sie mir, Ihnen Charlotte Fairfax vorzustellen. Ich wollte Sie längst miteinander bekannt machen. Charlotte ist unser Wealth Counsellor, unsere beste Finanzberaterin. Ich bin sicher, sie hätte ein paar sehr hilfreiche Ratschläge für Sie, in Bezug auf … Ihre verzwickte Scheidungssituation.«
Der große Mann blickte ihr lächelnd entgegen und beugte sich ein wenig vor, um sie auf beide Wangen zu küssen. »Lotts, wie schön, dich zu sehen! Wie geht’s, wie steht’s? Du siehst ja wieder umwerfend aus. Wolltest du nicht auch nach Klosters kommen?«
»Wollte ich, ja, aber am Ende ist mir doch was dazwischengekommen. Beruflich.«
»Äh, wie bitte – ihr kennt euch?« Milton konnte es kaum fassen.
»Ach, wir laufen uns ständig irgendwo über den Weg, nicht wahr, Lotts?«, bemerkte Lord Finch. In diesem Moment klingelte ihr Handy.
Sie warf einen Blick aufs Display. »Ah, auf den Anruf habe ich gewartet. Tut mir leid, aber da muss ich ran.« Sie lächelte bedauernd und stellte sich auf die Zehenspitzen, um sich mit einem Küsschen von ihm zu verabschieden. »Treffen wir uns doch mal im August zum Lunch. Kommst du auch nach Positano?«
»Darling, kackt der Papst in den Wald?«
Charlotte lachte. »Du bist unmöglich! Ich melde mich.« Und damit wandte sie sich zum Gehen und ließ einen völlig verblüfften Milton zurück.
»Ich werde Sie auf dem Laufenden halten!«, rief er ihr noch nach.
Sie hob, auf dem Korridor stehend, zustimmend den Arm und ging dann weiter, das Handy am Ohr. »Ja, Rosie?«
»Hallo, Charlotte«, antwortete ihre PA. »Passt es gerade?«
»Klar.« Sie ging zum gläsernen Lift und drückte auf den Knopf, ließ den Blick durch die bodentiefe Fensterfront über die unter ihr liegende Stadt schweifen. »Ich bin noch bei Steed, aber auf dem Weg nach draußen. Du musst alle meine Termine und Verabredungen absagen und mir für morgen früh einen Flug nach Madrid besorgen, okay?«
»Okay. He, Madrid, Mensch, du hast aber Glück! Da kannst du dich vor der Hochzeit gleich noch ein bisschen bräunen.«
»Ja, was für ein Glück«, erwiderte Charlotte wenig begeistert.
»Wieso, was hast du?«
»Ach, du musst ja nicht meiner Mutter beibringen, dass ich die letzte Anprobe des Hochzeitskleids nun doch sausen lassen muss.«
»Oh.« Rosie kannte Charlottes Mutter. »Ach was, halb so wild. Die haben schließlich deine Maße.«
»Klar«, meinte Charlotte zynisch. »Was soll’s, ist ja bloß ein Hochzeitskleid.«
Rosie lachte. Charlottes trockener Humor. »Wenigstens kannst du in Spanien ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Ein bisschen Abstand vom Hochzeitsrummel kann nicht schaden.«
»Du willst doch nicht andeuten, dass ich gestresst bin?«
»Ich sag ja nur. Du willst nächste Woche heiraten, hast aber weder eine Hen-Party veranstaltet noch einen Lunch, ja noch nicht mal einen Termin beim Friseur gehabt! Und für die Flitterwochen wollt ihr euch auch nur ein paar Tage Zeit nehmen …«
»Weil wir beide im Moment fürchterlich viel zu tun haben! Flittern können wir später, wenn alles wieder ein bisschen ruhiger läuft. Ach ja, hat er übrigens angerufen?«
»Nö, noch nicht. Soll ich’s mal versuchen?«
»Nein, nein, macht nichts. Ich erwische ihn dann später.« Stephen und sie telefonierten während der Arbeit so gut wie nie miteinander – einer von ihnen war unweigerlich in einem Meeting –, aber sie freute sich bereits auf einen ruhigen Abend mit ihm. Sie sahen sich wenig genug, selbst wenn sie morgen nicht nach Madrid hätte fliegen müssen. Junggesellen- und sonstige Gratulationspartys nahmen die meisten ihrer kostbaren Abende zu zweit in Anspruch, ein letztes Hurra, bevor man in die Sommerfrische flog, nach Formentera oder auf die Esmeraldas, wo man einander ja doch wieder über den Weg laufen würde und der Reigen erneut begann. Charlotte sehnte sich danach, in einen von Stephens Pyjamas zu schlüpfen und auf dem Sofa die Beine hochzulegen. Ein schöner Rhabarber-Gin-Tonic und eine Fußmassage. »Ich bin zwar schon unterwegs, aber könntest du mir vielleicht trotzdem kurz Lucy Santos’ Akte mailen? Du weißt schon, Roberto Santos’ Frau.«
»Der Chelsea-Fußballer.«
Der Lift war da, und sie trat ein. »Ex-Chelsea. Jetzt Real Madrid, weißt du nicht mehr?«
Als ob sie das vergessen könnte. Rosie kannte die Ambitionen ihrer Chefin. Der Chelsea-Fußballclub gehörte schon jetzt zu ihren wichtigsten Klienten. So hatten Lucy und sie sich ursprünglich kennengelernt. Sie und ihr Mann waren von Manchester nach London gewechselt, und Charlotte hatte Lucy geholfen, in der Stadt Fuß zu fassen. Real Madrid verfügte natürlich über eine eigene Wealth Consultancy (oder etwas in der Art), aber Lucy mochte Charlotte und hatte nicht auf sie verzichten wollen. Sie bestand darauf, dass eine weitere Zusammenarbeit mit ihr in den Transfervertrag ihres Gatten aufgenommen wurde. Madrid wollte seinen neuen Starspieler natürlich nicht schon zu Beginn verprellen und war einverstanden gewesen. Charlotte erhoffte sich eine ähnliche Ausbeute beim spanischen Fußballclub wie zuvor bei Chelsea. Deshalb war es ihr auch so wichtig, dass bei Umzug und Eingewöhnung der beiden alles gut lief, und sie gab sich besondere Mühe mit dieser Klientin.
»Das wäre eine gute Gelegenheit, mich vor Ort um sie zu kümmern, soweit es die Zeit erlaubt. Als wir das letzte Mal miteinander geredet haben, hatte sie immer noch große Probleme: die Sprachbarriere, die Presse, die richtige Vorschule für ihren kleinen Sohn … Und FaceTime ist kein Ersatz für ein echtes Vier-Augen-Gespräch. Das kann ich dann noch erledigen, ehe ich tiefer in das Mendoza-Problem einsteige.«
»Mendoza?« Der Name war allgemein bekannt. »Glaubst du denn, dass es wirklich ein Problem werden könnte?«
»Ja, schon möglich.« Charlotte nickte. Es kam schließlich nicht alle Tage vor, dass die Liquidität einer Bank durch einen einzigen Kunden in Gefahr geriet. »Der Lift ist da, ich muss Schluss machen. Ich rufe in zehn Minuten nochmal an, ja?«
»Ach – aber was ist mit dem Dinner am Samstag? Wirst du rechtzeitig wieder hier sein?«
Die Türen schlossen sich hinter ihr.
Charlotte verzog das Gesicht. »Mensch ja, stimmt, Samstag.« Wie konnte sie das vergessen? Sie biss sich auf die Unterlippe. Stephens Eltern gaben an dem Abend für die wichtigsten Hochzeitsgäste einen privaten Empfang im Savoy. »Nö, lass nur, das schaffe ich schon. Notfalls fliege ich nur für den einen Abend zurück.«
»Oder sie kommen einfach alle zu dir nach Madrid«, witzelte Rosie mit verzerrter Stimme, denn die Verbindung begann bereits abzureißen. »Ist doch nur ein Katzensprung.«
Charlotte schmunzelte bei der Vorstellung, dass hundert Leute aus dem engsten Freundes- und Verwandtenkreis nur wegen einer einzigen Party nach Madrid flögen. »Genau. Wir könnten einen Jumbojet chartern.«
Das Letzte, was sie hörte, bevor die Verbindung ganz abbrach, war Rosies Gelächter. Als ob das ein Scherz gewesen wäre!
»Ich bin’s!«, rief sie beim Eintreten und warf ihren Hausschlüssel in das Schälchen auf der Garderobenkonsole. Sie spähte auf dem Weg zum Wohnzimmer kurz die Treppe hinauf. Nichts. Im Wohnzimmer ebenso wenig. Aber immerhin stand Stephens Aktentasche auf dem Stuhl, auf dem er sie bei der Heimkehr stets abstellte. »Stephen? Ich bin wieder da. Und ich hab unter dem Mantel nichts an!« Sie ging nach hinten in die Küche. »Oh! Hallo Mutter.«
»Darling.« Ihre Mutter hob das Kinn und hielt Charlotte ihre Wange zum Kuss hin.
»Wo steckt Stephen?«
»Im Keller. Er holt eine Flasche Rotwein.«
Charlotte runzelte die Stirn. »Ach.« Ihr Blick fiel auf das große Hackbrett mit kleingeschnittenem Gemüse, daneben eine Platte mit Austern. »… war noch was geplant?«
»Nein, nein. Ich war bei der Visagistin und dachte mir, schaust mal kurz vorbei, und Stephen hat mich netterweise gebeten, zum Abendessen zu bleiben.«
»Aha.« Charlotte lächelte gezwungen. So viel zu einem ruhigen Abend im Männerpyjama auf der Couch. »Lieb von ihm.«
»Ich habe ihn bereits darauf aufmerksam gemacht, dass einige von deinen verantwortungsloseren Freunden uns noch immer eine Antwort auf die Einladung schuldig sind. Die denken wohl u. A.w. g. sei eine Art Cognac.«
Na toll. Charlotte nahm sich, während sie auf den Wein warteten, ein Glas Wasser. »Wie war die Gesichtsmassage? Du siehst übrigens toll aus.« Ihre Mutter nahm ihre Körperpflege sehr ernst, sie war immer die Erste, die neue kosmetische Behandlungen ausprobierte, um dem Alter zu trotzen. Ihr einst blondes Haar war zwar inzwischen silbrig-gelb, aber sie hatte noch dieselbe Frisur wie mit vierzig, einen Bob mit nach innen geföhnten Haarspitzen. Ihre strahlend blauen Augen blickten unter etwas faltigeren Lidern hervor, besaßen aber immer noch ein jugendliches Funkeln, das dafür sorgte, dass sie nach wie vor ein begehrter Gast auf den Dinnerpartys der Londoner High Society war.
»Einfach wundervoll. Maries Hände sind immer so schön kalt, allein das genügt, um meine Haut zu straffen, scheint mir.« Ihre Mutter betastete zufrieden ihre Wangenknochen.
»Mm.«
Stephen tauchte mit einer Flasche Domaine Leroy Musigny Grand Cru auf. »Ah, da bist du ja endlich. Wieder mal viel zu spät.« Er trat auf sie zu, und sie streckte sich, um ihn auf den Mund zu küssen, aber er gab ihr lediglich einen Kuss auf die Wange. Er hielt nicht viel von der »Zurschaustellung von Gefühlen«, wie er es ausdrückte. Schon gar nicht in Anwesenheit ihrer Mutter.
»Ja, ich musste noch einige Papiere durcharbeiten.« Sie sah zu, wie er die Flasche zwischen seine Knie klemmte und den Korken heraushebelte. Er trug eine Khakihose und ein frisches Hemd ohne Krawatte. Das war seine Freizeitkleidung, lockerer machte er sich nicht.
»Wie war’s bei Steed? Hat Farrer alle gefeuert?« Er war selbst Broker und wusste daher, dass bei der Bank momentan dicke Luft herrschte.
»Nein, es war interessant.« Sie ließ sich ein Glas füllen. Mann, sie hatte vielleicht einen Durst! Es war ein langer, harter Tag gewesen. »Sie schicken mich für ein paar Tage nach Madrid.«
»Was?« Stephens Hand stockte bei der Übergabe des Glases.
»Wann?«, fragte ihre Mutter ebenso bestürzt.
»Morgen.«
»Aber die letzte Anprobe …!«, rief ihre Mutter.
»Das Dinner …«, klagte Stephen.
Charlotte starrte in ihre bestürzten Gesichter. Sie zählte bis fünf. Menschenskind, manchmal hatte sie wirklich den Eindruck, dass diese beiden das Hochzeitspaar waren und sie das unartige Kind. »Keine Sorge, die Anprobe verschieben wir aufs Wochenende, ich werde rechtzeitig vor dem Dinner da sein, versprochen. Oder glaubt ihr, ich würde meine eigene Hochzeit versäumen?«
Beide musterten sie, als ob sie das durchaus in den Bereich des Möglichen zögen. »Jetzt macht euch mal keine Sorgen«, bat sie und nahm einen Schluck Wein. Sie hatte die Stärkung dringend nötig.
»Ich weiß wirklich nicht, wieso du das alles überhaupt mitmachst«, klagte ihre Mutter seufzend. Enttäuscht lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück.
»Was mitmache?«
»Diesen ganzen Stress.«
»Ich bin nicht gestresst.«
»Klar bist du das – all diese Meetings, dieses Herumreisen, immer diese Eile.« Ihre Mutter hob kreiselnd die Hand, um ihre Worte zu unterstreichen. »Kein Wunder, dass du immer so erledigt aussiehst.«
»Ich sehe doch nicht erledigt aus!«, protestierte sie, tastete aber, wie um sich zu vergewissern, ihr Gesicht ab. Sie warf Stephen einen hilfesuchenden Blick zu.
»Um ehrlich zu sein, hast du dich in letzter Zeit wirklich ein wenig zu sehr verausgabt«, meinte er achselzuckend. »Du hast abgenommen …«
»Aber das versucht doch jede Braut vor der Hochzeit!«
»Und du bist zerstreut und kommst ständig zu spät.«
»Ja, weil ich nun mal viel zu tun habe.«
»Aber das ist doch unnötig!«, rief ihre Mutter aufgebracht. »Warum das Ganze? Das hast du doch gar nicht nötig. Ich kann verstehen, dass dir die Vorstellung gefällt, berufstätig zu sein, aber davon solltest du doch inzwischen wirklich genug haben, nicht? Im Ernst, Darling, du machst dich kaputt! Stephen hat vorhin erst gesagt, dass es ihm lieber wäre, wenn du öfter zuhause wärst.«
Charlotte schoss ihrem Verlobten einen wütenden Blick zu. Stimmte das? Er wich ihrem Blick aus und widmete sich geflissentlich der Essenszubereitung. »Ich habe nur gesagt, dass es einfacher wäre, wenn du nicht ebenfalls berufstätig wärst«, sagte er hastig.
»Und was soll ich stattdessen machen? Shopping? Lunches? Tennis?«
»Ja, wieso denn nicht? Was ist so falsch daran?« Ihre Mutter war gekränkt. »So bist du nun mal aufgewachsen, kein Grund, die Nase zu rümpfen. Ehrlich, Charlotte, manchmal glaube ich fast, du bist eine verkappte Sozialistin.«
Charlotte starrte erst ihre Mutter an, dann ihren Verlobten. Manchmal war es schwer zu unterscheiden, mit wem genau sie sich stritt. Mit beiden offenbar. »Das ist eine Beleidigung.«
»Allerdings!«, rief ihre Mutter, die Bemerkung völlig missverstehend.
Charlotte schenkte sich seufzend Wein nach. Sie war zu müde für Auseinandersetzungen. »Also ich weiß wirklich nicht, worüber wir eigentlich streiten – und wieso. Mir ist meine Karriere nun mal wichtig, das ist alles. Ich habe hart gearbeitet, um es so weit zu bringen. Das ist für mich nicht bloß ein Hobby, mit dem ich meine Zeit fülle.«
»Ich finde, du solltest öfter an Stephen denken und daran, wie du ihm beruflich weiterhelfen könntest, anstatt immer nur an deine Karriere«, meinte ihre Mutter. »Aber wie soll das gehen, wenn du ständig überarbeitet bist?«
»Ich bin doch nicht überarbeitet.«
»Und morgen geht es schon wieder ab nach Madrid.«
Sie seufzte. Während der Modewoche hatte ihre Mutter noch viel mehr Termine als sie. »Stephen geht’s gut. Wenn er lieber ein Hausfrauchen hätte, das in der Küche auf ihn wartet, hätte er mir wohl kaum einen Heiratsantrag gemacht. Das stimmt doch, oder, Darling?«
Sie schaute ihren Verlobten hoffnungsvoll an. Der beugte sich geflissentlich über die Zitrone, die er gerade aufschnitt. Er hob zerstreut den Kopf. »Hm? … Ja, sicher.«
Das war eine seiner typischen Nicht-Antworten. Er wollte weder sie noch ihre Mutter kränken und drückte sich vor einer eindeutigen Stellungnahme. Obwohl er als Brigadier der British Army früher Taliban-Scharfschützenfeuer und Splitterbomben in Damaskus ausgehalten hatte. Trotzdem hatte er nicht den Mut, sich offen mit ihrer Mutter anzulegen.
»Also, ich gehe jetzt erst mal duschen und ziehe mir was Bequemeres an«, verkündete sie und stellte gereizt ihr Glas ab. »Meine Füße bringen mich noch um.«
»Aber mach schnell, ja? Wir müssen noch wegen der Knopflöcher sprechen. Und hast du Pips E-Mail gesehen? Die Twister-Rosen können wir offenbar vergessen. Ein Befall mit Weißen Fliegen, grässlich! Was für ein Pech! Jetzt müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen … Sie hat Ranunkeln als Ersatz vorgeschlagen«, rief ihre Mutter ihr nach.
Charlotte hob erschöpft die Hand und schleppte sich die Treppe hinauf, während ihre Mutter ihr eifrig weitere Vorschläge hinterherrief. Jedes Happy End hat offenbar seinen Preis.
Madrid
»Ich werde noch verrückt«, klagte Lucy Santos, und ihr hübscher voller Mund presste sich zu einem verbitterten Strich zusammen. »Niemand hier im Haus spricht Englisch. Sie nicht.« Sie wies mit einem Nicken auf die Haushälterin, die soeben einen Entsafter auswusch. »Und sie auch nicht.« Sie wies mit dem Kopf auf die Nanny, die mit Lucys Vierjährigem im Garten spielte. »Rob sagt, das macht nichts, das ist sogar gut, weil Leo dadurch gezwungen ist, schnell Spanisch zu lernen. Aber wenn ich was Wichtiges zu sagen habe, muss ich immer erst auf Rob warten, damit er das für mich macht.«
Charlotte runzelte die Stirn. Sie war vorhin auf dem Weg zum Klo an der telefonierenden Haushälterin vorbeigekommen. Und sie war sich sicher, dass sie am Telefon Englisch gesprochen hatte. »Dann wirf diese Haushälterin raus und such dir eine, die auch tatsächlich Englisch spricht. Und was ist mit deinem Spanischkurs? Hast du den schon angefangen?«
Lucy schnaubte. »Was nützt der schon! Hola. Qué tal? Mehr hab ich nicht drauf.«
»Du musst weiterüben. Du wirst überrascht sein, was für einen Unterschied es macht, wenn man die Landessprache spricht. Wenn einen die Leute verstehen und man selbst verstanden wird.«
Lucy warf Charlotte einen gereizten Blick zu. »Ich wette, du sprichst fließend Spanisch.«
Das klang vorwurfsvoll, aburteilend, defensiv. Verunsichert. »Ich war in meiner Kindheit oft hier, das hat geholfen, und später hab ich dann auf der Uni Spanischkurse belegt.«
»Lass mich raten – Oxford, was?«
»Cambridge«, antwortete Charlotte achselzuckend. »Aber das will nichts heißen. Ich hab eine miese Note gekriegt.«
Lucys Augen funkelten entzückt. »Echt?«
»Das wilde Studentenleben …«, meinte Charlotte mit einem vielsagenden Schmunzeln.
Dieses Geständnis tat Lucy sichtlich gut, und sie entspannte sich ein wenig. »Aber aufgehalten hat es dich am Ende nicht. Schau dich an: Counsellor bei einer schicken Privatbank. Wealth Counsellor. Wer hätte gedacht, dass es so was überhaupt gibt?«
»Solange es Geld gibt auf dieser Welt, wird es auch Leute geben, die mich brauchen, glaub mir. Mit Geld ist es wie mit Schönheit: Fluch und Segen zugleich. Die Leute glauben, es wäre die Antwort auf alle Probleme. Aber es werden davon genauso viele Leben zerstört wie gerettet. Jeder Reiche wird dir sagen können, dass Reichtum ein Käfig ist.«
»Wie wahr«, murmelte Lucy. Ihre kleine Gestalt verschwand fast in der riesigen weißen Sofalandschaft. Sie war nur eins fünfundfünfzig groß und trug Sandalen mit hohen Korkkeilsohlen, dazu eine mächtige, mit karamellbraunen Strähnchen aufgepeppte Mähne, die ihr zusätzliche Zentimeter verlieh. Dank regelmäßigem Fitnesstraining besaß sie eine gute Figur. An einem Finger prangte ein riesiger Aquamarin, und ihre wie aufgesprüht wirkenden Jeans besaßen so viele Risse, dass man den Eindruck hatte, sie wäre in ein Rudel Wölfe geraten.
Aber obwohl es draußen fast fünfunddreißig Grad heiß war, hielt Lucy eine dampfende Tasse orangeroten Tee umklammert, als müsse sie sich daran wärmen. Sie senkte alle paar Minuten ihren Kopf darüber, um einen Schluck zu nehmen, wirkte zerstreut und distanziert – ein blasses Abbild der temperamentvollen, fröhlichen jungen Frau, die Charlotte aus London kannte. Damals hatte sie den Umzug nach Spanien kaum abwarten können, wollte »endlich in die Sonne«.
Das hier sollte eigentlich ein wahr gewordener Traum sein, und auf dem Papier war der Umzug ja auch nahtlos über die Bühne gegangen. Der Club hatte bereits Santos-Merchandise im Wert von 67 Millionen britischer Pfund abgesetzt und damit schon fast die Hälfte der Transferkosten für den Spieler wieder hereingeholt. Auf dem Platz lief es ebenfalls gut: Santos hatte in den letzten neun Spielen sieben Tore erzielt. Am Leben hinter den Kulissen gab es auch nichts auszusetzen: ein Haus wie aus einer Architekturzeitschrift. Moderne polierte Betonböden, umlaufende Fensterfronten und holzverkleidete Fassaden. Dazu ein herrlicher Swimmingpool im weitläufigen Garten, über den Schwalben dahinschossen. In der Mitte der Küche stand eine kupferverkleidete Kochinsel von der Größe eines Himmelbetts, die gerade von einer Hausangestellten poliert wurde. Nur die Herrin des Hauses ließ ihre Flügel hängen. Fühlte sich allein und unglücklich und war gereizt.
Charlotte, die auf dem Sofa gegenüber saß, bemerkte den traurigen Blick, mit dem Lucy in den Garten starrte. Ihr Söhnchen war ins maßgeschneiderte Baumhaus hinaufgeklettert und schaute nun fröhlich auf seine Nanny hinab, die ihn vergebens anflehte, er möge wieder hinunterkommen.
»Findest du sie hübsch?« Lucy wies mit dem Kopf auf die junge Frau im Garten. Charlotte begutachtete sie. Das Kindermädchen trug eine kurze Cut-off-Jeans und dazu ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Déjà-vu. Ihr langes schwarzes Haar hatte sie zu einem kessen Pferdeschwanz hochgebunden. Sie trug Turnschuhe und, soweit es Charlotte erkennen konnte, kein Make-up.
»Doch, ja«, meinte Charlotte achselzuckend. »Und du?«
»Schon … Hässlich ist sie nicht.«
Charlotte musterte Lucys Miene, mit der sie die junge Hausangestellte betrachtete. »Glaubst du, dass Roberto sie hübsch findet?«
Lucys Kopf fuhr herum. »Wieso fragst du?«
»Weil ich das Gefühl habe, dass so etwas hinter deiner Frage stecken könnte.« Charlotte wartete mit schräg geneigtem Kopf. »Und?«
Lucy schwieg. »Weiß nicht«, murmelte sie schließlich. »… kann sein.«
Stille breitete sich im Raum aus, wie langsam aufquellender Isolierschaum, der alle Ritzen füllt. Beide kannten die Geschichten, die über Topfußballer kursierten – entweder gingen sie andauernd fremd, oder sie waren heimlich schwul. Keiner konnte einfach nur glücklich verheiratet sein. »Wie hat er sich hier eingelebt, was glaubst du?«
»Rob?«
Sie nickte.
»Ach, Rob ist Rob. Der ist überall zuhause, wo er seine Schuhe abstreift.«
»Aber für ihn ist es leichter als für dich – die Sprachbarriere fällt für ihn ja beispielsweise weg.«
»Aber kolumbianisches Spanisch ist anders als spanisches Spanisch.«
»Schon, aber es gibt doch sicher mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede?«
»Mag sein.«
»Wohingegen es für dich schon schwer ist, nur eine Tüte Milch zu kaufen.«
»Dafür habe ich ja Personal«, meinte Lucy wegwerfend.
»Aber das ist vielleicht ein Bestandteil des Problems«, schlug Charlotte vor.
»Was? Wieso sollte das ein Problem sein?«
»Es ändert die Dinge, wenn man nicht mehr für sich selbst sorgen muss. Natürlich ist es toll, Personal zu haben, das alles für einen erledigt. Aber man wird dadurch vom normalen Alltag abgeschnitten, vom Rhythmus des Lebens – man isoliert sich zwangsläufig. Entfernt sich von der Realität. Diese einfachen Routinehandlungen erden uns und sorgen dafür, dass wir nicht die Verbindung zu unseren Überlebensinstinkten verlieren. Und wenn’s nur so was Simples ist, wie sich seine Milch selbst zu besorgen.«
»Vergiss es.« Lucy schüttelte den Kopf. »Du hast ja keine Ahnung, wie’s hier zugeht. Es war ja schon zuhause schwer, irgendwo hinzugehen, aber hier … hier ist Galáctico ein anderes Wort für Gott. Ständig wird man angestarrt, beobachtet, ja sogar gefilmt. Letztes Wochenende sind wir mit Leo auf einen Burger gegangen, aber es kamen so viele Fans, die ein Foto mit Rob wollten oder ein Autogramm … Am Ende mussten wir wieder gehen. Leo war in Tränen aufgelöst, der Arme.«
»Ja, ich kann mir vorstellen, wie hart das für euch sein muss. Der Verlust der Anonymität ist schwer zu verkraften.«
»Ich werde mich nie dran gewöhnen. Leo und ich, wir haben uns das nie gewünscht.«
»Nein, natürlich nicht.« Charlotte nahm einen Schluck Tee und sah nun auch dem kleinen Jungen beim Spielen zu. Ein großer und wichtiger Teil ihres Jobs bestand darin, einfach nur zuzuhören, für die Sorgen und Nöte ihrer Klienten da zu sein. »Und die Öffentlichkeit ist bestimmt nicht das einzige Problem – die Gaffer, die Autogrammjäger. Es geht ja noch weiter, das reicht bis hinein in persönliche Beziehungen. Jeder, den du kennenlernst, weiß, dass du die Frau von Rob Santos bist …«
»Und dass er für 95 Mille zu Real gewechselt ist. Ich seh’s in ihren funkelnden Augen, wenn sie mit mir reden.«
»Big Boob Syndrome«, meinte Charlotte. »Das ist alles, woran sie denken können.«
Lucy lachte laut auf. »Ja, genau, du sagst es: Big Boob Syndrome!«
Charlotte schmunzelte, wusste aber, dass Lucys Lachen eher bitter als fröhlich war. »Es ist schwer, wenn man nie weiß, wem man vertrauen kann: Wird man um seiner selbst willen gemocht? Oder wegen Rob und eurem Reichtum? Das macht einsam, das isoliert. Hinzu kommt, dass ihr hier in einer Gated Community lebt, mit Zäunen, Toren, Wachpersonal, Hunden. Und das aus gutem Grund: Euer Reichtum macht euch zur Zielscheibe. Die Wände schützen vor dem Draußen – aber sie sperren einen eben auch ein. Wer fühlt sich da nicht mal einsam.«
»Ja.« Lucy blickte sich traurig in dem perfekten Haus um. »Aber ich fühle mich schuldig, verstehst du? Weil wir so viel haben, mehr, als ich mir je hätte erträumen können. Was für ein Recht habe ich denn schon, mich darüber zu beklagen?«
»Reichtum auf diesem Niveau kann eine zutiefst isolierende Erfahrung sein, Lucy. Außerdem bist du eine junge Mutter, du lebst in einem fremden Land, fern von der Heimat, von deiner Familie, deinen Freunden, du hast kaum Sprachkenntnisse, wirst von Paparazzi verfolgt … Wer würde das nicht als erdrückende Last empfinden?«
Lucy, den Tränen nahe, nickte.
»Die Herausforderung für dich ist es jetzt, die Spreu vom Weizen zu trennen, die Menschen auszusieben, die nur Äußerlichkeiten sehen, und sich auf die zu konzentrieren, denen es um mehr geht, um dich.«
»Aber wie denn?«
»Indem du machst, was dich wirklich interessiert. Wichtig sind jetzt erst mal Erfahrungen – Freundschaften werden dann schon folgen.«
Lucy sah sie verwirrt an und rutschte nervös auf dem Sofa hin und her.
»Okay, mal sehen: Was hast du früher am liebsten gemacht – ohne Rob, meine ich? Was hat dich glücklich gemacht?«
Ohne Rob? Diese Vorstellung schien Lucy zu überfordern. »Weiß nicht«, meinte sie mit einem hoffnungslosen Achselzucken. »Shopping, denke ich. Das Haus einrichten. Mit den Mädels in den Pub gehen. Ganz normale Sachen.«
»Irgendwelche Hobbys?«
»Hobbys?« Lucy zog ihre Stupsnase kraus. »Was denn? Etwa Stricken?«
»Oder Fotografie. Töpfern. Warst du mal in einem Buchclub? Einem Joggingverein? Einem Kurs in Blumenbinden?«
Lucy betrachtete Charlotte, als hätte sie den Verstand verloren. »Ich habe meinen Sport. Pilates. Intervalltraining. Und Boxen, vor allem Boxen. Das könnte ich ständig machen.«
»Na gut. Und machst du das hier auch?«
»Klar.«
»Und wo?«
»Na, hier.«
Charlotte hob eine Augenbraue. »Ihr habt einen Fitnessraum im Haus?«
»Mhm.«
»Du trainierst mit einem Personal Trainer?«
»Ja.«
»Also bloß ihr zwei? Du gehst nicht in ein Studio? Triffst keine anderen Leute? Mit denen man hinterher auf einen Kaffee gehen könnte?«
»Ach.« Ihr kleiner Körper fiel erneut in sich zusammen. »Nö.«
»Was ist mit den Frauen der anderen Spieler? Hast du dich schon mit denen getroffen? Ihr sitzt doch sozusagen im selben Boot.«
»Aber die sind nicht wie ich. Die meisten haben ihre Männer doch erst kennengelernt, als die schon berühmt waren. Aber Rob und ich, wir sind schon zusammen, seit sie ihn auf die Jugendakademie an der ManU geholt haben. Mir ging’s nie ums Geld. Wir lieben uns.«
»Ich weiß, das merkt man. Ihr seid ein richtiges Ehepaar. Eine echte Familie.« Charlotte überlegte einen Moment. »Okay, sag mir eins: Was würdest du tun, wenn Rob kein professioneller Fußballer wäre?«
Lucy überlegte einen Moment lang. »Ich wäre wohl Friseurin.«
»Okay. Und was würdest du tun, wenn du arbeiten müsstest, dir aber aussuchen könntest, was du am liebsten tätest?«
Diesmal zögerte Lucy keine Sekunde. »Künstlerin.«
»Echt?« Charlotte war überrascht, bemerkte aber, wie die Röte der Verlegenheit in die Wangen ihrer Klientin stieg. »Welche Art Künstlerin?«
»Malerin. Porträtmalerin. Ich liebe Gesichter.« Sie musterte Charlotte plötzlich mit einem intensiven Blick. »Dich zum Beispiel würde ich zu gerne porträtieren.«
Charlotte, der es unangenehm war, dass die Aufmerksamkeit plötzlich auf ihr selbst ruhte, lachte betreten. »Ach, da findest du doch sicher bessere Objekte als mich!«
»Nein, ich …« Lucy musterte ihr Gesicht, als würde sie bereits jede Linie nachzeichnen. »Dein Gesicht hat was …«
Charlotte selbst fand nichts Besonderes an ihrem Gesicht: hellbraune Augen, eine ordentliche Nase, unspektakulärer Mund, ein paar Sommersprossen. Hübsch, mehr nicht. Sogar Stephen hatte einmal gesagt, sie sehe »ganz anständig« aus.
»Hohlwangiges?«, schlug sie vor und musste dabei an die gestrige Auseinandersetzung mit ihrer Mutter denken.
Lucy lachte. »Wohl kaum. »Nö, es …« Ihre Stimme verklang, sie musterte ihr Gegenüber.
»Was?« Charlotte war interessiert, aber auch nervös.
Lucys Blick wurde nachdenklich. »Ich weiß nicht, du hast irgendwie … traurige Augen.«
Charlottes Lächeln erstarrte. »Ach …«
»Nein, nein, das soll keine Beleidigung sein«, versicherte Lucy hastig. »Ach, mir fällt einfach nicht das richtige Wort dafür ein. Ist bloß so ein Gefühl, das ich bei dir habe, verstehst du? Es gibt Menschen, da sieht man gleich, das sind alte Seelen, die sind sicher schon ein paarmal hier gewesen.« Sie machte komische große Kulleraugen. »Aber bei dir, ich weiß nicht, selbst wenn du lächelst und fröhlich wirkst … ist da immer eine gewisse unterschwellige Traurigkeit.« Sie zog die Nase kraus. »Entschuldige, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Wie gesagt, ich finde einfach nicht die richtigen Worte dafür. Traurig ist wahrscheinlich Unsinn.«
»Macht doch nichts«, meinte Charlotte mit einem verkrampften Lächeln. »Aber um mich brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen. Ich bin glücklich, sehr glücklich sogar. Und überhaupt nicht traurig.«
Lucys Miene erhellte sich, umso mehr, weil ihr gerade etwas einfiel. »Gott, ja, stimmt! Das letzte Mal, als wir uns in London gesehen haben, hattest du dich doch gerade verlobt!« Sie beugte sich vor und wollte nach Charlottes Hand greifen. »Uh-uh, zeig doch noch mal deinen Ri…«
Sie stockte, denn ihr Blick war auf Charlottes ringlosen Finger gefallen. Alarmiert schaute sie zu der anderen auf.
»Keine Sorge!« Charlotte musste über Lucys offensichtlichen Schrecken schmunzeln. »Ich lasse ihn nur ein wenig enger machen. Er saß zu lose.«
»Meine Güte, Gott sei Dank!« Lucy presste erleichtert die Hand aufs Herz. »Mir fällt ein Stein vom Herzen! Ich dachte schon, ich wäre ins größte Fettnäpfchen getreten, das es gibt.«
»Keine Sorge, alles ist gut. Mir geht’s gut.«
Lucy schnaubte. »Das sage ich auch immer, wenn Mum anruft: ›Mir geht’s gut.‹« Sie hob jäh den Kopf. »Wusstest du, dass das die dickste Lüge der Welt ist?«
Charlotte, deren Herz flatterte wie bei einem Kind, das aus dem Schlaf geschreckt wurde, schüttelte schwach den Kopf.
»Doch, hab ich irgendwo gelesen.«
Charlotte bewahrte eine neutrale Miene, hielt jedoch den Blick gesenkt. Gerade jetzt sollte ihr Lucy nicht in die Augen sehen. Denn falls »Mir geht’s gut« wirklich die dickste Lüge der Welt war, würde es nur eine von ihnen auch zugeben.
2. Kapitel
Das Apartment lag nach Westen, die spanische Sonne fiel durch die Fenster und spiegelte sich im goldbraunen Parkett. Es war eine Firmenwohnung, die für die höhere Riege der Bankangestellten reserviert war – oder auch für eine besonders geschätzte Beraterin. Charlotte saß auf dem Balkon und hatte ihre nackten Füße aufs gusseiserne Geländer gelegt, den Rock ein wenig hochgeschürzt, um sich die Beine bräunen zu lassen. Hier im sechsten Stock hatte man einen herrlichen Blick auf die Stadt und auf den unten vorbeirauschenden Feierabendverkehr. Rote Bremslichter zogen sich in einer endlosen Schlange den Boulevard entlang, Fahrradfahrer nahmen Abkürzungen durch schmale Gassen, die als Einbahnstraßen gekennzeichnet waren. Hinzu kam das ferne Rauschen des Zugverkehrs, wie ein dumpfer Unterton im größeren Lärm. Das Weinglas lag schwer in ihrer Hand, und die Kondenströpfchen am Glas waren ein Ebenbild der Schweißtröpfchen auf ihrer Oberlippe. Man musste sich erst an die hiesigen Temperaturen gewöhnen, vor allem wenn man direkt aus London kam.
»Na also! Endlich erreiche ich dich. Ich wollte schon aufgeben«, rief sie, als anstelle des Klingeltons das Rauschen des Londoner Verkehrs an ihr Ohr drang.
»Ah, Charlotte, ich bin unterwegs«, antwortete Stephen ein wenig gehetzt.
»Wo bist du denn?« Sie nahm einen Schluck Wein, und ihr Blick fiel dabei auf eine alte Dame, die ihren Hund unten auf dem Trottoir Gassi führte.
»Piccadilly.« Man hörte an seinen Atemzügen, wie eilig er es hatte. Er marschierte noch immer wie ein Soldat: Brust raus, Kinn hoch, gerade schwingende Arme. Wenn einem der militärische Drill einmal in den Knochen steckte … »Unterwegs zum Reformclub. Heatherwick ist in der Stadt.«
»Ah, Charlie, wie geht es ihm? Haust er noch immer bei diesem Andenstamm?« Sie war dem Mann erst einmal begegnet, als er einen abendlichen Zwischenstopp in London eingelegt hatte, ehe er seinen Flug von Sankt Petersburg nach Panama fortsetzte, aber Stephen hatte ihr viele Geschichten erzählt, von ihrer gemeinsamen Militärzeit, von Pokerspielen in Panzern und dem Gegröle von Rugbyliedern zum Klang seiner kleinen Taschenmundharmonika. Als Charlie seinen Militärdienst nach einem besonders traumatischen Einsatz in der Provinz Helmand nicht mehr hatte verlängern wollen, war Stephen am Boden zerstört gewesen. War es Zufall, dass auch er nach nur einem weiteren Einsatz den Dienst quittiert hatte? Er selbst begründete es damit, dass er in der Zwischenzeit ja sie kennengelernt habe, aber Charlotte hatte manchmal so ihre Zweifel. Vielleicht war es ja weniger sein Wunsch nach einem neuen Leben mit ihr gewesen, der seinen Entschluss forcierte, sondern vielmehr das Ende seines alten Lebens mit Charlie.
»Scheint so. Ich habe sicherheitshalber eine Krawatte für ihn dabei, falls er die hiesigen Bekleidungsvorschriften vergessen haben sollte.«
»Unmöglich, der war doch auf Sandhurst. Bestimmt poliert er sogar seinen Fischspeer, bevor er ihn wirft«, bemerkte sie trocken. Sie schwiegen einen Moment. Charlotte lauschte auf seinen Atem und das Trommeln seiner Füße auf dem Trottoir. Es war seine aufrechte, gerade Haltung, die ihr als Erstes an ihm aufgefallen war. Bei einem Mann, der der Welt mit stolz gereckter Brust entgegentrat, den scheinbar nichts umwarf, konnte man sich gut aufgehoben fühlen, schien ihr.
Hinter ihr drang sanfte Musik aus der Stereoanlage.
»Und wo bist du? Was heckst du aus?« Sie konnte das Stirnrunzeln in seiner Stimme hören.
»Relaxen in der Firmenwohnung. Bin gerade erst reingekommen.«
»Und wie ist sie? Anständig?«
»Ganz anständig, ja«, untertrieb sie, während hinter ihr die zarten champagnerfarbenen Voiles im Wind schaukelten und den Blick auf die minimalistische Armani-Möblierung freigaben.
»Gut. Und wie war’s heute?« Was er wirklich sagen wollte, war: Konntest du deine Geschäfte abschließen?
»Prima. Hab mich vormittags mit einer anderen Klientin getroffen und dann kurz in der Madrider Zweigstelle vorbeigeschaut, auf ein erstes Meeting. Die eigentliche Arbeit beginnt morgen.«
Sein missbilligendes Schnalzen drang durch den Hörer. »Solange du nur nicht vergisst, dass du bis Freitag wieder hier sein musst, Charlotte.«
Das Dinner fand zwar erst am Samstag statt, aber sie verzichtete auf einen diesbezüglichen Hinweis. Freitag war ihre Deadline, bis dahin wollte er sie wieder in London haben, egal wie. »Werde ich schon.«
»Was für ein verdammter Unsinn, dass sie dich ausgerechnet jetzt wegen irgendeines Projekts wegschicken müssen.«
»Ich werde schon rechtzeitig wieder hier sein, keine Sorge.« Ein verächtliches Schnauben seinerseits. Er war immer gereizt, wenn er allein zurechtkommen musste. »Was wirst du zum Abendbrot essen? Es ist noch etwas Lammbraten im Kühlschrank.«
»Ich werde erst mal sehen, was Charlie mit mir vorhat. Vielleicht gehen wir ja irgendwo essen. Könnte mir gut vorstellen, dass er nach dem ganzen Grünzeug in den Anden erst mal ein richtiges Steak braucht.«
Charlotte grinste. Ihr Verlobter gehörte noch zu jener Spezies Mann, für die eine ordentliche Fleischportion zur täglichen Mahlzeit gehörte und die für Vegetarier – geschweige denn Veganer – nur Verachtung übrighatten.
»Da ist der Club, ich muss Schluss machen. Du weißt ja, die haben’s da nicht so mit Handy und Co. Ich stelle jetzt auf stumm, du kannst mich also erst mal nicht mehr erreichen, es sei denn, es ist ein Notfall …«
»Schon gut, das macht nichts. Viel Spaß mit Charlie! Und füttere ihn gut! Wir telefonieren morgen.«
»Okay, dir auch viel Spaß. Cheerio.«
Cheerio. Sie musste immer schmunzeln, wenn er das sagte. Er hatte das von seiner Mutter, diese scheinbar unbekümmerte Fassade. »Hab dich lieb, mein Schatz.«
»Ja, ja, ich dich auch.«
Er legte auf. London verschwand, und Madrid trat wieder in den Vordergrund. Sie blieb noch ein paar Minuten lang sitzen und wippte mit den Zehen zum Takt der Musik, doch ihr Blick huschte rastlos hin und her, von einem Dach zum anderen, von der Straße zum Himmel, er haftete an ein paar Vögeln, dann wieder auf den Fußgängern, den Autos oder auf nichts Bestimmtem. Das war entspannend, oder nicht?
Wie um sich etwas zu beweisen, betrachtete sie den Sonnenuntergang noch ein wenig länger, aber dann hielt sie es nicht mehr aus und kehrte ins Apartment zurück. Es war makellos, bis auf das orangerote Einkaufsnetz, das sie achtlos auf den Tisch geworfen hatte. Sie hatte genug besorgt, um damit für heute Abend und morgen früh auszukommen: Kaffeepads, Milch, eine Flasche Rosé und eine Schachtel Cornflakes, die mehr Zucker als Flocken zu beinhalten schienen.
Sie war versucht, sich die Cornflakes zum Abendessen zu genehmigen. Stephen gegenüber hatte sie es nicht zugeben wollen – aber sie war noch sauer auf ihn und ihre Mutter, wegen ihres Gesprächs gestern Abend. Nun, es war ein langer, harter Tag gewesen. Nach der Begegnung mit Lucy Santos war sie direkt zur Bank gefahren, wo ihr Meeting mit der Rechtsabteilung ganze vier Stunden gedauert hatte. Es waren zwar in regelmäßigen Abständen Essen und Getränke hereingebracht worden, aber sie waren so in die Unterlagen vertieft gewesen, dass sie kaum die Köpfe gehoben, geschweige denn etwas zu sich genommen hatten. Es war unumgänglich, dass sie sich mit den Verhältnissen der Mendozas vertraut machte, mit ihren Geschäften, mit ihrer Vergangenheit und wie sie ihr Vermögen erworben hatten – wie sie zu der Dynastie geworden waren.
Marina Quincy. Hm. Ein ganz anderes Kaliber. Ein Niemand. Ein Einzeiler im Telefonbuch. Sie hatte selbst vorab eine kurze Internetrecherche vorgenommen, aber nichts über sie gefunden, weder auf Google noch auf Facebook oder auf Instagram – was ihr Interesse nur noch erhöhte. Der Name jedenfalls war bei ihr hängen geblieben, kein gewöhnlicher Name, irgendwie eigenartig.
Sie wandte den Kopf nach rechts, und ihr Blick fiel auf die Akte, die aus ihrer Mappe hervorragte. Rosie hatte sie ihr gemailt, kurz bevor sie für heute Feierabend gemacht hatte. Es war der vorläufige Untersuchungsbericht, den Mateo Mendoza in Auftrag gegeben hatte, um mehr über diese unbekannte Mätresse seines Vaters in Erfahrung zu bringen – wie sie jetzt allgemein bezeichnet wurde. Charlotte hatte sie wider besseres Wissen ausdrucken lassen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Dabei hatte sie doch jetzt frei, das war ihre Zeit. Es konnte bis morgen warten. Sie sollte sich ausruhen, sich in Gedanken mit der bevorstehenden Hochzeit beschäftigen. Entscheidungen treffen. Das mit den Knopflöchern und den Servietten stand noch aus. Rosie hatte recht – sie musste tatsächlich mal ausspannen, die Arbeit links liegen lassen und sich mit privaten Dingen beschäftigen.
Trotzdem ertappte sie sich dabei, wie sie nach der Akte griff und sich damit aufs Sofa kuschelte. Nur ein kurzer Blick …
Zuerst schaute sie sich die Fotos an. Marina Quincy war eine Schönheit von der Art, die Männern die Sprache verschlug und sie dazu veranlasste, ihr mit offenen Mündern nachzustarren, sogar im Beisein der eigenen Frau oder Freundin. Soweit Charlotte es auf den Fotos erkennen konnte, die wohl unweit des Cafés, in dem sie kellnerte, aufgenommen worden waren, war sie eine große, kantige, fast ein wenig maskulin wirkende Frau: Mit ihren großen Händen und Füßen war sie keine Femme fatale im herkömmlichen Sinne. Sie besaß kräftige Augenbrauen und einen eher dunklen Teint sowie ausgeprägte Wangenknochen. Ihr Haar war lang und fast schwarz, und sie trug es zu einem lockeren Haarknoten hochgesteckt, aus dem zahlreiche Strähnchen entkamen. Dicke Silberringe zierten beide Hände, und sie besaß ein winziges Tattoo an der Innenseite des linken Handgelenks, das eine Schwalbe im Flug darstellte. Ihre weiße Kellnerbluse spannte ein wenig über Brust und Schultern. Sie hatte ein Pflaster am kleinen Finger der linken Hand und an den Ohrläppchen zahlreiche Stecker und Ringe, die matt und beschlagen wirkten.
Nichts an ihr war geschliffen oder edel. Sie wirkte müde, erschöpft und überarbeitet. Trotzdem konnte man sehen, wie sie von den Männern angestarrt wurde, während sie mit gesenktem Blick ihrer Arbeit nachging und Teller abräumte. Ob sie sich ihrer Wirkung bewusst war? Oder war es ihr egal?
Charlotte bezweifelte es. Einen steinalten Mann wie Carlos Mendoza zu bezaubern war keine Kleinigkeit. So etwas klappte nur, wenn man sein Arsenal beherrschte.
Wie lange das mit den beiden wohl schon ging? Ein Blick ins Profil verriet, dass Marina fünfundvierzig war. Das konnte kein ganz neues Verhältnis sein, oder? Nicht in diesem Alter. Vielleicht hatten sie sich kennengelernt, als sie Anfang dreißig und er Mitte achtzig war? Nicht sehr plausibel, zugegeben, aber vielleicht war er in dem Alter ja noch überraschend viril gewesen? Ein Silberrücken? Charlotte war letztes Jahr auf einem Konzert der Rolling Stones in Twickenham gewesen, und der siebzigjährige Mick Jagger, der zwei Stunden lang über die Bühne tobte, war die reinste Offenbarung gewesen. Möglich war’s also, und es war ja allgemein bekannt, dass ein solches Vermögen, wie er es besaß, auf manche Frauen wie ein Aphrodisiakum wirkte.
Aber es war nicht nur der starke Altersunterschied, der ihr seltsam erschien. Auch die Tatsache, dass sie noch immer kellnerte … Sie mochten sich ja auf diese Weise kennengelernt haben, aber Charlotte hätte schon geglaubt, dass ein Mann wie er besser für seine Mätresse sorgte. Außer natürlich Marina bestand darauf, ihren Job, ihr altes Leben nicht aufzugeben? Aus Prinzip? Oder aus taktischen Gründen? Falls es das Letztere sein sollte, ergab sich die Frage: Wusste sie, was ihr Liebhaber ihr zugedacht hatte? Unermesslicher Reichtum und mehr Land, als ein Mensch brauchte?
Sie ging alles gründlich durch: Geboren und aufgewachsen in Madrid. Geschieden. Ihr Exmann, Miguel Hermoso, war Schreiner. Keine Kinder. Zwei Brüder, einer an Hodenkrebs verstorben. Drei Neffen und zwei Nichten. Mutter verstorben. Ihr Vater, Mechaniker, hatte wieder geheiratet und lebte in Bilbao. Zahlreiche eingleisige Jobs: in einem Waschsalon, als Zimmermädchen in einem Dreisternehotel, als Hundeausführerin, als Supermarktkassiererin. Aber … Aha, das hier war interessant: Sie hatte vor vier Jahren eine Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe gemacht.
Charlotte überlegte. Da musste sie einundvierzig gewesen sein – ziemlich spät, um noch eine Berufsausbildung zu beginnen. Warum die neue Richtung? Hatte Mendoza versucht, sie zu »bilden«, wie Professor Higgins es bei Eliza Doolittle angestrebt hatte? Aber wenn er derjenige war, der sie ermutigt und gefördert, der für die Kurse bezahlt hatte, warum kellnerte sie dann vier Jahre später noch immer in einem Touristencafé?
Sie stellte ihre Überlegungen erst einmal beiseite und kehrte zu dem Bericht zurück: Marina besaß eine Wohnung in einem heruntergekommenen Viertel der Stadt – kein Ghetto, aber auch nicht gerade nobel. Sie hatte Kreditkartenschulden in Höhe von 23 600 Euro und war im vergangenen Jahr immer wieder mit den Rückzahlungen in Verzug geraten.
Charlotte ließ die Papiere in den Schoß sinken und lehnte nachdenklich den Kopf zurück. Ihre Klientin war also eine geschiedene Schönheit, mit null Vermögen, finanziell insolvent und arbeitete in einem Gelegenheitsjob. Mit einer Verwandtschaft, die wahrscheinlich (aber nicht sicher) in ähnlichen Umständen steckte. Sie war unmanikürt und überarbeitet – was alles darauf hinwies, dass sie nicht von Mendozas Geld lebte. Aus den Bankauszügen ergab sich, dass sie keine regelmäßigen Zuwendungen oder auch nur eine einmalige Finanzspritze erhalten hatte.
Aber das war unsinnig. Wieso sonst sollte sie mit ihm zusammen sein? Eine Liebesgeschichte konnte es nicht sein, unmöglich. Der Mann war achtundneunzig! Er mochte in sie vernarrt sein, ihr Interesse allerdings konnte nur ein finanzielles sein: ein Arrangement, aus dem beide ihren Nutzen zogen. Und doch schien es offensichtlich, dass sie keinen Cent von ihm annahm.
Charlotte verfiel auf eine neue Theorie: Wenn Marina seine Hilfe ausschlug, wenn sie ihn zwang, tatenlos zuzusehen, wie sie sich tagtäglich abschuftete, in einer miesen kleinen Wohnung ohne Klimaanlage hauste … Sie nickte bedächtig. Ja, es wäre möglich, vielleicht war das das Spiel, das sie trieb … Bestimmt war es eine Folter für den vernarrten Mendoza – er war es gewohnt, mit Geld alle Probleme lösen, sich Wege ebnen, Menschen und Dinge kaufen zu können. Aber sie erlaubte ihm nicht, ihr »unter die Arme zu greifen«, sie zwang ihn zu einer größeren, einer kühneren Geste: Wenn er sie wirklich retten wollte, würde er ihr schon alles überschreiben müssen, was er besaß.
Es war immerhin eine Theorie.
Ihr Blick huschte zum Fenster: Madrid glühte goldrot im Glanz der untergehenden Sonne, die Gebäude wirkten wie in Feuer getaucht. Schatten huschten an den barocken Fassaden vorbei, hinter Fenstervorhängen regten sich Umrisse. Der Feierabendverkehr war zu einem fernen Rauschen verklungen. Das Weinglas in der Hand, entfernten sich ihre Gedanken von der Stadt und richteten sich auf zurückliegende Dinge, auf jemanden, den auch sie zu retten versucht hatte. Und jemand anderen, der wiederum versucht hatte, sie zu retten. Beide hatten sie versagt. Aber das Leben ging trotzdem weiter …
Sie erwachte und blickte sich stirnrunzelnd nach der Ursache dafür um. An ihrem Handy blinkte ein blaues Lämpchen und schickte hartnäckig einen Leuchtstrahl auf- und abblendend ins noch dunkle Schlafzimmer. Sie tastete danach und zuckte zusammen, als ihr das helle Display in die Augen stach: ein Anruf von Lucy Santos, einer von ihrer Mutter, einer von Stephen, von Milton, von ihrer Schwester. Wieso um alles in der Welt riefen sie sie in aller Herrgottsfrühe an? Was war da los? Und wie spät war es überhaupt?
Elf Uhr fünfund…
Elf Uhr fünfundzwanzig?