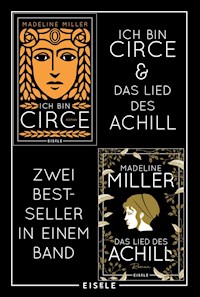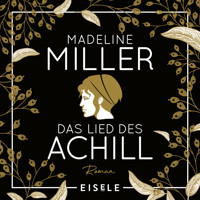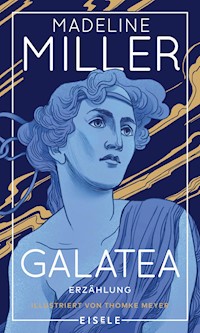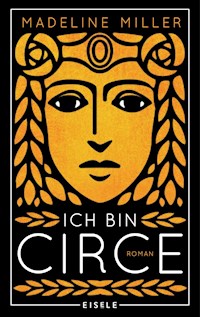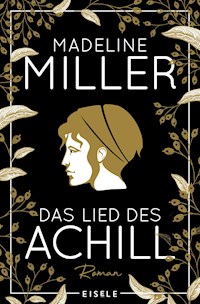
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Mythos Achill - Modern und fesselnd neu erzählt Das TikTok-Phänomen NEW-YORK-TIMES-BESTSELLER Achill, Sohn der Meeresgöttin Thetis und des König Peleus, ist stark, anmutig und schön – niemand, dem er begegnet, kann seinem Zauber widerstehen. Patroklos ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde. Ein Zufall führt die beiden schon als Kinder zusammen, und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto enger wird das Band zwischen ihnen. Nach ihrer Ausbildung in der Kriegs- und Heilkunst durch den Zentauren Chiron erfahren sie vom Raub der Helena. Alle Helden Griechenlands sind aufgerufen, gegen Troja in den Kampf zu ziehen, um die griechische Königin zurückzuerobern. Mit dem einzigen Ziel, ein ruhmreicher Krieger zu werden, nimmt Achill am Feldzug gegen die befestigte Stadt teil. Getrieben aus Sorge um seinen Freund, weicht Patroklos ihm nicht von der Seite. Noch ahnen beide nicht, dass das Schicksal ihre Liebe herausfordern und ihnen ein schreckliches Opfer abverlangen wird. VON DER AUTORIN DES BESTSELLERS "CIRCE" AUSGEZEICHNET MIT DEM ORANGE PRIZE FOR FICTION
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Achill, Sohn der Meeresgöttin Thetis und des König Peleus, ist stark, anmutig und schön – niemand, dem er begegnet, kann seinem Zauber widerstehen. Patroklos ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde. Ein Zufall führt die beiden schon als Kinder zusammen, und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto enger wird das Band zwischen ihnen. Nach ihrer Ausbildung in der Kriegs- und Heilkunst durch den Zentauren Chiron erfahren sie vom Raub der Helena. Alle Helden Griechenlands sind aufgerufen, gegen die Spartaner in den Kampf zu ziehen, um die griechische Königin zurückzuerobern. Mit dem einzigen Ziel, ein ruhmreicher Krieger zu werden, nimmt Achill am Feldzug gegen Troja teil. Getrieben aus Sorge um seinen Freund, weicht Patroklos ihm nicht von der Seite. Noch ahnen beide nicht, dass das Schicksal ihre Liebe herausfordern und ihnen ein schreckliches Opfer abverlangen wird.
Die Autorin
MADELINE MILLER, 1978 in Boston geboren, studierte Altphilologie und unterrichtete in Cambridge Latein und Griechisch. Für ihren Debütroman Das Lied des Achill wurde sie mit dem Orange Prize for Fiction ausgezeichnet; er wurde in 25 Sprachen übersetzt. In Ich bin Circe – ihr zweiter Roman und ebenso wie Das Lied des Achill
MADELINE MILLER
DAS LIED DES
ACHILL
ROMAN
AUS DEM AMERIKANISCHEN ENGLISCH
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
ISBN 978-3-96161-090-7
Die Originalausgabe »The Song of Achilles« erschien 2011 bei Ecco, an imprint of HarperCollins Publishers, New York.
© 2011 Madeline Miller
© 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
© der deutschen Übersetzung: Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2011
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: © shutterstock
Autorenfoto Innenklappe: © Stephanie Diani
E-Book:
ERSTES KAPITEL
MEIN VATER WAR EIN König und der Sohn von Königen. Er war wie die meisten von uns eher kleingewachsen, hatte eine bullige Statur und mächtige Schultern. Er heiratete meine Mutter, als sie vierzehn war und fruchtbar, wie die Priesterin versicherte. Eine gute Partie: Sie war das einzige Kind, und das Vermögen ihres Vaters würde an ihren Gatten übergehen.
Dass sie einfältig war, bemerkte er erst bei der Hochzeit. Ihr Vater hatte sorgsam darauf geachtet, dass sie bis zur feierlichen Trauung verschleiert blieb, und mein Vater war damit einverstanden gewesen. Falls sie hässlich sein sollte, gab es stets junge Sklavinnen und zu Diensten stehende Knaben. Als man ihr schließlich den Schleier abnahm, lächelte sie, und da wussten alle, dass sie einfältig war. Bräute lächelten nicht.
Als ich, ein Junge, zur Welt kam, nahm er mich aus ihren Armen und gab mich einer Amme, die meiner Mutter zum Trost ein Kissen reichte. Meine Mutter drückte es an sich. Den Austausch schien sie nicht bemerkt zu haben.
Ich wurde schnell zu einer Enttäuschung, war klein und schmächtig, weder kräftig noch flink und konnte auch nicht singen. Zu meinen Gunsten sprach eigentlich nur, dass ich nie kränkelte. Während andere Kinder immer wieder unter Erkältungen und Krämpfen litten, blieb ich davon verschont. Doch das machte meinen Vater argwöhnisch. War ich womöglich ein Wechselbalg, kein Mensch? Er beobachtete mich mit finsterer Miene. Unter seinem Blick fingen meine Hände zu zittern an. Meine Mutter indessen bekleckerte sich mit Wein.
Als ich fünf Jahre alt bin, ist mein Vater an der Reihe, die Spiele auszurichten. Von überall her kommen Männer, sogar aus Thessalien und Sparta, und unsere Kammern füllen sich mit ihrem Gold. Hundert Sklaven arbeiten zwanzig Tage, um die Laufstrecke einzuebnen und von Steinen zu befreien. Mein Vater ist entschlossen, die schönsten Spiele seiner Generation zu veranstalten.
Am meisten beeindruckt haben mich die Läufer, nussbraune, von Öl glänzende Athleten mit muskulösen Waden, die unter der Sonne ihre Glieder strecken, breitschultrige Ehemänner sind darunter, aber auch bartlose Burschen und Knaben.
Als Opfer wurde ein Bulle geschlachtet, sein Blut strömte in den Staub und in dunkle Bronzeschalen. Er starb lautlos, was ein gutes Omen für die Spiele war.
Die Läufer nehmen vor dem Podest Aufstellung, auf dem mein Vater und ich sitzen, umgeben von Preisen, die auf die Sieger warten: goldene Weinkelche, Dreifüße aus getriebener Bronze, Holzlanzen mit kostbaren Eisenspitzen. Der wichtigste Preis jedoch liegt in meinen Händen: ein Kranz aus staubgrünen, frisch gepflückten Blättern, die ich mit meinem Daumen zum Glänzen bringe. Mein Vater hat ihn mir nur widerwillig überlassen und mir eingeschärft, nichts weiter damit zu tun, als ihn zu halten.
Die Jungen gehen als Erste an den Start, noch heranwachsende Burschen, so mager, dass sich die Knochen unter der straffen Haut abzeichnen. Sie scharren mit den Füßen im Sand und warten auf das Zeichen des Priesters. Mein Blick bleibt an einem Jungen mit blonden Haaren hängen, der zwischen den dunklen, zerzausten Köpfen heraussticht. Ich beuge mich vor, um ihn besser zu sehen. In den Haaren des Jungen, die wie Honig leuchten, schimmert es golden – der Reif eines Prinzen.
Er ist kleiner als die anderen und noch mollig wie ein Kind. Seine langen Haare sind mit einem Lederriemen zusammengebunden und scheinen auf der dunklen Haut im Nacken zu brennen. Doch seine Miene ist entschlossen wie die eines Mannes.
Kaum hat der Priester das Startkommando gegeben, löst er sich aus der dichten Schar der älteren Jungen. Er läuft leichtfüßig, und seine Fersen schimmern rosig wie leckende Zungen. Er gewinnt.
Ich bewundere ihn sprachlos, als mein Vater mir den Kranz vom Schoß nimmt und ihm aufsetzt. Auf seinen hellen Haaren wirken die Blätter fast schwarz. Peleus, sein Vater, holt ihn ab, er lächelt stolz. Sein Königreich ist kleiner als unseres, doch sein Volk liebt ihn, und es heißt, dass seine Frau eine Göttin sei. Mein Vater betrachtet Peleus voller Neid, denn seine eigene Frau ist dumm und sein Sohn so langsam, dass er nicht einmal in der Gruppe der Jüngsten mithalten könnte. Er schaut mich an.
»So sollte ein Sohn sein.«
Ohne den Kranz fühlen sich meine Hände leer an. Vor meinen Augen umarmt König Peleus seinen Sohn. Ich sehe, wie der Junge den Kranz in die Luft wirft und wieder auffängt. Er lacht und strahlt vor Freude über seinen Triumph.
Ansonsten sind mir von meinem damaligen Leben nur ein paar einzelne Erinnerungen geblieben: mein Vater, wie er finster dreinblickend auf seinem Thron sitzt, mein geliebtes Spielzeugpferdchen oder meine Mutter am Strand, den Blick weit hinaus auf die Ägäis gerichtet. In dieser letzten Erinnerung werfe ich kleine Steine ins Wasser. Es scheint ihr zu gefallen, wie sich das Wasser zu Wellen aufwirft und dann wieder zu einer glatten Oberfläche wie Glas verströmt. Aber vielleicht liebt sie auch das Meer als solches. An ihrer Schläfe schimmert ein knochenweißer Fleck, eine Narbe, zurückgeblieben von einer Verletzung, die ihr damals der eigene Vater mit dem Heft eines Schwerts zugefügt hat. Sie hat die Füße im Sand vergraben, und nur die Zehen schauen daraus hervor; um sie nicht zu stören, suche ich leise nach flachen Steinen, die ich dann über das Wasser hüpfen lasse. Es freut mich, dass ich wenigstens darin gut bin. Diese Szene ist die einzige Erinnerung an meine Mutter, und weil sie so golden und verklärt erscheint, glaube ich fast, dass ich sie mir nur einbilde. Mein Vater hatte uns, seinen einfältigen Sohn und die noch einfältigere Mutter, wahrscheinlich ungern allein gelassen. Und wo sind wir da überhaupt? Ich erkenne den Strand und den Blick auf die Küste nicht wieder. Zu vieles hat sich in der Zwischenzeit ereignet.
ZWEITES KAPITEL
DER KÖNIG RIEF MICH zu sich. Ich weiß noch, wie sehr ich den weiten Weg durch den riesigen Thronsaal hasste. Vor dem Thron angekommen, kniete ich auf den Steinen nieder. Manche Könige hatten Teppiche ausgelegt, damit die Sendboten, die oft mit ausführlichen Nachrichten aufwarteten, ihre Knie schonen konnten. Mein Vater verzichtete darauf.
»Die Tochter von König Tyndareos ist endlich bereit zu heiraten«, sagte er.
Ich kannte den Namen. Tyndareos war König von Sparta und besaß große Gebiete im Süden, fruchtbares Land von der Beschaffenheit, wie sie mein Vater durchaus begehrte. Ich hatte auch von seiner Tochter gehört, der schönsten Frau weit und breit, wie es hieß. Von ihrer Mutter Leda erzählte man sich, dass sie von Zeus, dem Götterkönig, in Gestalt eines Schwans überwältigt worden sei. Neun Monate später brachte sie zwei Zwillingspaare zur Welt: Klytämnestra und Kastor, die Kinder ihres sterblichen Gatten, sowie Helena und Polydeukes, die strahlenden Nachkommen des Schwanengottes. Da die Götter aber bekanntlich schlechte Eltern waren, erwartete man, dass sich Tyndareos ihrer aller annahm.
Die Nachricht meines Vaters ließ mich ungerührt. Solche Dinge bedeuteten mir nichts.
Mein Vater räusperte sich, was im stillen Saal überraschend laut klang. »Es wäre für uns gut, sie in der Familie zu haben. Du wirst losziehen und um sie werben.« Wir waren allein, und so hörte nur er mein unwilliges Schnauben. Ich hütete mich jedoch, mein Unbehagen offen auszusprechen. Mein Vater wusste natürlich, was mir als Einwand auf der Zunge lag, nämlich dass ich erst neun war, wenig ansehnlich, ohne große Aussichten und uninteressant.
Am nächsten Morgen brachen wir schwer beladen mit Geschenken und Wegzehrung auf. Soldaten in prächtiger Rüstung begleiteten uns. An die Reise erinnere ich mich kaum. Wir zogen über Land und durch Gegenden, die keinen bleibenden Eindruck auf mich hinterließen. An der Spitze des Zuges diktierte mein Vater neue Befehle, und seine Boten ritten in alle Richtungen davon. Ich blickte auf meine Zügel und polierte das Leder mit dem Daumen. Ich kam mir verloren vor und verstand nicht, was mein Vater vorhatte. Mein Esel schwankte, und ich schwankte mit ihm, froh über jede Ablenkung.
Wir waren nicht die einzigen Bewerber, die an Tyndareos’ Hof erschienen. In den Ställen drängten sich Pferde und Esel, zwischen ihnen Sklaven, die sich um die Tiere kümmerten. Mein Vater schien ungehalten über das Protokoll zu sein. Er fuhr immer wieder mit der Hand über den Kaminsims in unserer Kammer und runzelte die Stirn. Ich hatte von zu Hause ein Spielzeug mitgebracht, ein kleines Ross mit beweglichen Beinen. Ich hob mal den einen, mal den anderen Huf und stellte mir vor, auf solch einem Pferd hergeritten zu sein, statt auf einem Esel. Die Tage vergingen, und wir aßen in unserer Kammer. Ein Soldat hatte Mitleid und lieh mir seine Würfel, die ich so oft über den Steinboden rollen ließ, bis mir irgendwann alle Sechse auf einen Wurf gelangen.
Endlich kam der Tag, an dem mich mein Vater baden und kämmen ließ. Doch die Tunika, die ich anzog, gefiel ihm nicht, und ich musste mich umkleiden. Ich gehorchte, obwohl ich keinen Unterschied sah zwischen dem gold-violetten und dem mit Goldfäden durchwirkten purpurnen Gewand. Weder das eine noch das andere bedeckte meine knochigen Knie. Mein Vater sah mächtig und streng aus mit seinem schwarzen Bart. Das Geschenk für Tyndareos stand bereit, eine goldene Schale, in die die Geschichte der Prinzessin Danaë eingeprägt war. Zeus hatte sich in einen Goldregen verwandelt und sie verführt, worauf sie Perseus gebar, den Bezwinger der Gorgone Medusa und nach Herakles unser zweitgrößter Held. Mein Vater gab mir die Schale. »Mach uns keine Schande«, sagte er.
Schon von weitem war der Lärm zu hören, der aus dem großen Saal schallte. Zahllose Stimmen und das Klirren von Kelchen und Rüstzeug hallten von den Wänden wider. Um den Lärm zu dämpfen, hatten die Sklaven die Fenster geöffnet und den Raum mit kostbaren Wandteppichen ausgekleidet. Ich hatte noch nie so viele Männer in einem Raum gesehen. Nein, nicht bloß Männer, Könige.
Wir wurden nach vorn gerufen, um Rat zu halten, und nahmen auf Bänken Platz, die mit Kuhhäuten bezogen waren. Die Diener wichen in den Schatten der Winkel zurück. Mein Vater hielt mich am Kragen gepackt, damit ich nicht zappelte.
Unter so vielen Prinzen und Helden und Königen, die alle dasselbe wollten, herrschte eine feindselige Stimmung, aber wir wussten uns zu benehmen. Einer nach dem anderen stellte sich vor, junge Männer mit glänzenden Haaren, von edler Statur und kostbar gekleidet. Viele waren Söhne oder Enkel von Göttern, und alle sangen ein oder zwei oder noch mehr Lieder, die von ihren großen Taten erzählten. Tyndareos begrüßte sie alle und nahm ihre Geschenke entgegen, die in der Mitte des Saals aufgehäuft wurden. Einen nach dem anderen forderte er auf, zu sprechen und sein Anliegen vorzutragen.
Mein Vater war der Älteste, abgesehen von jenem Mann, der sich, als er an die Reihe kam, Philoktetes nannte. »Ein Gefährte des Herakles«, flüsterte uns der Mann zu, der neben uns saß, und ich war sehr beeindruckt. Herakles war unser größter Held und Philoktetes sein engster Freund, der einzige, der noch lebte. Er hatte graue Haare und große sehnige Hände, die ihn als Bogenschützen verrieten. Und tatsächlich hob er wenig später den größten Bogen in die Höhe, der mir je zu Gesicht gekommen war, eine Waffe aus dem polierten Holz einer Eibe und am Griff mit Löwenhaut umwickelt. »Der Bogen des Herakles«, erklärte Philoktetes. »Er gab ihn mir, als er starb.« In unserer Gegend wurden Bögen verspottet als Waffen für Feiglinge. Aber das mochte über diesen Bogen niemand sagen. Keiner hätte die Kraft gehabt, ihn zu spannen.
Der nächste Bewerber, der zu Wort kam, hatte seine Augen wie eine Frau bemalt. »Idomeneus, König von Kreta«, stellte er sich vor. Er war schlank, und seine Haare reichten ihm bis zur Hüfte. Als Geschenk präsentierte er ein seltenes Eisen, eine Doppelaxt. »Das Symbol meines Volkes.« Seine Bewegungen erinnerten mich an die der Tänzer, die meine Mutter so liebte.
Und dann war da Menelaos, Sohn des Atreus. Er saß neben seinem Bruder Agamemnon, einem Bären von Mann. Menelaos hatte erstaunlich rote Haare, von einer Farbe wie glühende Bronze. Er war kräftig, muskelbepackt und sehr agil. Als Geschenk überreichte er ein kostbares, wunderschön gefärbtes Tuch. »Obwohl die Jungfer keine solche Zierde nötig hat«, fügte er lächelnd hinzu. Ein hübsches Kompliment. Ich wünschte, einen ähnlich gescheiten Satz vortragen zu können, war ich doch nur einer von zwanzig Bewerbern und leider nun einmal kein Gotteskind. Allenfalls der blonde Sohn des Peleus wäre ihm vielleicht ebenbürtig gewesen, doch den hatte sein Vater zu Hause gelassen.
Freier um Freier gab sich die Ehre, und ihre Namen schwirrten mir durch den Kopf. Meine Aufmerksamkeit wanderte in Richtung Podest, auf dem neben Tyndareos drei verschleierte Frauen saßen. Ich starrte auf die weißen Tücher, die ihre Gesichter verhüllten, als könnte es mir vielleicht gelingen, einen Blick von ihnen zu erhaschen. Mein Vater wollte, dass ich eine dieser Frauen zur Gemahlin nehme. Ihre Hände lagen, mit Armreifen reich geschmückt, ruhig in ihren Schößen. Eine Frau war größer als die beiden anderen. Ich glaubte, eine dunkle Locke unter dem Rand des Schleiers wahrnehmen zu können. Ich erinnerte mich jedoch, dass Helena helles Haar hatte. Sie also war es nicht. Den Königen hörte ich schon nicht mehr zu.
»Willkommen, Menoitios.« Den Namen meines Vaters zu hören, schreckte mich auf. Tyndareos schaute uns an. »Es tut mir leid, erfahren zu müssen, dass deine Frau gestorben ist.«
»Meine Frau lebt, Tyndareos. Es ist mein Sohn, der gekommen ist, um deine Tochter zur Frau zu nehmen.« Es wurde still in der Halle. Ich ging in die Knie und sah mich den Blicken aller Anwesenden ausgesetzt, was mir Schwindel bereitete.
»Dein Sohn ist noch kein Mann.« Es schien mir, als spräche Tyndareos aus weiter Ferne. Ich konnte seiner Stimme nichts entnehmen.
»Das muss er auch nicht sein. Ich bin Manns genug für uns beide.« Unsereins liebte solche Scherze, keck und prahlerisch vorgetragen. Doch hier lachte niemand.
»Verstehe«, entgegnete Tyndareos.
Meine Knie schmerzten auf dem harten Steinboden, doch ich rührte mich nicht. Ich war daran gewöhnt, und zum ersten Mal war ich froh darüber.
Mein Vater sprach in die Stille hinein: »Andere haben Bronze und Wein, Öl und Wolle mitgebracht. Ich aber bringe Gold, und dies ist nur ein kleiner Teil meiner Schätze.« Ich hielt die goldene Schale in der Hand und spürte die Gestalten der Geschichte unter den Fingern: den Göttervater Zeus, herabsteigend als Goldregen, die erschrockene Prinzessin, die Zusammenkunft der beiden.
»Meine Tochter und ich sind dankbar für ein solch kostbares Geschenk, auch wenn es anscheinend nur ein kleines ist.« Unter den Königen wurde ein Raunen laut. Mein Vater schien nicht zu verstehen, wie demütigend seine Worte wirken mussten. Ich aber errötete.
»Ich will Helena zur Königin meines Palasts machen. Wie du weißt, ist meine Frau nicht imstande zu herrschen. Ich bin reicher als alle, die hier anwesend sind, und meine Taten sprechen für sich.«
»Ich dachte, dein Sohn bewirbt sich um die Braut.«
Die neue Stimme ließ mich aufblicken. Sie gehörte einem Mann, der noch nichts gesagt hatte und in entspannter Haltung am Ende der langen Bank saß. Seine lockigen Haare leuchteten im Feuerschein. Er hatte eine auffällige Narbe am Unterschenkel, die sich als helle, krumme Spur auf der dunklen Haut seiner muskulösen Wade abzeichnete und von der Ferse bis unter den Saum des Schurzes reichte. Sie rührte wohl, wie ich vermutete, von einer schartigen Klinge her, einem Gewaltakt, über den die zarten, weichen Ränder jetzt hinwegtäuschten.
Mein Vater reagierte verärgert. »Sohn des Laertes, ich erinnere mich nicht, dir das Wort erteilt zu haben.«
Der Mann lächelte. »Wohl wahr, ich habe mir selbst das Wort erteilt. Aber keine Sorge, ich werde dir nicht in die Quere kommen. Ich bin nur als Beobachter hier.« Eine kleine Bewegung führte meinen Blick zurück auf das Podest. Eine der verschleierten Gestalten hatte sich gerührt.
»Was soll das heißen?« Mein Vater runzelte die Stirn. »Wenn nicht wegen Helena, weswegen ist er dann gekommen? Soll er doch zu seinen Felsen und Ziegen zurückkehren.«
Der Mann zog die Brauen in die Stirn, sagte aber nichts.
Auch Tyndareos blieb gelassen. »Wenn sich, wie du sagst, dein Sohn um meine Tochter bewirbt, so lass ihn doch für sich sprechen.«
Selbst mir war bewusst, dass ich mich nun vorzustellen hatte. »Ich bin Patroklos, Sohn des Menoitios.« Weil ich lange nichts gesagt hatte, klang meine Stimme rau und holprig. »Ich möchte Helena zur Frau nehmen. Mein Vater ist König und der Sohn von Königen.« Mehr wusste ich nicht vorzutragen. Mein Vater hatte mich nicht vorbereitet und wohl auch nicht damit gerechnet, dass Tyndareos mich zu reden auffordern würde. Ich stand auf, trug die Schale zu den anderen Geschenken und legte sie vorsichtig ab. Anschließend kehrte ich auf meinen Platz auf der Bank zurück, erleichtert darüber, weder gezittert zu haben noch gestolpert zu sein, und ich hatte mich auch nicht mit meinen Worten zum Narren gemacht. Dennoch brannte mein Gesicht vor Verlegenheit. Ich ahnte, was diese Männer von mir hielten.
Doch mein peinlicher Auftritt schien schon bald vergessen zu sein. Als nächster Bewerber ging ein riesiger Mann auf die Knie, um einiges größer und breiter als mein Vater. Hinter ihm hatten zwei Sklaven einen gewaltigen Schild aufgerichtet, der anscheinend zu seiner Ausstattung gehörte und von den Füßen bis zur Krone reichte. Ein normaler Sterblicher hätte ihn unmöglich allein tragen können. Und ein Schmuckstück war es nicht. Tiefe Kerben und Einschnitte zeugten von seinem Einsatz im Kampf. Der Riese stellte sich als Ajax vor, Sohn des Telamon. Er sprach mit einfachen, schnörkellosen Worten, behauptete, in direkter Linie von Zeus abzustammen, und stellte seine mächtige Statur als Beweis dafür heraus, dass er immer noch in der Gunst seines Urgroßvaters stand. Er brachte einen Speer mit wunderschönem Schnitzwerk als Geschenk dar. Die geschmiedete Spitze glomm im Licht der Fackeln.
Als Letzter kam der Mann mit der Narbe an die Reihe. »Nun, Sohn des Laertes?« Tyndareos wandte ihm sein Gesicht zu. »Was sagt ein unbeteiligter Beobachter zu diesen Vorgängen?«
Der Angesprochene lehnte sich zurück. »Ich frage mich, wie du die Verlierer der Brautwerbung davon abhalten wirst, dir den Krieg zu erklären. Oder Helenas glücklichem Gatten. Ich sehe hier ein halbes Dutzend Männer, die sich am liebsten gegenseitig an die Gurgel springen würden.«
»Das scheint dich zu amüsieren.«
Der Mann zuckte mit den Achseln. »Ja, ich finde närrische Männer komisch.«
»Der Sohn des Laertes macht sich über uns lustig«, schimpfte Ajax, der Riese, und ballte eine Faust, die so groß war wie mein Kopf.
»Oh nein, Sohn des Telamon, niemals.«
»Was dann, Odysseus? Erklär dich, und sei es nur dieses eine Mal.« Tyndareos schlug einen scharfen Ton an.
Wieder zuckte Odysseus mit den Achseln. »Du treibst ein gefährliches Spiel mit diesen Männern. Ein jeder von ihnen ist voller Stolz und nähme es dir übel, wenn er abgewiesen würde.«
»All das hast du mir bereits unter vier Augen gesagt.«
Mein Vater fuhr zusammen. Verschwörung. Nicht nur er schien verärgert zu sein.
»Das ist wahr, nun aber biete ich dir einen Vorschlag zur Güte an.« Er hob die leeren Hände. »Ich habe kein Geschenk mitgebracht und will auch nicht um Helena werben. Wie schon gesagt wurde, ich bin nur ein König über Felsen und Ziegen. Als Gegenleistung für meinen Vorschlag erbitte ich nur den Preis, den ich bereits genannt habe.«
»Du sollst ihn haben im Austausch für deinen Vorschlag.« Wieder war eine flüchtige Bewegung auf dem Podest wahrzunehmen. Eine der Frauen berührte das Kleid der anderen.
»So höre. Ich finde, wir sollten Helena entscheiden lassen.« Odysseus legte eine Pause ein, weil Unmutsäußerungen laut wurden. Frauen hatten in solchen Dingen nicht mitzubestimmen. »Niemand wird es dir je verübeln können. Aber sie muss sich jetzt entscheiden, hier und heute, damit man ihr nicht nachsagen kann, sie habe sich mit dir beraten oder gar von dir beeinflussen lassen. Und …« Er streckte einen Finger in die Höhe. »Bevor sie ihre Entscheidung trifft, sollte jeder, der hier anwesend ist, einen Eid leisten und schwören, dass er Helenas Wahl anerkennt und ihren zukünftigen Gatten gegen alle verteidigt, die sie ihm streitig machen.«
Ich spürte die Unruhe in der Halle. Ein Schwur? In einer so unkonventionellen Angelegenheit wie die selbstbestimmte Gattenwahl einer Frau? Die Männer reagierten mit unverhohlenem Argwohn.
»Nun denn.« Tyndareos wandte sich den verschleierten Frauen zu. Er verriet mit keiner Miene, was er dachte. »Helena, nimmst du diesen Vorschlag an?«
Ihre Stimme klang wunderschön, war zwar leise, aber füllte dennoch den Raum. »Ich bin einverstanden.« Mehr sagte sie nicht, doch es reichte, um die Männer um mich herum zu berauschen. Selbst als Kind, das ich noch war, spürte ich die Macht, die von dieser Frau ausging. Ich erinnerte mich an Gerüchte, wonach ihre Haut vergoldet sei und ihre Augen wie Obsidiane leuchteten, jene schwarzen, gläsernen Steine, gegen die wir unsere Oliven tauschten. In diesem Moment war sie all die Preise wert, die in der Mitte der Halle aufgehäuft waren. Mehr noch, sie war unser aller Leben wert.
Tyndareos nickte. »Also ordne ich es an. Wer zu schwören bereit ist, möge es nun tun.«
Ich hörte Gemurmel und ein paar ärgerliche Stimmen. Doch niemand verließ die Halle. Helena, deren Schleier sich durch ihren Atem bauschte, hielt uns alle in ihrem Bann gefangen.
Ein eilends herbeigerufener Priester führte eine weiße Ziege zum Altar. Hier in der Halle war ein solches Opfertier verheißungsvoller als ein Bulle, dessen Blut den gesamten Steinboden überspült hätte. Die Ziege starb ohne großes Klagen, worauf der Priester in einer Schale das Blut mit der Zypressenasche aus dem Kamin vermengte. Es war so still im Raum, dass alle hörten, wie es in der Schale zischte.
»Sei du der Erste.« Tyndareos zeigte auf Odysseus. Selbst als Neunjähriger erkannte ich, wie passend diese Aufforderung war. Odysseus hatte sich als besonders schlau erwiesen. Bündnisse unter Fürsten und Königen hatten nur dann Bestand, wenn keinem Einzelnen erlaubt wurde, mächtiger zu sein als die anderen. Ich sah, dass manche gehässig grinsten. Odysseus würde sich dem jetzt nicht entziehen können.
Er verzog den Mund zu einem angedeuteten Schmunzeln. »Natürlich. Mit Vergnügen.« Letzteres glaubte ich ihm nicht. Als die Ziege geopfert worden war, hatte ich bemerkt, dass er sich an den Rand lehnte, um in den Hintergrund zu treten. Nun stand er auf und trat vor den Altar.
Er streckte dem Priester seine Arme entgegen und sagte: »Helena, vergiss nicht, dass ich diesen Eid als dein Gefolgsmann leiste und nicht als Freier. Du würdest dir nie verzeihen, mich auserwählt zu haben.« Seine Worte erregten Heiterkeit unter den Männern. Wir alle wussten, dass es einer so strahlenden Frau wie Helena niemals einfallen würde, den König von Ithaka, diesem dürren und kargen Landstrich, zum Mann zu nehmen.
Der Priester rief einen nach dem anderen zur Feuerstelle und markierte ein Handgelenk mit Blut und Asche als Zeichen des Gelübdes. Auch ich sprach den Eid, als ich an die Reihe kam, und hob den Arm, damit alle das Zeichen sehen konnten.
Als schließlich der Letzte auf seinen Platz zurückgekehrt war, stand Tyndareos auf. »Triff nun deine Wahl, meine Tochter.«
»Menelaos«, sagte sie, ohne zu zögern, was uns alle verblüffte. Wir hatten mit einer spannenderen Entscheidung gerechnet und erwartet, dass sie sich Zeit lassen würde. Ich schaute den rothaarigen Mann an, der nun aufstand und übers ganze Gesicht grinste. Überglücklich, wie es schien, gab er seinem schweigenden Bruder einen Klaps auf den Rücken. Alle anderen zeigten sich wütend, enttäuscht oder gar betrübt. Aber keiner griff nach seinem Schwert. Das Blut auf den Handgelenken war getrocknet.
»So möge es geschehen.« Auch Tyndareos hatte sich von seinem Thron erhoben. »Und dein ehrenwerter Bruder Agamemnon soll ebenfalls nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehren.« Er zeigte auf die größere der Frauen. »Klytämnestra, meine andere Tochter, sei seine Braut.« Die Frau, nach wie vor verschleiert, rührte sich nicht. Ich fragte mich, ob sie die Worte ihres Vaters gehört hatte.
»Was ist mit dem dritten Mädchen?« Die Frage, laut in die Halle hinausgerufen, kam von einem kleinen Mann, der neben dem Riesen Ajax stand. »Deine Nichte. Kann ich sie haben?«
Die Männer lachten, erleichtert darüber, dass sich die Anspannung löste.
»Du kommst zu spät, Teukros«, sagte Odysseus über das allgemeine Gelächter hinweg. »Sie ist bereits mir versprochen.«
Mehr konnte ich nicht hören. Mein Vater zerrte mich von der Bank. »Wir haben hier nichts mehr verloren.« Noch in derselben Nacht machten wir uns auf den Heimweg. Ich bestieg meinen Esel, enttäuscht und voller Bedauern, die sagenhaft schöne Helena nicht einmal zu Gesicht bekommen zu haben.
Mein Vater kam auf diese Reise nie mehr zu sprechen, und in meiner Erinnerung nahmen die Ereignisse von damals eine sonderbare Färbung an. Das Blut des Opfertiers, der Raum voller Könige – all das erschien mir fern und blass, fast so, als hätte ich es nicht selbst erlebt, sondern nur von einem Sänger vorgetragen gehört. War ich tatsächlich vor Tyndareos auf die Knie gegangen? Und was hatte es mit diesem Schwur auf sich? Allein daran zu denken erschien mir abwegig, töricht und so unwirklich wie ein Traum.
DRITTES KAPITEL
ICH WAR AUF DEM Feld und hielt zwei Würfel in der Hand, ein Geschenk. Nicht von meinem Vater, der an so etwas nie gedacht hätte. Auch nicht von meiner Mutter, die mich manchmal nicht erkannte. Ich weiß selbst nicht mehr, wer sie mir gab. Ein König, der bei uns zu Besuch gewesen war? Ein Höfling, der sich einzuschmeicheln versucht hatte?
Die Würfel waren aus Elfenbein geschnitzt und mit kleinen Onyx-Einlagen versehen, vollkommen glatt unter meinem Daumen. Es war Spätsommer, und ich rang, außer Atem nach dem schnellen Lauf hinaus aus dem Palast, nach Luft. Seit dem Wettkampf damals hatte man mir einen Mann zur Seite gestellt, der mich in unseren athletischen Disziplinen unterrichten sollte: Boxen, Schwert- und Speerkampf, Diskus. Aber ich war vor ihm davongelaufen und wie benommen vor Freude darüber, seit Wochen endlich einmal wieder allein sein zu können.
Plötzlich tauchte dieser Junge auf. Er hieß Kleitonymos und war der Sohn eines Edelmanns, der häufig in unserem Palast zu Gast war. Er war älter und größer als ich und unangenehm stämmig. Offenbar hatte er es auf die Würfel in meiner Hand abgesehen, denn er streckte seine Hand aus und sagte: »Lass mal sehen.«
»Nein.« Ich wollte nicht, dass er sie mit seinen schmutzigen Fingern begrabschte. Ich war zwar kleiner, aber immerhin ein Prinz. Hatte ich nicht das Recht, nein zu sagen? Allerdings waren diese Söhne von Edelmännern daran gewöhnt, alles von mir verlangen zu können, was sie wollten. Sie wussten, dass mein Vater nie einschreiten würde.
»Gib her!« Er machte sich nicht einmal die Mühe, mir zu drohen. Dafür hasste ich ihn. Mir zu drohen wäre das Wenigste gewesen, was ich an Respekt verlangen durfte.
»Nein.«
Er trat auf mich zu. »Ich will sie haben.«
»Sie gehören mir.« Ich zeigte ihm die Zähne wie Hunde, die um das kämpften, was vom Tisch zu Boden fällt.
Er streckte die Hand aus, doch ich stieß ihn zurück. Er stolperte, worüber ich mich freute. Ich würde ihm nicht geben, was mir gehörte.
»He!«, brüllte er wütend. Ich war so klein, und viele hielten mich für dumm. Es wäre eine Schmach für ihn, wenn er sich von mir abweisen ließe. Hochrot im Gesicht griff er an. Ich wich unwillkürlich zurück.
Er grinste. »Feigling.«
»Ich bin kein Feigling«, rief ich laut. Mir wurde ganz heiß.
»Dein Vater hält dich aber für einen.« Er wählte seine Worte mit Bedacht und schien sie zu genießen. »Ich habe gehört, wie er sich vor meinem Vater über dich beklagt hat.«
»Hat er nicht«, entgegnete ich, obwohl ich wusste, dass es doch so war.
Der Junge hob die Faust. »Nennst du mich einen Lügner?« Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass er zuschlagen würde. Er wartete nur noch auf einen Vorwand. Ich konnte mir vorstellen, wie mein Vater dieses Wort ausgesprochen hatte. Feigling. Ich stemmte dem Jungen beide Hände gegen die Brust und stieß ihn so fest, wie ich nur konnte, von mir. Unser Land bestand aus Wiesen und Getreidefeldern. Hinfallen tat nicht weh.
Nun, um ehrlich zu sein, gab es auch jede Menge Steine.
Er schlug heftig mit dem Kopf auf, und ich sah, wie er vor Schreck die Augen aufriss. Um seinen Kopf herum breitete sich eine Blutlache aus.
Vor lauter Entsetzen über das, was ich getan hatte, schnürte sich mir die Kehle zu. Ich hatte nie zuvor einen Menschen sterben sehen. Bullen, ja, und Ziegen, nicht zuletzt auch Fische in ihrem zappelnden Todeskampf. Auch auf Gemälden hatte ich es gesehen, auf Wandteppichen und unserem Geschirr, in das solche Szenen von Mord und Totschlag unter schwarzen Gestalten eingebrannt waren. Aber das war mir noch nie zu Gesicht oder zu Ohren gekommen: dieses Gliederzucken und Röcheln. Und dann dieser Gestank des blutigen Ausflusses! Ich ergriff die Flucht.
Irgendwann später fanden sie mich vor den knorrigen Wurzeln eines Olivenbaums. Ich lag, schlaff und bleich, in meinem eigenen Erbrochenen. Die Würfel waren verschwunden, verloren auf der Flucht. Mein Vater musterte mich mit wütendem Blick. Die grimmige Miene ließ seine gelb gewordenen Zähne zum Vorschein kommen. Auf sein Zeichen hin trugen mich die Diener nach Hause.
Die Familie des Jungen verlangte meinen Tod oder meine Verbannung. Sie war mächtig und der Verstorbene ihr ältester Sohn. Ein Prinz mochte unbehelligt ihre Felder niederbrennen oder eine ihrer Töchter missbrauchen, solange Schadensersatz geleistet wurde. Doch die Söhne eines Mannes galten als unantastbar. Für sie würde ein Edelmann Krieg führen. Wir alle kannten die Regeln und hielten daran fest, um das Schlimmste zu vermeiden, das uns ständig bedrohte. Blutfehde. Die Diener machten das Zeichen zur Abwehr des Bösen.
Mein Vater hatte sich zeit seines Lebens für den Erhalt seines Königreichs eingesetzt, und das wollte er nun nicht wegen eines solchen Sohns wie mich verlieren, zumal es ihm ein Leichtes sein würde, mit irgendeiner Sklavin andere Erben zu zeugen. Also willigte er ein: Ich sollte ins Exil geschickt und am Hof eines anderen Königs für den Preis von Gold, aufgewogen mit meinem Gewicht, zum Mann erzogen werden. Ich würde keine Eltern haben, keinen Familiennamen, kein Erbe. In unseren Tagen wäre es besser zu sterben. Aber mein Vater dachte praktisch. Mein Gewicht an Gold kostete ihn weniger als eine aufwändige Bestattung, die in meinem Fall nötig gewesen wäre.
So wurde ich im Alter von zehn Jahren zum Waisenkind. So kam ich nach Phthia.
Phthia war das kleinste unserer Länder, ein winziger Fleck nur, im Norden zwischen der Meeresküste und den Gipfelgraden des Othrys-Gebirges gelegen. Sein König Peleus war ein Liebling der Götter, selbst zwar nicht göttlich, aber klug, tapfer, stattlich und an Frömmigkeit allen Männern seines Standes überlegen. Und weil sie ihm günstig gesinnt waren, gaben ihm die Götter eine Nymphe zur Frau, womit ihm die größtmögliche Ehre zuteilwurde. Denn welcher Sterbliche würde nicht einer Göttin beiwohnen und einen Sohn mit ihr zeugen wollen? Göttliches Blut läuterte unser irdenes Geschlecht und brachte aus Staub und Lehm Helden hervor. Und mit dieser Göttin verband sich ein noch größeres Versprechen: Die Moiren hatten geweissagt, ihr Sohn werde den Vater bei weitem übertreffen. Sein Stamm wäre gesichert. Doch wie alle Geschenke der Götter hatte auch dieses einen Haken. Die Göttin selbst widersetzte sich.
Jeder, sogar ich, kannte die Geschichte von Thetis’ Verführung. Die Götter hatten Peleus an einen heimlichen Ort geführt, zu einer Meeresbucht, in der sie sich gern aufhielt. Sie hatten ihn gewarnt, er solle keine Zeit mit Aufwartungen verschwenden – sie würde sich nie freiwillig mit einem Sterblichen einlassen.
Sie hatten ihn außerdem auf das vorbereitet, was er zu erwarten hatte. Die Nymphe Thetis war ähnlich gerissen wie ihr Vater Proteus, jener wandlungsfähige Gott des Meeres, und wusste auf vielfältigste Art und Weise Gestalt anzunehmen, ob in einem Kleid aus Schuppen, Tierhäuten oder Federn. Und sie würde sich mit Schnäbeln, Klauen und Zähnen, mit Schlingen und Stachelschwänzen zur Wehr setzen, doch Peleus dürfe nicht von ihr ablassen.
Peleus war ein frommer und gehorsamer Mann. Er tat, wozu ihm die Götter rieten, und wartete darauf, dass sie den schiefergrauen Wellen entstieg mit ihren schwarzen Haaren, die so lang waren wie ein Pferdeschweif. Da ergriff er sie und hielt sie gepackt, obwohl sie sich heftig wehrte, und sie rangen miteinander, bis beide erschöpft und geschunden im Sand lagen. Das Blut aus den Wunden, die sie ihm zugefügt hatte, vermischte sich mit der Schmiere ihrer verlorenen Jungfräulichkeit auf den Schenkeln. Sie hatte sich ihm vergeblich widersetzt, denn eine Entjungferung war so bindend wie ein Ehegelöbnis.
Die Götter verlangten von ihr, dass sie mindestens ein Jahr lang bei ihrem sterblichen Gatten bleiben sollte, und sie diente ihre Zeit auf Erden ab, wie es ihre Pflicht war, wenngleich schweigend und mürrisch. Wenn er ihr nun nahe kam, ließ sie ihn gewähren und wehrte sich nicht, lag stattdessen nur da, kalt wie ein Fisch. Ihr widerwilliger Schoß empfing nur ein einziges Kind, und kaum war die Frist verstrichen, floh sie aus dem Palast und verschwand im Meer.
Wenn sie zurückkehrte, so nur aus dem einzigen Grund, ihren Sohn zu sehen, doch sie blieb nie lange. Das Kind wurde von Ammen und Hauslehrern erzogen und unter die Aufsicht von Phoinix gestellt, dem getreuesten Berater Peleus’. Ob Peleus jemals bereute, von den Göttern beschenkt worden zu sein? Eine gewöhnliche Frau hätte sich an der Seite eines so milden und freundlich lächelnden Gatten wie Peleus glücklich schätzen können, doch der Meeresgöttin Thetis war er in seiner Sterblichkeit und Mittelmäßigkeit nur ein Gräuel gewesen.
Ein Diener führte mich durch den Palast. Seinen Namen hatte ich nicht verstanden, aber vielleicht hatte er ihn auch gar nicht genannt. Die Räume waren kleiner als in meinem früheren Zuhause und entsprachen dem Geist der Bescheidenheit, in dem das Land regiert wurde. Die Wände und Böden waren aus dem Marmor, der hier in der Gegend abgebaut wurde und im Vergleich zu den Steinen, die man im Süden fand, makellos weiß schimmerte. Meine Füße nahmen sich darauf noch dunkler aus.
Ich hatte nichts bei mir. Meine wenigen Habseligkeiten waren in meine Kammer gebracht worden, und das Gold meines Vaters befand sich auf dem Weg in die Schatzkammer. Ich fühlte eine seltsame Panik, als man mich von den Schmuckstücken getrennt hatte, meinen Begleitern auf der wochenlangen Reise, die mir meinen Wert versichert hatten: fünf Kelche mit ziselierten Stielen, ein schweres Zepter, ein Halsband aus getriebenem Gold, zwei schmuckvolle Vögel und eine Leier mit vergoldeten Armen. Letztere war, wie ich wusste, eine betrügerische Beigabe, denn das Instrument bestand natürlich aus billigem Holz und nahm den Platz ein, der mit Gold hätte aufgefüllt sein sollen. Doch es war so wunderschön, dass niemand Einwand erheben konnte. Die Leier stammte aus der Mitgift meiner Mutter. Während der Reise hatte ich immer wieder in die Satteltasche gegriffen, um mit der Hand über das polierte Holz zu streichen.
Ich nahm an, dass man mich in den Thronsaal führte, damit ich dort auf die Knie fallen und meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen könnte. Doch plötzlich hielt der Sklave vor einer Seitentür an. König Peleus sei abwesend, erklärte er mir und sagte, dass er mich stattdessen dem Königssohn vorstellen werde. Ich war verärgert, weil ich die artigen Worte, die ich mir unterwegs auf dem Eselsrücken zurechtgelegt hatte, nun nicht vorbringen konnte. Peleus’ Sohn. Ich erinnerte mich noch an den Kranz auf seinen hellen Haaren und an seine rosigen Fußsohlen, auf denen er so flink über die Laufstrecke gerannt war. So sollte ein Sohn sein.
Er lag auf einer breiten, mit Kissen gepolsterten Bank, balancierte eine Leier auf dem Bauch und zupfte gelangweilt an den Saiten. Er hatte mich nicht kommen hören, oder er wollte mich nicht zur Kenntnis nehmen. Jedenfalls wurde mir in dem Moment klar, welchen Platz ich an diesem Ort einnehmen sollte. Bis zu diesem Tag war ich ein Prinz gewesen, dessen Erscheinen angekündigt wurde. Jetzt war ich jemand, den man getrost übersehen konnte.
Ich trat einen Schritt vor und scharrte mit den Füßen, worauf er den Kopf zur Seite drehte und mich beäugte. Vor fünf Jahren hatte ich ihn das erste Mal gesehen und stellte nun fest, dass er aus seiner kindlichen Molligkeit herausgewachsen war. Ich starrte ihn an, tief beeindruckt von seiner Schönheit, den dunkelgrünen Augen und den zarten, fast märchenhaften Gesichtszügen. Ich hingegen hatte mich nicht so sehr verändert, geschweige denn zu meinem Vorteil, weshalb ich bei seinem Anblick neidisch wurde und mit Abneigung reagierte.
Er gähnte und hob die schweren Lider. »Wie heißt du?«
Das Königreich meines Vaters war vielleicht achtmal so groß wie das seines Vaters, ich hatte immerhin einen Jungen getötet, war in die Verbannung geschickt worden, und dennoch kannte er mich nicht. Ich presste die Lippen aufeinander und schwieg.
Wieder fragte er, lauter diesmal: »Wie heißt du?«
Dass ich ihm nicht gleich geantwortet hatte, war noch entschuldbar gewesen, es mochte ja sein, dass ich ihn nicht gehört hatte. Nun aber gab es keine Ausrede mehr.
»Patroklos.« Es war der Name, den mir mein Vater nach meiner Geburt hoffnungsvoll, aber unüberlegt gegeben hatte, und er lag mir bitter auf der Zunge. Er bedeutete »zur Ehre des Vaters«. Ich war gefasst darauf, dass der Junge auf der Bank einen Scherz machte und auf meine Schande anspielte. Aber das tat er nicht. Vielleicht, dachte ich, war er ein bisschen zu dumm dazu.
Er drehte sich zur Seite und schaute mich an. Eine Locke seiner goldenen Haare fiel ihm über die Augen. Er blies sie weg. »Mein Name ist Achill.«
Ich hob mein Kinn, und wir betrachteten einander. Dann blinzelte er mit den Augen, gähnte wieder und riss dabei den Mund auf wie eine Katze. »Willkommen in Phthia.«
Ich war an einem Königshof aufgewachsen und wusste, wann man mir zu verstehen gab, dass ich entlassen war.
Noch am selben Nachmittag erfuhr ich, dass ich nicht das einzige Pflegekind von Peleus war. Der bescheidene König erwies sich als durchaus reich an verstoßenen Söhnen. Es hieß, dass er als junger Bursche von zu Hause ausgerissen sei und ein Herz für Verbannte habe. Mein Bett bestand aus einem Strohlager in einem langen kahlen Raum, den ich mir mit anderen Jungen teilte, die sich rauften oder in den Tag hineinträumten. Ein Sklave zeigte mir, wohin man meine Sachen gebracht hatte. Ein paar Jungen hoben die Köpfe und starrten mich an. Einer fragte nach meinem Namen, und ich antwortete. Doch sie verloren schnell wieder das Interesse. Niemand Wichtiges. Zaghaft ging ich zu meinem Strohlager und wartete auf das Abendessen.
In der Abenddämmerung rief uns das Geläut einer Bronzeglocke, das aus dem Inneren des Palasts tönte. Die anderen Jungen sprangen auf und eilten hinaus. Ich wähnte mich wie in einem Kaninchenbau, so verschlungen waren die engen, dunklen Korridore. Aus Angst, den Anschluss zu verlieren, trat ich dem Jungen, der vor mir lief, fast in die Hacken.
Die Halle, in der gegessen wurde, befand sich im vorderen Teil des Palasts mit Blick auf die Ausläufer des Othrys-Gebirges und war so groß, dass eine Vielzahl von Gästen darin Platz gefunden hätte. Peleus war bekannt dafür, dass er gern große Feste gab. Wir saßen auf Bänken aus Eichenholz, an Tischen, die offenbar uralt und entsprechend abgenutzt und zerkratzt waren. Das Essen war einfach, aber reichlich – gepökelter Fisch und dicke Scheiben Brot mit Kräuterkäse. Ziegen- oder Rindfleisch gab es nicht. Das war der Königsfamilie vorbehalten oder wurde nur an Festtagen gereicht. Am anderen Ende des Raumes sah ich im Schein der Lampe einen hellen Haarschopf leuchten. Achill. Die Jungen, die neben ihm saßen, amüsierten sich köstlich und lachten, offenbar über etwas, was er gesagt oder getan hatte. So sollte ein Prinz sein. Ich starrte auf mein Brot aus grobem Weizenschrot und strich mit den Fingern über die raue Rinde.
Nach dem Essen durften wir machen, was uns gefiel. Manche Jungen zogen sich in eine Ecke zurück, um zu spielen. »Willst du mitspielen?«, fragte einer. Er hatte noch kindliche Locken und war jünger als ich.
»Spielen?«
»Würfeln.« Er öffnete langsam die Hand und zeigte mir zwei Würfel aus geschnitzten Knochen, betupft mit schwarzer Farbe.
Unwillkürlich wich ich zurück. »Nein«, rief ich aus.
Er zwinkerte überrascht mit den Augen. »Dann eben nicht«, sagte er achselzuckend und ging fort.
In dieser Nacht träumte ich von dem toten Jungen, der mit zerbrochenem Schädel, aufgeschlagen wie ein Ei, am Boden liegt. Er hat mir nachgestellt. Blut strömt, dunkel wie Wein. Er öffnet die Augen, bewegt seine Lippen. Ich halte mir die Ohren zu. Die Stimmen der Toten, so heißt es, können Lebende in den Irrsinn treiben. Ich will kein Wort von ihm hören.
Ich schreckte auf und hoffte, nicht geschrien zu haben. Es war dunkel, vor dem Fenster leuchteten nur die Sterne am mondlosen Himmel. Mein flacher, hastiger Atem durchschnitt die Stille. Unter mir knisterte die Matratze, deren Füllung aus Stroh im Rücken piekste. Die Gegenwart der anderen Jungen tröstete mich nicht. Unsere Toten übten Rache, auch ungeachtet der Zeugen.
Die Gestirne kreisten, der Mond ging auf und zog über den Himmel. Als meine Augen schließlich wieder zufielen, lauerte der Junge noch, blutbesudelt und mit knochenbleichem Gesicht. Natürlich wartete er auf mich. Keine Seele wollte so früh in die endlosen Schatten unserer Unterwelt eingehen müssen. Die Verbannung mochte vielleicht die Lebenden besänftigen, doch die Toten waren damit nicht zufriedengestellt.
Als ich aufwachte, waren meine Lider verklebt, die Glieder schwer und gefühllos. Die anderen Jungen liefen bereits umher und zogen sich an, um pünktlich zum Frühstück zu erscheinen. Dass ich womöglich ein wenig merkwürdig sei, hatte sich schnell herumgesprochen, und der Junge mit den Locken trat nicht mehr auf mich zu, weder mit Würfeln noch irgendetwas anderem. Am Frühstückstisch stopfte ich mir Brotkrumen in den Mund und schluckte. Man schenkte mir Milch ein, und ich trank.
Anschließend wurden wir nach draußen in einen staubigen Hof in die pralle Sonne geführt, um im Umgang mit Speer und Schwert unterrichtet zu werden. Hier sollte ich erfahren, was es mit der Freundlichkeit des Peleus in Wahrheit auf sich hatte. Gut ausgebildet und zu Dank verpflichtet, würden wir ihm eines Tages als tüchtige Kämpfer dienen.
Man gab mir einen Speer. Eine schwielige Hand korrigierte meinen Griff und korrigierte ihn abermals. Ich warf und verfehlte das Ziel, den Stamm einer Eiche, nur knapp. Der Lehrer ließ schnaubend Luft ab und reichte mir einen zweiten Speer. Ich schaute mich im Kreis der anderen Jungen um, auf der Suche nach Peleus’ Sohn. Er war nicht da. Dann konzentrierte ich mich wieder auf die Eiche, deren Borke zerfetzt und aufgebrochen war. Aus den Einschlaglöchern troff Harz. Ich warf.
Die Sonne stieg höher und höher. Meine Kehle war heiß und trocken, Staub brannte darin. Als der Unterricht vorbei war, rannten die meisten Jungen zum Strand, wo immer noch ein leichter Wind wehte. Dort würfelten sie oder jagten einander und rissen Witze in den scharfen Dialekten des Nordens.
Meine Augen waren schwer, und meine Arme schmerzten von den Übungen am Vormittag. Ich setzte mich in den Schatten eines struppigen Olivenbaums und schaute hinaus aufs bewegte Meer. Niemand wechselte ein Wort mit mir. Mich nicht zur Kenntnis zu nehmen, war leicht. Es war nicht viel anders als zu Hause.
Der nächste Tag verlief ähnlich, mit ermüdenden Übungen am Vormittag und langen Nachmittagsstunden, die ich allein verbrachte. In der Nacht betrachtete ich den abnehmenden Mond, so lange, bis ich ihn auch mit geschlossenen Augen sehen konnte, als gelbe Sichel vor meinen dunklen Augenlidern. Ich hoffte, sein Anblick würde mir das stets wiederkehrende Bild des Jungen ersparen. Unsere Mondgöttin hat Zauberkräfte und Macht über die Toten. Wenn sie es wollte, konnte sie auch meine Alpträume bannen.
Sie tat es nicht. Der Junge kam, Nacht für Nacht, mit starrem Blick und zerschmettertem Schädel. Manchmal drehte er sich um und zeigte mir das Loch im Kopf, aus dem die weiche Masse seines Gehirns hervorquoll. Ich wachte jedes Mal auf, atemlos vor Entsetzen, und starrte ins Dunkel, bis es hell wurde.
VIERTES KAPITEL
DAS EINZIG ERLEICHTERNDE waren für mich die Mahlzeiten im Speisesaal. Unter dem hohen Gewölbe fühlte ich mich nicht so eingeengt, und hier verstopfte mir nicht der Staub vom Exerzierplatz die Kehle. Das Stimmengemurmel und Klappern von Geschirr beruhigten mich. Ich saß allein vor meinem Essen und konnte wieder frei atmen.
Und ich hatte Gelegenheit, Achill zu sehen. Er verbrachte seine Tage woanders und ging als Prinz Pflichten nach, mit denen wir anderen nichts zu tun hatten. Aber die Mahlzeiten nahm er immer mit uns zusammen ein, mal an diesem, mal an jenem Tisch. In der großen Halle leuchtete seine Schönheit wie eine Flamme, lebendig und hell. Immer wieder zog sie meinen Blick auf sich. Sein Mund war wie ein kleiner geschwungener Bogen geformt, die Nase wie ein aristokratischer Pfeil. Wenn er sich setzte, verrenkte er nicht die Glieder, wie ich es tat, sondern ordnete sie anmutig, als säße er Modell für einen Bildhauer. Am bemerkenswertesten war vielleicht seine völlige Unbefangenheit. Im Unterschied zu anderen hübschen Kindern machte er keinerlei Aufhebens um sich. Im Gegenteil, er schien sich seiner Wirkung auf die anderen Jungen überhaupt nicht bewusst zu sein, obwohl er doch hätte bemerken müssen, dass sie sich wie eine Hundemeute um ihn drängten, begierig darauf, von ihm wahrgenommen zu werden.
Ich beobachtete solche Szenen von meinem Tisch in der Ecke, und das Brot zerkrümelte in meiner Faust. Mein Neid war scharf wie ein Feuerstein, nur einen Funken entfernt vom Feuer.
Eines Tages saß er am Nebentisch. Seine staubigen Füße scharrten auf den Steinfliesen, während er aß. Sie waren nicht so schwielig wie meine, sondern rosig an den Sohlen und mit gebräuntem Rist. Prinz, höhnte ich im Stillen.
Er drehte sich um, als hätte er mich gehört. Wir schauten einander an, Panik durchströmte meinen Körper. Ich riss mich von seinem Blick los und zupfte an meinem Brot. Meine Wangen waren heiß, und die Haut prickelte wie vor einem Unwetter. Als ich schließlich wieder hinsah, hatte er sich abgewendet und sprach mit den Jungen am Tisch.
Danach war ich vorsichtiger mit meinen Beobachtungen. Ich hielt den Kopf gesenkt und bewegte nur die Augen, immer auf der Hut, meinen Blick ganz schnell woandershin zu lenken. Aber er war noch gewiefter. Er schaffte es während einer Mahlzeit mindestens einmal, mich in meiner Neugier zu ertappen, ehe ich seinen Blicken ausweichen konnte. In solchen kurzen Momenten empfand ich mehr als im Laufe eines ganzen Tages. Mein Magen verkrampfte sich, und heiße Wut stieg in mir auf. Ich kam mir vor wie ein Fisch am Haken.
In der vierten Woche meiner Verbannung fand ich ihn im Speisesaal an meinem Tisch vor. Ich bezeichnete ihn als meinen Tisch, weil ihn sonst kaum jemand mit mir teilte. Doch jetzt, da er dort saß, drängten sich die Jungen auf den Bänken. Ich erstarrte, hin- und hergerissen von meiner Wut und dem Impuls, Reißaus zu nehmen. Doch die Wut gewann die Oberhand. Es war mein Tisch, und ich würde mich von ihnen nicht verdrängen lassen, egal, wie viele Jungen er auf seiner Seite hatte.
Ich setzte mich auf den letzten leeren Platz und straffte kampfbereit die Schultern. Die Jungen gaben mächtig an und plapperten durcheinander. Sie redeten über einen Speer, einen toten Vogel am Strand und über die Wettkämpfe im Frühling. Ich hörte nicht hin. Seine Gegenwart störte mich wie ein Stein im Schuh, der sich einfach nicht ignorieren ließ. Seine Haut hatte die Farbe frisch gepressten Olivenöls und war so glatt wie poliertes Holz, ohne Schrammen und Blessuren wie bei all den anderen.
Nach dem Essen wurde das Geschirr weggeräumt. Hinter den Fenstern zeigte sich der Erntemond, voll und rötlich gelb am Abendhimmel. Achill blieb länger als sonst. Gedankenversunken strich er die Haare aus dem Gesicht. Sie waren in den Wochen seit meiner Ankunft lang geworden. Er griff nach einer Schale auf dem Tisch, in der sich Feigen befanden, und klaubte mehrere heraus.
Mit einem Schlenker aus dem Handgelenk warf er die Feigen in die Luft, eine, zwei, drei, und ließ sie so leicht umeinanderfliegen, dass die zarte Haut der Früchte unbeschädigt blieb. Dann fügte er eine vierte, eine fünfte hinzu. Die Jungen lachten und applaudierten. Mehr, mehr!
So schnell schwirrten die Feigen durch die Luft, dass das Auge kaum folgen konnte, und es schien, als seien die Hände gar nicht im Spiel, als flögen die Früchte aus eigener Kraft. Solche Kunststücke waren eigentlich Sache von Gauklern und Bettlern, doch er schuf ein lebendiges Luftgebilde, so schön, dass ich mein Interesse nicht länger verhehlen konnte.
Sein Blick, der den fliegenden Früchten folgte, richtete sich kurz auf mich. Ich hatte nicht die Zeit, wegzuschauen, bevor er leise sagte: »Fang!« Eine Feige löste sich aus dem schwerelosen Kreis, flog auf mich zu und landete, weich und warm, in meinen geöffneten Händen. Ich hörte die Jungen johlen.
Daraufhin pflückte Achill eine Frucht nach der anderen aus der Luft, verbeugte sich wie ein Schausteller und legte sie zurück in die Schale, bis auf eine, die er in den Mund steckte und mit den Zähnen zerteilte. Die Frucht war reif und voller Saft. Ohne lange zu überlegen, führte ich diejenige, die er mir zugeworfen hatte, an die Lippen, schmeckte ihr süßes, körniges Fleisch, die weiche Haut auf der Zunge.
Er stand auf. Die Jungen verabschiedeten ihn im Chor. Ich dachte, er würde mich noch einmal ansehen. Stattdessen aber wandte er sich ab und ging zurück in seine Kammer im hinteren Teil des Palasts.
Am nächsten Tag kehrte Peleus zurück. Man brachte mich in den Thronsaal, wo ein Eibenholzfeuer brannte und würzigen Rauch verbreitete. Wie es sich geziemte, kniete ich nieder und verbeugte mich, worauf er sein mildes Lächeln zeigte, für das er berühmt war. »Patroklos«, antwortete ich auf seine Frage nach meinem Namen. Daran, dass ich ihn ohne Hinweis auf meinen Vater nannte, hatte ich mich inzwischen gewöhnt. Peleus nickte. Er hatte einen Buckel und kam mir vor wie ein Greis, obwohl er kaum älter als fünfzig war, so alt wie mein Vater. Wie ein Mann, der eine Göttin erobert und mit ihr ein Kind wie Achill gezeugt hatte, sah er nicht aus.
»Du bist hier, weil du einen Jungen getötet hast. Verstehst du?«
Aus seiner Frage sprach die Grausamkeit der Erwachsenen. Verstehst du?
»Ja«, antwortete ich. Ich hätte ihm von meinen Träumen erzählen können, die mich nicht in Ruhe ließen und so sehr quälten, dass ich schreien mochte; sie raubten mir den Schlaf und ich lag nächtelang wach, die kreisenden Sterne vor Augen.
»Du bist hier willkommen. Aus dir kann immer noch ein guter Mann werden.« Er meinte es als Trost.
An diesem Tag erfuhren alle den Grund meiner Verbannung, vielleicht vom König selbst oder durch einen Sklaven, der gelauscht hatte. Damit war eigentlich zu rechnen gewesen, denn es wurde viel getratscht. Gerüchte waren für die Jungen die einzige Währung, mit der sie handeln konnten. Dennoch verblüffte mich der plötzliche Umschwung in ihrem Verhalten mir gegenüber. Sooft ich an ihnen vorbeiging, spiegelten sich Furcht und Faszination auf ihren Gesichtern. Selbst der frechste von ihnen murmelte ein Gebet vor sich hin, wenn ich ihm zu nahe kam. Unglück steckt bekanntlich an, und die Erinnyen, unsere gefürchteten Rachegöttinnen, waren nicht wählerisch. Gespannt schauten sie aus sicherer Entfernung zu. Was glaubt ihr, werden sie sein Blut trinken?
Das Getuschel schlug mir auf den Magen. Ich schob meinen Teller weg und suchte stille Ecken und Räume auf, wo mich niemand störte, allenfalls ein Sklave, der vorbeikam. Meine enge Welt wurde noch enger und begrenzte sich auf die Fugen im Boden oder die in Steinmauern gemeißelten Ornamente, die leise wisperten, wenn ich mit den Fingerspitzen darüberstrich.
»Man hat mir gesagt, wo du bist.« Eine klare Stimme, wie aus schmelzendem Eis tropfendes Wasser.
Mein Kopf fuhr empor. Ich saß mit eingezogenen Beinen in einer Vorratskammer, eingeengt zwischen Fässern voller Olivenöl. Ich hatte geträumt, ein Fisch zu sein, der aus dem Wasser springt und, von der Sonne beschienen, silbern glitzert. Die Wellen lösten sich auf, und stattdessen traten wieder die unförmigen Getreidesäcke zum Vorschein.
Es war Achill, der vor mir stand. Er machte einen ernsten Eindruck und musterte mich mit seinen grünen Augen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil mir bewusst war, dass ich mich hier in der Kammer nicht aufhalten durfte.
»Ich habe dich gesucht«, sagte er mit ausdrucksloser Stimme, der nicht mehr als diese Worte anzuhören waren. »Du hast den Drill geschwänzt.«
Mein Gesicht lief rot an, unter das schlechte Gewissen mischte sich dumpfe Wut. Er hatte das Recht, mich zu maßregeln, doch dafür hasste ich ihn.
»Woher weißt du das? Du warst doch auch nicht auf dem Hof.«
»Dem Meister ist es aufgefallen, und er hat meinen Vater informiert.«
»Der hat dich wohl geschickt.« Ich wollte, dass er sich schämte.
»Nein, niemand hat mich geschickt.« Seine Stimme klang unaufgeregt, doch seine Miene verriet etwas anderes. »Ich habe das Gespräch der beiden belauscht und bin gekommen, um zu sehen, wie es dir geht.«
Ich antwortete nicht. Er musterte mich immer noch.
»Mein Vater denkt darüber nach, dich zu bestrafen«, sagte er.
Wir wussten beide, was damit gemeint war. Strafe bedeutete körperliche Züchtigung, meist vor aller Augen. Ein Prinz musste nicht fürchten, ausgepeitscht zu werden, aber ich war kein Prinz mehr.
»Bist du krank?«, fragte er.
»Nein.«
»Dann kommt das als Entschuldigung nicht in Frage.«
»Wie bitte?« Vor lauter Angst konnte ich ihm nicht folgen.
»Als Entschuldigung, den Drill geschwänzt zu haben.« Er schien die Geduld zu verlieren. »Um der Strafe zu entgehen. Was wirst du sagen?«
»Ich weiß nicht.«
»Du musst aber etwas sagen.«
Seine Beharrlichkeit machte mich noch wütender. »Du bist der Prinz«, platzte es aus mir heraus.
Er zeigte sich überrascht und neigte den Kopf wie ein neugieriger Vogel zur Seite. »Und?«
»Sprich du mit deinem Vater und sag ihm, wir wären zusammen gewesen. Das wird er entschuldigen.« Was so beherzt klang, war eher Ausdruck meiner Verlegenheit. Hätte ich mich vor meinem Vater für einen anderen Jungen stark gemacht, wäre dieser trotzdem ausgepeitscht worden. Aber ich war nicht Achill.
Zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine kleine Furche. »Mir gefällt es nicht, zu lügen«, entgegnete er.
So viel Anständigkeit wurde von anderen Jungen meist verlacht, und wer noch anständig war, gab es nicht offen zu.
»Lass mich an deinem Unterricht teilnehmen«, sagte ich. »Dann müsstest du nicht lügen.«
Er zog die Stirn in Falten und war so still wie ein alarmiertes Tier, das den Geräuschen seines Jägers lauschte. Unwillkürlich hielt ich die Luft an.
Plötzlich entspannte sich sein Gesicht wieder. Er hatte eine Entscheidung getroffen.
»Komm mit«, sagte er.
»Wohin?« Ich war argwöhnisch. Womöglich sollte ich nun dafür bestraft werden, dass ich ihm zu lügen vorgeschlagen hatte.
»Zu meinem Leierunterricht. Damit ich, wie du sagst, nicht lügen muss. Anschließend sprechen wir mit meinem Vater.«
»Jetzt?«
»Ja. Warum nicht?« Er sah mich fragend an. Warum nicht?
Als ich aufstand, um ihm zu folgen, taten mir die Beine weh, weil ich so lange auf dem kalten Steinboden gehockt hatte. In meiner Brust kribbelte etwas, das ich nicht benennen konnte. Furcht und Hoffnung, beides zugleich.
Wortlos gingen wir durch die langen Flure und gelangten schließlich in einen kleinen Raum, in dem sich nur eine Truhe und ein paar Stühle befanden. Achill deutete auf einen davon. Es war ein mit Leder überspannter Holzrahmen auf Beinen – ein Schemel, wie ihn fahrende Musikanten mit sich führten.
Er öffnete die Truhe, holte eine Leier daraus hervor und reichte sie mir.
»Ich kann darauf nicht spielen«, sagte ich.
Wieder krauste er die Stirn. »Hast du es nie versucht?«
Seltsamerweise verspürte ich den Wunsch, ihn nicht zu enttäuschen. »Mein Vater mag keine Musik.«
»Na und? Er ist doch nicht hier.«
Ich nahm das Instrument entgegen. Es war dasjenige, mit dem ich ihn am Tag meiner Ankunft gesehen hatte. Ich ließ die Finger über die Saiten streichen und hörte ein dumpfes Summen. Achill holte eine zweite Leier aus der Truhe hervor und setzte sich neben mich.
Er platzierte sie auf seine Knie. Die Holzarme waren mit kunstvollen Schnitzereien verziert und vergoldet. Es war das Instrument meiner Mutter, das mir mein Vater als Teil des Entgelts für meine Aufnahme an Peleus’ Hof mitgegeben hatte.
Achill zupfte an einer Saite und ließ einen wunderschönen Ton erklingen, warm und anhaltend. Meine Mutter war früher immer auf ihrem Stuhl ganz nah an die Musikanten herangerückt, so nah, dass mein Vater das Gesicht verzog und die Sklaven untereinander tuschelten. Ich erinnerte mich plötzlich an den dunklen Glanz ihrer Augen, wenn sie auf den Händen des Musikers ruhten und zu dürsten schienen.
Achill zupfte an einer anderen Saite, die einen tieferen Klang hervorbrachte. Dann griff er nach einem Schlüssel und stimmte sie nach.
Das ist die Leier meiner Mutter, hätte ich fast gesagt. Die Worte lagen mir schon auf der Zunge, und dahinter drängten sich weitere vor. Sie gehört mir. Doch ich schwieg. Was hätte er wohl auf eine solche Äußerung geantwortet? Das Instrument war nun in seinem Besitz.
Meine Kehle war trocken. Ich schluckte. »Sie ist schön.«
»Mein Vater hat sie mir gegeben«, erklärte er arglos, und nur weil er mit dem Instrument so sanft und schonend umging, konnte ich meine Wut beherrschen.
Er bemerkte nichts davon. »Du kannst sie mal halten, wenn du willst.«