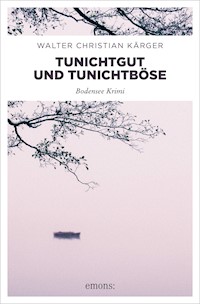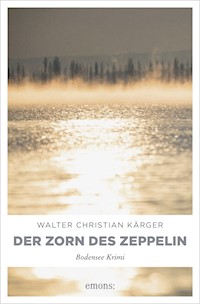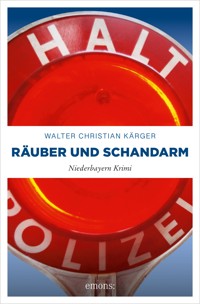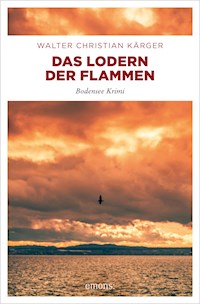
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Max Madlener
- Sprache: Deutsch
Feuerhölle am Bodensee Kommissar Madlener und seine Assistentin Harriet bekommen es mit einem besonders skrupellosen Täter zu tun: einem Feuerteufel, der von Mal zu Mal mehr Gefallen daran findet, den gesamten Bodenseeraum mit seinen Brandstiftungen in Angst und Schrecken zu versetzen. Als es ein erstes Todesopfer gibt, setzen die beiden alles daran, ihn endlich zu schnappen. Gleichzeitig haben sie noch einen Cold Case am Hals, den Madleners verstorbener Ex-Kollege nie lösen konnte ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: iStockphoto.com/Say-Cheese
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-477-3
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
You fought hard and you saved and earnedBut all of it’s going to burnAnd your mind, your tiny mindYou know you’ve really been so blindNow’s your time, burn your mindYou’re falling far too far behindOh no, oh no, oh no, you’re gonna burnFire, to destroy all you’ve doneFire, to end all you’ve becomeI’ll feel you burn
The Crazy World of Arthur Brown, »Fire«
Prolog
Love is a burning thing
And it makes a fiery ring
Bound by wild desire
I fell into a ring of fire
I fell into a burning ring of fire
I went down, down, down
And the flames went higher
And it burns, burns, burns
The ring of fire
Johnny Cash, »Ring Of Fire«
Er war ein widerliches Schwein.
Das stand nun einmal hundertprozentig fest, keine Frage.
Seit er sie verlassen hatte, konnte sie keinen klaren Gedanken mehr fassen.
Was heißt »verlassen«?
Den Laufpass hatte er ihr gegeben.
Sie in die Wüste geschickt.
Gnadenlos abserviert.
Von jetzt auf gleich.
Es ihr einfach so hingerotzt.
Eine SMS-Nachricht war alles, was er nach acht Monaten für sie übrig hatte.
Das war’s. Mach’s gut.
Viel kürzer ging’s wohl nicht.
Der feige Hund.
Er hätte es ihr wenigstens ins Gesicht sagen können, ihr dabei in die Augen blicken.
Aber nein, so viel Anstand besaß er nicht.
Anstand – ein Wort, das lächerlich klang, wenn man es mit ihm in Verbindung brachte. So ein Typ war er nicht, nie gewesen.
Aber das hatte sie von vornherein gewusst.
Die Frauen wollten etwas von ihm, nicht umgekehrt. Das war ja das Fatale. Und diese Tatsache nutzte er weidlich aus. Weil er ein Sadist war. Und sie hatte seine herrische Art ertragen.
Am Anfang hatte sie es angeturnt, es geil gefunden, wenn er nicht lange fragte, sondern über sie herfiel. Aber irgendwann war die Stimmung bei ihr gekippt. Er war ihr zu fordernd geworden, zu brutal. Wenn sie Nein sagte, war das nur der Anlass für ihn, erst recht das zu tun, wonach ihm gerade der Sinn stand. Sie dachte immer, sie könnte ihn von seinem gewalttätigen Trip herunterbringen, ihn ändern.
Was für eine törichte Illusion!
Er war so, wie er war.
Trotzdem heulte sie einen ganzen Tag und eine ganze Nacht, als es vorbei war.
Für ihn war es vorbei.
Für sie nicht.
Sie kochte innerlich.
Weil sie seinetwegen auch noch Schuldgefühle hatte.
Und warum?
Weil sie ihn zur Rede gestellt hatte, ihn gefragt hatte, wo er gewesen war, obwohl sie es genau wusste. Weil sie hören wollte, wie er sich in seinem eigenen Lügengespinst verhedderte. Sie hatte ihm eine Falle gestellt, ihn hineingelockt. Und zwar so, dass er nicht mehr anders konnte, als zuzugeben, dass er es längst mit einer anderen trieb.
Sie wollte nur hören, dass es ihm leidtat.
Wollte ihm verzeihen.
Sich wieder mit ihm versöhnen.
Das war schon immer das Schärfste gewesen, die Versöhnung nach dem Streit, der lautstark und meistens auch handfest ausgetragen worden war. Da flogen die Fetzen und auch bisweilen die Fäuste. Ohrfeigen, blindwütige Schläge, Tränen, Beschimpfungen, Gekreische, Heulen, Beleidigungen, Schreie, Umarmungen, Küsse, Bisse, Leidenschaft.
Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.
Aber immer volles Drama, Baby.
Die Versöhnung war dann umso schöner …
Wie oft hatten sie sich zerstritten und wieder miteinander versöhnt?
Zehnmal? Ein Dutzend Mal?
Egal.
Jetzt war sowieso alles aus und vorbei.
Sie wusste es in dem Augenblick, als er ihr nicht mehr auf ihre Fragen antwortete, ihr nicht mehr in die Augen blicken konnte. Weil er mit den Gedanken schon längst bei der anderen war.
Ja, sie hatte ihm nachspioniert, hatte sein Smartphone gecheckt und alles gesehen und gelesen, was nicht für ihre Augen und Ohren bestimmt war.
Oder vielleicht doch?
Vielleicht wollte er, dass sie seine Geheimnisse entdeckte.
Weil er wusste, dass sie sein Handy kontrollierte?
Und sie wusste, dass er nichts mehr hasste, als kontrolliert zu werden?
Weil er selbst ein Kontrollfreak war, sie nach seiner Pfeife tanzen musste?
Aber als sie das Handy herumliegen sah, konnte sie einfach nicht anders.
Sie liebte ihn doch!
Sie musste nachsehen, es war schon zwanghaft, sie musste ihren Verdacht verifizieren, obwohl oder weil sie ahnte, wie schmerzhaft das sein würde. War sie eine Masochistin, wenn sie das tat?
Es war ein Fehler gewesen, zu denken, dass sie ihn allein für sich haben könnte. Wenn sie nur tat, was er wollte und sagte.
Und zwar ausschließlich, wenn es ihm in den Kram passte.
Das konnte nicht funktionieren.
So viel Menschenkenntnis und Erfahrung im Umgang mit Männern hatte sie.
Aber bei ihm hatte einfach ihr Verstand ausgesetzt.
Und jetzt musste sie mit den Konsequenzen fertigwerden.
Dass er einfach nicht für eine dauerhafte Beziehung geschaffen war, das hatte er ihr von Anfang an klargemacht.
Hatte sie wirklich daran geglaubt, dass er es ernst meinte?
Nein – sie war nicht so wie alle anderen.
Bei ihr würde er sein Verhalten ändern.
Sie würde ihn ändern.
Sie konnte nicht fassen, dass sie tatsächlich so naiv gewesen war, das zu glauben.
Das hatte sie nun davon.
Als sie endlich kapierte, dass es aus war, endgültig aus, stürzte das Universum für sie ein.
Großer Vergleich, zugegeben.
Aber für sie war es so.
Sie holte ihren gesamten Kerzenvorrat zusammen und verteilte die Kerzen im Bad, zündete sie an und legte sich in die Badewanne, wo sie heißes Wasser einlaufen ließ.
Die flackernden Lichter machten aus dem hell gefliesten Raum die reinste Votivkapelle.
Opferkerzen – wofür?
Ihren ehemaligen Liebhaber?
Ihre gestorbene Liebe?
Alles Bullshit.
Wenn schon Abschied, dann sollte es ein stilvoller sein.
Sie wartete, bis ihr das Wasser bis zum Kinn reichte. Dann machte sie den Wasserhahn zu und sah die Rasierklinge an, die sie schon die ganze Zeit zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten hatte. Vorsichtig pulte sie das Schutzpapier ab und schnippte es auf den Boden des Badezimmers.
Seine Rasierklingen waren das Einzige, was er bei ihr vergessen hatte. Neben der Zahnbürste, aber die hatte sie schon weggeworfen.
Es war eine altmodische Wilkinson.
Die Art von Rasierklinge, mit der man drei verschiedene Dinge anstellen konnte.
Man konnte sich damit rasieren, natürlich.
Man konnte damit Koks zerhäckseln, das er gelegentlich mitgebracht hatte.
Und man konnte sich damit die Pulsadern aufschneiden.
Sie hatte sich für Nummer drei entschieden.
Der Wasserhahn tropfte, obwohl sie mit aller Kraft versucht hatte, ihn ganz zuzudrehen.
Seit sie ihn kannte, hatte er versprochen, ihn zu reparieren. Dazu war es natürlich nie gekommen.
Dip.
Dip.
Dip.
Sie sah den Tropfen zu, war wie hypnotisiert davon.
Das lag vielleicht auch daran, dass sie sich vorher Mut angetrunken hatte, eine halbe Flasche Wodka, den teuren schwedischen. Den sie immer für ihn daheimhatte, er mochte Wodka on the rocks.
Egal, das war vorbei.
Alles war vorbei.
Sie probierte die Schneide der Klinge mit ihrem Daumen. Sie war so scharf, wie sie sein sollte, sie schleckte an dem Blutstropfen. Nur um zu testen, was für einen Geschmack Blut hatte.
Wie Kupfer. Eindeutig.
Ihr Leben schmeckte wie Kupfer. Metallisch.
Eine Erkenntnis, die sie irgendwie enttäuschte.
Sie fing an, sich am Handgelenk zu ritzen.
Senkrecht, nicht quer. So, wie es sich gehörte, wenn man ernst machen wollte.
Sie sah dem roten Rinnsal zu, wie es an ihrem Unterarm herunterfloss und ins Wasser tropfte, sich dort mit ihm vermischte.
Der Schnitt war noch nicht tief genug, es war die Generalprobe vor der Premiere.
Noch ein Schnitt, noch ein bisschen tiefer …
Sie wusste nicht mehr, was in ihr vorgegangen war, warum sie den letzten, entscheidenden Schnitt nicht machte. Vielleicht gab es auch keine konkrete Erklärung dafür.
Es war einfach nur die plötzliche Erkenntnis, dass er es nicht wert war.
Die Wut war doch größer als das Selbstmitleid.
Er war einfach ein Schwein, das sie belogen und betrogen hatte.
Nichts weiter.
Ihre Hand mit der Rasierklinge hing über dem Badewannenrand.
Sie ließ die Klinge fallen.
Ein leises Klirren auf den Bodenfliesen.
Dann stand sie auf, nahm das Handtuch und wickelte es um ihr leicht blutendes Handgelenk.
So leicht würde sie ihn nicht davonkommen lassen.
Oh no!
1
Der Mercedes-Fahrer in dem schwarzen Hoodie, die Kapuze über dem Kopf, sah auf die Leuchtziffern seiner Armbanduhr.
Kurz nach drei Uhr nachts.
Zeit zu handeln.
Er stieg aus der alten schwarzen Limousine, die er an der Friedrichstraße am Yachthafen geparkt hatte, und sah sich um.
Kein Mensch war unterwegs.
Es nieselte leicht, die dichte Wolkendecke ließ kein Mondlicht durch, nur die Straßenlaternen bildeten trübe Lichtinseln.
Aus dem Kofferraum des Mercedes holte er graue, unförmige Arbeitshandschuhe, die nagelneu und entsprechend steif waren.
Er war nervös.
Die Handschuhe hatte er erst vor Kurzem gekauft, sie waren noch mit einer Plastiklasche verbunden. Er riss sie gewaltsam auseinander, dann schlüpfte er hinein.
Er sah seine unförmigen Hände an, zögerte, überlegte, griff sich an den Kopf, fluchte leise, zog die Handschuhe wieder aus. Weil ihm eingefallen war, dass er den zusammengerollten Saum seiner schwarzen Baumwollmütze, die er auf dem Schädel trug, herunterlassen musste, damit sein Gesicht nicht von einer der Überwachungskameras, die am Yachthafen angebracht waren, erfasst werden konnte. Er klemmte die Arbeitshandschuhe zwischen seine Knie und rollte den Saum der Mütze über sein Gesicht. Es war eine Sturmhaube, die einen Augenschlitz hatte und ihn wie einen Ninja auf Kriegspfad aussehen ließ. Dann zog er wieder die unförmigen Arbeitshandschuhe an und nahm eine schwere Plastiktüte aus dem Kofferraum, in der zwei für seine Zwecke präparierte Glasflaschen steckten.
Was das für Zwecke waren, würde sich in Kürze herausstellen.
Er schlug den Kofferraumdeckel zu und marschierte zügig an der Minigolfanlage vorbei zum Yachthafen hinunter.
Der schwarze See glitzerte im Licht der Lampen, im Regen hatten sich große Pfützen gebildet, denen die Gestalt nicht auswich.
Sie hatte nur ein Ziel vor Augen und steuerte schnurstracks auf die dickste Motoryacht zu, die direkt an der Mole vertäut lag, »Hella Wahnsinn« hieß und im leichten Wellengang dümpelte.
Der Eigner, der vermögend genug war, um sich so ein kostspieliges Wasserspielzeug samt Liegeplatz leisten zu können, fand den angeberischen Namen wohl witzig. Sobald er einen Anruf von der Polizei bekam, würde ihm das Lachen schon vergehen, dachte die schwarz gekleidete Gestalt.
Das Wasser gluckste und gluckerte, die Takelagen der Segelboote klirrten leise an den Masten, alles in allem ein Bild des Friedens.
Aber der Mercedes-Fahrer war nicht hierhergekommen, um sich an einem kitschigen nächtlichen Hafenanblick zu ergötzen. Die Vorfreude auf das, was er gleich in die Tat umsetzen würde, versetzte ihn in Hochstimmung.
Er sah sich noch einmal nach allen Seiten um, vergewisserte sich, dass er wirklich der einzige Mensch weit und breit war, bevor er mit seinen Handschuhen die zwei Flaschen aus der Tüte zog. Die Flaschenhälse waren mit Baumwollfetzen verstopft. Es waren selbst hergestellte Molotow-Cocktails, Brandbomben mit einer hochexplosiven Mischung aus Öl und Benzin.
Der Mercedes-Fahrer im Hoodie mühte sich umständlich mit den unförmigen Handschuhen ab, mit einem Zippo-Feuerzeug eine Flamme zu erzeugen. Er fluchte und ärgerte sich maßlos, dass er keine Gummihandschuhe mitgenommen hatte, beim nächsten Mal würde er es besser machen. Aber man lernte eben immer dazu. Sein Vorsatz, so wenige Spuren wie möglich zu hinterlassen, war im Prinzip natürlich richtig, nur seine Methodik musste er dringend verfeinern.
Endlich gelang es ihm, trotz der unpraktischen Handschuhe, mit dem Feuerzeug eine Flamme zustande zu bringen. Er hielt sie an den mit Benzin getränkten Lappen, der aus der ersten Flasche hing, die andere hatte er auf dem Boden abgestellt, wartete drei Herzschläge lang und warf dann den Molotow-Cocktail mit der brennenden Lunte mitten auf das Deck der Motoryacht.
Beim Aufprall zerplatzte die Flasche, und augenblicklich pilzte eine Flammenwolke empor.
Sie war haushoch und musste kilometerweit zu sehen sein.
Für einen Moment starrte er sie wie hypnotisiert an, sie spiegelte sich in seinen glänzenden Augen.
Gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, dass er noch eine zweite Flasche gleichen Inhalts mitgebracht hatte, um sein Werk auch wirklich mit letzter Gründlichkeit zu vollenden.
Zitternd versuchte er vergeblich, mit seinen klobigen Handschuhen im grellen Licht der fauchenden Flammenwand sein Zippo erneut in Gang zu bringen, bis ihm endlich in den Sinn kam, dass es vollauf genügte, die volle Flasche auf die brennende Yacht zu schleudern.
Er holte aus, aber gerade als er mit der Wurfhand durchzog, rutschte er auf dem glitschigen Gras aus und verfehlte die »Hella Wahnsinn«, die Flasche plumpste wirkungslos ins Wasser.
Laut fluchte er über sein Missgeschick.
Doch der erste Molotow-Cocktail war schon ausreichend, um die Motoryacht vollständig in Flammen aufgehen zu lassen.
Es kam ihm vor, als würde er von ihnen wütend angefaucht wie von einem wilden Tier.
Er hatte Schwierigkeiten, sich von dem apokalyptischen Anblick zu lösen. Ganz langsam wie ein Schlafwandler bewegte er sich Schritt für Schritt rückwärts von der Mole weg, bis er sich endlich abrupt umdrehte und zu seinem Mercedes spurtete.
2
Die schwarze Gestalt klemmte sich hinters Steuer ihres Wagens, zog sich die vermaledeiten Arbeitshandschuhe von den Händen und warf sie hinter sich auf den Rücksitz. Den Zündschlüssel hatte sie stecken gelassen. Zum Glück sprang der Motor sofort an. Ein letzter Blick auf das geile Flammeninferno am Hafenbecken, dann gab sie Gas und verschwand. Die Nummernschilder des Mercedes waren geklaut – für alle Fälle.
Im Rückspiegel sah der Fahrer, wie die Motoryacht endgültig in einem gewaltigen Feuerball in die Luft ging, anscheinend war der Tank voll und durch die enorme Hitzeeinwirkung explodiert.
Schade, diesen göttlichen Anblick hätte er sich liebend gern aus nächster Nähe gegönnt.
Oder wenigstens als Video mit seinem Smartphone festgehalten.
Aber das wäre dann doch des Guten zu viel gewesen.
Ein gewisses Risiko war zwar ein Fest für seinen Adrenalinspiegel, aber man durfte es nicht übertreiben, wenn man es nicht unbedingt darauf anlegen wollte, erwischt zu werden.
Schließlich war er nicht bekloppt.
Jedenfalls hoffte er das, weil er urplötzlich einen unbezähmbaren Lachreiz verspürte, dem er nichts entgegenzusetzen hatte, als er seine Augen hinter dem Sehschlitz der Sturmhaube im Rückspiegel sah und an das dachte, was er soeben getan hatte.
Er musste rechts ranfahren, sich das schwarze, wollene Ding vom Kopf reißen, hysterisch den Stern in der Mitte seines Lenkrads anlachen und zwanghaft mit den Fäusten auf das Armaturenbrett einhämmern.
Es war wie ein Krampf, dem man nicht so ohne Weiteres Einhalt gebieten konnte. Das Zwerchfell schmerzte ihm schon.
Er schaffte es erst, damit aufzuhören, als er Sirenen vernahm und flackernde Blaulichter näher kommen sah.
Die Feuerwehr tat ihre Pflicht.
Großalarm.
Heulend und blinkend rauschte ein roter Einsatzwagen nach dem anderen an ihm vorbei und klatschte ihm das Wasser von der Straße gegen seinen Mercedes.
Es war eine ganze Armada von Feuerwehren.
Man hätte glatt meinen können, er habe halb Friedrichshafen in Brand gesetzt. Dabei war es nur so ein Wichserschiff mit einem Wichsernamen.
»Hella Wahnsinn«.
Nun – jetzt war es »Brennender Wahnsinn«.
Beinahe hätte er den nächsten Lachanfall bekommen.
Aber diesmal riss er sich zusammen und gab Gas, um endlich von der Bildfläche zu verschwinden.
3
Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide
No escape from reality
Queen, »Bohemian Rhapsody«
Kommissar Max Madlener stand in aller Herrgottsfrüh auf der weiträumigen Terrasse vor der Basilika Birnau und ließ seinen Blick über den Überlingersee, die nordwestliche Ausbuchtung des Bodensees, schweifen. Es war sein Lieblingsplatz am See, von hier aus hatte man einen wundervollen Panoramablick.
Seiner Meinung nach den schönsten überhaupt.
Nebelschwaden schwebten über der Insel Mainau und den Pfahlbauten bei Unteruhldingen, es war windstill, der Himmel über den Schweizer Alpen färbte sich rosaviolett. Die Rebstöcke der Weinberge, die sich unter ihm wohlgeordnet in Reih und Glied ausbreiteten, waren noch frühlingsgrün.
Über der Szenerie lag eine friedvolle Ruhe, wenn man das latente Grundrauschen ausblendete, das vom ständigen Verkehr stammte, der Tag und Nacht ohne Unterlass die B 31 entlangbrauste.
Es war eben so wie überall: Jede Ruhe war trügerisch, es fragte sich nur, wann sie vorbei war, dachte Madlener. Und warum man im Innersten nur darauf wartete, dass es unaufhaltsam so kommen musste, früher oder später.
Er merkte schon, dass er wieder einmal seinen philosophischen Tag hatte.
Aber das war kein Wunder.
Er hatte sein Fernglas dabei und schwenkte den Horizont ab.
Madlener genoss es, eine Stunde für sich zu sein, er hatte sich an diesem Morgen extra freigenommen, weil er in aller Ruhe über sich und seine Zukunft nachdenken wollte.
Was heißt freigenommen – er hatte sich selbst freigegeben. Als interimistischer Dienststellenleiter der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Friedrichshafen war Kommissar Max Madlener der oberste Dienstherr vor Ort und konnte innerhalb des Rahmens seiner Befugnisse tun und lassen, was er für richtig und angemessen hielt. Solange er die alltäglichen Verwaltungsarbeiten und die Papierstapel, die sich zu seinem Leidwesen auf seinem Schreibtisch türmten und trotz emsiger Büroüberstunden einfach nicht weniger werden wollten, nicht allzu sehr vernachlässigte.
Obwohl er manchmal nicht übel Lust verspürte, es so zu machen wie der Briefträger im nahe gelegenen Konstanz, bei dem vor Kurzem eine Hausdurchsuchung zutage gebracht hatte, dass der gute Mann vollkommen überfordert war und einen Großteil der Post, die er austragen sollte, bei sich in der Garage zwischengelagert und nach und nach in einem leeren Blechfass in seinem Schrebergarten verbrannt hatte.
Wenn Madlener seinen Blick von den Papierbergen auf seinem Schreibtisch aus dem Fenster seines Chefbüros hinaus auf die Müllcontainer im Hof des Präsidiums schweifen ließ, war er durchaus imstande, die Gedankengänge des Briefträgers nachzuvollziehen, und geriet schwer in Versuchung, alle Memos, Zettel, Anordnungen und Anfragen zu einem Bündel zu schnüren und auf Nimmerwiedersehen im Rachen des Papiercontainers verschwinden zu lassen.
Allmählich hatte er es satt, auf einem Posten zu sitzen, den er nie angestrebt hatte. Ganz im Gegenteil – er war ihm schon mehrfach angetragen worden, und er hatte jedes Mal dankend abgelehnt.
Doch nach der erzwungenen Demission der Kriminaldirektorin Schwanitz-Terstegen musste er nolens volens auf Geheiß seiner Vorgesetzten in den sauren Apfel beißen und sie widerstrebend so lange vertreten, bis ein Nachfolger gefunden war.
Er riss sich zusammen, so gut er konnte, aber die Welt der Wiedervorlagemäppchen war nun mal nicht die seine.
Verwaltungskram, Diensteinteilung, endlose Etatsitzungen und Telefonate, Urlaubsplanungen, Statistiken, Fortbildungsseminare, Schriftverkehr mit dem Ministerium – das alles langweilte ihn entsetzlich, um es jugendfrei auszudrücken.
Er war ein Mann der Tat und der Straße.
Spesenabrechnungen und Überstundenanträge prüfen und genehmigen – das sollten andere machen.
Zur überbordenden Bürokratie kam noch politisches Lavieren und diplomatisches Antichambrieren dazu.
Aber das war beileibe nicht alles.
Am schlimmsten war das Repräsentieren.
Madlener, sowieso kein Freund von größeren Menschenansammlungen, war gezwungen, bei sämtlichen städtischen Veranstaltungen anwesend zu sein. An der Seite von lokaler Politprominenz, Geld- und sonstigem Adel, Bankern, Winzern, Unternehmern, kurz: allen, die wichtig waren für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben im gesamten Bodenseeraum oder sich sonst wie für wichtig hielten. Und das waren eine ganze Menge.
Oft waren es zwei oder drei offizielle Anlässe pro Woche, auf denen er sich blicken lassen musste.
Und das insbesondere in der nach dem Weihnachtsrummel für ihn schlimmsten Jahreszeit am Bodensee, der fünften, dem Fasching. Im schwäbisch-alemannischen Sprachraum Fasnet genannt.
Wie hatte er den Aschermittwoch herbeigesehnt!
Aber ihm blieb nichts anderes übrig, als stoisch die Umzüge, die Karnevalssitzungen und das närrische Treiben über sich ergehen zu lassen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und dabei mit den Gedanken ganz woanders zu sein.
Dass diese ganzen Veranstaltungen eine lange historische Tradition hatten, war schön und gut und ihm von Kindesbeinen an bekannt.
Aber er hatte einfach keine Ader dafür.
Keinen Zugang.
Nie gehabt.
Das würde sich auch in diesem Leben nicht mehr ändern.
Harriet Holtby ging das genauso.
Wenigstens hatte er in seiner Assistentin eine Leidensgenossin. Aber Harriet hatte den Vorteil, dass sie nicht gezwungen war, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.
Von ihm in seiner neuen Position wurde es hingegen selbstverständlich erwartet. Ja, es war sozusagen eine Pflichtaufgabe, der er sich schwerlich entziehen konnte, indem er Unpässlichkeit oder sonst eine windelweiche Ausrede vorschützte.
Er war weder humorlos noch intolerant, aber mit albernen Verkleidungen, dem gemeinsamen Absingen von Liedern, die man nur im Vollrausch lustig finden konnte, Schunkeln und Büttenreden konnte er partout nichts anfangen.
Im Gegenteil, das alles war ein einziger Gräuel für ihn, ein Fegefeuer der falsch verstandenen, aufgesetzten Fröhlichkeit, ein Vorgeschmack auf die Vorhölle, und es bereitete ihm körperliche und seelische Qualen.
Dabei war er ein waschechter Eingeborener, der Bodensee war seine Heimat.
Heimat – auch so ein überstrapazierter Begriff, der, oft genug missbraucht, momentan wieder eine Art Renaissance durchmachte, erneut in aller Munde war und von der Politik – wie immer – je nach Standpunkt instrumentalisiert wurde. Wie hatte der Wiener Lebenskünstler Alfred Polgar gesagt, als er nach seiner Heimat gefragt wurde: »Ich bin überall ein bisschen ungern.«
Das war auch Madleners Devise.
Der Umstand, dass der Bodenseeraum bis in die Schweiz und nach Vorarlberg hinein eine einzige Faschingshochburg in sämtlichen Spielarten war, von der schrägen Guggamusik bis zu den rituellen Zusammenkünften mit dem obligatorischen »Narhallamarsch«, machte ihm jedes Mal den letzten Rest von Heimatgefühl zunichte, wenn er sich damit konfrontiert sah.
Ein zugegeben sentimentales Gefühl, das er zuweilen verspürte, wenn er mutterseelenallein bei magischer Föhnlage oder einer dramatisch aufziehenden Gewitterfront von der Aussichtsterrasse der Basilika Birnau seine Blicke über den Bodensee schweifen ließ.
So wie jetzt.
Er »glotzte romantisch«, wie Bertolt Brecht polemisiert hätte und er sich selbstkritisch in solchen Momenten eingestand.
Und zugestand.
Er machte das zuweilen, zu jeder Jahreszeit, am liebsten in der Morgendämmerung, wenn noch keine Touristen unterwegs waren. Weil er unter Schlaflosigkeit litt. Jedenfalls redete er sich das ein.
In Wirklichkeit steckte noch etwas anderes dahinter.
Die Sehnsucht nach einer heilen Welt.
Das genaue Gegenteil von der Welt, in der er sich berufs- und geburtsbedingt durchschlagen musste.
Das war naiv und kindisch, so viel war ihm klar. Deshalb wusste auch niemand davon, weil ihm das selbst ein wenig peinlich war.
Aber das war nun mal seine Art von Heimatgefühl.
Wenigstens für ein paar stille Minuten.
So lange, bis er durch seinen unvermeidlichen Handyton und die Worte seiner Sekretärin Frau Gallmann in die manchmal prosaische, manchmal raue Wirklichkeit zurückgeholt wurde.
Ein wichtiger Termin – welcher Termin war nicht wichtig! – mit dem Organisator des alljährlichen Seehasenfestes war vorgezogen worden. Madlener nahm es zur Kenntnis und legte auf.
Wenn er nicht seine Vorzimmerdame Frau Gallmann an seiner Seite gehabt hätte, die schon seinen Vorgängern als Chefsekretärin – jetzt: First Office Management Female Assistant – kompetent und zuverlässig durch sämtliche Untiefen geholfen hatte, er hätte nicht gewusst, wo ihm der Kopf stand. Immer wie aus dem Ei gepellt, immer gut gelaunt, immer da, wenn er sie brauchte. Ganz abgesehen davon, dass sie stets mit einer Tube Zovirax zur Hand war, wenn ihn wieder mal ein aufkeimender Herpes labialis in helle Panik versetzte – was stressbedingt immer öfter der Fall war – und er wie immer seine Tube in seinem Hotelzimmer vergessen hatte.
Von Anfang an war ihm sein Posten als Dienststellenleiter eher wie eine Strafversetzung vorgekommen, nicht wie eine Beförderung aufgrund seiner Verdienste.
Aber sobald er im Ministerium nachfragte, wann er denn nun endlich mit dem von Anfang an avisierten Nachfolger für die ehemalige Kriminaldirektorin Schwanitz-Terstegen rechnen konnte, erntete er nur Ausflüchte und wurde vertröstet, dass es bald so weit sei.
Nach dem Motto »Steter Tropfen höhlt den Stein« blieb Madlener am Ball und rief wöchentlich beim zuständigen Staatssekretär im Ministerium in Stuttgart an. Allerdings ahnte er seit geraumer Zeit, dass sein Ansprechpartner sich verleugnen ließ, sobald er seine Sekretärin Frau Gallmann bat, ihn zu diesem durchzustellen. Entweder war er gerade angeblich in einer furchtbar wichtigen Besprechung, mit dem Minister zu Tisch, gesundheitlich indisponiert oder im Urlaub.
Aber Madlener blieb weiterhin hartnäckig und beschloss, in der Causa nicht lockerzulassen. Irgendwann würde er denen da oben in Stuttgart so sehr auf den Geist gehen, dass sie sich endlich gezwungen sahen, ihm die versprochene Ablösung zu schicken.
Dann konnte er sich wieder um das kümmern, was ihm wirklich am Herzen lag und weshalb er bei der Kripo gelandet war: Ermittlungsarbeit und das Knacken von diffizilen Fällen. Das waren seine berufliche Leidenschaft und seine Bestimmung.
Manchmal beschlich ihn der leise Verdacht, dass er nichts Großartiges mit sich anzustellen wusste, wenn er nicht an einem Fall arbeiten konnte, der seine ganze Aufmerksamkeit und Konzentration erforderte. Darüber konnte er mit niemandem reden. Mit seiner Lebensgefährtin Dr. Ellen Herzog, der einzigen Person neben seiner Assistentin Harriet Holtby, der er vorbehaltlos vertraute, ging das nämlich momentan nicht, es herrschte Funkstille zwischen ihnen.
Ein letzter Blick auf die Alpenkette, die zum Greifen nah vor ihm lag, bestätigte ihm, was er in der Wettervorhersage im Radio gehört hatte. Es würde ein schöner Frühsommertag werden.
Kaiserwetter.
Er steckte sein Fernglas weg, setzte sich in seinen Dienstwagen und machte sich auf den Weg zurück.
Er hatte noch einen wichtigen persönlichen Termin, den er wahrnehmen wollte, bevor es ins Polizeipräsidium nach Friedrichshafen ging.
Einen sehr wichtigen – seine Entscheidung war endgültig, obwohl sie seine Beziehung zu Dr. Ellen Herzog einer ernsthaften Zerreißprobe unterziehen würde.
Er wusste nicht, ob diese Beziehung, die jahrelang so harmonisch funktioniert hatte, daran zerbrechen würde.
Sehr wahrscheinlich sogar.
Wenn er daran dachte, wurde ihm schwer ums Herz.
Aber er konnte nicht anders.
Er würde aus seinem Hotelzimmer ausziehen und eine Wohnung nehmen.
Eine eigene.
Und nicht bei Ellen in das Untergeschoss der väterlichen Villa einziehen.
So, wie sie es sich gewünscht hatte.
Ganz in seine schwermütigen Gedanken versunken, überholte er im Autopilotzustand halsbrecherisch einen Lastwagen samt Anhänger und scherte im wirklich allerletzten Moment vor dem plötzlich auftauchenden Gegenverkehr ein.
Mist, Mist, Doppelmist!
Das war gerade noch mal gut gegangen.
Wütend über seinen bodenlosen Leichtsinn, mit dem er sich und andere gefährdete, bremste er ab.
Er war ein erwachsener Mann, der eigentlich schon sämtliche Höhen und Tiefen des Lebens durchgemacht hatte und um Himmels willen endlich vernünftiger sein müsste.
Aber manchmal ging einfach der Gaul mit ihm durch.
Nicht umsonst nannte man ihn hinter seinem Rücken »Mad Max«.
Den Spitznamen hatte er sich redlich verdient.
Das wusste er nur zu genau.
4
Harriet Holtby sah kurz in den Spiegel im Flur ihres kleinen Apartments in Immenstaad, bevor sie zur Arbeit ins Polizeipräsidium fuhr.
Sie hatte keinen Spitznamen.
Jedenfalls soweit sie das wusste.
In ihrer Kindheit war sie »Harry« genannt worden, weil sie sich nur mit Jungs herumtrieb und weil sie wie ein Junge war: wild, ungestüm, bei jeder Frechheit ganz vorn mit dabei und bei jeder Rauferei ebenfalls. Ein Alptraum für Erziehungsberechtigte und Lehrer.
Jetzt, als Erwachsene, hatte sie nur ihrem Mentor und Kollegen Max Madlener einmal ihren früheren Spitznamen verraten und ihm sogar angeboten, sie so zu nennen, wenn sie unter sich waren.
Aber Madlener hatte das nie getan. Außer einmal, als er sich wirklich Sorgen um sie gemacht hatte.
Seither nie wieder.
Nicht etwa, um ihr nicht zu nahe zu treten. Das ließ sie sowieso nicht zu.
Doch für ihn war sie von Anfang an Harriet gewesen, und dabei blieb es. Vielleicht wollte er ihr unbewusst damit zeigen, dass er sie so respektierte, wie sie war.
Obwohl sie erst seit knapp drei Jahren zusammenarbeiteten, hatten sie bei den Fällen, in die sie involviert gewesen waren, mehr durchgemacht als andere Zweierteams in ihrem ganzen Berufsleben. Das hatte sie zusammengeschweißt. Jeder wusste, was er an dem anderen hatte. Das musste nicht ausgesprochen werden, weil ihnen das auch so klar war. Sie akzeptierten ihre jeweiligen Eigenheiten, die bisweilen grenzwertig waren. Sie kannten und verstanden sich meistens auch ohne Worte.
Auf Madlener hörte Harriet, obwohl sie im Allgemeinen widerborstig sein konnte wie ein störrisches Maultier. Ihre dabei offen zur Schau getragene Distanziertheit verlieh ihr ungewollt eine Aura der Arroganz. Sie hatte deswegen bei den meisten Kollegen den Ruf, eiskalt und überehrgeizig zu sein, aber wie sie auf andere wirken musste, das war ihr gleichgültig. Ihr soziales Verhalten hatte dadurch zuweilen etwas Autistisches.
Was ihr Äußeres anging, wunderte sich Madlener über ihren Hang zur ständigen Provokation und Veränderung schon lange nicht mehr. Das gehörte einfach zu ihrer Persönlichkeit. Für ihn hatte Harriet das Sternzeichen Chamäleon, Aszendent wahlweise Pippi Langstrumpf oder Sid Vicious.
Je nachdem, wie sie gerade drauf war.
Hatte sie einen schlechten Tag, gab sie sich abweisend und punkig. Lederjacke, Springerstiefel, Haare strubbelig und stachlig, mit Haarwachs zurechtgezwirbelt, adäquat zu ihrem Gemütszustand.
Hatte sie einen sonnigen Tag, kam Madlener sofort, wenn er ihr von der Seite einen unauffälligen Blick zuwarf, die dazu passende Liedzeile in den Sinn: Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt …
Von Anfang an hatte sie ihr Aussehen von einem Tag auf den anderen gern radikal verändert, einfach aus einer Laune heraus. So wie Farbe und Form ihrer Haare, ihre Kriegsbemalung, herkömmlicherweise auch Make-up genannt, und insbesondere den Anstrich ihrer Fingernägel, die sie mit Hingabe umlackieren konnte, während sie im Büro an ihrem Schreibtisch im Intranet der Polizei auf ihrem Computer herumsurfte. Ihre Arbeit vernachlässigte sie dabei nie. Sie hatte nicht nur ein eidetisches Gedächtnis, sondern war auch ein Multitasking-Phänomen.
Wenn ihr Kollege Götze sie auf ihre täglich wechselnden Fingernägel-Bepinselungen ansprach, entgegnete sie lapidar, dass Menschen, die ihre Nägel nicht lackierten, dazu neigten, die dafür notwendige Kunstfertigkeit zu unterschätzen. Dazu sah sie ihn so lange entwaffnend an, bis er achselzuckend das Weite suchte.
Ihr Selbstbewusstsein war so ausgeprägt wie ihr Glaube, sich auf diese Weise unangreifbar zu machen. Ihr rebellisches Image und den Habitus der Unnahbarkeit trug sie wie einen Schutzschild vor sich her.
Wehe, es sollte jemand auf die Idee kommen, ihr auf die Pelle zu rücken!
Das wiederum erinnerte Madlener an eine Sphinx.
Also hatte er insgeheim doch gleich mehrere Spitznamen für sie, die er allerdings nur in Gedanken verwendete und strikt für sich behielt.
Das Chamäleon blickte heute jedenfalls länger in den Spiegel als üblich.
Was es sah, war eine neu gestaltete und neu definierte Harriet.
Das Einzige, was sich nicht geändert hatte, war das Kaugummikauen. Weil sie ständig damit kämpfte, mit dem Rauchen aufzuhören.
Sie warf einen kurzen Blick auf das große schwarz-weiße Poster, das gerahmt neben dem Spiegel an der Flurwand angebracht war.
James Dean mit der Kippe zwischen den Lippen, wie er, gebeugt und gebeutelt vom Leben, bei grauem Regenwetter, den Mantelkragen hochgezogen, am Times Square in New York durch eine Wasserpfütze stapfte. Das berühmte ikonografische Foto von Dennis Stock.
Es war das einzige Bild in ihrem Apartment, und es verkörperte für sie ihren seelischen Zustand perfekt.
Aber gleichzeitig ermunterte es sie jeden Morgen aufs Neue, hinauszugehen in die Welt, um sich den inneren und äußeren Dämonen zu stellen, die dort auf sie warteten.
Gestern hatte Harriet ihren freien Tag dazu genutzt, ihrem Drang nach dramatischer Verwandlung wieder einmal nachzugeben und an sich selbst eine vollkommene Runderneuerung vorzunehmen.
Nach einer ausgiebigen Trainingseinheit im Boxstudio, das sie zweimal wöchentlich besuchte, nicht etwa aus rein sportlichen Gründen, sondern eher, um sich ihre irrationale Wut, die sich immer wieder in ihr anstaute, aus den Knochen zu boxen, indem sie, so lange sie konnte und bis ihr der Schweiß in Strömen herunterlief, einen Punchingball und anschließend einen Boxsack bearbeitete.
Danach kämpfte sie noch zwei oder drei Runden mit einem erfahrenen männlichen Sparringspartner im Boxring, ihrem Trainer, einem türkischen Amateurmeister im Bantamgewicht, wobei sie beide nicht darauf aus waren, den anderen k.o. zu schlagen. Es ging vielmehr darum, Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und Schnelligkeit zu verbessern, und um die Kunst, Defensive und Offensive abzuwechseln, Schlägen auszuweichen und zu kontern. Natürlich mit entsprechendem Kopf- und Mundschutz, aber bis zur völligen Erschöpfung. Wenn sie während einer Runde das Gefühl bekam, dass ihr Trainer nur mit sechzig Prozent Einsatz und vierzig Prozent Rücksichtnahme boxte, konnte Harriet wirklich sauer werden. Dann drehte sie so richtig auf, um ihn zu zwingen, sie als Gegnerin ernst zu nehmen. Auch wenn sie dann mehr einstecken musste, als ihr lieb sein konnte.
Sie genoss es, sich anschließend eine kleine Ewigkeit unter die eiskalte Dusche zu stellen, und fühlte sich danach immer wie neugeboren. Die paar blauen Flecken und die Schmerzen ignorierte sie. Denn wenn ihr etwas wehtat, dann verbuchte sie das unter »Erfahrungszuwachs« – das nächste Mal musste sie eben besser auf ihre Deckung achten.
Anschließend war sie mit ihrem neu erworbenen Enduro-Motorrad, einer gebrauchten, aber bestens erhaltenen BMWR 1200 Adventure – ihre alte Vespa hatte vor einiger Zeit den verbliebenen Geist mit einer letzten Fehlzündung endgültig ausgehaucht –, nach Lindau gefahren. Das Tattoo-Studio mit den zwei schwarz lackierten Schaufenstern hieß so, wie sich der Tätowierer, ein Meister seiner Kunst, nannte: »Rob Roy«, in stilisierter Frakturschrift geschrieben. Es lag zwischen einem Bio-Laden und einer türkischen Änderungsschneiderei in Lindau, aber nicht auf der Insel, sondern auf dem Festland bei Bad Schachen. Dort hatte Harriet eine längere Sitzung bei Rob, um ihre großflächige Rückentätowierung eines Long vollenden zu lassen. »Long« war der chinesische Name des Feuerdrachen der Mythologie aus dem Reich der Mitte. Ein Fabelwesen mit dem gewundenen Leib einer mächtigen Schlange, den Schuppen eines Fisches, mit Bart, gezacktem Rückenkamm, vier Adlerklauen und dem Gebiss eines Löwen, die hervorspringende Zunge war ein stilisierter Flammenstoß.
Er reichte gerade bis zu ihrem Haaransatz im Nacken.
Mit dem fertigen Ergebnis, einem opulenten farbigen Kunstwerk, zeigte sie sich bei einem Blick in den Spiegel und einem tiefen Zug an dem von Rob angebotenen Joint nach der überstandenen Sitzung äußerst zufrieden.
Sie bezahlte ihn cash – Rob bestand immer auf sofortiger Barzahlung – und kaufte ihm noch zusätzlich für fünfzig Euro ein paar Gramm seines selbst gezüchteten und mit marokkanischem Dope gestreckten Krauts ab, die Mischung nannte sich »Taliban«.
Dass Harriet bei der Kripo war, was Rob wusste, störte ihn nicht. Und sie ebenfalls nicht. Was sie in ihrer Freizeit machte, war ihre Privatsache. Berufliches und Privates pflegte sie strikt zu trennen. In der Beziehung war Harriet überaus diszipliniert.
Vor dem Tattoo-Studio schwang sie sich auf ihre Enduro und brauste zu ihrem nächsten Termin.
Dort wartete schon die Friseurin ihres Vertrauens auf sie. Edwina war nicht ganz zufällig die Cousine des Tätowierers. Sie war ähnlich verrückt und abgehoben wie Rob Roy, genauso am ganzen Körper tätowiert und hatte zahlreiche Piercings in Nase, Lippen, Augenbrauen und Ohren.
Und das waren nur die sichtbaren.
Edwina war keine Coiffeurin, bei der sich alte Damen mit Dauerwellen, Lilafärbung, Revolverblättern und Filterkaffee ein Stelldichein gaben und sich umgarnen ließen. Ihre Klientel stammte vorzugsweise aus der Subkultur und der Raver-Szene, um nicht zu sagen: eher aus exhibitionistisch orientierten Kreisen. Sie war also jemand, mit der Harriet gut klarkam, weil sie modemäßig auf ähnlich experimentierfreudiger Wellenlänge war und es im Gegensatz zu ihren normalen Berufskollegen vorzog, während der Arbeit die Klappe zu halten.
Ein gepflegtes Gespräch bei der Frisurgestaltung wäre auch kaum möglich gewesen, weil es in ihrem Laden aus den Lautsprechern wummerte wie in einem Techno-Club in einer Wochenendnacht. Ihr Salon nannte sich »Edwina mit den Scherenhänden«, und als Harriet ihr zeigte, wie sie ihre Haare, mit denen sie bisher die ganze Bandbreite von stachliger Punkfrisur bis Amy-Winehouse-Bienenkorb abgedeckt und ausprobiert hatte, verändert haben wollte, machte Edwina sich ohne Kommentar gekonnt ans Werk.
Harriet hatte ihr zwei Fotos vorgelegt, die sie aus dem Internet heruntergeladen hatte, und genauso wie die Schauspielerin auf dem schwarz-weißen Szenenfoto, die neben Jean-Paul Belmondo auf einer Pariser Straße zu sehen war, wollte sie ihre neue Frisur haben. Der Film hieß »À bout de souffle«, war von Godard, ein Klassiker der Nouvelle Vague, und der weibliche Star war Jean Seberg. Ihre Kurzhaarfrisur war damals, in den 1960er Jahren, eine Sensation gewesen, Seberg wurde zur Stilikone ihrer Zeit und des französischen Films.
Aber so strahlend hell, wie ihr Stern aufgegangen war, so schnell verglühte er auch wieder. Sie starb jung, wie James Dean, und unter nie geklärten tragischen Umständen.
Das zweite Bild zeigte Mia Farrow, die sich extra für die Dreharbeiten zum Film »Rosemary’s Baby« von Roman Polanski aus dem Jahr 1968 einen extremen Kurzhaarschnitt zugelegt hatte, der bei ihrem damaligen Ehemann Frank Sinatra – der schlappe dreißig Jahre älter war als Mia – zu einem Tobsuchtsanfall samt Scheidungsandrohung führte.
Im Gegensatz zu Frankieboy fand Harriet die Frisur großartig, und Edwina stimmte ihr stumm zu, bevor sie sich an die Arbeit machte.
Als sie fertig war, was mit Schnitt und Haarfärbung ziemlich lange dauerte, erkannte sich Harriet kaum wieder.
Jetzt war sie blond und sah tatsächlich aus wie die mittlere Schwester zwischen Jean Seberg und Mia Farrow.
Genau so hatte sie es sich vorgestellt, und es gefiel ihr.
Endlich hatte sie sich neu erfunden.
5
Open your eyes
Look up to the skies and see
I’m just a poor boy, I need no sympathy
Because I’m easy come, easy go
A little high, little low
Any way the wind blows, doesn’t really matter to me
Queen, »Bohemian Rhapsody«
Er summte leise »Bohemian Rhapsody« von Queen vor sich hin, dessen Text er auswendig kannte, weil es einer seiner Lieblingssongs war, und schaute von der kleinen Dachterrasse über die Dächer von Friedrichshafen, sogar ein schmaler Streifen Bodensee war am Horizont zu erkennen. Und, im Dunst, die Appenzeller Alpenkette mit dem Säntis, der eine weiße Haube aus Schnee hatte.
Sein Handy klingelte. Er sah nach dem Anrufer auf dem Display. Es war Ellen. Madlener seufzte und nahm den Anruf trotz seines schlechten Gewissens nicht an.
Jetzt nicht.
Seine Entscheidung war endgültig, und er zweifelte nicht mehr daran, dass sie richtig war.
Obwohl die Konsequenzen absehbar waren, würde er nicht weiter herumlavieren oder sie rückgängig machen.
Er würde seinem Hoteldasein, das nun auch schon über drei Jahre dauerte, endgültig Adieu sagen und diese Drei-Zimmer-Wohnung gleich bei der Fußgängerzone nehmen.
Was dieser Entschluss für seine Beziehung zu Ellen bedeutete, war ihm klar. Sie hatte es ihm ultimativ angedeutet, wenn auch nur indirekt. Weil er schon länger damit geliebäugelt hatte, sein letzten Endes doch einigermaßen ödes Hotelzimmerleben aufzugeben. Seit Monaten hatte Ellen ihm deshalb in den Ohren gelegen und ihm angeboten, ganz in die Wohnung im Erdgeschoss der väterlichen Kaffeemühlenvilla einzuziehen. Das Angebot kam nicht überraschend, mehr oder weniger lebte er sowieso schon dort – er hatte sogar einen eigenen Schlüssel –, außer er war beruflich so in einen komplexen Fall verwickelt, dass er es vorzog, in seinem Zimmer im Hotel »Zum silbernen Zeppelin« zu übernachten. Aus reiner Rücksichtnahme, weil er dann nur zu absolut unchristlichen Zeiten nach Hause und in sein Bett kam. Oder er brach noch vor der Morgendämmerung zu Fuß ins Büro auf, weil er sowieso kein Auge zumachen konnte, wenn allzu viel Berufliches in seinem Kopf herumgeisterte.
Doch Ellens Einwand gegen dieses Nomadendasein war eindeutig: Entweder er gab es auf und zog ohne Wenn und Aber bei ihr ein, oder in ihrer Beziehung kam es zu einer unumgänglichen Auszeit, in der sie beide Grundsätzliches überdenken sollten.
»Auszeit« wie »Eiszeit«, assoziierte Madlener, sagte es aber nicht.
Er überlegte, wie lange die letzte gedauert hatte.
Neunzigtausend Jahre?
Hunderttausend?
Endgültig bei Ellen einzuziehen war ein verlockendes Angebot, gewiss, aber diesen letzten, den entscheidenden Schritt scheute Madlener wie der Teufel das Weihwasser.
»Bindungsangst« wäre die simple Diagnose von Dr. Auerbach gewesen, dem renommierten Psychiater und leider auch Übervater von Ellen – und Bewohner der ersten Etage.
Vielleicht hatte Dr. Auerbach diese Kurzdiagnose der Madlener’schen Hinhaltetaktik bezüglich des Zusammenziehens mit Ellen so wortwörtlich zu seiner Tochter gesagt und sie ausdrücklich noch einmal davor gewarnt, sich weiter mit Madlener einzulassen.
Sehr wahrscheinlich sogar.
Obwohl ihr Verhältnis inzwischen einigermaßen intakt war. Besser gesagt: Es herrschte eine Art Patt, nachdem es anfangs erhebliche Dissonanzen zwischen ihnen gegeben hatte, weil Dr. Auerbach alles darangesetzt hatte, Madlener in den Augen seiner Tochter schlecht dastehen zu lassen, um zu verhindern, dass sie womöglich eine Beziehung unter ihrem Niveau einging.
Eine anerkannte Wissenschaftlerin und Pathologin mit Doktortitel aus einer regelrechten Dynastie von Medizinern mit einem Polizisten, der nichts Besseres zu tun hatte, als sich im Rotlichtmilieu und in zwielichtigen Kreisen herumzutreiben und Ganoven, Zuhältern und Schwerkriminellen hinterherzujagen – mon Dieu!
Inzwischen hatte es Ellen zwar geschafft, ihrem dominanten Vater die Meinung zu geigen, und Madlener war sozusagen als Schwiegersohn in spe notgedrungen akzeptiert worden, wenn auch sicherlich zähneknirschend.
Trotzdem – wenn Dr. Auerbach in der Nähe war, fühlte sich Madlener einfach nicht wohl in seiner Haut.
Es war irrational, zugegeben, aber er schaffte es nicht, in Bezug auf ein gemeinsames Zusammenleben in der Auerbach-Villa über seinen Schatten zu springen und die alten Querelen zu vergessen.
Und Ellen würde nie das Haus ihres Vaters verlassen, solange dieser noch im ersten Stock lebte, darum hatte sie Madlener mehrfach ans Herz gelegt, bei ihr einzuziehen.
Wenn er daran dachte, seufzte er aus tiefster Seele. Aber nur, weil er wusste, dass er allein war und ihn niemand hören konnte. Die Immobilienmaklerin, die ihn zum zweiten Mal in die leer stehende Wohnung gelassen hatte, damit er sich ganz sicher sein konnte, dass er sie auch wirklich wollte, führte ein wichtiges Telefonat und war deshalb vor die Tür gegangen.
Madlener machte erneut einen kleinen Rundgang durch die besenreinen, frisch geweißelten Räume, obwohl er seine Entscheidung schon gefällt hatte.
Es gab eine kleine Einbauküche mit Herd, Kühlschrank und Geschirrspüler, alles so gut wie neu, für die er noch eine Ablöse zahlen musste, aber sie war groß genug für ihn und seine Bedürfnisse, kleiner Esstisch, mattweiße Fronten, modern und zweckmäßig. Bei Eiche rustikal hätte er sofort den Rückzug angetreten. Aber die wohlfeile Ausrede, die Wohnung deswegen nicht zu nehmen, gab es in diesem Fall nicht.
Dazu ein helles Bad mit Oberlicht.
Das Wohnzimmer mit dem großen Panoramafenster in Richtung Süden hatte es ihm besonders angetan, ebenso die kleine Dachterrasse.
Dann waren da noch ein Schlaf- und ein Gästezimmer.
Oberstes Stockwerk, Dachgeschoss, alle Räume mit Dachschräge. »Lichtdurchflutet« hatte in der Anzeige gestanden.
Branchenübliches Maklergeschwätz, den schönfärberischen Ausdruck würde die Immobilienmafia auch auf eine Kellerwohnung in einem düsteren Hinterhof anwenden, selbst wenn es nur eine DIN-A4-große Fensterluke ins Freie gab.
Aber hier war der Begriff tatsächlich angebracht, es war hell und freundlich. Madlener fand es gemütlich. Einen Aufzug gab es auch.
Eigentlich wäre eine Zwei-Zimmer-Wohnung ausreichend für ihn gewesen. Das Gästezimmer brauchte er nur in der vagen Hoffnung, dass sein inzwischen siebzehn Jahre alter Sohn Oliver, der in einem Internat bei Radolfzell am Bodensee kurz vor dem Abitur stand, vielleicht doch ab und zu mal ein paar Tage bei seinem Vater zu verbringen gedachte.
Ein frommer Wunsch, das wusste er, weil sein Sohn sich inzwischen zu einem selbstständigen jungen Mann gemausert hatte, der so von Schule, Sport, Freunden, Events, Clubbesuchen und seiner Mutter, Madleners Ex-Frau, vereinnahmt war, dass er es gerade noch schaffte, seinen Vater alle zwei Wochen anzurufen. Anscheinend hatte er seit einiger Zeit auch eine Freundin, aber das wusste Madlener nicht von ihm, sondern von seiner Mutter. Er fand, dass es klüger war, abzuwarten, bis Oliver ihm von selbst davon erzählte. Mit Fragen löchern wollte er ihn nicht. Da war sein Sohn empfindlich und wurde sofort einsilbig. Erst recht, wenn es zu persönlich zu werden drohte.
Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm, dachte Madlener und übte sich in Zurückhaltung.
Er war genauso gewesen.
Und war es auch heute noch.
Trotzdem – er gab die Hoffnung nicht auf, Oliver vielleicht öfter zu sehen, wenn er jetzt eine eigene Wohnung hatte und nicht ausschließlich in einem Hinterhofhotel hauste.
Nach einem Blick auf seine Uhr folgte ein erneuter tiefer Seufzer.
Er musste zurück ins Büro. Sein First Office Management Female Assistant – vulgo: seine Sekretärin – Frau Gallmann hatte unter Garantie wieder ein Dutzend wichtige Anrufer damit vertröstet, dass er zurückrufen werde. Außerdem wartete der erste oder zweite Vorsitzende des Seehasenfest-Fördervereins auf ihn, er wusste es nicht mehr so genau, jedenfalls ging es um die Frage, wie viele Polizisten er aus seinem Ressort für die Zeit der alljährlich stattfindenden Großveranstaltung in Friedrichshafen abstellen konnte und wie viele er aus den angrenzenden Polizeidienststellen anfordern musste, um die Sicherheit des Festzuges zu gewährleisten. Das hätte auch Frau Gallmann besprechen können, die das schon seit Jahren gemanagt hatte, aber man erwartete von einem Dienststellenleiter, dass er sich in dieser für Stadt und Landkreis eminent wichtigen Angelegenheit selbst einbrachte. Zumal seine Kollegen Binder und Götze begeisterte »Häfler« waren, wie die Eingeborenen genannt wurden, und damit auch maßgeblich am Seehasenfest mitwirkten. Götze war sogar als zweiter Ersatzmann für den verkleideten Seehasen vorgesehen, falls der unwahrscheinliche Worst Case eintreten sollte, dass das Original und sein Backup ausfallen würden.
Die Anglizismen stammten nicht von Madlener, sie waren noch Überbleibsel aus der Ära seines Vorvorgängers, Kriminaldirektor Thielen, dessen Vorliebe dafür in Götzes Wortschatz hängen geblieben war. Götze war sich der großen Ehre bewusst, auserwählt worden zu sein, und konnte vor lauter Stolz kaum noch von etwas anderem sprechen.
Madlener hatte schon Panik geschoben, dass ihm der Oberfestorganisator die Rolle des Ersatzhasen auch noch antragen würde.
Ehrenhalber, sozusagen. Sodass er nicht Nein sagen konnte.
Schuld an dieser Befürchtung war Harriet, die ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit von diesem angeblichen Geheimplan erzählt und ihm damit einen gehörigen Schrecken eingejagt hatte.
In der darauffolgenden Nacht hatte Madlener davon geträumt, dass er in diesem albernen Hasenkostüm mit den Riesenohren als Bugs Bunny vorn auf dem Schiffsbug im Hafen anlandete, um Süßigkeiten an die jubelnden Menschenmassen zu verteilen – so wie das jedes Jahr zum Höhepunkt des Seehasenfestes üblich war.
Er war schweißgebadet aufgewacht, das Geschrei und Gekreische dröhnte eine ganze Weile in seinen Ohren nach, die er sicherheitshalber noch im Bett liegend abtastete, bis ihm klar wurde, dass seine Assistentin ihn ganz schön aufs Glatteis geführt hatte – Harriet wusste um seine Agoraphobie.
Sie neigte, was ihn anging, gelegentlich zu solchen Späßen, weil sie seine Schwächen und Ängste nur zu gut kannte.
Aber diesmal würde er sich rächen!
Er wusste noch nicht, wie, aber dass er ihr angeblich aufgeschnapptes Gerücht ernst genommen hatte und darauf hereingefallen war, das wurmte ihn doch beträchtlich.
Frau Gallmann konnte ihn am nächsten Tag vollends beruhigen: Erstens standen der Kandidat und seine Stellvertreter für den Seehas schon längst fest, und zweitens sei Madlener sowieso viel zu alt dafür.
Einerseits war er erleichtert, andererseits empfand er diese Aussage auch nicht gerade als Kompliment, als er sich an seinen überladenen Schreibtisch setzte und darüber ins Grübeln kam. Geistesabwesend räumte er die Akten und Papierstapel enger zusammen, um sich mehr Platz zu verschaffen.
Dann musste er sich regelrecht zwingen, seinen leeren Blick wieder auf die Papierstapel vor seinen Augen zu fokussieren. Das alles sollte noch durchgelesen, verstanden, umgesetzt und kommentiert werden.
An die Unterschriftenmappe, die Frau Gallmann gerade vorbereitete, die Briefe und die E-Mails, die er zusätzlich noch beantworten musste, wagte er gar nicht zu denken.
Mist, Mist, Doppelmist!
Irgendwie fühlte er sich an seinen fiktiven Kollegen Sherlock Holmes erinnert, der ebenfalls schwer darunter zu leiden hatte, wenn es keinen aufregenden und rätselhaften Fall für ihn gab. Dann fiel er stets aus purer Langeweile in tiefe Depressionen und Selbstmitleidsphasen, weil er wusste, dass er für ein normales menschliches Dasein nicht tauglich war.
Ja, vielleicht brauchte auch er wieder einen richtigen Fall, eine echte Herausforderung, um seine lähmende Alltagslethargie abschütteln zu können.
Er hörte eine Tür und Schritte. Die Immobilienmaklerin kam zurück in die Wohnung, sie hatte offensichtlich ihr Telefonat beendet.
Madlener sah ihr an, dass sie sich über irgendetwas aufregte, sie hatte hektische rote Flecken im Gesicht und schüttelte indigniert den Kopf.
»Ich will ja nicht indiskret sein«, fragte er besorgt, »aber ist was passiert?«
»Ja, kann man wohl sagen!«, antwortete sie mit einer gehörigen Portion Wut und Erregung in ihrer Stimme. »Sie sind doch von der Polizei …«
Er zuckte zustimmend mit den Schultern, fast als müsse er sich dafür entschuldigen.
»Dann erklären Sie mir doch bitte, warum es immer wieder Menschen gibt, denen es Spaß macht, anderer Leute Eigentum zu zerstören.«
Darauf hatte Madlener keine zufriedenstellende Antwort zu bieten, also übernahm das die Immobilienmaklerin, eine resolute, stämmige Mittfünfzigerin, gleich selbst.
»Ich will es Ihnen sagen. Weil einfach niemand mehr Respekt davor hat, was man sich mit Fleiß und Können aufgebaut hat. Heutzutage muss man seinen hart erarbeiteten Wohlstand geradezu vor anderen verstecken. Als ob man sich dafür schämen müsste. Der Sozialneid zündelt an unserer Gesellschaft, das ist eine gefährliche Entwicklung, finden Sie nicht auch?«
Madlener merkte, dass er sich mit einer eindeutigen Antwort auf dünnes Eis begeben würde, deshalb versuchte er es mit der alten Psychologentaktik, die er in diversen Therapiesitzungen bei Dr. Auerbach gelernt hatte, und stellte eine Gegenfrage: »Was meinen Sie konkret?«
»Mein Schwager war gerade am Telefon. Irgendjemand hat heute Nacht sein Schiff abgefackelt. Hier im Yachthafen von Friedrichshafen. Was sagen Sie dazu?«
»Was für ein Schiff?«
»Eine Motoryacht, die ›Hella Wahnsinn‹. Klein, aber fein. Was sind das für Menschen, die so was tun, Herr Kommissar?«
»Bösartige Menschen. Verbitterte. Betrunkene. Verwirrte. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Ihr Schwager Feinde, die sich rächen oder ihm eins auswischen wollen. Da gibt es viele Motive.«
»Und was tut die Polizei in so einem Fall? Nichts?«
»Das wird sehr ernst genommen, glauben Sie mir.«
»Können Sie sich nicht darum kümmern?«
»Tut mir leid, das fällt nicht in mein Ressort. Das ist Brandstiftung. Ich bin bei der Mordkommission. Aber ich werde mich beim zuständigen Kollegen erkundigen, was es damit auf sich hat und wie die Faktenlage ist. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr Schwager gut versichert ist …«
»Das dürfen Sie annehmen. Er hat selbst eine Versicherungsagentur. Eine ziemlich große.«
»Und es wurde doch niemand verletzt, oder?«
»Nein. Nur das Ego meines Schwagers hat wahrscheinlich ein paar Kratzer abbekommen.«
Madlener unterdrückte ein Grinsen.
Die Immobilienmaklerin ebenfalls, so schien es ihm.
»Nehmen Sie die Wohnung?«, fragte sie unvermittelt.
»Ich nehme sie«, antwortete Madlener und ließ einen lauten und deutlichen Seufzer hören.
Ob aus Erleichterung darüber, dass die Würfel gefallen waren, oder aus der Sorge heraus, was das für seine private Zukunft bedeutete, erschloss sich der Maklerin nicht.
Sie nahm es als Erleichterung und schüttelte ihm die Hand.
»Gratuliere«, sagte sie. »Eine gute Entscheidung.«
Das wird sich noch herausstellen, dachte sich Madlener, behielt das aber für sich.
6
Sie hatten an der viel befahrenen B 31 Posten bezogen, die, von Meersburg kommend, in Richtung Friedrichshafen verlief, bevor sie sich teilte. Der linke Fahrstreifen, die Albrechtstraße, ging um das Stadtzentrum am Zeppelinwerk entlang vorbei, während der rechte geradeaus ins Zentrum und als Zeppelinstraße zum Hafen führte.
Julian Böhme und Martin Schöllhorn waren zwei junge Polizisten der Friedrichshafener Verkehrspolizei, die ihren Job sehr ernst nahmen und keinen Funken Humor besaßen. Oft genug wurden sie dumm angemacht, wenn sie einen Strafzettel ausstellten oder eine Verwarnung aussprachen. Dann ignorierten sie auch schon mal eine blöde Bemerkung. Aber wenn mit verschärften Verbalinjurien bestimmte Grenzen überschritten wurden, gab es gnadenlos mit allen Konsequenzen eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Zuweilen, wenn ein Verkehrssünder renitent wurde und zu pöbeln oder zu spucken anfing – was in letzter Zeit anscheinend immer mehr in Mode kam –, mussten eben Zwangsmaßnahmen ergriffen werden. Dann fackelten sie nicht lange, der Aggressor wurde mit Handschellen gefesselt und abgeführt.
Böhme und Schöllhorn fuhren seit drei Jahren Streife und hatten sich im Dienst eine dicke Haut zugelegt, so gut das eben ging. Sie waren Junggesellen und befreundet und auch in ihrer Freizeit oft zusammen, wenn sie gemeinsam Sport trieben, segelten oder am Abend ein Bier trinken gingen.
Eine feste Beziehung hatten sie noch nicht, es gab hin und wieder eine Verabredung oder einen One-Night-Stand, aber anscheinend hatten beide noch nicht die Richtige gefunden.
Beziehungsweise waren gar nicht auf der Suche danach.
Das Leben hatte noch so viel zu bieten, sich jetzt schon voreilig zu binden wie die meisten ihrer Kollegen und Kolleginnen, sich mit Kindern und dem Sparen auf ein trautes Heim zu belasten, und das die nächsten fünfundzwanzig Jahre – das wäre ihnen wie eine Verschwendung von Möglichkeiten vorgekommen. Abgesehen davon, dass die Scheidungsrate bei Polizisten besonders hoch war. Sie hatten beide das Gejammer von älteren Kollegen im Ohr, deren Gehalt mit den Ausgaben für getrennte Wohnungen und Unterhaltszahlungen hinten und vorn nicht ausreichte. Es gab einige, die Nebenjobs annehmen mussten, um über die Runden zu kommen. Die schoben dann in ihrer freien Zeit Wachdienste, wer handwerklich was draufhatte, arbeitete schwarz für Nachbarn, Verwandte und Bekannte auf dem Bau oder half mit bei der Obst- oder Weinernte.
Das war nicht das Leben, das sich Böhme und Schöllhorn vorstellten. Schöllhorn bekam das hautnah mit, seine Eltern bauten seit zehn Jahren an einem Haus für die große Familie. Immer wenn das Geld ausging, ruhte der Bau. Er hatte bis vor Kurzem noch zu Hause gewohnt, musste oft genug mithelfen und hasste es, dass es ständig irgendwo im Haus eine Baustelle gab und er häufig genug seinem Vater zur Hand gehen musste – er war das älteste von fünf Geschwistern. Eine eigene Wohnung hatte er sich lange Zeit nicht leisten können, bei den Ansprüchen, die er hatte. Sein großes Hobby – ein teures! – waren sein Motorrad und Oldtimer, an denen er in jeder freien Minute herumbastelte. Aber jetzt war er umgezogen und hatte eine ehemalige alte Werkstatt samt Wohnung in einem Dorf im Hinterland gemietet.
Friedrichshafen und überhaupt der gesamte Bodenseeraum waren berüchtigt dafür, mit Radarfallen gespickt zu sein. Die mattgrün lackierten, altmodischen, auf dicken Pfosten angebrachten Metallgehäuse mit der Kameralinse, die nicht nur das Nummernschild, sondern auch noch den Fahrer erfasste, damit das Beweisfoto auch vor Gericht standhalten konnte, waren allgegenwärtig. Sinn und Zweck dieser Überwachungsgerätschaften war, den Tag und Nacht auf den Hauptdurchgangsstraßen strömenden Verkehr wenigstens einigermaßen einzubremsen. An Hinweisschildern wurde nicht gespart. Trotzdem gab es jede Menge Verkehrsteilnehmer, die gedanken- oder rücksichtslos dahinbretterten, vor allem nachts, weil sie es eilig hatten.
Ob mit oder ohne Grund, heutzutage hatte es jeder irgendwie eilig.
Um das zu ahnden, dafür waren sie da, die sogenannten Starenkästen.
Fieserweise an einigen Straßenabschnitten sogar mehrere hintereinander im Abstand von wenigen hundert Metern. Sodass der Fahrer, der glaubte, die erste Radarfalle ausgetrickst zu haben, indem er rechtzeitig nach dem Hinweisschild herunterbremste, um dann nach Passieren des Kastens wieder freie Fahrt zu haben und zu beschleunigen, prompt schon kurz darauf geblitzt wurde. Und wenn ihm das immer noch nicht genügte und er nicht vom Gas ging, weil’s jetzt eh schon egal war, dann kam die dritte Radarfalle, die ihm endgültig eine Aufstockung seines Punktekontos in Flensburg einbrachte.
Einheimische und Berufspendler wussten das natürlich und passten ihre Geschwindigkeit dementsprechend an.
Oder nahmen Schleichwege.
Aber dort lauerten die Verkehrspolizisten mit mobilen Messgeräten an den unterschiedlichsten Stellen, bevorzugt an solchen, wo man nicht damit rechnete.
So wie Böhme und Schöllhorn.
Sie hatten ihren Streifenwagen sorgfältig hinter einem Busch versteckt, er konnte erst bemerkt werden, wenn es zu spät war. Daneben standen sie auf der Lauer, Schöllhorn mit dem optischen Lasermessgerät neben Böhme. Die Zahl fünfzig war groß auf die Straße geschrieben, und Schilder zeigten zusätzlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Niemand konnte sich damit herausreden, dass er die Hinweise übersehen hatte. Dazu musste man schon blind sein.
Schöllhorn erfasste die Geschwindigkeit eines sich nähernden Autos, dessen Fahrer die Polizisten, obwohl sie über ihrer Uniform noch zusätzlich auffällige orangefarbene Schutzwesten trugen, erst im allerletzten Augenblick sah, als es längst zu spät war.
»Sechs drüber«, sagte er. »Lohnt sich nicht.«
Böhme wartete mit seiner Kelle in der Hand und nickte zustimmend.
Ein halbes Dutzend Autos fuhr nacheinander knapp am Limit, aber das lag daran, dass ein Lastwagen, der die Kolonne anführte, alle aufhielt, weil sie gezwungen waren, hinter ihm herzuschleichen.
In der Ferne sahen sie einen Motorradfahrer herankommen.
Schöllhorn zielte mit dem Lasergerät auf ihn.
»Sechzehn drüber. Den holen wir uns«, sagte er. Sein Partner konnte geradezu spüren, wie er sich darüber freute, den ersten Fang des Tages gemacht zu haben, obwohl er so tat, als sei alles nur Routine.
Böhme wusste, dass Schöllhorn am liebsten im Dienstwagen hinter einer großen Werbetafel gewartet hätte, wie die Jungs von der Highway Patrol in den USA, mit Stetson, verspiegelter Sonnenbrille und ausdruckslosem Gesicht, um dann beim geringsten Verkehrsverstoß oder einfach nur, weil man das Abzeichen am Ärmel hatte, mit aufheulender Sirene und flackerndem Blaulicht aus dem Hinterhalt hervorzupreschen, die Verfolgung des Sünders aufzunehmen und ihn zu stellen. Und sich anschließend kaugummikauend mit dem linken Ellbogen ins offene Seitenfenster zu lehnen – die rechte Hand sicherheitshalber auf dem Griff des Revolvers im Holster – und den Übeltäter gehörig schmoren zu lassen, bis man die obligatorische Frage nach den Fahrzeugpapieren stellte.
Da sie aber nicht in Dallas, Texas, waren, sondern in Friedrichshafen, Baden-Württemberg, stellte sich Böhme mit der Kelle winkend auf die Straße und gab dem Motorradfahrer zu verstehen, dass er rechts ranfahren und anhalten sollte.
Was er auch brav tat. Er blieb sitzen, machte den Motor aus und nahm den Helm ab, während Böhme und Schöllhorn herankamen.
Der Fahrer war die frisch erblondete Harriet Holtby. Seit Kurzem zur Kommissarin beförderte rechte Hand des Dienststellenleiters der Kriminalpolizei, Max Madlener.
Böhme und Schöllhorn erkannten sie natürlich, wenn auch erst auf den zweiten Blick, weil sie ihr Aussehen komplett verändert hatte. Immerhin war sie eine Kollegin von der Kripo, man lief sich im Präsidium oft genug über den Weg. Außerdem hatte Harriet zusammen mit Kriminalhauptkommissar Madlener eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil sie, wie alle in Polizeikreisen wussten, an der Aufklärung mehrerer großer Fälle maßgeblich beteiligt gewesen war. Das alles war oft genug durch sämtliche Medien gegangen.
Harriet sah betont gelassen zu, wie sie näher kamen.
»Guten Morgen«, sagte Schöllhorn in offiziellem Tonfall. »Sie wissen, dass Sie zu schnell gefahren sind?«
»Bin ich das?«
»Allerdings. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.«
Harriet atmete einmal tief durch, bevor sie sagte: »Hey, ihr kennt mich. Ich bin beim gleichen Verein wie ihr. Also …«
Sie machte eine Geste, die ausdrücken sollte, dass sie das Vorgehen der Kollegen für reichlich übertrieben hielt. Sie hatten sie zweifelsohne erkannt, auch wenn sie jetzt Kurzhaarfrisur und blond trug. Eine kleine, nicht ganz ernst gemeinte Anspielung darauf und auf ihre – wie sie fand – unerhebliche Geschwindigkeitsübertretung, und damit hätten sie es bewenden lassen können.
Das taten sie aber nicht.
»Sie wissen genau, Kollegin Holtby, dass wir keine Ausnahme machen dürfen. Oder sind Sie dienstlich unterwegs?«
»Nein, bin ich nicht«, antwortete Harriet wahrheitsgemäß. »Vorschlag: Ihr könntet trotzdem so tun, als wäre ich das. Ihr habt mich mündlich verwarnt, und damit wäre der Gerechtigkeit Genüge getan, und ihr könnt wieder euren Job machen.«
»Ts, ts, ts«, schüttelte Schöllhorn mit aufgesetzter Besorgnis den Kopf. »Das wollen wir aber nicht gehört haben. Oder, Kollege?«
Er sah Böhme an, der mit ernster Miene zustimmte.
»Lieber nicht«, sagte er, schenkte Harriet aber wenigstens ein kleines Lächeln. Vielleicht deutete es auch den Triumph an, dass sie jetzt Gelegenheit hatten, dieser arroganten Braut von der Kripo, die sich für etwas Besseres hielt, einmal eins auswischen zu können.
Schöllhorn streckte wortlos die Hand aus.
Harriet unterdrückte sichtlich genervt einen Kommentar, zog die Papiere aus ihrem Rucksack und gab sie Schöllhorn in die Hand, der sie umständlich und genau unter die Lupe nahm.
»Um wie viel war ich zu schnell?«, fragte Harriet, die versuchte, die Konversation wieder auf ein vernünftiges Level zu bringen.
Schöllhorn zeigte ihr das Sichtfeld des Messgeräts und führte ihr den Messvorgang noch einmal vor, die Geschwindigkeit war eingeblendet. Sechsundsechzig Kilometer pro Stunde.
»Sechzehn Stundenkilometer«, sagte er mit gespieltem Bedauern, gab Harriet die Papiere zurück und drückte auf seinem elektronischen Gerät herum, das längst den herkömmlichen Strafzettel abgelöst hatte.
»War’s das?«, fragte Harriet. Man hörte ihr deutlich an, dass sie sauer war.
»Das war’s«, antwortete Schöllhorn kurz angebunden.
»Sie bekommen schriftlich Bescheid«, fügte Böhme hinzu, »gute Fahrt!«
Er tippte kurz an seine Dienstmütze und begab sich mit seinem Kollegen in die alte Lauerstellung zurück.
Harriet blieb äußerlich cool, weil sie sich nicht provozieren lassen wollte. Es lagen ihr ein paar deftige Worte auf der Zunge, doch sie schluckte sie lieber hinunter, so weit hatte sie sich im Zaum, steckte ihre Papiere weg, schlüpfte in die Riemen ihres Rucksacks, setzte sich den Helm mit dem selbst gepinselten weißen Totenkopflogo und den gekreuzten Knochen auf schwarzem Grund auf, ließ den Motor an und fuhr nicht zu schnell und nicht zu langsam davon.