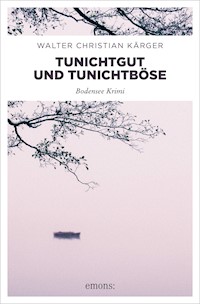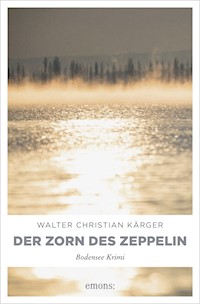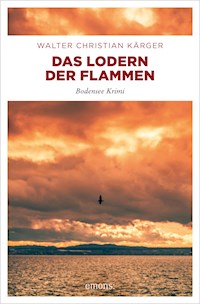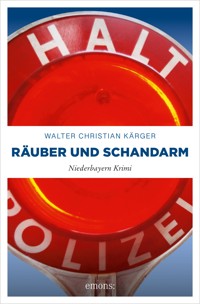Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Emons VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max Madlener
- Sprache: Deutsch
Cold Case am Bodensee. Madlener und Harriet ermitteln in einem Fall, der 30 Jahre zurückliegt. Am Bodensee wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, doch während ihre Kollegen nach dem Mörder fahnden, ermitteln Kommissar Madlener und seine Partnerin Harriet in einem Cold Case: Ein kürzlich verstorbener Mann hat gestanden, vor dreißig Jahren an einem schrecklichen Verbrechen beteiligt gewesen zu sein.Tatsächlich wurde damals ein Junge entführt und ist bis heute verschwunden. Madlener und Harriet rollen den Fall neu auf, um den Verbleib des Kindes endlich zu klären – und den noch lebenden zweiten Täter zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, absolvierte die Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Jan Hendrik
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-204-8
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Es ist Wahnsinn, zu verlangen,
dass Bösewichte nicht sündigen sollen.
Marc Aurel
Jedermann ist ein Mond
mit einer dunklen Seite,
die er niemals jemand anderem zeigt.
Mark Twain
Das Leben lässt sich
nur rückwärts verstehen.
1
Vor 33Jahren
»Weißt du was?«, fragte Grischa und äugte noch einmal durch das Okular des Amateurteleskops, das auf das Sternbild Gemini gerichtet war. Über dreißig Lichtjahre entfernt und nur im Winter zu sehen. »Das ist es, Elmar!«
Am 12. Februar 1991 gegen zwei Uhr nachts war es bitterkalt und sternenklar, aber er und sein bester Freund hatten dick gefütterte Parkas an, sich Schals um den Hals geschlungen und Mützen auf dem Kopf. Sie standen auf dem Flachdach der großen Werkstatt abseits von Schul- und Wohngebäuden des Internats, das im nördlichen Hinterland des Bodensees lag und nur Schülerinnen und Schüler aufnahm, deren Eltern sich die horrenden Jahresgebühren leisten konnten.
Vom Dach aus hatten sie einen guten Rundblick über den angrenzenden Wald hinweg, alle vom Wahlfach Astronomie nutzten den Platz, wenn sie Himmelsbeobachtungen machen wollten. Wegen des höhergelegenen Sichthorizonts und der relativ geringen Lichtverschmutzung. Aber in dieser Nacht waren nur Grischa und Elmar dort oben, die anderen Internatszöglinge und das Lehrpersonal waren schon längst schlafen gegangen.
Alle, die im Internat Klosterstetten ihr Abitur machen wollten, waren mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Die meisten zogen die Schulroutine stoisch durch, niemand rebellierte, und viele langweilten sich, aber bissen die Zähne zusammen mit dem Ziel, eines nicht allzu fernen Tages nützliche und gut verdienende Mitglieder der besseren Gesellschaft zu werden wie ihre Eltern.
Elmar und Grischa waren von Grund auf anders gepolt.
In dieser Nacht gingen sie als begeisterte Sternengucker ihrer großen Leidenschaft nach – dem Geheimnis und Wesen des Universums nachzuspüren. Sie waren natürlich die Besten im Wahlfach Astronomie. Kepler und Galileo junior nannte sie ihr Lehrer scherzhaft, der sie und eine Handvoll andere betreute.
»Hallo!«, sagte Grischa, als er keine Antwort bekam, und klopfte seinem Freund, der immer noch fasziniert auf das Firmament über sich starrte und nach Sternschnuppen Ausschau hielt, mit dem Finger an die Stirn. »Hallo – jemand zu Hause?«
»Ja«, antwortete Elmar und zuckte zusammen. »Ja, Mister Spock an Logbuch von Raumschiff ›USS Enterprise‹, Sternzeit 6334,1. Suche nach außerirdischen Lebensformen. Was liegt an, Captain Kirk?«
»Eine Eingebung, Mister Spock.«
»Eine Eingebung? Faszinierend. Dann lass mal hören …«
»Wir nennen uns nach dem Zwillingsgestirn im Gemini. Castor und Pollux. Das sind unsere Decknamen.«
Elmar legte seinen Arm um Grischas Schultern, beide schauten sie nach oben. »Nicht schlecht. Das gefällt mir: Castor und Pollux … Und wer bist du? Castor oder Pollux?«
»Natürlich Pollux.«
»Warum?«
»Weil er unsterblich ist. Im Gegensatz zu Castor. Pollux hatte Zeus zum Vater. Und Castor ist nur sein Halbbruder, sein Vater war der König von Sparta.« Er grinste Elmar an.
Elmar grinste zurück. »Du kannst es nicht lassen, oder?«
»Einer muss das Sagen haben.«
»Und das bist du?«
»Schau selber durch. Außerdem ist Pollux heller.«
Er trat einen Schritt zurück und überließ das Teleskop, das er nicht bewegt hatte, seinem Freund Elmar, mit dem er vom ersten Moment an, als sie sich kennengelernt hatten, auf einer Wellenlänge war. Sie waren wie eineiige Zwillinge, auch wenn sie äußerlich völlig verschieden waren.
Grischa war groß, rothaarig und sommersprossig, Elmar einen Kopf kleiner, dunkelhaarig und Brillenträger. Beide waren fast achtzehn Jahre alt und hatten noch eineinhalb Jahre bis zum Abitur. Sie tickten gleich, hatten dieselben Lieblingsfächer, nämlich Philosophie, Mathematik, Physik und Astronomie, was sie im Internat gewissermaßen schon zu Außenseitern machte, erst recht, weil sie ständig die Köpfe zusammensteckten und es immer so aussah, als ob sie über irgendetwas tuschelten, und sofort auseinanderfuhren, sobald jemand an sie herantrat und etwas von ihnen wollte. Aber das war ihnen vollkommen egal. Sie hatten einander und waren sich dessen bewusst, dass sie himmelhoch über den anderen standen, diesen langweiligen Spießern, denen jeglicher Sinn und der nötige Verstand dafür fehlten, etwas Besonderes zu sein, etwas Auserwähltes. In ihrer Arroganz verachteten sie die Normalsterblichen, die nicht die blasseste Ahnung davon hatten, was es bedeutete, in anderen Sphären zu denken, über sich selbst hinauszuwachsen, so etwas wie Übermenschen zu sein. Ungefähr auf diese Weise interpretierten sie ihren Nietzsche.
»Also sprach Zarathustra« war ihre Bibel, der Übermensch an sich war ihre Bestimmung, ihr Karma, jedenfalls bildeten sie sich das ein.
Es fehlte nur noch eine Tat, mit der sie das auch unter Beweis stellen konnten.
Etwas Gewagtes, Unglaubliches.
Jeder gängigen Moralvorstellung abhold.
Moral war etwas für verklemmte Erdlinge. Diese antiquierte Wertvorstellung hatten sie längst hinter sich gelassen.
So wie die beiden Studenten Leopold und Loeb das im Amerika der 1920er Jahre getan hatten, als sie den vierzehnjährigen Bobby Franks ermordeten, ohne erkennbares Motiv, nur um zu beweisen, dass sie es konnten, ohne jemals dafür belangt zu werden. Was ein Trugschluss war. Sie wurden erwischt.
Das konnten Grischa und Elmar besser machen, davon waren sie überzeugt. Außerdem waren ihre Ambitionen nicht dahin gehend ausgerichtet, dass irgendjemand verletzt oder sogar getötet wurde. Sie wollten sich und der Welt nur beweisen, dass man eine Entführung durchziehen, das Lösegeld abkassieren und ungeschoren davonkommen konnte.
Sie hielten sich für echte Überflieger, und das war es, was sie in ihrer Eitelkeit der Öffentlichkeit demonstrieren wollten. Natürlich hatten sie nicht vor, wie Loeb und Leopold für ihre Tat im Gefängnis zu landen, das war ja der Clou an der ganzen Sache. Unter der Tarnkappe der Anonymität zu beobachten, wie der unfähige und gnadenlos lächerlich gemachte Polizeiapparat sich vergeblich abstrampelte, ihnen auf die Schliche zu kommen – das war ihre Motivation. Während sie beide, im Bewusstsein ihrer Überlegenheit, von ihrer hohen Warte herabschauten und sich ein homerisches Lachen nicht verkneifen konnten angesichts der untauglichen Versuche seitens der dilettantischen Gesetzeshüter.
Was für ein göttlicher Spaß!
An einem Plan dieser Größenordnung arbeiteten sie schon seit geraumer Zeit.
Die Schulroutine erledigten sie nebenbei mit links. Dass sie auf die Idee gekommen waren, etwas Kriminelles zu veranstalten, geschah aus purer Langeweile heraus. Sie brauchten etwas, das sie herausforderte, ihre überragende Intelligenz auf die Probe stellte.
Während die anderen Internatszöglinge an den Wochenenden nach Hause fuhren, hatten sie die zahlreichen Einrichtungen des großzügig ausgestatteten Campusgeländes für sich allein und konnten die schuleigene Schreinerei für ihre Zwecke nutzen, ohne Fragen beantworten zu müssen, was es mit dem geräumigen Holzkubus auf sich hatte, den sie zusammenzimmerten. Sie waren handwerklich geschickt und stellten den Kasten, der die Größe eines begehbaren Kleiderschranks hatte, nach einem Baukastensystem her, damit sie die Einzelteile während der Woche im Holzlager aufbewahren konnten, bis sie die gesamte Einheit endgültig fertiggestellt hatten.
Wenn man die Teile zusammensetzte, war das Ganze nichts anderes als eine fensterlose Gefängniszelle mit einem Rohr zur Belüftung, die sie im Wald eingraben wollten, um dort ihre potenzielle Geisel unterzubringen, bis Lösegeld bezahlt worden war.
Das war der Plan.
Sie hatten ihn so lange durchdekliniert, bis sie davon überzeugt waren, dass er funktionieren musste, weil er perfekt war.
»Sollen wir es wirklich machen?«, fragte Elmar.
»Ja, wir ziehen es durch. Das Verbrechen des Jahrhunderts. Ist das nichts?«
Elmar breitete die Arme aus. »Es ist nichts – es ist alles!«, schrie er ins Weltall hinaus, sodass er noch auf Castor und Pollux zu hören sein musste.
Grischa legte seinen Zeigefinger auf die Lippen. »Scht! Das ist unser Geheimnis! Und das wird es auf ewig bleiben.«
»Tun wir es?«, fragte Elmar noch mal.
»Ja, wir tun es.«
»Es ist aber ziemlich riskant.«
»Na und? Das ist ja gerade das Reizvolle daran.«
»Wann fangen wir an?«
»Sobald der Boden nicht mehr gefroren ist. Wird auch so eine ganz schöne Plackerei werden, das Loch für die Kiste auszuheben. Und dann müssen wir auch noch eine abgelegene, schwer zugängliche Stelle finden, die geeignet ist. Eine Stelle, die so versteckt ist, dass keine Menschenseele durch Zufall darauf stößt. Oder uns beim Graben sieht. Kein Förster, kein Spaziergänger, kein Pilzsucher.«
»Schwierig.«
»Schwierig, aber nicht unmöglich. Das Undenkbare zu wagen – ist es nicht genau das, was wir wollen?«
»Ja, das ist es.«
Elmar sah Grischa an, dann küsste er ihn.
»Bist du verrückt? Wenn uns jemand sieht!«
»Wer soll uns sehen? Unser Astronomielehrer? Der ist doch selber schwul.«
»Woher willst du das wissen?«
»Also hör mal … das weiß doch jeder.«
»Hat er dich angemacht?«
»Nein. Das traut er sich nicht. Er ist ein Feigling.«
»Hast du ihn angemacht?«
»Schon. Ich glaube, ich habe ihn wirklich zum Schwitzen gebracht. Ich habe es in seinen Augen gesehen.«
»Was?«
»Dass er scharf auf mich war.«
»Hat dir das Spaß gemacht, ihn zu quälen?«
»Irgendwie schon. Rein sportlich, verstehst du? Nicht dass ich Lust auf ihn hätte. Hier ein Blick, dort ein Lächeln … mehr nicht. Ich habe ihn quasi am ausgestreckten Arm verhungern lassen.«
»Es hat dir also doch Spaß gemacht. Du bist ein Sadist und ein Meister im Manipulieren.«
»Ja, das Einzige, was ich wirklich gut kann.«
»Oh, das stimmt nicht. Du hast noch ganz andere Talente.«
»Findest du?«
Elmar küsste ihn erneut. Leidenschaftlich.
»Gehen wir auf unser Zimmer?«, fragte er. »Mir wird allmählich kalt.«
»Ja, so schnell wie möglich.«
Sie packten das Teleskop zusammen und verließen das Dach durch die große Luke, durch die man ins Innere des Gebäudes gelangte.
Die Sterne funkelten unbeeindruckt.
2
33Jahre später
Harriet Holtby heilte. Langsam zwar, aber sie heilte.
Madlener ließ sie nicht aus den Augen, seit sie aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen worden war und darauf bestanden hatte, zu ihrer Arbeit zurückzukehren. Sie wollte keine Auszeit nehmen, irgendwo Urlaub machen oder ein Sabbatical einlegen.
Nein, sie bestand darauf, sich wieder an ihren angestammten Schreibtisch zu setzen, ihren Computer einzuschalten und sich darum zu kümmern, ihre seit Wochen liegen gebliebenen E-Mails zu sichten und abzuarbeiten.
Dafür hatte Madlener vollstes Verständnis, und er legte ein Wort für Harriets Arbeitsbedürfnis bei Kriminaldirektor Cornelius ein, der seit Neuestem kommentarlos alles abnickte, was Madlener vorschlug. Weil er wusste, dass Madlener inzwischen ein ganz besonderes Standing in einflussreichen Kreisen hatte, gegen das anzugehen aussichtslos war.
Harriet und Madlener hatten unzählbare Hearings, die sie überstehen mussten, mit der Staatsanwaltschaft und einem internen Ermittlerteam aus Stuttgart, das sinnigerweise Eleonora Schwartz und Viola Weiss hieß, und das cool und unbarmherzig jeder noch so unbedeutenden Kleinigkeit nachging und versuchte, Harriet und Madlener irgendein falsches Vorgehen oder einen Fehler in der Ermittlungsarbeit anzukreiden. Die beiden waren absolut professionell und unnachgiebig, aber letzten Endes mussten sie einsehen, dass Madlener und Harriet kein Fehlverhalten nachzuweisen war.
Es war schon anstrengend und emotional genug für die beiden Kommissare, alles, was im letzten Fall passiert war, zum hundertsten Mal durchzukauen und zu begründen, bis auch der letzte Zweifel ausgeräumt werden konnte, dass alles nach rechtsstaatlichen Prinzipen abgelaufen und folgerichtig war, was sie durchgestanden hatten. Aber ihre Version der Abläufe wurde schließlich akzeptiert, und sie waren aus dem Schneider.
Nach langen Wochen der Anhörungen, Vernehmungen und Rekonstruktionen – sogar die Landespolizeipräsidentin und der Polizeiinspekteur aus Stuttgart waren involviert – wurden die Akten endlich geschlossen und der Fall für erledigt erklärt.
Harriet war vollständig rehabilitiert.
Im Polizeipräsidium Friedrichshafen wurde Madlener anlässlich einer Abschlussbesprechung in Anwesenheit einiger hoher Tiere aus dem Innenministerium für sein Eingreifen sogar eine besondere Belobigung der Landespolizeipräsidentin ausgesprochen. Madlener war normalerweise kein Freund von solchen Veranstaltungen, in denen sich die Polizei selbst auf die Schulter klopfte, doch in dem Fall war er froh, alles überstanden zu haben. Erst recht auch für Harriet. Er nahm die Glückwünsche einigermaßen dankbar entgegen und hoffte nur, dass der Lobhudelei bald ein Ende gesetzt wurde und er wieder seine stinknormale Arbeit aufnehmen konnte. Er hatte getan, was getan werden musste, und die warmen Worte waren ihm gleichgültig. Aber er schüttelte alle Hände, die ihm hingestreckt wurden, auf dass er niemanden beleidigte, diese diplomatische Lektion hatte er inzwischen gelernt.
Unter dem positiven Einfluss seiner neuen Lebensgefährtin war aus dem Saulus geradezu ein Paulus geworden – jedenfalls, was den Umgang mit Vorgesetzten anging.
»Mad« Max hatte Kreide gefressen. Oder waren es erste Anzeichen von einsetzender Altersmilde? Wie lange das anhielt, konnte er selbst nicht sagen. Sogar die »Mutter der Kompanie« im Polizeipräsidium wunderte sich. So wurde Frau Gallmann insgeheim von Madlener genannt, obwohl er eigentlich jeglichen Militärjargon verabscheute, aber dieser Ausdruck passte nun einmal genau auf sie, die Sekretärin für alle Angelegenheiten und Gelegenheiten, offiziell »First Office Management Female Assistant«. Zugegeben, eine alberne, aber in Stellenanzeigen im Netz üblich gewordene modernistische Berufsbezeichnung, die Götze eingeführt hatte und die Madlener gerne benutzte, wenn er Frau Gallmann auf den Arm nehmen wollte, weil er wusste, dass sie sich darüber ärgerte.
Frau Gallmann kannte Madlener inzwischen gut genug, um zu wissen: Es war nur eine Frage der Zeit und brauchte nur einen kleinen Anlass, dass ihm wieder einmal der Geduldsfaden riss. Jeder Vulkan hatte seine Ruhezeiten, bis irgendwelche Verwerfungen dafür sorgten, dass er von jetzt auf gleich erneut explodieren konnte.
Um sich selbst war Madlener nicht besorgt.
Aber um Harriet.
Der psychische Druck auf sie war aus seiner Sicht eigentlich unerträglich, aber Harriet hatte sich ihrer Jahre zurückliegenden traumatischen Geschichte gestellt und bewies Stärke und Durchhaltevermögen, obwohl es an die Grenzen ihrer Belastbarkeit ging. Doch weil sie selbst wusste, dass sie da durchmusste, tat sie es mit der ihr eigenen Verbissenheit. Madlener sah es ihr an, dass sie ein zweites Mal durch die Hölle ging, er bewunderte sie für ihren Mut und ihre gnadenlose Ehrlichkeit sich selbst und den externen Ermittlerinnen und Ermittlern gegenüber.
Er unterstützte sie, wo er nur konnte, indem er bei jeder Sitzung anwesend war, wenn sie dies wünschte. Und zu seiner Verwunderung wollte sie es, auch wenn seine Anwesenheit nicht viel mehr war als ein imaginäres Händchenhalten. Sie wusste, ihr bester Freund und Kollege saß an ihrer Seite und würde für sie aussagen, falls es nötig sein sollte. Schon diese absolute Gewissheit gab ihr Rückendeckung und Sicherheit.
Natürlich wurde auch Madleners Rolle beim Untergang der »Moby Dick II« und beim Tod ihres Miteigners genauestens untersucht. Zeitweise kam sich Madlener vor wie ein Angeklagter bei einem Inquisitionsprozess, bisweilen musste er einem Dutzend Beamten Rede und Antwort stehen. Aber er kämpfte sich mit Ruhe und Gelassenheit durch sämtliche Vernehmungen und Kreuzverhöre sowie durch die Rekonstruktion des Tatverlaufs auf der Jacht, mit der Dr. Hahn untergegangen war – schließlich hatte er sich nichts vorzuwerfen. Er blieb stur und konsequent bei seiner Version, und Skrupel plagten ihn schon gar nicht angesichts der Vorgeschichte und der Tatsache, dass der mehrfache Mörder und Vergewaltiger Gottfried Hahn alle Schuld Harriet Holtby in die Schuhe schieben wollte und sie deswegen unter Drogen gesetzt hatte, sodass sie als kaltblütige Mörderin dastand und das sogar selber glauben musste, weil sie durch die K.-o.-Tropfen einen totalen Filmriss hatte und sich an nichts mehr erinnern konnte.
Bis Madlener die Wahrheit aufdeckte und dabei sein Leben riskierte.
Seltsamerweise waren seine früheren Schlafschwierigkeiten seitdem wie weggeblasen. Und sein ständig wiederkehrendes Herpes-Problem ebenfalls. Er schlief ein, wenn er müde war, und konnte durchschlafen, ohne mitten in der Nacht schweißgebadet aufzuwachen und manchmal nicht einmal zu wissen, warum.
Aber vielleicht lag das auch daran, dass er an der Seite von Simone Zoller lag, entweder bei ihr oder in seiner Wohnung, an die er sich inzwischen einigermaßen gewöhnt hatte. Wenn er wirklich einmal kurz wach wurde, spürte er sie neben sich, legte seinen Arm um sie und war sofort wieder im Nirwana.
In einem friedlichen Nirwana, in dem keine Geister aus der Vergangenheit auftauchten, wie es früher allzu oft der Fall gewesen war. Meistens Gesichter mit krimineller Agenda, die sich rächen wollten, weil er sie hinter Gitter gebracht hatte. Oder eine seiner Ex-Frauen, die ihm Vorwürfe machte, die er nicht mehr verstand, weil die Trennung schon so lange her war und er seine Verpflichtungen immer erfüllt hatte. Trotzdem waren sie in seinen Alpträumen immer unterwegs zu einem Flughafen, natürlich waren sie zu spät dran, und er hatte die Koffer vergessen oder falsch gepackt.
Er hätte nicht sagen können, welcher der Alpträume schlimmer gewesen war.
Nein, er hatte das Richtige getan, und das war anscheinend gut für seinen Seelenfrieden.
Ganz allmählich stellte sich im Polizeipräsidium Friedrichshafen so etwas wie Normalität ein.
Business as usual.
Bis Miriam kam.
3
Vor 33Jahren
Nach wochenlanger Schinderei war alles für die Entführung vorbereitet. Die Kiste war mitten im Wald in einer fast unzugänglichen Senke eingegraben. Wenn man den Deckel zumachte und ihn mit Erde, Blättern und Zweigen bedeckte, lugte nur ein kleines Stück des Belüftungsrohrs heraus, und wenn nicht jemand zufällig darüber stolperte, was äußerst unwahrscheinlich war, war nichts davon zu sehen.
Grischa und Elmar hatten im »Bunker«, wie sie den Kasten nannten, alles so eingerichtet, dass es der Geisel an nichts fehlen sollte, um eine Woche – mehr veranschlagten sie nicht bis zur Lösegeldübergabe – durchzuhalten. Dafür hatten sie in verschiedenen abgelegenen Supermärkten eingekauft, alles sorgfältig abgewischt – sie arbeiteten stets mit Latexhandschuhen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen – und damit den Bunker ausgestattet: genügend Trinkwasser in Flaschen, Kekse, Schokolade, Comics als Lesestoff, eine Taschenlampe mit Ersatzbatterien, ein Eimer, Toilettenpapier, eine alte Matratze, Decken.
Was fehlte, war nur noch die geeignete Geisel.
Sogar den Erpresserbrief hatten sie schon vorbereitet, er war aus ausgeschnittenen Zeitungsschnipseln zusammengestellt.
Das war zwar in Zeiten von Computer und Drucker ziemlich old fashioned, aber lenkte ihrer Meinung nach die Ermittler der Kripo auf die falsche Spur. Nämlich dass sie es mit einem Täter zu tun hatten, der noch im analogen Zeitalter stecken geblieben und damit älter war. Außerdem sah es irgendwie dramatischer und somit authentischer und gefährlicher aus. Als kleinen Sidekick hatten sie einige grammatische Fehler eingebaut, um die Analyseexperten endgültig in die Irre zu führen. Vielleicht war der Erpresser ja ein Ausländer? Nur der Schlusstext mit der Lösegeldübergabe stand noch nicht drin, darüber mussten sie sich selbst erst schlüssig werden.
Tagelang hatten sie abwechselnd, sofern es der Schulbetrieb zuließ und es nicht auffiel, dass einer fehlte, am Uferweg zwischen Meersburg und Unteruhldingen auf der Lauer gelegen, um nach einem potenziellen Opfer Ausschau zu halten. Die einzige Schwierigkeit war, ihre Geisel ins weit entfernte Versteck zu bringen, ohne von jemandem gesehen zu werden.
Sie hatten inzwischen beide ihren Führerschein gemacht, und Grischas Vater hatte seinem Sohn ein Auto spendiert, einen VW Golf, der zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, für ihr Vorhaben aber ausreichte.
Auch das Opfer hatten sie endlich im Visier, es war der zwölfjährige Sohn eines Bankdirektors, sein Name war Wolfgang Becker. Er hatte regelmäßig jeden Montag und Donnerstag Musikunterricht und pendelte mit dem Fahrrad zwischen Meersburg, wo das Geigenstudio war, und seinem Elternhaus in Unteruhldingen hin und her. Das Elternhaus war eine Villa am Hang mit Seeblick und vermittelte ganz den Eindruck, dass die Besitzer genügend Vermögen besaßen, um eine Million Mark als Lösegeld bezahlen zu können.
Fehlte nur noch ein Tatverdächtiger, den sie der Polizei als Köder liefern konnten, um von sich abzulenken. Wenn sie den gefunden hatten, war ihr Plan so gut wie in trockenen Tüchern.
Sie hatten wirklich an alles gedacht.
Bis auf die Lösegeldübergabe. Sie war die Achillesferse ihres Unternehmens.
Das war ihnen klar, und sie hatten sich deshalb mit entsprechender Literatur über berühmte Entführungsfälle eingedeckt, um den entscheidenden Schwachpunkt zu analysieren, der immer wieder dazu geführt hatte, dass die Entführer von der Polizei geschnappt worden waren. Egal, wie sie es angestellt hatten: Fast alle waren dabei erwischt worden, wenn sie das Geld auf entlegenen Parkplätzen, oder wo es sonst deponiert worden war, abholen wollten.
Aber Grischa hatte sich dieses Problems angenommen und sich ausgedacht, wie es zu bewältigen war.
»Pass auf«, sagte er nach dem Abendessen, als sie noch ein wenig spazieren gingen, damit sie nicht belauscht werden konnten. »Wir besorgen uns zwei Walkie-Talkies und legen eines unserem Erpresserbrief bei. Darin schreiben wir, dass der Mann mit dem Lösegeld eine bestimmte Bahnstrecke fahren soll. Mit dem Funksprechgerät. Irgendwann kriegt er von uns den Hinweis, das Geld aus dem fahrenden Zug zu werfen. Sie können unmöglich eine Strecke von hundert Kilometern komplett überwachen. Wir müssen uns nur eine Stelle aussuchen, die geeignet ist. Was sagst du dazu?«
»Klingt gut, Pollux«, meinte Elmar und klopfte seinem Freund anerkennend auf die Schulter. »So machen wir es. Ich habe übrigens auch etwas mitgebracht.«
Er hielt eine Plastiktüte hoch.
»Was ist das? Ein Geschenk?«
»Ja. Aber nicht für dich. Für die Bullen. Es ist eine Bierdose mit den Fingerabdrücken von unserem Kandidaten, den wir uns als Hauptverdächtigen auserkoren haben.«
»Dem Kioskbetreiber in Unteruhldingen?«
»Genau der. Ich habe mich unauffällig umgehört.«
»Unauffällig? Was heißt das?«
»Na ja, vor dem Kiosk hängen immer genug Leute an den Stehtischen herum. Du weißt schon – die üblichen Stammtischbrüder und -schwestern. Die quatschen nach ein paar Bierchen so laut, dass es jeder mitkriegt, ob er will oder nicht. Ich war ein paarmal da und hab eine Cola gezischt und gut zugehört. Unser Kandidat soll Schulden haben und seine Pacht seit Monaten nicht bezahlen können. Wenn wir diese Dose, die er in der Hand gehabt hat, im Bunker deponieren und nach der Übergabe des Lösegelds den Bullen den anonymen Tipp geben, wo die Geisel steckt, dann haben sie den Burschen am Kanthaken. Er heißt übrigens Karl Meggle. Soviel ich mitbekommen habe, ist er geschieden, bezahlt keinen Unterhalt, weil er im Dauerstreit mit seiner Ex lebt, die ihn angeblich ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans. Jedenfalls erzählt er das gerne, wenn er anfängt, sich an seinem eigenen Biervorrat zu vergreifen.«
»Der perfekte Erpresser. Und das perfekte Ablenkungsmanöver.«
»Ganz genau. Und dann schlage ich noch vor: Wenn wir den Jungen im Bunker haben … vielleicht sollten wir einen kurzen anonymen Anruf tätigen. Dass wir Augenzeugen der Entführung waren und gesehen haben, dass er in einen Ford Transit verfrachtet worden ist. Der Ford steht immer hinter dem Kiosk. Ich habe sogar das Kennzeichen.«
»Hey – die Idee könnte ja glatt von mir stammen!«
Elmar klopfte Grischa gespielt wohlwollend auf die Schulter. »Tja, Pollux, Castor ist auch nicht ohne …«
Er sah sich um – es war niemand in der Nähe – und zog ein kleines Fläschchen mit einer farblosen Flüssigkeit aus seiner Tasche, das er Grischa zeigte.
»Ich habe noch mehr.«
»Was ist das?«, wollte Grischa wissen.
»Unser Zaubertrank. Ich war so frei und habe mir ein wenig in der Apotheke meiner Mutter abgezapft für unsere Zwecke.«
Grischa nahm es ihm ab und sah es an. »Was ist da drin?«
»Trichlormethan.«
»Chloroform?«
»Bravo. Gut aufgepasst in Chemie. Schließlich wollen wir doch nicht, dass der Junge noch anfängt sich zu wehren und herumzuschreien. Oder gar davonläuft …«
So viel zur Theorie.
Die Praxis sah anders aus.
4
33Jahre später
Im Polizeipräsidium Friedrichshafen, Kommissariat 1, vorsätzliche Tötungsdelikte, Geiselnahme und Menschenraub, bedeutete business as usual, dass Kriminaldirektor Cornelius auf Dienstreise bei Europol weilte, Frau Gallmann mit ihrer Präsenz die Garantin für Kontinuität, Zuverlässigkeit, guten Kaffee und Selbstgebackenes war, auch wenn das altmodisch sein mochte, aber sie wollte es von sich aus so, Madlener und Harriet Bürokram erledigten und dass Götze, ihr Kollege, der mit dem letzten Fall eindeutig an Statur, Gewissenhaftigkeit und Engagement hinzugewonnen hatte, Fachzeitschriften studierte, insbesondere aus den angelsächsischen Ländern. Er hatte sein Faible für amerikanische und britische Kriminalistik noch vertieft und liebäugelte damit, ein Seminar in den USA zu besuchen, in Quantico, dem Sitz der FBI-Abteilung für Verhaltensforschung.
Einen Antrag dafür hatte er schon in Stuttgart eingereicht, obwohl er nicht mit einer schnellen Zusage rechnete – er kannte inzwischen die Mühlen der Bürokratie, die noch langsamer mahlten als diejenigen Gottes. Mit Kopfhörern arbeitete er fleißig in einem Online-Sprachkurs für Fortgeschrittene an seinem amerikanischen Englisch, und das Einzige, was man von ihm hörte, waren Sätze, die er der besseren Aussprache wegen laut deklamierte, als hätte er eine heiße Kartoffel im Mund, weil er sich unbedingt einen waschechten amerikanischen Slang angewöhnen wollte.
Er trug nach wie vor Slim-Fit-Anzüge und verbrachte seine Freizeit bevorzugt im Fitness-Studio, was man ihm auch ansah, sein Body-Mass-Index war im idealen Bereich.
Und: Er besuchte sogar ab und zu seinen Ex-Kollegen Binder, der seinen Ruhestand mehr oder weniger genoss.
Mehr, weil er sich nicht länger mit Mördern, Vergewaltigern und sonstigen Schwerkriminellen auseinandersetzen musste.
Weniger, weil er so recht nichts mit sich anzufangen wusste und darunter litt, dass er seiner Frau mitunter schwer auf den Geist ging, weil er überwiegend zu Hause war und an allem und jedem herumnörgelte. Das Einzige, was ihn neben der Frage, was es zum Abendessen gab, wirklich interessierte, waren Neuigkeiten aus seinem alten Revier. So ganz konnte ein eingefleischter Bulle wie er eben nicht aufhören, Bulle zu sein, wie er Götze gegenüber gestand.
Er hatte inzwischen ganz schön zugenommen, was insbesondere an Bewegungsmangel und den Kochkünsten seiner Frau lag, denen er nicht widerstehen konnte.
Wenn Götze bei ihnen zum Abendessen eingeladen war, was öfters vorkam, weil Frau Binder seine Gesellschaft, seinen gesunden Appetit und seine Geschichten aus Quantico schätzte, die er sich alle angelesen hatte, musste er anderntags im Hallenbad zwanzig Extrabahnen zusätzlich zu seinem Routinepensum dreimal die Woche absolvieren, um seine Form nicht zu verlieren.
Madlener hatte sich aus dem Archiv von Frau Gallmann einen ganzen Aktenberg mit Altfällen besorgen lassen, sogenannte Cold Cases, die er zusammen mit Harriet systematisch durchging. Sie suchten nach neuen Ansätzen, nach Hinweisen, die übersehen worden waren, nach Zeugenaussagen, die sich widersprachen, nach irgendetwas, wo sie einhaken und vielleicht etwas Neues ans Tageslicht bringen konnten.
Die nicht digitalisierten Akten reichten zurück bis ins Jahr 1991, es gab mehr als genug davon: spurlos verschwundene Mädchen, nicht identifizierte Leichen, Verdächtige, denen nie etwas hatte nachgewiesen werden können. Einige davon waren inzwischen verstorben, wie Harriet schnell herausfand, und wenigstens diese Fälle konnten sie so herausfiltern und die entsprechenden Unterlagen beiseitelegen.
Aber es war trotzdem eine frustrierende Arbeit.
Madlener verbiss sich in den Fall der vermissten Liselotte Kreuzer, eine junge Frau, die seit über zwanzig Jahren verschwunden und wahrscheinlich ermordet worden war, wie der zuständige Ermittler damals schriftlich festgehalten hatte. Aber eine Leiche wurde nie gefunden. Und dem Tatverdächtigen – ihrem Verlobten – konnte nie etwas nachgewiesen werden.
Sie vernahmen ihn erneut. Er war inzwischen dem Anschein nach ein treu sorgender Familienvater und Ehemann, die drei Kinder waren im Teenageralter. Seine jetzige Ehefrau empörte sich darüber, dass ihr Mann immer noch von der Polizei belästigt wurde, wie sie sich ausdrückte. Sie bezeichnete Madleners und Harriets Vorgehen als Schikane, und der ehemalige Verlobte der spurlos verschwundenen Liselotte Kreuzer bekam einen Weinkrampf, als Madlener ihn mit allem, was sie an Beweisen und Vermutungen aufzubieten hatten, konfrontierte.
»Ich bin unschuldig!«, beteuerte er. »Warum lassen Sie mich nicht endlich in Ruhe?«
Madlener nahm ihm die Nummer mit den Krokodilstränen nicht ab, aber was sollte er machen?
Sie verließen die Doppelhaushälfte, und die Frau des Verdächtigen schrie ihnen noch nach: »Wenn Sie noch mal hier auftauchen, dann hetze ich einen Anwalt auf Sie! Der wird Sie verklagen wegen Amtsmissbrauch und Verleumdung! Scheren Sie sich zum Teufel!«
Als sie, ohne das Geringste erreicht zu haben, wieder im Dienstwagen saßen, fragte Harriet: »Meinst du, er war es?«
»Ja, er war es«, sagte Madlener mit großer Bestimmtheit. »Da bin ich mir sicher. Aber wir werden es ihm nie nachweisen können, solange er es nicht von selbst zugibt oder bis die Leiche mit DNA-Spuren von ihm irgendwo auftaucht. Der einzige Trost, den ich in diesem Augenblick habe, besteht darin, dass er hoffentlich nachts kein Auge zutun kann vor lauter Angst, dass wir Liselotte Kreuzer durch irgendeinen dummen Zufall doch noch finden.«
Auf der Fahrt zurück zum Polizeipräsidium in Friedrichshafen sagte keiner von ihnen etwas. Jeder hing seinen Gedanken nach.
Madlener war nicht nur frustriert, nein, er war außer sich, dass sie in diesem speziellen Fall machtlos waren und sich sogar noch beschimpfen lassen mussten. Wenn er sich einer Sache sicher war – auf seinen Instinkt konnte er sich verlassen. Und sein Bauchgefühl sagte ihm, dass der Verdächtige ihnen zwanzig Jahre nach der Tat erneut ein Schmierentheater vorspielte – genau diese Formulierung hatte der Ermittler von damals handschriftlich im Protokoll vermerkt – und damit auch noch davonkam. Eine junge, lebenslustige Frau war mutmaßlich von ihm getötet und irgendwo verscharrt worden.
So etwas machte ihn fuchsteufelswild. Da kam der alte »Mad« Max wieder zum Vorschein, den er schon überwunden zu haben glaubte.
Er schlug auf das Lenkrad ein, sodass sogar eine seltsam lethargisch gewordene Harriet ihm einen erstaunten Blick zuwarf.
Aber es ging ihm einfach fürchterlich gegen den Strich, jemanden, der ein schweres Verbrechen begangen hatte, davonkommen lassen zu müssen, weil es keine Beweise gab.
In diesem besonderen Fall nicht einmal eine Leiche.
Harriet fragte nicht, warum er sich so echauffierte.
Sie wusste es ohnehin.
Weil es ihr genauso ging.
Nur ließ sie es sich nicht anmerken.
5
Und dann kam Miriam.
Sie maß mindestens eins fünfundachtzig, und das ohne die hohen Absätze, die sie trug. Sie war genauso schlank wie groß in ihrem grauen Hosenanzug aus feinstem Zwirn, kam frisch von der Polizeihochschule, erschien Madlener nassforsch, als hätte sie schon zwanzig Jahre lang Polizeidienst geschoben, obwohl sie noch feucht hinter den Ohren war, gab sich ambitioniert bis unter die blonden Haarspitzen und trug Pferdeschwanz.
Kriminaldirektor Cornelius stellte die versammelte Mannschaft persönlich vor, als da waren Madlener, Frau Gallmann, Harriet und Götze.
Dann zeigte er auf die Neue und hielt eine kleine Ansprache.
»Ihre zukünftige Mitarbeiterin, Frau Mosacher«, sagte er. »Mit ihr sind wir endlich wieder ein vollständiges Team, nachdem unser bewährter und allseits geschätzter Kollege Binder in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Dies ist ihre erste Stelle als Kommissaranwärterin. Frau Mosacher hat die Polizeihochschule mit Auszeichnung abgeschlossen – mein Kompliment! –, und ich bin überzeugt davon, dass sie sich mit Ihrer Hilfe schnell einarbeiten und eine wertvolle Bereicherung und Verstärkung unseres wunderbaren Teams sein wird. Ich schlage vor, dass Sie, Herr Götze, zukünftig mit Frau Mosacher als Partnerin zusammenarbeiten und sie erst einmal mit ihren neuen Kolleginnen und Kollegen sowie den Abläufen und Arbeitsweisen bei uns im Hause bekannt machen.«
»Es ist mir eine Freude, Frau Mosacher«, preschte Götze vor und schüttelte ihre Hand, die er anscheinend gar nicht mehr loslassen wollte.
»Miriam, bitte«, sagte sie.
»Ist mir eine Freude, Miriam«, wiederholte er geflissentlich.
Nachtigall, ick hör dir trapsen!, dachte Madlener, als er sah, wie Götze mit einem unverhohlenen und begeisterten Grinsen im Gesicht reagierte, er schmachtete die neue Kollegin geradezu an. Es mochte nicht lange dauern, und Götze würde sie anbaggern, darauf verwettete Madlener im Geiste seine Pension.
Na ja – die halbe.
Wenn der gute Götze – er war Single und hatte, soviel sie wussten, aktuell keine Beziehung – sich bei Frau Mosacher nur nicht eine veritable Abfuhr holte!
Miriam Mosacher trat vor, räusperte sich leicht und zeigte nicht die geringste Spur von Scheu oder Befangenheit. Im Gegenteil – sie trat so selbstbewusst auf, als wäre sie die Landespolizeipräsidentin höchstpersönlich, weil sie sich insgeheim sicher war, dass sie auf der Karriereleiter so schnell nach oben steigen würde wie kaum jemand vor ihr.
Das konnte ihr Madlener vom Gesicht ablesen. So viel Menschenkenntnis hatte er.
»Bitte nennen Sie mich bei meinem Vornamen Miriam. Ich freue mich, Ihrem erfolgreichen Team angehören zu dürfen. Ich habe schon viel von Ihnen allen gehört, das heißt, ich habe mich natürlich vorher erkundigt, mit wem mich das Schicksal beziehungsweise die zuständige Personalabteilung zusammenbringen wird. Ich denke, ich bin hier bei Ihnen in Friedrichshafen in gute Hände geraten, wenn ich mir so ansehe, wie viele und was für Fälle Sie in letzter Zeit gelöst haben. Chapeau! Eines möchte ich von vorneherein klarstellen: Ich weiß, dass ich von Ihnen nur lernen kann, und ich hätte mir keinen besseren Beginn für meine Laufbahn wünschen können. Ich habe mit Erlaubnis unseres Chefs Kriminaldirektor Cornelius eine Flasche Crémant mitgebracht, damit wir zum Einstand anstoßen können. Mein Bruder hat beste Connections zu einem erstklassigen Weingut im Elsass, also wenn Sie mal etwas in der Richtung brauchen – wenden Sie sich an mich.«
Frau Gallmann war schon vorbereitet, entkorkte gekonnt die Flasche und schenkte den Crémant in die Champagnergläser ein, die sie bereitgestellt hatte und die ihr nun entgegengehalten wurden.
Miriam Mosacher erhob ihr Glas.
»Auf gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!«
Na, das kann ja heiter werden, dachte sich Madlener, während er den ersten Schluck nahm. Diese Miriam strotzte nur so vor überzogenem Selbstbewusstsein. Aber vielleicht überspielte sie dadurch auch nur ihre Unsicherheit. Er beschloss, seine Vorurteile hintanzustellen und erst mal abzuwarten, wie sich die Zusammenarbeit entwickeln würde. Don’t judge a book by its cover!, dachte er.
Das hätte Götze mit seiner Vorliebe für Anglizismen gesagt.
Also sollte er sich auch mit Miriam Mosacher herumschlagen.
Ihm war anzusehen, dass er förmlich darauf brannte.
Der Crémant war schon mal erstklassig, fand Madlener.
Wie sich Miriam Mosacher machen und bewähren würde, darauf war nicht nur er gespannt. Das würde sich zeigen, wenn es erst einmal ernst werden sollte.
Und das kam schneller als erwartet.
6
Im Fall Liselotte Kreuzer, den Madlener immer noch nicht ganz abgeschrieben hatte, solange es nichts Dringenderes zu tun gab, suchte er zusammen mit Harriet noch lebende Verwandte und Zeugen auf, redete mit ihnen, bohrte immer wieder nach und ließ nicht locker.
Aber das Erinnerungsvermögen der Menschen war nun einmal sehr begrenzt.
Wenn ein Zeuge nach so langer Zeit behauptete, Liselotte sei in ein schwarzes Auto gestiegen, und Harriet im Protokoll las, das Auto sei rot gewesen, als derselbe Zeuge das erste Mal vor zwanzig Jahren danach gefragt worden war, sahen sie und Madlener sich nur an und wussten, dass sie der Wahrheit keinen Schritt näher kamen.
Harriet war einsilbig geworden und hatte sich wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Ihre wechselhaften modischen Extravaganzen, die insbesondere Hairstyling und Habitus betrafen und ihr bei Madlener in Gedanken den Spitznamen »Chamäleon« eingetragen hatten, den er aber nie aussprach, hatte sie gegen ihre natürliche Haarfarbe brünett eingetauscht. Wenigstens ihren stacheligen gegelten Igel-Haarschnitt und ihre Vorliebe für schwarze Jeans und ihre schwarze Lederjacke hatte sie nicht auch noch aufgegeben.
Die einzige Person, die sie wohl noch regelmäßig an den Wochenenden besuchte, war ihre Tante im Rollstuhl, die in Gottmadingen wohnte und der sie sich verpflichtet fühlte, weil sie viel für sie getan hatte, als es ihr wirklich schlecht ging. Außerdem mochte sie Elfie Ott. Aber davon erzählte sie niemandem etwas. Madlener vermutete, dass sie weiterhin den Kontakt zu ihrer Tante aufrechterhielt, aber da wollte er sich nicht einmischen, das war Harriets Privatangelegenheit.
Sie machte ihren Job nach wie vor gewissenhaft von neun bis fünf, und dann fuhr sie mit ihrem Motorrad nach Hause in ihr Apartment in Immenstaad, wo sie sich bei einer Pizza Mafiosa aus der Trattoria »Don Giovanni« und einer Cola light ihre Kopfhörer aufsetzte, Musik hörte und sich bis spätnachts mit ungelösten mathematischen Problemen beschäftigte. Einladungen nahm sie keine mehr an.
Madlener und seine Lebensgefährtin Simone kochten gern und gut und hatten sie oft gefragt, ob sie nicht mal zum Essen kommen wollte, aber stets nur ausweichende Antworten erhalten – keine Zeit, keine Lust, sie habe was anderes vor –, sodass sie sich fast nicht mehr trauten, sie deswegen anzusprechen.
Einmal hatte Madlener Harriets Boxstudio antelefoniert, weil er wissen wollte, ob sie dort mal wieder aufgetaucht war. Die Antwort war negativ – ihr türkischer Trainer vom »Boxwerk Friedrichshafen« hatte Madlener mitgeteilt, dass Harriet ihre Mitgliedschaft gekündigt hatte und seither zu seinem großen Bedauern nicht mehr gekommen war. Er bat Madlener, ihr schöne Grüße auszurichten und dass er sie vermisste. Er hatte Harriet selbst einige Male angerufen, aber sie hatte nie abgenommen oder auf seine Bitte reagiert, ihn zurückzurufen, die er auf ihren Anrufbeantworter gesprochen hatte.
Schon früher war Harriet nicht gerade eine allseits gut vernetzte Kommunikationskanone gewesen, obwohl sie ein Computercrack war. Aber jetzt schien sie jeden sozialen Kontakt auf null heruntergefahren zu haben. Anscheinend war sie auch nicht mehr auf Twitter, Instagram oder Facebook aktiv.
Das wusste Madlener von Frau Gallmann, er war mehr der analoge Mensch und pflegte seine – zugegeben – altmodische Einstellung und Verachtung für die seiner Meinung nach asozialen Medien des Öfteren kundzutun, auch wenn er – schon aus beruflichen Gründen – mit Computer und Smartphone umgehen musste und das auch konnte.
Für Feinheiten wie das Hacken versteckter und verschlüsselter Daten konnte er sich immer auf die besonderen Fähigkeiten von Harriet verlassen.
Wenn er mit ihr beruflich unterwegs war, verhielt sie sich seit Neuestem wortkarg und einsilbig. Das machte Madlener wirklich zu schaffen. Harriet war einfach nicht mehr mit Begeisterung bei der Sache. Früher hatte sie ihm oft widersprochen, weil es ihr Spaß gemacht hatte, sich auf ein Streitgespräch einzulassen, und sei es nur aus Prinzip. Wenn sie sich aneinander verbal abgearbeitet hatten, war immer etwas Produktives dabei herausgekommen, immer.
Er brauchte Harriets Widerspruchsgeist, um sich an ihm zu reiben und damit seine Vorstellungskraft und Phantasie auf Lösungen zu bringen, die ihm sonst nie eingefallen wären.
Aber er beklagte sich nicht darüber, dass Harriet sich so sehr in sich selbst verkrochen hatte, bis er auf einer Fahrt von einer Befragung zurück nach Friedrichshafen feststellte, dass sie sogar seinem Blick auswich und nur mit der Schulter zuckte, als er von ihr wissen wollte, ob sie noch einen kurzen Abstecher in sein Lieblingscafé mit dem guten Espresso und den phantastischen Croissants machen sollten.
Das brachte bei ihm das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen.
Er fuhr rechts ran, hielt an und schaltete den Motor aus.
Sie reagierte nicht einmal auf seine unerwartete Aktion, sondern kaute unbeeindruckt ihren obligatorischen Kaugummi und starrte ins Nichts.
Eine ganze Weile sagte keiner ein Wort, bis Madlener endgültig der Geduldsfaden riss.
»Herrgott noch mal, Harriet – warum fragst du nicht einfach, warum ich anhalte?«
»Also«, ließ sie sich erweichen, »warum hältst du an?«
»Willst du das wirklich wissen?«
Sie zuckte nur erneut mit den Schultern. »Du wirst schon einen Grund dafür haben«, antwortete sie lakonisch.
Madlener stöhnte demonstrativ.
Mist, Mist, Doppelmist.
»Ja. Ja, den habe ich.«
»Und der wäre?«, sagte sie, blies ihren Kaugummi auf und ließ ihn platzen.
»Verstehst du denn nicht?«, fragte Madlener schon beinahe verzweifelt. »Ich will meine alte Harriet wiederhaben!«
»Ach ja? Wie war sie denn deiner Meinung nach?«
»Widerspenstig, kratzbürstig, frech. Lebendig eben, verstehst du? So wie früher.«
»Ach so. Und jetzt? Was bin ich jetzt deiner Meinung nach?«
»Jetzt? Jetzt läufst du herum wie ein Zombie.«
»Wenn du das so siehst – dann kannst du dir ja diese Miriam als neue Partnerin nehmen.«
»Wieso sollte ich? Die hat sich ja schon Götze geschnappt.«
Normalerweise hätte Harriet jetzt etwas Witziges oder zumindest Provozierendes gesagt, aber sie blieb ernst.
»So wie früher wird es nicht mehr sein, Max«, sagte sie beiläufig und schenkte ihm tatsächlich einen bedeutungsvollen Blick, der etwas Endgültiges hatte.
Er erschrak regelrecht und erwiderte ihn, ohne sich sein Befremden über ihre apodiktische Bemerkung anmerken zu lassen.
»Sag mal, spinnst du jetzt?«
»Okay. Ja, ich spinne. Bist du jetzt zufrieden? Können wir dann endlich weiterfahren?«
Er sah sie nach wie vor an, aber Harriet wandte den Blick ab und überprüfte nur wie geistesabwesend ihre Fingernägel.
Nicht einmal die hatte sie, wie sonst immer üblich, schwarz lackiert.
Er wollte ihr etwas entgegnen, aber er spürte, dass es sinnlos gewesen wäre in diesem Augenblick.
Also ließ er resigniert den Motor des Dienstwagens wieder an und fuhr los.
Er gab zu viel Gas und die Räder drehten durch, bis der Wagen vom Randstreifen auf den Asphalt der Straße traf und Fahrt aufnahm.
Madlener war nicht sauer über Harriets Reaktion.
Nur traurig.
7
»Ich weiß nicht, was ich noch anstellen soll«, sagte Madlener zu Simone. »Ich mache mir wirklich Sorgen um Harriet.«
Sie saßen in Madleners Mittagspause an der Uferpromenade von Friedrichshafen bei einer Pizza Meeresfrüchte, die sie sich zu zweit teilten, in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés in der milden Frühlingssonne. Sie hatten gerade noch den letzten freien Tisch ergattert, vom See her wehte ein angenehmes Lüftchen, und sie sahen dem nicht enden wollenden Strom von Menschen zu, die in beide Richtungen an ihnen vorbeiflanierten.
Manche schlenderten, manche drängelten, Teenager rannten kopflos in andere Leute hinein, Kinder schrien, weil sie hingefallen waren, zwei Jugendliche auf einem E-Scooter versuchten sich elegant durch die Menge zu schlängeln, Mütter mit und ohne Kinderwagen oder Lastenfahrrad schimpften, zwei alte Damen mit Rollatoren pflügten sich den Weg frei, eine Gruppe Halbwüchsiger mit geistigen und körperlichen Einschränkungen war grundlos stehen geblieben, obwohl die Betreuerinnen sie vergeblich aufforderten weiterzugehen, was sofort einen Fußgängerstau verursachte. Kurz: Es war ein Querschnitt der gesamten Menschheit und ihrer guten und schlechten Eigenschaften unterwegs – weiß, schwarz, bunt, queer, punkig, dominant, tolerant, aggressiv, geschäftig, gelangweilt, eilig, betont cool, jung, alt.
Man konnte auch Tohuwabohu dazu sagen.
Die überwiegende Mehrheit der älteren Touristen trug Multifunktionskleidung, die unvermeidliche Uniform im Urlaub, mit allerlei Taschen und Reißverschlüssen, mehr als Joseph Beuys jemals an seiner Weste gehabt hatte, dachte Madlener, war sich aber sicher, dass in den zahlreichen Taschen nichts von Bedeutung steckte. Viele der jüngeren oder die sich so fühlten, schoben sündteure Fahrräder durch die Menge. Sie wirkten mit ihren bunten Helmen, verwegenen Sonnenbrillen und Ohrstöpseln, dunklen Radlerhosen und mit Werbung bedruckten Shirts, als würden sie jeden Moment zu einer Tour-de-Lac-Constance an den Start gehen.
Madlener konnte sich nicht helfen, aber seiner Meinung nach sahen Fahrradhelme durch die Bank aus wie für autoaggressive Menschen in psychiatrischen Anstalten gemacht, die dazu da waren, sie vor sich selbst zu schützen, wenn sie auf die Idee kamen, ihren Kopf gegen die Wand zu schlagen, weil sie an der Welt und sich selbst verzweifelten. Diese Meinung behielt er aber lieber für sich, weil er wusste, dass er allzu gern zu gedanklichen Übertreibungen neigte.
Dass manche trotz einer gewissen Leibesfülle hautenge Trikots trugen, die sie wie eine Presswurst mit Rettungsringen aussehen ließen, schien sie nicht zu stören, das zur Schau getragene Selbstbewusstsein überstieg ihre Eitelkeit bei Weitem. Hauptsache, man sah draufgängerisch und professionell aus und konnte Sportlichkeit vortäuschen und mit seinem Outfit angeben.
Jetzt, zu Beginn der Hochsaison, die von Ostern bis spät in den Oktober ging, war am ganzen Bodensee der Teufel los. Egal, in welcher Stadt, egal, auf welcher Promenade, egal, in welchem Hafen.
Sehen und gesehen werden war das allgemeine Motto.
Auch nicht viel besser als die Poser, dachte Madlener, die sich mit ihren gepimpten Autos übers Netz verabredeten und ein kurzzeitiges Schaufahren auf den Hauptstraßen veranstalteten, mit lautem Techno aus riesigen Lautsprechern im Heck ihrer Angeberkarossen und dem Knallenlassen der eigens dafür präparierten Auspuffanlagen, um dann wie von Zauberhand von der Bildfläche zu verschwinden, sobald der erste Streifenwagen gemeldet wurde.
Die Kollegen von der Verkehrspolizei konnten ein Lied davon singen.
Wenigstens machten die Fahrräder keinen Lärm und stießen keine Abgase aus.
Das Motiv ihrer Auftritte war das gleiche.
Auffallen um jeden Preis.
Insbesondere bei Kaiserwetter, und heute war so ein Tag.
Das Schwäbische Meer war eben eine Region, in die die Touristen in Horden einfielen. Dazu kamen noch die endlosen lärmenden und stinkenden Lastwagenkolonnen, die Tag und Nacht auf der B31, die ohne Schutzwall um den nördlichen Teil des Bodensees herumführte, die Nerven der Anwohner im Tal strapazierten und die Lebensqualität dazu.
Man musste das als Einheimischer alles aushalten und tolerieren, weil man hier in dieser Gegend schließlich von den Gästen lebte.
Madlener seufzte innerlich.
Er dachte mit Schaudern daran, wie trist und ausgestorben alles während dieser scheußlichen Corona-Krise gewesen war, die sich Gott sei Dank nach zwei bleiernen und schier endlosen Jahren wieder in Luft aufgelöst zu haben schien.
Er hatte die Masken gehasst; er hatte die Einschränkungen und die Hysterie gehasst, die nur Panik geschürt hatten; er hatte die endlosen Wasserstandsmeldungen über Tote und Neuansteckungen gehasst; er hatte die beinahe täglichen und sich teilweise widersprechenden Verlautbarungen der Experten und Gesundheitsminister gehasst; er hatte die sogenannten Querdenker gehasst, für die Vernunft zum Wortschatz der angeblichen Weltverschwörung zählte. Aber er hatte wie so viele andere auch alles nolens volens hingenommen und die Zähne zusammengebissen, hatte sich – so gut es ging – durch diese globale Krise hindurchlaviert und -geimpft und war glücklicherweise von Covid verschont geblieben.
Jetzt, wenn er so von seinem Logenplatz an der Uferpromenade auf die Parade der menschlichen Eitelkeiten sah, kam es ihm vor, als müssten die Leute alles auf einmal nachholen, was sie versäumt hatten.
Von einem Extrem ins andere, das war der Preis des modernen Lebens.
Wie lange das noch funktionierte, das war die andere Frage. Die keiner beantworten konnte bis auf die üblichen Besserwisser und Untergangspropheten, von denen es genug gab.
Simone und er versuchten sich damit zu arrangieren.
Etwas anderes blieb ihnen auch gar nicht übrig.
Simone hatte angeboten, Madlener ebenfalls eine Semi-Profi-Ausrüstung zum Geburtstag zu spendieren, für ihre gemeinsamen Fahrradtouren, die sie bevorzugt im Hinterland unternahmen, da ging es wesentlich ruhiger zu. Aber er hatte diesen Vorschlag fast schon entrüstet abgelehnt mit dem Argument, dass er sich doch nicht lächerlich machen wollte. In seinem Alter und mit seiner Figur wollte er nicht mehr so tun, als wäre er die Inkarnation von Lance Armstrong. Er hatte ein normales Hollandrad, und das reichte ihm völlig. Auch wenn Simone mit ihrem E-Bike scheinbar mühelos vorankam, während er bei Steigungen ganz schön in die Pedale treten musste und schnell aus der Puste geriet, obwohl er sich das Rauchen mühsam abgewöhnt hatte. Aber das war ja seiner Meinung nach auch der Sinn der Sache – dass man beim Fahrradfahren das abstrampelte, was man die Woche über an zu vielen Kalorien zu sich genommen hatte.
Simone war so klug, in dieser Angelegenheit nicht weiter zu insistieren, sie kannte Madleners Schwachstellen und Animositäten inzwischen und beschloss, sie zu akzeptieren.
Er hatte zugegebenermaßen einige Macken, einige, von denen er selbst wusste, und einige, die er verdrängte. Da hatte sich im Laufe der Zeit doch einiges angesammelt, vor allem in den langen Junggesellenjahren, als er im Hotel »Zum silbernen Zeppelin« gewohnt hatte. In denen er, dessen war er sich bewusst, wenn er darüber nachdachte, teilweise zu einem Eigenbrötler geworden war, der in so manchen Stunden, in denen er in seinem Hotelzimmer wach gelegen und an die Decke gestarrt hatte, wirklich befürchten musste, allmählich nicht mehr gesellschaftsfähig zu sein.
Er besaß zu seinem Leidwesen die fatale Neigung, zu oft und zu viel zu grübeln und über den Sinn des Lebens nachzudenken.
Wie seine rechte Hand Harriet Holtby.
Waren das Anzeichen einer beginnenden Depression?
Wahrscheinlich.
Sein Beinahe-Schwiegervater, der Psychiater Dr. Dr. h.c. Auerbach, hätte die Diagnose unter Garantie so gestellt.
Das Einzige, was kurzfristig half, war, an einen Sketch zu denken, den er in der Muppet Show einmal vor langer Zeit zufällig gesehen hatte: »Schweine im Weltall«.
Er erinnerte sich rudimentär daran. Oder hatte er ihn inzwischen mit seinen eigenen erfundenen Ausschmückungen und Ergänzungen aufgemotzt? Egal. Jedenfalls half es.