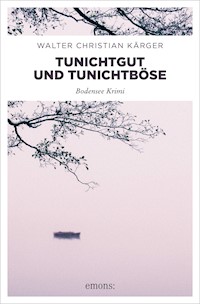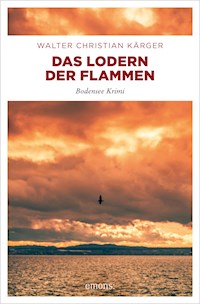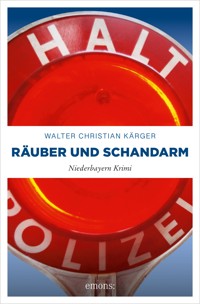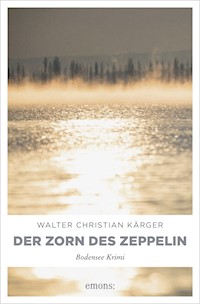
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Emons VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Max Madlener
- Sprache: Deutsch
Die Nichte des Friedrichshafener Kriminaldirektors wird entführt und schwer traumatisiert in der Basilika von Birnau wiedergefunden. Wenig später stirbt ein Mädchen, und es wird klar: Der Täter befi ndet sich auf einem ebenso heimtückischen wie raffi nierten Rachefeldzug. Sein Gegner: die gesamte Kripo inklusive Max Madlener. Immer wieder wird die Polizei in der Öffentlichkeit vorgeführt – bis Madlener beschließt, nicht mehr mitzuspielen . . . Tiefe Einblicke in dunkle Abgründe, filmreife Action und große Bilder – ein fulminanter Kriminalroman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©mauritius images/imageBROKER/Stefan Arendt Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-974-5 Bodensee Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Gabriele und Tilman. Sie wissen, warum.
Don’t push me’cause I’m close to the edgeI’m trying not to lose my head, ah-huh-huh-huhIt’s like a jungle sometimesIt makes me wonderHow I keep from going under…
aus: »The Message« von Grandmaster Flash& The Furious Five
Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben,um einen tanzenden Stern gebären zu können.Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch. aus: »Also sprach Zarathustra« von Friedrich Nietzsche
Prolog
Erst einige Wochen nachdem er sich endgültig entschlossen hatte, seine Mutter zu töten, schickte sich Dr.Arbogast an, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die finale Entscheidung war ihm bei Gott nicht leichtgefallen, aber es musste sein. Wie lange hatte er sich schon danach gesehnt, endlich in Freiheit zu leben und all das zu verwirklichen, wovon er sein ganzes erwachsenes Leben nur geträumt und phantasiert hatte. Jetzt endlich, nach Jahrzehnten der Selbstverleugnung, Bevormundung und Unterdrückung, hatte ihm ein gnädiges Schicksal die Möglichkeit dazu auf einem Silbertablett serviert. Er musste nur noch den letzten, entscheidenden Schritt machen, um sich endgültig aus den Fesseln der Vergangenheit zu lösen und emporzusteigen in sein dunkles Reich der Phantasie, die er nun endlich ausleben und verwirklichen konnte. Was hatte er nur alles nachzuholen!
Eine schwarze unbändige und zerstörerische Kraft durchströmte ihn bei diesem Gedankengang, der ihn die letzten Jahre mehr und mehr während der Arbeit und in seinen schlaflosen Nächten gefesselt hatte und zur Obsession geworden war, zur wahren Bestimmung seines Ichs.
Nicht dass er etwa bei seiner Arbeit geschludert hätte oder gedankenlos war und deshalb einen Fehler begangen hätte, das konnte er sich als seriöser und angesehener Apotheker in Friedrichshafen am Bodensee nicht leisten. Bei seiner Stellung und Verantwortung wäre selbst ein kleiner Fauxpas fatal gewesen und hätte sich schnell herumgesprochen. Nein, er durfte sich nicht den geringsten beruflichen Fehler erlauben, wenn er endlich ausleben wollte, was ihm bisher versagt und nur in seinen Phantasien vergönnt war. Solange er unter der Fuchtel seiner Mutter war, würde er genau so sein, wie sie sich das vorstellte.
Sehr bald schon hatte er gelernt, wie man sein wahres Ich unter dem Deckmantel der Anständigkeit, der Integrität und des konservativen Calvinismus verbarg, von dem die alteingesessenen Menschen in der Region geprägt waren. Das Vorspiegeln dessen, was die Leute erwarteten, war ihm zur zweiten Natur geworden. Wenn er seinen weißen Kittel anhatte, sein Namensschild mit dem Doktortitel neben der Brusttasche mit den akkurat darin aufgereihten Kugelschreibern, dann war er eine Autoritätsperson mit der Aura der Zuverlässigkeit, des Fachwissens und der Respektabilität. Genau so, wie ihn seine Mutter immer gewollt hatte und wie sie ihn nach ihren Vorstellungen geformt zu haben glaubte. Aber hinter der Maske der Achtbarkeit brodelte es von Anfang an. Sein Lieblingsbuch seit Kindertagen war »Der seltsame Fall des Dr.Jekyll und Mr.Hyde« von Robert Louis Stevenson. Als er es das erste Mal gelesen, ja verschlungen hatte, war das sein Damaskuserlebnis gewesen. Dieses Buch hatte ihm die Augen geöffnet, wer er wirklich war.
Zum Glück war er nicht nur damit gesegnet, dass er seine wahre Natur verbergen konnte, was er bis zur Perfektion entwickelt hatte, er besaß zudem auch die Geduld eines Krokodils, das so lange regungslos am Wasserloch im Schlamm warten konnte, bis ein unbedarftes Gnu durstig genug war, heranzukommen und ihm in aller Unschuld beim Saufen den schlanken Hals zu präsentieren.
Jahrelang hatte Dr.Arbogast gewissermaßen in seinem Schlammloch ausgeharrt, bis sich eine günstige Gelegenheit bieten würde, um sich in das zu verwandeln, was er eigentlich in seinem Innersten war: ein Monster. Ein Monster, das nur darauf fixiert war, sich in einer blitzschnellen Bewegung aus seiner Starre zu lösen und zuzupacken, seine rasiermesserscharfen Zähne in den Hals seines Opfers zu schlagen, es erbarmungslos hin und her zu schleudern und das Blut zu schmecken, das ihm in seine Lefzen floss, und diesen Augenblick der absoluten Macht zu spüren, Herr über Leben und Tod zu sein.
Eine Bestie ohne Gnade und ohne Gewissen.
So wie Gott.
Bei diesem blasphemischen Gedanken lächelte er in sich hinein, während er die Medikamente für eine alte Dame, eine Stammkundin und Mitglied im Kirchenvorstand, zusammenstellte.
Wenn das seine Mutter wüsste, seine Mutter, die nie auch nur einen Sonntagsgottesdienst versäumt hatte. Was sie selbstverständlich auch von ihm erwartete. Und er war über all die Jahre wahrlich ein folgsamer und fügsamer Sohn gewesen, halleluja und gepriesen sei der Herr! Klaglos war er nach dem glänzenden Abschluss seines Pharmaziestudiums, das er mit einem Summa-cum-laude-Doktortitel gekrönt hatte, in die väterliche Apotheke und seine Heimatstadt zurückgekehrt, um an der Seite seiner Mutter, die selbst Apothekerin und seit seinem dreizehnten Lebensjahr Witwe war– damals war sein Vater bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen–, die Apotheke zu führen, die seit Generationen im Besitz der Familie Arbogast war, eine Institution in Friedrichshafen und weit darüber hinaus.
Die Pflegerin, die zweimal am Tag vorbeikam und sich um seine Mutter kümmerte, war die Hintertreppe von der Wohnung, die im selben Haus über der Apotheke lag, heruntergekommen und wartete, bis Dr.Arbogast die Kundin bedient hatte. Er steckte die Medikamente in eine Plastiktüte, dazu als Beigabe ein Fläschchen Multivitamine– Frau Frantischek war Privatpatientin, und die Medikamente waren teuer, ein Präsent in angemessener Größenordnung wurde selbstverständlich erwartet.
»Es fehlt noch was, Herr Doktor«, bemerkte die alte Dame mit den gedrechselten grauen Dauerwellen süffisant und lächelte auffordernd.
Dr.Arbogast, der selbstverständlich alle Eigenheiten seiner anspruchsvollen Stammkundschaft kannte, spielte mit und griff sich, als sei er zerstreut, an die Stirn, bevor er der Kundin noch die neueste Ausgabe der »Apotheken Umschau« in die Hand drückte und sie mit Namen und Titel ihres verstorbenen Mannes verabschiedete. Dieser war Gymnasialprofessor gewesen, und sie erwartete selbstverständlich, dass sie mit »Frau Professor Frantischek« angesprochen wurde. Arbogast wusste, dass sie nur von ihm und in ihrer Metzgerei so tituliert wurde, aber seiner Kundschaft Honig ums Maul zu schmieren gehörte zu seinem Service, und er tat ihr selbstverständlich diesen Gefallen, der ihn nichts kostete als ein vorgetäuschtes freundliches Lächeln.
Zufrieden verließ sie die Apotheke, nicht ohne sich vorher noch in der offenen Tür nach dem Befinden seiner Mutter zu erkundigen, was er mit traurigem Dackelblick und einem leisen »Nicht so gut, leider« beantwortete, das ein resignatives Nicken und mitfühlendes Seufzen ihrerseits zur Folge hatte, bevor sich die Tür endgültig hinter ihr schloss.
Arbogast wandte sich der jungen Frau vom Pflegedienst zu, die hinter ihm gewartet hatte.
»Ich habe Ihrer Mutter eine neue Windel angelegt, die Infusion läuft noch, Sie wissen ja Bescheid. Sie schläft jetzt«, sagte sie.
»Gut«, sagte er und nickte. »Vielen Dank.«
»Wir sehen uns morgen früh.«
»Ja, schönen Abend noch«, verabschiedete er die Pflegerin und hielt ihr die Tür auf. Er blickte ihr nach, wie sie in einen taubenblauen Opel Corsa mit der Aufschrift »Ambulante Kranken- und Seniorenpflege Meyer-zur Heyde« stieg und davonfuhr. Dann sah er auf seine Uhr.
Zeit, Feierabend zu machen. Er schloss die Tür ab und ließ den Schlüssel wie immer von innen stecken. Trotzdem versicherte er sich noch einmal, ob die Tür auch wirklich verriegelt war, eine seiner vielen Marotten, die er sich einfach nicht abgewöhnen konnte. Er war sich dessen bewusst, aber das neurotische Sicherheitsbedürfnis seiner Mutter– »Hast du auch den Herd abgestellt? Ist das Auto abgesperrt? Sind die oberen Fenster zu? Es sieht nach einem Gewitter aus!«– war auch ihm in Fleisch und Blut übergegangen.
Zeit, um endlich zur Tat zu schreiten.
Er griff in die Schublade mit den steril verpackten Einwegspritzen, nahm eine heraus und entfernte die Cellophanhülle.
Mit der Spritze bewaffnet ging er leichten und federnden Schrittes zur hinteren Tür der Apotheke, die ins Treppenhaus führte, über das man zur Wohnung im ersten Stock hinaufgelangte.
Er konnte es kaum erwarten. Heute war der 1.September. Der Jahrestag, der einen anderen Menschen aus ihm gemacht hatte. Genau der richtige Zeitpunkt, um die nächste Stufe seiner Entwicklung zu erklimmen.
Zum Baal, zum Übermenschen, der über den mühevoll aufgehäuften zivilisatorischen Gesetzen und ihrer übergestülpten Moral stand. Ab sofort hatten sie ihre Gültigkeit für ihn verloren. Oder besser: Er hatte sie abgeschüttelt wie ein Reptil seine zu dünn gewordene Haut.
1
Im Presseraum des Polizeipräsidiums Friedrichshafen bereitete sich Kriminaldirektor Thielen zwei Stunden vor Feierabend darauf vor, wieder einmal einen seiner wegen ihrer Länge, Ausführlichkeit und auswuchernden Phrasenhaftigkeit berüchtigten und gefürchteten Vorträge zu halten. Die Kripoleute von den Abteilungen Kapitaldelikte und Sitte waren pflichtgemäß vollständig angetreten, ebenso die Techniker vom Erkennungsdienst und der Spurensicherung, die keine Ausrede mehr gefunden hatten, denn Thielen war so schlau gewesen, seinen Auftritt bei ihnen so kurzfristig wie möglich von seiner Sekretärin Frau Gallmann anberaumen zu lassen, weil er seine Rede naturgemäß vor möglichst zahlreichem Publikum an die Frau beziehungsweise den Mann bringen wollte. Die Nachbarschaftsreviere hatten notgedrungen ebenfalls Abgesandte geschickt, sogar einige Männer von der Verkehrspolizei waren abkommandiert worden, und auch die Wasserschutzpolizei aus Überlingen war nicht umhingekommen, zwei wichtige Beamte nach Friedrichshafen zu beordern.
Schließlich ging es um das grundsätzliche Verwaltungsthema »Verbesserung der Koordination und Bündelung polizeilicher Verfahren und Abläufe unter dem besonderen Gesichtspunkt von mehr Effizienz«. Ein Dauerbrenner des Kriminaldirektors, den er schon in unzähligen Updates durchdekliniert hatte, und in etwa so spannend, wie Bettlaken auf der Wäscheleine beim Trocknen zuzusehen.
Hauptkommissar Max Madlener und seine Assistentin Harriet Holtby wussten das und waren deshalb absichtlich weit vor der Zeit aus ihrem Büro, das nebenan im Gebäude der Verkehrspolizei untergebracht war, herbeigeeilt. Ihr Kalkül ging auf, sie hatten das Glück, zwei Plätze in der allerletzten Stuhlreihe zu ergattern. Wer das Pech hatte, pünktlich oder mit Verspätung einzutreffen, musste sich weiter vorne platzieren. Die Azubis saßen alle in der ersten Reihe, weil sie noch nicht besser wussten, was auf sie zukam, oder weil sie hofften, mit ihrer Streberhaftigkeit die Aufmerksamkeit des Chefs auf sich zu ziehen und so für einen möglichen Aufstieg auf der Karriereleiter Pluspunkte sammeln zu können.
Thielen wartete, bis die gut drei Dutzend Stühle alle besetzt waren, und plauderte derweil mit seiner Sekretärin Frau Gallmann, die eben ein Glas kohlensäurefreies Mineralwasser auf dem Rednerpult abgestellt hatte und den Sitz seiner Krawatte korrigierte. Sie gab wie immer ihr Bestes, um ihren Chef zu umsorgen und bei Laune zu halten. Und wie immer sah sie aus wie aus dem Ei gepellt: die Haare wie frisch vom Friseur, Fingernägel, Make-up, lilafarbenes Kostüm, gestärkte weiße Schluppenbluse mit Trompetenärmeln, die etwas zu hohen, farblich passenden Pumps– alles war perfekt aufeinander abgestimmt. Madlener war sich sicher: Solange Frau Gallmann für die Verkörperung von Kontinuität und Solidität im Polizeipräsidium zuständig war, würde die Welt sich zuverlässig weiterdrehen und der Himmel einem nicht auf den Kopf fallen.
Die letzten Stühle wurden gerückt, und allmählich kehrte erwartungsvolle Stille ein. In vorauseilendem Gehorsam hatte jeder der Zuhörer zumindest ein Laptop oder einen Notizblock auf den Knien, sei es aus Pflichtbewusstsein– bei den Novizen–, sei es, weil sie wussten, dass Kriminaldirektor Thielen davon ausging, dass jedes seiner goldenen Worte pflichteifrigst festgehalten wurde, um bei Bedarf nachgelesen und memoriert werden zu können.
Er blätterte zufrieden durch seine Unterlagen. Sein Blick schweifte über die geschlossenen Reihen der Zuhörer, wie stets registrierte er genauestens, wer seine Anwesenheitspflicht ernst nahm und sich eingefunden hatte und wer nicht.
Madlener und Harriet in der hintersten Reihe wandten ihm schon ihr Aufmerksamkeitsgesicht zu, das aber nur auf ihrer raffinierten Verstellungskunst basierte, denn sie waren zwar körperlich, aber nicht geistig anwesend, auch wenn Harriets aufgeklapptes Laptop und Madleners Notizbüchlein eine andere Haltung vortäuschten. Harriet stellte sich darauf ein, ihren im Yogakurs erlernten Schlafmodus mit offenen Augen– ihre Yogalehrerin nannte die Übung »Dem Drachen in die Augen schauen«– zur Anwendung zu bringen und zu vervollkommnen. Madlener war sowieso ein Meister im Vorgaukeln von großem Interesse, wenn es um die schier endlosen Ansprachen des Kriminaldirektors ging, auch wenn er bereits dabei war, an etwas Wichtigerem zu feilen: seiner neuesten(S)hitliste, einer Liste von Dingen, die die Welt nicht brauchte.
Die zweite Liste, die er sich immer vornahm, wenn es im Präsidium keine dringenderen Fälle zu bearbeiten gab als des Nachts abgesägte Maibäume in irgendeinem Dorfflecken im Hinterland oder auf dem Seeparkplatz abgerissene Mercedessterne und er sich dementsprechend langweilte, war die von den besten Popsongs aller Zeiten– ein mühevolles und wohl für ewige Zeiten nicht zu vollendendes Unterfangen, weil ihm immer wieder Titel einfielen, die er noch in seine Top100 aufnehmen wollte, obwohl er bereits mehr als das Doppelte an Songs hatte und eigentlich eher radikal kürzen musste, sonst würde die Aufstellung seiner Rangliste mit seinem Eintritt ins Rentenalter noch immer ein Torso sein.
Er überlegte, ob er die selbst aufgestellte eherne Regel umstoßen und aus den besten hundert eine Top200 machen sollte, um nicht doch noch Songs unter den Tisch fallen lassen zu müssen, die die Welt seiner Meinung nach maßgeblich bereichert und ein gutes Stück erträglicher gemacht hatten. Nach langem innerem Kampf beschloss er aber dennoch, es bei einhundert Titeln zu belassen, um seine Herzensangelegenheit nicht allzu sehr ins Uferlose auszuweiten, da war eben ein gewisses Maß an Selbstdisziplin angebracht.
Während Kriminaldirektor Thielen mit seinem Vortrag begann, den er wie immer mit einem Witz einleitete, der einen Bart hatte wie ein Klischee-Salafist und bei dessen misslungener Pointe trotzdem pflichtgemäß gelacht wurde, überlegte Madlener, ob er den Song »Stool Pigeon« von Kid Creole&the Coconuts auf Platz neunundneunzig positionieren und dafür »Dedicated Follower of Fashion« von den Kinks eliminieren sollte, wobei er automatisch mitlachte, als das die anderen taten. Er setzte Kid Creole innerlich auf seine Warteliste, weil ihm einfiel, als er seinen Namen ins Notizbuch schrieb, dass er schon seit Langem noch eine weitere Rangliste mit den peinlichsten lebenden Persönlichkeiten anlegen wollte.
Kriminaldirektor Thielen hatte durchaus berechtigte Chancen auf einen der vorderen Plätze, die derzeit von Dieter Bohlen, Hansi Hinterseer, Lothar Matthäus, Heidi Klum, Boris Becker und den Geissens besetzt waren. Die Auswahlkriterien waren eine komplizierte Mixtur aus dem geschätzten Intelligenzquotienten, dem exhibitionistischen Auftreten in Interviews und dem gefühlten Fremdschämfaktor, den die Akteure und Aktricen bei ihren Aussagen und Auftritten bei ihm auslösten.
Er ging seine Notizen noch einmal durch.
Auf Platz eins der Rangliste von den Dingen, die die Welt nicht brauchte und/oder die sie ein gutes Stück hässlicher machten, stand seit langer Zeit unangefochten die Duravit-Fernbedienung für Klospülungen, ein wahres Evergreen. Auf Platz zwei kam der Wackeldackel, gleichauf gefolgt von Marmelade in Aludöschen und einem Strunkentfernungsgerät für Tomaten, gehäkelten Klopapierhüten und sämtlichen Coverversionen, die André Rieu jemals eingespielt hatte. Aber erst gestern war er durch Zufall im Supermarkt auf eine brandaktuelle, grandios überflüssige Neuentwicklung der Abfallindustrie gestoßen, die beste Aussichten hatte, aus dem Stand einen Spitzenplatz zu erreichen, er wusste nur noch nicht, ob er sie auf Platz vier oder fünf ansiedeln sollte: der beduftete Müllbeutel in drei verschiedenen Geruchsvariationen– wahlweise Floral, Orient oder Vanille. Fehlte nur noch Chanel N°5 für die Hausfrau mit Stil, alternativ im Zuge der Gleichberechtigung Man Extreme von Bulgari für den Hausmann.
Madleners leerer Blick war zwar auf den Kriminaldirektor gerichtet, der hinter dem Rednerpult mit Inbrunst und Pathos seinen Vortrag hielt wie der Bundespräsident seine unvermeidliche Rede zum Tag der Deutschen Einheit, aber in seinem Kopfkino stellte er sich vor, wie die schmutzig grauen Mülltüten bei der Herstellung an einem Fließband von leicht bekleideten Germany’s-Next-Topmodels mit Riesenflakons eingesprüht wurden. Unwillkürlich grinsend schüttelte er dabei den Kopf, was Gott sei Dank nur Harriet auffiel, die ihn sanft von der Seite anstupste, was ihn wieder in die schnöde Wirklichkeit zurückbrachte.
Die Rede von Kriminaldirektor Thielen war– dem Himmel sei’s gepriesen!– durch die intensive geistige Beschäftigung Madleners mit den wirklich wichtigen Petitessen des Lebens schon weit fortgeschritten und inzwischen bei den Statistiken angelangt, einer Stelle, die Thielen immer besonders genüsslich auswalzte und mit von Frau Gallmann an die Wand projizierten Diagrammen untermauerte.
Die hingebungsvolle Interpretation endloser Säulen und Zahlen durch ihren Chef übertraf bei Madlener und Harriet die Wirkung und Durchschlagskraft von einer Handvoll Valium bei Weitem. Beide kämpften geradezu heroisch gegen die bleierne Müdigkeit an. Madlener vertiefte sich noch mehr in seine Ranglisten, und Harriet musste sich mehrfach in ihren Oberschenkel zwicken, um nicht vollends einzunicken. Es war ein langer Tag gewesen.
Madlener gab sich einen Ruck, setzte sich wieder gerade hin und klatschte in die Hände, weil plötzlich, er wusste nicht, warum, Beifall aufbrandete.
Thielen dankte mit erhobenen Armen und entließ endlich die gesamte Belegschaft, sofern sie nicht Bereitschaftsdienst hatte, ins verdiente Wochenende, nicht ohne noch einen seiner geliebten englischen Aussprüche loszuwerden: »Who fights can lose. Who doesn’t fight has already lost.«
Allmählich hatten auch die pflichteifrigsten Polizisten angefangen, klammheimlich auf ihre Armbanduhr zu schielen, aber sie nickten alle beifällig. Ob aus Erleichterung, dass der Redemarathon überstanden war, oder aus Verlegenheit, weil sie den Spruch und vor allem den inhaltlichen Zusammenhang nicht verstanden, war einerlei, für Thielen zählte nur die Bestätigung seiner rhetorischen Kunst und seiner umwälzenden Verbesserungsvorschläge in verwaltungstechnischer Hinsicht.
Zu guter Letzt setzte er noch einmal an. »Einen Augenblick bitte, Herrschaften! Bevor Sie jetzt alle aufbrechen, darf ich Ihnen noch eine kleine Wochenendlektüre ans Herz legen. Es ist ein Flyer, in dem ich selbst alles zusammengetragen habe, womit wir den Dienstweg optimieren können. Frau Gallmann, bitte…«
Frau Gallmann ging schon durch die Reihen und verteilte die Broschüre.
2
Dr.Anselm Arbogast hörte leise Stimmen von oben, als er die hintere Stahltür zur Apotheke abgesperrt hatte und die Treppe zum ersten Stock in den Wohnbereich hinaufging. Aber das war nicht ungewöhnlich. Die Stimmen stammten vom Fernseher, der Tag und Nacht im Schlafzimmer seiner Mutter lief. Sie war seit gut einem halben Jahr ans Bett gefesselt. Seit ihrem schweren Schlaganfall, dem Blutgerinnsel im Gehirn. Der Apoplex hatte seine Mutter im Schlaf überrascht und rechts halbseitig gelähmt. Er hatte Adelheid Arbogast, Witwe und Apothekerin, über Nacht in einen lebenden Leichnam verwandelt, der sich nicht mehr artikulieren konnte und nur noch im Dämmerzustand im Ehebett dahinvegetierte, ein regloser Zombie, mit dem keine Kommunikation mehr möglich war, obwohl die altkluge Pflegerin meinte, man könne nie wissen, ob so ein im Koma liegender Patient nicht doch alles oder wenigstens einiges von dem mitbekomme, was um ihn herum vorging.
Niemand kannte Adelheid Arbogast so gut wie ihr einziger Sohn. Er brauchte ihr nur in die Augen zu sehen, dann wusste er Bescheid: Sie bekam alles mit.
Und er wusste auch genau, was sie am meisten hasste: Fernsehen und Werbung im Fernsehen.
Noch während sie im Krankenhaus lag, hatte er ihr einen neuen Flachbildschirm so vor das Bett in ihrem Schlafzimmer gestellt, dass sie, wenn sie wieder daheim war und die Augen aufmachte, gar nicht umhinkam, etwas anderes zu sehen als die stets flimmernde Mattscheibe.
Der Pflegerin flunkerte er vor, dass er das Gefühl habe, seine Mutter freue sich darüber, unterhalten zu werden. Sie habe ihm einmal dankbar die Hand gedrückt, wenn auch schwach, aber er habe es deutlich gespürt. Die Lautstärke war so eingestellt, dass er gerade nicht gestört wurde, wenn er die Schlafzimmertür seiner Mutter geschlossen hatte. Wenn er sie heimlich aus einem Winkel, der außerhalb ihres Gesichtsfeldes lag, beobachtete, was er oft und mit Genugtuung tat, schien sie seine Gegenwart doch zu spüren und wahrzunehmen und murmelte Unverständliches. Ihr maskenhaftes, verzerrtes Gesicht versuchte mit übermenschlicher Anstrengung, sich irgendwie zu äußern, aber es gelang ihr nicht. Sie hatte eine leicht zu bedienende Fahrradklingel an ihrem Nachtkästchen, die Arbogast extra für sie angebracht hatte, damit sie sich bemerkbar machen konnte, denn ihre linke Hand konnte sie bewegen. Aber Arbogast schob einfach, wenn ihm das Geklingel auf den Wecker ging, das Nachtkästchen ein kleines Stück aus ihrer Reichweite. Noch in ihrem jetzigen Zustand hätte sie ihn sonst terrorisiert, so wie sie das ihr ganzes Leben hindurch getan hatte.
Damit war jetzt ein für alle Mal Schluss.
Die Installation aus Klingel und TV-Gerät war von der Pflegerin mit viel Anerkennung bedacht worden, sie fand es großartig, wie Dr.Arbogast seiner Mutter das armselige Stückchen Leben, das ihr noch geblieben war, erleichterte. Überhaupt: wie rührend der Sohn um seine Mutter besorgt war, ein wahres Vorbild für alle Menschen, die sich selbst um die Pflege ihrer Angehörigen kümmern mussten. Und dabei hätte Dr.Arbogast doch das Geld gehabt, um seine Mutter in einem teuren Pflegeheim unterzubringen. Aber nein– er wollte selbst für sie da sein, sie sollte nicht aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden. Das würde die Pflegerin auch brühwarm allen weitererzählen, und sie kam viel herum, das hatte Dr.Arbogast einkalkuliert. Manche Stammkunden, die davon erfahren hatten und ihn deswegen über den Schellenkönig lobten, wie man in Friedrichshafen zu sagen pflegte, konnten sich vor Lob und Bewunderung für die rührende Besorgtheit des Apothekers kaum noch zurückhalten. Manchmal war ihm das selbst richtiggehend peinlich, jedenfalls tat er so.
Insgeheim jedoch aalte er sich geradezu in der Sonne der öffentlichen Meinung, ihr strahlender Glanz trug nur dazu bei, seine wahre Natur zu übertünchen, der er von nun an umso eifriger und ungestörter erlauben konnte, das zu tun, was sie immer schon tun wollte.
Unbewusst sang er ein Lied vor sich hin, »Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum…«, das ihm seit Kindertagen nicht mehr über die Lippen gekommen war. Jetzt auf einmal fiel ihm der gesamte Text wieder ein, als er im Schlafzimmer seiner Mutter vor ihrem Bett stand und ihr leidendes Gesicht im flimmernden Licht des Flachbildfernsehers genoss. Er hatte extra den Ton leise gestellt, damit sie, wenn sie dazu noch in der Lage war, seinen Liedtext verstehen konnte. Vielleicht würde sie dann auch alles verstehen, was er bisher vor ihr geheim gehalten hatte, wer weiß. So kurz vor ihrem Ende hatte sie vielleicht einen dieser hellsichtigen Momente, von denen er einmal gelesen hatte. Er zog den Besucherstuhl ans Bett heran und setzte sich neben sie.
Endlich konnte sie nicht mehr über ihn bestimmen, ihn mit ihrer mitleidheischenden, wehklagenden Stimme traktieren, ihm Befehle erteilen, die in letzter Zeit nur noch mühsam als Anweisungen oder Bitten verklausuliert dahergekommen waren. Lange genug hatte er nach ihrer Pfeife getanzt, zu lange.
Eigentlich ein ganzes Leben lang.
Er griff sich an den Kopf– meldete sich da seine Migräne wieder? Prophylaktisch schluckte er eine von seinen Tabletten, die er immer in einem Döschen bei sich hatte, und spülte sie mit einem Schluck aus der Wasserflasche hinunter, die auf dem Nachtkästchen seiner Mutter stand. Eine erzwungene Auszeit wegen eines Anfalls– und sei sie auch noch so kurz– konnte er sich in diesem Stadium auf keinen Fall leisten.
Er seufzte und drehte sich zum Bildschirm um, weil er sehen wollte, was die letzten Eindrücke waren, die seine Mutter auf dem Weg ins Jenseits zu Gesicht bekam. Ausgerechnet einen dieser Fernsehfilme, die sie hasste wie die Pest. Rosamunde Pilcher. Deutsche Akteure aus der zweiten und dritten Schauspielerriege, die so taten, als seien sie Engländer. Holy shit! Seiner Mutter musste es gehen wie der Queen, wenn sie an ihre verkorkste Familie dachte: She really was not amused!
Er stellte es mit der Fernbedienung wieder ein bisschen lauter, damit sie auch wirklich hören konnte, was da vor sich ging, und auf gar keinen Fall den Werbeblock verpasste. Wenn sie noch könnte, würde sie sich jetzt winden vor hilfloser Qual. Ihre Augen flackerten voller Wut, das war der einzige Ausdruck, den sie noch hinbekam. Er nutzte die Gelegenheit und zeigte ihr die Spritze, zog demonstrativ den Kolben heraus, um sie mit Luft zu füllen.
»Du weißt schon, was heute für ein Datum ist, ja? Unser Jahrestag. Der 1.September. Du erinnerst dich doch noch daran? Ich weiß genau, dass du das nicht vergessen hast. Dann wollen wir mal… Zeit, Adieu zu sagen.«
Ihre linke, zitternde Hand tastete vergeblich nach der Fahrradklingel, aber die hatte er beim Hereinkommen tunlichst aus ihrer Reichweite geschoben. Ihre Reaktion zeigte, dass sie sehr wohl verstand, was er vorhatte. Die pure Panik spiegelte sich in ihren Augen, die weit aufgerissen waren.
Umso besser.
Dann konnte sie den endgültigen Triumph in seinem Blick wenigstens wahrnehmen.
Er nickte ihr zu: Es war unwiderruflich so weit.
Er betrachtete ihre rechte Hand, die blau geädert und mit Altersflecken übersät regungslos auf der Bettdecke lag. Im Handrücken war der Katheter mit dem Infusionsschlauch. Er würde jetzt an einer Stelle, die man hinterher nicht bemerken würde, die Spitze der Spritze einstechen und Luft in den Katheter drücken. Die Luft würde in die rechte Herzhälfte und von dort in die Lunge gelangen. Der Druck in der rechten Herzhälfte würde ansteigen, und die Blutgefäße der Lunge würden sich zusammenziehen. So lange, bis die Embolie in die linke Hälfte des Herzens weiterwanderte. Durch den Blutkreislauf hatte die Luftblase nun Zugang zum ganzen Körper. Wenn sie sich in einer Koronararterie festsetzte, würde sie einen Herzinfarkt auslösen. Wenn sie ins Gehirn gelangte, einen zweiten Schlaganfall.
So gut wie nicht nachweisbar, wenn man nicht danach suchte.
Und wer sollte das schon tun? Der langjährige Hausarzt würde eine natürliche Todesursache diagnostizieren, ihm kondolieren und ihm von Doktor zu Doktor sagen, dass seine Mutter froh sein konnte, von ihrem Zustand erlöst worden zu sein, von dem keine Besserung zu erwarten war, bevor er den Totenschein ausfüllte und unterschrieb.
Er summte leise »La-le-lu, nur der Mann im Mond schaut zu…«, während er die Luft mit Hingabe in den Katheter drückte, aufstand und seine Mutter mit Rosamunde Pilcher und der Werbung für Kukident-Haftcreme und Dulcolax gegen Obstipation allein ließ.
Er würde morgen früh nach ihr sehen, wenn es endlich vorbei war.
Wenn sie Glück hatte, würde sie noch die »Ich bin doch nicht blöd«-Werbung und das Happy End im TV mitbekommen, er gönnte es ihr von ganzem Herzen.
Aber jetzt hatte er weiß Gott Wichtigeres zu tun. Er musste in sein streng abgesichertes und schalldichtes Labor gehen. Der Zugang erfolgte durch eine Stahltür, die mit einem elektronischen Schloss versperrt war, dessen Code nur er und seine Mutter kannten, weil hinter ihr auch die Medikamente untergebracht waren, die unter das Betäubungsmittelgesetz fielen. Dort gab es Strom und einen Wasseranschluss, dort war sein ganz persönliches Reich, eben sein »Labor«, wie er seiner Mutter und seinen Mitarbeitern in der Apotheke weisgemacht hatte, in dem er angeblich in seiner Freizeit seinem Hobby, der Chemie, nachging.
Seit seine Mutter das Bett nicht mehr verlassen und ihm heimlich nachspionieren konnte, hatte er den Raum nach und nach ganz seinen Vorstellungen entsprechend eingerichtet. Er war vollkommen mit Fliesen ausgestattet, alle Geräte und der Computer waren auf dem neuesten Stand der Technik. Und er hatte einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil: Man konnte ihn auch durch eine Stahltür von der geräumigen Doppelgarage aus betreten. Wenn man etwas aus dem Auto ausladen musste, was nicht unbedingt jemand zu sehen brauchte, fuhr man in die Garage, schloss das Garagentor wieder mit der Fernbedienung und konnte in aller Ruhe– wenn es sein musste, mit der bereitstehenden Sackkarre– jeden Gegenstand, den man für sein Vorhaben brauchte, ohne unliebsame Zeugen in den Laborraum schaffen.
Alles wäre so perfekt gewesen, genau so, wie er es sich immer vorgestellt hatte. Absolute Kontrolle war etwas, was er zu seinem Lebensinhalt gemacht hatte. Dummerweise war ihm dann das Leben als solches dazwischengekommen. In Form von migräneartigen Kopfschmerzen, die aus heiterem Himmel und mit einer Heftigkeit auftraten, die ihm die Tränen in die Augen treten ließ. Zunächst hatte er zwar darunter gelitten, sie aber nicht weiter beachtet und gehofft, dass es nur eine einmalige Angelegenheit war. Aber als die Intervalle der Schmerzattacken immer kürzer wurden, wandte er sich doch an einen Neurologen, den er noch von seinem Studium her kannte und der seine Praxis in Radolfzell hatte.
Das Ergebnis der Computer- und der Kernspintomografie war ebenso eindeutig wie niederschmetternd. Er hatte ein anaplastisches malignes Meningeom an der Falx cerebri, also in der Innenseite der Schädelkalotte, das so weit fortgeschritten war, dass eine operative Entfernung praktisch ausgeschlossen war. Aber auch wenn es nahezu aussichtslos war– es gab immer Spezialisten, die so einen riskanten Eingriff wagen würden, das sagte ihm der Neurologe, um ihm nicht alle Hoffnung zu nehmen.
Arbogast, der als Apotheker mit besten medizinischen Kenntnissen nur zu gut wusste, was diese Diagnose und die Prognose bedeuteten, stellte sich vor, wie er nach dem intrakraniellen Eingriff aufwachen würde– wenn er überhaupt wieder aufwachte– und nur noch ein Zombie war, wie seine Mutter nach ihrem schweren Apoplex.
Noch in der Praxis eilte er auf die Toilette, wo er sich heftig übergeben musste.
Nein, das war ausgeschlossen, so wollte er nicht enden. Wenn schon Schluss war, dann mit einem großen Knall. Schließlich hatte er nichts mehr zu verlieren. Wenigstens den Abgang von der Bühne des Lebens, das Wie, würde er sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Und er würde ihn so gestalten, dass man sich noch jahrelang landauf und landab das Maul darüber zerreißen würde.
Deshalb ging es von nun an nur noch darum, seinen ursprünglichen Plan zu modifizieren und in der ihm verbleibenden Zeit umzusetzen. Er würde ihn bis zum Finale grande durchführen, das sich in seinem Kopf festgesetzt hatte wie der inoperable Gehirntumor, den er sich bisweilen ohne Selbstmitleid ansah. Er hatte sich den Ausdruck der Computertomografie hinter seinen Labortisch gepinnt, neben den Kanistern mit der hochexplosiven, selbst hergestellten Flüssigkeit, den Chemikalien und dem Computer, der ihm unbeschränkten Zugang zu allem verschaffte, was er für sein Werk brauchte.
Arbogast hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Eine Strahlen- und Chemotherapie lehnte er ab, die Ärzte gaben ihm, sollte er sich nicht unters Messer legen, noch ein halbes Jahr, ohne Gewähr, aber diese Gnadenfrist war ein Mittelwert aus mehreren Diagnosen. Er war noch bei diversen anderen Spezialisten gewesen, die Prognosen gingen dabei weit auseinander.
Es war der Tag gekommen, als er es endgültig satthatte, von Praxis zu Praxis zu marschieren und Klinken zu putzen, sich das immer gleiche Gelaber der Ärzte anzuhören und ihre auf geziemenden Ernst und Empathie getrimmten Gesichter anzusehen. Sein ganzes irdisches Dasein hatte er darauf hingearbeitet, selbstbestimmt zu leben. Das hatte zuerst seine Mutter verhindert, und nun, da er endlich hätte tun und lassen dürfen, wonach ihm der Sinn stand, war dieser gottverdammte Krebs dazwischengekommen.
Nach dem ersten Schock und der verspätet einsetzenden Verzweiflung war ihm noch in derselben schlaflosen Nacht klar geworden, dass sein Todesurteil gleichzeitig auch eine Chance war, das mit aller Konsequenz durchzuführen, was er immer schon hatte tun wollen. Nun gab es eben keine Optionen mehr.
Dass er über den Zeitpunkt seines Ablebens ziemlich genau Bescheid wusste, hatte auch etwas Gutes. Es machte ihn praktisch unverwundbar, falls er vor dem Finale erwischt werden sollte– was er tunlichst vermeiden wollte. Niemals würde er mit lebenslänglicher Haft und anschließender Sicherungsverwahrung bestraft werden, niemals würde er ein Gefängnis von innen sehen, das war bei seinem ursprünglichen Plan immer seine größte Sorge gewesen. Selbst wenn er das, was er vorhatte, noch so genau und sorgfältig durchführte, gab es immer dumme Zufälligkeiten und Fehler, die einen auffliegen lassen konnten, bevor man sein Ziel erreicht hatte. In seinem Fall war das nun egal. Fast egal– denn sein Ziel, die große Apotheose seiner selbst, musste natürlich erreicht werden, sonst wäre alles umsonst gewesen. Erst wenn er mit seiner Tat ans Ziel gekommen war, hätte sein ganzes Leben einen wirklichen Sinn gehabt.
Er starrte einen Kratzer an der Stahltür an und merkte, dass er, anstatt den Geheimcode einzugeben, wieder einmal regungslos stehen geblieben war, ganz in seine Gedankenwelt versunken, und dabei jegliches Zeitgefühl verloren hatte. Als er einen Blick auf seine Uhr warf, stellte er fest, dass er mindestens fünfzehn Minuten lang einen völligen Blackout gehabt haben musste. So etwas war früher, als er noch gesund war, nie vorgekommen. Es konnte durchaus eine Folge der Krankheit sein, die sich da in seinem Kopf eingenistet hatte. Das bereitete ihm mehr als ein dumpfes Unbehagen– so ein Aussetzer zur falschen Zeit konnte ihm den entscheidenden Strich durch die Rechnung und damit alles zunichtemachen. Was, wenn er für immer länger werdende Zeitabschnitte nicht mehr wusste, was er tat?
Er verdrängte den Gedanken daran wieder. Er musste sich darauf konzentrieren, was er sich jetzt und heute noch zu erledigen vorgenommen hatte, und tippte endlich die Zahlenfolge ein.
Im Labor machte er Licht. Auf dem einfachen Feldbett lag das Mädchen wie Schneewittchen im Glassarg. Lange Haare, schwarz wie Ebenholz, das Gesicht bleich wie Schnee, die Augen wie im Schlaf geschlossen, die Arme ausgestreckt am Körper. Sein Eröffnungszug gewissermaßen. Arbogast war begeisterter Schachspieler. Und zwar ein guter– er hatte bis zum Schachmatt seines Gegners alle Züge schon vorausberechnet. Das Mädchen stand unter perfekt dosierten Drogen und bekam nichts davon mit, wo es war und was um es herum vorging. Es war seit einem Tag in seiner Gewalt und mit Kabeln an einen Monitor angeschlossen, der seine Vitalfunktionen kontrollierte und den er über sein Smartphone ständig überwachen konnte. Gelobt sei das heilige Zeitalter der Computertechnik!
Er streckte die Hand aus und wollte dem Mädchen über die schwarzen Locken streichen. Im letzten Moment hielt er sich zurück, weil er gerade noch rechtzeitig merkte, dass er seine Vinylhandschuhe nicht anhatte. Beinahe hätte er einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Wenn man nicht an alles dachte!
Er studierte das Gesicht, das gelegentlich zuckte, als würde sich in seinem Kopf ein schrecklicher Alptraum abspielen.
Arbogast lachte in sich hinein. Niemand wusste, dass dies erst der Auftakt zu einem Spektakel großen Ausmaßes war, gegen den ein Shakespeare’sches Königsdrama ein müdes Possenspiel war. Dabei hatte er ein Faible für Shakespeares Schurken: König Lear, RichardIII., Macbeth…
Er würde sie alle wie Waisenknaben aussehen lassen.
Aber dann würde es zu spät sein.
Der Name des Mädchens war Sandra.
3
And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
She said, »There is no reason
And the truth is plain to see.«
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well’ve been closed
Warum ihm ausgerechnet dieser Song aus den späten 1960er Jahren im Kopf herumspukte, wusste er nicht. Er wusste nur, dass es nicht die Originalversion von Procol Harum war, sondern die gecoverte von Annie Lennox.
In seinem Traum hetzte Madlener durch die Gänge eines riesigen, abbruchreifen Gebäudes am Ende der Welt. Seine Assistentin Harriet rannte voraus, sie hatten es aus irgendeinem Grund furchtbar eilig, wahrscheinlich war er wie immer zu spät dran.
Er suchte nach einem Gesicht, konnte sich aber einfach nicht mehr vorstellen, wie es aussah. Er erinnerte sich nur noch, wie die Frau hieß, die hier unten irgendwo sein musste: Ellen. Er rief ihren Namen, aber er bekam keine Antwort, nur das schallende Echo seiner eigenen Stimme. Auf einmal erfasste ihn eine vage Angst, dass er für immer vergessen hatte, wie sie aussah.
Rechts und links gingen weitere Gänge und Hallen ab, es war wie in einem Labyrinth, bei dem man nicht einmal ahnte, was das Ziel war und wohin man wollte. Die Wände der Räume und Gänge waren bedeckt mit unzähligen Graffiti und Kritzeleien ohne Sinn. Von der Decke hingen seltsame Artefakte aus knochenbleichem Schwemmholz und Tiergeweihen, wie man sie für exotische magische Zeremonien verwendete. Er wunderte sich– sie waren doch am Bodensee, seit wann gab es da einen Voodoo-Kult? Einige Schmierereien waren Gang-Tags oder die üblichen Spraymenetekel von irgendwelchen Freaks im Drogenrausch mit nicht vorhandenen oder obskuren Botschaften, andere wie Höhlenmalereien von Aborigines, wieder andere irres Gekrakel von verlorenen Seelen, die ihre quälenden inneren Stimmen dadurch loszuwerden hofften, dass sie alles manisch an die Wand schrieben, was ihnen diese einflüsterten.
Endlich fand Madlener einen kahlen, kirchenschiffhohen Raum mit schier endlos aufragenden gotischen Säulen, in dem Menschen waren, die er alle kannte. Seine zwei Ex-Frauen, seine Eltern, die seit über zehn Jahren tot waren, sein Bruder und ein paar Freundinnen aus Jugendzeiten. Seltsamerweise fielen ihm auf Anhieb ihre Namen ein, Franziska, Uschi Nummer eins und zwei, Lore, Barbara. Sie alle standen anklagend da, als ob sie nur auf ihn gewartet hätten. Es schien eine Art Tribunal zu sein. Mitten unter ihnen, den Rücken ihm zugewandt, war ein älterer Mann mit schlohweißen Haaren.
Gandalf?
Oder vielleicht doch… Gott?
Madlener war alles andere als religiös, aber das konnte nur ER sein, der wissen wollte, warum er immer zu spät kam und dann auch noch ständig seine Siebensachen vergessen hatte. Insbesondere seine Dienstwaffe, die SIG Sauer. Er tastete danach.
Schlagartig wurde ihm bewusst, dass er auch diesmal nichts dabeihatte und seine Pistole schon gar nicht. Er sah an sich herunter: Was zum Teufel hatte er sich dabei gedacht, zu so einer wichtigen Unterredung mit Gott nur ein Nachthemd anzuziehen? Dabei besaß er doch gar keine Nachthemden.
Er suchte vergeblich nach Taschen, aber Nachthemden hatten nun mal keine.
Der weißhaarige und weißbärtige Mann drehte sich wie in Zeitlupe langsam zu ihm um und zeigte sein wahres Gesicht: Gott hatte eine dicke Brille und sah mit seinen Fischaugen seltsamerweise aus wie sein ehemaliger Psychiater, Dr.Dr.h. c. Auerbach, der Vater seiner Lebensgefährtin.
»Du«, sagte Dr.Auerbach in anklagendem Ton und mit donnernder Stimme, »du!«, und zeigte mit dem Finger in seine Richtung.
Madlener sah neben und hinter sich– da war niemand außer ihm selbst.
Harriet war verschwunden. Also konnte nur er gemeint sein.
Verzweifelt versuchte Madlener sich zu entsinnen, was er jetzt wieder angestellt hatte, und wies unsicher auf sich.
»Ja, du bist gemeint! Mad Max…«, bestätigte der Weißhaarige mit den dicken Brillengläsern voller Ingrimm.
Wenn dieser weißbärtige Ankläger schon seinen Spitznamen wusste, stand er fraglos wegen eines schweren Vergehens vor Gericht– oder war es gar wegen eines Kapitalverbrechens?
Sosehr er sich auch darüber den Kopf zerbrach: Er konnte sich beim besten Willen nicht erinnern. Irgendwie glaubte er aber zu wissen, dass er verdammt noch mal unschuldig war!
Oh Mist, Mist, Doppelmist– er hatte eben zum zweiten Mal geflucht! Und das vor dem Angesicht seines Psychiaters. Oder hatte sich Gott nur als solcher verkleidet? Schließlich war er Gott, er konnte das.
Die Strafe, die ihn nun wohl oder übel erwartete, würde jetzt natürlich noch höher ausfallen. Warum konnte er auch sein loses Mundwerk nicht halten? Obwohl– eigentlich hatte er bisher überhaupt keinen Ton von sich gegeben!
Oder etwa doch? Er glaubte sich zu erinnern, dass er Ellens Namen gerufen hatte. Mehrfach. War das vielleicht der Anlass für diese kafkaeske Situation, in der Gott oder Dr.Auerbach ihm den Prozess machte, ohne dass er, »Mad« Max Madlener, überhaupt wusste, wogegen er sich eigentlich verteidigen sollte?
»Max«, sagte eine Stimme, »Max…«
Es war keine Männerstimme, es war eine ihm wohlbekannte weibliche. Er blinzelte und sah in ein Paar braune Augen, die ins Goldfarbene changierten. Dazu legte sich eine kühle Hand auf seine Stirn. »Hast du Fieber? Du bist so heiß!«
»Ellen, Gott sei Dank! Du bist es…«
Die Erleichterung, die ihn überkam, als ihm endlich bewusst wurde, wo er war– nämlich in Ellens Bett–, war schier grenzenlos.
Sie musste lächeln und küsste ihn sanft. »Wen hast du sonst erwartet?«
Er setzte sich im Bett auf und rieb sich sein Gesicht, um erst einmal ganz zu sich zu kommen. »Entschuldige, ich habe furchtbares Zeug geträumt.«
»Das hab ich gemerkt. So wie du gestöhnt hast.«
»Habe ich was gesagt?«
»Wieso? Hast du Angst, im Schlaf etwas auszuplaudern, was ich nicht hören darf?«
Er warf ihr einen gespielt strengen Blick zu und sagte: »Wenn es unter das Dienstgeheimnis fällt… Wie spät ist es eigentlich?«
»Halb sieben. Am Sonntag.«
»Oh Gott…« Er ließ sich mit einem Seufzer der Erleichterung wieder zurück aufs Kopfkissen fallen.
Sie schmiegte sich an ihn und sah ihn mit diesem leichten Silberblick an, mit dem sie so unschuldig daherkam wie eine Fee aus dem Morgennebel von Avalon– die es aber in Wirklichkeit faustdick hinter den Ohren hatte. Kein gesundes männliches Wesen aus Fleisch und Blut konnte diesem Blick widerstehen, er erst recht nicht.
»Bist du schon ganz wach? Ich bin es jedenfalls…«, gurrte sie.
»Was soll das heißen?«, brachte er mit belegter Stimme heraus, obwohl er es ganz genau wusste.
»Frag nicht so dumm.«
4
Der Schlaf danach war tief und traumlos. Madlener erwachte erst, als etwas unwiderstehlich in seiner Nase kitzelte: der Duft von Croissants und frisch gebrühtem Kaffee.
Ellen hatte im Freien den Tisch gedeckt.
Sie saßen entspannt im Morgenmantel auf der Terrasse in der für September erstaunlich warmen Sonne und frühstückten bei ihrer Morgenlektüre, die Sonntagszeitung hatten sie sich redlich geteilt. Madlener studierte den Sportteil und Ellen die Seiten mit den A- und B-Promis, um zu erfahren, wo diese ihren Urlaub verbrachten und mit wem sie fremdgingen. Manchmal beschlich sie das Gefühl, dass diese Stars und Starlets zwischen den ganzen Charity-Galas, Preisverleihungen und Homestorys ständig Urlaub machten und ständig fremdgingen. Wann arbeiteten die eigentlich?
Madlener las, welche Spieler der FCBayern München verpflichtet hatte und welche die Stuttgarter nicht, weil der VfB kein Geld hatte und stattdessen wieder einmal den Trainer feuerte. Da klopfte es an seine Zeitung. Er ließ sie sinken und sah Ellens Gesicht vor sich. Sie hatte ein tückisches Glitzern in den Augen.
»Ja?«, seufzte Madlener, weil er wusste, dass es nun ernst wurde und er gewisse Zusagen nicht weiter hinauszögern konnte, was er auf mehr oder weniger raffinierte Art und Weise die ganzen letzten vierzehn Tage schon getan hatte. Er war auf alles gefasst, einmal musste es ja so weit kommen, dass Ellen das bisher streng unter Verschluss gehaltene Tabuthema aufs Tapet brachte.
»In zwei Wochen ist D-Day«, sagte sie, sie sprach es englisch aus.
»D-Day?«
»Du weißt genau, was das heißt.«
»Nein, wirklich nicht.« Er stellte sich erst mal dumm und schlürfte an seinem Kaffee, das war vielleicht die beste Taktik. Doch damit kam er bei Ellen nicht weit.
»Daddy-Day«, erklärte sie mit einem gewissen heimtückisch-kindischen Unterton.
»Nein!«, sagte er und verzog das Gesicht, als hätte er schlecht gewordene Milch in seinen Kaffee getan. Dabei nahm er gar keine Milch.
»Doch«, sagte sie. »Du hast es mir versprochen. Zu seinem runden Geburtstag.«
»Na ja, so halb und halb«, wehrte er sich schwach. Es war sowieso vergebens.
»Max, bitte…«
Er nahm ihre Hand. »War nur ein Spaß.« Dabei war ihm nicht nach Lachen zumute. »Klar komm ich mit. Mach dir mal keine Sorgen.«
»Er will mit uns eine richtige Bergwanderung unternehmen.«
»Bergwanderung?« Beinahe hätte er die Kaffeetasse umgestoßen, so ruckartig zog er seine Hand wieder zurück. »Nur über meine Leiche!«
Sie griff nach seiner Hand, tätschelte sie und lächelte ihn verführerisch an. »Jetzt hab dich nicht so. Das hört sich schlimmer an, als es ist. Ein kleiner Spaziergang an frischer Bergluft, du brauchst nur ein Paar feste Schuhe. Die hast du doch, oder?«
Er gab sich für den Augenblick geschlagen– in der stillen Hoffnung, dass in zwei Wochen eine Menge passieren könnte.
»Ja, klar.«
Sie lehnte sich zufrieden zurück. »Und was ist mit deiner Kondition? Du rauchst seit Neuestem wieder.«
Er winkte ab. »Nur gelegentlich. Meine Kondition reicht für drei Achttausender nacheinander. Ohne Sauerstoff.«
Ellen glaubte ihm die vorgespielte Reinhold-Messner-Nummer nicht. »Vernehme ich da unterschwellig einen gewissen süffisanten Unterton der Unwilligkeit?«, fragte sie und runzelte die Stirn.
Er glättete die Fältchen sanft mit dem Daumen.
»Nein, überhaupt nicht.«
Er verschränkte seine Arme vor der Brust. »Hör mal: Es reicht, dass dein Vater versucht, mich ständig zu analysieren. Warum fängst du jetzt auch noch damit an?«
»Max– es ist nur für drei Tage. Aber Dad wünscht es sich so sehr. Nach der Mediation.«
Madlener erstarrte und sah Ellen perplex an, als habe sie ihm eben gestanden, dass sie noch mit drei anderen Männern gleichzeitig verheiratet sei und am nächsten Tag wegen Trigamie vor Gericht stehen werde.
»Nach der was?«, fragte er und konnte es nicht vermeiden, sein Gesicht zu verziehen.
»Du hast schon richtig verstanden. Nach der Mediation. Es ist an der Zeit für ein Versöhnungsgespräch zwischen euch. Dad hat das vorgeschlagen. Als Zeichen seines Entgegenkommens.«
»Entgegenkommen? Dein Vater will mir entgegenkommen?«
»Ja. Und ich finde das großartig von ihm. Sehr… sehr großzügig.«
»Großzügig?«
»Sag mal, bist du ein Papagei, der alles wiederholt, was ich sage?«
»Jetzt mal im Ernst: Dein Vater will, dass wir zwei– er und ich– eine Mediation machen?«
»Ja. Er findet, dass ihr beide einen Neuanfang braucht. Nun, da er allmählich merkt, dass wir beide in einer festen Beziehung sind und es ernst meinen. Er tut das mir zuliebe. Weil er eingesehen hat, wie wichtig du mir bist.«
Madlener stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich wusste es.«
»Was?«
»Dass er nichts unversucht lässt, mir meine Schädeldecke aufzufräsen, um an meine innersten Gedanken heranzukommen. Dr.Frankenstein, bildlich gesprochen.«
»Mein Gott, jetzt sei doch nicht gleich so dramatisch.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, falsch. Nicht bildlich. Er will das wörtlich. Und du assistierst ihm dabei.«
Als sie sah, dass er unwillkürlich an seinen Kopf fasste, als würde Dr.Auerbach schon eine dieser kleinen, hässlichen Knochenkreissägen aus ihrem Werkzeugkasten in der Pathologie ansetzen, musste sie lachen.
»Siehst du«, sagte sie, »genau das ist der Grund, warum es für euch alle beide nur von Vorteil sein kann, wenn ihr euch mal so richtig aussprecht. Von Mann zu Mann.«
Er schloss die Augen. Na schön, dachte er, wenn ich schon nichts ausschlagen kann, woran ihr wirklich etwas liegt, dann heißt es eben die Zähne zusammenbeißen und durch. Oder noch besser: gute Miene zum bösen Spiel machen und den Kampf ausfechten.
Wenn es denn sein musste, bis aufs Blut. Er würde Dr.Dr.h. c. Auerbach nichts schenken. Sollte er doch sehen, was er von seiner Mediation hatte. Er würde ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Erst einlullen und dann erbarmungslos zustoßen. Nur mit Worten natürlich. Aber die konnten bisweilen, richtig angewandt, schärfer sein als jedes Schwert. Auch er, Hauptkommissar Max Madlener, war ein Meister im Umgang mit der menschlichen Psyche, nicht nur der selbst ernannte Nachlassverwalter und Apostel von Sigmund Freud und Vater seiner Geliebten. Schließlich war Madlener ein ausgewiesener Verhörspezialist, der wie sein Kontrahent auch aus beruflichen Gründen schon in so manchen menschlichen Abgrund geblickt hatte. Sie würden die rhetorischen Klingen kreuzen. Mal sehen, wer letzten Endes die Oberhand behielt.
»Wenn ich so nachdenke… weißt du, irgendwie freue ich mich schon darauf, mich mit deinem Vater zu versöhnen«, log er unverfroren, dass sich die sprichwörtlichen Balken bogen. »Das könnte vielleicht der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein.«
Ellen sah ihn an und wartete nur darauf, dass er entweder errötete oder in prustendes Lachen ausbrach.
Aber Madlener hatte seinen dienstlichen Meeting-Room-Blick aufgesetzt, das Paradebeispiel für die perfekte Vortäuschung von Konzentration und beifälliger Zustimmung. Diese Miene war eigentlich für seinen Chef, Kriminaldirektor Thielen, reserviert, doch genau dieser Blick war jetzt und hier angebracht, weil sogar Ellen auf ihn hereinzufallen schien.
Sie umarmte ihn spontan und drückte ihm einen dicken Schmatz auf die Backe.
»Danke. Dass du über deinen eigenen Schatten springst– das hätte ich dir nie zugetraut!«
Er zuckte bescheiden mit den Schultern. Jedes weitere Wort wäre zu viel des Guten gewesen. Wirklich große Schauspielkunst zeigte sich eben nicht in exaltierten Gesten, sondern in zurückhaltender Mimik und Gestik.
5
Magdalena Baumgärtner hatte es nicht eilig, als sie mit ihrem alten Audi von der viel befahrenen Bundesstraße B31 zwischen Meersburg und Nußdorf abbog und die Senke zur Basilika Birnau hinabsteuerte. Sie war achtundsiebzig Jahre alt, hatte eine spindeldürre Gestalt mit langen, zerbrechlich wirkenden Armen und Beinen, eine randlose Brille und ihre grauen Haare zu einem Dutt am Hinterkopf zusammengedreht. Obwohl man ihr das nicht mehr zutraute, fuhr sie auf den Feldern und Obstwiesen ihres Bauernhofs im Hinterland des Bodensees mit dem Traktor herum, wenn es die Aussaat oder die Ernte notwendig machte und jede helfende Hand gebraucht wurde. Den Familienbetrieb hatte sie längst an ihre Tochter und den Schwiegersohn übergeben, sie wohnte in einem kleinen Austragshäuschen neben dem stattlichen Zweikanthof und war mit sich und ihrem Leben im Reinen.
Auch sonst machte sie sich überall nützlich, wo sie nur konnte. Sie hütete die drei Enkelkinder, und bei Bedarf stand sie halbtags im kleinen Bioladen des Hofs, in dem die Familie Baumgärtner ihr Obst und Gemüse und selbst gebrannten Schnaps verkaufte.
»Müßiggang ist aller Laster Anfang« war ihr Lebensmotto, und sie war es gewohnt, überall mit anzupacken, auch wenn das eine oder andere altersbedingte Zipperlein sie gelegentlich heimsuchte. Aber ob es an ihren Genen lag oder an ihrer Generation, die noch in Kriegszeiten aufgewachsen war: Sie klagte nie. Wehleidigkeit war in ihren Augen genauso eine Todsünde wie Trägheit. Jedenfalls solange sie jeden Morgen in der Lage war, um die gleiche Zeit in aller Herrgottsfrüh, wenn noch keine Touristenhorden wie die sprichwörtlichen Heuschreckenschwärme einfielen, »ihre« Kirche für ein stilles Gebet aufzusuchen. Dort, in der Basilika Birnau, ließ sie sich auch alle zwei Wochen die Beichte abnehmen.
Beides war ihr ein Bedürfnis und gehörte zu ihrem natürlichen Lebensrhythmus wie Essen und Trinken, wobei sie, wovon ihre hagere Gestalt Zeugnis ablegte, sich auch auf diesem Gebiet strenge Mäßigung auferlegt hatte. Was ihr nicht weiter schwerfiel, weil ihr Körper schon lange auf Sparflamme umgeschaltet hatte. Sie musste sich geradezu zwingen, regelmäßig etwas zu sich zu nehmen, um einigermaßen bei Kräften zu bleiben.
Angst vor dem Tod hatte sie nicht, im Großen und Ganzen hatte sie ein gottesfürchtiges Leben geführt. Und für die Sünden, die sie begangen hatte, lieh ihr Beichtvater Pater Sixtus sein Ohr und erteilte ihr regelmäßig im Auftrag des Herrn seine Absolution– es waren sowieso nur Sünden lässlicher Art. Aber es war ihr wichtig, dass sie sie bekannte und dass sie das befreiende Gefühl hatte, sie seien ihr wirklich vergeben worden. Nur dann fühlte sie sich wohl in ihrer Haut, die in letzter Zeit immer durchsichtiger und pergamentener geworden war.
Es war kurz vor acht Uhr in der Früh, als Magdalena Baumgärtner auf den Parkplatz neben der Wallfahrtskirche fuhr. Der Schatten eines großen Luftschiffs glitt über den Platz, der ZeppelinNT war auf einem seiner täglichen Rundflüge mit zahlungskräftigen Passagieren vom Friedrichshafener Airport im Bodenseeraum unterwegs. Für die Einheimischen war der Anblick des riesigen Luftschiffs nichts Besonderes, bei ruhigem Wetter drehte der Zeppelin von früh bis spät seine gemächlichen Runden.
Über dem oberen Fischschwanz des Bodensees, dem Überlinger See, schwebten dichte Nebelschwaden und verliehen seinem Anblick im Morgenlicht beinahe etwas Entrücktes und Mystisches, wenn da nicht der ständig rauschende Geräuschpegel der nahen B31 gewesen wäre, dessen Brausen unablässig Tag und Nacht zu hören war. Das Singen der Reifen und das Brummen der Motoren eines stetigen Fahrzeugstroms in beiden Fahrtrichtungen sorgten gnadenlos dafür, dass die weite Panorama-Umsicht vor der Kirche nicht allzu überschwänglich ins romantische Klischee verkitschte.
Magdalena Baumgärtner nahm mit ihrem alten Audi, mit dem sie immer noch sicher und manchmal mehr als zügig unterwegs war, den erstbesten Stellplatz und stieg aus, dem Zeppelin schenkte sie nur einen kurzen Blick. Der Parkplatz neben dem Kiosk war um diese Zeit noch leer, aber in zwei, drei Stunden, wenn der Touristenstrom einsetzte, würde man Probleme bekommen, überhaupt eine Lücke zwischen den zahllosen Bussen, Wohnmobilen, Motorrädern und Pkws zu ergattern. Die Basilika Birnau zählte zu den Hauptattraktionen des Bodenseeraums und war geradezu das Musterbeispiel eines dekorativen Postkartenmotivs. Sie war ein weithin sichtbares und markantes, in Altrosa und Weiß gehaltenes Juwel des Rokoko, und ihre Architektur und allein stehende Lage auf einem Hügelvorsprung über dem Nordwestufer des Bodensees oberhalb der klösterlichen Weinberge war einzigartig.
Direkt am Ufer des Sees unterhalb der Kirche waren die ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Klosters zu bewundern, Schloss Maurach und der putzige Bahnhof gleichen Namens, der als Plastiknachbildung so manche deutsche Spielzeugeisenbahnanlage schmückte, in der Ferne die Insel Mainau, die jetzt im Nebel lag, genauso wie die Schweizer Alpenkette, die nur zu erahnen war. Neben Schloss Neuschwanstein und dem Kölner Dom sorgten die Wallfahrtskirche Birnau und ihre Umgebung zuverlässig dafür, dass vor allem bei den japanischen Besuchern auf ihrer Deutschland-in-zwei-Tagen-Tour ein regelrechtes Fotografierfieber grassierte, sobald sie aus ihren Reisebussen ausgestiegen waren.
Dabei interessierte sich selten jemand für die Kehrseite der Hochglanzmedaille, ein Mahnmal für die typische Widersprüchlichkeit der deutschen Seele, denn genau im Rücken der Vorzeigekulisse, ein paar hundert Meter weiter auf der nordöstlichen Seite der B31, lag der KZ-Friedhof Birnau, in dem siebenundneunzig Tote aus dem Außenlager Aufkirch beerdigt worden waren, die kurz vor Kriegsende ihr Leben für sinnlose Grabungen der Nazis im nahen Molassegestein des Goldbacher Stollens hatten lassen müssen.
Magdalena Baumgärtner hatte kein Augenmerk dafür, weder für die Manifestation des menschlichen Strebens nach Schönheit auf der einen noch nach Zeugnissen des Vernichtungswahns auf der anderen Seite. Sie war allein darauf fixiert, wie sie Pater Sixtus schildern sollte, dass sie die Todsünde begangen hatte, im Bioladen einen selbst produzierten Ziegenkäse zu verkaufen, dessen Haltbarkeitsdatum eigentlich abgelaufen und der schon zum Wegwerfen hergerichtet worden war. Als sie den Fehler bemerkt hatte, war sie dem unbekannten Kunden noch hinterhergelaufen, aber der war schon vom Hof gefahren. Dieses Missgeschick belastete ihr Gewissen, und sie hoffte inständig, dafür von ihrem Stammbeichtvater Absolution zu bekommen. Vielleicht konnten ein entsprechendes Scherflein für die Instandhaltung der Kirche und das Anzünden einer Opferkerze dabei nicht schaden.
Sie kramte in ihrem Geldbeutel nach entsprechenden Münzen und betrat den Vorraum zum Kirchenschiff, grüßte die Verkäuferin des zur rechten Hand gelegenen Klosterladens, die gerade dabei war, die Postkartenständer verkaufsgerecht aufzustellen, mit einem Nicken und überlegte kurz, ob sie die Beichtglocke betätigen sollte, die Pater Sixtus herbeirufen würde. Aber dazu war es noch zu früh, Beichtgelegenheit gab es erst ab neun Uhr, auch das Ohr Gottes hatte Pausen und feste Öffnungszeiten, dafür hatte irgendjemand in der himmlischen Gewerkschaft schon gesorgt. Sie beschloss, zuerst die eine oder andere Opferkerze anzuzünden und still zu beten, bevor sie beichten würde.
Sie drückte die schwere Tür zum Kirchenschiff auf und bekreuzigte sich mit Weihwasser. Als die Tür wieder ins Schloss fiel, ging es ihr wie immer, wenn sie allein im Kirchenschiff war– und das war sie, wie sie im ersten Rundumblick zu ihrer Zufriedenheit feststellte. Die plötzlich einsetzende Stille nach dem Zuschnappen der Tür bewirkte, dass sie das Gefühl hatte, die geschäftigen Geräusche der profanen Welt seien mit einem Mal draußen ausgesperrt worden, sodass sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren konnte, nämlich die Zwiesprache mit Gott und dem Einssein mit sich selbst.
Sie schätzte sich glücklich, zu so früher Stunde der einzige Mensch in der Basilika zu sein, ohne Rummel und ohne Blitzlichter, die verboten waren, worauf mehrere Schilder hinwiesen. Aber darum kümmerte sich niemand, wenn es darum ging, so schnell wie möglich so viel wie möglich abzufotografieren. An die spätbarocke Pracht, Lichtführung und Vielfalt mit dem schier überbordenden Zierrat aus Ornamenten, Fresken, Stuckaturen, Figuren, Beichtstühlen und Altären verschwendete sie keinen Blick, die beeindruckende Umgebung mit der üppigen Betonung der Herrlichkeit Gottes und der Macht der katholischen Kirche war für sie Normalität und gehörte zu ihrem Alltag.
Sie wandte sich nach rechts, steckte zwei Silbermünzen in den dafür vorgesehenen Opferstock und wollte gerade zwei Kerzen anzünden und auf das eiserne treppenförmige Gestell drapieren, als ihr auffiel, dass auf dem Boden einige Teelichter verstreut herumlagen. Die hatten hier eigentlich nichts zu suchen, die Opferkerzen waren alle unecht, es waren Kerzen aus weißen Metallhülsen, deren ölgetränkte Dochte angeblich rußfrei brannten.
Sie bückte sich und sammelte die Teelichter ein. Ihr Blick fiel dabei auf die Apsis und ließ sie irritiert in ihrer Bewegung innehalten. Vor dem Hauptaltar flackerten weitere brennende Teelichter, die in einem Kreis auf dem Boden aufgereiht waren, und, sie traute ihren Augen kaum, dazwischen lag etwas, was aussah wie eine menschliche Gestalt.
Zögernd ging sie auf die Apsis zu, die durch eine rote Kordel abgesperrt war, und sah genauer zum Marienaltar hin. Zuerst dachte sie, es sei jemand, der in altkatholischer Manier flach auf dem Bauch liegend und mit ausgestreckten Armen in einem Bittgebet um Gnade flehte. Das war in einer Wallfahrtskirche zu respektieren. Zuerst wollte sie einem inneren Impuls folgen und sich abwenden, um nicht zu stören, aber die absolute Reglosigkeit der Person kam ihr dann doch seltsam vor. Wie tot lag sie da.
Magdalena Baumgärtner mühte sich unter der Holzbarriere des Lettners durch, was ihr ziemlich schwerfiel, weil sie nicht mehr so gelenkig war, und sah an der zierlichen Gestalt und den langen Haaren, dass die Person ein Mädchen oder eine jüngere Frau sein musste.
Hier konnte etwas nicht stimmen.
Magdalena Baumgärtner war zwar fromm mit einem guten Schuss Bigotterie, aber nicht weltfremd. Sie hielt sich auf dem Laufenden, wie die Jugend von heute tickte, schließlich hatte sie drei Enkelkinder. Entweder war die Frau, die vor ihr ausgestreckt dalag und sich nicht rührte, von religiösem Wahn besessen oder völlig zugedröhnt, oder sie war… tot.
Magdalena Baumgärtner kniete sich neben sie. Die Gestalt hatte rosé-goldene Sneakers, enge Jeans und einen rosafarbenen Kapuzenpulli an. Das Gesicht war nicht zu erkennen, es war in den roten Teppich geschmiegt, die lockigen schwarzen Haare bedeckten es vollends.
»Hallo«, sagte Magdalena Baumgärtner und stupste die Gestalt leicht an der Schulter an. »Kannst du mich hören?«
Fast erwartete sie, dass das Mädchen sich umdrehen und sie anschnauzen würde, vielleicht weil es betrunken war und hier vor dem Altar seinen Rausch ausschlief. Aber es bewegte sich nicht.
Magdalena Baumgärtner nahm ihren ganzen Mut zusammen und tastete nach der Halsschlagader. Sie konnte einen leichten Puls fühlen, er war kaum wahrnehmbar. Vorsichtig packte sie das Mädchen an der Schulter und drehte es herum.
In diesem Moment kam Pater Sixtus durch die seitliche Zisterzienserpforte, beugte im Mittelgang, wie es sich gehörte, das Knie in Richtung Altar und bekreuzigte sich.
»Pater Sixtus… Gott sei Dank…«, murmelte Magdalena Baumgärtner bei seinem Anblick erleichtert und rief so laut, dass es durch das ganze Kirchenschiff hallte: »Kommen Sie, schnell!«
Pater Sixtus, ein alter Mann von beleibter Gestalt und manchmal etwas schwer von Begriff, reagierte nicht gleich und blinzelte irritiert in ihre Richtung. Magdalena Baumgärtner stand auf und winkte ihm heftig. »Pater, hierher! Da liegt ein Mädchen. Kommen Sie und helfen Sie mir!«
Als Pater Sixtus immer noch unschlüssig stehen blieb, als habe er eine unerklärliche Marienerscheinung, fing sie an, noch lauter zu werden. »Nun machen Sie schon! Holen Sie Hilfe– Sie müssen den Notarzt rufen, und zwar schnell!«
Jetzt kam endlich Bewegung in Pater Sixtus, er tat ein paar Schritte auf den Altar zu, wirkte aber nach wie vor einigermaßen verwirrt. »Frau Baumgärtner? Was machen Sie da? Was ist da los?«, fragte er.
Magdalena Baumgärtner riss beinahe der Geduldsfaden