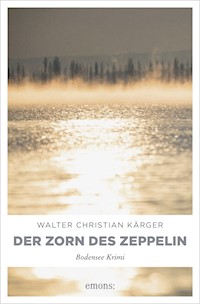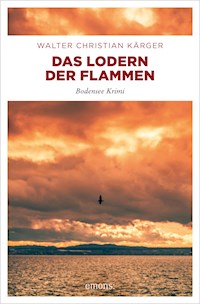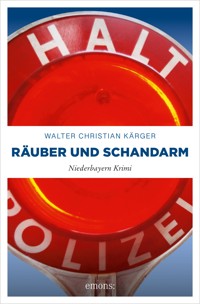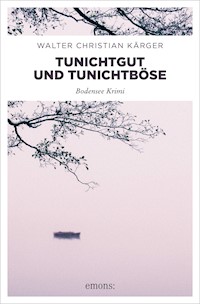
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Emons VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Max Madlener
- Sprache: Deutsch
Staatsanwalt Matussek aus Friedrichshafen fühlt sich und seine Familie verfolgt und bedroht - von einem verurteilten Mörder, den er vor Jahren hinter Gitter gebracht hat. Kommissar Madlener und seine Assistentin Harriet sollen sich darum kümmern. Doch als im Eisenbahntunnel von Überlingen eine Frauenleiche gefunden wird, nimmt der Fall eine überraschende Wendung, und Madlener muss weit in die Vergangenheit zurückgehen, um alle Fäden zu entwirren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Christian Kärger, geboren 1955 in Memmingen/Allgäu, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/Livepiccs.de Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Carlos Westerkamp eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-779-6 Bodensee Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
See these eyes so green
I can stare for a thousand years
Colder than the moon
It’s been so long
And I’ve been putting out fire
With gasoline…
»Cat People (Putting Out Fire)« von David Bowie
Wir sind beide zwei rechte Tunichtgute und Tunichtböse.
Jenseits von Gut und Böse fanden wir unser Eiland
und unsre grüne Wiese– wir zwei allein!
»Also sprach Zarathustra« von Friedrich Nietzsche
Prolog
»Was hast du vor, wenn du hier rauskommst?«
Giovanni saß im Rollstuhl am Billardtisch, sein unvermeidliches Baseballkäppi der New York Yankees mit dem Schild nach hinten im Stil der Hip-Hopper auf dem Kopf, obwohl er die sechzig bereits überschritten hatte. Er zielte mit seinem Queue auf die weiße Kugel, die die schwarze Acht im mittigen Loch der Bande versenken sollte, was nicht ganz einfach war, denn sein Gegner hatte ihm die letzte Kugel nicht nah genug und im falschen Winkel vorgelegt. Aber Giovanni war ein Kunstschütze mit allem, was rund war, und mit dem nötigen Effet konnte es trotzdem gelingen. Vor dem entscheidenden Stoß zum Spielgewinn äugte er noch einmal hoch zu Aigner, der die Lederspitze seines Queues mit der blauen Kreide bearbeitete und nicht damit aufhörte, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders war.
»Sag schon– bist du endlich vernünftig geworden? Was willst du machen?«
Sie waren allein im Gemeinschaftsraum in der Justizvollzugsanstalt Singen, zwei alteingesessene Knastbrüder mit einem Vorstrafenregister so lang wie die Beipackzettel auf ihren Blutdruckmedikamenten.
Aigner war das glatte Gegenteil von Giovanni, der sich mit der gesiebten Luft abgefunden und mit seiner Situation arrangiert hatte– aber er hatte auch keine anderen Optionen. Im gleichaltrigen Aigner, der eine Vollglatze hatte, die von hinten glänzte wie die Billardkugeln vor ihnen, brodelte noch immer das Magma aus Wut, Hass und Vergeltung, es war nie erkaltet oder abgestumpft wie bei den meisten anderen Langzeitinsassen. Und gestern hatte Aigner diesen Anruf bekommen, der ihn vollkommen fertiggemacht hatte. Giovanni wusste nicht, warum, Aigner wollte nicht darüber sprechen, aber er konnte das lodernde Feuer in dessen Augen erkennen. Giovanni war Aigners allgemeine Gemütslage bekannt, er hatte lange genug mit ihm eine Zelle geteilt, um zu wissen, in welcher Verfassung sein Gegenüber war. Aber jetzt, ein Jahr vor dessen Entlassung, wollte er hören, ob Aigner immer noch so schräg drauf war wie früher, als die Freiheit noch in weiter Ferne war, oder ob ihm die Haft das letzte bisschen Mark aus den Knochen gesaugt hatte wie allen anderen auch.
Aigners Augen, die normalerweise durch seine herunterhängenden Lider immer etwas schläfrig wirkten, blitzten, als er sich umsah, um sicherzugehen, dass niemand in der Nähe war, der sie hätte belauschen können. Giovanni hatte Aigners einzigen wunden Punkt getroffen, und der sah in diesem Moment keine Veranlassung, seinen Gefühlen nicht freien Lauf zu lassen, die er lange genug überspielt und unterdrückt hatte. Der gestrige Anruf hatte ihm noch den Rest gegeben und das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie waren in diesem Moment ganz unter sich, die anderen Gefängnisinsassen waren alle im Freien. Durch das offene Fenster, das zum Hof und auf das Ballspielfeld hinausging, ertönten lautes Gejohle und Pfiffe.
Aigner wandte sich Giovanni zu. »Ich will dir sagen, was ich vorhabe. Ich werde dieses beschissene eingebildete Schwein fertigmachen. Wenn ich hier rauskomme, ist der feine Herr geliefert. Ich werde ihn gründlich auseinandernehmen. Ihn und seine ganze Familie. Alles, was der falsche Hund sich aufgebaut hat, seinen Ruf und seine Reputation – alles werde ich vernichten, seine Frau, seinen Sohn– alles.«
Er sprach mit einer zunehmenden Leidenschaft und Intensität, die ihn am Ende fast nur noch spucken ließ, so redete er sich in Rage.
»Scheißegal, wohin er geht oder was er unternimmt– ich werde schon da sein. Wie der Hase und der Igel, nur nicht so lustig. Scheißegal, in welchem Rattenloch er sich versteckt– ich finde ihn. Ich bin sein Schatten, was er auch tut, er kann mich nicht abschütteln. Wenn er am Morgen die Augen aufmacht, stehe ich über ihm. Und wenn er einschläft, was ihm nur noch selten gelingen wird, erscheine ich in seinen Träumen. Du kannst mir glauben– es werden Alpträume sein. Er und seine ganze Familie– sie werden keine ruhige Sekunde mehr haben, bis alles weg ist. Geld, Ehrbarkeit, Sicherheit. Ich werde diese Familie zerstören, so, wie er mich zerstört hat. Ich werde diesem scheinheiligen Schwein für immer im Nacken sitzen. Bis zu dem Tag, an dem er sich endlich auf ein Brückengeländer oder das Dach eines Hochhauses stellt und springt. Nur um mich aus seinem Kopf zu kriegen. Das ist es, was ich vorhabe.«
Giovanni schniefte, dann senkte er seinen Blick, visierte die Spielkugel an und stieß zu. Die schwarze Acht wurde elegant eingelocht, und Giovanni sah Aigner triumphierend an, bevor er seinen Queue auf dem Billardtisch ablegte. »Hoffentlich hast du nicht vor, diesen Sermon unserer Anstaltspsychologin zu beichten. Ich glaube kaum, dass das die richtige Strategie wäre, um hier rauszukommen.«
»Für wie bescheuert hältst du mich?«
»Willst du das wirklich wissen?«
Statt einer Antwort warf Aigner Giovanni nur einen Blick zu, der ihn schaudern ließ. Giovanni schüttelte den Kopf und meinte: »Dann will ich es dir auch sagen: Ich bin froh, wenn sie dich rauslassen. Tick, tick, tick.« Er klopfte mit seinem linken Zeigefinger an seine Schläfe. »Ich kann es regelrecht hören. Du bist eine lebende Zeitbombe, Aigner. Und ich möchte weiß Gott nicht in der Nähe sein, wenn sie explodiert.«
Damit drehte er seinen Rollstuhl geschickt in einer einzigen flüssigen Bewegung herum und fuhr auf den Gang hinaus.
Aigner starrte auf die weiße Kugel auf dem grünen Filz, stellte sich breitbeinig hin und versenkte sie mit seinem Queue über zwei Banden, bevor er ihn auf den Tisch warf, die Augen schloss und lauschte.
Auch er konnte das Ticken in seinem Kopf hören. Laut und deutlich. Schon seit Langem. Aber seit gestern war es noch lauter geworden. Es würde so lange andauern, bis er getan hatte, was er tun musste.
Vielleicht konnte er dann endlich Frieden finden.
1
Er sah sich ein letztes Mal in seiner Einzelzelle um. Bett, Regal, Schrank, Tisch, Stuhl, Waschbecken,WC. Alles sauber, alles leer geräumt. Auch die Bilder, zehn an der Zahl, bei jedem Besuch seiner Nichte eines, die er an die Wand über seinem Bett gepinnt hatte, alles ungelenke, aber liebevolle Kinderzeichnungen, hatte er abgenommen und sauber zusammengerollt. Sie waren sein kostbarster Besitz, die einzigen Erinnerungen an jemanden, den er bedingungslos und aufrichtig geliebt hatte. Daran durfte er jetzt nicht denken, sonst würden ihn seine Gefühle wieder überwältigen, und das brach ihm das Herz. Dies war nicht der richtige Zeitpunkt, um in Melancholie und Trauer zu versinken. Dazu war später noch Gelegenheit genug.
Jetzt ging es darum, erhobenen Hauptes die Zelle für immer zu verlassen. Kein Fitzelchen würde er zurücklassen, das an ihn erinnerte, weil er in dieser Hinsicht abergläubisch war– für nichts in der Welt würde er diesen Raum noch einmal betreten wollen, lieber wäre er tot. Die acht Quadratmeter, die er weiß Gott unzählige Male mit seinen Schritten durchmessen hatte, wenn er wieder einmal nicht schlafen konnte, waren die letzten zwei Jahre sein Wohnklo gewesen, gewissermaßen sein Zuhause. Bei diesem Gedanken war ihm nicht nach einem Grinsen zumute, im Gegenteil, ein Schauder der Beklemmung kroch ihm den Rücken hoch. Er war jenseits der sechzig und hatte seine besten Jahre hinter sich, darüber machte er sich keinerlei Illusionen.
Aigner warf einen Blick durch das vergitterte Fenster hinaus auf den Innenhof der Justizvollzugsanstalt Singen, auf die liebevoll gepflegten Blumenbeete, den Fischteich und das Ballspielfeld. Es regnete in Strömen, doch Giovanni, der Rollstuhlfahrer, der wegen mehrfacher Sexualdelikte noch drei Jahre abzusitzen hatte – bei der Doppelbedeutung des Ausdrucks »absitzen« schlich sich doch ein bitteres Lächeln in Aigners Gesicht–, war trotzdem mit seinem Baseballkäppi als einzigem Schutz gegen den Regen unermüdlich wie jeden Tag, egal, ob es schneite, aus Eimern schüttete oder die Sonne vom Himmel brannte, damit beschäftigt, seinen Basketball in den Korb zu werfen. Giovanni war von der Hüfte abwärts gelähmt, eine Kugel aus dem Lauf seiner eigenen Beretta92, Kaliber 9x19mm, die ihm sein letztes Opfer im Handgemenge hatte entreißen und abfeuern können, hatte ihm das Rückenmark zerfetzt. Seitdem war er an den Rollstuhl gefesselt, aber für haftfähig erklärt worden. Trotz seines körperlichen Handicaps traf Giovanni fast immer in den Korb, und am Abend notierte er in einer penibel geführten Kladde, wie oft er in sechzig Minuten eingelocht hatte. Auch so konnte man die Zeit totschlagen.
Aigner hatte mit Giovanni über ein Jahr die Zelle geteilt, bevor ihm die Einzelzelle zugewiesen worden war. Man hatte sich viel zu erzählen in den langen, schlaflosen Nächten, es war wie eine Beichte ohne Absolution. Und davon hatte er im Lauf der Jahre einige angehört von Männern, mit denen er zusammengelegt worden war.
Er drehte sich vom Fenster weg. Nein, er würde diesen Ausblick ganz und gar nicht vermissen. Die Justizvollzugsanstalt Singen, ein gutes Dutzend Kilometer vom Bodensee entfernt im südwestlichen Zipfel von Baden-Württemberg gelegen, war ein Seniorengefängnis, eine altersgerechte Strafanstalt für Knackis über zweiundsechzig, rollstuhlgeeignet und mit relativ lockerem Vollzug. Die Zellen standen von sieben Uhr morgens bis zweiundzwanzig Uhr abends offen, es gab ein Fitnessstudio, Bastel-, Koch- und Gymnastikkurse, Billard, Tischtennis und eine gut bestückte Bibliothek. Das reinste Sanatorium, wenn man davon absah, dass man keinen Schlüssel für den Eingang besaß und nach keiner adretten Krankenschwester klingeln konnte, die einem nachts das flach gelegene Kopfkissen aufschüttelte.
Aigner hatte Glück gehabt, dass er für seine Reststrafe hierher nach Singen am Hohentwiel verlegt worden war. In der Pension Sing-Sing, wie die JVA im Knastjargon genannt wurde, waren das Totschlagen der Zeit und das Überleben – und nur darauf kam es an– wesentlich einfacher, es gab keine Nazigang, die einen terrorisierte, keine Russenmafia, die einen drangsalierte, und altersbedingt auch weniger Machos, die sich daran aufgeilten, andere zu tyrannisieren. Pension Sing-Sing war sozusagen das Altersheim unter den Haftanstalten. Es verging kaum ein Monat, in dem nicht der schwere schwarze Leichenwagen mit Milchglasfenstern, in dessen Heckscheibe gekreuzte Palmwedel eingeätzt waren, die doppelt gesicherten Eingangstore passierte und einer der »Mitinsassen«, wie das auf Vollzugsbeamtendeutsch lautete, seine letzte Fahrt antrat.
Das wenigstens blieb ihm erspart. Er würde hocherhobenen Hauptes und auf eigenen Füßen mit seinem Karton und seinem Koffer die ersten Schritte in die endgültige Freiheit machen. Stückchenweise hatte er das schon im Rahmen des offenen Vollzugs ausprobiert, aber von nun an würde er nicht mehr zurückkehren müssen. Der eine von zwei Menschen, an denen ihm etwas lag, seine Nichte Emma, würde auf ihn warten und ihn mit dem Auto abholen. Das hatte sie ihm hoch und heilig bei einem ihrer seltenen Besuche versprochen. Er atmete tief ein und wieder aus. Nur für diesen Augenblick hatte er durchgehalten.
Sein gepackter Koffer stand unter dem Waschbecken, das liebevoll mit Geschenkpapier eingewickelte Päckchen mit der roten Schleife lag auf der sorgfältig geglätteten und gefalteten Zudecke seiner Schlafpritsche, damit er es nicht vergessen konnte, und sein einziger persönlicher Besitz von Wert, eine faustgroße Buddhastatue aus Bronze, wartete mit einem feinen Lächeln und auf Hochglanz poliert auf dem Tischchen beim Fenster. Er entdeckte einen winzigen Fleck auf ihr und hauchte darauf, bevor er ihn mit seinem Taschentuch wegputzte und sie ebenso wie das Päckchen in den Karton steckte, in dem er seine restlichen Siebensachen, die nicht mehr in den Koffer passten, untergebracht hatte.
Jetzt war es so weit, er hörte schon die sich nähernden Schritte des Vollzugsbeamten auf dem Gang, der ihn nach draußen begleiten würde. Er klemmte sich den Karton unter den Arm und packte mit der freien Hand den Griff seines Koffers. Er war bereit für die Freiheit, so bereit, wie man nur sein konnte.
Dies war die eine Seite der Medaille, die für die Direktorin der JVA, die Anstaltspsychologin und das Wachpersonal. Und für seine Nichte, bei der er vorläufig unterkommen sollte. Aber jede Medaille hatte zwei Seiten. Von der Kehrseite wusste niemand. Nur er selbst. Und sein langjähriger Knastbruder Giovanni. Jahrelang hatte er daran gearbeitet, was er nach seiner Entlassung machen würde. In seinem Kopf. Sein Plan war einfach und klar: Rache und Genugtuung um jeden Preis. Selbst um den seines Lebens. Das war es ihm wert.
Der übergewichtige Vollzugsbeamte Schneider klopfte pro forma an den Türrahmen und fragte: »Sind Sie so weit, Herr Aigner?«
»Bereit, wenn Sie es sind, Herr Schneider«, antwortete Aigner und versuchte so zu lächeln, dass es möglichst echt aussah.
Als die schwere Seitentür ins Schloss gefallen war und Aigner endlich außerhalb der Gefängnismauern stand, schloss er erst einmal die Augen und sog die Luft tief ein. Aber irgendwie roch sie nicht nach Freiheit, sondern nach Diesel. Er öffnete die Augen wieder und sah, dass ein schwarzer 5er BMW mit laufendem Motor rechts neben ihm am Bürgersteig die Abgase produzierte, die ihm in die Nase gestiegen waren. Das konnte nicht seine Nichte sein, sie fuhr einen roten VWPolo, der mindestens zehn Jahre alt war. Aigner beschloss, zum Vordereingang zu gehen, wahrscheinlich wartete Emma dort auf ihn.
Er marschierte zielstrebig los und beschleunigte seine Schritte, weil es immer noch regnete und er nicht wollte, dass die Sachen in seinem Karton nass wurden. Er hörte, dass der BMW mit quietschenden Reifen Gas gab und nun, als er auf seiner Höhe war, verlangsamte, neben ihm herschlich und der Fahrer das Seitenfenster herunterfahren ließ. Aber Aigner blickte stur geradeaus.
»He, Aigner!«, sprach ihn der Fahrer an, ein kräftiger Mann mit schwarzen gegelten Haaren, dunklen Augenbrauen und einem hellgrauen Anzug mit schwarzer Krawatte. Er beugte sich zu Aigner herüber, sodass ihn dieser erkennen musste. »Komm schon, steig ein. Wir müssen reden.«
Aigner blieb abrupt stehen. In der Ferne, am videoüberwachten Haupteingang, wartete der rote Polo. Der BMW hatte ebenfalls abgebremst, der Fahrer spekulierte wohl darauf, dass Aigner bei ihm einsteigen würde, denn der Regen wurde stärker, aus dem Tröpfeln war ein veritabler Landregen geworden.
Aigner sagte noch immer kein Wort. Er stellte seinen Koffer ab, daneben seinen Karton, nahm den massiven Buddha heraus und wuchtete ihn mit voller Kraft gegen die Windschutzscheibe. Einmal, zweimal, dreimal. Das Sicherheitsglas zersplitterte in abertausend Facetten, zerbrach aber nicht. Aigner packte seinen Buddha in aller Seelenruhe wieder weg, nahm Koffer und Karton auf und eilte nun, so schnell es ihm seine körperliche Konstitution erlaubte, durch den prasselnden Regen zum Polo, wo ihm seine Nichte schon die Heckklappe für sein Gepäck aufgemacht hatte. Er warf Koffer und Karton hinein, schmiss die Klappe zu, ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und fuhr mit ihr davon, während der BMW-Fahrer nach dem ersten Schreck endlich reagiert hatte, ausgestiegen war und fassungslos den Totalschaden ansah, den Aigner auf der Windschutzscheibe seines Autos hinterlassen hatte.
2
»Wie hast du das angestellt?«, fragte Hauptkommissar Max Madlener kopfschüttelnd seine Assistentin Harriet, die ihm am Doppelschreibtisch gegenübersaß und die Unschuld in Person verkörperte, obwohl sie wie immer wie ein Kobold aussah, egal, wie ihre gewagten Frisuren gerade, je nach Lust und Laune, gestylt waren– diesmal hatte sie pinkfarbene Strähnen mit grünen Enden in ihren schulterlangen, glatten schwarzen Haaren. Seit Neuestem war ihr Nasenpiercing verschwunden, dafür aber durch eines an der rechten Augenbraue ersetzt worden.
Es war Sommer, die halbe Polizeidirektion Friedrichshafen war im Urlaub, und anscheinend hatten die Straftäter im gesamten Bodenseeraum ebenfalls eine Verschnaufpause eingelegt, jedenfalls war momentan außer dreier Bagatellvorfälle nichts auf der Agenda der Kripo, was nachhaltige Ermittlungsarbeit dringend erforderlich gemacht hätte. Dabei handelte es sich um einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Überlingen, bei dem die schusselige Diebin zweiunddreißig Tuben mit Gebisshaftcreme für ihre Oma zum Geburtstag hatte mitgehen lassen und dabei prompt erwischt worden war, einen erfolglosen Einbruchsversuch mit geringem Sachschaden in ein mickriges Segelboot namens »Big Spender« im Immenstaader Hafen und einen Unfall mit Anfangsverdacht auf Fremdeinwirkung auf dem Friedrichshafener Hauptfriedhof, bei dem ein Grabstein umgekippt und auf die grabpflegende Witwe gefallen war, die sich dabei den Fuß eingeklemmt hatte und aus Angst davor, dass ihr verblichener Gatte ihr noch aus dem Sarg heraus ans Leder wollte, um Hilfe schrie, weshalb die Polizei gerufen worden war.
Harriet, die wusste, dass sie sich bei ihrem Chef Madlener mehr Freiheiten herausnehmen konnte, als es bei Kriminaldirektor Thielen auch nur ansatzweise statthaft gewesen wäre, und dies auch weidlich ausnutzte, war gerade dabei, sich ihre Fingernägel abwechselnd schwarz und pink zu lackieren, passend zu ihren Haarsträhnen und den dicken Kajalstrichen, die ihre Augen und die langen Wimpern betonten.
In Ermangelung aktueller Fälle hatten sie sich wieder einmal die Altakten aus dem Archiv vorgenommen. Die Leitzordner stapelten sich auf dem Boden ihres Büros, das ehemals eine Abstellkammer im Gebäude der Verkehrspolizei gewesen war. Nachdem sie beide unter Einsatz ihres Lebens vor einem Jahr mit der Aufklärung mehrerer Morde die Büchse der Pandora geöffnet und die schrecklichen Missbrauchsfälle im Jan-Hus-Internat ans Licht des Tages gebracht und damit eine Lawine ausgelöst hatten, die das Internat hinwegfegte, waren sie noch lange mit der Aufarbeitung und dem sich bis in die Gegenwart hinziehenden Rattenschwanz aus Zeugenaussagen, Vernehmungen, Protokollen und Gerichtsverfahren beschäftigt gewesen. Kriminaldirektor Thielen, der unverfroren die Lorbeeren eingeheimst hatte, was Madlener und Harriet gar nicht so unrecht war, weil ihr Chef deshalb im Fokus der Öffentlichkeit stand, was er offensichtlich genoss, und sie so unfreiwillig aus der Schusslinie genommen hatte, war nicht umhingekommen, seinem erfolgreichen Ermittlerduo ein adäquates Büro im Präsidium anzubieten. Das hatte Madlener aber nachdrücklich abgelehnt. Er fühlte sich im alten Gebäude der Verkehrspolizei, einen Steinwurf vom Präsidium entfernt, gut genug aufgehoben.
Ihm und Harriet war es bedeutend lieber, im Abseits ihrer Arbeit nachgehen zu können und nicht ständig in Thielens Radarbereich zu sein. Es reichte schon, dass er sie und die anderen Kollegen regelmäßig zu sich in den Besprechungsraum zu einem »Update« beorderte, wie der tägliche Jour fixe neuerdings von ihm genannt wurde– »Schtatus-Meeting«, schwäbisch intoniert, war anscheinend out. Auch wenn es dann nichts Wichtigeres zu besprechen gab als die ständige Ebbe in der Kaffeekasse, die inflationäre Benutzung des Kopiergerätes oder die Neuvergabe der nicht ausreichend vorhandenen Dienstparkplätze.
Noch einen Tag vor seinem Jahresurlaub, den alle herbeigesehnt hatten, um ihren anstrengenden Chef einmal vier Wochen lang nicht sehen zu müssen, hatte Thielen eine vierzigminütige Motivationsrede hingelegt, die er wohl im Gedenken an Jürgen Klinsmann abhielt, der vor dem WM-Spiel gegen Polen anno 2006 derart in die Impulskiste gegriffen hatte, dass die Spieler nach neunzig Minuten noch so von sich berauscht waren, dass sie gleich fünf Ehrenrunden zusätzlich liefen und anschließend von Muskelkrämpfen geplagt umfielen. Im Gegensatz dazu waren die Auswirkungen des brennenden Appells von Thielen aber doch eher kontraproduktiv. Madlener schaltete, sobald der Kriminaldirektor sich in seinen Redeschwall hineinsteigerte, sowieso grundsätzlich ab, obwohl er sich den gegenteiligen Anschein gab– den Gesichtsausdruck interessierter und zustimmender Dreiviertelbegeisterung mit gleichzeitig konzentriertem Stirnrunzeln hatte er seit seinem Dienstantritt im letzten Jahr bis zur Perfektion entwickelt. Harriet bewunderte ihn dafür, sie musste bei diesen Sitzungen immer dagegen ankämpfen, dass sie unweigerlich mühsam beherrschbare Gähnanfälle bekam und das Gefühl hatte, ihre Augenlider wären plötzlich tonnenschwer.
Die Ansprache Thielens war gespickt mit unzähligen Anglizismen und wurde mit dem üblichen schlechten Altherrenwitz beendet, bei dem seine tüchtige Sekretärin Frau Gallmann als Einzige immer rot anlief, obwohl sie ihn auch schon oft genug gehört hatte, während der männliche Teil der Belegschaft pflichtgemäß auflachte. Nur Madlener und Harriet lachten nicht– Madlener, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders war, und Harriet, weil sie mit offenen Augen geschlafen hatte, ein Kunststück, das ihr nur bei einer Thielen-Ansprache gelang, obwohl sie es in ihrem Yogakurs zigmal vergeblich versucht hatte. Die Übung hieß dort »Dem Drachen in die Augen sehen«.
Thielen zahlte den obligatorischen Obolus in die Chauvi-Kasse, die ihm Frau Gallmann kommentarlos hinhielt– sie war ein besonders hässlicher moosgrüner Sparelefant aus den Beständen der untergegangenen Dresdner Bank, der aus unerklärlichen Gründen alle Wegwerfaktionen von überflüssiger Nippesdeko aus mehreren Kripogenerationen überlebt hatte. Während Frau Gallmann umgehend den Sparelefanten schlachtete, zog sich ihr Chef, begeistert von seiner rhetorischen Glanzleistung und der dadurch hervorgerufenen immensen Stärkung des Teamgeists, erschöpft, aber gleichzeitig beseelt in sein Büro zurück. Seine, was die Chauvi-Kasse anging, strenge, ansonsten absolut loyale Sekretärin sammelte noch rasch die herumliegenden Schmierzettel ein, auf denen sich alle eifrig Notizen gemacht zu haben schienen, und entsorgte sie im Schredder. Sie vermied es tunlichst, dass Thielen sie zu Gesicht bekam, denn es waren nur Strichmännchen, unleserliches Gekritzel und geometrische Figuren in allerlei Variationen darauf.
Madlener stand auf und wollte das widerspenstige Fenster öffnen, das immer klemmte und nur mit roher Gewalt aufzubekommen war. Es stank penetrant nach dem Nagellackentferner, den Harriet vorhin benutzt hatte, weil die erste Grundierung ihrer Fingernägel nicht zu ihrer vollen Zufriedenheit ausgefallen war. Sie beobachtete Madlener interessiert bei seinem Kampf mit dem Fensterflügel und wedelte dabei sanft mit ihren Händen hin und her, um den Lack zu trocknen.
»Also, nun sag schon«, forderte Madlener sie auf, während er ruckartig am Kipphebel zerrte und rüttelte. Mist, Mist, Doppelmist. »Wie hast du das angestellt?«
»Willst du das wirklich wissen?«, lautete ihre rein rhetorisch gemeinte Gegenfrage, bevor sie sich wieder ganz auf ihre Maniküre zu konzentrieren schien, obwohl Madlener genau wusste, dass Harriet geradezu ein Paradebeispiel für Multitasking war.
Endlich gab das widerspenstige Fenster nach, Madlener atmete auf und die frische Luft ein, kehrte an seinen Platz hinter dem Schreibtisch zurück und nahm wieder die zwei Kopien in die Hand, die Harriet ihm bei Dienstbeginn kommentarlos hingelegt hatte. Es waren Auszüge aus seiner Personalakte, die ausschließlich Kriminaldirektor Thielen einsehen durfte. »Du weißt, wenn dich jemand dabei erwischt hätte, wäre ein ziemlich unangenehmes Disziplinarverfahren das wenigste gewesen.«
»Hätte, hätte, Fahrradkette…«, entgegnete Harriet schnippisch und blies auf ihre Nägel. »Wollen Sie mich jetzt auffliegen lassen dafür, dass ich Ihnen einen Gefallen getan habe, Herr Hauptkommissar?«
Wenn sie unter sich waren, duzten sie sich normalerweise. Madlener hatte es nur für recht und billig gehalten, seiner Assistentin, die gut ein Vierteljahrhundert jünger war als er mit seinen fünfzig, das Du anzubieten, nachdem sie ihm im Internatsfall buchstäblich in letzter Sekunde das Leben gerettet hatte. Aber im Beisein von anderen und bei offiziellen Anlässen verfielen sie automatisch in den Sie-Status, den Harriet bisweilen auch anwendete, um ihren Partner auf den Arm zu nehmen. Sie kannte seine Schwachstellen, und manchmal konnte sie nicht anders, als ein wenig zu sticheln, weil es ihr einfach Spaß machte. Dabei überschritt sie nie gewisse Grenzen, nur zu gut kannte sie seine Eigenschaft, aus heiterem Himmel wie ein Vulkan zu explodieren, was ihm den vielsagenden Spitznamen »Mad Max« eingebrockt hatte.
»Wenn der Gefallen illegal war und gegen die Dienstvorschriften verstößt, dann sollte ich dich tatsächlich auffliegen lassen.«
»Dazu hätte es aber schon früher zahlreiche Gelegenheiten gegeben«, erinnerte sie ihn gemeinerweise.
»Harriet, das hätte dich Kopf und Kragen kosten können, das war es einfach nicht wert.«
»Ach was«, entgegnete sie, »es war weder riskant noch weiter schwer. Reiner Zufall. Der Chef ist seit gestern auf einer Tagung vom LKA. Ein hohes Tier von Scotland Yard hat da einen Vortrag gehalten, dreimal darfst du raten, was das Thema war…«
Sie sah ihn mit einem bühnenreifen Unschuldsblick an, der ihn an ein Reh erinnerte, das nachts plötzlich auf der Straße im Scheinwerferlicht stand. Er spielte mit, zuckte mit den Schultern, und Harriet sprach die nackte Wahrheit schonungslos aus: »Thema war ›Leadership, staff motivation and competence development‹.«
»Nein!«, sagte Madlener.
»Doch.« Ungerührt fuhr Harriet fort: »Und Frau Gallmann hat sich gestern ebenfalls einen Tag freigenommen. Sie hatte mich gebeten, die Blumen in ihrem Vorzimmer und dem Büro des Chefs zu gießen.«
»Und ich dachte immer, sie übernachtet im Präsidium.«
»Anscheinend hat sie doch ein geheimes Privatleben. Also bitte: Wer hätte mich dabei erwischen sollen, wenn ich einen kurzen Blick in deine Personalakte werfe – die übrigens einfach so auf dem Tisch lag– und zwei Seiten für dich kopiere, die du schon immer mal einsehen wolltest?«
»Hast du das auch gelesen?«, fragte er.
»Na klar. Man will doch wissen, wem man im Büro gegenübersitzt.« Sie grinste unverhohlen.
Madlener stieß einen tiefen und resignativen Seufzer aus und überflog die Kopien.
HAUPTKOMMISSAR MAX MADLENER
(vertraulich, nur für Herrn Kriminaldirektor Thielen, Kripo Friedrichshafen)
Beurteilung Vorgesetzter:
18Jahre Kripo Stuttgart, Abtlg. Gewaltverbrechen. Höchste Aufklärungsquote. Zwei Abmahnungen wegen eigenmächtigen und gesetzwidrigen Vorgehens.
Wg. Schusswaffengebrauchs mit Todesfolge Suspendierung vom Dienst. Interne Untersuchung ergab abschließend Notwehrsituation, hat danach selbst um Beurlaubung und anschließende Versetzung zur Kripo Friedrichshafen aus familiären Gründen gebeten.
Beurteilung Psychologischer Dienst:
Stärken: hervorragender Verhörpsychologe und Profiler, kann sich außerordentlich in die Psyche eines Täters hineinversetzen.
Schwächen: leidet selbst unter psych. Defiziten– ignoriert bzw. konterkariert Vorgaben von Vorgesetzten, Autoritätsproblem, kann sich nicht unterordnen. Bisweilen stur, sarkastisch, neigt zu Wutausbrüchen, Einzelgänger, schwer teamfähig. (Streng vertraulich: Unter Kollegen wirdHK Madlener wegen seiner zuweilen aufbrausenden Art »Mad Max« genannt.)
Anordnung: HK Madlener hat sich bei erneutem Dienstantritt einer Therapie zu unterziehen!
Handschriftliche Anmerkung Dr.Auerbach, behandelnder Psychiater/Friedrichshafen:
PatientM.M.ist notorisch unpünktlich, ein pathologischer Lügner, gesteuert von seinen verdrängten sexuellen Obsessionen. Leicht reiz- und erregbar in Stresssituationen, erhöhte Vigilanz, Restless-Legs-Syndrom. Schwere Neurose, Hauptmerkmal: Patient stellt zwanghaft ständig neue Ranglisten auf, z.B.die von ihm selbst so genannte (S)hit-Liste für Dinge, die die Welt nicht braucht (nach Aussage des Probanden):
Rang 1: Duravit-Fernbedienung für Klospülungen
Rang 2: sämtliche Musikstücke von André Rieu (?)
Rang 3: Birkenstock-Sandalen
Diagnose nach drei Therapiesitzungen: manische Depression, endogene Psychose, dissoziative Dysthymie und bipolare Störung infolge posttraumatischer Belastungsstörung. Dienstuntauglich.
Empfehle Suspendierung und Versetzung in den Vorruhestand.
Gez. Dr.Dr.h.c. Auerbach
»Ich hab die Fremdwörter gegoogelt«, sagte Harriet grinsend, als Madlener die Kopien wieder weglegte. »Cool, was Sie alles haben, Herr Hauptkommissar.« Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu grinsen. »Fehlt eigentlich nur noch das Tourettesyndrom.«
Madlener zog wortlos seine unterste Schreibtischschublade auf, die nur allerlei Krimskrams enthielt, und entnahm ihr einen schweren, altmodischen Wirtshausaschenbecher aus Kristallglas, den er aus unerfindlichen Gründen dort deponiert hatte. Er knallte ihn vor sich auf den Schreibtisch, sodass Harriet zusammenzuckte, stand auf und zündete die Kopien mit einem Feuerzeug an, das er aus seiner Hosentasche herausfischte. Geschickt drehte er die brennenden Seiten über dem Aschenbecher, bis sie komplett verkohlt waren.
»Jetzt habe ich gar nichts mehr«, sagte er dazu. »Wie allen hier im Hause hinlänglich bekannt sein dürfte, bin ich von der Koryphäe Dr.Dr.h.c. Auerbach vollständig rehabilitiert und wieder dienstfähig geschrieben worden. Und jetzt zu Ihnen, Frau Kommissaranwärterin.«
Madlener stützte seine Hände auf den Schreibtisch und beugte sich zu Harriet vor, die seinem Gesicht ansah, dass es ernst wurde. Er veränderte seine Lautstärke kaum, aber Harriet wusste, dass es fast noch schlimmer war, wenn er gefährlich leise wurde wie jetzt.
»Ich schätze zwar Ihren Hang zur Eigeninitiative, Ihren Sinn für unorthodoxes Vorgehen und Ihre Intuition und Sponaneität außerordentlich, schließlich habe ich diesen Eigenschaften mein Leben zu verdanken. Aber ich schätze es nicht, wenn man in meiner Personalakte herumschnüffelt. Zumal wenn man sie auch noch aus dem Büro des Kriminaldirektors klaut!«
»Kopiert«, warf Harriet kleinlaut ein. Es klang fast wie »kapiert«.
Aber Madlener war noch nicht fertig und wechselte urplötzlich von piano auf fortissimo.
»Das war eine bodenlose Dummheit, Harriet Holtby! Und zu Ihrem eigenen Besten werden Sie das nicht noch einmal tun. Dies ist ein dienstlicher Befehl! Haben wir uns verstanden?«
Harriet zögerte, dann schniefte sie vernehmlich, stand auf und packte die Leitzordner mit einem gewaltigen Schwung, den man ihrer zierlichen Figur nicht zugetraut hätte, mitten auf die zwei zusammengestellten Schreibtische.
»Die ungelösten Altfälle. Mit welchem fangen wir an?«
Madlener hatte sich noch nicht beruhigt. »Ist das ein Ja?«, fragte er. »Ich möchte es gern hören.«
Harriet fing seinen Blick ein und nickte kaum merklich.
Madlener akzeptierte mit der gleichen Kopfbewegung und schüttete die verkohlten Kopienreste in den Papierkorb, verstaute den monströsen Aschenbecher wieder in der untersten Schublade und fing an, die Daten auf den Aktenrücken akribisch zu studieren.
Schließlich zog er einen Ordner aus dem Stapel heraus und blätterte oberflächlich darin herum. Dann seufzte er demonstrativ und sagte in versöhnlichem Ton: »Haben wir wenigstens irgendwas nach 2000? Wie in Gottes Namen sollen wir einen Vermisstenfall aus dem Jahr 1963 jetzt noch aufklären?«
»Indem wir uns so richtig reinhängen«, erwiderte Harriet mit Nachdruck.
3
»Danke fürs Abholen«, sagte Aigner erst nach einer langen Pause zu der alt gewordenen Frau am Steuer des VWPolo, die seine einzige Angehörige war, die Tochter seiner vor langer Zeit verstorbenen Schwester.
Emma entgegnete nichts und nickte nur. Sie war sechsundvierzig Jahre alt und sah nach gut zehn Jahren mehr aus, was kein Wunder war, wenn er daran dachte, was sie alles durchgemacht hatte. Ihre Haare, die sie lang trug und nicht färbte, waren mit weißen Strähnen durchzogen und die Falten um ihre Augen seit ihrem letzten Besuch noch tiefer und verästelter geworden. Seit einiger Zeit legte sie auch keinen Wert mehr darauf, sich zu schminken, und ihre Haut war vom vielen Rauchen grau und ledrig. Auch jetzt, im Auto, rauchte sie eine Zigarette nach der anderen. Aigner war Nichtraucher, aber er ertrug den Qualm kommentarlos, weil er froh war, überhaupt abgeholt worden zu sein.
Sie fuhren in Richtung Konstanz, wo Emma lebte, und schwiegen. Es hatte aufgehört zu regnen, und tief hängende graue Wolken zogen am Himmel dahin. Obwohl es erst Mitte August war, beschlich Aigner das unangenehme Gefühl, dass der Herbst schon angebrochen war. Verstohlen blickte er zu seiner Nichte, die sich auf den Verkehr konzentrierte.
Emma hatte immer für zwei große Leidenschaften gelebt. An zweiter Stelle kamen ihre Pflanzen. Sie führte den kleinen Blumenladen in Konstanz weiter, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte und mit dem sie recht und schlecht über die Runden kam.
Und an erster Stelle war ihre Tochter gekommen, Sophie. Emma war die meiste Zeit alleinerziehend gewesen. Sophie hatte ihren Adoptivvater nie richtig kennengelernt, er war, kurz nachdem sie von Emma und ihrem Mann adoptiert worden war, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Bei Sophie war im Alter von zwölf Jahren das Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden, eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems. Sie war vor gut einem Jahr an einer Lungenentzündung gestorben. Von ihr stammten die Kinderzeichnungen, die Aigner hütete wie einen Augapfel, denn jedes Mal, wenn Emma ihn im Knast besucht hatte, was zwei- oder dreimal im Jahr der Fall war, hatte Sophie ihrer Mutter ein selbst gemaltes Bild mitgegeben.
Sophie war der eine Grund, warum er durchgehalten hatte. Der andere war sein unstillbares Verlangen nach Rache. Jetzt war nur noch der Gedanke an Vergeltung übrig geblieben. Seit Sophies Tod war daraus ein bösartig wuchernder Tumor geworden, der mehr und mehr die Oberhand gewonnen hatte und Aigner die nötige Antriebskraft und Energie lieferte, um so lange weiterzuleben, bis seine Mission erfüllt war.
Seine Nichte Emma hatte ihm angeboten, fürs Erste in Sophies ehemaligem Zimmer zu wohnen, bis er eine endgültige Bleibe gefunden hatte. Sie hatte eine kleine Wohnung über ihrem Blumenladen, und Aigner hatte dankbar angenommen. Seine Pläne waren ganz andere, aber für seine fristgerechte Entlassung aus der Obhut des Staates war das Angebot seiner Nichte Gold wert gewesen und überaus hilfreich. Es zog eine günstige Sozialprognose nach sich, die zuständigen Entscheidungsträger, die über ihn Gutachten erstellten, sahen darin den ersten Schritt zu einer vielversprechenden Wiedereingliederung in die Gesellschaft, und so ging alles seinen geordneten bürokratischen Gang. Mehr wollte Aigner nicht. Dass er, sobald er den Fuß über die Schwelle der JVA Singen gesetzt hatte, ganz andere Pläne verfolgte, wusste weder seine Nichte noch sonst irgendjemand.
Nur bei seinem Knastkollegen Giovanni hatte er einmal die Kontrolle verloren und sein Innerstes nach außen gestülpt. Aber das war einen Tag, nachdem er vom Tod seiner Großnichte erfahren hatte. Diese Nachricht hatte ihn kurzfristig die Fassung verlieren lassen.
Doch das würde nie wieder vorkommen.
»Willst du wirklich als Erstes nach Wollmatingen?«, fragte Emma, als sie Allensbach durchquert hatten und am Gnadensee entlangfuhren. Es war nicht mehr weit nach Konstanz.
»Es ist mir wichtig«, erwiderte er. »Macht es dir was aus?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Inzwischen nicht mehr. Ich besuche sie jede Woche und bringe frische Blumen für ihr Grab mit. Anfangs war das noch sehr schwer für mich. Aber jetzt nutze ich die Gelegenheit, bei meiner Tochter zu sein und mit ihr zu reden. Für mich ist sie an einem besseren Ort, wo sie keine Schmerzen mehr hat oder ständig Angst davor, keine Luft zu bekommen. Daran glaube ich. Und wenn ich vor ihrem Grab stehe, habe ich das Gefühl, dass sie mich hört und mich versteht.«
Er merkte, dass sie ihn kurz unsicher von der Seite ansah. »Findest du, dass ich nicht mehr ganz bei Trost bin?«
Er zuckte mit den Schultern. »Dann bin ich’s auch nicht. Genau aus den gleichen Gründen will ich an ihr Grab.«
Zum ersten Mal stahl sich so etwas wie ein Lächeln auf Emmas Gesicht.
Sie hielten auf dem Parkplatz vor dem Friedhof von Wollmatingen. Das Wetter hatte sich verschlechtert, der Wind hatte noch aufgefrischt und war so kühl geworden, dass Aigner das Gefühl hatte, plötzlich im Oktober gelandet zu sein, als er aus dem Auto ausstieg und einen Blick auf den Friedhof warf. Es war ein dörflich wirkender Gottesacker mit einem schlichten haushohen Betonkreuz, wenigen Bäumen und penibel gestutzten Hecken die Grabreihen entlang, bekiesten Gehwegen und einer kleinen Kapelle auf einer Anhöhe mitten in der weiträumigen Hügellandschaft des Bodanrück. Durch die tief hängenden dunklen Wolken, die vom heftigen Wind getrieben dahinjagten, dem Himmel nah, wie Aigner fand.
Er ging zur Heckklappe, öffnete sie und nahm das kleine, liebevoll mit Geschenkpapier eingewickelte Päckchen mit der roten Schleife heraus, dann hakte er sich bei seiner Nichte ein, die ihn über die Kieswege zum Grab von Sophie führte. Es war ein kleines Kindergrab mit einem weißen Holzkreuz, auf dem ihr Name und Geburts- und Todesdatum standen. Ein Foto von ihr, gegen die Unbilden des Wetters mit einer Plastikfolie geschützt, war mit Heftzwecken daran befestigt. Auf dem Grabhügel war eine Auswahl ihrer Spielsachen drapiert: mehrere Plastikpferdchen, ein billiger Armreif, ein Püppchen. Daneben, hübsch in einer Vase angeordnet, ein buntes Blumensträußchen, das noch sehr frisch aussah.
Sie blieben eine Weile stumm und eingehakt davor stehen, bis Aigner sich löste und einen Schritt näher trat, um das Foto zu betrachten, auf dem ihn ein fröhliches Mädchen anlachte. Er strich mit dem Daumen darüber und musste sich zusammennehmen, vor Emma wollte er nicht zeigen, wie ihn das Arrangement berührte und ihm schier das Herz zu zerreißen drohte. Er war ein erwachsener Mann, der sich in seiner Kindheit das Weinen abgewöhnt hatte, er hatte schmerzhaft gelernt, alles in sich hineinzufressen, und war darüber hart zu sich selbst geworden.
Langsam ging er in die Hocke und legte das Päckchen sanft am Fuß des weißen Holzkreuzes nieder, verharrte so eine ganze Weile mit gesenktem Kopf, bis er wieder aufstand, noch einmal wie zum Gruß nickte und sich umdrehte, Emma am Arm nahm und mit ihr zum Auto zurückging.
»Verrätst du mir, was in dem Päckchen ist?«, fragte Emma, während ihre Schritte im Kies knirschten und ihnen der kalte Wind um die Ohren pfiff.
»Entschuldige, aber das geht nur mich und Sophie etwas an«, erwiderte er und lächelte seine Nichte traurig an. Sie drückte seinen Arm an sich und lächelte ebenso traurig zurück.
Als sie im Wagen saßen, der Motor lief und sie sich erst einmal aufwärmten, fragte Emma, die sich eine Zigarette angezündet hatte und tief inhalierte: »Kommst du jetzt mit mir nach Hause? Du kannst in Sophies Zimmer wohnen, wie ich es dir versprochen habe.«
»Danke für das gut gemeinte Angebot. Aber ich habe schon eine andere Unterkunft. Wenn du mich jetzt noch nach Friedrichshafen fährst, dann bist du mich wieder los.«
»Dein Ernst?«
»Ja. Mach dir keine Sorgen. Ich lasse von mir hören.«
4
Es hatte aufgehört zu regnen, und die tief stehende Sonne stach so scharf und gleißend durch die sich öffnende Wolkendecke, dass die Insassen des roten Polo die Augen zusammenkneifen und blinzeln mussten, so sehr blendete sie.
Aigner dirigierte Emma am Stadtrand von Friedrichshafen durch ein weitläufiges Industriegebiet, bis die Gebäude und Lagerhallen nach und nach immer baufälliger wurden und sie schließlich zu einer breiten Toreinfahrt mit der Aufschrift »Autoersatzteile& Buntmetalle Gebr. Schwarz« in einer doppelt mannshohen Mauer kamen. Sie fuhren schier endlos an demolierten Autos entlang, die links und rechts in drei Schichten übereinandergestapelt waren. Die Straßenschlucht aus Autowracks mündete in einen großen Platz mit einem Baucontainer in der Mitte, der mit einem Schild als Büro gekennzeichnet war. Davor war in einem riesigen Rund Metallschrott bergeweise aufgetürmt, und ein betagter Bagger mit einer Greifklaue lud unter höllischem Krach alte gerippte Heizkörper von der Ladefläche eines Lastwagens.
Sie hielten vor dem Container, und Aigner stieg aus, Emma blieb hinter dem Steuer sitzen. Er holte seinen Koffer und den Karton aus dem Kofferraum und beugte sich noch einmal durch das heruntergekurbelte Seitenfenster in den Polo.
»Ich melde mich«, sagte er.
Emma machte ein argwöhnisches Gesicht und schrie gegen den Lärm an. »Bist du sicher, dass du hier unterkommst?«
»Hab ich alles schon abgecheckt, mach dir keine Sorgen«, erwiderte er, klopfte zum Abschied auf das Autodach und sah zu, wie der rote Polo zwischen den Reihen der gestapelten Schrottkisten wieder davonfuhr. Als nur noch die Staubfahne übrig geblieben war, packte er Koffer und Karton und marschierte auf den Bürocontainer zu, dessen Tür auch schon von einem drahtigen Mann geöffnet wurde. Er war in Aigners Alter, hatte raspelkurz geschnittene Haare und einen Fünftagebart und trug eine schmutzige Latzhose und einen dazu passenden Kittel, deren ursprüngliche Farbe als Dunkelgrün zu deuten war.
»Immer herein in die gute Stube!« Er winkte und wartete, bis sich Aigner an ihm vorbeigezwängt hatte, bevor er die Tür wieder schloss. »Setz dich, setz dich«, fuhr er fort und machte den einzigen Besucherstuhl frei, der zwischen Gerümpel, Kartons, Metallschränken und -regalen stand, indem er die darauf liegenden Ordner auf einen Stapel mit Kartons packte. Er selbst nahm hinter seinem Metallschreibtisch Platz.
Das Telefon fing an zu klingeln, aber Schwarz ignorierte es einfach. Er wirkte wie ein Mann, der durch nichts und niemanden aus der Ruhe zu bringen war.
»Bierchen?«, fragte er.
»Warum nicht?«, antwortete Aigner.
Schwarz griff in einen Bierkasten, den er im Fußraum deponiert hatte, holte zwei Flaschen heraus, entfernte die Kronkorken geschickt mit einem Schlag an der Kante seines Schreibtischs und stieß mit Aigner an. »Auf die Freiheit!«, sagte er dazu, bevor er die Flasche ansetzte und sie mit hüpfendem Adamsapfel in einem Zug halb leer trank.
»Auf die Freiheit!«, erwiderte Aigner und trank aus Solidarität mit, er mochte eigentlich kein Bier.
Schwarz setzte seine Flasche ab und zog eine Schublade auf, aus der er nacheinander Schlüssel und Papiere hervorkramte und auf den Tisch knallte. »Mein Bruder ist geschäftlich unterwegs, aber er hat mich genau instruiert.«
»Woher wussten Sie, wer ich bin?«, fragte Aigner.
»Ich würde vorschlagen, wir bleiben beim Du«, knurrte Schwarz, und Aigner hob in einer zustimmenden Geste die Hände.
Schwarz grinste und bleckte Zähne, die so makellos waren, dass sie gar nicht echt sein konnten. »Nichts für ungut, aber ein Knastvogel erkennt einen anderen Knastvogel, wenn er ihn sieht. Mein Bruder hat alles so vorbereitet, wie du’s bei ihm bestellt hast. Den Wohnwagen zeig ich dir gleich, hier ist der Schlüssel. Ist nicht groß, hat aber alles, was ein Mann so braucht: Stromanschluss, Kochplatte, Kühlschrank, Bett. Nur keine Heizung. Ist’n altes Modell. Für den Winter musst du dir was anderes suchen.«
Aigner zuckte mit den Schultern. Was bis dahin war, würde sich ergeben.
Schwarz legte ein Handy auf den Tisch, das er aus einer anderen Schublade herausgezogen hatte, in der noch ein gutes Dutzend weitere waren. »Hier ist ein Prepaidhandy, ein wenig aus der Zeit, aber du wolltest es so.« Er hob einen zweiten Schlüsselbund hoch. »Das sind die Schlüssel für deinen Wagen. Ist eine Reisschüssel.«
»Eine was?«, fragte Aigner irritiert.
»Ein Japaner, Toyota, deine Preisklasse, auf einen Freund vom Schwager meines Bruders zugelassen, der momentan einsitzt. Hat über zweihunderttausend Kilometer auf dem Tacho und ein paar Jahre auf dem Buckel, tut’s aber noch, ich hab ihn generalüberholt. Und, Überraschung: Modefarbe Weiß. Wenn was passiert mit ihm, war er gestohlen. Du verstehst, was ich meine.«
Aigner nickte.
Schwarz lehnte sich zurück. »Das war’s vorerst. Reden wir über Geld. Mein Bruder hat gesagt, man kann dir vertrauen, du zahlst in Raten. Das geht in Ordnung, solange die Kohle pünktlich auf meinem Schreibtisch liegt. Jeden Monatsersten fünfhundert.«
»Das ist korrekt«, sagte Aigner, zog einen Umschlag heraus und reichte ihn Schwarz, der ihn ohne nachzusehen in seine Brusttasche steckte und aufstand.
»Dann wollen wir mal…«
Drei Stunden später saß Aigner allein in seinem betagten Wohnwagen und studierte eine Straßenkarte vom Bodenseegebiet, die er mit seiner Buddhastatue aus Bronze beschwert hatte. Er sah nachdenklich hoch und aus dem Fenster seines neuen Domizils, das durchdringend nach altem Zigarettenrauch stank und gelb war vom Nikotin, aber dafür konnte er kommen und gehen, wie es ihm passte, und das war das Einzige, was zählte. Die Aussicht war auch nicht gerade atemberaubend, dafür waren keine Gitterstäbe davor. Der Wohnwagen war zwischen einem Dutzend anderer eingeklemmt, die ausgeweidet werden sollten oder es zum Teil schon waren, dahinter ein hoher Maschendrahtzaun mit Stacheldraht als Krönung, der das ganze weiträumige Areal der Gebrüder Schwarz umgab. Hinter dem Zaun waren eine verlassene Kiesgrube und Brachland, das in der Ferne in Felder überging. Gegenüber den Wohnwagen die Wellblechwand einer Lagerhalle, in der unzählige Ersatzteile aufbewahrt wurden, die man noch verwerten konnte. Der Wohnwagen war eine Bleibe, ein besseres Schlupfloch, das war es, mehr nicht. Aber Aigner hatte wenigstens ein Dach über dem Kopf, an reduzierte Lebensumstände war er gewöhnt, er brauchte nicht viel.
Doch er hatte viel vor.
Und heute war der erste Tag seines neuen Lebens. Wie sehr hatte er ihm entgegengefiebert! Er konnte es kaum erwarten, dass es nun endlich losgehen sollte. Er legte seine rechte Hand auf die Glatze des Buddhas, schloss die Augen und fokussierte sein Denken ganz auf seinen Atem. Als er glaubte, sich innerlich genügend gesammelt zu haben, nahm er ein DIN-A2-Blatt und tat das, was ihm durch die enorme Konzentration, die er dazu brauchte, die nötige Ruhe und das Gefühl verlieh, über den Dingen gleichsam zu schweben und sie kontrollieren zu können: Er faltete ein Origami. Aus einem einzigen Blatt Papier, ohne Schere oder Klebstoff, nur durch Falttechnik, gelang es ihm, nach tausendfacher Übung, einen Vogel zu falten oder einen Elefanten oder ein Krokodil. Was auch immer ihm seine Phantasie eingab. Wenn es ihm beim ersten Mal misslang, probierte er es ein zweites Mal. Wenn es sein musste, ein drittes und viertes Mal, bis es perfekt war. So wie das Pferd, das er für Sophie gefaltet hatte und das in dem Päckchen war, das nun als kleines Geschenk unter ihrem Grabkreuz lag. Es war das letzte Origami, das er nur für sie mit all seiner Sorgfalt und Kunstfertigkeit gefaltet hatte. Und mit all der Liebe, zu der er fähig war.
Die nächsten Origami, die er zu falten gedachte, würden Werke des Hasses sein. Genauso raffiniert, aber zu einem ganz anderen Zweck. Sie würden Angst und Schrecken repräsentieren, und der Adressat, für den sie bestimmt waren, würde wissen, was sie darstellten und warum sie gemacht worden waren. Aber Aigner konstruierte dafür kein Pferd, das war nur für Sophie bestimmt, nein, er faltete einen Skorpion.
Als er damit fertig war, hielt er ihn mit seinen Latexhandschuhen, die er wegen der Fingerabdrücke getragen hatte, ins Licht der Lampe. Ja, der Skorpion war ihm auf Anhieb gelungen. Am schwierigsten war es gewesen, den Stachel hinzubekommen. Aber er war perfekt. Gut, dass er dazu neben den notwendigsten Lebensmitteln extra noch mehrere Bogen schwarzes Papier im Einkaufscenter erworben hatte, so sah der Skorpion noch viel echter und bedrohlicher aus. Als ob er sich plötzlich bewegen und zustechen würde.
Nun musste er nur noch die passende Schachtel für den Skorpion falten.
Nichts einfacher als das.
5
Aigner parkte mit dem alten Toyota am Eingang zum Waldfriedhof von Memmingen und stieg aus. Es war früher Nachmittag, ein großes Plakat kündigte an, dass nächste Woche im Krematorium Tag der offenen Tür war.
Die Glocke der Aussegnungshalle gleich links vom Haupteingang fing gerade an zu läuten, Gruppen von schwarz gekleideten Menschen standen auf dem Vorplatz herum, teilweise mit Blumen in den Händen.
Er holte einen Zettel heraus, auf dem ein Grabplatz mit Nummer und Grabreihe notiert war und der dazugehörige Name, Seyfried. In den zehn Jahren, die er abgesessen hatte, war er mit einigen Leidensgenossen auf einer Zelle gewesen, aber angefreundet hatte er sich nur mit ganz wenigen. Seyfried war einer davon gewesen, bis ihn der Krebs dahingerafft hatte, Bauchspeicheldrüse. Es kam aus heiterem Himmel, und die Krankheit war rasend schnell vorangeschritten, ohne Aussicht auf Heilung. Als Seyfried die Diagnose bekommen hatte und wusste, dass ihm nur noch ein paar Wochen blieben, um seine letzten Dinge zu regeln, hatte er die einzige Person, zu der er in der Pension Sing-Sing Vertrauen gefasst hatte, nämlich Aigner, weil dieser wie er aus der Memminger Gegend stammte, am Ballspielplatz beiseitegenommen und in sein wichtigstes Geheimnis eingeweiht. Angehörige hatte er keine mehr, und er wollte ganz aus der Welt verschwinden, so als hätte es ihn nie gegeben. Mit seinem Leben und seiner Vergangenheit hatte er nach dem ersten Schock ohne eine Spur von Reue oder Sentimentalität abgeschlossen und seinen Frieden gemacht. Seinen Leichnam hatte er der Anatomie vermacht– wenigstens einmal wollte er etwas Nützliches für die Menschheit tun, hatte er mit einem selbstironischen Lächeln gesagt.
Während sie im Schatten einer Platane Giovanni zugesehen hatten, der bei sengender Hitze von seinem Rollstuhl aus seine üblichen Würfe mit dem Basketball absolvierte, erzählte er Aigner von seinen Ersparnissen. Sein Leben lang hatte er Leute um ihr Geld betrogen oder es unterschlagen, war mehrfach erwischt worden und als Wiederholungstäter für viele Jahre hinter Gittern gewesen. Ins Detail ging er nicht, das machte keiner im Knast, außer er war von der notorischen Unschuldsfraktion und nervte jeden Neuankömmling mit möglichen Wiederaufnahmeverfahren und Revisionen und wie und warum er Opfer des größten Justizirrtums der Nachkriegszeit geworden war. So einer war Seyfried nicht gewesen, ganz im Gegenteil. Er hatte sich eben einstmals dafür entschieden, sich auf krummen Wegen durchs Leben zu schlagen, und dazu stand er auch, obwohl er nun seinen Traum, sich im Alter nach Thailand zurückzuziehen und den Herrgott einen guten Mann sein zu lassen, kurz vor der Zielgeraden abschreiben musste. Für diesen Traum hatte er vorgesorgt und das dazu nötige Kapital ganz altmodisch versteckt. Nicht auf einem Offshorekonto, sondern auf die antiquierte Art, wie das Oetker-Lösegeld– nur dass er es absolut wasserdicht und insekten- und wurmsicher verpackt hatte, bevor er es vergrub. In Dollarscheinen. Der D-Mark hatte er schon seit der Oetker-Entführung nicht mehr getraut und dem Euro erst recht nicht.
Als Aigner sich das angehört hatte, konnte er es zunächst nicht glauben. Aber Seyfried hatte ihm versichert, dass er keine Witze machte, und ihn eingeweiht, wo das Geld war. Aber nun konnte er nichts mehr damit anfangen. »So spielt das Leben!«, meinte er achselzuckend und überreichte Aigner den Zettel mit der Nummer und dem Namen darauf. »Das Familiengrab«, sagte er und kicherte. Nur dass es keine Familie mehr gab, aber die Grabstelle hatte er angeblich für zwanzig Jahre im Voraus bezahlt. Drei Tage später war Seyfried tot.
Und jetzt stand Aigner am Eingang zum Friedhof und kam sich wie ein einfältiger Esel vor, weil er Seyfrieds Geschichte Glauben geschenkt hatte. Doch einen Versuch war es wert. Wenn das der letzte Scherz eines alten Gauners gewesen war, dann hatte er nur einen Tag verschwendet und war umsonst nach Memmingen gefahren. Zeit war etwas, das er im Überfluss besaß, aber wenn die Geschichte wirklich stimmte, dann hatte er bald mehr als genug Kapital, um seinen Plan reibungslos durchzuziehen.
Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Wunde für Wunde– er hatte das Bibelzitat verinnerlicht, lange Nächte hatte er damit verbracht, sie zu studieren. Die erhoffte Läuterung war ausgeblieben, aber es hatte geholfen, die Zeit zu vertreiben. Beim Gedanken daran kroch brennender Hass wie bittere Galle die Kehle hoch und drohte wie so häufig auch seinen Geist zu verätzen. Das durfte er nicht zulassen, für sein Vorhaben brauchte er einen klaren Kopf und ein kühles Herz.
Bevor er zum Friedhof gefahren war, hatte er einen Baumarkt aufgesucht und sich einen Sack Blumenerde, Gartenhandschuhe, eine kleine Harke und eine Schaufel gekauft. Er ging an ein paar halbwüchsigen schwarz gekleideten Mädchen vorbei, die mit leerem Blick zu Boden starrten oder in Taschentücher schnäuzten, und studierte auf einer Schautafel den Friedhofsplan. Dann holte er sich eines der zweirädrigen Handwägelchen, die für die Grabpflege gleich rechts neben dem Eingang bereitstanden. Er kehrte damit zu seinem Auto zurück und öffnete den Kofferraum, packte seine Einkäufe auf das Wägelchen und zog damit in den Friedhof.
Er musste warten, bis die Trauergemeinde, die eben gemessenen Schrittes aus der Aussegnungshalle kam und hinter dem Sarg herdefilierte, nach links abbog. Da er den gleichen Weg nehmen wollte, zog er das Wägelchen langsam hinter sich her, um einen gebührenden Abstand zum Leichenzug zu wahren. Der schien schier endlos, immer mehr Wartende schlossen sich ihm an, der Verstorbene war offenbar ein beliebter Mensch gewesen. Aigner zählte mindestens hundert Leute, die dem Rollwagen mit den Sargträgern an der Seite folgten, hinter dem Pfarrer her, der von Weihrauchkesseln schwingenden Ministranten begleitet wurde.
Endlich konnte Aigner einen Seitenweg nach rechts einschlagen und fand schließlich das Familiengrab der Seyfrieds, das im Halbdunkel der Schatten spendenden Fichten unscheinbar neben einem modernen Grabdenkmal aus mehreren schlanken Stelen gelegen war, ganz wie es ihm Seyfried selbst noch beschrieben hatte. Die Stelen waren mit adeligen Namen und akademischen Titeln übersät– aber das war nicht ungewöhnlich, im Gegensatz zu dem aufgespannten Segel, das die Grabstelle nach oben abschirmte. Jetzt erst fiel Aigner auf, dass in der ganzen Umgebung die meisten Grabsteine mit Plastikhauben oder sogar mit bunten Sonnenschirmen abgedeckt waren, die über und über gesprenkelt waren mit weißem Vogelkot. Er vernahm lautes Gekrächze und hob den Kopf: Die Fichten und auch ein paar Laubbäume waren dicht an dicht mit Krähennestern übersät, eine ganze Kolonie der schwarzen Vögel hatte sich anscheinend genau diese Ecke des Friedhofs ausgesucht, um dort in geselliger Gemeinschaft zu nisten. Auch der Seyfried-Grabstein aus schwarz glänzendem Marmorimitat war von oben bis unten mit Vogeldreck besudelt, der Grabhügel davor verwahrlost und ungepflegt.
Er sah sich um. In der Nähe war ein Brunnen mit Gießkannen, daneben ein Abfallhaufen aus verwelkten Blumen, Gestecken und Kränzen. Zwei ältere Frauen in Schürzen und Gummihandschuhen unterhielten sich heftig gestikulierend und füllten ihre Gießkannen auf. Aigner, der unauffällige Rentnerklamotten anhatte – taubengraue Jacke, graue Jerseyhose und einen niedrigen schwarzen Strohhut mit schmaler Krempe–, zog seine Gartenhandschuhe an, legte eine Plastiktüte auf den Boden und ging darauf auf die Knie. Er begann, pro forma das Unkraut herauszurupfen, das den gesamten Grabhügel überwuchert hatte. Graben konnte er erst, wenn die zwei Frauen am Brunnen wieder außer Sichtweite waren, so lange musste er wohl oder übel warten.
Vor seiner Fahrt nach Memmingen hatte er sich überlegt, ob es nicht besser war, in der Nacht auf den Friedhof zu schleichen, hatte diese Schnapsidee aber schnell wieder verworfen. Tagsüber, als harmloser Rentner, der das Grab seiner Angehörigen herrichten wollte, würde er nicht weiter auffallen, wenn er mit den dazu nötigen Arbeitsgeräten und Erde auf dem Friedhof unterwegs war.
»Das wird aber auch Zeit!«, hörte er plötzlich eine weibliche Stimme hinter sich so nah und unvermittelt sagen, dass er zusammenzuckte. Wegen des an- und abschwellenden Vogellärms in den Bäumen hatte er sie nicht herankommen gehört. Er drehte sich schwerfällig nach der Stimme um. Eine resolut aussehende Mittsiebzigerin stand vor ihm, mit grauvioletten Dauerwellen, einem wagenradgroßen Hut und ausladenden Formen, eingehüllt in ein zeltartiges schwarzes Kleid. Mit ihren schwarzen Netzhandschuhen hielt sie die Griffe eines Outdoor-Rollators gepackt, mit dem sie aussah, als könne sie ihn ohne Weiteres panzertaktisch als Räumwaffe einsetzen und würde auch keine Sekunde zögern, es zu tun, falls ihr jemand in die Quere käme. Ihre gnadenlosen Augen hinter den dicken Brillengläsern musterten ihn hemmungslos von oben bis unten.
Das hatte ihm gerade noch gefehlt!
»Ich bin nicht von hier«, murmelte er und kehrte ihr wieder den Rücken zu, aber mit dieser fadenscheinigen Erklärung ließ sich die nahkampferprobte Dame nicht abspeisen.
»Wissen Sie«, sagte sie, »mein Grab ist neben dem Ihrigen, da möchte man schon, dass es einigermaßen gepflegt aussieht. Und Ihres ist offensichtlich seit Jahren nicht mehr hergerichtet worden.«
»Ja«, brummte Aigner, »ich war lange im Ausland und kam nicht dazu.«
»Das sieht man«, bemerkte sie spitz. »Von Fröhmsdorff, mein Name. Bertha von Fröhmsdorff.«
Sie bekam keine Antwort, aber das machte sie nur noch neugieriger. »Und wer sind Sie, wenn man fragen darf?«
Aigner stöhnte innerlich auf und zeigte mit seiner Harke auf das Grab. »Ein entfernter Verwandter.«
»Aha«, sagte sie misstrauisch und ließ sich einfach nicht abwimmeln. »Wenn das Ihre Angehörigen sind– haben Sie die Petition schon unterschrieben?«
»Welche Petition?«
»Na die gegen die Mistviecher, die den Saustall hier verursachen.« Sie zeigte nach oben, wo die Krähen kreisten und ihre Krächzkakophonie aufführten.
»Nein«, antwortete er und wusste im selben Augenblick, dass das ein Fehler war.
»Dann wird’s aber Zeit!«, sagte Frau von Fröhmsdorff. »Oder sind Sie auch einer von denen?«
»Ich… ich verstehe nicht…«, stotterte Aigner und erhob sich mühsam, achtete aber darauf, dass seine Hutkrempe so viel vom Gesicht verdeckte wie möglich.
»Ob Sie’s glauben oder nicht«, sagte sie verschwörerisch, »es gibt so fanatische Tierschützer, die verhindern, dass man etwas gegen diese schwarzen Mistviecher unternimmt! Sie abschießt, vergiftet oder was auch immer. Man sollte es nicht für möglich halten, aber diese schwarze Pest wird vom Gesetz geschützt. Und die Ruhe der Toten nicht. Pervers, oder?«
»Was Sie nicht sagen.« Er schüttelte den Kopf. »Wirklich kaum zu glauben.«
»Aber wahr. Also– Sie sind keiner von denen?«
»Nein. Ich bitte Sie!«, sagte er. »Bei dem Lärm und Dreck, den die Vögel machen.«
Er traute seinen Augen nicht, aber Frau von Fröhmsdorff streckte ihm jetzt auch noch die Hand entgegen!
Innerlich fluchend brachte er ein gequältes Lächeln zustande, lüpfte für eine Millisekunde den Hut und reichte ihr die Hand, bevor er merkte, dass er noch die Gartenhandschuhe anhatte. Mühsam zupfte er den rechten von seiner Hand, schüttelte die ihre und sagte: »Angenehm. Äh… Franz Schmidt.«
Frau von Fröhmsdorff ließ seine Hand nicht mehr los. »Mit Dete?«
»Wie bitte?«
»Schmidt. Mit Dete am Ende? Wie unser Altbundeskanzler?«
Selten hatte ihn jemand so vollkommen aus dem Konzept gebracht wie dieses weibliche Schlachtschiff. »Ja, ja«, brachte er mit Müh und Not heraus. »Mit Dete.«
Endlich ließ sie seine Hand los, stemmte die ihre in die Hüftgegend und sagte: »Also, Herr Schmidt– was sagen Sie? Sind Sie auf unserer Seite? Wir haben schon an die fünfzig Unterschriften zusammen, müssen Sie wissen.« Sie zog ihre Handtasche aus dem Gepäckkorb ihres Rollators und kramte mehrere zusammengefaltete Zettel heraus, die sie sorgfältig glättete und ihm hinhielt. Aigner musste nach seiner Lesebrille suchen, setzte sie auf und gab sich den Anschein von Interesse.
»Ja«, sagte er, »das kann man unterschreiben.« Er hoffte inständig darauf, die gute Frau von Fröhmsdorff damit endlich loszuwerden, denn ihr Familiengrab war in so perfektem Zustand – sichtlich von professioneller Gärtnerhand–, dass sie mit ihrer schwäbischen Hausfrauenmentalität wenigstens bis Allerheiligen zufrieden sein konnte.
Schon hatte sie einen Kugelschreiber gezückt. Er nahm ihn, legte den Zettel auf den Rand des Seyfried-Grabsteins, versah ihn mit seinem ausgedachten Namen, einer fiktiven Adresse und einer unleserlichen Unterschrift und gab ihn samt Schreibgerät zurück. Natürlich warf Frau von Fröhmsdorff noch einen kritischen Blick darauf, ob auch alles korrekt ausgefüllt war, bis sie sich endlich zufriedengab und den Zettel wegsteckte.
»Ich muss dann mal gehen, Herr Schmidt«, sagte sie in einem Ton, als tue es ihr von Herzen leid, den armen Herrn Schmidt bei seinen toten Angehörigen allein zurücklassen zu müssen.
Wäre er ein guter Katholik gewesen, hätte Aigner jetzt drei Kreuze gemacht, stattdessen lüpfte er noch einmal andeutungsweise seinen Hut und sagte heuchlerisch: »Freut mich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben!«, und sah zu, wie Frau von Fröhmsdorff ihm gönnerhaft zunickte, ihren Rollator in Gang setzte und mit einem bösen Blick nach oben zu den Krähen davonschob. Es war, als wären die Krähen genauso erleichtert wie Aigner, nur dass sie den Abgang der resoluten Gouvernante adeliger Herkunft freudig krächzend kommentierten, während Aigner ein Stein vom Herzen fiel. Endlich konnte er sich dem eigentlichen Grund seines Friedhofsbesuch widmen.
Er versicherte sich erneut, dass außer den Krähen keiner mehr zu sehen war, leerte die Blumenerde aus dem Plastiksack und fing an zu graben. Einen guten Meter tief, hatte Seyfried gesagt. Der Schweiß lief ihm bald in Strömen den Rücken hinunter. An schwere körperliche Arbeit war er nicht mehr gewöhnt, und mit der kleinen Schaufel war es eine Schinderei, obwohl der Boden relativ weich war, aber von Wurzeln durchzogen.
Als die Schaufel auf etwas Hartes stieß, sah er sich noch einmal um, bevor er tief durchatmete: Seyfried hatte ihn also nach seinem Tod nicht ein letztes Mal verarscht, so wie er das ein ganzes Leben lang mit seinen Opfern getan hatte. Obwohl– es konnte immer noch sein, dass er nur eine Botschaft in einem Kästchen fand, auf der »Angeschmiert!« oder »Reingefallen!« stand. Dem Scherzkeks Seyfried wäre so etwas durchaus zuzutrauen gewesen.
Er kratzte den letzten Rest Erde mit der Hand weg, der einen undurchsichtigen Plastikbehälter von der Größe eines Handgepäckkoffers bedeckte– es war tatsächlich Tupperware, stellte Aigner kopfschüttelnd fest. Er nahm den leeren Plastiksack, in dem die Blumenerde gewesen war, und steckte den Behälter hinein, bevor er ihn auf das Handwägelchen lud. Hastig schaufelte er das Loch wieder zu, verteilte die frische Blumenerde grob über dem Grab und rückte mit seinem Wägelchen ab, so rasch es ging, ohne den anderen Friedhofsbesuchern aufzufallen.
An seinem Auto angekommen, öffnete er die Heckklappe und warf die Gerätschaften achtlos hinein. Und dann kam der Moment der Wahrheit. Er legte den Behälter im Plastiksack in den Kofferraum und holte ihn erst dort aus der Hülle. Der Deckel des Behälters war mit einem Klebeband abgedichtet. Das Band ließ sich mit einem Ruck entfernen, und Aigner hob den Deckel vorsichtig hoch. Zwei DIN-A4-große Pakete, jeweils so dick wie ein Großstadttelefonbuch und sorgfältig in wasserabstoßendes Spezialpapier eingewickelt, das ebenfalls mit Klebeband gesichert war, kamen zum Vorschein. Irgendwie war Aigner darauf gefasst, dass jetzt, im allerletzten Augenblick, sobald er die Klebestreifen entfernte, ein Scherzartikelclown auf einer Sprungfederhalterung herausschießen und ihn endgültig zum Affen machen würde. Er beschloss, der Ungewissheit ein Ende zu bereiten, und riss ein Paket auf.
Was er sah, zeigte, dass Seyfried am Ende seiner Tage doch die Wahrheit gesagt hatte.
Fein säuberlich lagen mit Banderolen versehene Geldbündel nebeneinander, Aigner sah sechs Stapel, vier in Reihe, zwei quer, mit Zwanzig-Dollar-Scheinen. Die Summe war schwer zu schätzen, das Zählen verschob er auf später. Er riss das zweite Paket ebenfalls auf, Schweizer Franken, Fünfzigerscheine, gebündelt zu fünftausend Franken.
Er schlug die Heckklappe mit der Gewissheit zu, von nun an unabhängig und vermögend genug zu sein, um alle seine Pläne nach Gusto verwirklichen zu können. Und für seine Nichte Emma würde auch noch eine hübsche Summe übrig bleiben. Kein Sozialamt, kein HartzIV