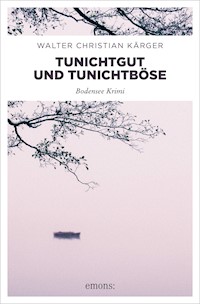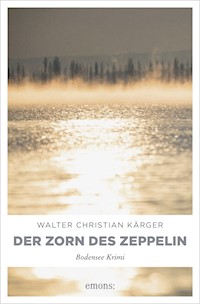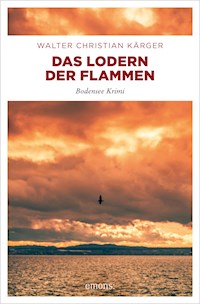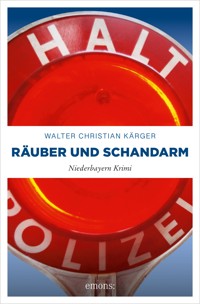Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bodensee Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Dreamteam vom Bodensee in seinem härtesten Fall. Während Kommissar Madlener nach dem folgenschweren Ausgang des letzten Falls in eine Auszeit geschickt wird, steht seine Kollegin Harriet vor einem Dilemma: Bei den Ermittlungen in einem herausfordernden Mordfall erkennt sie in zwei Tatverdächtigen ihre Peiniger wieder, die sie vor Jahren überfallen und beinahe umgebracht haben. Ein traumatisches Erlebnis, von dem außer ihr niemand weiß. Die Entscheidung liegt nun in ihrer Hand: Soll sie Rache nehmen oder nach Recht und Gesetz handeln?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Walter Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: achimguenter/photocase.de, Michael Schwarzenberger/Pixabay.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-968-6
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Gabriele, Tilman und Lilly-Marie
Denn alles,was nicht ins Bewusstsein steigt,kommt als Schicksal zurück.
Christian Kracht, »Eurotrash«
So kämpfen wir uns voranwie Schiffe gegen die Strömung,unaufhörlich zurück ins Vergangene getrieben.
F. Scott Fitzgerald, »Der große Gatsby«
When the levee breaks, I’ll have no place to stay.
Led Zeppelin, »When the Levee Breaks«
1
Laut hallten seine Schritte durch die Gänge des Gefängnisses.
Kriminalhauptkommissar Max Madlener musste sich ins Zeug legen, um mit der Wärterin mitzuhalten, die ihm vorauseilte, durch videoüberwachte Türen, die von der Zentrale aus gesteuert wurden und mit einem deutlich hörbaren elektrischen Summton anzeigten, dass sie geöffnet werden konnten.
Madlener nahm einen vagen Geruch nach einer toxischen Mischung aus Desinfektionsmitteln, Schweiß und Angst wahr. Vielleicht war das auch nur Einbildung, aber er hatte ein Sensorium dafür. Das war in allen Gefängnissen so, und er war berufsbedingt schon in vielen gewesen.
Ein paar Tage – und vor allem Nächte – hinter Gittern genügten im Normalfall, um den scheinbar coolsten Untersuchungshäftling weichzukochen, das war seine Erfahrung.
Es gab Ausnahmen – Wiederholungstäter und Gewohnheitsganoven, die nicht zum ersten Mal einsaßen und für die es Routine war, den harten Hund zu geben, weil es zu ihrer Standesehre gehörte.
Oder Bessergestellte, die sich eine sündteure Anwaltskanzlei leisten konnten, deren Vertreter sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in kürzester Zeit wieder herauspauken würden.
Aber wer als durchschnittlicher Premierengast gesiebte Luft atmete und in einer Einzelzelle auf neun oder zehn Quadratmetern Gelegenheit zum Nachdenken über die Konsequenzen seines Tuns hatte, war normalerweise mehr oder weniger angeknockt.
Die meisten eher mehr.
Es war ein Schockerlebnis, wenn man zum ersten Mal in einer spartanischen Zelle auf seiner Pritsche lag, die muffige und kratzige Decke am Kinn, eine ganze Nacht über kein Auge zubekam, die graue Betondecke anstarrte, sich wieder und wieder den Kopf zermarterte, wie und warum man im Knast gelandet war und wie hoch wohl das Strafmaß ausfallen könnte, Schreie und Flüstern hörte und einem allmählich ins Bewusstsein einsickerte, dass die Tür von außen abgesperrt war. Ein Zustand, der, wenn man Pech, einen schlechten Anwalt oder einen überstrengen Richter hatte, vielleicht auf Jahre hinaus zementiert war. Am schlimmsten waren die frühen Morgenstunden zwischen der dunkelsten Nacht und der Dämmerung. Dann nämlich, wenn man sich vorstellte, dass vielleicht jemand den Schlüssel weggeworfen hatte. Da war schon so mancher auf dumme Gedanken gekommen.
Nicht umsonst war die Suizidgefahr bei Neuankömmlingen unverhältnismäßig groß. Für sie galten ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen, das gehörte zum Standardausbildungsprogramm eines jeden Mitarbeiters einer JVA.
Die Justizvollzugsbeamtin, die vor Madlener hergegangen war, blieb schließlich vor einer Tür stehen, die sie ihm aufhielt, ohne ein Wort zu sagen.
In einem schlichten Vernehmungsraum mit vergitterten Fenstern wartete eine weitere weibliche Wärterin in der Ecke und nickte ihm zu.
Am Tisch in der Mitte des Raums saß eine junge Frau mit blondem Kurzhaarschnitt, die ihre Hände tief in den Taschen ihrer schwarzen Lederjacke vergraben hatte. Die Kajalschminke um ihre Augen war noch dicker als sonst, und ihre Lippen hatte sie zu einem trotzigen Strich zusammengepresst.
Harriet Holtby, Madleners frühere Assistentin und jetzige Kollegin.
Sie sah zu ihm hoch, ein Anblick, der Madlener erschreckte, weil er die Verzweiflung in ihrem waidwunden Blick erkennen konnte, aber er ließ sich nichts anmerken. Am liebsten hätte er sie jetzt in den Arm genommen und sie ganz fest gedrückt, aber das ging natürlich nicht.
»Hallo, Harriet«, sagte er.
Sie nickte.
Das war schon mal etwas. Wenigstens ignorierte sie ihn nicht.
»Hast du einen guten Anwalt?«, fragte er als Erstes.
»Nein«, antwortete sie. »Nicht mal einen schlechten.«
Ihr Versuch, einen Witz zu machen, fiel ziemlich kläglich aus. Er ignorierte ihn.
»Dann besorge ich dir einen.«
»Ich brauche keinen Anwalt«, sagte sie trotzig.
»Natürlich brauchst du einen. Ich kenne ein paar hervorragende Strafverteidiger.«
Harriet schüttelte entschieden den Kopf. »Ich will keinen Anwalt«, wiederholte sie.
Madlener insistierte: »Harriet, ich bin mir sicher, dass du unschuldig bist. Aber du bist nicht in der Lage, auf anwaltlichen Beistand zu verzichten. Dazu sind die Vorwürfe, die gegen dich erhoben werden, viel zu ernst.«
Sie zuckte mit den Schultern, gerade so, als ob sie das alles nichts anging.
»Ist mir egal«, sagte sie. »Ich bin schuldig. Wozu brauche ich da noch einen Anwalt?«
Aber Madlener kannte seine Kollegin viel zu gut, um zu wissen, dass ihre Gleichgültigkeit nur aufgesetzt war.
»Red keinen Blödsinn«, sagte er ungewöhnlich streng.
Er setzte sich ihr gegenüber und legte seine Hände mit den Handflächen nach oben auf den Tisch.
Es war eine auffordernde Geste.
Er wollte wenigstens ihre Hände nehmen in der Hoffnung, ihr durch die Berührung Trost und Zuversicht vermitteln zu können.
Sie sah ihn mit traurigen Augen an und ließ ihre Hände in den Taschen.
Madlener riss sich zusammen, obwohl er sie am liebsten gepackt und die Wahrheit aus ihr herausgeschüttelt hätte, weil er das alles nicht glauben konnte und wollte, was er bisher in der kurzen Zeit in Erfahrung gebracht hatte. Aber damit hätte er bei Harriet gar nichts erreicht, ganz im Gegenteil.
»Harriet, ich bin hier, um dir zu helfen«, beschwor er sie. »Erzähl mir, was passiert ist!«
»Das weißt du doch längst. Oder hast du die Akten nicht gelesen?«
»Ich will es aus deinem Mund hören. Mit deinen eigenen Worten.«
Wieder zuckte sie scheinbar unbeeindruckt mit den Schultern. »Ich habe ihn erschossen. Punkt. Das ist alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und weißt du was – ich bereue es nicht. Kein bisschen, um ehrlich zu sein.«
Madlener erkannte das kurze Aufblitzen von Hass in ihren Augen und wusste, dass sie in diesem Augenblick die Wahrheit sagte.
Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
So schrecklich sie auch war.
Nach einer kurzen Pause, in der sie sich anschwiegen – Madlener, weil er nach diesem unerwarteten Bekenntnis erst einmal sprachlos war, und Harriet, weil sie alles gesagt hatte, was es für sie zu sagen gab –, erhob sich Harriet. Sie zeigte der Wärterin mit einer Kopfbewegung an, dass für sie die Unterredung beendet war und sie den Vernehmungsraum wieder verlassen wollte.
»Himmelherrgott noch mal – Harriet!«, regte sich Madlener auf und schoss von seinem Stuhl hoch. »Jetzt hör mir doch erst mal zu! Wir müssen reden, uns eine Strategie ausdenken!«
Aber Harriet sah ihn nur kurz mit diesem abgrundtief traurigen Blick an und wandte sich ab. »Ich wüsste nicht, warum. Die Tatsachen sprechen für sich. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.«
In diesem Moment wusste er, dass es sinnlos war, sie weiter zu bedrängen und umstimmen zu wollen. Wenn Harriet sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, war es so gut wie unmöglich, sie davon abzubringen.
»Danke für deinen Besuch«, sagte sie noch kaum hörbar, bevor sie, von ihrer Wärterin begleitet, durch die zweite Tür in Richtung Zellentrakt verschwand.
Wie zur Salzsäule erstarrt registrierte Madlener, dass die Tür mit einem satten Klicken ins Schloss fiel.
Er ballte seine Hände zu Fäusten, um nicht vor blinder Wut und Ratlosigkeit auszuflippen. Noch nie hatte er sich so hilflos gefühlt.
In ihrem verhängnisvollen Fatalismus schien Harriet alles egal zu sein.
Aber was hätte er machen sollen?
Den Stuhl packen und ihn gegen die Tür hämmern?
Als Beweis dafür, dass er zu Recht in Kollegenkreisen den Spitznamen »Mad Max« führte? Um allen zu zeigen, wozu er in der Lage war, wenn er wirklich in Rage geriet?
Damit würde er nur Leuten wie seinem Vorgesetzten Kriminaldirektor Cornelius Munition dafür liefern, ihn endgültig für unzurechnungsfähig und somit dienstunfähig zu erklären.
So wie es seine Vorgänger schon versucht hatten.
Den Gefallen wollte er ihnen nicht tun, ganz bestimmt nicht.
Madlener merkte, wie ihm tausend Gedanken gleichzeitig nur so durch den Kopf schossen.
Er spürte, dass er wirklich kurz davor war, vollkommen die Kontrolle zu verlieren.
Aber wenn er jetzt ausrastete, schadete er nur sich und vor allem Harriet. Sollte er sich nicht zusammenreißen können und sich selbst durch seine Unbeherrschtheit aus dem Spiel kegeln, dann war Harriet auf sich allein gestellt.
Dann konnte er nichts mehr für sie tun.
Das durfte er auf keinen Fall zulassen. Sie war wahrlich auf jede Hilfe angewiesen, die sie kriegen konnte. Und nur er war kraft seines Amtes dazu in der Lage, sie aus ihrer aussichtslosen Lage herauszuboxen, in die sie sich selbst manövriert hatte.
Egal wie.
Schließlich kannte niemand sie so gut wie er.
Obwohl – in diesem sterilen Verhörraum mit seinen nackten Wänden, von denen die Farbe abblätterte, war er sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er Harriet auch nur ansatzweise kannte.
Er hatte immer schon geahnt, dass sie im übertragenen Sinn einiges an schwerem Gepäck aus ihrer Vergangenheit mit sich herumschleppte.
Etwas, das sie nicht einmal ihm anvertrauen mochte.
Das, was sie getan hatte, konnte nur irgendwie mit ihrer Vergangenheit zusammenhängen, da war er sich sicher.
Aber um hinter dieses dunkle Geheimnis zu kommen, musste sie ihm gegenüber absolut ehrlich sein und alle Karten auf den Tisch legen.
Wirklich alle.
Selbst wenn es noch so schmerzhaft war.
Was für ein Geheimnis konnte so unsagbar furchtbar für sie sein, dass sie sich ihm nicht offenbaren konnte oder wollte?
Dabei hatte er immer geglaubt, dass sie einander rückhaltlos vertrauten.
Ohne schonungslose Offenheit von ihrer Seite sah er keine Chance, dem unweigerlich auf sie zukommenden Gerichtsverfahren mit all den verheerenden Folgen für ihr Leben und ihre Zukunft noch etwas entgegensetzen zu können.
Anscheinend war Harriet eher bereit, den Gang nach Golgatha anzutreten, als ihm die ganze Wahrheit zu beichten.
Nicht zum ersten Mal hatte er Angst um sie.
Doch diesmal konnte er nicht darauf hoffen, dass sie es irgendwie schaffte, ihren Hals von selbst noch aus der Schlinge zu ziehen.
Die Beweislast war zu erdrückend.
So verzweifelt, wie sie ausgesehen hatte, traute er Harriet alles zu.
Auch das Undenkbare.
In tiefer Resignation ließ er sich wieder auf seinen Sitz am Vernehmungstisch niedersinken und schlug die Hände vors Gesicht.
Schlimmer konnte es nicht mehr kommen.
Zwölf Wochen vorher
2
Juri war hibbelig.
Er hatte auch allen Grund dazu.
Alle paar Sekunden warf er einen Blick auf seinen sündteuren Da-Vinci-Perpetual-Chronometer von IWC.
Jedes Mal, wenn er das tat, freute er sich diebisch, dass er den einzig richtigen Moment abgepasst hatte, um ihn zu klauen.
Aber diesmal war es die reine Nervosität.
Nachts um zwei wartete er auf einen Mann, der bisher in seinem Leben eine große, ja prägende Rolle gespielt hatte.
Dieser Mann in seinen besten Jahren, scheinbar ein Gentleman mit vollendeten Manieren, konnte verdammt grob und ausfallend werden, wenn man ihn reizte.
Und Juri hatte ihn bis aufs Blut gereizt.
Er stand auf, warf seine Kippe ins Wasser und vertrat sich die Beine auf den Betonstufen am Ufer des Landungsplatzes in Überlingen, vor dem plätschernden Skandalbrunnen des Bodenseereiters von Peter Lenk.
Juri starrte zwar auf den Brunnen, aber er sah ihn nicht.
Für manche Besucher und Einheimische mit eher konservativem Kunstverständnis war der Brunnen eine obszöne Provokation, ebenso für den letzten deutschen Großdichter Martin Walser, selbst ein Überlinger, der als groteske Karikatur – aber eindeutig erkennbar – mit Schlittschuhen auf einem Gaul saß. Der wiederum wurde getragen von den Schwanzflossen zweier üppiger weiblicher Nixen mit gewaltigen, nach oben gestreckten Oberschenkeln. Walser, der Reiter mit seiner Ohrenklappenmütze, blickte dabei grimmig zum See und zu den Schweizer Alpen hinüber.
Juri verstand nichts von Kunst, und sie interessierte ihn auch nicht. Ihm gingen momentan ganz andere Dinge durch den Kopf. Wieder einmal musste er die möglichen Abläufe des Treffens geistig durchexerzieren.
Vieles hatte er durchdacht.
Eigentlich alles.
Er hatte so viel gegen ihn und seinesgleichen in der Hand, dass sie es nicht wagen würden, ihm auch nur ein einziges Haar zu krümmen.
Dachte er.
Das war bei Gott nicht sein erster Fehler, aber sein größter und letzter.
Doch das konnte er nicht ahnen.
Im Moment war er nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, sich eine glänzende Zukunft auszumalen. Mit all dem Geld, dass die Männer ihm bezahlen mussten, damit er ihre dunklen Geheimnisse nicht ausplauderte. Seiner Überzeugung nach blieb ihnen gar nichts anderes übrig, wenn sie nicht alles verlieren wollten, was sie sich so mühsam im Laufe eines Lebens aufgebaut hatten: ihren Ruf, ihre Reputation, ihren Wohlstand. Und letzten Endes ihre Freiheit.
Nein, das konnten sie nicht riskieren, für sie stand viel zu viel auf dem Spiel.
Jetzt mussten sie zur Abwechslung einmal nach seinen Regeln tanzen, und nicht er nach ihren, das stand für ihn fest.
Er hatte sich das Ganze schließlich gründlich überlegt.
Wenn alles klappte, würde er für immer dem Bodensee den Rücken kehren und seinen Traum leben können, der bisher so unendlich weit weg gewesen war wie die funkelnden Sterne am klaren Nachthimmel.
Seinen Traum von Ibiza.
Und nun konnte dieser Traum Wirklichkeit werden, er musste nur zupacken.
Nimm dir, was du kriegen kannst!
Aber lass dich nicht dabei erwischen.
Das war sein Lebensmotto, so lange er denken konnte.
Jetzt hatte sich so vieles verändert – aber das nicht.
3
Es war eine laue Sommernacht Ende Juli und trotz der späten Stunde alles andere als ruhig. Wasservögel krakeelten unablässig, von der gegenüberliegenden Halbinsel Bodanrück, wo irgendein Festival stattfand, wehten Musikfetzen herüber, in der Ferne stritten sich zwei Betrunkene lautstark, und ein paar Jugendliche fuhren übermütig und ausdauernd mit ihren bollernden Skateboards die Uferpromenade auf und ab.
Die Lichter von Dingelsdorf und Wallhausen am anderen Ufer spiegelten sich im schwarzen See.
Eine leichte an- und abschwellende Brise kräuselte das Wasser und wehte Juri immer wieder die langen Haare ins Gesicht. Er bemerkte es gar nicht, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders war.
Er war ein gut aussehender Junge von sechzehn Jahren und, seit er denken konnte, eigentlich ein Straßenkid. Er ging aber für achtzehn durch, konnte Auto fahren und tat das auch unverfroren, wenn sich die Gelegenheit dazu bot.
Er wusste nicht, wer seine Erzeuger waren, es interessierte ihn auch nicht. Ein richtiges Zuhause hatte für ihn nie existiert.
Bisher hatte er sich treiben lassen, seine Segel im Wind, egal, wohin es ihn verschlug.
Oder war er unbewusst auf der Suche nach …
Ja – wonach?
Nach Anerkennung, Wärme, einer Art von Familie, etwas, was er nie kennengelernt hatte?
Immer hatte es jemanden gegeben, der ihn weitergereicht hatte, seit er zum x-ten Mal von einer Pflegefamilie oder von einer Einrichtung abgehauen war, alles wieder mal hinter sich gelassen hatte, den ständigen Zoff und Streit mit seinen diversen Pflegeeltern in Österreich, dem Jugendamt, den Bullen, irgendwelchen Streetworkern oder Sozialarbeitern.
Wie oft hatte er »Scheiße gebaut«, wie man in seinen Kreisen zu sagen pflegte.
Das war sein Mantra, wenn er in angemessener Büßerhaltung vor einem Vertreter des Jugendamtes oder einem Richter saß, weil er inzwischen strafmündig geworden war.
In seiner kurzen, aber umfangreichen Laufbahn hatte er so gut wie nichts ausgelassen, was ihn mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt brachte.
Er hatte geklaut, gedealt, sich prostituiert, wildfremde Leute übers Ohr gehauen, war als Schwarzfahrer unzählige Male erwischt, verprügelt, eingesperrt worden, hatte Gerichtstermine und Auflagen missachtet und war schließlich als Intensivstraftäter aktenkundig geworden. Was auch immer man Gesetzwidriges anstellen konnte: Er hatte es getan.
Wieder einmal war er in einem Erziehungsheim gelandet. Aber diesmal, das schwor er sich, war es das letzte Mal.
Um aus dem Teufelskreis auszubrechen – auf der Straße leben, klauen, erwischt werden, eingebuchtet werden, herauskommen, von Neuem auf die schiefe Bahn geraten –, war es nötig, einen Plan zu haben und sich nicht nur von einem Deal zum nächsten, von einem Diebstahl zum anderen weiterzuhangeln.
Zum ersten Mal in seinem Leben war er gezwungen, längerfristig zu denken.
Er hatte keinen Schulabschluss, nichts vorzuweisen, so vieles hatte er angefangen und nichts zu Ende gebracht.
Wie viele Menschen, die es gut mit ihm meinten, hatte er enttäuscht und vor den Kopf gestoßen? Er wusste es nicht mehr.
Aber das kratzte ihn nicht weiter, so etwas wie ein schlechtes Gewissen hatte er noch nie verspürt. Irgendwie musste er sich eben durchs Leben kämpfen. Dass es dabei mitunter zu erheblichen Kollateralschäden kam – shit happens.
Je älter er wurde und je mehr desolate Erfahrungen er gemacht hatte, desto mehr war ihm klar geworden, dass er einfach nicht gesellschaftsfähig war.
Aber Juri war nicht dumm.
Er war Realist genug, um zu wissen, wie man sich durchschlägt.
Deshalb beschloss er, bis zu seinem achtzehnten Geburtstag zu warten, um dann den großen Schnitt zu machen und ein anderes Leben zu beginnen. Endgültig. Bis dahin musste er die Zähne zusammenbeißen und durchhalten.
Wenn der Zeitpunkt gekommen war, würde er irgendwie aus dem Radarbereich der Strafverfolgungsbehörden verschwinden, sich ausklinken aus dem Kontrollsystem, in dem er gefangen war, würde ganz von vorne anfangen, sich eine weiße Weste verschaffen, sich befreien von den Fesseln der Vergangenheit.
Dazu brauchte er einen gültigen Ausweis und genügend Geld. Und er musste auf eine Gelegenheit warten, die es ihm ermöglichte, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, in den er im Laufe der Zeit, auch durch eigene Schuld – dessen war er sich in lichten Momenten durchaus bewusst –, hineingeraten war.
Andere Perspektiven hatte er nie gehabt als die, den nächsten Tag irgendwie zu überstehen, für eine überschaubare Zeit eine Bleibe zu finden, einen Job, der ihn für eine Weile über Wasser hielt, ein paar Gleichgesinnte, mit denen er abhängen und chillen konnte, sich zuzudröhnen, um auf der kurzfristigen Leichtigkeit, die ihm die Drogen verschafften, davonzusegeln wie Johnny Depp alias Captain Sparrow auf seinem Piratenschiff »Black Pearl« – mit der gleichen nonchalanten Coolness. Das war der omnipräsente und gleichzeitig unerreichbare Traum, der ihn nicht mehr losließ, seit er »Fluch der Karibik« gesehen hatte, und das mindestens ein Dutzend Mal.
Wenn Juri ein Fazit seines Lebens gezogen hätte: Es war, seit er denken konnte, auf Kante genäht.
Aber egal, diese Zeiten waren für immer vorbei.
Nun hatte er auf einmal Flausen im Kopf und Schmetterlinge im Bauch.
Nur noch das zählte.
Und er hatte einen Plan.
Er wollte mit Sandra, seiner heimlichen Freundin aus bestem Haus, durchbrennen und mit ihr ein neues, selbstbestimmtes Leben anfangen.
Sandra hatte ihm die Augen geöffnet.
Er sei gefangen in seinem alten Leben, sei abhängig vom Willen und Geld anderer Leute. Sei nichts anderes als ein Leibsklave seines Herrn.
Das hatte sie wortwörtlich zu ihm gesagt.
So wie sie gefangen war in dem goldenen Käfig und den übergroßen Erwartungen ihres ignoranten und stockkonservativen Elternhauses.
Sie hatte ausgesprochen, was ihm schon lange undeutlich im Kopf herumgespukt war.
Er musste zugeben, dass sie recht hatte.
Wie sie wollte er ein freies Leben.
Ein Leben ohne Freier.
4
In Sandra hatte er jemanden gefunden, mit der er seinen Traum verwirklichen wollte und konnte.
Ein Mädchen, das er liebte. Bei ihr erst hatte er erkannt, was wirkliche Liebe war. Etwas, das er noch nie im Entferntesten erlebt hatte. Etwas, das ihm durch Mark und Bein gegangen war, ein Gefühl, das ihn immer noch durchrauschte wie ein guter Trip, wenn er nur an Sandra dachte.
Er hatte ihr am See beim Windsurfen zugeschaut, an einem herrlichen Sommernachmittag.
Oder besser gesagt: beim Versuch zu surfen, denn sie war, kaum hatte sie sich aufs Brett geschwungen und den Gabelbaum ergriffen, nach ein paar Metern umgekippt und ins Wasser gefallen.
Trotzdem hatte sie nicht aufgegeben und es immer wieder vergeblich aufs Neue probiert.
Das imponierte Juri.
Eigentlich war er an diesem Tag an den Überlinger Badestrand gekommen, um nach lohnender Beute Ausschau zu halten. Smartphones oder Geldbörsen, die leichtsinnigerweise zurückgelassen wurden, wenn man zum Schwimmen ins Wasser ging. Er konnte es einfach nicht lassen, es reizte ihn nach wie vor, die Gedankenlosigkeit der Leute auszunutzen.
Aber diesmal hatte er nur noch Augen für das hübsche Mädchen.
Schließlich zögerte er nicht länger, stürzte sich kopfüber ins Wasser und bot ihr an, ihr das richtige Windsurfen beizubringen. Das konnte er, seit er mit einem zeitweiligen Gönner einen zweiwöchigen Urlaub an einem Traumstrand auf Ibiza verbracht hatte. Außerdem: Was sportliche Aktivitäten anging, war er ein Naturtalent, athletisch, kraftvoll, geschickt.
Er zeigte Sandra, wie man das Gleichgewicht auf dem Brett hielt, wie man sich mit dem Segel in den Wind stemmte, wie man Zug aufs Brett bekam, indem man richtig mit dem Gabelbaum umging.
So hatten sie sich kennengelernt.
Sandra war mit ihrer Clique am See, Juri gesellte sich zu ihnen, erfuhr, dass sie alle aus Betzis kamen, dem Internat für Schülerinnen und Schüler aus bestem Hause, was Juri erst recht anmachte und ihn zur Höchstform auflaufen ließ. Wenn er wollte, konnte er eine ganze Gesellschaft mit seinen Geschichten unterhalten, ohne als Angeber oder Aufschneider dazustehen.
Natürlich waren seine Geschichten von vorn bis hinten erlogen, genauso wie das, was er über sich selbst erzählte. In der Hinsicht war er äußerst anpassungsfähig, er spürte instinktiv, was gut ankam und was ihn interessant machte.
Wenn er noch ein wenig an sich arbeitete, sagte ihm sein erster großer Mentor, der Wiener Kunstauktionator Dr. phil. Wegener, vierzig Jahre älter als er, bei dem er für einige Wochen untergekommen war, dann könne noch etwas aus ihm werden, bei entsprechender Nachhilfe in Benehmen und anständiger Kleidung. Für beides würde er sorgen. Für den Rest hatte die Natur gesorgt.
Juri war groß, schlank, gut aussehend und konnte ein Menschenfänger sein. Durch seinen natürlichen Charme, den er nach Belieben an- und ausschalten konnte, und seine Skrupellosigkeit hatte er keine Schwierigkeiten, auch bei Wildfremden schnell Anschluss zu finden.
Als Gegenleistung forderte Wegener Gehorsam, Verschwiegenheit, Zuneigung und Sex, was Juri nicht weiter schwerfiel, weil der väterliche Freund sich wirklich als kultiviert und großzügig erwies.
Juri fühlte sich nicht zu Männern hingezogen, aber er war experimentierfreudig und konnte Enthusiasmus und Leidenschaft vortäuschen, wenn es erforderlich war oder verlangt wurde.
Sein Gönner brachte Freunde mit ins Spiel, die ebenfalls Gefallen an Juri fanden und bereit waren, für seine Dienste zu bezahlen, etwa wenn er Sonderwünsche erfüllte.
Zum ersten Mal hatte Juri Zugang zu einer großbürgerlichen Lebensweise, regelmäßigem Essen, einem eigenen Zimmer mit Bad – lauter Annehmlichkeiten, die ihm völlig neu waren, der reinste Luxus.
Zudem war sein Sugardaddy – so nannten ihn die Freunde aus seiner Clique, mit denen er sich zuweilen immer noch traf – des Öfteren geschäftlich unterwegs, sodass Juri das ganze Haus für sich allein hatte und es sich gut gehen ließ.
War das die Gelegenheit, um sich von seinem alten Leben ein für alle Mal verabschieden zu können?
Er wusste es nicht, fügte sich aber, weil es so bequem und angenehm war. Und wesentlich weniger stressig als das Leben mit der Hand im Mund und als Straßenköter.
So etwas wie gesellschaftliche Normen hatte es für ihn, den notorischen Ausreißer und Außenseiter, sowieso noch nie gegeben. Nur Trotz, Misstrauen, Hass, Widerspenstigkeit.
Aber nun war er durch Zufall auf weiche Kissen gebettet, hatte Geld, glaubte nach einer Weile, seinen älteren Liebhaber um den Finger wickeln und ihn nach Lust und Laune beeinflussen zu können. Geschickt begann er, ihn zu manipulieren, weil er raffiniert genug war, um dessen Schwächen nach und nach zu durchschauen und ihn hemmungslos auszunutzen. Schließlich dachte er, Sugardaddy von sich abhängig gemacht zu haben und sich alles erlauben zu können.
Es war eine coole Zeit. Alles, was ihm zeitlebens verwehrt gewesen war, hatte er nun im Überfluss.
Der Traum von Ibiza war vorübergehend in weite Ferne gerückt. Warum sollte er abhauen, wenn er tun und lassen konnte, was er wollte, und zudem noch in Saus und Braus lebte?
Er hätte gewarnt sein sollen.
So ein Zustand war nichts für die Ewigkeit, aber weil es eine ganze Weile wie geschmiert lief, sah er keinen Grund, sich weiter mit Selbstzweifeln zu quälen oder daran auch nur einen Gedanken zu verschwenden.
Solange alles neu war und aufregend, auch und gerade für seinen Mentor und Gönner, so lange konnte er sich alles erlauben.
Bis zu dem Tag, als es zum großen Zerwürfnis kam.
Juri war selbst schuld daran, er hatte in Abwesenheit seines Gönners eine spontane Party für seine Freunde aus der Ausreißerszene gegeben, die völlig aus dem Ruder gelaufen war.
Zu viele Leute, zu viel Alkohol und Drogen, zu viel Randale.
Es kam, wie es kommen musste. Dr. phil. Wegener war dummerweise früher als geplant zurückgekehrt und hatte in seinem Zorn über die Verwüstungen und den Vertrauensbruch alle hochkant rausgeschmissen – auch Juri.
Plötzlich stand er wieder auf der Straße.
Aber diesmal nicht mit leeren Händen.
Er hatte vorgesorgt, sich in einem Versteck etwas Geld zusammengespart und bei einem Treffen mit einem neuen Liebhaber eine wertvolle IWC Da Vinci Perpetual gegen seine billige Kaufhausuhr umgetauscht, was dem sicher noch gar nicht aufgefallen war, weil er eine ganze Sammlung Luxuschronometer in automatischen Uhrenbewegern in Vitrinen im Schlafzimmer hatte.
Ihm hatte Juri auch den Ausweis gestohlen. Weil er ihm ein bisschen ähnlich sah. Der Freier war zwar über fünfzehn Jahre älter, aber bei flüchtigem Hinsehen würde das gar nicht auffallen. Jetzt hatte er einen anderen Namen und war dem Ausweis nach volljährig.
Marian Moisander.
Der Name gefiel ihm.
Der Rest war Schicksal.
Er war wissbegierig und hatte viel von seinen Gönnern gelernt, die ihn, nachdem er von Dr. phil. Wegener auf die Straße gesetzt worden war, in ihren gehobenen Kreisen, die bestens miteinander vernetzt waren, weiter herumreichten. Man kannte sich untereinander, es war beinahe wie eine Art Geheimbund, der peinlich darauf bedacht war, dass nichts von seinen Aktivitäten nach außen drang. Allen Mitgliedern war bewusst, dass das, was sie in ihren Zirkeln und bei gelegentlichen Treffs taten, in der Öffentlichkeit nicht gerade auf Verständnis gestoßen wäre. Sie hatten feste Regeln, die jeder einzuhalten hatte. Mitglied konnte nur werden, wer einen Zugang zur Nomenklatura hatte.
Die Nomenklatura bestand aus drei Männern.
Sie hatten die Regeln aufgestellt.
Regel Nummer zwei: Keiner von ihnen trieb sich auf obskuren Websites oder im Darknet herum.
Regel Nummer drei: Dates und Abmachungen wurden nur mündlich getroffen.
Erste und heiligste Regel: Keine Spuren im Internet oder per Handy. Nichts sollte überwacht oder zurückverfolgt werden können. Bei Treffen wurden vorher die Handys eingesammelt.
Wer diese Sicherheitsvorkehrungen ignorierte, war draußen.
Aufgebaut hatte dieses Imperium des Schattens Martin Rombach, zusammen mit seinem Freund Gottfried Hahn. Und Marian Moisander.
Ein paar Wochen nach dem Rauswurf bei Wegener machte Juri Bekanntschaft mit Rombach. Es war bei einer privaten Feier in der Villa eines bekannten Fernsehmoderators in Salzburg, als Rombach ihn ansprach und mit ihm auf einem Zimmer verschwand.
Damit begann der zweite entscheidende Abschnitt in Juris Leben.
Für Rombach war es Liebe auf den ersten Blick. Behauptete er jedenfalls.
Juri sollte zu ihm an den Bodensee ziehen. Er machte Juri ein Angebot, das dieser nicht ausschlagen wollte. Rombach war Immobilienmakler, hatte Geld und residierte in einem protzigen Anwesen bei Meersburg.
Juri bekam ein Apartment in der Nähe und musste dafür Rombach immer zur Verfügung stehen, wenn dem danach war und er gerade Zeit hatte.
Martin war also von nun an Juris neuer Gönner. Man hätte auch Zuhälter sagen können, aber Gönner klang wertneutraler. Es stimmte zwar, dass Rombach Makler war, aber das war nur Fassade. Was er vor allem vermakelte, waren sämtliche Spielarten von Sex. Und das war mindestens ebenso lukrativ und dazu noch um einiges aufregender, wenn man die entsprechenden Leute und ihre speziellen Vorlieben kennenlernte.
Juri war sein bestes Pferd im Stall. Für Geld war Juri zu allem bereit. Zweier mit oder ohne Ehemann, Dreier, Vierer: Er war universell einsetzbar, beklagte sich nie, tat, was auch immer von ihm erwartet wurde. Hauptsache, der Preis stimmte.
Juri hielt sich an die Abmachungen, weil er es nicht riskieren wollte, zum zweiten Mal einen goldenen Handschlag zu vermasseln. Er spielte das Spiel mit, das Martin von ihm verlangte, und er spielte es so gut, dass er immer öfter eingesetzt wurde, weil die Freier Gefallen an ihm fanden.
Bis zu dem Tag, als er Sandra kennenlernte und ihm klar geworden war, dass dies der Wendepunkt sein musste, auf den er die ganze Zeit schon gewartet hatte.
Wer einmal falsch abbiegt, kommt nicht zurück, heißt es.
Juri war gleich ein paarmal in seinem Leben falsch abgebogen.
Aber mit Sandra würde er wieder in die richtige Spur kommen.
Da war er sich sicher.
5
Sie hatten sich für weitere Surfstunden getroffen, Sandra hatte Juri ihre Telefonnummer gegeben. Ein Vertrauensbeweis, der Juri nicht etwa überraschte, ihn aber doch seltsam berührte, weil er spürte, dass da etwas Besonderes war, eine einzigartige Chemie zwischen ihnen.
Unter seiner Anleitung machte Sandra rasch Fortschritte auf dem Surfbrett, sie kamen sich näher, vertrauten sich mehr und mehr.
Schließlich verabredeten sie sich an einer einsamen Bushaltestelle.
Aber als sie dort aus verschiedenen Richtungen eintrafen, regnete es in Strömen. Sandra kannte ein nahe gelegenes Bootshaus im Schilfgürtel des Ufers.
Sie rannten los.
Bis sie ihr Ziel erreichten, waren sie beide klatschnass und völlig außer Atem.
Das Bootshaus war abgesperrt, aber Juri knackte im Handumdrehen das Schloss.
Sie froren und wärmten einander.
Eines kam zum anderen, es fügte sich einfach, es war für beide in diesem Augenblick die natürlichste Sache der Welt. Während der Regen auf das Dach prasselte, kam es Juri so vor, als hätte sich ihm eine neue Dimension aufgetan.
Sie waren völlig offen zueinander. Sandra beichtete, dass sie ihre Eltern verachtete und das Internat hasste.
Und Juri vertraute ihr zum ersten Mal die Wahrheit über seine Herkunft und Vergangenheit an, die ganze schonungslose Wahrheit. Es erschien ihm auf einmal wichtig, Sandra nicht zu belügen, er wusste nicht, warum, aber er konnte und wollte es einfach nicht. Nicht mehr.
Er empfand es als Erleichterung, dass er sich alles von der Seele reden konnte, was seit Jahren wie eine unsichtbare Zentnerlast auf ihm gelegen hatte.
Selbst wenn er jetzt nach seiner Generalbeichte fürchten musste, Sandra so vor den Kopf gestoßen zu haben, dass sie nichts mehr von ihm wissen wollte. Er hätte das sogar irgendwie verstehen können.
Aber dann geschah das Wunder: Sandra verachtete ihn nicht für das, womit er sich durchgeschlagen hatte. Im Gegenteil, sie tröstete ihn und bestärkte ihn in seinem Vorhaben, aus der ganzen Geschichte auszusteigen.
Sie schmiedeten Pläne, bis ihr gemeinsamer Entschluss feststand. Juri würde das nötige Kleingeld besorgen. Sobald er es hatte, würde er Sandra aus dem Internat holen. Sie würden die Fliege machen, und dann könnte die ganze Welt nur noch Kondensstreifen von ihnen sehen.
Hinein in den Horizont und darüber hinaus.
Wie die »Black Pearl« …
6
Das einschläfernde Plätschern des Bodenseereiter-Brunnens und das geistige Durchforsten alter und neuer Erinnerungen hatten Juri wie so oft in letzter Zeit in eine Art Trance versetzt, von der er sich manchmal kaum lösen konnte. Vor allem, wenn er – mit was auch immer – vorgeglüht hatte.
Und in dieser Nacht hatte er ordentlich vorgeglüht.
Weil er trotz allem vage eine böse Vorahnung verspürte. Dieses mulmige Gefühl im Solarplexus wurde er einfach nicht los.
Er schloss die Augen und schwor sich selbst darauf ein, positiv zu denken.
Er hatte Sandra, seinen Plan, einen Ausweis und die Aussicht auf Geld. Auf eine Menge Geld, bei seinen Forderungen an Martin Rombach war Juri nicht kleinlich gewesen. Weil er wusste, was der Mann auf der hohen Kante hatte.
Oder besser: auf mehreren hohen Kanten in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.
Martin Rombach konnte es sich leisten, auf Juris Geldforderungen einzugehen. Die Frage war eher, wie er reagieren würde. Ein einziges Mal hatte Juri miterlebt, wie Rombach vollkommen ausgerastet war und auf einen seiner Zöglinge, der nicht korrekt abgerechnet hatte, wieder und wieder erbarmungslos eingeschlagen hatte, obwohl der Junge schon wehrlos am Boden lag. Im letzten Moment konnte Juri eingreifen und Rombach wegziehen.
Es lief ihm heute noch kalt den Rücken herunter, wenn er sich Rombachs Augen bei diesem Vorfall in Erinnerung rief.
Sie waren schwarz vor ungezügelter Wut.
»Hey – Kakerlake!«
Die laute Stimme in seinem Rücken riss Juri aus seinen Gedanken.
Erschrocken drehte er sich nach dem Urheber der Stimme um, die er nur zu gut kannte.
Martin Rombach war wie aus dem Nichts aufgetaucht. Wahrscheinlich hatte Juri wegen des laut plätschernden Brunnens seine Schritte nicht gehört. Oder weil er wieder mal mit seinen Gedanken ganz woanders war.
Wie immer war Rombach wie aus dem Ei gepellt, er trug einen leichten Sommeranzug aus hellem Leinen, der sein Übergewicht einigermaßen kaschierte, weiße Sneakers und einen Strohhut, der seinem Auftreten etwas Gigolohaftes aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts verlieh. Eine »Kreissäge«, wie man den Hut nannte, Juri hatte sich diesen Begriff eingeprägt.
Sein geckenhafter Auftritt war pures Kalkül, Rombach hatte eine gewisse libidinöse Neigung für die Roaring Twenties aus dem Berlin der Weimarer Republik entwickelt, die er in seiner Freizeit gern zur Schau stellte. Sein Outfit war ein Zeichen seiner Individualität, so hatte er Juri einmal belehrt und dabei unverhohlen eine gewisse Eitelkeit und Hochnäsigkeit an den Tag gelegt. Obwohl – das machte er eigentlich immer.
»Hi, Martin«, brachte Juri heraus und versuchte dabei, nicht eingeschüchtert zu wirken, obwohl es ihm schwerfiel, weil Rombach einfach nur dastand und ihn musterte.
Juri sah in schwarze Augen.
Rombachs Gesicht war unbewegt, er sagte nichts, aber seine Miene und seine Haltung verrieten Juri, dass er kurz davor war, vollkommen auszurasten.
Beide versuchten, sich keine Blöße zu geben und den anderen niederzustarren.
»Wollen wir das hier abchecken?«, fragte Juri schließlich, weil er die Spannung nicht länger ertragen konnte.
Rombach machte sich scheinbar locker und gab sich auf einmal jovial.
»Nein, natürlich nicht. Wo denkst du hin. Geschäftliche Dinge dieser Größenordnung wickelt man doch nicht unter freiem Himmel ab … Kommst du?«
Er wies einladend zur nahen Parkbucht für Taxis, auf der um diese Zeit nur ein cremeweißer Jeep-SUV wartete.
Juri sah ihn erst jetzt.
Ein Mann war ausgestiegen und öffnete die Beifahrertür für ihn. Er war schlank und groß und lächelte einladend.
Juri erkannte ihn, es war Gottfried Hahn, der Duzfreund von Rombach. Sein Lächeln war so falsch wie das Toupet, das er trug. Er war Juri schon immer unsympathisch gewesen.
Dass sie entgegen der Abmachung plötzlich zu zweit auftauchten, gefiel ihm ganz und gar nicht. Er hatte ausdrücklich am Telefon verlangt, dass er sich nur mit Rombach am Bodenseereiter-Brunnen treffen wollte.
»Du hast mir gesagt, dass du allein kommst!«
»Hab ich das? Ich kann mich nicht erinnern. Ist das so wichtig?«
»Hast du mein Geld?«, fragte Juri verunsichert. »Oder hast du es nicht?«, fügte er hinzu, um Stärke zu demonstrieren. »Dann war’s das nämlich für mich. Und du bist geliefert.«
»Juri, Juri, Juri«, seufzte Rombach in einem Ton, der höchstes Mitleid suggerierte. »Warum so misstrauisch? Was in Gottes Namen ist bloß aus dir geworden?«
»Das, was du aus mir gemacht hast.«
Für einen kurzen Augenblick zeigte Rombach sein wahres Gesicht hinter der aufgesetzten Souveränität. Mühsam kaschierte Feindseligkeit kombiniert mit einem Schuss Vorfreude auf verlockende Grausamkeiten.
Die Augen schwarz wie Kohle.
»Komm mir jetzt bloß nicht auf die Tour! Damit sind wir durch.«
Juri überging die Warnzeichen. Er durfte keine Schwäche zeigen.
Jetzt nicht.
»Ja. Das sind wir. Also, wo ist mein Geld?«
»Doch nicht hier. Wenn du haben willst, wovon du glaubst, dass es dir zusteht, dann musst du schon mitkommen und mir vertrauen. Apropos: Wo ist dein Teil der Abmachung?«
Juri zog einen Stick aus der Tasche und zeigte ihn demonstrativ vor.
Rombach nickte und wies erneut auf den Wagen mit dem offenen Schlag. Er wartete nicht ab, drehte sich um und ging voran zu seinem Partner, der immer noch am Wagen stand.
Juri bewegte sich nicht vom Fleck.
Wenn das eine Falle war …
Rombach stellte sich neben Hahn und verschränkte seine Arme, ohne Juri aus den Augen zu lassen.
»Was machen wir, wenn er nicht freiwillig einsteigt?«, fragte Hahn leise.
»Glaub mir: Er wird einsteigen.«
Aber Juri zögerte immer noch.
»Findest du nicht«, sagte Rombach, »dass er aussieht wie ein kleines Kind, wenn er sich fürchtet?«
Hahn nickte zustimmend. »Na ja – er hat ja auch allen Grund dazu.«
»Ja, das hat er«, bestätigte Rombach und setzte sein einladendes Lächeln auf. Es passte irgendwie gut zu seinem kecken Hut. Der »Kreissäge«.
Und war genauso verlogen wie seine ganze Attitüde.
Er war wie eine fleischfressende Pflanze, die ihre hinterhältige Schönheit und die Aussicht auf Belohnung nur einsetzt, um ein Insekt in die tödliche Falle zu locken.
Jetzt bewegte sich Juri endlich doch auf die beiden zu. Sein Solarplexus meldete sich wieder.
Weil sie zu zweit waren. Und überhaupt …
Aber er hatte sich entschieden, die Angelegenheit hier und jetzt durchzuziehen.
Nimm dir, was du kriegen kannst, dachte er entschlossen, stieg ohne ein weiteres Wort auf der Beifahrerseite ein und zog die Tür zu. Aber lass dich nicht erwischen!
Rombach setzte sich ans Steuer.
Hahn schob sich auf den Rücksitz hinter Juri, was diesem sofort eine zweite Woge mulmigen Bauchgefühls verschaffte.
»Gib mir dein Handy!«, sagte Hahn und streckte die Hand aus.
Juri befolgte die Anweisung und händigte Hahn sein Smartphone aus.
Er hätte auf seinen Solarplexus hören sollen.
Aber jetzt war es zu spät.
Die roten Rückleuchten des SUV verschwanden stadtauswärts in der Nacht.
Der Brunnen plätscherte munter weiter.
Der Bodenseereiter Martin Walser war wieder allein mit sich und seinem grimmigen Blick in weite Ferne. Eine Ferne, die nichts Gutes für die Zukunft verhieß.
Er musste es schließlich wissen, als Dichter und Denker.
Neun Wochen später
7
Im nächtlichen Großraumbüro des Polizeipräsidiums Friedrichshafen brannte noch Licht.
Eine einsame Gestalt mit blonder Kurzhaarfrisur und einem schwarzen T-Shirt mit dem roten Aufdruck »MISFITS« saß vor einem Computer und bearbeitete mit Höchstgeschwindigkeit die Tasten ihres Keyboards.
Kriminaloberkommissarin Harriet Holtby war dabei, ihren Abschlussbericht zu verfassen. Er war ziemlich umfangreich geraten, aber der Fall des Armbrustschützenmörders und skrupellosen Entführers, der sie und Kommissar Max Madlener bis an ihre Grenzen gebracht hatte und darüber hinaus, erforderte gründliche und aufwendige Nachbearbeitung.
Mit vier Toten und dem Showdown in einer Tankstellenexplosion am Stadtrand von Friedrichshafen, die ihren Freund und Kollegen Madlener beinahe das Leben gekostet hatte, war er so extrem und außergewöhnlich und erregte so viel Aufmerksamkeit in sämtlichen Medien europaweit, dass es unabdingbar war, jede Einzelheit und jeden Nebenaspekt ihrer Ermittlungen und deren Folgen schriftlich festzuhalten.
Harriet hatte fast die halbe Nacht durchgearbeitet, weil sie ihren Bericht vor der Weitergabe an ihre Vorgesetzten und die Staatsanwaltschaft mit Madlener durchgehen wollte, der sich im Krankenhaus von seinen Verletzungen erholte. Er hatte bei der Explosion doch einiges abbekommen – dabei hatte er noch unverschämtes Glück gehabt.
Sie ebenfalls – viel hatte nicht gefehlt, und der Killer mit der Armbrust, der sie schon mit seiner Waffe aufs Korn genommen hatte, hätte sie ins Jenseits befördert.
Beim Gedanken an diese ganz spezielle Nahtoderfahrung unterbrach sie ihre Arbeit und sah auf die Uhr: Es war schon weit nach Mitternacht.
Sie suchte nach einer bürokratisch korrekten Formulierung für diesen Moment, in dem sie mit dem Leben abgeschlossen hatte, weil sie mit Handschellen an einen Baum im Wald gefesselt nur darauf wartete, jeden Augenblick einen Pfeil in den Rücken geschossen zu bekommen.
Selbstverständlich wollte sie in ihrem Bericht nicht emotional werden, sondern streng sachlich im üblichen nüchternen Polizeijargon bleiben, das konnte sie, schließlich hatte sie das gelernt und verinnerlicht. Aber jetzt musste sie doch innehalten, weil die Erinnerung daran ein lange zurückliegendes Ereignis wieder hochkommen ließ, das ihr weiteres Leben geprägt und sie nie mehr ganz losgelassen hatte.
Es war ein traumatisches Erlebnis, das unter ähnlichen Umständen stattgefunden hatte – eine Nacht im Wald, hilflos ausgeliefert, gefesselt, mit der permanenten Angst im Nacken, bei Anbruch des Tages getötet zu werden.
War etwas noch Schlimmeres vorstellbar?
Ja, das war es, das wusste Harriet nur zu gut.
Der Ausdruck »Todesangst« konnte nur annähernd das ausdrücken, was sich ihr damals – vor vierzehn Jahren – unauslöschlich eingebrannt hatte.
Fast niemand wusste davon, sie hatte nur ein Mal mit ihrer Tante darüber gesprochen.
Nicht einmal Madlener, obwohl er der einzige Mensch auf der Welt war, dem sie rückhaltlos vertraute. Ohne Wenn und Aber. Eigentlich …
Erst jetzt merkte sie, dass ihre Augen brannten, und das lag nicht nur daran, dass sie seit Stunden vor dem Computerbildschirm saß.
Sie sicherte die Datei, ließ sie ausdrucken, packte ihren Rucksack und die Lederjacke und machte sich mit ihrem Motorrad auf den Weg nach Immenstaad, wo sie ein paar Kilometer von Friedrichshafen entfernt ihr Apartment hatte.
Dort versicherte sie sich mehrfach, dass sie ihre Wohnungstür auch wirklich abgesperrt und verriegelt hatte, trank ein Glas warme Milch, kroch in ihr Bett, zog die Decke über den Kopf und versuchte einzuschlafen.
Normalerweise hatte sie sich selbst und ihre Gedanken perfekt unter Kontrolle. Gegebenenfalls war sie sogar in der Lage, wie auf Knopfdruck abzuschalten.
Aber in dieser Nacht funktionierte das nicht.
Dazu war sie einfach zu sehr aufgewühlt.
Je mehr sie sich abmühte, in den Schlaf zu sinken, desto mehr spielte ihr Kopf verrückt.
8
Vierzehn Jahre war es jetzt her.
Harriet hatte die Nacht nie vergessen.
Nicht nur, weil sie ein eidetisches Gedächtnis hatte. Sondern weil es mit Abstand die schlimmste Nacht ihres Lebens gewesen war.
Aber die Erinnerung an diese Nacht und den darauffolgenden Tag hatte sie im Mare Tranquillitatis weggesperrt.
Ihrem geistigen Verlies für Gedankengift.
Sie war fast noch ein Kind gewesen, jedenfalls körperlich, geistig war sie allen Jungs weit voraus, als sie fünfzehn war. Wieder einmal war sie von zu Hause – einer der zahlreichen Pflegefamilien, die sie als Kind und Teenager durchlaufen hatte – ausgerissen und hatte sich ziellos herumgetrieben. Bis sie nachts nach ein paar spendierten Drinks auf dem dunklen Parkplatz einer Dorfdisco zusammengebrochen und erst viel später wieder aufgewacht war.
Umgeben von hohen, dunklen Bäumen, in denen der Wind raunte.
Das laute Krächzen eines Raben und die ebenso laute Antwort seines schwarzen Kollegen hatten sie geweckt.
Wie sie mitten in einen Wald gekommen war, wo sie jetzt auf dem bemoosten Boden lag, das wusste sie nicht mehr, sosehr sie sich auch den Kopf zerbrach. Irgendwie musste sie betäubt worden sein. Sie hatte einen scheußlichen Geschmack im Mund und pochende Kopfschmerzen, außerdem war ihr schwindlig und speiübel. Sie versuchte, indem sie mehrmals tief einatmete, gegen den aufsteigenden Brechreiz anzukämpfen, aber die Kontraktion in ihrem Bauch kam so plötzlich, dass sie ihm nichts mehr entgegensetzen konnte und sich heftig übergeben musste. So oft, bis sie schließlich nur noch Galle hervorwürgte und ihre Bauchmuskeln schmerzten. Als sie endlich wieder Luft bekam und sich erschöpft rückwärts auf den Boden wälzte, begann sie zu zittern, weil sie erbärmlich fror, und schlang die Arme um den Körper.
Wenn sie senkrecht hochschaute, konnte sie zwischen den kirchturmhohen Fichtenstämmen die vorüberziehenden Wolkenfetzen sehen, die zwischenzeitlich den Mond verdunkelten.
Mühsam stemmte sie sich hoch, um von hier wegzukommen, doch schon nach zwei Schritten wurde sie grob zu Boden gerissen, und ein heftiger Schmerz durchfuhr ihren rechten Knöchel. Erst jetzt stellte sie fest, dass sie einen Drahtring um ihren rechten Fuß hatte, der mit einer langen Kette am Baum hinter ihr befestigt war.
Ihr Herz raste, wie von Sinnen zerrte sie an der Kette und schrie vor lauter blindwütigem Zorn.
Aber es half nichts.
Niemand außer den zwei Raben konnte sie hören.
Sie zog und riss so lange ergebnislos an der Kette, bis sie vor Erschöpfung wieder zurück ins weiche Moosbett sank.
Jetzt, wo der Zorn sich ausgetobt hatte und sie wieder halbwegs klar denken konnte, pulste auf einmal aufkeimende Furcht durch ihre Adern.
Sie dachte daran, dass Wölfe, wenn sie mit einem Lauf in eine Falle geraten waren, sich lieber das Bein abbissen, als darauf zu warten, vom Jäger erlegt zu werden.
Angst brandete in ihr auf.
Bodenlose Angst, die größer und peinvoller war als jede Panikattacke.
Sie machte sich so klein wie möglich und lehnte sich in Embryonalhaltung an eine dicke Wurzel des Baumes, an den sie angekettet war.
Sie schloss die Augen und zitterte vor sich hin. Es war nicht nur die Kälte, die den unbeherrschbaren Tremor ausgelöst hatte.
Ein erster Sonnenstrahl, der zwischen den Baumwipfeln hindurchstach, weckte sie am frühen Morgen. Sie blinzelte ihn an und richtete sich auf.
Irgendwann musste sie trotz allem eingeschlafen sein.
Ihr war eiskalt, ihr Kopf dröhnte, ihr Mund war völlig ausgetrocknet, jeder Knochen und ihre Bauchmuskulatur taten ihr weh.
Mühselig quälte sie sich hoch und lauschte, ihr Atem kondensierte in der kalten Luft.
Ein Geräusch war zu hören, das zunehmend lauter wurde.
Es klang wie ein Motor.
Ganz in der Ferne, zwischen den unendlich vielen Baumstämmen, tauchten im Zwielicht zwei Scheinwerfer auf und kamen näher.
Harriet machte ein paar Schritte darauf zu, soweit es die Kette zuließ, und fing verzweifelt an zu winken und zu schreien.
Entsetzt musste sie feststellen, dass das Auto einfach weiterfuhr, was sie erst recht motivierte, noch lauter zu schreien und mit ihren Armen zu rudern.
Als sie schon die Rücklichter aufleuchten sah, hielt der Wagen doch noch an und setzte wieder ein Stück zurück.
Harriet konnte ihr Glück kaum fassen. Was hatte sie doch für ein Massel, dass mitten im Nirgendwo zufällig ein Auto vorbeikam, vielleicht ein Förster oder Waldbesitzer.
Jedenfalls irgendjemand, der ihr helfen würde.
Wieder winkte sie und rief.
Das Auto, ein großer Pick-up, hielt an.
Sie sah drei Männer aussteigen. Dazu hörte sie Hundegebell.
Sie schwenkte beide Arme und schrie, so laut sie konnte: »Hallo! Hierher! Helft mir!«
Die Männer mussten sie hören und sehen. Aber seltsamerweise machten sie keinerlei Anstalten, auf sie zu reagieren. Oder ihr wenigstens einmal zuzuwinken, um ihr zu zeigen, dass sie bemerkt worden war.
Sie wunderte sich, dass die drei mit ihrem Hund dort am Pick-up herumstanden und erst irgendetwas von der Ladefläche holten und verteilten, bevor sie schließlich auf sie zukamen.
Harriets grenzenlose Erleichterung wurde in Sekundenbruchteilen zu Panik. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie erkannte, dass die Männer Gewehre in der Hand hielten und Mützen mit Schlitzen für Augen und Mund über den Kopf gezogen hatten. Der riesige Hund knurrte und zerrte an seiner Leine, die von einem der Männer stramm gehalten werden musste.
Harriet kannte die Rasse nicht, aber es reichte ihr, zu sehen, wie groß er war und wie er die Zähne fletschte.
Plötzlich wusste sie wieder, wie sie hier gelandet war: Sie war in der Nacht auf dem Parkplatz hinter der Disco gewaltsam auf die Ladefläche des Pick-ups bugsiert worden, und dort hatte sie endgültig das Bewusstsein verloren. Irgendwie hatte sie das alles nur noch wie durch einen Nebel wahrgenommen, als wäre sie in Watte gepackt.
Aber an eines konnte sie sich noch genau erinnern: an die Gestalten der drei Männer auf dem Hinterhofparkplatz.
Einer der drei hatte sie in der Disco im flackernden Licht einer Stroboskopkugel offensiv angetanzt, sie hatte ihn ignoriert. Er war attraktiv, obwohl er eine Stirnglatze hatte. Aber er gab nicht auf und lud sie an seinen Tisch auf einen Drink ein, wo zwei Kumpels von ihm saßen. Sie ließ sich schließlich dummerweise zum Trinken überreden, aber als die drei zu aufdringlich wurden, setzte sie sich unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, über den Hinterausgang ab.
Weit war sie jedoch nicht gekommen, plötzlich war ihr schwindlig geworden, und alles drehte sich. Sie musste sich in den Kies setzen und kippte um.
Es mussten dieselben drei Typen sein, die jetzt durch den Wald gemessenen Schrittes auf sie zusteuerten. Je näher sie kamen, desto klarer wurde es ihr, dass sie nichts Gutes im Schilde führten. Sie wirkten wie ein Exekutionskommando mit dem Auftrag, sie zu liquidieren.
Der Hund zerrte an seiner Leine, und Harriet zerrte an ihrer Kette, aber dann beschloss sie, sich zu stellen und sich wie eine Wildkatze zur Wehr zu setzen.
Was anderes blieb ihr nicht übrig.
Dazu packte sie den nächstbesten Ast und nahm eine Kampfposition ein, die sie in einem Martial-Arts-Film gesehen hatte. Sie würde ihre Haut so teuer wie möglich verkaufen.
Die drei Männer blieben in gebührendem Abstand stehen und musterten sie erst einmal.
Richtig unheimlich aber war, dass sie die ganze Zeit kein Wort sagten.
Nur der Hund kläffte wütend.
Anscheinend hatten sie sich längst vorher abgesprochen, was sie mit Harriet anstellen würden.
»Aus!«, befahl der Mann mit dem Hund scharf.
Der Hund hörte auf zu bellen, knurrte nur noch bedrohlich und fletschte die Zähne.
Es kam Harriet vor, als würde er grinsen. Weil er sich schon auf das freute, was jetzt passieren würde.
9
Wenn Harriet sich an etwas erinnern wollte, und sei es auch nur eine belanglose Einzelheit in ihrer bewussten Vergangenheit, visualisierte sie, dass sie einen riesigen Gedächtnispalast in ihrem Kopf hatte, in dem sie nach Belieben herumgeistern konnte.
Normalerweise fiel ihr mühelos und auf der Stelle ein, wie ein Name zu einem Gesicht lautete, das sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte; was der exakte Inhalt ihres Rucksacks war, den sie ständig mit sich herumschleppte; wie die genaue Nummer der Akte lautete, die ihr Kollege Madlener in seinem Chaos auf dem Schreibtisch suchte, und wo er sie abgelegt hatte; oder wie die letzte Stellung ihrer Schachfiguren war, wenn sie die berühmte sechste Partie von Weltmeister Spasski gegen seinen Herausforderer Fischer im Jahr 1972 in Reykjavík auf Island nachspielte. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte sich Fischer für das Damengambit als Eröffnung entschieden, und Spasski verlor, obwohl er mit seiner geliebten Tartakow-Variante dagegenhielt. Es war mitten im Kalten Krieg der Supermächte UdSSR und USA, und der Russe Boris Spasski und sein Gegner, der verrückte Amerikaner Bobby Fischer, fochten ihn stellvertretend für eine hysterische Öffentlichkeit auf den vierundsechzig Schachfeldern aus.
Harriet konnte die Züge vieler Klassiker im Kopf nachspielen und brauchte kein Brett und keine Figuren dazu. Das machte sie mit legendären Schachpartien immer im Bett, wenn sie nicht einschlafen konnte.
Sollte ein Ereignis, das weiter zurücklag und über das sich im Laufe der Zeit so etwas wie ein geistiger Mehltau gelegt hatte, wieder vor ihrer inneren Leinwand ablaufen, brauchte sie sich nur in ihrem Gedächtnispalast, den sie sich vorstellte wie die unendlich scheinende geheimnisvolle Oktogonbibliothek des benediktinischen Klosters im Film »Der Name der Rose«, in die entsprechende Zeitebene zu begeben, wo alle ihre Erinnerungen schön chronologisch in endlosen Regalreihen untergebracht waren. Die Räume in der imaginären Bibliothek waren unterschiedlich groß und unterschiedlich ausgestattet. Manche riesig wie ein gotisches Kirchenschiff, manche im Rokokostil elegant, weiß-golden und verschwenderisch wie die Anna-Amalia-Bibliothek, manche wie das in der Grafik »Treppauf Treppab« von M. C. Escher entworfene Labyrinth aus Treppen, die im Nichts endeten oder in einer unlogischen perspektivischen Surrealität wieder zum Ausgangspunkt zurückführten.
Oder die Räume waren einfach nur schnörkellos und schlicht wie ein zweckmäßiges Büro mit Billy-Regalen an den Wänden.
Jeder dieser Räume war ein Zeitabschnitt ihres Lebens. Manche davon betrat sie selten oder nie. Manche nur, wenn es unumgänglich und notwendig war.
Ihre Erinnerungen stellte sie sich wie auf Festplatten abgelegt vor, so wie im Raumschiff »Discovery« aus dem Film »2001 – Odyssee im Weltraum« in der Abteilung der künstlichen Intelligenz des Computers HAL. Dessen gesamtes Wissen und einprogrammiertes Verhalten in jeglicher nur denkbaren Konstellation konnte mit einem leichten Fingerdruck auf eines von Tausenden CD-großen Speichermedien herausgefahren werden und stand für Harriets Kopfkino zur freien Verfügung.
Sie liebte diese bildhaften Vorstellungen, die sie nach Belieben visualisieren konnte. Sie hatte sie für ihre innere Art der Mnemotechnik entworfen, weil sie etwas Spielerisches, aber auch gleichzeitig etwas Konkretes und Fassbares hatten.
Es war, als würde man in einem Video mit Fast-Forward- und Rewind-Taste nach einer bestimmten Stelle suchen und, sobald man sie gefunden hatte, es anhalten, beliebig vergrößern und abscannen. Oder es so lange in Zeitlupe ablaufen lassen, bis man gefunden hatte, was man suchte.
Das alles ging, wenn Harriet sich konzentrierte, in Lichtgeschwindigkeit vor sich, ohne große Anstrengung.
Normalerweise.
Aber es gab auch tief im Inneren des Gedächtnispalastes, versteckt wie die Grabkammer des Pharao in der Cheopspyramide, ein hermetisch abgeschlossenes Geheimverlies, in dem die toxischen Ereignisse ihres Lebens untergebracht waren wie in einem Tresor, zu dessen Zugang eine Zahlenkombination gehörte, die scheinbar verloren gegangen war.
Weil die einzig Zugangsberechtigte, Harriet Holtby, dessen Inhalt gewaltsam verdrängt hatte, indem sie ihn für alle Zeiten auf den Grund des Ozeans ihres Unterbewusstseins verbannte, dem sie den Namen Mare Tranquillitatis gegeben hatte. Nach der trostlosen Geröllwüste auf dem Mond.
Und genauso weit weg.
Weil es zu schmerzhaft war, diese Tresortür zu öffnen.
Bevor sie zuließ, dass diese Erinnerungen wieder auftauchten und sie mit ihrem Gift fluteten, wollte sie lieber sterben.
Und nun, ohne ihr Zutun, war die normalerweise hermetisch verschlossene Tresortür einfach aufgesprungen, Harriet konnte nichts dagegen tun.
Die Bilder, lange weggesperrt, kamen erbarmungslos herangerollt wie ein Tsunami.
Nichts konnte sie aufhalten.
10
Harriet zitterte wie Espenlaub, obwohl sie sich die wärmende Bettdecke bis über den Kopf gezogen hatte.
Krampfhaft war sie versucht, an alles zu denken, nur nicht an die Geschehnisse von damals.
Aber es war so, wie sie es befürchtet hatte. Die Rekapitulation der Ereignisse um die Bedrohung durch den Armbrustschützenkiller waren der Auslöser für ihr Déjà-vu aus den Tiefen des Mare Tranquillitatis.
Je mehr sie sich abmühte, sich etwas anderes durch den Kopf gehen zu lassen, desto stärker kochten die unseligen Erinnerungen hoch.
Wie sie wie von Sinnen blindlings durch den Wald gehetzt war, nachdem sie einer der Männer mit einem Schlüssel von der Kette befreit hatte. Sie konnte sein Aftershave riechen, so nah war er ihr gekommen. Der penetrante Geruch nach Old Spice war ihr schon in der Disco aufgefallen.
Wie sie gar nicht mehr darauf geachtet hatte, dass im Weg stehende Zweige ihr ins Gesicht schlugen und blutige Kratzer auf Stirn und Wange hinterließen.
Wie sie sich immer wieder in Panik nach den Jägern umgeschaut hatte, ob sie schon hinter ihr her waren.
Schließlich war sie völlig ausgepumpt stehen geblieben, um wieder Luft zu bekommen und sich überhaupt erst einmal zu orientieren.
Aber woran?
Die Bäume sahen alle gleich aus. Ein paar Lichtflecken fielen durch das nahezu undurchdringliche Nadeldach, und irgendwo in der Richtung, in der die Sonne aufgegangen war, musste Osten sein.
Doch das nutzte ihr nicht viel.
Sie setzte sich wieder in Bewegung und rannte auf eine Stelle zu, wo die Bäume nicht so dicht standen.
Jetzt bekam sie auch noch heftiges Seitenstechen. Sie musste stehen bleiben und hielt keuchend Ausschau nach einer Anhöhe, irgendeinem höher gelegenen Standpunkt, von dem aus sie sich einen Überblick über die Gegend verschaffen konnte. Vielleicht machte sie eine befahrene Straße ausfindig oder einen Einödhof, von dem aus sie telefonieren konnte.
Langsam ging sie weiter, Augen und Ohren in Alarmbereitschaft.
Als sie plötzlich ein heftiges Rascheln hörte und unmittelbar vor ihr ein Vogel aus einem Gebüsch hochflatterte, zuckte sie vor Schreck zusammen und spürte, wie ihr Herz für einen Moment aussetzte.
Sie änderte ihre Taktik und fing an, im Zickzack zu laufen wie ein Hase auf der Flucht.
Auf einmal vernahm sie Rufe. Sie klangen so, als kämen sie von weit her, hinter ihr. Dann wieder waren sie vor ihr.
Aber im Wald war der Akustik nicht zu trauen, das Echo konnte sie leicht verfälschen.
Harriet hatte auf einmal den Eindruck, als ob die Schreie aus allen Richtungen gleichzeitig kamen.
Es waren die typischen Rufe, mit denen die Treiber einer Jagdgesellschaft das Wild aufscheuchten, um es direkt vor die Flinten der lauernden Jäger zu hetzen.
Und nun hörte sie auch noch andere Geräusche, die sich von allen Seiten zu nähern schienen.
Sie hallten durch den ganzen Wald und peitschten wie Schüsse.
Es waren Schläge von Stöcken gegen die Baumstämme.
Verstecken!, schoss es ihr durch den Kopf. Du musst dich verstecken!
Sie stolperte auf eine Felsformation zu, als ihr einfiel, dass diese Männer einen Hund dabeihatten.
Verstecken war sinnlos.
Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass die Geräusche überall um sie herum waren.
Die Rufe und die Schläge.
Und sie kamen näher und näher.
Jetzt wusste sie, wie sich ein in die Enge getriebenes Wild fühlen musste.
Sie drehte sich im Kreis, und da sah sie es.
Sie war im Mittelpunkt eines Dreiecks, das die Männer um sie herum gebildet hatten und von dessen Eckpunkten aus sie immer weiter vorrückten.
Ein Entkommen war nicht mehr möglich.
Sie hatten das Wild gestellt.
Hätten sie keine Masken getragen, dann hätten sie ein widerliches Grinsen im Gesicht gehabt, da war sich Harriet sicher.
Ihre Stöcke hieben sie wie zum Spaß weiter gegen die Baumstämme.
Aber es war kein Spaß.
Es war bitterer Ernst.
11
Obwohl er die Intensivstation verlassen hatte und nicht mehr an die blinkenden und oszillierenden Apparaturen angeschlossen war, die ihn in seinen halbwachen Zuständen denken ließen, Aliens hätten ihn entführt und ihn zum Versuchskaninchen auserkoren, konnte Madlener in seinem Einzelzimmer trotz der Medikamente, die ihm verabreicht worden waren, nicht so tief und erholsam schlafen, wie er sich das gewünscht hätte.
Die Synapsen in seinem Gehirn fuhren Achterbahn. Zu viel ging ihm im Kopf herum. Nicht nur, dass er den Ablauf dessen, was der Explosion der Tankstelle vorausgegangen war, die ihn ausgeknockt, auf die Bretter geschickt und ihn anschließend auf die Intensivstation des Klinikums befördert hatte, immer und immer wieder im Halbdelirium durchdeklinierte – er konnte einfach nicht zur Ruhe kommen und abschalten.
Schon der erste Tag, nachdem er auf ein Einzelzimmer auf der normalen Station verlegt worden war, war alles andere als besonders erholsam gewesen.
Losgegangen war es mit der Visite: Auftritt des Chefarztes Dr. Würtz samt Gefolge in aller Herrgottsfrüh.
Zu neunt versammelten sie sich mit ihren weißen Kitteln und besorgten Mienen um sein Bett und sahen ihr Studienobjekt – Max Madlener – mit ernsten Gesichtern an, so als würden sie ihm im besten Fall noch ein oder zwei Tage geben.
Der Chefarzt übernahm sofort das Kommando.
»Morgen, Morgen«, sagte er forsch-fröhlich.
Kriminalhauptkommissar im Krankenstand Max Madlener war gerade damit beschäftigt, sein schlichtes Frühstück zu begutachten, und nickte nur in banger Erwartung dessen, was jetzt kommen würde.
»Haben Sie Schmerzen?«, fragte Dr. Würtz.
»Nur wenn ich lache«, antwortete Madlener mit todernstem Gesicht. Nach Lachen war ihm wahrlich nicht zumute.
Dr. Würtz sah ihn irritiert an.
Madlener konkretisierte: »Die Rippen …«
»Verstehe.« Dr. Würtz nickte. »Lassen Sie sich nicht stören, machen Sie ruhig weiter«, murmelte er und widmete sich den Blättern auf einem Klemmbrett, das ihm ein Assistent gereicht hatte.
Madlener zuckte mit seinen Achseln, ignorierte die Blicke, die auf ihn gerichtet waren, und rätselte beim Anblick seines Tellers, ob sie ihn ungefragt auf Diät gesetzt hatten oder ob das, was er auf dem Plastiktablett kredenzt bekam, normale Krankenhauskost war. Doch er hatte Appetit, was er als positives Zeichen deutete, und bestrich eine seiner zwei Scheiben Graubrot sorgfältig mit Butter und Erdbeermarmelade aus Plastikdöschen mit widerspenstigen Aludeckeln, was ihn an seinen mehrjährigen Aufenthalt im Drei-Sterne-Hotel »Zum silbernen Zeppelin« und den dortigen Frühstücksraum erinnerte.
Die zweite Scheibe belegte er mit etwas, das ansatzweise nach Wurst aussah, jedoch olfaktorisch und geschmacklich eher an gepresste Sättigungsbeilage mit Geschmacksverstärker erinnerte. Aber er beklagte sich nicht, weil er froh war, überhaupt noch unter den Lebenden zu weilen.
Er nahm einen Schluck von seinem dünnen, vermutlich koffeinfreien Kaffee, biss herzhaft in sein Marmeladenbrot und harrte kauend der Dinge, die der Chefarzt, der mit seiner dicken Brille immer noch Madleners Werte auf dem Klemmbrett studierte, ihm mitzuteilen gedachte.
»Schön, schön«, brummte Dr. Würtz kryptisch, bevor er das Klemmbrett zurückreichte, seine Brille auf die Stirn schob und Madlener mit vor dem Bauch gefalteten Händen ansah wie ein Bischof vor der Osterpredigt seine Schäflein.
»Wie fühlen Sie sich, Herr Madlener?«, fragte er, während Madlener sich schnell an sein nicht eindeutig zu spezifizierendes Wurstbrot machte und sich dabei noch beinahe verschluckt hätte, weil er sich des Ernstes der Lage endlich bewusst geworden war. Das hätte gerade noch gefehlt – ein schmerzhafter Hustenanfall mit seinen angeknacksten Rippen! Und das auch noch vor den Augen der versammelten Ärzteschaft!
Er musste alles tun, um hier rauszukommen, und durfte sich nicht die geringste Blöße geben.
Hastig schlürfte er an seinem inzwischen lauwarmen Heißgetränk, was auch nicht gerade angenehm war mit seiner angegriffenen Speiseröhre, und bekam seinen Hals wieder reizfrei.