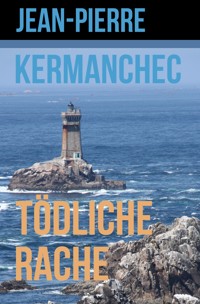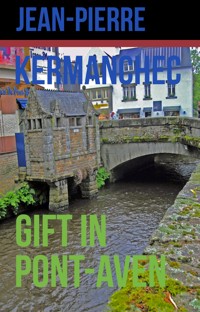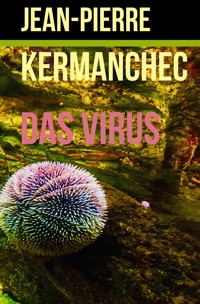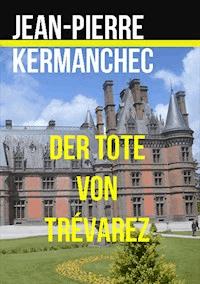Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kommissar Kerber erhält von seinem langjährigen luxemburgischen Freund, Georges Ehinger, eine Einladung in die Normandie. Carla, seine Frau, freut sich mit ihm einige private Tage verbringen zu können. Kurz vor dem Urlaubsantritt bittet ihn sein Chef, Nourilly, an einer Tagung aller Leiter der Kommissariate aus der Region Bretagne und Normandie in Avrange teilzunehmen. Da Avrange nur wenige Kilometer von dem geplanten Urlaubsort entfernt liegt, willigt er nach anfänglichem Zögern ein. Er wird nur an zwei Tagen in Avrange an der Konferenz teilnehmen müssen. Die Abende kann er mit Carla und Georges gemeinsam verbringen. Am Abend des ersten Konferenztages sitzen Ewen und Georges bei einem Glas zusammen. Carla hat sich bereits ins Schlafzimmer zurückgezogen. Plötzlich werden sie vom Knall eines Schusses, unmittelbar hinter dem Anwesen von Georges, aufgeschreckt. Sie informieren umgehend die Gendarmerie und warten auf deren Eintreffen. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden was passiert ist. Schon nach wenigen Minuten treffen sie auf die Leiche einer jungen, muslimischen Frau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Pierre Kermanchec
Das Mädchen vom Bois Avenel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Epilog
Andere Kriminalromane des Autors:
Kinderroman des Autors:
Vorankündigung:
Impressum neobooks
Kapitel 1
Das Mädchen vom Bois Avenel
Jean-Pierre Kermanchec
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Menschen, sind rein zufällig.
Impressum
© 2015 Jean-Pierre Kermanchec und Ulrike Müller
Covergestaltung: Atelier Meer Kunst, Oetrange
Luxemburg
Gewidmet meinem Freund,
Georges Henri Germain Schmit
In tiefer Dankbarkeit für seine Unterstützung und seine Freundschaft. Ohne ihn wäre dieser Roman nie entstanden und der Bois Avenel hätte keine Erwähnung gefunden.
Du hast die verlassen die du liebst, um die zu treffen die du geliebt hast.
A´ischa Bakhta trat aus dem großen Tor der Haftanstalt des 9. Arrondissements von Marseille, besser bekannt als Prison des Baumettes, und genoss zum ersten Mal seit Langem wieder die Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht. Sie ließ ihren Blick von links nach rechts schweifen und betrachtete dieses veraltete, dunkle und ungesunde Gemäuer, das in den letzten sechs Monaten ihr Zuhause gewesen war. Ganz schnell wollte sie diese Umgebung vergessen. Ihre vier auf zwei Meter große Zelle, mit der metallenen Kloschüssel und dem kleinen Waschbecken, dem alten Eisenbett, mit der viel zu dünnen Matratze, auf der sie beständig den Gitterrost gespürt hatte und das kleine Wandbord, auf dem sie das Bild von ihrem Freund Walid aufgestellt hatte, konnte sie nun endlich vergessen. Jetzt sah sie die strahlende Sonne, die sie in den letzten Monaten nur durch die Gitter des winzigen Fensters betrachtet hatte. Von ihrer Pritsche aus hatte sie nur auf die Zellentür geblickt. Eine Stahltür, mit einem kleinen Sehschlitz und einer Klappe davor, die von Zeit zu Zeit von einer Aufseherin geöffnet wurde, um einen Blick in ihre Behausung und auf ihre Intimität werfen zu können, so als wollte die Aufseherin sich an dem Anblick ergötzen oder erheitern.
Dieses Zuhause war keine freiwillig gewählte Wohnstätte gewesen, sondern eine erzwungene Stätte, eine forcierte, eine fremdbestimmte und in ihren Augen eine Brutstätte von Gewalt und Hass. Ein Haus, in dem sich alle nur erdenklichen Schicksale versammelt hatten, um die Gesellschaft anzuklagen, die sie hierher gebracht hatte. Dieses Zuhause, ausgewählt von Menschen, mit denen sie sich nicht mehr verbunden fühlte, in deren Mitte sie hineingeboren worden war, in der sie über 25 Jahre gelebt hatte und die sie verurteilt hatte sechs Monate ihres Lebens hier verbringen zu müssen. Umgeben von Frauen, die ihren Mann ermordet hatten, ihre Freier ausgeraubt oder mit einer Pistole in der Hand zum Einkaufen gegangen waren. Frauen, die keinen anderen Ausweg mehr sahen, als dieser Gesellschaft den Rücken zu kehren und einen anderen Weg einzuschlagen, einen Weg der sich aber immer wieder als Sackgasse erwies und stets hier endete.
A´ischa dachte in diesen ersten Minuten der wiedergewonnen Freiheit über ihr Leben nach. Was für ein Leben hatte sie geführt? Schon in der Schule begannen diese Sticheleien der Klassenkameradinnen, die sich über ihren dunklen Teint lustig machten und vor allem über das Kopftuch, das sie zu tragen genötigt war. Ihre Eltern, Auswanderer aus dem Irak, waren strenggläubige Moslems und erzogen ihre Tochter mit aller Strenge und nach den Vorschriften des Koran. Nicht, dass ihr Vater ohne Fehl und Tadel war, nein, das war er bestimmt nicht, und der Besuch der Moschee gehörte nicht unbedingt zu seinen Ritualen. Aber für A´ischa galten andere Maßstäbe. Sie musste alle Regeln penibel einhalten und durfte keinen Fehler begehen. Jede Zuwiderhandlung wurde von ihrem Vater auf das Strengste geahndet.
Ihre Wohnung in der 13. Etage eines schmucklosen Ungetüms von Wohnblock, mit annähernd 500 Appartements, mit Aufzügen, die mehr außer als in Betrieb waren, war nicht angetan, Freude am Leben zu vermitteln. Angesiedelt in den Banlieue, den Vororten von Marseille, galten diese Wohnsilos als Orte von Gewalt und Kriminalität.
Die Bewohner hielten zusammen, so, dass A´ischa keine Probleme mit den Nachbarkindern hatte, zumal die meisten der Kinder ebenfalls aus arabischen oder afrikanischen Ländern stammten. Ausgegrenzt war sie eher in der Schule, die nicht zu ihrem Viertel gehörte und die von zahlreichen Kindern französischstämmiger Eltern besucht wurde. Kinder aus einer Bevölkerungsschicht, die sich selbst zur Mittelschicht zählte, obwohl ihre Einkommen sich nur unwesentlich von denen der Einwanderer unterschieden. Die aber schon ihren Kindern vermittelten, dass sie aus einer besseren, gesellschaftlich angeseheneren und selbstverständlich intelligenteren Bevölkerungsschicht stammten.
A´ischa war das einzige Mädchen mit einem Kopftuch in ihrer Klasse. Die ersten Erfahrungen von Ausgrenzung fingen bereits im Kindergarten an und setzten sich in der Grundschule fort. Diese begleiteten sie während der ganzen Schulzeit, das änderte sich auch nicht, als sie später einen Beruf erlernte. Sie wollte unbedingt Verkäuferin werden, obgleich ihr die Eltern davon abgeraten hatten, überhaupt einen Beruf zu erlernen. Sie brauche keinen Beruf, meinte ihr Vater, schließlich würde sie bald heiraten und dann Mutter sein. Eine Vorstellung, die A´ischa jetzt im Alter von sechzehn Jahren weit von sich wies.
Es war eines der seltenen Male, in denen sie sich über die Meinung ihres Vaters hinwegsetzte und mit seinem Zorn leben musste. Sie lernte in einem Supermarkt, legte nach drei Jahren ihre Prüfung ab und verdiente ihr erstes eigenes Geld. Das Kopftuch setzte sie in der Öffentlichkeit nie ab, was dazu führte, dass die jungen Männer, die zum Einkauf in den Laden kamen, sie hänselten und dumme Bemerkungen fallen ließen.
„Wahrscheinlich ist sie kahl“, war noch die harmloseste Aussage. Je mehr man sie aufzog, umso sturer wurde ihre Haltung. Das Kopftuch wurde für sie zu einem Symbol ihres Widerstandes gegen die etablierte Gesellschaft, ein Symbol ihrer Andersartigkeit und zunehmend ein Bekenntnis ihrer wachsenden Radikalisierung. Eines Tages würde sie es denen da draußen heimzahlen, würde sie allen, die sie verhöhnten, sie erniedrigten und ihr zu zeigen versuchten, wie wertlos sie doch war, beweisen was sie konnte. Eines Tages würde auch sie Anerkennung finden.
Sie war gerade einmal neunzehn, als sie Walid kennenlernte. Walid ibn Tabari wohnte nicht weit von der Wohnung ihrer Eltern entfernt, in der sie immer noch lebte. Sie hatte sich erfolgreich gegen ihren Vater behaupten können, der sie mit einem Mann aus dem Irak verheiraten wollte, den sie aber abgelehnt hatte.
„Wenn ich den heiraten muss, dann stürze ich mich aus dem Fenster“, hatte sie ihrem Vater prophezeit. Schließlich gab ihr Vater sein Ansinnen auf und meinte nur, dass sie aber nicht mit seiner Unterstützung rechnen könne, falls sie einen dahergelaufenen Mann heiraten möchte. A´ischa wollte noch gar nicht heiraten, sie wollte zuerst das Leben kennenlernen und sich nicht von der Abhängigkeit des Elternhauses in die Abhängigkeit eines Ehemannes begeben.
Walid war sechs Jahre älter und lebte bereits sein eigenes Leben. Er hatte eine 30 m2 große Wohnung angemietet und finanzierte seinen Lebensunterhalt aux frais de la princesse, wie er zu sagen pflegte, was nichts anderes bedeutete, als dass er von der Sozialhilfe lebte.
„Eine vernünftige Arbeit gibt es gerade nicht für mich“, meinte er nur, als A´ischa ihn danach fragte. Was er als vernünftige Arbeit einstufte blieb A´ischa verborgen. Auf ihre konkreten Fragen antwortete er nur, dass es sich um eine angenehme, gut dotierte und saubere Tätigkeit handeln müsste. Einen Schulabschluss konnte er nicht vorweisen und Schuld daran hatten nur seine Lehrer, die ihn schlecht beurteilten, so dass er die Lust am Lernen verloren hatte.
„Ich habe einige tolle Typen kennengelernt, A´ischa, die würden dir auch gefallen. Komm doch einfach mal mit zu einer Versammlung heute Abend.“
Tolle Typen könnte sie sich ja einmal ansehen, obwohl sie Zweifel hegte, dass diese Typen wirklich so toll waren. A´ischa sagte dennoch zu und versprach mitzugehen. Sie trafen sich am späteren Abend, nachdem der Supermarkt geschlossen hatte und gingen zu Fuß vom Supermarkt durch die Siedlung zur anderen Seite ihres Viertels. Vorbei an all den riesigen Wohnblöcken, mit den gleichförmigen Fassaden, den winzigen Grünflächen vor den Eingängen, die mehr graubraun als grün waren und an den, in Gruppen herumstehenden Jugendlichen, die mit Zigaretten zwischen den Lippen mit dem Handy spielten oder den Hörer am Ohr hatten, um mit dem Freund oder der Freundin zu telefonieren. Vereinzelt grüßten sie A´ischa, die mit ihnen aufgewachsen war.
Die Versammlung, von der Walid gesprochen hatte, fand in einem Hinterhof eines ziemlich heruntergekommenen Gebäudes aus der Nachkriegszeit statt. Die schmucklosen Wände, von denen der Gips teilweise schon abgeblättert war, die alten Fabrikleuchten an der Decke, die Nässe an verschiedenen Ecken des Raumes, zeigten deutlich, dass hier niemand mehr wohnte oder arbeitete. Zwanzig Jugendliche, deren Alter zwischen achtzehn und knapp über zwanzig Jahren liegen durfte, hielten sich bereits in dem Raum auf, als A´ischa mit Walid eintraf. Alle schienen arabischen Ursprungs zu sein, nur zwei oder drei ähnelten mehr den Franzosen der Provence, deren Haut von der Sonne braun gebrannt war.
Ein Mann, eindeutig arabischer Abstammung mit einem dichten, rabenschwarzen Bart und dunkler Kleidung, kam auf Walid zu und begrüßte ihn wie einen alten Freund. Walid schien hier bestens bekannt zu sein.
„Abdul, sei mir gegrüßt, das ist A´ischa, eine gute Freundin von mir.“
„Deine Freundin soll mir willkommen sein, Walid.“
Der Mann, den Walid Abdul nannte, drehte sich zu A´ischa um und reichte ihr die Hand.
„Abdul Bassari, ich freue mich, dich kennenzulernen.“
„A´ischa Bakhta“, sagte sie und sah ihm fest in die Augen.
„Hast du A´ischa gesagt, wer wir sind und was wir machen?“
Abdul Bassari sprach zu Walid und sein Gesicht hatte einen sehr ernsten Ausdruck, der durch den schwarzen Bart noch düsterer wirkte.
„Nein, ich habe A´ischa nur gesagt, dass sie hier unter Freunden sein wird, die ihr bestimmt gefallen und die sie nicht, wie die anderen Menschen auf den Straßen der Stadt, nur als eine unerwünschte Person betrachten.“
Jetzt wand Abdul sich an A´ischa und sagte mit ernster Stimme:
„Wir alle haben den Eindruck, dass wir in diesem Land nicht respektiert und nicht angenommen werden so wie wir sind. Wir haben uns zusammengefunden, um unseren Respekt einzuklagen und uns Achtung zu verschaffen. Wir wollen in dieser Gesellschaft den Platz erhalten, der uns zusteht. Bist du bereit für deine Achtung und Ehre zu kämpfen? Freiwillig wird man uns diesen Platz nicht einräumen!“
A´ischa, die auf jedes Wort von Abdul geachtet hatte, brauchte nicht lange nachzudenken. Die Begriffe Achtung, Ehre, Respekt gehörten zu dem Vokabular, dass sie sich zurechtgelegt hatte, als sie den Anfeindungen und den Pöbeleien ausgesetzt war. Es waren Begriffe, die aus ihrem Mund stammen konnten. Sie war absolut einverstanden mit Abduls Aussage. Natürlich würde sie sich dafür einsetzen und auch dafür kämpfen, was auch immer Abdul unter Kampf verstand.
„Ja, das bin ich. Ich bin aber nicht die Stärkste, meine körperlichen Kräfte sind bescheiden.“
„Kraft kann auch der entwickeln, der nicht mit besonderen körperlichen Attributen ausgestattet ist. Wir werden dir diese Kraft verleihen, so wie wir immer für dich da sein werden. Wir brauchen nur deine absolute Loyalität, die Zusicherung, dass du uns nicht verrätst und deinen Willen, für unsere Ziele einzustehen.“
Das gefiel A´ischa, sie wollte die Kraft haben, sich zu wehren, sich vor den herablassenden Bemerkungen zu schützen und in Zukunft respektiert zu werden.
„Das will ich alles tun, das verspreche ich hier“, antwortete A´ischa und Abdul hieß sie nun erneut willkommen in ihrer Mitte. Das erste Zusammentreffen mit Abdul Bassari war für A´ischa eine angenehme Erfahrung. Sie wurde den anderen der Gruppe vorgestellt und mit Beifall willkommen geheißen. Plötzlich gehörte sie dazu, war nicht mehr ausgegrenzt, sondern angenommen und ein Teil dieser Gesellschaft. Von jetzt an nahm sie regelmäßig an den Treffen teil. Es waren Zusammenkünfte, die ein oder auch zwei Mal die Woche stattfanden. Die Teilnehmer erzählten von ihren Erlebnissen in den vergangenen Tagen, berichteten von Pöbeleien und vergaßen regelmäßig von ihrem eigenen Verhalten zu berichten, das durchaus an manchen Tagen Auslöser von entsprechenden Reaktion der Umwelt war. Einzig A´ischa versuchte ihre Fehler einzugestehen und nach Erklärungen für das Verhalten der Menschen ihr gegenüber zu suchen. Aber auch bei ihr waren diese Ereignisse eher die Ausnahme. Viel häufiger war ihr Kopftuch, ihr Aussehen oder auch die Kleidung, Auslöser von Rüpeleien und von herablassenden Bemerkungen.
Nach der Austauschrunde, wie Abdul die Gespräche nannte, wurde über aktuelle Nachrichten gesprochen. Abdul berichtete von den Brüdern und Schwestern, die in den verschiedenen arabischen Ländern für ihre Sache kämpften und zeigte Videoaufnahmen. Die Aufnahmen hatten zumeist die schlechten Lebensbedingungen zum Inhalt oder zeigten Demonstrationen in verschiedenen Ländern der Welt. Ein Schwerpunkt war immer wieder das Leben der Mohammedaner in Frankreich. Von Mal zu Mal wuchs bei den Teilnehmern der Hass gegen die Regierung, gegen die Gesellschaft und gegen alles was diese Gesellschaft repräsentierte. Nach einigen Monaten, war auch A´ischa soweit, dass sie nur noch das Schlechte in ihrem Umfeld sah. Jetzt war sie dort, wo Abdul alle seine Schützlinge hinbringen wollte.
Ihre erste Aufgabe, bei der sie ihre Loyalität beweisen sollte, bestand darin, einen Brandanschlag auf einen Gendarmerieposten zu verüben. Sie hatte sich gut darauf vorbereitet und mit Walid alles genau durchgesprochen. Jetzt, so sagte Walid ihr, sei sie soweit, dass sie ihre Stärke zeigen könne. Ab jetzt würde sie Macht ausüben und sich zur Wehr setzten können. Bei der Durchführung passierte dann aber genau das, was sie nicht vorhergesehen hatten. Genau zu dem Zeitpunkt, als sie vor dem Gebäude der Gendarmerie stand und die Flasche mit dem Molotowcocktail warf, kam ein Wagen der Gendarmerie an, und die zwei Gendarmen stürzten sich sofort auf sie und nahmen sie fest. Das Ergebnis dieser Loyalitätsprobe waren sechs Monate Gefängnis. Es wurden nur sechs Monate, weil das Gericht ihr anrechnete, dass es sich um ihre erste Straftat handelte.
Jetzt also stand sie wieder vor dem Tor und war in Freiheit, blickte in die Sonne, die sie solange nur durch das vergitterte Fenster gesehen hatte, folgte dem Flug eines Schmetterlings, der sich von einer Blüte zur nächsten bewegte, sah den unaufhörlich vorbeifahrenden Fahrzeugen, auf der vor ihr liegenden Straße zu und hoffte, dass die Welt in der Zwischenzeit nicht unmenschlicher geworden war.
Sie sah den dunkelblauen Seat auf sich zukommen und erkannte den Wagen sofort. Wenigstens der war geblieben, so dass es einen Anknüpfungspunkt gab, um ihr Leben dort fortzusetzen, wo es vor sechs Monaten aufgehört hatte. Walid öffnete ihr die Beifahrertür und winkte sie zu sich heran, ohne auszusteigen und sie gebührend zu begrüßen. Das hatte sich A´ischa anders vorgestellt, ja erhofft gehabt, davon hatte sie geträumt in den letzten Monaten. Walid kam in ihren Träumen auf sie zugerannt und nahm sie in den Arm und zeigte seine Freude, sie wieder in Händen halten zu können. Aber an die Stelle einer solchen Begrüßung trat jetzt ein einfaches Zurufen und eine lieblos geöffnete Beifahrertür.
„Komm A´ischa, wir haben ein Willkommensfest für dich organisiert.“
Kapitel 2
Es war Sommer! Endlich war es Sommer und die Tage wurden wieder länger und wärmer. Ewen Kerber fühlte sich wie neu geboren. Er genoss die Ruhe in seinem Liegestuhl. Auch wenn er kein wirklicher Sonnenanbeter war, so ließ er sich gerne für eine halbe Stunde von der Sonne erwärmen. Es war Samstagnachmittag und er genoss seinen freien Tag.
Seine Frau Carla lag neben ihm. Sie liebte es, in der Sonne zu liegen und einen dunklen Teint zu bekommen. Sie vertrug die Sonne sehr gut und schätzte die wohlige Wärme, die durch ihren Körper ging. Einen Sonnenbrand hatte sie noch nicht gehabt.
„Vielleicht liegt es meinen dunklen Haaren“, pflegte sie Ewen zu sagen, wenn der sich wieder einmal wunderte.
Ewen musste spätestens nach einer halben Stunde die Sonne verlassen und sich einen schattigen Platz suchen. Über der Terrasse ihres Hauses war eine Markise angebracht, die er bei starker Sonneneinstrahlung ausfahren konnte.
Ewen las ein Buch über die Bretagne und ihre Geschichte. Es war sein Steckenpferd über die Geschichte, die Geologie aber auch über die Sagenwelt der Bretagne zu lesen. Wäre er nicht bei der police judiciaire, als Leiter der Mordkommission tätig, dann könnte er sich ganz bestimmt als Erzähler von bretonischen Sagen einen Namen machen oder Vorträge für Touristen aus dem Ausland halten, die so zahlreich die Bretagne besuchten.
Die vergangenen Wochen waren anstrengend gewesen. Der letzte Fall hatte sich hingezogen und seinen ganzen Einsatz erfordert. Wie immer, wenn er einen schwierigen Fall zu lösen hatte, hatte Carla häufig auf ihn verzichten müssen. Doch jetzt war der Mörder gefunden und Ewen konnte wieder etwas kürzer treten.
Die Geschichte, die er gerade las, kannte er noch nicht. Menhire, so las er, können durchaus als Entwicklungshelfer dienen.
In Plouër-sur-Rance gibt es einen Menhir mit einer gewissen Zauberkraft. Schafft ein Mädchen es, siebenmal hintereinander über diesen Menhir zu rutschen, ohne sich dabei eine Verletzung zuzuziehen, dann wird sie einen würdigen Bräutigam finden. Für die Eheleute, deren Kinderwunsch noch nicht in Erfüllung gegangen ist, so die Aussage der Sage weiter, gibt es Hilfe in Carnac. Das Ehepaar, das dort um den Kerderff-Felsen läuft, steigert seine Chancen auf Erfüllung des Kinderwunsches.
Für diejenigen, die nicht an die Kraft der Menhire glauben, hat die Erzählung auch eine Weissagung parat. Sie bräuchten nur die Unmengen an Menhiren zu betrachten, die nichts anderes als versteinerte Ungläubige sind.
Ewen konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Seine Heimat war wirklich reich an Sagen, Geschichten und Erzählungen. Vielleicht war das auch ein Teil des Zaubers, den die Bretagne auf ihre Besucher ausübte.
Sein Handy lag neben ihm auf dem kleinen Beistelltisch, auf dem normalerweise am späteren Nachmittag sein Aperitif, ein Glas Rosé, zu stehen pflegte. Er hatte wieder einmal Rufbereitschaft und das Telefon konnte ihn jederzeit zum Dienst rufen. Es klingelte und störte die Ruhe, die bis jetzt in ihrem Garten geherrscht hatte, wenn er von dem Gezwitscher der Vögel einmal absah, die ihre Nester bauten und alles für eine Familienerweiterung vorbereiteten. Ewen sah von seinem Buch auf und nahm das Telefon in die Hand. Carla öffnete die Augen und wandte ihren Kopf zu Ewen. Sie hegte sofort die größte Befürchtung, dass ein neuer Mord Ewen aus seinem wohlverdienten Wochenende reißen würde.
Ewen sah auf das Display und las den Namen, Georges.
Georges war ein alter Freund von ihm und seinem luxemburgischen Kollegen Medernach, den er während seiner Zeit an der École Nationale Supérieure de la Police in Saint-Cyr au Mont d´Or, kennengelernt hatte. Georges war nicht auf der Polizeischule gewesen, er studierte damals Betriebswirtschaft in Lausanne. Als Schulfreund von Henri Medernach war er öfter zu ihnen nach Saint-Cyr gekommen. Ewen und Georges waren sich sehr sympathisch und so hatte er Georges bald zu seinem engsten Freundeskreis gezählt. Seit einigen Jahren besaß Georges ein schönes Anwesen in der Normandie, nur wenige Kilometer hinter der bretonischen Grenze, knappe 25 Kilometer südöstlich vom Mont-Saint-Michel.
„Hallo Georges, schön von dir zu hören. Bist du in der Normandie?“, hörte Carla ihn sagen und atmete auf.
„Hallo Ewen, ich musste dich einfach anrufen. Wir haben schon sehr lange nichts mehr voneinander gehört. Ja, ich halte mich für einige Wochen hier auf. Es gibt noch einiges zu tun an meinem Haus. Ich bin dabei, die Einfahrt zu erneuern und ein Tor einzubauen. An einem alten Haus gibt es immer etwas zu arbeiten. Sag, hättest du nicht Lust, mich mit deiner Frau zu besuchen? Ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen, sie kennenzulernen. Fast könnte man meinen, dass du sie mir vorenthalten möchtest. Ihr könntet doch einige Tage zu mir kommen und wir könnten uns über die alten Zeiten unterhalten. Was hältst du davon?“
„Vielen Dank für deine Einladung, Georges. Ich habe nicht vor, Carla zu verstecken. Aber du weißt ja selbst wie es ist, wenn man noch berufstätig ist. Das Privatleben kommt dann häufig zu kurz. Ich werde deine Einladung gerne mit Carla besprechen. Vielleicht können wir uns in der nächsten Woche ein paar Tage frei machen. Aber sag, wie geht es dir?“
„Ich bin immer noch beschäftigt mit diversen Aufträgen, die noch zu erledigen sind, bevor ich mich etwas zurücknehme. Meine Pensionierung ist bereits genehmigt aber ich möchte mich noch nicht völlig aus dem Berufsleben zurückziehen. Daher helfe ich einem Kollegen aus und erledige kleinere Arbeiten für ihn. Gesundheitlich geht es mir gut, allerdings habe ich den Tod meiner langjährigen Lebensgefährtin noch nicht überwunden. Aber auch hier denke ich, heilt die Zeit die Wunden.“
„Ja, ich kann es sehr gut verstehen. Nach dem Tod meiner Frau habe ich Ähnliches durchgemacht.“
„Du kennst mich ja schon sehr lange, ich kann so schlecht alleine sein. Irgendwann werde ich sicherlich versuchen, einen Menschen zu finden, der an meiner Seite leben möchte.“
„Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück! Georges, ich melde mich in den nächsten Tagen bei dir und sage Bescheid, ob es mit einem Besuch klappt.“
Ewen und Georges beendeten das Gespräch und Ewen wandte sich Carla zu, die ihn bereits gespannt ansah, nachdem ihr Name mehrfach gefallen war.
„Wer war am Telefon?“
„Georges aus Luxemburg, ich habe dir schon viel von ihm erzählt.“
„Ach, der Freund von Henri Medernach, den du in Saint-Cyr kennengelernt hast?“
„Genau der, er hat uns für einige Tage in die Normandie eingeladen. Er besitzt dort ein schönes Anwesen und wir könnten bei ihm wohnen. Der Ort ist nicht sehr weit vom Mont-Saint-Michel entfernt.“
„Das hört sich gut an, ich war noch nie am Mont-Saint-Michel. Vielleicht könnten wir das mit einem Besuch dieses weltberühmten Klosters verbinden.“
„Das lässt sich bestimmt machen, wir müssen nur sehen, ob wir ein paar Tage Urlaub bekommen können. Bei mir ist zurzeit alles ruhig, wir haben gerade wenig Arbeit. Wie sieht es bei dir aus?“
„Ich habe noch so viele Überstunden und schon lange keinen Urlaub mehr genommen. Ich denke, dass es kein Problem werden dürfte.“
„Gut, dann klären wir das und ich sage Georges am Montag Bescheid. Ich würde mich wirklich freuen, ihn einmal wiederzusehen.“
Ewen nahm sein Buch wieder in die Hand und las weiter. Allerdings waren seine Gedanken nicht mehr ausschließlich bei seiner Lektüre. Sie kreisten um das gerade Gehörte von seinem Freund Georges, der sein Alleinsein noch nicht verarbeitet hatte. Zu gerne hätte er ihm Hilfe angeboten aber er war nicht sehr gut als Therapeut. Er konnte sich noch sehr gut an seine eigene Einsamkeit erinnern. An die langen Abende nach der Arbeit im Büro, in seinem Sessel, neben dem Kamin und an das Glas Rotwein, an dem er sich so oft festgehalten hatte, als Rettungsanker sozusagen. In seiner Erinnerung sah er sich immer noch, wie er das Glas hin und hergedreht und nachdenklich hineingestarrt hatte, so als stünden dort die Antworten auf seine Lebensfragen.
Langsam müsste er sich aber nach einem Sonnenschutz umsehen, die Sonne hatte doch schon mehr Kraft, als er erwartet hatte. Er sah, dass seine Haut einen rötlichen Schimmer bekam.
Carla drehte sich von Zeit zu Zeit um.
Am späten Nachmittag stand Carla auf und ging in die Küche, um den Aperitif vorzubereiten und die amuses gueules zu richten. Dieses Ritual schätzte Ewen sehr, gab es seinem Tagesablauf doch einen gewissen zuverlässigen Ruhepunkt in dieser hektischen Welt.
Wenig später kam Carla mit einem Tablett auf die Terrasse zurück. Ewen stand auf und nahm die Weinflasche vom Tablett, und schenkte ihnen den gut gekühlten Rosé ein. Auf dem Teller lagen kleine, ungefähr ein Zentimeter dicke Gurkenscheiben, mit einem kleinen Häubchen Frischkäse garniert und mit Piment d´Espelette bestreut. Ewen war überrascht, seine Paté au pommes nicht vorzufinden.
„Gibt es heute keine Paté?“
„Ewen, ich muss hin und wieder etwas Neues machen, ansonsten wird dir meine Küche zu langweilig. Versuch mal diese kleinen gesunden Häppchen, die schmecken ganz gut.“
Ewen griff nach einem Gurkenscheibchen und steckte es in den Mund. Sofort entfaltete das Gewürz seine Wirkung, während der Frischkäse und die Gurkenscheibe gleich wieder eine gewisse Neutralisierung vornahmen. Er musste zugeben, dass es ganz vorzüglich schmeckte und er nahm sich sofort ein weiteres Stück, bevor er sein Weinglas in die Hand nahm.
„Es scheint dir ja doch zu schmecken?“ Carla prostete ihm zu.
„Ganz ausgezeichnet, das lässt mich glatt die Paté für eine Weile vergessen. Woher hast du das Rezept?“
„Ach Ewen, dafür braucht man kein Rezept. Ich habe es einfach vorhin ausprobiert.“
„Ich war also ein Versuchskaninchen?“
„Wenn du so willst, ja.“
„Es ist ja noch einmal gutgegangen, Carla, ich habe das Experiment überstanden.“ Ewen lachte Carla an.
„Was heißt hier überstanden? Ich habe dich doch nicht mit gefährlichen und unbekannten Substanzen gefüttert!“
„So war es auch nicht gemeint. Ich wollte nur sagen….“
„Lass gut sein, Ewen, ich kenne dich inzwischen. Prost!“
Der Samstagnachmittag neigte sich dem Ende entgegen und Carla verschwand in die Küche, um das Abendessen zuzubereiten.
Kapitel 3
Ewen Kerber, Leiter der Mordkommission von Quimper, betrat sein Büro an diesem Montagmorgen in bester Stimmung. Das Wochenende war einfach toll gewesen und absolut ruhig verlaufen. Obwohl er Rufbereitschaft gehabt hatte, so hatte er sich trotzdem wunderbar erholen können. Kein Mord war ihm dazwischengekommen.
Paul Chevrier kam ihm auf dem Flur entgegen.
„Bonjour Ewen, wie war dein Wochenende?“
„Hätte nicht besser sein können, Paul! Und wie war es bei dir?“
„Nach dem 1:0 von Brest, am Samstag gegen Arles-Avignon, sieht es wieder viel besser aus. Du wirst sehen, wir steigen wieder in die erste Liga auf.“
„Wieso aufsteigen? War Brest denn abgestiegen?“
„Ewen, du bist ein Fußballbanause. Letztes Jahr war Brest doch aus der 1. Liga abgestiegen. Es war eindeutig der Fehler vom Trainer. Aber jetzt stehen wir auf Platz zwei und haben damit Chancen, wieder in die 1. Liga aufzusteigen. Genau dort gehört Brest auch hin.“
„Ach so, Brest hat einen neuen Trainer bekommen, und der macht alles besser.“
„Nein, der Trainer ist geblieben aber jetzt trainiert er völlig anders. Aber lassen wir das, du verstehst doch nichts vom Fußball.“
„Paul, ich habe eine ganz andere Frage an dich. Meinst du, du könntest für ein paar Tage ohne mich hier auskommen? Ich habe von einem langjährigen Freund eine Einladung in die Normandie erhalten. Carla und ich sind eingeladen, ihn dort zu besuchen.“
„Ohne dich? Wie soll das gehen?“
„Also, wenn du……“
„Ewen, natürlich komme ich alleine klar. Es ist doch nicht dein erster Urlaub. Außerdem scheint die Unterwelt ruhig zu sein. Schon seit Wochen gibt es keinen neuen Mord.“
„Als ob wir täglich oder wöchentlich einen Mord in Quimper oder Umgebung hätten.“ Ewen lachte und war zufrieden, dass sein Freund meinte, alleine klar zu kommen. Ewen mochte Paul sehr und wollte unbedingt verhindern, ihn zu überanstrengen. Dabei fiel ihm gar nicht auf, dass Paul es durchaus gut gefiel, manchmal auch ohne seinen Chef, Freund und Lehrer, seine Arbeit zu verrichten. Aus der Sicht von Ewen war Paul Chevrier seine erste Wahl, wenn es einmal um seine Nachfolge gehen würde. Ewen war inzwischen 58 geworden und in einigen Monaten, genauer gesagt im November, würde er seinen 59. Geburtstag feiern. Er hatte sich zwar noch keine Gedanken gemacht, wie lange er seiner Tätigkeit noch nachgehen würde, aber länger, als bis zu seinem 63. würde er bestimmt nicht arbeiten wollen. Ginge es nach Carla, dann würde er seine Arbeit schon mit 60 Jahren in jüngere Hände legen.
Ewen betrat sein Büro, legte sein Jackett über den Besucherstuhl und setzte sich an seinen Arbeitsplatz. Auf der linken Seite des Schreibtisches lagen keine Akten. Das bedeutete, dass es keine ungelösten Fälle gab. Sein Arbeitsplatz war jungfräulich. Was bei ihm die Frage aufkommen ließ, ob er nicht sofort mit dem Urlaub beginnen sollte. Er war kein Freund von Untätigkeit. Ohne einen neuen Fall würde er sehr viel Zeit für die Lektüre der Zeitung haben.
Das Telefon riss ihn aus seinen Überlegungen. Hoffentlich wollte ihn niemand informieren, dass man soeben einen Toten gefunden hatte.
„Kerber“, meldete er sich.
„Bonjour, Monsieur le Commissaire, Nolwenn hier. Monsieur le Commissaire, Monsieur Nourilly würde Sie gerne sprechen, wenn Sie etwas Zeit erübrigen können, meinte er.“
„Wenn ich Zeit erübrigen kann? Madame Nolwenn, so hat Nourilly mich noch nie zu sich gebeten. Liegt etwas Schlimmes an?“
Nolwenn Meunier musste heftig lachen, sie konnte Ewen gut verstehen. Nourilly pflegte eher einen Befehlston an den Tag zu legen, wenn er um den Besuch eines Untergebenen bat. Die heute gewählte Ausdrucksform unterschied sich schon sehr von den üblichen kurzen Sätzen, die meistens nur mit dem Namen des gewünschten Gesprächspartners und dem Zusatz soll kommen versehen wurden.
„Monsieur le Commissaire, soweit ich es mitbekommen habe, geht es wohl um eine eher private Angelegenheit, die der OPJ mit Ihnen besprechen möchte. Genaues habe ich auch noch nicht erfahren. Er ist jedenfalls bester Laune.“
„Dann lasse ich ausrichten, dass meine Zeit es zulässt, dass ich für einige Minuten zu ihm kommen kann.“
Wieder musste Nolwenn lachen.
„Ich werde es ausrichten, Monsieur le Commissaire. Bis gleich.“
Nolwenn Meunier legte auf. Ewen stand auf, schnappte sich sein Jackett, zog es an und machte sich auf den Weg in die dritte Etage, zu seinem Chef.
Kapitel 4
Ewen Kerber klopfte an der Tür zum Vorzimmer von Nourilly und trat auch sofort ein.
„Bonjour Monsieur le Commissaire“, begrüßte ihn Nolwenn und lachte erneut, als sie ihn erblickte.
„Ich habe dem Chef ihre Antwort ausgerichtet. Ich glaube, er hat sie nicht ganz verstanden. Jedenfalls meinte er, ach so, nur einige Minuten, aber das reicht ja auch. Ich sage ihm Bescheid, dass Sie hier sind.“
Nolwenn erhob sich von ihrem Platz und ging in das Zimmer von Monsieur Nourilly. Eine sehr schöne Frau, dachte Ewen, als sie an ihm vorbei ins Chefbüro ging. Sie kam sofort wieder heraus, ließ die Tür offen stehen und sagte nur:
„Bitte, Monsieur le Commissaire.“ Sie trat zur Seite und ließ Kerber eintreten. Hinter ihm schloss sie die Tür.
„Bonjour, mein lieber Kerber, nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee bringen lassen, oder ein Wasser?“
„Bonjour, Monsieur Nourilly, ein Kaffee wäre gut“, meinte Ewen und nahm die Einladung gerne an. Wann gab es schon einen Kaffee bei Nourilly. Entweder das Kommissariat hatte einen unerwarteten Zuschuss zum Jahresbudget erhalten, so dass Geld für Kaffee vorhanden war, oder Nourilly wollte etwas von Ewen wissen und brauchte dafür ein angenehmes Gesprächsklima.
Nourilly griff zum Telefon und bestellt bei Nolwenn zwei Tassen Kaffee.
„Für mich, wie immer mit viel Milch und für Sie, lieber Monsieur Kerber?“
„Nur schwarz, ohne Zucker und ohne Milch“, antwortete Ewen.
„Haben Sie´s gehört, Nolwenn. Für den Kommissar schwarz.“
Er legte auf und kam zurück zur Sitzecke seines Büros. Er nahm neben Ewen Platz und schien nicht zu wissen, wie er anfangen sollte. Nolwenn betrat das Büro und stellte die Tassen auf den kleinen Tisch. Sie verließ den Raum sofort wieder.
„Monsieur Kerber, ich habe ein kleines, persönliches, sagen wir beinahe schon privates, Anliegen. In Avranches findet ab Mittwoch ein Treffen der Polizeichefs aus der Bretagne und der Normandie statt. Bei dieser kleinen Zusammenkunft, nennen wir es Kongress, bringen die Kollegen ihre erfolgreichsten Kriminalkommissare mit, um parallel zu unserem Treffen, einen Meinungsaustausch über die Arbeitsweise der Mordkommissionen abzuhalten. Wir, die Chefs der Polizei der Bretagne und der Normandie, wollen diese Treffen in der Zukunft regelmäßig abhalten, um effektiver zu werden und vor allem, um Paris zu zeigen, dass wir es besser können, als die Herren in der Hauptstadt. Es ist ein eher inoffizielles Treffen, so dass ich Sie nicht einfach abkommandieren kann. Selbstverständlich werden Sie für die dienstlichen Aufgaben während der Zeit von mir freigestellt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Zusage erteilten.“
Jetzt war es raus. Nourilly wollte in Avranches mit Kerber glänzen. Ewen hatte in den letzten Jahren die höchste Aufklärungsrate in ganz Nordfrankreich erreicht. Ewen passte es überhaupt nicht, jetzt nach Avranches fahren zu müssen, gemeinsam mit Nourilly.
„Monsieur Nourilly, es gibt da ein Problem. Ich habe in dieser Woche einige Tage Urlaub eingeplant und will zu einem Freund in die Normandie fahren. Mein Freund lebt nicht ständig dort, er wohnt in Luxemburg. Jetzt ist er gerade in der Normandie. Er hat meine Frau und mich für ein paar Tage zu sich eingeladen.“
„Oh, bedauerlich, sehr bedauerlich.“ Nourilly schwieg und dachte einige Augenblicke nach.
„Sagen Sie, Monsieur le Commissaire, wo wohnt den ihr Freund?“
„Er hat ein Haus in Saint-Martin-de-Landelles.“
„Saint-Martin“, Nourilly erhob sich und ging zu seiner großen Frankreichkarte. Er suchte den Ort.
„Sagen Sie, Monsieur Kerber, wo liegt Saint-Martin?“
„In der Nähe von Saint-James, östlich der Autobahn, zwischen Rennes und Avranches."
Nourilly folgte mit dem Finger der Autobahn auf der Karte. Dann schien er Saint-James gefunden zu haben und wenig später auch Saint-Martin-de-Landelles.
„Aber, mein lieber Kerber, das ist doch überhaupt kein Problem. Die Entfernung zwischen Saint-Martin und Avranches beträgt höchstens dreißig Kilometer. Eine halbe Stunde Fahrt. Sie können doch ihren Freund besuchen und an den beiden Tagen, an denen wir unseren sogenannten Kongress abhalten, nach Avranches kommen. Selbstverständlich können Sie danach noch ein paar weitere Urlaubstage anhängen. Was sagen Sie dazu?“
Ewen war nicht sehr erbaut von dem Gedanken, Nourilly auch während eines Urlaubs zu sehen, andererseits, würde es ihm die Gelegenheit bieten, sich mit seinen Kollegen auszutauschen. Einige von ihnen kannte er ja schon. Die Kollegen aus der Normandie fehlten noch. Carla würde dann die ersten beiden Tagen alleine mit Georges verbringen müssen. Er wollte mit ihr darüber sprechen.
„Ich würde Ihren Vorschlag gerne zuerst mit meiner Frau besprechen, schließlich sollte es unser gemeinsamer Kurzurlaub werden. Kann ich Ihnen morgen das Ergebnis mitteilen?“
„Aber selbstverständlich, lieber Monsieur Kerber, und grüßen Sie ihre Frau recht herzlich von mir.“
Ewen leerte seine Tasse, an der er immer wieder zwischendurch genippt hatte, erhob sich und verabschiedete sich von seinem Chef. Er hatte jetzt eine schwierige Entscheidung zu treffen. Urlaub in Verbindung mit zwei Tagen Nourilly war anstrengend. Andererseits waren zwei Tage schnell vorüber und er hatte danach wirkliche Urlaubstage, die er mit Carla verbringen konnte. Sie hatten ein paar gemeinsame Tage miteinander verdient. Während der letzten Urlaubsaufenthalte waren immer wieder Verbrechen dazwischengekommen.
Am Abend sprach er mit Carla darüber, die überhaupt nicht erbaut war von dem Gedanken, einen Kurzurlaub mit dienstlichen Aufgaben zu verbinden. Sie diskutierten die Vor- und Nachteile und kamen dann doch zu dem Schluss, dass sie auf das Angebot von Nourilly eingehen würden.
Ewen wäre für maximal zwei Tagen beschäftigt und Carla würde versuchen, an den beiden Tagen die Gegend rund um Saint-Martin kennenzulernen. Sie erkundigte sich im Internet, was es in der Gegend zu sehen gab und stieß dabei auf die Fabrik und die angeschlossene Boutique von Saint James. Ewen und Carla schätzten die Pullover dieser Marke. Es waren die Pullover, die ursprünglich für die Fischer angefertigt worden waren. Reine, dicke Wollpullover mit einem sehr hohen Kragen, der durch einen Reißverschluss geschlossen wurde. Schnell stand fest, dass sie an einem Tag den Fabrikverkauf aufsuchen würde. Für den zweiten Tag würde sie auch noch etwas finden.
„Wenn du dann noch mit mir zum Mont-Saint-Michel fährst, dann würde mich das für deine Abwesenheit in den zwei Tagen entschädigen“, fügte Carla hinzu und wartete auf Ewens Antwort.
„Den Mont werden wir ganz sicher besuchen, da freue ich mich schon darauf. Schließlich gibt es eine Neuerung, die auch ich noch nicht gesehen habe.“
Kapitel 5
Robert Nourilly war zufrieden. Mit Kerber konnte er in Avranches glänzen. Für ihn stand fest, dass Kerber nur deshalb so erfolgreich agieren konnte, weil er, Nourilly, die Führung innehatte. Ohne seine Führungsqualitäten wäre die police judiciaire von Quimper nicht dort wo sie jetzt stand. Sie wäre immer noch tiefste Provinz und niemand in Frankreich würde ein Wort über die Mordkommission dieser Provinzstadt verlieren. Dank seiner Aufopferung und seinem unermüdlichen Presseeinsatz war Quimper inzwischen eine Perle unter den zahlreichen police judiciaires in Frankreich geworden. Erst vor einigen Wochen war die neue Statistik über die Aufklärungsquote für Nordfrankreich erschienen und Quimper nahm den ersten Rang ein.
Ewen wusste von Nourillys Überlegungen nichts, er hätte sicher eine andere Erklärung für ihre erfolgreiche Arbeit gefunden. Übermorgen würden sie also nach Avranches fahren. Am Donnerstagmorgen und am Freitag fand dann der Minikongress statt.
Robert Nourilly bereitete sich auf den Kongress auf seine Art vor.
„Nolwenn, können Sie bitte in mein Büro kommen.“
Nolwenn Meunier wusste, wenn Nourilly dienstlich verreisen wollte oder musste, durfte sie die entsprechenden Vorbereitungen erledigen. Dabei ging es weniger um die Reservierung von Hotelzimmern oder die Buchung von Fahr- oder Flugkarten, sondern eher um die Beschaffung von Informationen über die Teilnehmer. Nourilly wollte alles Aktuelle von den Beteiligten erfahren.
„Nolwenn, ich brauche Informationen.“
„Wie immer Chef?“
„Nun ja, ich brauche die aktuellen Informationen zu folgenden Fragen:
Wie viele Fälle haben die Kollegen der anderen Departements der Bretagne in den letzten Monaten bearbeitet und gelöst?
Wie hoch waren die Kosten in dem Zeitraum?
Wie hoch war deren Aufklärungsquote?
Natürlich müssen Sie unsere Daten deutlich herausstellen. Unsere Polizei soll in sehr gutem Licht stehen. Unsere Aufklärungsquote ist bestimmt sehr hoch.“
„Die von Kerber liegt zurzeit bei 100 %, Monsieur Nourilly, besser kann sie nicht werden. Die der anderen lass ich mir geben.“
„Deswegen will ich Kerber auch dabei haben. Bestimmt werden alle wissen wollen, wie er es schafft, alle Mörder zu erwischen. Ich werde mir überlegen, wie ich diesen Erfolg wirksam darstellen kann. Schließlich kommt ein solcher Erfolg ja nicht ohne die Unterstützung der Leitung zustande.“
Nolwenn nickte bedächtig, drehte sich um und ging zur Tür. Das Grinsen auf ihrem Gesicht konnte Nourilly nicht mehr sehen. Für sie begannen jetzt wieder die Telefonate mit den Kolleginnen in den einzelnen Departements. Sie verstand es, den Kontakt zu den anderen Chefsekretärinnen sehr geschickt zu pflegen. Die Informationen waren schnell gesammelt.
Kapitel 6
Walid ibn Tabari war ein weitgereister Mann. Die letzten vier Jahre unterschieden sich jedoch deutlich von seinem früheren Leben.
Geboren und zur Schule gegangen war er in Marseille. Seine Eltern, Einwanderer aus Algerien, waren einfache Menschen gewesen. Seine Mutter arbeitete als Putzfrau bei einem Internisten, sein Vater war schon seit dreißig Jahren bei derselben Firma beschäftigt. Eine Firma, die Schiffszubehör für die Yachtwerften entlang des Mittelmeers produzierte und die schon seit Jahren, dank guter Umsätze, zu den Wachstumsbranchen der Region gehörte.
Die Schule war Walid als eine reine Zeitverschwendung erschienen. Walid war nicht dumm, er war nur faul und hatte gedacht, er könnte alles bekommen, auch ohne dafür lange zu arbeiten. Bereits mit vierzehn Jahren hatte er sich lieber mit Gleichgesinnten getroffen und einen Einbruch nach dem anderen verübt, um seine Wünsche zu erfüllen. Zuerst ging es nur darum, das nötige Kleingeld zu bekommen, um die neuesten Handymodelle erwerben zu können, später hatten sie Geld gebraucht, um den Mädchen imponieren zu können, und ein Auto kaufen zu können. Während die ersten Einbrüche in Marseille verübt worden waren, hatte sich alles geändert, seitdem er ein Auto besaß. Jetzt ging es über die Stadtgrenze hinaus nach Cassis, später nach Aix und in die anderen Ortschaften rund um Marseille. Am Anfang waren es nur kleinere Wohnungseinbrüche, bei denen sie einige hundert Euro mit dem Verkauf des Diebesgutes erzielten. Später überfielen sie dann Tankstellen und stahlen nicht nur die Tageseinnahmen, sondern auch Zigaretten und Alkohol, der auf dem Schwarzmarkt verkauft werden konnte. Walid selbst lehnte Alkohol und Zigaretten ab, das war das Einzige, was von seiner islamischen Erziehung übrig geblieben war. Sie hatten immer viel Glück gehabt und waren nie von der Polizei gefasst worden.
Als er dann eine Wohnung und ein schöneres, teureres Auto haben wollte, mussten andere Einnahmequellen her. Da traf es sich gut, dass er Abdul Bassari kennenlernte. Abdul Bassari war ein Mann mit einer Körpergröße von knapp zwei Metern. Seine athletische Figur, sein pechschwarzer Bart und seine ebenso dunkle Kleidung, verliehen ihm Autorität und flößten seinen Gesprächspartnern Respekt ein. Abdul Bassari brauchte keine großen Überzeugungskünste, um Walid von seiner Gang zu trennen und ihn von seinen eigenen Ideen zu überzeugen.
„Du kannst mehr als nur einen Einbruch verüben, du kannst Einfluss und Macht bekommen, wenn du machst, was ich dir sage. Du musst es aber wollen, du musst dich aus freien Stücken unseren Ideen unterwerfen und treu zu unseren Idealen stehen. Dann verspreche ich dir die Macht, über viele zu herrschen. Alle werden das tun, was du von ihnen verlangst. Du wirst jedes Mädchen zur Frau haben können. Du wirst bestimmen über ganze Regionen. Alle werden dich bewundern und versuchen, dir nachzueifern. Aber du brauchst Zeit, Mut und Ausdauer. Wenn du bereit bist, dein Leben neu zu gestalten, dann komm zu mir und sag es mir. Für deinen Lebensunterhalt werden wir sorgen. Du erhältst so viel Geld, wie du zum Leben benötigst. Glaube mir, es wird dir an nichts fehlen.“
Die Worte von Abdul Bassari waren wohl überlegt eingesetzt. Er kannte die jungen Männer aus den Gettos von Marseille. Er wusste von ihren Minderwertigkeitsgefühlen und von dem Wunsch, wichtig zu sein. Jemand, der Anerkennung und Ansehen findet, vor allem beim weiblichen Geschlecht, aber auch in der Stadt oder sogar im Land. So wie die Spieler von Olympique Marseille, die beinahe schon angebetet wurden von ihren Fans.
Walid war kein Fußballer, er war ein Nobody in der Stadt, und er war es satt, ein Nobody zu sein. Er wollte nach vorne, er wollte an die Spitze, er wollte die Anerkennung, die den Bewohnern der Banlieu von Marseille versagt blieb. Daher war sein Entschluss schnell gefasst. Er würde das Angebot von Abdul Bassari annehmen und sich seiner Autorität unterstellen.
Abdul Bassari war nicht überrascht, als Walid bereits am nächsten Tag seine Zustimmung gab. Er hatte es genauso vorhergesehen, schließlich war Walid nicht der erste, der seinen Verlockungen erlag.
Schon nach weiteren drei Tagen war Walid auf dem Weg nach Murzuq, ungefähr 900 Kilometer südlich von Tripolis, mit zwölf weiteren jungen Männern. Seinen Eltern durfte er nichts sagen, seine Reise war streng geheim, das hatte Abdul Bassari mehrfach betont. Die Reise in die ferne Stadt war Ausgangspunkt für das endgültige Ziel.
Abdul Bassari hatte ihm erklärt, dass er dort eine Ausbildung erhalten würde, eine Voraussetzung für seinen Aufstieg in der Organisation.
Walid war sechs Monate in dem Camp, das fünfzig Kilometer von Murzuq entfernt, mitten in der Sahara lag. Ein Beduinenzelt war sein Zuhause, und die Ausbildung an den Gewehren, den Granaten und im Nahkampf war zur täglichen Routine geworden.
Manchmal ertappte er sich bei den Gedanken, alles zu vergessen und wieder zurück nach Marseille zu fahren. Aber er verwarf den Gedanken schnell wieder. Alleine von Murzuq wegzukommen war ein Ding der Unmöglichkeit. Abgesehen von den Folgen die ihn erwarteten, sollte er die Organisation durch eine Flucht verlassen. Schon am ersten Tag war ihm gesagt worden, dass darauf die Todesstrafe stand. Schließlich hatten sich alle freiwillig der geheimen Organisation angeschlossen und es war die Organisation, die ihnen das Leben in Frankreich finanzierte. Verrat war das Schlimmste in den Augen der Führung und musste mit dem härtesten Mittel bestraft werden.
Er lernte zu gehorchen und sich blind auf seinen Partner zu verlassen. Er lernte genügsam zu sein und mit Wasser sparsam umzugehen. Das Wasser nannten sie ihren Schutzengel, er begleitete sie in Form einer Feldflasche, die sie am Gürtel trugen. Zuerst wurde die Wasserflasche angehängt und dann erst der Munitionsgürtel.
Abdul Bassari kam nur einmal in den sechs Monaten zu ihm ins Lager. Walid konnte nicht herausbekommen, welche Funktion er innehatte oder welcher Einfluss von ihm ausging. Sicher war nur, dass er nicht der oberste Führer in der Hierarchie war, denn er sprach häufig von der Spitze. Bassari schien sehr zufrieden mit seiner Ausbildung zu sein.
„Du wirst das Erlernte in den nächsten Monaten anwenden können“, sagte er zu Walid.
„Wir haben einen ersten Auftrag für dich. Von diesem Camp aus schleusen wir dich nach Pakistan. Dort wirst du eine Gruppe von Kämpfern befehligen. Wenn du dich dort auch so gut bewährst wie hier, dann haben wir Großes mit dir vor.“
Walid war bereit, obgleich die Aussicht nach Pakistan zu fahren, ihn nicht unbedingt zum Jubilieren brachte. Pakistan war in der Vergangenheit ein Land gewesen, das in seinem Weltbild nicht vorgekommen war. Europa, die europäischen Länder, allen voran Frankreich, bildeten seine Welt, in der er sich bewegen wollte. Aber Pakistan? Jetzt war es gleichgültig, welche Rolle er diesem Land in seinen Vorstellungen eingeräumt hatte. Pakistan war sein nächstes Ziel, ein Ziel, das eine weitere Stufe auf dem Weg zu seinem persönlichen Erfolg, zu seinem Aufstieg in der Organisation, auf dem Weg zu Macht, Ruhm und Geld war.
Sein Einsatz in Pakistan dauerte fast acht Monate. In der Zeit nahm er an mehreren Anschlägen auf Polizeistationen und militärischen Einrichtungen teil, mit einer Gruppe von Männern, deren Ausbildung sehr zu wünschen übrig ließ.
Unter seinem Kommando wurde die Gruppe zu einer der erfolgreichsten im Land und erfuhr entsprechende Anerkennung. Das Leben dort war hart. Kein Vergleich zu dem schon harten Leben in den Beduinenzelten, während seiner Ausbildungszeit in der Sahara. Ihr Zuhause bestand aus Höhlen, hoch oben in den Bergen, nördlich von Peshāwar. Es war eine raue, fast schon unwirtliche Gegend, in der sie sich bewegten. Mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen Geröll und Gesteinsmassen, nur unterbrochen von wilden Wasserläufen, die aus den mehr als 3000 Meter hohen schneebedeckten Bergspitzen herunterstürzten, lag ihr Versteck. An manchen Tagen hörten und sahen sie die Kampfjets der pakistanischen und amerikanischen Luftwaffen über ihr Lager hinwegfliegen, auf der Suche nach ihnen. Vereinzelt wurden Bomben wahllos abgeworfen, die aber wenig Schaden anrichteten, manchmal wurden auch Trupps, die sich hier bewegten, gezielt angegriffen. Er hatte mit seinen Leuten großes Glück. Sie bewegten sich selten in einer Reihe, so dass sie aus großer Höhe sofort ausgemacht werden konnten, sondern verteilten sich auf ihrem Weg ins Tal. Er hätte sehr gerne die Nacht für diese Märsche genutzt, aber in dieser Landschaft war ein Fortkommen in völliger Dunkelheit sehr schwer. Nach Bat Kehl, der nächstgelegenen Stadt, waren es schon beinahe 30 Kilometer Entfernung. Von dort mussten sie sich ihre Verpflegung, Munition und Waffen holen und alles zu Fuß zu ihrem Versteck transportieren. Die Anschläge verübten sie in einer noch größeren Entfernung, oder sie überfielen Konvois, die sich auf den schmalen Straßen durchs Gebirge zwängen mussten, um die Versorgung der Grenzposten sicherzustellen.