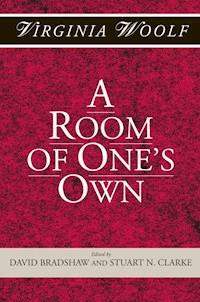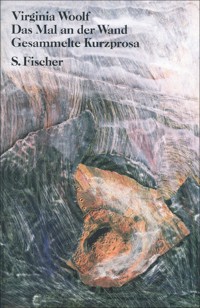
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Virginia Woolf, Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Zu Virginia Woolfs Lebzeiten erschien nur ein Band mit Kurzprosa, und zwar ›Montag oder Dienstag‹. Er enthielt acht Erzählungen. Bis zur Veröffentlichung des hier nun auf deutsch vorliegenden Bandes (1985 in London erschienen, in erweiterter Ausgabe 1989) waren selbst auf englisch lediglich 21 Erzählungen Virginia Woolfs erhältlich. Diese Ausgabe enthält 46 Erzählungen und Skizzen, von denen 28 bisher noch nie ins Deutsche übersetzt waren. Sie vereint die gesamte von ihr selbst und ihrem Mann Leonard Woolf aus dem Nachlaß veröffentlichte Kurzprosa und alle unveröffentlichten Stücke. Die Sammlung ist chronologisch angeordnet, so dass dem Leser neue Einsichten in den schriftstellerischen Werdegang Virginia Woolfs eröffnet werden. In den Erzählungen experimentiert die Autorin mit erzählerischen Methoden, Themen und sogar einzelnen Figuren, wie Mrs Dalloway, die sie dann in ihren Romanen breiter angelegt fortführte. ›Das Mal an der Wand‹ präsentiert nicht nur die maßgebliche Textfassung von jeder Erzählung, der Band enthält auch Kommentare mit den wichtigsten Informationen, die u. a. die Entstehungsgeschichte der abgedruckten Fassungen skizzieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Virginia Woolf
Das Mal an der Wand
Gesammelte Kurzprosa
Über dieses Buch
Zu Virginia Woolfs Lebzeiten erschien nur ein Band mit Kurzprosa, und zwar ›Montag oder Dienstag‹. Er enthielt acht Erzählungen. Bis zur Veröffentlichung des hier nun auf deutsch vorliegenden Bandes (1985 in London erschienen, in erweiterter Ausgabe 1989) waren selbst auf englisch lediglich 21 Erzählungen Virginia Woolfs erhältlich. Diese Ausgabe enthält 46 Erzählungen und Skizzen, von denen 28 bisher noch nie ins Deutsche übersetzt waren. Sie vereint die gesamte von ihr selbst und ihrem Mann Leonard Woolf aus dem Nachlass veröffentlichte Kurzprosa und alle unveröffentlichten Stücke.
Die Sammlung ist chronologisch angeordnet, sodass dem Leser neue Einsichten in den schriftstellerischen Werdegang Virginia Woolfs eröffnet werden. In den Erzählungen experimentiert die Autorin mit erzählerischen Methoden, Themen und sogar einzelnen Figuren, wie Mrs Dalloway, die sie dann in ihren Romanen breiter angelegt fortführte.
›Das Mal an der Wand‹ präsentiert nicht nur die maßgebliche Textfassung von jeder Erzählung, der Band enthält auch Kommentare mit den wichtigsten Informationen, die u. a. die Entstehungsgeschichte der abgedruckten Fassung skizzieren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Virginia Woolf wurde am 25. Januar 1882 als Tochter des Biographen und Literaten Sir Leslie Stephen in London geboren. Zusammen mit ihrem Mann, dem Kritiker Leonard Woolf, gründete sie 1917 den Verlag The Hogarth Press. Ihre Romane stellen sie als Schriftstellerin neben James Joyce und Marcel Proust.
Zugleich war sie eine der lebendigsten Essayistinnen ihrer Zeit und hinterließ ein umfangreiches Tagebuch- und Briefwerk. Virginia Woolf nahm sich am 28. März 1941 in dem Fluß Ouse bei Lewes (Sussex) das Leben.
Klaus Reichert, 1938 geboren, ist Literaturwissenschaftler, Autor, Übersetzer und Herausgeber. Von 1964 bis 1968 war er Lektor in den Verlagen Insel und Suhrkamp, von 1975 bis 2003 war er Professor für Anglistik und Amerikanistik an der Frankfurter Universität, 1993 gründete er das »Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit«. Von 2002 bis 2011 war er Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Er schrieb Bücher über Shakespeare, Joyce, moderne Literatur und über die Geschichte und Theorie des Übersetzens, veröffentlichte drei Gedichtbände und ein Wüstentagebuch. Er übersetzte u.a. Shakespeare, Lewis Carroll, Joyce, John Cage und das Hohelied Salomos. Er war Herausgeber der deutschen Ausgabe von James Joyce und gibt seit 1989 im S. Fischer Verlag die Werke Virginia Woolfs heraus. Bei S. Fischer erschien seine Prosaübersetzung der Sonette Shakespeares.
Claudia Wenner, Schriftstellerin, Publizistin und Übersetzerin. Sie lebt abwechselnd in Frankfurt und Pondicherry. Für S. Fischer übertrug sie die Tagebücher von Virginia Woolf, für die Neue Zürcher Zeitung schreibt sie regelmäßig über Indien.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Vorbemerkung
Frühe Erzählungen
[Phyllis und Rosamond]
Der mysteriöse Fall von Miss V.
[Das Tagebuch der Mistress Joan Martyn]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Letzte Seiten
[Ein Dialog auf dem Berg Pentelicus]
Memoiren einer Romanautorin
1917–1921
Das Mal an der Wand
Kew Gardens
Die Abendgesellschaft
Feste Gegenstände
Beileid
Ein ungeschriebener Roman
Ein verwunschenes Haus
Ein Verein
Montag oder Dienstag
Das Streichquartett
Blau & Grün
Grün
Blau
1922–1925
Ein Frauencollege von außen
Im Obstgarten
Mrs Dalloway in der Bond Street
Schwester Lugtons Vorhang
Die Witwe und der Papagei:Eine wahre Geschichte
Das neue Kleid
Glück
Vorfahren
Vorgestellt werden
Zusammen und getrennt
Der Mann, der seinesgleichen liebte
Eine einfache Melodie
Ein Resümee
1926–1941
Augenblicke des Seins:»Slater-Nadeln haben keine Spitzen«
Die Dame im Spiegel:Eine Reflexion
Die Faszination des Teichs
Drei Bilder
Das erste Bild
Das zweite Bild
Das dritte Bild
Szenen aus dem Leben eines britischen Marineoffiziers
Miss Pryme
Ode teils in Prosa geschrieben ausgelöst durch den NamenCutbush über einem Metzgerladen in Pentonville
[Porträts]
Warten aufs Déjeuner
Die Französin im Zug
Porträt 3
[Porträt 4]
[Porträt 5]
[Porträt 6]
[Porträt 7]
[Porträt 8]
Onkel Wanja
Die Herzogin und der Juwelier
Die Jagdgesellschaft
Lappin und Lapinova
Der Suchscheinwerfer
Gipsy, die Promenadenmischung
Das Erbe
Das Symbol
Der Badeort
Anmerkungen
[Phyllis und Rosamond]
Der mysteriöse Fall von Miss V. (The Mysterious Case of Miss V.)
[Das Tagebuch der Mistress Joan Martyn] (The Journal of Mistress Joan Martyn)
[Ein Dialog auf dem Berg Pentelicus] (A Dialogue upon Mount Pentelicus)
Memoiren einer Romanautorin (Memoirs of a Novelist)
Das Mal an der Wand (The Mark on the Wall)
Kew Gardens
Die Abendgesellschaft (The Evening Party)
Feste Gegenstände (Solid Objects)
Beileid (Sympathy)
Ein ungeschriebener Roman (An Unwritten Novel)
Ein verwunschenes Haus (A Haunted House)
Ein Verein (A Society)
Montag oder Dienstag (Monday or Tuesday)
Das Streichquartett (The String Quartet)
Blau & Grün (Blue & Green)
Ein Frauencollege von außen (A Woman's College from Outside)
Im Obstgarten (In the Orchard)
Mrs Dalloway in der Bond Street (Mrs Dalloway in Bond Street)
Schwester Lugtons Vorhang (Nurse Lugton's Curtain)
Die Witwe und der Papagei: Eine wahre Geschichte(The Widow and the Parrot: A True Story)
Das neue Kleid (The New Dress)
Glück (Happiness)
Vorfahren (Ancestors)
Vorgestellt werden (The Introduction)
Zusammen und getrennt (Together and Apart)
Der Mann, der seinesgleichen liebte (The Man Who Loved His Kind)
Eine einfache Melodie (A Simple Melody)
Ein Resümee (A Summing Up)
Augenblicke des Seins: »Slater-Nadeln haben keine Spitzen« (Moments of Being: ›Slater's Pins Have No Points‹)
Die Dame im Spiegel: Eine Reflexion (The Lady in the Looking-Glass: A Reflection)
Die Faszination des Teichs (The Fascination of the Pool)
Drei Bilder (Three Pictures)
Szenen aus dem Leben eines britischen Marineoffiziers (Scenes from the Life of a British Naval Officer)
Miss Pryme
Ode teils in Prosa geschrieben … (Ode Written Partly in Prose on Seeing the Name of Cutbush Above a Butcher's Shop in Pentonville)
[Porträts] (Portraits)
Onkel Wanja (Uncle Vanya)
Die Herzogin und der Juwelier (The Duchess and the Jeweller)
Die Jagdgesellschaft (The Shooting Party)
Lappin und Lapinova
Der Suchscheinwerfer (The Searchlight)
Gipsy, die Promenadenmischung (Gipsy, the Mongrel)
Das Erbe (The Legacy)
Das Symbol
Der Badeort (The Watering Place)
Vorbemerkung
Nur etwa ein Drittel der in diesem Band gesammelten erzählenden Prosa ist von Virginia Woolf veröffentlicht oder zur Publikation vorbereitet worden. Der Rest fand sich in unterschiedlichen Formen der Verarbeitung – manchmal nur als Entwurf, manchmal in mehreren Fassungen – im Nachlaß. Unser Band folgt den von Susan Dick hergestellten Fassungen, die in ihrer Edition der Complete Shorter Fiction (Hogarth Press 1986 und 1989) erschienen sind.
Der Band bietet einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung der Schriftstellerin. Die erste Erzählung stammt von 1906, kurz nachdem sie mit knappen Essays erstmals an die Öffentlichkeit getreten war, die letzte wurde wenige Wochen vor ihrem Tod, am 28. März 1941, geschrieben. Dazwischen werden wir Zeugen der alles andere als geradlinigen Entwicklung dieser Autorin. Durchkomponierte Kurzgeschichten im konventionellen Sinne stehen neben experimentierenden Skizzen, Impressionen neben eher essayistischen Stücken (wie überhaupt die Grenze zum Essay nicht immer scharf zu ziehen ist, so wie umgekehrt sich in den als Essay ausgegebenen Texten immer wieder erzählende Passagen finden). Häufig benutzt Virginia Woolf die kleine Form, um Möglichkeiten auszuprobieren, die im bisherigen Roman noch nicht genutzt wurden, ihr eigenes Schreiben aber im Hinblick auf die größere Form vorbereiten könnte. So verwies sie, als sie sich an ihren ersten »modernistischen« Roman, Jacob's Room, traute, auf die Vorbildhaftigkeit von Prosastücken wie ›Das Mal an der Wand‹, ›Ein ungeschriebener Roman‹ und ›Kew Gardens‹. Von besonderem Interesse sind die Erzählungen aus dem Umkreis des Romans Mrs Dalloway: sie zeigen, in welche Richtungen der Roman nicht gegangen ist und werfen doch zugleich ein neues Licht auf seine Figuren, zumal auch auf solche, die ganz an seinem Rand stehen. Andere Erzählungen ergaben sich als Nebenprodukte beim Schreiben der großen Romane, und wieder andere verdanken ihre Entstehung dem Auftrag einer Zeitschrift.
In ihrer Mischung aus durchgearbeitetem Text und Entwurf, Erzählung und Experiment, Kunst und Tagesschriftstellerei, geben die Stücke dieses Bandes zugleich einen Querschnitt durch das Gesamtwerk, der in dieser Art bisher noch nicht sichtbar war.
K.R.
Frühe Erzählungen
[Phyllis und Rosamond]
In diesem äußerst merkwürdigen Zeitalter, da wir anfangen, nach Bildern von Menschen zu verlangen, nach ihren Ansichten und ihren Überkleidern, mag eine getreue Skizze, die weniger gekonnt als wahrhaftig gezeichnet ist, eventuell von einigem Wert sein.
Ein jeder sollte, habe ich neulich gehört, die Einzelheiten seines Tagewerks aufschreiben; die Nachwelt wird sich über das Verzeichnis genauso freuen, wie wir uns freuen würden, hätten wir Aufzeichnungen darüber, wie der Türhüter des Globe Theaters und der Mann, der den Parkeingang bewachte, am 18. März im Jahre des Herrn 1568 den Samstag verbrachten.
Und da die Porträts, die wir haben, fast ausnahmslos dem männlichen Geschlecht angehören, das mit größter Auffälligkeit über die Bühne stolziert, scheint es sich zu lohnen, eine der vielen Frauen als Modell zu nehmen, die sich im Schatten drängen. Denn das Studium der Geschichte und Biographie überzeugt jeden vernünftigen Menschen davon, daß diese obskuren Gestalten eine ganz ähnliche Stelle einnehmen wie die Hand des Puppenspielers beim Tanz der Marionetten; und der Finger legt sich aufs Herz. Es stimmt, daß unsere einfältigen Augen jahrhundertelang geglaubt haben, die Figuren würden von selbst tanzen und ihre Schritte eigenständig wählen; und das bißchen Licht, das die Romanciers und die Historiker auf diesen dunklen, überfüllten Ort hinter den Kulissen zu werfen begonnen haben, hat uns bisher nur gezeigt, wie viele Fäden dort sind, die von obskuren Händen gehalten werden, von deren Rucks und Drehungen die ganze Tanzfigur abhängt. Diese einleitenden Worte führen uns an unseren Ausgangspunkt zurück; wir haben vor, so unverwandt wie möglich eine kleine Gruppe zu betrachten, die hier und heute lebt (am 20. Juni 1906); und die aus verschiedenen Gründen, die noch zu nennen sind, die Eigenschaften vieler zu verkörpern scheinen. Ihr Fall ist weit verbreitet, weil es schließlich viele junge Frauen gibt, die die Kinder wohlhabender, angesehener und hochgestellter Eltern sind; und sie alle müssen mit sehr ähnlichen Problemen konfrontiert sein, und leider kann es nur eine kleine Anzahl von Antworten für sie geben.
Sie seien zu fünft, allesamt Töchter, werden sie Ihnen trübselig erklären: ihr Leben lang anscheinend voller Bedauern über diesen Anfangsfehler ihrer Eltern. Überdies teilen sie sich in zwei Lager: zwei Schwestern stehen gegen zwei andere; die fünfte wechselt zwischen ihnen hin und her. Die Natur hat zweien ein robustes, kampflustiges Gemüt mitgegeben, das sich erfolgreich und recht glücklich politischer Ökonomie und sozialen Problemen widmet; während die anderen beiden leichtfertiger, häuslicher geraten sind, von weicherem und sensiblerem Temperament. Diese beiden sind folglich dazu verdammt, das zu sein, was man mit dem Jargon der Zeit als »höhere Töchter« bezeichnet. Ihre Schwestern, die sich für die Schulung ihres Intellekts entschieden haben, gehen auf die Universität, sind dort erfolgreich und heiraten Professoren. Ihre Karrieren ähneln denen der Männer so sehr, daß es sich kaum lohnt, sie eigens zum Gegenstand einer Untersuchung zu erheben. Die fünfte Schwester hat keinen so ausgeprägten Charakter wie die anderen vier; aber sie heiratet mit zweiundzwanzig, so daß ihr kaum Zeit bleibt, die charakteristischen Merkmale des höheren Töchtertums zu entwickeln, die zu beschreiben wir uns vorgenommen haben. In den beiden »höheren Töchtern« Phyllis und Rosamond, wie wir sie nennen wollen, findet sich ausgezeichnetes Material für unsere Untersuchung.
Ein paar Fakten werden uns helfen, ihren Standort zu bestimmen, bevor wir mit den Untersuchungen beginnen. Phyllis ist achtundzwanzig, Rosamond ist vierundzwanzig. Sie sehen hübsch, rotbackig und lebhaft aus; ein neugieriger Blick wird keine ebenmäßig schönen Züge finden; aber Kleidung und Haltung verleihen ihnen die Wirkung der Schönheit ohne deren Substanz. Ihre Heimat ist anscheinend der Salon, so als seien sie in seidenen Abendkleidern geboren und hätten niemals härtere Erde beschritten als den türkischen Teppich oder sich auf rauheren Boden zurückgelegt als den Lehnstuhl oder das Sofa. Wenn man sie in einem Salon sieht, der voll mit gutgekleideten Männern und Frauen ist, sieht man den Makler an der Börse oder den Rechtsanwalt im Temple. Dies, verkündet jede Bewegung und jedes Wort, ist Heimatluft für sie; ihr Geschäftslokal, ihre Berufsarena. Eindeutig üben sie hier die Künste aus, in denen sie seit ihrer Kindheit unterwiesen worden sind. Vielleicht erringen sie hier ihre Siege und verdienen sich ihr Brot. Aber es wäre ebenso ungerecht wie leicht, diese Metapher so zu strapazieren, daß sie suggeriert, der Vergleich sei durchweg angemessen und vollständig. Er hinkt; aber wo er hinkt und warum, dies herauszufinden wird etwas Zeit und Aufmerksamkeit benötigen.
Man muß in der Lage sein, diesen jungen Damen bis nach Hause nachzugehen und ihre Kommentare bei brennender Schlafzimmerkerze zu hören. Man muß bei ihnen sein, wenn sie am nächsten Morgen aufwachen; und man muß den ganzen Tag über dabei sein, während sie sich fortbewegen. Wenn man das nicht nur einen Tag sondern viele Tage getan hat, dann wird man den Wert jener Eindrücke ermessen können, die man abends im Salon erhalten wird.
Folgendes kann von der hier verwendeten Metapher beibehalten werden; daß die Szene im Salon Arbeit für sie bedeutet und nicht Spiel. Soviel wird ziemlich deutlich an der Szene auf der Heimfahrt im Wagen. Lady Hibbert ist eine strenge Kritiker in solcher Aufführungen; sie hat bemerkt, ob ihre Töchter gut ausgesehen, gut gesprochen, sich gut benommen haben; ob sie die richtigen Leute angezogen und die falschen abgestoßen haben; ob der Eindruck, den sie insgesamt hinterlassen haben, günstig war. An der Vielzahl und Genauigkeit ihrer Kommentare läßt sich leicht erkennen, daß zwei Stunden Unterhaltung für Künstler dieser Art ein sehr heikles und kompliziertes Stück Arbeit sind. Vieles scheint davon abzuhängen, wie sie die Kommentare aufnehmen. Die Töchter antworten gehorsam und schweigen dann, ganz gleich ob die Mutter lobt oder schimpft: und ihr Tadel ist scharf. Wenn sie endlich allein sind, und sie haben ganz oben in einem großen häßlichen Haus ein gemeinsames Schlafzimmer von bescheidener Größe, breiten sie die Arme aus und fangen vor Erleichterung zu seufzen an. Ihr Gespräch ist nicht sehr erbaulich; es ist der »Laden« der Geschäftsleute; sie rechnen ihren Gewinn und ihren Verlust aus und offenbar liegt ihnen nichts als das eigene Interesse am Herzen. Und trotzdem hätte man sie über Bücher und Theaterstücke und Gemälde plaudern hören können, als seien dies die Dinge, die ihnen am meisten bedeuteten; als seien Diskussionen darüber das einzige Motiv für eine »Gesellschaft«.
Dennoch wird man auch in dieser Stunde unschöner Ehrlichkeit etwas beobachten, was ebenfalls sehr aufrichtig, aber keineswegs häßlich ist. Die Schwestern hatten sich wahrhaftig gern. Ihre Zuneigung hat großenteils die Form des Freimaurertums angenommen, die alles andere als sentimental ist; alle ihre Hoffnungen und Ängste tragen sie gemeinsam; aber es ist ein echtes Gefühl, tief, trotz seines prosaischen Äußeren. Sie sind absolut redlich im Umgang miteinander; und es liegt sogar etwas Ritterliches in der Haltung der jüngeren Schwester gegenüber der älteren. Sie, als die Schwächere aufgrund ihres höheren Alters, muß immer das Beste haben. Auch liegt ein gewisses Pathos in der Dankbarkeit, mit der Phyllis den Vorrang akzeptiert. Aber es wird spät, und mit Rücksicht auf ihren Teint erinnern sich diese geschäftstüchtigen jungen Frauen gegenseitig, daß es Zeit ist, das Licht auszumachen.
Trotz dieser Vorsorge schlafen sie morgens nach dem Wecken gerne weiter. Doch Rosamond springt auf und schüttelt Phyllis.
»Phyllis, wir kommen zu spät zum Frühstück.«
Dieses Argument mußte von einiger Überzeugungskraft gewesen sein, denn Phyllis stand auf und begann sich schweigend anzukleiden. Aber ihre Eile gestattete ihnen doch, die Kleider mit viel Geschick und Sorgfalt anzulegen, und beide Schwestern begutachteten abwechselnd das Ergebnis mit peinlicher Genauigkeit, bevor sie nach unten gingen. Die Uhr schlug neun, als sie das Frühstückszimmer betraten: ihr Vater war schon da, küßte die Töchter flüchtig, streckte die Tasse nach Kaffee aus, las seine Zeitung und verschwand. Es war eine schweigende Mahlzeit. Lady Hibbert nahm das Frühstück in ihrem Zimmer ein; aber nach dem Frühstück mußten sie ihr einen Besuch abstatten, um die Anweisungen für den Tag von ihr entgegenzunehmen, und während die eine Notizen für sie machte, plante die andere Mittag- und Abendessen mit der Köchin. Gegen elf waren sie vorübergehend frei und trafen sich im Schulzimmer, wo die jüngste Schwester Doris, die sechzehn Jahre alt war, einen Aufsatz über die Magna Charta auf französisch schrieb.1 Ihre Klagen über die Unterbrechung – denn sie träumte bereits von einer Eins im Examen – wurden mit wenig Respekt aufgenommen. »Wir müssen hier sitzen, weil wir sonst nirgends sitzen können,« bemerkte Rosamond. »Du brauchst nicht zu denken, daß wir ohne dich nicht sein können,« fügte Phyllis hinzu. Aber diese Bemerkungen wurden ohne Bitterkeit gesprochen und waren bloß Plattheiten des täglichen Lebens.
Aus Achtung vor ihrer Schwester nahm Phyllis jedoch einen Band Anatole France zur Hand und Rosamond klappte die Greek Studies von Walter Pater2 auf. Eine Weile lasen sie schweigend; dann klopfte ein Dienstmädchen, ganz außer Atem, und teilte mit, daß »Ihre Ladyschaft die jungen Damen im Salon zu sehen wünsche.« Sie stöhnten. Rosamond erbot sich, allein zu gehen; Phyllis sagte nein, sie seien beide die Opfer; und schmollend gingen sie nach unten und fragten sich dabei, was man wohl von ihnen wollte. Lady Hibbert erwartete sie ungeduldig.
»Oh, da seid ihr ja endlich,« rief sie aus. »Euer Vater läßt euch ausrichten, daß er Mr Middleton und Sir Thomas Carew zum Mittagessen gebeten hat. Was für eine unangenehme Idee von ihm! Ich weiß wirklich nicht, wie er darauf kommt, sie herzubitten, und wir haben noch kein Mittagessen – und wie ich sehe, hast du dich nicht um den Blumenschmuck gekümmert, Phyllis; und Rosamond, ich möchte, daß du einen sauberen Latz in mein kastanienbraunes Kleid nähst. Meine Güte, wie rücksichtslos die Männer sind.«
Die Töchter waren an solche Insinuationen gegen ihren Vater gewöhnt: im großen und ganzen ergriffen sie Partei für ihn, sagten es aber nie.
Sie gingen nun schweigend ihren unterschiedlichen Aufträgen nach: Phyllis mußte Blumen kaufen und einen zusätzlichen Gang für das Mittagessen; und Rosamond setzte sich an ihre Näharbeit.
Als sie ihre Aufgaben endlich erledigt hatten, blieb ihnen kaum noch Zeit, sich fürs Mittagessen umzukleiden; aber um halb zwei kamen sie rosig und lächelnd in den prunkvollen großen Salon. Mr Middleton war Sir William Hibberts Sekretär; ein recht angesehener junger Mann mit Zukunft, wie Lady Hibbert ihn charakterisierte; den man vielleicht ermutigen könnte. Sir Thomas war Beamter im selben Amt, solide und gichtig, eine hübsche Portion auf dem Parkett, aber ohne eigene Bedeutung.
Beim Mittagessen ergab sich dann eine lebhafte Unterhaltung zwischen Mr Middleton und Phyllis, während die Älteren mit sonoren tiefen Stimmen Banalitäten austauschten. Rosamond saß ziemlich schweigsam da, wie es ihrer Gewohnheit entsprach; und spekulierte dabei heftig über den Charakter des Sekretärs, der vielleicht ihr Schwager werden würde; und überprüfte bestimmte Theorien, die sie aufgestellt hatte, an jedem neuen Wort, das er sprach. Es bestand offenes Einvernehmen darüber, daß Mr Middleton die Partie ihrer Schwester war; sie griff nicht ein. Wenn man ihre Gedanken hätte lesen können, während sie Sir Thomas' Geschichten über das Indien der sechziger Jahre lauschte, hätte man festgestellt, daß sie mit etwas abstrusen Kalkulationen beschäftigt war; Klein-Middleton, wie sie ihn nannte, war ganz in Ordnung; er hatte Verstand; er war, das wußte sie, ein guter Sohn und würde einen guten Ehemann abgeben. Auch war er wohlhabend und würde seinen Weg im Staatsdienst machen. Andererseits sagte ihr ihr psychologischer Scharfsinn, daß er engstirnig war, ohne eine Spur von Phantasie oder Intellekt, in dem Sinne, wie sie Intellekt verstand; und sie kannte ihre Schwester gut genug, um zu wissen, daß sie diesen tüchtigen aktiven kleinen Mann niemals lieben, wenn sie ihn auch achten würde. Die Frage war, sollte sie ihn heiraten? An diesem Punkt war sie angelangt, als Lord Mayo einem Attentat zum Opfer fiel;3 und während leise Ohs und Ahs des Grauens über ihre Lippen drangen, telegraphierten ihre Augen über den Tisch, »ich habe meine Zweifel«. Hätte sie genickt, so hätte ihre Schwester mit der Ausübung derjenigen Künste begonnen, durch die schon viele Heiratsanträge garantiert worden waren. Rosamond wußte jedoch noch nicht genug, um eine Entscheidung zu treffen. Sie telegraphierte nur, »Halte ihn bei der Stange«.
Die Herren gingen bald nach dem Mittagessen, und Lady Hibbert machte Anstalten, sich zur Ruhe zu begeben. Aber bevor sie ging, rief sie Phyllis zu sich.
»Nun, meine Liebe«, sagte sie, mit größerer Zuneigung als sie bisher gezeigt hatte, »war es ein erfreuliches Essen für dich? War Mr Middleton ansprechend?« Sie tätschelte die Wange ihrer Tochter und sah ihr tief in die Augen.
Eine Laune des Mutwillens kam über Phyllis und sie antwortete lustlos, »oh, der kleine Mann ist nicht schlecht; aber begeistern tut er mich nicht.«
Lady Hibberts Gesichtsausdruck veränderte sich auf der Stelle: war sie zuvor noch als wohlwollende Katze erschienen, die aus philanthropischen Motiven mit einer Maus spielte, so war sie jetzt das bitterernste wirkliche Tier.
»Denk daran«, sagte sie barsch, »es kann nicht ewig so weitergehen. Versuch ein bißchen weniger selbstsüchtig zu sein, meine Liebe.« Wenn sie laut geflucht hätte, hätten ihre Worte kaum unangenehmer klingen können.
Sie rauschte davon, und die beiden Mädchen sahen sich mit ausdrucksvoll verzerrten Mündern an.
»Ich konnte nicht anders«, sagte Phyllis schwach lachend. Laß uns jetzt eine Ruhepause einlegen. Ihre Ladyschaft braucht uns erst wieder um vier.
Sie gingen ins Schulzimmer hinauf, das jetzt leer war; und warfen sich in tiefe Sessel. Phyllis zündete sich eine Zigarette an und Rosamond lutschte Pfefferminzbonbons, als würden sie Gedanken auslösen.
»Also, meine Liebe«, sagte Phyllis schließlich, »zu welchem Entschluß kommen wir? Wir haben jetzt Juni; die Eltern geben mir bis Juli Zeit: Klein-Middleton ist der einzige.
»Außer –« fing Rosamond an.
»Ja, aber an ihn zu denken ist zwecklos.«
»Arme Phyllis! Na, er ist ja kein schlechter Mann.«
»Anständig, nüchtern, aufrichtig, fleißig. Oh, wir würden ein Musterpaar abgeben! Du solltest bei uns in Derbyshire wohnen.«
»Vielleicht findest du einen besseren«, fuhr Rosamond fort; mit der nachdenklichen Miene eines Richters. »Andererseits werden sie das nicht mehr lange mitmachen.« »Sie« bedeutete Sir William und Lady Hibbert.
»Vater hat mich gestern gefragt, was ich anfangen wollte, wenn ich nicht heiraten würde. Ich wußte nichts zu sagen.«
»Nein, wir sind für die Ehe erzogen worden.«
»Du hättest etwas Besseres tun können. Ich bin natürlich ein Dummkopf, also ist es egal.«
»Und ich halte die Ehe für das Beste, was es gibt – wenn man den Mann heiraten dürfte, den man will.«
»Oh ich weiß: es ist gemein. Trotzdem müssen wir den Tatsachen ins Auge sehen.«
»Middleton«, sagte Rosamond kurz. »Er ist im Moment die Tatsache. Bedeutet er dir etwas?«
»Nicht das geringste.«
»Könntest du ihn heiraten?«
»Wenn ihre Ladyschaft mich dazu zwänge.«
»Es wäre jedenfalls ein Ausweg.«
»Was hältst du denn nun von ihm?« fragte Phyllis, die jeden Mann auf den Rat ihrer Schwester hin akzeptiert oder abgewiesen hätte. Rosamond, die über einen durchaus scharfen und fähigen Verstand verfügte, war gezwungen, ihn ausschließlich mit dem menschlichen Charakter zu ernähren, und da ihre Wissenschaft nur in geringem Maße von persönlichen Vorurteilen getrübt war, waren ihre Ergebnisse im allgemeinen verläßlich.
»Er ist sehr gut«, fing sie an; »ausgezeichnete moralische Qualitäten: klarer Verstand: er wird natürlich Erfolg haben: kein Fünkchen Phantasie oder Romantik: er würde dich sehr gerecht behandeln.«
»Kurzum, wir wären ein würdiges Paar: ungefähr wie unsere Eltern!«
»Die Frage ist«, fuhr Rosamond fort; »lohnt es sich, noch ein Jahr in Knechtschaft zu verbringen, bis der nächste auftaucht? Und wer ist der nächste? Simpson, Rogers, [Leiscetter?].«
Bei jedem Namen verzog ihre Schwester das Gesicht.
»Das Fazit ist anscheinend: auf der Stelle treten und den äußeren Schein wahren.«
»Ach wir wollen uns doch amüsieren, solange es noch geht! Wenn du nicht wärst, Rosamond, hätte ich schon ein dutzendmal geheiratet.«
»Du hättest bereits die Scheidung eingereicht, meine Liebe.«
»Dafür bin ich zu rechtschaffen. Ich bin sehr schwach ohne dich. Und jetzt laß uns über deine Angelegenheiten sprechen.«
»Meine Angelegenheiten können warten«, sagte Rosamond entschlossen. Und die beiden jungen Frauen sprachen mit Scharfsinn und ohne die geringste Barmherzigkeit über die Charaktere ihrer Freunde, bis es an der Zeit war, sich von neuem umzukleiden. Aber zwei Dinge sind an ihrem Gespräch bemerkenswert. Erstens, daß sie den Intellekt hoch in Ehren hielten und zum Angelpunkt ihrer Untersuchung machten; zweitens, daß immer dann, wenn sie ein unglückliches Zuhause oder eine enttäuschte Liebe vermuteten, ihr Urteil sogar im unattraktivsten Falle immer gleichermaßen liebenswürdig und verständnisvoll ausfiel.
Um vier fuhren sie mit Lady Hibbert aus, um Besuche zu machen. Diese Vorführung bestand darin, daß man feierlich von einem Haus zum nächsten fuhr, dorthin, wo man zum Abendessen gewesen war oder zu Abend zu essen hoffte, und dem Dienstboten zwei oder drei Karten in die Hand drückte. In ein Haus gingen sie hinein und tranken eine Tasse Tee und redeten genau fünfzehn Minuten lang über das Wetter. Zum Schluß fuhren sie langsam durch den Park, als eine der fröhlichen Kutschen, die sich um diese Zeit in einer Prozession im Schrittempo um das Achillesstandbild bewegten. Lady Hibbert lächelte in einem fort dasselbe unwandelbare Lächeln.
Um sechs Uhr waren sie wieder zu Hause und fanden Sir William vor, der einen älteren Cousin und seine Frau zum Tee zu Gast hatte. Bei diesen Leuten konnte man auf alle Förmlichkeit verzichten, und Lady Hibbert ging weg, um sich hinzulegen; und überließ es ihren Töchtern, sich danach zu erkundigen, wie es John ging und ob Milly die Masern gut überstanden hätte. »Denk daran; wir sind um acht zum Essen eingeladen, William,« sagte sie, als sie aus dem Zimmer ging.
Phyllis begleitete die beiden; Gastgeber der Gesellschaft war ein Richter von hohem Rang, und sie hatte einen angesehenen K.C.4 zu unterhalten; in eine Richtung zumindest konnten ihre Bemühungen zwanglos sein; und der Blick ihrer Mutter ruhte gleichgültig auf ihr. Es war wie ein Schluck klares kaltes Wasser, überlegte Phyllis, dieses Gespräch über unpersönliche Gegenstände mit einem intelligenten älteren Herrn. Sie theoretisierten nicht, sondern er erzählte von Tatsachen, und sie war froh über die Erkenntnis, daß die Welt voller handfester Dinge war, die nicht von ihrem Leben abhängig waren.
Als sie gingen, sagte sie zu ihrer Mutter, sie sehe noch bei den Tristrams vorbei, wo sie Rosamond treffen wolle. Lady Hibbert machte einen Schmollmund, zuckte die Schultern und sagte, »nun gut«, so als hätte sie Einspruch erhoben, wenn sie eine ausreichend gute Begründung zur Hand gehabt hätte. Aber Sir William wartete und ein Stirnrunzeln war ihr einziger Kommentar.
So ging Phyllis allein in das entfernte und wenig gefragte Londoner Viertel, in dem die Tristrams wohnten. Das war eine der vielen beneidenswerten Seiten an ihrem Schicksal. Die Stuckfassaden, die untadeligen Häuserreihen von Belgravia und South Kensington erschienen Phyllis als Sinnbild ihres eigenen Schicksals; eines Lebens, das am Spalier gezogen wird, damit es in einem häßlichen Muster wächst und zur seriösen Häßlichkeit seiner Gefährten paßt. Aber wenn man hier in Bloomsbury leben würde, fing sie an zu theoretisieren und wedelte mit der Hand, als die Droschke über die großen ruhigen Plätze, unter dem zarten Grün schattenspendender Bäume, dahinfuhr, könnte man aufwachsen wie man wollte. Da war Raum und Freiheit und im prächtigen Tosen der Strand5 erkannte sie die Lebenswirklichkeit der Welt, von der ihr Stuck und ihre Säulen sie so vollständig abschirmten.
Ihre Droschke hielt vor ein paar erleuchteten Fenstern, die offen waren in der Sommernacht und von der Unterhaltung und dem Leben drinnen etwas aufs Trottoir schwappen ließen. Sie wartete ungeduldig, daß die Tür aufging, auf daß sie eintreten und teilnehmen könnte. Als sie jedoch im Zimmer stand, wurde sie sich ihres Äußeren bewußt, das, wie sie auswendig wußte, bei solchen Anlässen dem der Damen glich, die Romney gemalt hatte.6 Sie sah sich den verrauchten Raum betreten, wo Leute auf dem Boden saßen und die Gastgeberin einen Jagdrock trug, den schelmischen kleinen Kopf hoch erhoben hielt und den Mund spitzte, wie um eine Sentenz von sich zu geben. In ihrem weißen Seidenkleid mit den kirschroten Bändern fiel sie auf. Mit dem Gefühl, anders als die anderen zu sein, saß sie sehr schweigsam da und nutzte die Anknüpfungspunkte kaum, die man ihr in der Unterhaltung bot. Mit einem Gefühl der Verwirrung sah sie sich immer wieder das Dutzend Leute an, das dort saß. Man sprach über bestimmte Bilder, die gerade ausgestellt waren, und diskutierte ihren Gehalt von einem eher technischen Standpunkt aus. Wo sollte Phyllis anfangen? Sie hatte sie gesehen; aber sie wußte, daß ihre Platitüden niemals die Prüfung aus Fragen und Kritik bestehen würden, der sie ausgesetzt wäre. Und es gab hier, das wußte sie, auch nicht die Möglichkeit, jene weibliche Anmut zu entfalten, mit der man so viel verschleiern konnte. Die Zeit ging vorbei; denn die Diskussion war hitzig und ernst, und keiner der Streitenden wollte von unlogischen Sprüchen ein Bein gestellt bekommen. Also saß sie da und sah zu und fühlte sich dabei wie ein Vogel mit gestutzten Flügeln; und wesentlich unbehaglicher, da es diesmal ernst war, als sie sich je auf einem Ball oder bei einem Stück gefühlt hatte. Sie wiederholte sich das kleine bittere Axiom, daß sie sich zwischen zwei Stühle gesetzt habe; und versuchte inzwischen, ihren Kopf zu gebrauchen und nüchtern dem zu folgen, was gesagt wurde. Rosamond gab ihr aus der anderen Ecke des Zimmers zu verstehen, daß sie sich im selben Dilemma befand.
Schließlich löste sich der Disput auf und das Gespräch wurde wieder allgemein; aber niemand entschuldigte sich für den konzentrierten Charakter, den es gehabt hatte, und die allgemeine Unterhaltung hatte, fanden die Miss Hibberts, wenn sie sich trivialeren Themen zuwandte, die Tendenz, das Banale zu verachten, und man zögerte nicht, das auch zu sagen. Aber es war amüsant; und Rosamond machte ihre Sache lobenswert, als sie über einen bestimmten Charakter redete, der zur Sprache kam; obwohl sie überrascht war, daß ihre tiefgründigsten Entdeckungen als Ausgangspunkt für weitere Fragestellungen genommen wurden und keinerlei Ergebnisse darstellten.
Zudem waren die Miss Hibberts überrascht und ein wenig bestürzt darüber, zu entdecken, wieviel Erziehung an ihnen hängengeblieben war. Phyllis hätte sich im nächsten Augenblick schlagen können, als sie instinktiv einen Witz über das Christentum mißbilligte, den die Tristrams von sich gaben, und applaudierte so obenhin, als sei die Religion etwas ganz Unwichtiges.
Noch erstaunter waren die Miss Hibberts jedoch über die Art, auf die in ihrem eigenen Geschäftsbereich verhandelt wurde; denn sie glaubten, daß selbst in dieser seltsamen Atmosphäre »die Tatsachen des Lebens« zählten. Miss Tristram, eine junge Frau von großer Schönheit und eine wirklich vielversprechende Künstlerin, diskutierte mit einem Herrn über die Ehe, der, soweit man das beurteilen konnte, durchaus ein persönliches Interesse an der Frage hätte haben können. Aber die Freiheit und Offenheit, mit der die beiden ihre Ansichten darlegten und über das gesamte Thema Liebe und Ehe theoretisierten, schien die ganze Sache in ein neues Licht zu stellen, das erschreckend genug war. Es faszinierte die jungen Damen mehr als alles andere, was sie bisher gesehen oder gehört hatten. Sie hatten sich eingebildet, das Thema von allen Seiten und unter allen Gesichtspunkten zu kennen; aber das hier war nicht nur etwas Neues, sondern ohne Frage etwas Authentisches.
»Mir ist noch nie ein Heiratsantrag gemacht worden; ich frage mich, wie das ist«, sagte die offene nachdenkliche Stimme der jüngeren Miss Tristram; und Phyllis und Rosamond hatten das Gefühl, sie müßten zur Belehrung der Gesellschaft von ihren Erfahrungen erzählen. Aber sie konnten diese seltsame neue Sicht der Dinge auch nicht übernehmen, und ihre Erfahrungen waren schließlich von ganz anderer Art. Die Liebe war für sie etwas, das von bestimmten kalkulierten Handlungen hervorgerufen wurde; und man pflegte sie in Ballsälen, in duftenden Wintergärten, durch Augen-Blicke, Fächerblitze und einen stockenden zweideutigen Tonfall. Die Liebe hier war eine widerstandsfähige, aufrichtige Sache, die im Tageslicht hervorstach, nackt und handfest, die beklopft und untersucht werden konnte, wie man es für richtig hielt. Selbst wenn man es ihnen freigestanden hätte, zu lieben, wie sie wollten, hatten Phyllis und Rosamond starke Zweifel, ob sie auf diese Weise lieben konnten. In ihrer jugendlichen Impulsivität verdammten sie sich selbst zutiefst und kamen zu dem Schluß, daß alle ihre Freiheitsbestrebungen vergeblich wären: die lange Gefangenschaft hatte sie innen und außen gleichermaßen vergiftet.
So saßen sie, ohne sich ihres Schweigens bewußt zu sein, wie Menschen, die man von einem Fest ausgeschlossen hat in der Kälte und im Wind; unsichtbar für die Feiernden im Haus. Aber in Wirklichkeit wurde die Gegenwart dieser beiden schweigenden jungen Frauen mit den hungrigen Augen von allen Anwesenden als bedrückend empfunden; obwohl sie nicht genau wußten, warum; vielleicht langweilten sie sich. Die Miss Tristrams fühlten sich jedoch verantwortlich; und Miss Sylvia Tristram, die jüngere, ließ sich auf ein Flüstern hin auf ein vertrauliches Gespräch mit Phyllis ein. Phyllis schnappte danach wie ein Hund nach dem Knochen; tatsächlich trug ihr Gesicht einen abgezehrten und heißhungrigen Ausdruck, während sie die Augenblicke vorüberfliegen sah, und die Essenz dieses merkwürdigen Abends ging über ihren Verstand. Wenn sie schon nicht Anteil nehmen konnte, konnte sie wenigstens erklären, was sie daran hinderte. Sie wollte sich zu gern beweisen, daß es gute Gründe für ihre Ohnmacht gab; und wenn sie merken würde, daß Miss Sylvia trotz ihrer unpersönlichen Verallgemeinerungen eine handfeste Frau war, bestand die Hoffnung, daß sie sich vielleicht eines Tages auf einer gemeinsamen Basis begegneten. Als Phyllis sich vorbeugte, um zu sprechen, hatte sie das seltsame Gefühl, fieberhaft durch eine Masse künstlicher Leichtfertigkeiten zu dringen, um den festen Kern des wahren Selbst zu erfassen, der ihrer Vermutung nach irgendwo versteckt lag.
»Oh Miss Tristram«, begann sie, »Sie alle hier sind so brillant. Ich habe wirklich Angst.«
»Machen Sie sich über uns lustig?« fragte Sylvia.
»Warum sollte ich mich über Sie lustig machen? Sehen Sie nicht, wie dumm ich mir vorkomme?«
Sylvia fing zu sehen an und was sie sah, interessierte sie.
»Sie haben doch ein so wunderbares Leben; uns erscheint es so fremd.«
Sylvia, die schrieb und ein literarisches Vergnügen daran hatte, sich in fremden Spiegeln zu sehen und dem Leben anderer ihren eigenen Spiegel vorzuhalten, machte sich mit Genuß an die Arbeit. Zuvor hatte sie die Hibberts nie als menschliche Wesen betrachtet; sondern sie die »jungen Ladies« genannt. Deshalb war sie jetzt um so bereiter, ihren Fehler zu korrigieren; aus Eitelkeit wie auch aus echter Neugier.
»Was machen Sie?« fragte sie plötzlich, um sofort zur Sache zu kommen.
»Was ich mache?« sprach Phyllis nach. »Oh, ich gebe das Essen in Auftrag und kümmere mich um den Blumenschmuck!«
»Ja, aber was sind Sie von Beruf«, insistierte Sylvia, die entschlossen war, sich nicht mit Floskeln abspeisen zu lassen.
»Das ist mein Beruf; ich wünschte, es wäre nicht so! Wirklich, Miss Tristram, Sie müssen bedenken, daß die meisten jungen Ladies Sklavinnen sind; und Sie dürfen mich nicht beleidigen, nur weil Sie zufälligerweise frei sind.«
»Oh, sagen Sie mir doch«, platzte Sylvia heraus, »was Sie genau meinen. Ich will es wissen. Ich weiß gerne etwas über Menschen. Schließlich ist ja die menschliche Seele das Eigentliche.«
»Ja«, sagte Phyllis, darauf bedacht, sich von Theorien fernzuhalten. »Aber unser Leben ist so simpel und gewöhnlich. Sie kennen wahrscheinlich Dutzende wie uns.«
»Ich kenne eure Abendkleider«, sagte Sylvia; »ich sehe euch in schönen Prozessionen an mir vorüberziehen, aber ich habe euch noch nie sprechen hören. Seid ihr durch und durch aus Fleisch und Blut?« Ihr kam zu Bewußtsein, daß dieser Ton Phyllis einen Schock versetzte: also änderte sie ihn.
»Ich darf doch behaupten, daß wir Schwestern sind. Aber warum sind wir äußerlich so verschieden?«
»Oh nein, wir sind keine Schwestern«, sagte Phyllis bitter; »zumindest würde mir das leid tun für Sie. Wissen Sie, wir sind dazu erzogen, uns nur abends zu zeigen und hübsche Reden zu halten und, nun ja, vermutlich zu heiraten, und natürlich hätten wir auf die Universität gehen können, wenn wir gewollt hätten; da wir das aber nicht wollten, haben wir eben unsere Fertigkeiten ausgebildet.«
»Wir sind auch nie auf die Universität gegangen«, sagte Sylvia.
»Und Sie haben keine Fertigkeiten? Natürlich sind Sie und Ihre Schwester wirklich und Rosamond und ich sind Talmi: ich zumindest. Aber verstehen Sie jetzt mehr, und verstehen Sie, was für ein ideales Leben Sie führen?«
»Ich verstehe nicht, warum Sie nicht machen sollten, was Sie wollen, so wie wir«, sagte Sylvia und sah sich im Zimmer um.
»Glauben Sie, wir könnten solche Menschen um uns haben? Wir können ja nicht einmal eine Freundin einladen, es sei denn unsere Eltern sind nicht da.«
»Warum nicht?«
»Erstens haben wir kein Zimmer: und außerdem bekämen wir nie die Erlaubnis dazu. Wir sind Töchter, bis wir zu verheirateten Frauen werden.«
Sylvia betrachtete sie ein wenig grimmig. Phyllis merkte, daß sie mit der falschen Art von Offenheit über die Liebe gesprochen hatte.
»Wollen Sie heiraten?« fragte Sylvia.
»Das fragen Sie noch? Sie Unschuldslamm! – aber natürlich haben Sie vollkommen recht. Man sollte es aus Liebe tun und so weiter und so fort. Aber«, fuhr Phyllis, verzweifelt die Wahrheit sagend, fort, »wir können nicht auf diese Weise darüber denken. Wir wollen so viele Dinge, daß wir die Ehe nie für sich sehen können, so wie sie wirklich ist oder sein sollte. Sie ist immer mit so viel anderem vermischt. Sie bedeutet Freiheit und Freunde und ein eigenes Haus und, ja, all die Dinge, die Sie schon haben! Kommt Ihnen das sehr schrecklich und sehr gewinnsüchtig vor?«
»Es hört sich ziemlich schrecklich an; aber nicht gewinnsüchtig, finde ich. An Ihrer Stelle würde ich schreiben.«
»Oh, Sie fangen ja schon wieder an, Miss Tristram!« rief Phyllis in komischer Verzweiflung aus. »Wie soll ich Ihnen klarmachen, daß es uns zum einen an Verstand fehlt; und daß wir ihn zum anderen, wenn wir ihn hätten, nicht gebrauchen könnten. Der liebe Gott hat uns in seiner Gnade für unsere Stellung in der Welt gerüstet. Rosamond hätte etwas machen können; jetzt ist sie zu alt.«
»Mein Gott«, rief Sylvia, »was für ein schwarzes Loch! Ich würde Feuer legen, schießen, aus dem Fenster springen; zumindest irgendetwas machen!«
»Was?« fragte Phyllis höhnisch. »Wenn Sie da stünden, wo wir stehen, vielleicht; aber ich glaube nicht, daß Sie dort stehen könnten. Oh nein«, sagte sie in leichterem und zynischerem Ton, »es ist unser Leben, und wir müssen das Beste daraus machen. Ich möchte, daß Sie verstehen, weshalb wir hierherkommen und schweigend dasitzen. Sehen Sie, das hier ist das Leben, das wir gerne führen würden; und jetzt bezweifle ich eher, daß wir es können. Sie«, sie zeigte auf alle im Zimmer, »glauben, wir seien Modepuppen; das sind wir auch, beinah. Aber vielleicht hätten wir etwas Besseres sein können. Ist das nicht rührend?« Sie lachte ihr kurzes trockenes Lachen.
»Aber versprechen Sie mir eines, Miss Tristram: daß Sie uns besuchen kommen, und daß wir manchmal hierherkommen dürfen. Jetzt müssen wir aber wirklich gehen, Rosamond.«
Sie gingen, und in der Droschke wunderte sich Phyllis ein wenig über ihren Ausbruch; spürte aber, daß sie ihn genossen hatte. Sie waren beide ein bißchen aufgeregt; und darauf aus, ihr Unbehagen zu analysieren und herauszufinden, was es bedeutete. Letzte Nacht um diese Zeit waren sie mißmutiger und gleichzeitig selbstzufriedener gestimmt nach Hause gefahren; was sie gemacht hatten, langweilte sie, aber sie wußten, daß sie es gut gemacht hatten. Und sie hatten das befriedigende Gefühl, daß sie sich für etwas weitaus Besseres eigneten. Diese Nacht langweilten sie sich nicht; aber sie hatten nicht das Gefühl, daß sie ihre Sache gut gemacht hatten, als sich ihnen die Gelegenheit dazu bot. Die Schlafzimmerkonferenz verlief ein wenig niedergeschlagen; beim Vorstoß auf ihr wahres Selbst hatte Phyllis einen eisigen Windstoß in diesen streng bewachten Ort gelassen; was wollte sie wirklich, fragte sie sich? Wofür eignete sie sich? Beide Welten kritisieren und merken, daß keine von beiden ihr das gab, was sie brauchte. Sie war zu tief deprimiert, um den Fall ihrer Schwester darlegen zu können; und ihr Ehrlichkeitsanfall ließ sie in der Überzeugung zurück, daß das Reden nichts half; und wenn sie überhaupt etwas tun könnte, müßte sie es selbst tun. Ihre letzten Gedanken in dieser Nacht waren, daß es eine ziemliche Erleichterung bedeutete, daß Lady Hibbert für den nächsten Tag ein volles Programm für sie aufgestellt hatte: zumindest brauchte sie nicht zu denken; und Gesellschaften am Wasser waren amüsant.
Der mysteriöse Fall von Miss V.
Es ist ein Gemeinplatz, daß die Einsamkeit am größten ist, wenn man sich allein in einer Menschenmenge befindet; die Romanciers wiederholen es; das Pathos läßt sich nicht leugnen; und nun, seit dem Fall von Miss V., glaube ich schließlich auch daran. So eine Geschichte wie die von ihr und ihrer Schwester – aber es ist charakteristisch, daß ein einziger Name unwillkürlich für beide zu reichen scheint, wenn man von ihnen schreibt – ja man könnte ein Dutzend solcher Schwestern in einem Atemzug nennen. So eine Geschichte ist kaum anderswo möglich als in London. Auf dem Lande wäre der Metzger oder der Postbote oder die Pfarrfrau dagewesen; aber in einer hochzivilisierten Stadt beschränken sich die Zivilisationsbekundungen des menschlichen Lebens auf den kleinstmöglichen Raum. Der Metzger liefert sein Fleisch in den Unterhof der Häuser; der Postbote steckt seinen Brief in den Kasten und die Pfarrfrau ist dafür bekannt, daß sie die seelsorgerischen Sendschreiben durch dieselbe praktische Bresche schleudert: man darf, wiederholen sie alle, keine Zeit verschwenden. Auch wenn also das Fleisch nicht gegessen wird, die Briefe ungelesen bleiben und die seelsorgerischen Kommentare mißachtet werden, wird niemand etwas davon merken; bis zu dem Tag, an dem diese Funktionäre stillschweigend zu dem Schluß kommen, daß die Nr. 16 oder 23 nicht länger bedient zu werden braucht. Wenn sie die Runde machen, überspringen sie das Haus, und die arme Miss J. oder Miss V. fällt aus der dichtgeknüpften Kette des menschlichen Lebens heraus; und wird von allen und für immer übersprungen.
Die Leichtigkeit, mit der einen solch ein Schicksal ereilt, legt nahe, daß es wirklich notwendig ist, sich zu behaupten, um zu verhindern, daß man übersprungen wird; wie kann man je wieder lebendig werden, wenn der Metzger, der Postbote und der Polizist sich entschlossen haben, einen zu ignorieren? Es ist ein schreckliches Schicksal; ich glaube, ich werde augenblicklich einen Stuhl umwerfen; jetzt weiß der Mieter unter mir wenigstens, daß ich am Leben bin.
Aber um auf den mysteriösen Fall Miss V. zurückzukommen, in diesem Anfangsbuchstaben verbirgt sich wohlgemerkt auch die Person von Miss Janet V.: es ist kaum erforderlich, den einen Buchstaben in zwei Teile aufzuteilen.
Sie schwebten seit ungefähr fünfzehn Jahren durch London; man begegnete ihnen gewöhnlich in gewissen Salons oder Bildergalerien, und wenn man sagte, »Oh, Miss V., wie geht es Ihnen«, so als hätte man sie regelmäßig jeden Tag seines Lebens getroffen, antwortete sie immer, »Ist es nicht ein schöner Tag« oder »Was für schlechtes Wetter wir haben«, und dann ging man weiter und sie schien mit irgendeinem Sessel oder einer Kommode zu verschmelzen. Auf jeden Fall dachte man nicht mehr an sie, bis sie sich vielleicht nach einem Jahr von dem Möbelstück loslöste und dasselbe wieder gesagt wurde.
Ein Band des Blutes – oder welche Flüssigkeit auch immer in Miss V.s Adern floß – machte es mir zum ureigenen Schicksal, ihr fortwährend in die Arme zu laufen wie vielleicht niemand sonst – oder durch sie hindurchzugehen oder sie in nichts aufzulösen, wie auch immer der richtige Ausdruck heißen mag –, bis diese kleine Vorstellung fast zur Regel wurde. Anscheinend war man bei keiner Gesellschaft, in keinem Konzert und in keiner Galerie ganz vollzählig, wenn der vertraute graue Schatten nicht dabei war; und als sie vor einiger Zeit aufhörte, mir über den Weg zu geistern, war ich mir vage bewußt, daß etwas fehlte. Ich will nicht übertreiben und sagen, daß ich wußte, daß sie fehlte; aber es ist nicht unaufrichtig, das Neutrum zu gebrauchen.
So sah ich mich in einem überfüllten Raum allmählich in namenloser Unzufriedenheit umherblicken; nein, anscheinend waren alle da – aber zweifellos fehlte etwas an den Möbeln oder den Vorhängen – oder hatte man einen Druck von der Wand abgehängt?
Dann eines Morgens in der Frühe, ich war tatsächlich bei Tagesanbruch wach geworden, rief ich laut: Mary V. Mary V.!! Es war sicherlich das erste Mal, daß irgendjemand ihren Namen mit solcher Überzeugung gerufen hatte; im allgemeinen schien er ein farbloses Epitheton zu sein, das man bloß verwendete, um einen Satz abzurunden. Aber meine Stimme zitierte nicht, wie ich es fast erwartete, die Person oder das Abbild von Miss V. vor mich: der Raum blieb verschwommen. Den ganzen Tag hindurch hatte ich das Echo meines eigenen Rufs im Kopf; bis ich mir versicherte, daß ich ihr an irgendeiner Straßenecke wie gewöhnlich begegnen und sie dahinschwinden sehen würde und zufrieden wäre. Doch sie kam nicht; und ich glaube, ich war unzufrieden. Jedenfalls kam mir, als ich nachts wachlag, der sonderbar phantastische Plan in den Sinn, eine bloße Laune zunächst, die nach und nach ernst und aufregend wurde, daß ich Mary V. nämlich persönlich besuchen würde.
Oh wie verrückt und merkwürdig und amüsant das schien, jetzt, da ich es mir vorstellte! – den Schatten aufzuspüren, zu sehen wo sie lebte und ob sie lebte und mit ihr zu sprechen, als sei sie ein Mensch wie wir alle!
Man bedenke, wie es anmuten würde, in einem Omnibus loszufahren, um den Schatten einer Glockenblume in Kew Gardens zu besichtigen, wenn die Sonne halbhoch am Himmel steht! oder den Samenflaum von einer Pusteblume aufzufangen! um Mitternacht auf einer Wiese in Surrey. Und doch war es eine weitaus phantastischere Expedition als jede, die ich hier vorgeschlagen habe; und als ich mir die Kleider anzog und mich aufmachte, lachte ich und lachte bei dem Gedanken daran, daß so handfeste Vorbereitungen für meine Aufgabe notwendig waren. Stiefel und Hut für Mary V.! Es schien unglaublich unangemessen.
Schließlich erreichte ich die Wohnung, in der sie wohnte, und als ich auf das Schild sah, fand ich, es erklärte auf zweideutige Weise – wie bei uns allen –, daß sie gleichzeitig da war und nicht da war. An ihrer Tür ganz oben im obersten Stockwerk des Gebäudes klopfte und klingelte ich und wartete und musterte alles genau; niemand kam; und ich fing schon an mich zu fragen, ob Schatten sterben könnten und wie man sie beerdigte; als die Tür behutsam von einem Dienstmädchen geöffnet wurde. Mary V. war zwei Monate lang krank gewesen; sie war gestern morgen gestorben, genau zu der Zeit, als ich ihren Namen rief. Ich werde ihrem Schatten also nie wieder begegnen.
[Das Tagebuch der Mistress Joan Martyn]
Meine Leser wissen vielleicht nicht, wer ich bin. Auch wenn es ungewöhnlich und unnatürlich ist, so zu verfahren – man weiß ja, wie bescheiden Schriftsteller sind –, erkläre ich daher unverzüglich, daß ich Miss Rosamond Merridew heiße, fünfundvierzig Jahre alt bin – meine Offenheit ist nur konsequent! – und daß ich mir unter meinen Berufskollegen einen beachtlichen Namen gemacht habe mit meinen Forschungen über das System der Landpacht im England des Mittelalters. In Berlin hat man von mir gehört; Frankfurt möchte mir zu Ehren eine Soiree geben; und in ein oder zwei abgelegenen Zimmern in Oxford und Cambridge bin ich nicht ganz unbekannt. Da die menschliche Natur nun einmal danach verlangt, werde ich meiner Sache vielleicht mehr Überzeugungskraft verleihen, wenn ich erkläre, daß ich Mann und Familie und ein Haus, in dem ich alt werden könnte, eingetauscht habe gegen ein paar Fragmente gelben Pergaments, die nur wenige lesen können, und für die noch weniger Menschen Interesse aufbrächten, wenn sie sie lesen könnten. Aber wie es in der Literatur meiner Geschlechtsgenossinnen geschrieben steht, die ich manchmal mit einiger Neugier lese, hat eine Mutter das häßlichste und dümmste ihrer Nachkömmlinge am liebsten; und so ist auch in meiner Brust eine Art mütterliche Leidenschaft entbrannt für diese verschrumpelten und farblosen kleinen Gnome; im wirklichen Leben sind sie für mich Krüppel mit verdrießlichen Gesichtern, die aber gleichzeitig das Feuer des Genies in den Augen haben. Ich möchte diesen Satz nicht näher erläutern; mir wäre dabei nämlich kaum mehr Erfolg beschieden als eben jener Mutter, mit der ich mich vergleiche, wenn sie sich auf den schmerzlichen Versuch einließe zu erklären, daß ihr Krüppel in Wirklichkeit ein schöner Junge sei, holder als alle seine Brüder.
Jedenfalls haben meine Ermittlungen einen reisenden Hausierer aus mir gemacht; nur habe ich die Angewohnheit, zu kaufen und nicht zu verkaufen. In alten Bauernhäusern, zerfallenen Herrensitzen, Pfarrhäusern und Sakristeien werde ich immer mit demselben Anliegen vorstellig: Haben Sie alte Schriftstücke, die Sie mir zeigen können? Wie Sie sich denken können, ist die Glanzzeit für diese Art Sport längst vorüber; das Alter ist zum bestverkäuflichen Gütemerkmal geworden; und darüber hinaus hat der Staat mit seinen Ausschüssen den Unternehmungsgeist von Einzelpersonen fast völlig zum Erliegen gebracht. Irgendein Beamter, so sagt man mir oft, habe versprochen vorbeizusehen und die Dokumente zu begutachten; und die Aussicht auf die Gunst des »Staates«, die ein solches Versprechen mit sich bringt, beraubt meine armselige Privatstimme jeglicher Überzeugungskraft.
Und dennoch habe ich keinen Grund zu klagen, denn schließlich kann ich auf ein paar sehr schöne Beutestücke zurückblicken, die für den Historiker von echtem Interesse sein werden, und auf ein paar andere, die mir sogar noch besser zusagen, weil das, was sie erhellen, so zufallsbedingt und so minutiös ist. Plötzlich fällt Licht auf die Beine der Lady Elizabeth Partridge und sendet seine Strahlen über ganz England bis zum König auf seinem Thron; sie brauchte Strümpfe! und kaum ein anderes Bedürfnis ist so geeignet, uns einen Eindruck zu geben von der Wirklichkeit mittelalterlicher Beine; und damit von der Wirklichkeit mittelalterlicher Körper, und schließlich, schrittweise geht es nach oben von der Wirklichkeit des mittelalterlichen Gehirns; und damit steht man dann im Zentrum aller Zeiten: der Mitte, dem Anfang oder dem Ende. Und das bringt mich zu einem weiteren Bekenntnis meiner Tugenden. Meine Forschungen zum System der Landpacht im 13., 14. und 15. Jahrhundert sind, wie mir versichert wurde, doppelt wertvoll aufgrund meines bemerkenswerten Talents, Beziehungen herzustellen zum Leben der damaligen Zeit. Ich habe immer im Hinterkopf behalten, daß die komplizierten Gesetze der Landpacht nicht immer die wichtigsten Faktoren im Leben von Männern und Frauen und Kindern waren; oft habe ich mir erlaubt, darauf hinzuweisen, daß die Feinheiten, an denen wir uns so sehr ergötzen, eher von der Nachlässigkeit unserer Vorfahren als von ihrer erstaunlichen Sorgfalt zeugen. Denn welcher vernünftige Mensch, hatte ich die Kühnheit zu bemerken, hätte sonst seine Zeit damit zubringen können, einem halben Dutzend Altertumsforschern zuliebe, die fünf Jahrhunderte, nachdem er ins Grab gesunken ist, geboren würden, die Gesetze zu verkomplizieren.
Wir wollen hier nicht über diese These diskutieren, derentwegen ich viele heftige Schläge ausgeteilt und eingesteckt habe; ich stelle die Frage lediglich, um zu erklären, warum ich diese Nachforschungen bestimmten Bildern aus dem Familienleben untergeordnet habe, die Eingang in meinen Text gefunden haben; als Blüte all dieser verschlungenen Wurzeln; als Funkenblitz nach all der Reiberei am Feuerstein.
Wenn Sie meine Arbeit mit dem Titel The Manor Rolls1 lesen, werden Sie je nach Temperament erfreut oder empört sein über gewisse Abschweifungen, die Ihnen dort begegnen.
Ich habe keine Skrupel gehabt, mich auf ein paar Seiten in Großdruck darin zu versuchen, die eine oder andere Szene aus dem Leben der damaligen Zeit mit der Lebendigkeit eines Bildes vorzuführen; hier klopfe ich an die Tür eines Leibeigenen und finde ihn beim Braten gewilderter Kaninchen; ich zeige Ihnen, wie der Gutsherr sich auf eine Reise macht oder seine Hunde ruft, um einen Spaziergang über die Felder zu machen, oder wie er auf einem Stuhl mit hoher Lehne sitzt und mühsam Zahlen auf einen glänzenden Bogen Pergament ritzt. In einem anderen Zimmer zeige ich ihnen Lady Elinor, die über einer Nadelarbeit sitzt; und neben ihr sitzt auf einem niedrigeren Schemel ihre Tochter und stickt ebenfalls, aber weniger gewissenhaft. »Kind, dein Gemahl wird hier sein, bevor dein Linnen für den Hausstand fertig ist«, tadelt die Mutter.
Ah, um dies aber ausführlich zu lesen, müssen Sie sich mit meinem Buch befassen! Die Kritiker haben mir immer mit zwei Ruten gedroht; erstens, so sagen sie, machten sich solche Abschweifungen zwar sehr gut in einem Geschichtswerk über diese Zeit, sie hätten aber nichts zu tun mit dem System der mittelalterlichen Landpacht; zweitens beanstanden sie, daß ich über keinerlei Material verfüge, um diesen Worten auch nur einen Anflug von Wahrheit zu verleihen. Bekanntlich ist die von mir gewählte Epoche ärmer an privaten Aufzeichnungen als jede andere; falls man sich nicht dazu entschließen kann, seine Inspiration einzig aus den Paston Letters2 zu beziehen, muß man sich wie jeder andere Erzähler mit der bloßen Vorstellungskraft begnügen. Und das, so wird mir gesagt, sei für sich genommen eine nützliche Kunst, die aber keinen Anspruch auf eine Verwandtschaft mit der strengeren Kunst des Historikers erheben dürfe. Aber hier streife ich schon wieder meine berühmte These, über die ich mich einst so voller Eifer im Historian's Quarterly ausgelassen habe. Wir müssen aber vorwärts kommen mit unserer Einführung, sonst wird vielleicht irgendein eigensinniger Leser das Buch hinwerfen und behaupten, er wisse bereits alles über dessen Inhalt: Oh, die alte Geschichte! Streitereien unter Altertumsforschern! Ich möchte hier also einen Strich ziehen – und die gesamte Frage nach falsch und richtig, nach Dichtung und Wahrheit hinter mir lassen.
An einem Junimorgen vor zwei Jahren fügte es sich, daß ich die Thetford Road von Norwich nach East Harling entlangfuhr. Ich war auf irgendeiner Expedition gewesen, einer Wildgansjagd nämlich, um ein paar Schriftstücke zu bergen, von denen ich glaubte, sie lägen in den Ruinen von Caister Abbey begraben. Wenn wir nur ein Zehntel der Beträge, die wir jährlich für die Ausgrabung griechischer Städte ausgeben, für die Ausgrabung unserer eigenen Ruinen ausgeben würden, dann hätte der Historiker gewiß eine ganz andere Geschichte zu erzählen!
Das war das Thema, über das ich nachsann; und trotzdem blieb mein eines Auge, mein archäologisches Auge, wach für die Landschaft, durch die wir fuhren. Und aus Gehorsam gegenüber einem Telegramm von diesem Auge sprang ich an einer bestimmten Stelle im Wagen auf und wies den Fahrer an, scharf nach links abzubiegen. Wir fuhren eine gewöhnliche Straße hinunter, die von alten Ulmen gesäumt war; aber der Köder, der mich lockte, war ein kleines rechteckiges Bild am anderen Ende, das zart von grünen Zweigen umrahmt war, und in das mit deutlichen Linien aus behauenem, weißen Stein eine alte Eingangstür gezeichnet war.
Als wir näher kamen, zeigte es sich, daß die Tür von langen niedrigen Mauern umgeben war, die gelbbraun verputzt waren; auf ihnen saß direkt das rote Ziegeldach, und schließlich erblickte ich das ehrwürdige kleine Haus als Ganzes vor mir, gebaut wie ein großes E, bei dem der Mittelstrich ausgewischt worden ist.
Hier war also eines jener bescheidenen, kleinen alten Herrenhäuser, die die Jahrhunderte beinah unberührt und praktisch ohne daß man sie kennt überstehen, weil sie zu unbedeutend sind, um abgerissen oder umgebaut zu werden; und die Besitzer zu arm sind, um Ambitionen zu haben. Und die Nachkommen des Bauherrn leben weiterhin hier, in jener sonderbaren Unkenntnis darüber, daß das Haus in irgendeiner Weise bemerkenswert sein könnte, die bewirkt, daß sie genauso zu einem Teil des Hauses werden wie der große Schornstein, der schwarz geworden ist durch Generationen von Küchenruß. Natürlich wäre ein größeres Haus vorzuziehen und ich zweifle nicht daran, daß sie dieses alte Haus ohne Bedenken verkaufen würden, wenn ihnen ein gutes Angebot gemacht würde. Aber daraus spricht ein natürlicher und unbefangener Geist, der irgendwie beweist, wie echt die ganze Sache ist. Bei einem Haus, in dem man fünfhundert Jahre lang gelebt hat, kann man nicht sentimental sein. Das ist die Art Haus, dachte ich, als ich so dastand mit der Hand an der Klingel, dessen Eigentümer wahrscheinlich ausgezeichnete Manuskripte besitzen, die sie mit derselben Leichtigkeit an den erstbesten Lumpensammler verkaufen, der vorbeikommt, mit der sie ihren Plunder verkaufen würden oder das Holz aus dem Park. Schließlich vertrete ich den Standpunkt einer morbiden Exzentrikerin, und diese Leute hier haben eine wahrhaft gesunde Natur. Können die nicht schreiben? werden sie zu mir sagen; und was sind alte Briefe schon wert? Ich verbrenne meine immer – oder nehme sie zum Abbinden von Marmeladengläsern.
Endlich kam ein Dienstmädchen und starrte mich nachdenklich an, als hätte sie sich an mein Gesicht und mein Anliegen zu erinnern. »Wer wohnt hier?« fragte ich sie. »Mr Martyn«, sagte sie und sperrte den Mund auf, als hätte ich nach dem regierenden König von England gefragt. »Gibt es eine Mrs Martyn, und ist sie zu Hause, und kann ich sie vielleicht sehen?« Das Mädchen winkte mich herein und führte mich wortlos zu einer Person, die vermutlich die Verantwortung auf sich nehmen konnte, meinen merkwürdigen Fragen zu erwidern.
Ich wurde durch einen großen eichengetäfelten Saal in einen kleineren Raum geführt, in dem eine rosige Frau in meinem Alter mit der Maschine an einer Hose nähte. Sie sah aus wie eine Haushälterin; aber das sei, flüsterte das Mädchen, Mrs Martyn.
Sie erhob sich mit einer Geste, die deutlich machte, daß sie nicht gerade eine Dame war, die Morgenbesuche empfing, aber trotzdem eine Respektsperson, die Herrin des Hauses, die ein Recht darauf hatte, zu erfahren, mit welchem Anliegen ich hierhergekommen war.
Für das Spiel des Altertumsforschers gibt es gewisse Regeln, von denen die erste und einfachste darin besteht, daß man seine Absicht nicht sofort bei der ersten Begegnung kundtun darf. »Ich kam gerade an ihrer Tür vorbei; und ich war so frei – ich muß sagen, daß ich sehr viel für das Pittoreske übrig habe –, vorzusprechen und so vielleicht Gelegenheit zu bekommen, mir das Haus ansehen zu dürfen. Es scheint mir ein ganz besonderes Prachtexemplar zu sein.«
»Darf ich fragen, ob Sie das Haus mieten wollen«, sagte Mrs Martyn, die mit einem angenehmen Anflug von Dialekt sprach.
»Vermieten Sie denn Zimmer?« fragte ich.
»Oh nein«, erwiderte Mrs Martyn mit Bestimmtheit: »Wir vermieten niemals Zimmer; ich dachte, Sie wollten vielleicht das ganze Haus mieten.«
»Es ist ein bißchen groß für mich; aber ich habe Freunde.«
»Nun gut«, unterbrach Mrs Martyn fröhlich, wobei sie den Gedanken an Profit beiseite schob und bloß noch daraufwartete, sich als mildtätig erweisen zu dürfen; »Ich würde mich sehr freuen, Ihnen das Haus zeigen zu dürfen – ich selbst weiß nicht viel von alten Dingen; und ich habe noch nie gehört, daß das Haus in irgendeiner Weise besonders sei. Und doch ist es ein angenehmer Ort – wenn man aus London kommt.« Sie betrachtete neugierig mein Kleid und meine Gestalt, die mir, ich gestehe es, unter ihrem frischen und ein wenig mitleidigen Blick gebeugter als sonst vorkam; und ich gab ihr die Auskunft, die sie wünschte. Als wir durch die langen weißgetünchten Gänge spazierten, die wohltuend mit Eichenbalken gestreift waren und in makellose kleine Zimmer mit grünen, quadratischen Fenstern schauten, die zum Garten hinausgingen und in denen ich ein paar wenige aber hübsche Möbel sah, tauschten wir tatsächlich eine beträchtliche Anzahl von Fragen und Antworten aus. Ihr Mann war ein Großbauer; aber Grundbesitz hatte schrecklich an Wert verloren; und sie waren jetzt gezwungen, im Herrenhaus zu leben, das sich nicht vermieten ließ; obwohl es viel zu groß für sie war und die Ratten eine Plage waren. Das Herrenhaus befand sich seit vielen Jahren im Besitz der Familie ihres Mannes, bemerkte sie mit einer Spur von Stolz; sie wußte nicht wie lange, aber man erzählte sich, die Martyns seien in der Gegend einst große Leute gewesen. Sie machte mich auf das »y« in ihrem Namen aufmerksam. Sie sprach immer noch mit dem sehr gezügelten und scharfsichtigen Stolz desjenigen, der aus harter persönlicher Erfahrung weiß, wie wenig eine adlige Geburt gegen gewisse materielle Nachteile auszurichten vermag, wie zum Beispiel die Armut des Bodens, die Löcher im Dach und die Raubgier der Ratten.