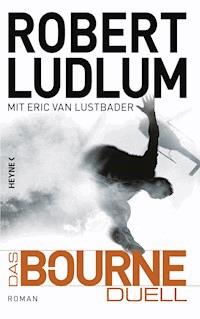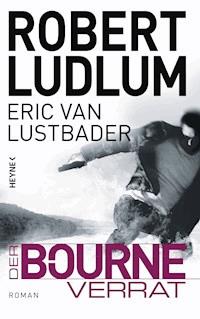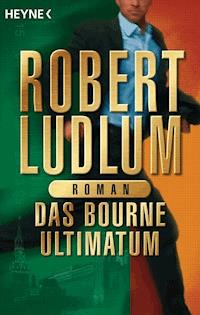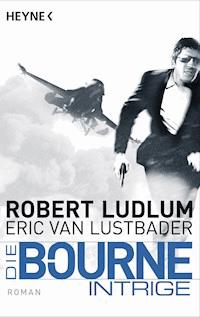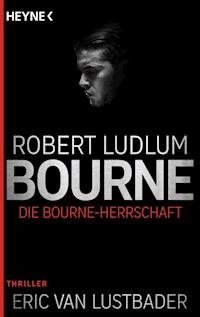9,99 €
9,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit ausgefeilten Computerstrategien manipuliert der Matarese-Geheimbund Macht an sich zu reißen. Nur CIA-Topagent Beowulf Agate kann ihn stoppen...
Das E-Book Das Matarese-Mosaik wird angeboten von Heyne Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
thriller,politthriller,agententhriller,ebooks,roman,spannung,action,geheimbund,cia,agent,spion,verschwörung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 890
Veröffentlichungsjahr: 2011
4,5 (42 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Zum Autor
Lieferbare Titel
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Copyright
Das Buch
Vor über zwanzig Jahren hat der CIA-Topagent Brandon Scofield, Codename »Beowulf Agate«, zusammen mit seinem einstigen russischen Erzfeind, dem KGB-Agenten Wassilij Taleniekov, den Matarese-Bund zerschlagen. Der internationale Geheimbund wollte die Welt in ein Chaos stürzen, um daraus in glorreicher Macht aufzuerstehen. Aber der Matarese-Bund hat nur eine Art Winterschlaf gehalten, aus dem er zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder erwacht – mörderischer und mächtiger denn je. Die CIA muß hilflos zusehen, wie die Matarese mittels modernster Technik die globale Wirtschaft allmählich in Aufruhr versetzen, um die Welt nach ihren totalitären Regeln neu zu ordnen. Nur der altgediente CIA-Agent Beowulf Agate kennt die Verflechtungen des Geheimbunds genau und könnte die Weltverschwörung noch stoppen. Aber der hält sich seit zwei Jahrzehnten versteckt. Der junge CIA-Agent Cameron Pryce findet ihn schließlich, und zusammen machen sie sich auf in den letzten Kampf.
Zum Autor
Robert Ludlum war Schauspieler und Filmproduzent, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Seine Romane wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und erreichten weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Lieferbare Titel
Der Cassandra-Plan – Die Paris-Option – Der Altman-Code – Die Lazarus-Vendetta – Der Janson-Befehl – Die Lennox-Falle – Der Tristan-Betrug – Das Jesus-Papier – Der Ikarus-Plan – Das Scarlatti-Erbe – Der Hades-Faktor – Die Halidon-Verfolgung – Der Holcroft-Vertrag – Der Prometheus-Verrat – Das Sigma-Protokoll – Das Bourne Ultimatum – Das Bourne Vermächtnis – Die Bourne Identität – Das Bourne Imperium – Die Ambler Warnung
Für Karen-»Suzie«
Sie kam lachend, nachdem alles Lachen erstarb. Und brachte wieder Freude ins Leben.
Prolog
In den Wäldern von Tscheljabinsk, etwa neunhundert Flugmeilen von Moskau entfernt, steht eine früher einmal von der Herrscherelite der Sowjetunion hochgeschätzte Jagdhütte. Es handelte sich um eine das ganze Jahr über nutzbare Datscha, im Frühling und Sommer ein Paradies von Gärten und Wildblumen am Rande eines Bergsees, im Herbst und Winter ein Paradies für Jäger. Die neuen Herrscher hatten sie in den Jahren seit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums in Ruhe gelassen, und sie war zu einer Art letzter Ruhestätte für den angesehensten Wissenschaftler Rußlands geworden, einen Kernphysiker namens Dimitrij Juri Juriewitsch. Denn er war ermordet worden, in eine monströse Falle gelockt von Killern, die für sein Genie, das er mit allen Nationen teilen wollte, keinen Respekt, nur Wut und Zorn übrig hatten. Ganz gleich woher die Mörder kamen, und niemand wußte das wirklich: Sie waren die Bösen und sicherlich nicht ihr Opfer, trotz der tödlichen Implikationen seiner Wissenschaft.
Die weißhaarige alte Frau mit dem schütteren Haar lag auf dem Bett am Erkerfenster, das den Blick auf den ersten Schnee des Winters freigab. Ebenso wie ihr Haar und ihre runzlige Haut war alles hinter dem Glas weiß, gefrorene neue Reinheit vom Himmel, unter deren Gewicht sich die Zweige beugten, ein Paradies blendenden Lichts. Mit einiger Mühe griff sie nach der Messingglocke auf ihrem Nachttisch und schüttelte sie.
Kurz darauf trat eine kräftige Frau Anfang vierzig mit braunem Haar und lebhaften, fragend blickenden Augen zur Tür herein. »Ja, Großmutter, was kann ich für dich tun?« fragte sie.
»Du hast schon mehr für mich getan als nötig, mein Kind.«
»Ein Kind bin ich wohl kaum noch, und du weißt genau, daß es nichts gibt, was ich nicht für dich tun würde. Soll ich dir Tee bringen?«
»Nein, aber hol mir einen Priester – egal, was für einen. Die waren uns so lange nicht erlaubt.«
»Du brauchst keinen Priester, du brauchst etwas Ordentliches zu essen, Großmutter.«
»Mein Gott, du klingst wie dein Großvater. Immer widersprechen, immer analysieren …«
»Ich habe überhaupt nicht analysiert«, fiel ihr Anastasia Juriskaja Solatow ins Wort. »Du ißt wie ein Spatz!«
»Die essen wahrscheinlich jeden Tag soviel, wie sie wiegen … Nicht, daß es wichtig wäre, aber wo ist dein Mann?«
»Draußen, jagen. Er sagt, im frischen Schnee kann man gut Spuren verfolgen.«
»Wahrscheinlich wird er sich den Fuß abschießen. Außerdem brauchen wir kein Fleisch. Moskau ist großzügig«, sagte die alte Frau.
»Das gehört sich wohl auch so!«
»Nein, meine Liebe. Das tun sie, weil sie Angst haben.«
»Was willst du damit sagen, Maria Juriskaja?«
»Hol mir den Priester, mein Kind. Ich bin siebenundneunzig Jahre alt, und jemand muß die Wahrheit erfahren. Geh jetzt!«
Der ältere russisch-orthodoxe Prälat in seinem schwarzen Ornat stand am Bett. Er kannte die Anzeichen; er hatte sie nur zu oft gesehen. Die alte Frau lag im Sterben, ihre Atemzüge wurden immer kürzer, schienen ihr immer mehr Mühe zu bereiten. »Ihre Beichte, gute Frau?«
»Nicht meine, Sie Esel!« erwiderte Maria Juriskaja. »Es war an einem Tag ganz wie diesem – es lag Schnee, die Jäger waren bereit, hatten die Flinten über der Schulter. Er ist an einem Tag wie diesem getötet worden, zerfetzt, zerrissen von einem verwundeten Bären, den Wahnsinnige ihm über den Weg getrieben hatten.«
»Ja, ja, wir alle haben die Geschichte Ihres tragischen Verlusts gehört, Maria.«
»Zuerst hieß es, es seien die Amerikaner gewesen, und dann die Kritiker meines Mannes in Moskau – selbst seine eifersüchtigen Konkurrenten, aber das stimmt nicht.«
»Es ist solange her, gute Frau. Bleiben Sie ruhig. Der Herr erwartet Sie. Er wird Sie an seinen Busen drücken und Sie trösten …«
»Guwno, Sie Narr! Die Wahrheit muß heraus. Ich habe später erfahren – Anrufe aus der ganzen Welt, nichts Schriftliches, nur Worte über die Telefonleitung -, daß ich und meine Kinder und deren Kinder nie die nächste Morgendämmerung erleben würden, wenn ich irgend jemandem von dem, was mein Mann mir erzählt hat, auch nur ein Wort sagen würde.«
»Und was war das, Maria?«
»Mein Atem verläßt mich, Vater, das Fenster wird dunkel.«
»Was war es?«
»Eine Macht, die viel gefährlicher ist als all die miteinander zerstrittenen Machtgruppen auf dieser Erde.«
»Was für eine ›Macht‹, gute Frau?«
»Die Matarese… das Böseste, was es auf dieser Welt gibt.« Der Kopf der alten Frau fiel in die Kissen. Sie war tot.
Die schimmernde weiße Jacht, von Bug bis Heck mehr als dreißig Meter lang, manövrierte langsam in den Jachthafen von Estepona, dem nördlichsten Punkt der Costa del Sol, einem Refugium der Reichen der Welt, die dort ihren Ruhestand genießen.
Der hagere, alte Mann in der luxuriösen Eignerkabine saß auf dem mit Samt bezogenen Sessel und ließ sich von seinem Kammerdiener, der jetzt schon fast drei Jahrzehnte in seinen Diensten stand, umsorgen. Der betagte Schiffseigner wurde von seinem Diener und Freund für die wichtigste Konferenz seines langen Lebens vorbereitet, eines Lebens, das mehr als neunzig Jahre umspannte, wobei das exakte Alter geheimgehalten wurde, weil sich der größte Teil jenes Lebens in der grausamen Arena viel jüngerer Männer abspielte. Warum diesen habgierigen Türken den Vorteil seiner angeblichen Senilität verschaffen, die doch in Wirklichkeit auf einige Generationen überlegener Erfahrung hinauslief? Sein Gesicht mochte ja nach drei kosmetischen Operationen ein wenig maskenhaft wirken, aber das war nur oberflächlich. Ein täuschendes Bild, um die Opportunisten zu verwirren, die sein finanzielles Imperium in ihre Macht gebracht hätten, wenn man ihnen auch nur die leiseste Chance dazu bot.
Ein Imperium, das ihm nichts mehr bedeutete. Es war ein Koloß aus Papier, der über sieben Milliarden US-Dollar wert war, siebentausend Millionen aufgebaut auf den Manipulationen eines lang vergessenen Gebildes, das als wohltätige Vision angefangen und sich zu etwas geradezu Satanischem gewandelt hatte, korrumpiert von subalternen Kreaturen, denen jede Wohltätigkeit fremd war und deren einzige Vision der eigene Vorteil war.
»Wie sehe ich aus, Antoine?«
»Großartig, Monsieur«, erwiderte der Kammerdiener, trug ein mildes After-shave auf und entfernte einen Frisierumhang, unter dem Gesellschaftskleidung und eine gestreifte Krawatte zum Vorschein kam.
»Das ist doch nicht übertrieben, oder?« fragte sein eleganter Arbeitgeber.
»Keineswegs. Sie sind der Vorsitzende, Sir, und das müssen alle begreifen. Sie dürfen keinen Widerstand dulden.«
»O nein, alter Freund. Widerstand wird es keinen geben. Ich beabsichtige, meine verschiedenen Vorstände und Aufsichtsräte anzuweisen, sich auf eine Auflösung der Strukturen vorzubereiten. Ich habe vor, alle großzügig zu bedenken, die ihre Zeit und Schaffenskraft Unternehmungen gewidmet haben, von denen sie im wesentlichen nichts wußten.«
»Einige werden Mühe haben, Ihre Anweisungen zu akzeptieren, mon ami René.«
»Gut! Sie verzichten auf unser Rollenspiel. Sie haben vor, mir etwas zu sagen.« Die beiden Männer lachten leise, dann fuhr der ältere fort: »Ich hätte Sie wirklich mit einer leitenden Position betrauen sollen, Antoine. Ich kann mich nicht erinnern, daß Sie mir je einen falschen Rat gegeben haben.«
»Ich habe ihn nur dann angeboten, wenn Sie darum gebeten haben und ich zu verstehen glaubte, worum es geht. Nie in geschäftlichen Verhandlungen, von denen ich nichts verstehe.«
»Nur von Menschen verstehen Sie etwas, richtig?«
»Sagen wir, ich habe Beschützerinstinkte, René… Kommen Sie, ich helfe Ihnen beim Aufstehen, dann können Sie sich in den Rollstuhl setzen …«
»Nein, Antoine, nicht den Rollstuhl! Nehmen Sie meinen Arm, dann gehe ich zu der Sitzung… Übrigens, was haben Sie gemeint, als Sie sagten, einige würden Mühe haben, meine Anweisungen zu akzeptieren? Sie werden großzügig bedacht, und alle werden gut versorgt sein.«
»Sicherheit ist nicht dasselbe wie aktive Teilhabe, mon ami. Die Arbeiter werden natürlich dankbar sein, aber Ihre leitenden Mitarbeiter sehen das vielleicht anders. Sie entfernen sie aus ihren Machtpositionen, nehmen ihnen den Einfluß. Nehmen Sie sich in acht, René. Einige, die an dieser Konferenz teilnehmen, gehören zu dieser Gruppe.«
Der große Speisesalon der Jacht wirkte wie ein schickes Pariser Restaurant. Die impressionistischen Wandgemälde zeigten Ansichten vom Seine-Ufer, den Arc de Triomphe, den Eiffelturm und verschiedene andere Pariser Sehenswürdigkeiten. Vier Männer in dunklen Anzügen saßen um den runden Mahagonitisch, Flaschen mit Evianwasser vor sich, Aschenbecher mit Schachteln Gauloises neben sich. Nur zwei der Aschenbecher wurden benutzt, die anderen hatte man beiseite geschoben.
Der gebrechliche alte Mann betrat den Raum, begleitet von seinem langjährigen Kammerdiener, den alle von vorangegangenen Sitzungen kannten. Man begrüßte sich gegenseitig; der betagte Vorsitzende ließ sich auf dem freien Sessel in der Mitte nieder, worauf der Kammerdiener hinten an der Wand Platz nahm. Das wurde ohne Einwendungen akzeptiert, denn es war Tradition.
»Hier sind also sämtliche Anwälte versammelt. Mein avocat in Paris, mein Rechtsanwalt in Berlin, mio avvocato in Rom und natürlich unser Syndikus aus Washington, D.C. Ich freue mich, Sie alle hier zu sehen.« Halblautes Gemurmel antwortete ihm, dann fuhr der alte Mann fort: »Ihre fröhliche Stimmung läßt mich erkennen, daß Sie von unserer Konferenz nicht begeistert sind. Das ist schade, denn meine Anweisungen werden ausgeführt, ob es Ihnen paßt oder nicht.«
»Wenn Sie gestatten, Herr Mouchistine«, sagte der Anwalt aus Deutschland, »wir alle haben Ihre verschlüsselten Instruktionen erhalten, die jetzt in unseren Safes eingeschlossen sind, und sind offen gestanden entsetzt! Sie haben nicht nur die Absicht, Ihre Firmen und deren gesamten Besitz zu verkaufen …«
»Nach Abzug recht beträchtlicher Summen für Ihre Dienste natürlich«, fiel ihm René Mouchistine ins Wort.
»Wir wissen Ihre Großzügigkeit sehr zu schätzen, René, aber dem gilt unsere Sorge nicht«, sagte der Anwalt aus Washington. »Es geht darum, was dann passiert. Bestimmte Märkte werden zusammenbrechen, Aktien ins Uferlose stürzen … Man wird Fragen stellen! Es könnte zu Ermittlungen kommen … Wir alle wären kompromittiert.«
»Unsinn. Jeder von Ihnen hat die Anweisungen des geheimnisvollen René Pierre Mouchistine befolgt, Alleininhaber seiner sämtlichen Unternehmen. Jede Abweichung von seinen Anordnungen würde zu Ihrer Entlassung führen. Sagen Sie ein einziges Mal die Wahrheit, Gentlemen. Dann kann niemand Ihnen etwas anhaben.«
»Aber signore«, rief der avvocato aus Italien, »Sie verkaufen weit unter Marktwert! Was bezwecken Sie damit? Sie spenden wohltätigen Institutionen überall auf der Welt Millionen und Abermillionen, Leuten, die eine Lira nicht von einer Deutschen Mark unterscheiden können! Was sind Sie, ein socialista, der die Welt reformieren und dabei die Tausende vernichten will, die an Sie geglaubt haben, an uns geglaubt haben?«
»Seltsam, daß gerade Sie das sagen, denn als alles begann, Jahre vor Ihrer Geburt, war das die Vision des großen padrone, des Baron von Matarese.«
»Wer?« fragte der französische Anwalt.
»Ich kann mich vage daran erinnern, den Namen gehört zu haben«, sagte der Deutsche. »Aber für mich ist er nicht relevant.«
»Warum sollte er das auch sein?« René Mouchistine sah sich kurz zu seinem Kammerdiener Antoine um. »Sie alle sind nichts als Spinnennetze, die von der Quelle ausgehen, die von der Quelle engagiert sind, um ihren Transaktionen den Anschein des Legitimen zu geben, weil Sie legitim waren. Sie sagen, ich gebe denen, die das Spiel verloren haben, Millionen zurück – woher kommt denn Ihrer Ansicht nach mein Reichtum? Wir sind zur personifizierten Habgier geworden, Habgier, die sich wie ein Berserker gebärdet hat.«
»Das dürfen Sie nicht tun, Mouchistine!« rief der Amerikaner und sprang auf. »Man wird mich vor den Kongreß zerren!«
»Und mich vor einen Bundestagsausschuß!« schrie der Anwalt aus Berlin.
»Ich habe keine Lust, mich vor der Deputiertenkammer zu rechtfertigen!« rief der Pariser.
»Ich werde veranlassen, daß unsere Kollegen in Palermo Ihnen das ausreden«, sagte der Mann aus Rom unheilverheißend. »Sie werden Einsicht zeigen.«
»Warum versuchen Sie es nicht selbst? Haben Sie Angst vor einem alten Mann?«
Der Italiener sprang wutentbrannt auf, und seine Hand griff unter sein maßgeschneidertes Jackett. Weiter kam er nicht. Ein Schuß aus der schallgedämpften Pistole Antoines verwandelte sein Gesicht in eine blutige Masse. Der römische Anwalt fiel zu Boden, sein Blut floß über das Parkett.
»Sie sind wahnsinnig!« schrie der Deutsche. »Er wollte Ihnen bloß einen Zeitungsartikel zeigen, in dem steht, daß einige Ihrer Firmen mit der Mafia in Verbindung stehen, und das ist wahr. Sie sind ein Monstrum!«
»Aus Ihrem Munde ist das die reine Ironie, wenn man an Auschwitz und Dachau denkt.«
»Damals war ich noch nicht geboren!«
»Lesen Sie’s nach … Was meinen Sie, Antoine?«
»Notwehr, Monsieur. Als alter Informant der Sûreté werde ich es so in meinem Bericht festhalten. Er hat nach einer Waffe gegriffen.«
»Scheiße!« brüllte der Anwalt aus Washington. »Sie haben uns in die Falle gelockt, Sie Hurensohn!«
»Das stimmt nicht. Ich wollte nur sicherstellen, daß Sie meine Anweisungen ausführen werden.«
»Das können wir nicht! Herrgott, verstehen Sie denn nicht? Das wäre das Ende für uns alle…«
»Für einen ganz sicherlich, aber wir werden die Leiche beseitigen, ein Fisch für die Fische im Meer.«
»Sie sind tatsächlich wahnsinnig!«
»Wir sind wahnsinnig geworden. Am Anfang waren wir das nicht. Halt! Antoine!… Die Bullaugen!«
Plötzlich waren an den kleinen runden Fenstern des Speisesaals hinter Gummimasken verborgene Gesichter zu sehen. Die Männer schlugen das Glas ein und fingen an, aus Maschinenpistolen in den Raum zu feuern, in jeden Winkel und jedes Schatteneck. Der Kammerdiener Antoine zerrte Mouchistine unter einen Wandschrank, selbst an der Schulter verletzt, sein Herr aus mehreren Brustwunden blutend. Er würde nicht überleben.
»René, René!« rief Antoine. »Sie müssen tief atmen, ständig tief atmen! Ich bringe Sie ins Krankenhaus!«
»Nein, Antoine. Es ist zu spät!« würgte Mouchistine heraus. »Die Anwälte sind tot, und mein Ende bedauere ich nicht. Ich habe mit dem Bösen gelebt und sterbe jetzt, während ich mich davon löse. Vielleicht wird mir das irgendwo nützen.«
»Wovon reden Sie, mon ami, Freund meines Lebens!«
»Finden Sie Beowulf Agate.«
»Wen?«
»Fragen Sie Washington. Die müssen wissen, wo er ist! Wassilij Taleniekov ist getötet worden, ja, aber nicht Beowulf Agate. Er lebt irgendwo, und er kennt die Wahrheit.«
»Welche Wahrheit, mein bester Freund?«
»Die Matarese! Sie sind wieder da. Sie wußten von dieser Konferenz, den verschlüsselten Anweisungen, die ohne die Chiffren keinen Sinn haben. Wer auch immer noch übrig ist, mußte mich beseitigen, also ist es jetzt Ihre Aufgabe, ihnen Einhalt zu gebieten!«
»Wie denn?«
»Kämpfen Sie mit Ihrer ganzen Kraft dagegen! Bald wird es überall sein. Es war das Böse, das der Erzengel der Hölle vorhergesagt hat. Das Gute, das ein Diener Satans wurde.«
»Das ergibt keinen Sinn. Ich bin kein Theologe!«
»Sie brauchen auch keiner zu sein«, flüsterte der sterbende Mouchistine. »Ideen sind größere Denkmäler als Kathedralen. Sie überdauern die Jahrtausende besser als behauener Stein.«
»Was reden Sie da?«
»Finden Sie Beowulf Agate. Er ist der Schlüssel zu allem.«
René Mouchistine taumelte, von einem Krampf geschüttelt, nach vorn und fiel dann um, kippte nach hinten, sein Kopf blieb an der Schiffswand liegen. Seine letzten Worten waren so klar, als hätte seine kehlige Stimme sie in eine Echokammer geflüstert. »Die Matarese… das fleischgewordene Böse.« Dann war der alte Mann mit den Geheimnissen tot.
1
In den schroffen Bergen von Korsika über den Wassern von Porto-Vecchio am Tyrrhenischen Meer ragten die skelettartigen Überreste eines früher einmal majestätischen Herrenhauses in den Himmel. Das Mauerwerk, geschaffen, um Jahrhunderte zu überdauern, war im großen und ganzen noch intakt, die Innenmauern hingegen zerstört, vor Jahrzehnten vom Feuer vernichtet. Es war früher Nachmittag, der Himmel dunkel, ein Wintersturm arbeitete sich an der Küste von Bonifacio herauf und drohte mit heftigen Regenfällen, die bald die überwucherten, kaum mehr sichtbaren Wege um das Haus herum in matschigen Morast verwandeln würden.
»Ich schlage vor, wir beeilen uns, padrone«, sagte der vierschrötige Korse, der einen Parka mit Kapuze trug. »Die Straßen zum Flugplatz von Senetosa sind schon ohne Sturm gefährlich genug«, fügte er in Englisch hinzu, der Sprache, auf die man sich geeinigt hatte, die er aber nur schlecht sprach.
»Senetosa kann warten«, erwiderte der schlanke Mann im Regenmantel. Sein Akzent verriet die holländische Herkunft. »Alles kann warten, bis ich fertig bin! Geben Sie mir den Vermessungsplan für den nördlichen Teil, bitte.« Der Korse griff in die Tasche und zog ein mehrfach zusammengefaltetes Blatt schweres Papier heraus. Er gab es dem Mann aus Amsterdam, der es schnell entfaltete, es mit beiden Händen gegen die Mauer drückte und studierte. Er wandte den Blick immer wieder von der Karte und musterte einzelne Teile des Areals. Jetzt fing es zu regnen an, ein leichter Nieselregen zuerst, der aber schnell in einen gleichmäßigen Regenschauer überging.
»Hier drüben, padrone«, rief der Führer aus Bonifacio und deutete auf einen Bogen in der Mauer, der zu einer Art Garten führte. Es war ein eigenartiger Bogen, er war nur gut einen Meter breit, dafür aber knapp zwei Meter tief, und erinnerte an einen Tunnel. Das Ganze war über und über mit Schlingpflanzen überwachsen, die den Eingang förmlich erwürgten. Trotzdem bildete der Bogen willkommenen Schutz vor dem plötzlichen Regenguß.
Der padrone, ein Mann Anfang vierzig suchte mit schnellen Schritten Zuflucht und preßte die auseinandergefaltete Karte gegen das Blattwerk; er zog einen roten Filzstift aus der Tasche seines Regenmantels und kreiste eine größere Fläche ein. »Dieser Abschnitt«, schrie er, um sich über dem Prasseln der Regentropfen auf dem Gemäuer Gehör zu verschaffen, »das muß mit Seilen abgesperrt werden, damit niemand reinkommt oder dort irgendwie stört! Ist das klar?«
»Wenn Sie das so wünschen, wird es geschehen. Aber, padrone, Sie sprechen da von beinahe hundert Hektar.«
»So will ich es haben. Meine Vertreter werden sich laufend überzeugen, daß meine Anweisung ausgeführt wird.«
»Das ist nicht notwendig, Sir. Ich werde dafür sorgen.«
»Gut, schön, dann tun Sie es.«
»Und der Rest, signore?«
»So, wie wir es in Senetosa besprochen haben. Alles muß genauso wiederhergestellt werden, wie es auf den ursprünglichen Plänen aussieht, die vor zweihundert Jahren in Bastia gezeichnet wurden. Meine Schiffe und Frachtflugzeuge werden alles, was Sie brauchen, in Marseille anliefern. Sie haben meine geheimen Telefon- und Faxnummern und die Zugangscodes. Tun Sie das, um was ich Sie bitte – was ich von Ihnen fordere -, und Sie können sich als wohlhabender Mann mit gesicherter Zukunft zur Ruhe setzen.«
»Ich betrachte es als Privileg, daß Sie mich ausgewählt haben, padrone.«
»Und Sie sind sich darüber im klaren, daß alles unter strengster Geheimhaltung ablaufen muß?«
»Naturalmente, padrone! Sie sind ein exzentrischer Mann aus Bayern, ungeheuer reich, und wollen den Rest Ihres Lebens in den herrlichen Bergen von Porto-Vecchio verbringen. Mehr braucht niemand zu wissen!«
»Gut, schön.«
»Aber wenn Sie gestatten, signore, als wir im Dorf angehalten haben, hat die alte Frau Sie gesehen, die dort diesen runtergekommenen Gasthof führt. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen – sie ist in ihrer Küche auf die Knie gefallen und hat dem Heiland dafür gedankt, daß Sie zurückgekommen sind.«
»Was?«
»Wenn Sie sich erinnern – als es solange dauerte, bis unsere Erfrischungen kamen, bin ich in die cucina gegangen und habe die Frau dort laut betend vorgefunden. Die Tränen liefen ihr über die Wangen. Und dann hat sie gesagt, sie könne es an Ihrem Gesicht und Ihren Augen erkennen. ›Der Barone di Matarese ist zurückgekehrt‹, hat sie immer wieder gesagt.« Der Korse sprach den Namen italienisch aus, Mataresa. »Sie hat dem Herrgott dafür gedankt, daß Sie zurückgekommen sind, daß wieder Größe und Glück in die Berge zurückkehren würden.«
»Dieser Vorfall muß aus Ihrem Gedächtnis gelöscht werden, verstehen Sie?«
»Selbstverständlich, padrone. Ich habe nichts gehört!«
»Zu den Wiederaufbauarbeiten – alles muß in sechs Monaten fertiggestellt sein. Sie brauchen an nichts zu sparen. Tun Sie einfach alles, was nötig ist.«
»Ich werde mein Bestes geben.«
»Wenn Ihr Bestes nicht gut genug ist, wird nichts aus dem Ruhestand, weder wohlhabend noch sonstwie, capisce?«
»Ja, padrone«, sagte der Korse und schluckte.
»Und was die alte Frau in dem Gasthof angeht…«
»Ja?«
»Töten Sie sie.«
Sechs Monate und zwölf Tage voller Hektik verstrichen, und das große Herrenhaus der Matarese-Dynastie war wieder hergestellt. Das Ergebnis der Bemühungen war erstaunlich, so wie es nur viele Millionen Dollar gewährleisten konnten. Das Herrenhaus mit seinem beeindruckenden Bankettsaal war so, wie der Architekt es sich zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts vorgestellt hatte, nur waren Kronleuchter an die Stelle der gewaltigen Kerzenleuchter getreten. Natürlich war das ganze Haus mit den Annehmlichkeiten moderner Haustechnik wie fließendem Wasser, Toiletten, Klimaanlage und Elektrizität auf den neuesten Stand gebracht worden.
Der Außenbereich war freigelegt worden, und eine weite Rasenfläche, die das Hauptgebäude umgab, bot Platz für eine große Krocketbahn und ein raffiniertes Putting Green. Die lange Zufahrt von der Straße nach Senetosa war asphaltiert worden, nachts beleuchteten im Boden versenkte Lampen den Weg, und elegant gekleidete Bedienstete begrüßten sämtliche Fahrzeuge, wenn diese vor der Marmortreppe des Eingangsbereichs zum Stehen kamen. Was die Besucher nicht wußten, war, daß all diese Bediensteten ausgebildete Leibwächter waren. Sie trugen alle elektronische Scanner bei sich, die es ihnen erlaubten, Waffen, Kameras oder Tonbandgeräte im Umkreis von drei Metern festzustellen; auf eine Distanz von einem halben Meter konnte man solche Geräte zweifelsfrei erkennen.
Die Männer hatten klare Anweisungen: falls jemand mit Gegenständen dieser Art ankam, mußte der oder die Betreffende gewaltsam festgehalten und in einen Verhörraum gebracht werden, wo unangenehme Fragen gestellt wurden. Falls die Anworten darauf nicht befriedigten, gab es Gerätschaften, sowohl für manuellen Einsatz als auch elektrischer Natur, die dazu gedacht waren, Antworten sprudeln zu lassen. Der Matarese war zurückgekehrt – mit all seiner fragwürdigen Macht und Glorie.
Die Abenddämmerung war angebrochen, und die untergehende Sonne hüllte die Berge von Porto-Vecchio in rötlichen Schein, als die ersten Limousinen eintrafen. Die mit Armani-Anzügen bekleideten Bodyguards begrüßten die Besucher beflissen, waren ihnen beim Aussteigen behilflich und strichen dabei unauffällig über ihre Kleidung. Acht schwere Wagen waren eingetroffen. Acht Gäste. Mehr würden es nicht sein. Sieben Männer und eine Frau, von Anfang dreißig bis Mitte fünfzig, Angehörige der verschiedensten Nationalitäten, die alle eines gemeinsam hatten – alle waren unermeßlich reich. Jeder wurde die Marmorstufen der Villa Matarese hinaufgeführt und dann von einzelnen Wachen in den Bankettsaal gebracht. In der Mitte des riesigen Saals stand eine lange Tafel mit Platzkarten vor den acht Stühlen, vier auf der rechten, vier auf der linken Seite, jeder Stuhl mindestens anderthalb Meter vom nächsten Gast entfernt. Am Kopfende der Tafel stand ein leerer Sessel, davor ein kleines Rednerpult. Zwei uniformierte Kellner nahmen Cocktailbestellungen entgegen; vor jedem Platz stand eine Kristallschüssel mit eisgekühltem Belugakaviar, und von den Wänden tönten die gedämpften Klänge einer Bachfuge.
Das Gespräch kam nur stockend in Gang, als wüßte keiner der Gäste, weshalb sie hier zusammengekommen waren. Und doch gab es einen gemeinsamen Nenner: alle sprachen Englisch und Französisch, so daß beide Sprachen gebraucht wurden, bis man sich schließlich auf erstere geeinigt hatte, als sich erwies, daß zwei der männlichen Amerikaner das Französische nicht hinreichend fließend beherrschten. Es waren recht belanglose Gespräche, im wesentlichen darauf beschränkt, wer wen kannte, und ob das Wetter in St. Tropez, auf den Bahamas, in Hawaii oder Hongkong nicht großartig sei. Niemand wagte es, die entscheidende Frage zu stellen: Weshalb sind wir hier? Sieben Männer und eine Frau hatten Angst. Dazu hatten sie Anlaß. Die Gegenwart ließ nicht erkennen, daß es in ihrer Vergangenheit Dinge gab, die keiner wissen durfte.
Plötzlich verstummte die Musik. Die schweren Kronleuchter wurden gedimmt, und an dem umlaufenden Geländer des Balkons tauchte der kleine Lichtpunkt eines Scheinwerfers auf, wurde heller, als der Strahl das Rednerpult am Ende der Tafel erfaßte. Der schlanke Mann aus Amsterdam trat aus einer Wandnische und schritt langsam in den Lichtschein hinein. Sein angenehmes, wenn auch durchschnittliches Gesicht wirkte im Lichtschein blaß, aber seine Augen waren alles andere als nichtssagend. Sein Blick wanderte von einem der Gäste zum nächsten, als er jedem von ihnen zunickte.
»Ich danke Ihnen, daß Sie meine Einladung angenommen haben«, begann er mit einer Stimme, die nach Eis und unterdrückter Hitze zugleich klang. »Ich hoffe, Ihre Reise entsprach dem Stil, den Sie gewöhnt sind.« Das zustimmende Gemurmel klang nicht enthusiastisch. »Mir ist klar«, fuhr der Mann aus Amsterdam fort, »daß ich Ihr Leben in gesellschaftlicher wie in beruflicher Hinsicht gestört habe, aber ich hatte keine Wahl.«
»Jetzt haben Sie sie«, unterbrach ihn die eine Frau kühl. Sie war Mitte dreißig und trug ein teures schwarzes Kleid mit einer Perlenkette, die wenigstens fünfzigtausend Dollar gekostet hatte. »Wir sind hier, jetzt sagen Sie uns, warum.«
»Ich bitte um Nachsicht, Madam. Mir ist wohl bewußt, daß Sie zum Rancho Mirage in Palm Springs unterwegs waren, um sich mit dem Partner Ihres augenblicklichen Ehemanns zu treffen, dem Partner in seiner erpresserischen Maklerfirma, meine ich. Ich bin sicher, daß man Ihnen Ihr Nichterscheinen nicht nachträgt, weil es ja keine Firma gäbe, wenn Sie sie nicht finanziert hätten.«
»Ich muß doch sehr bitten!«
»Und ich muß Ihnen sagen, daß ich mich in Gegenwart von Bittstellern unbehaglich fühle.«
»Was mich betrifft«, sagte ein Portugiese in mittleren Jahren mit schütter werdendem Haar, »so bin ich hier, weil Sie angedeutet haben, daß mein Nichterscheinen ernsthafte Schwierigkeiten für mich zur Folge haben könnte. Ihre verdeckte Anspielung ist mir nicht entgangen.«
»Ich habe in meinem Telegramm lediglich den Namen ›Azoren‹ erwähnt. Das hat offenbar gereicht. Das Konsortium, an dessen Spitze Sie stehen, ist durch und durch korrupt. Die Bestechungsgelder, die Sie Lissabon zahlen, sind kriminell. Sollte es Ihnen gelingen, die Kontrolle über die Azoren an sich zu bringen, dann würden Sie damit nicht nur Einfluß auf die ohnehin überhöhten Preise der Fluggesellschaften, sondern auch auf die Verbrauchssteuern von über einer Million Touristen im Jahr ausüben. Gut ausgedacht, würde ich sagen.«
Auf beiden Seiten der Tafel kam es zu einem Stimmengewirr, Andeutungen verschiedener fragwürdiger Aktivitäten, die Grundlage für das Erscheinen der acht auf dem verborgenen Anwesen in Porto-Vecchio sein könnten.
»Genug«, sagte der Mann aus Amsterdam und hob die Stimme. »Sie täuschen sich über den Grund Ihres Hierseins. Ich weiß mehr über jeden einzelnen von Ihnen, als Sie selbst über sich wissen. Das ist mein Vermächtnis, meine Erbschaft – und Sie sind alle Erben. Wir sind die Nachkommen des Matarese, des Quells, aus dem Ihr Reichtum stammt.«
Die acht Besucher sahen einander bestürzt an, als wäre da etwas Unsägliches, das sie miteinander verband.
»Diesen Namen haben wir noch nie benutzt, denke ich«, sagte ein Engländer im makellosen Glanz der Savile Row. »Weder meine Frau noch meine Kinder haben ihn je gehört«, fügte er dann leise hinzu.
»Warum diesen Namen zu neuem Leben erwecken?« fragte der Franzose. »Der Matarese ist lang dahin – tot und vergessen. Eine ferne Erinnerung, die man besser begräbt.«
»Sind Sie tot?« fragte der Holländer. »Sind Sie begraben? Ich denke doch nicht. Ihr Reichtum hat Sie in die Lage versetzt, den Gipfel finanziellen Einflusses zu erklimmen. Sie alle führen offiziell oder in aller Stille größere Unternehmen und Konglomerate, wie es dem Wesen der Matarese-Philosophie entspricht. Und jeder von Ihnen ist von mir dazu auserwählt worden, die Bestimmung der Matarese zu erfüllen.«
»Bestimmung? Was soll der gottverdammte Unsinn?« fragte einer der beiden Amerikaner, dem Akzent nach aus dem tiefen Süden stammend. »Sind Sie ʹne Art Huey Long?«
»Wohl kaum, aber Ihre Casino-Beteiligungen am Ufer des Mississippi deuten vielleicht darauf hin, daß Sie es sind.«
»Meine geschäftlichen Unternehmungen sind so sauber, wie sie nur sein müssen, Kumpel!«
»Ich weiß Ihre Einschränkung zu schätzen…«
»Was für eine Bestimmung?« fiel ihm der andere Amerikaner ins Wort. »Der Name Matarese ist nie im Zusammenhang mit irgendwelchen Immobilien aufgetaucht, die meiner Familie vererbt wurden.«
»Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre ich erschüttert, Sir. Sie sind einer der führenden Anwälte in Boston, Massachusetts. Harvard Law School, magna cum laude… und Seniorpartner der korruptesten Sozietät, die sich je dadurch bereichert hat, daß sie Bundes- und Staatsbeamte, gewählt wie ernannt, in Mißkredit gebracht hat. Ich muß Ihre Geschicklichkeit loben.«
»Sie können nichts dergleichen beweisen.«
»Führen Sie mich nicht in Versuchung, Counselor … Sie hätten keine Chance. Aber ich habe Sie nicht alle deshalb nach Porto-Vecchio kommen lassen, um mich der Gründlichkeit meiner Nachforschungen zu brüsten, obwohl ich einräume, daß sie ein Bestandteil des Ganzen sind. Zuckerbrot und Peitsche, sozusagen … Zunächst möchte ich mich selbst vorstellen. Ich bin Jan van der Meer Matareisen, und ich bin überzeugt, daß mein Familienname Ihnen etwas bedeutet. Ich bin ein direkter Nachkomme des Baron von Matarese; genauer gesagt, er war mein Großvater. Wie Sie möglicherweise wissen oder auch nicht, hat der Baron seine Affären geheimgehalten und ebenso eventuelle Nachkommen. Aber seiner Verantwortung hat sich der große Mann in keiner Weise entzogen. Sein Same wurde in die besten Familien von Italien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Deutschland, Amerika und, wie ich selbst bezeugen kann, der Niederlande gepflanzt.«
Wieder waren die Besucher wie vom Blitz gerührt. Ihre Blicke wanderten langsam um den Tisch. Sie musterten einander kurz, aber durchdringend, als würde gleich ein außergewöhnliches Geheimnis enthüllt werden.
»Worauf, zum Teufel, wollen Sie hinaus?« fragte der große, grobschlächtig wirkende Amerikaner aus Louisiana. »Raus mit der Sprache, Kumpel!«
»Der Ansicht bin ich auch«, fügte der Mann aus London hinzu, »was soll das alles, alter Junge?«
»Ich glaube, einige von Ihnen sind mir bereits ein Stück voraus«, sagte Jan van der Meer Matareisen und gestattete sich die Andeutung eines Lächelns.
»Dann sagen Sie es, Holländer!« forderte der Unternehmer aus Lissabon.
»Also gut, das werde ich. So wie ich, sind auch Sie alle Kinder jener Kinder. Wir sind das Produkt derselben Lenden, wie Shakespeare es vielleicht formuliert hätte. In den Adern eines jeden einzelnen von Ihnen fließt das Blut des Baron von Matarese.«
Jetzt redeten alle wirr durcheinander. »Wir haben von Matarese gehört, aber nicht so etwas!« und »Das ist doch lächerlich! Meine Familie hat es selbst zu Reichtum gebracht!« und »Sie brauchen mich doch bloß anzusehen! Ich bin blond. Keine Spur südländischer Vorfahren!« Die Protestrufe wurden immer lauter, bis den sieben der Atem ausging und sie schließlich verstummten, als Jan Matareisen die Hände hob.
»Ich kann alle Ihre Fragen beantworten«, sagte er ruhig, »Sie brauchen mir bloß zuzuhören … Der Baron hatte vielfältige Neigungen, so vielfältig, wie er selbst war. Ihre Großmütter wurden zu ihm gebracht wie in einen arabischen Harem; aber keiner von ihnen ist Gewalt angetan worden, weil alle in ihm den außergewöhnlichen Mann erkannten, der er war. Aber ich, und nur ich, war in den Augen der Kirche sein legitimes Kind. Meine Großmutter hat er geheiratet.«
»Was, zum Teufel, sind dann wir?« schrie der Amerikaner aus New Orleans. »Bastarde seit zwei Generationen?«
»Litten Sie je unter Geldmangel, Sir? Für Ihre Ausbildung oder für Investitionen.«
»Nein … das kann ich nicht behaupten.«
»Und Ihre Großmutter war, und ist das immer noch, eine ungewöhnlich schöne Frau, ein ehemaliges Model, deren Gesicht man auf den Titelbildern von Vogue und Vanity Fair bewundern konnte. Oder stimmt das nicht?«
»Ich denke schon, wenn sie auch nicht viel davon spricht.«
»Das braucht sie auch nicht. Sie hat ziemlich schnell einen leitenden Mann aus der Versicherungswirtschaft geheiratet, dessen Firma sich erfolgreich ausgeweitet hat und ihn schließlich zum Vorstandsvorsitzenden gemacht hat.«
»Sie deuten nicht nur an, sondern Sie behaupten buchstäblich, daß wir alle miteinander verwandt sind!« rief der Anwalt aus Boston. »Was für Beweise haben Sie dafür?«
»In der nordöstlichen Ecke dieses Anwesens war anderthalb Meter unter der Erde eine kleine Kassette mit einem in Öltuch eingewickelten Päckchen vergraben. Ich habe fünf Monate gebraucht, um die Kassette zu finden. Das Päckchen enthielt die Namen der Kinder des Barons und ihre Ursprungsländer. Er war, wenn er sonst nichts war, in allen Dingen präzise und exakt … ja, mein Gast aus Boston. Wir sind alle miteinander verwandt. Wir sind Cousins, ob uns das gefällt oder nicht. Gemeinsam sind wir die Erben des Matarese.«
»Unglaublich«, sagte der Engländer und hielt den Atem an.
»Mein Gooott!« sagte der Amerikaner aus den Südstaaten.
»Das ist lächerlich!« rief die blonde Frau aus Los Angeles.
»Eigentlich ist es eher komisch«, sagte der Mann aus Rom im Priestergewand des Vatikan. Ein Kardinal.
»Ja«, pflichtete Matareisen ihm bei, »ich dachte mir, daß Sie den erhabenen Humor zu schätzen wissen. Sie stehen in der Gunst Seiner Heiligkeit, sind aber beim Kollegium verhaßt.«
»Wir müssen die Kirche auf das einundzwanzigste Jahrhundert vorbereiten. Ich sehe keinen Anlaß für Entschuldigungen.«
»Aber Sie sehen eine Menge Geld von Banken, die der Heilige Stuhl kontrolliert, in Ihre Richtung fließen, oder nicht?«
»Ich spreche Empfehlungen aus und ziehe daraus keinen persönlichen Vorteil.«
»Meinen Gewährsleuten zufolge ließe sich darüber streiten. Ich beziehe mich damit auf eine Villa am Comer See.«
»Die gehört meinem Neffen.«
»Dessen erste Ehe Sie illegalerweise annulliert haben. Aber machen wir weiter. Ich bin wirklich nicht darauf erpicht, irgend jemanden in Verlegenheit zu bringen. Schließlich sind wir alle eine Familie … Sie alle sind hier, weil Sie verletzbar sind, so wie auch ich ganz bestimmt verletzbar bin. Wenn ich imstande bin, Ihre verschiedenen Unternehmungen ans Licht zu bringen, dann können das andere auch. Es ist lediglich eine Frage des Anreizes, der Zeit und der Neugierde, nicht wahr?«
»Für meinen Geschmack reden Sie mir einfach zu viel und sagen dabei überhaupt nichts«, sagte der erregte Amerikaner aus den Südstaaten. »Wie ist Ihre Tagesordnung, Kumpel?«
»›Tagesordnung‹, das gefällt mir. Das paßt gut zu Ihrer Ausbildung, ein Diplom in Betriebswirtschaft und der entsprechende Doktortitel, wenn ich mich nicht täusche.«
»Sie täuschen sich nicht. Sie können mich zwar einen Redneck nennen und würden da auch nicht sehr falsch liegen, aber dumm bin ich nicht. Fahren Sie fort.«
»Gut. Die Tagesordnung – unsere Tagesordnung – besteht darin, das Anliegen des Matarese zu verwirklichen, die Vision unseres Großvaters, Guillaume de Matarese.«
Jetzt hingen alle Augen wie gebannt an dem Holländer. Es war offensichtlich, daß die sieben Erben trotz aller Vorbehalte interessiert waren – vorsichtig interessiert. »Da Sie mit dieser ›Vision‹ wesentlich vertrauter sind als wir, könnten Sie sich da vielleicht ein wenig präziser äußern?« fragte die elegant gekleidete Frau.
»Wie Ihnen allen bekannt ist, ist die internationale Finanzwelt jetzt auf globaler Ebene integriert. Was mit dem amerikanischen Dollar geschieht, hat seine Auswirkungen auf die Deutsche Mark, das englische Pfund, den japanischen Yen und sämtliche Währungen der Welt, ebenso wie diese Währungen wiederum Auswirkungen auf die anderen haben.«
»Das ist uns bekannt, Herr Matareisen«, sagte der vierte Mann auf der rechten Seite der Tafel, ein Deutscher. »Ich habe den Verdacht, daß viele von uns erheblichen Vorteil aus den schwankenden Wechselkursen ziehen.«
»Sie haben auch Verluste erlitten, nicht wahr?«
»Geringfügig, im Vergleich zu unseren Gewinnen, wie mein ›Cousin‹, der Amerikaner, vielleicht von den Gewinnen seiner Casinos im Vergleich zu den Verlusten seiner Spieler sagen könnte.«
»Damit haben Sie recht, Cousin…«
»Ich glaube, wir schweifen vom Thema ab«, fiel der Engländer ihm ins Wort. »Die Tagesordnung, wenn Sie so liebenswürdig wären?«
»Die globalen Märkte zu kontrollieren, die internationale Finanzwelt zu disziplinieren – das war das Anliegen des Visionärs, den man als den Baron von Matarese kannte. Geld in die Hände derjenigen geben, die damit umgehen können, nicht in die Hände der Regierungen, die sich nur darauf verstehen, es zu vergeuden und eine Nation gegen die andere aufzustacheln. Die Welt befindet sich bereits im Krieg, einem andauernden Wirtschaftskrieg. Aber wer sind die Sieger? Vergessen Sie nicht, wer auch immer die Wirtschaft eines Landes kontrolliert, kontrolliert seine Regierung.«
»Und Sie wollen sagen…?« Der Portugiese beugte sich vor.
»Ja, das will ich«, sagte der Holländer. »Wir sind dazu imstande. Die Mittel, die uns gemeinsam zur Verfügung stehen, betragen über eine Billion Dollar, das ist ein genügend großer Hebel, noch dazu geographisch weit genug verteilt, um auf die Machtzentren, die wir vertreten, Einfluß auszuüben. Einen Einfluß, der sich ebenso schnell über die Welt ausbreiten wird, wie die im Stundentakt erfolgenden Überweisungen von Millionen von Dollar von einem Finanzmarkt zum anderen. Wenn wir konzertiert handeln, verfügen wir über die Macht, wirtschaftliches Chaos zu erzeugen. Und alles das zu unserem Nutzen, als Individuen und als Gemeinschaft.«
»Das ist ja irre«, rief der Unternehmer aus New Orleans. »Wir können nicht verlieren, weil wir die Karten in der Hand halten!«
»Mit Ausnahme einiger weniger«, sagte der Matarese-Enkel. »Wie ich schon erwähnte, wurden Sie alle ausgewählt, weil ich Schwachstellen gefunden habe, die meinen Zwecken dienten, Zuckerbrot und Peitsche, sagte ich wohl. Ich habe auch mit anderen Fühlung aufgenommen, dabei vielleicht mehr preisgegeben, als ich hätte tun sollen. Sie haben sich meinen Vorstellungen auf das heftigste widersetzt und erklärt, sie würden sofort jeden Schritt, den die Erben der Matarese etwa unternehmen könnten, an die Öffentlichkeit bringen … Es handelt sich um drei Individuen, zwei Männer und eine Frau, denn der Baron hatte außerhalb seiner kirchlichen Ehe elf Enkelkinder. Damit kommen wir vom Abstrakten, der globalen Ebene, zum Persönlichen, zu diesen drei äußerst einflußreichen Individuen, die uns vernichten würden. Deshalb müssen wir sie zuerst vernichten. Und dabei können Sie alle mitwirken … Meine Herren, meine sehr verehrte Dame, diese drei müssen ausgeschaltet werden, ehe wir handeln. Aber sie müssen auf raffinierte Weise getötet werden, damit ja keine Spur zu einem von Ihnen weist. Es gab noch jemanden, keinen Blutsverwandten, einen alten Mann, der so mächtig war, daß er uns in dem Augenblick, in dem wir die Bühne des Geschehens beträten, hätte lähmen können. Er stellt kein Hindernis mehr dar, wohl aber die anderen. Sie sind die einzigen, die übriggeblieben sind und uns im Wege stehen. Wollen wir zum Grundsätzlichen kommen? Oder gibt es jemanden, der uns jetzt verlassen möchte?«
»Wie komme ich nur darauf, daß wir nie die Straße nach Senetosa erreichen würden, wenn wir das täten?« sagte die Frau nachdenklich.
»Sie trauen mir mehr zu, als ich mir selbst zutraue, Madam.«
»Machen Sie weiter, Jan van der Meer Matareisen, Visionen sind mein Geschäft«, sagte der Kardinal.
»Was halten Sie dann von folgender Vision, Priester«, sagte Matareisen. »Wir haben einen Zeitplan, einen Countdown, wenn Sie so wollen. Nur ein paar Monate, bis zum Anfang des neuen Jahres. Das ist unser Ziel für die globale Kontrolle, die Matarese-Kontrolle.«
2
The Hamptons, New York, 28. August Die Nordküste von Long Island ist weniger als eine Stunde von Manhattan entfernt, je nachdem, welchen Typ Privatflugzeug man benutzt. Die »Hamps« werden immer die imaginäre Provinz des Romanciers F. Scott Fitzgerald bleiben, zumindest gewisse Bereiche, wo es Privatflugzeuge gibt. Eine reiche, verwöhnte Gegend, voll grandioser Villen, manikürter Rasenflächen, schimmernder blauer Swimmingpools, Tennisplätzen und parkartiger Anlagen, die die Sommersonne zu prachtvoller Blüte erweckt. Der Reichtum der Leistungsgesellschaft hat die Exklusivität früherer Jahrzehnte hinweggefegt. Juden, Italiener, prominente Schwarze und Latinos – denen früher der Zugang verwehrt gewesen war – bilden jetzt die Hautevolee der Nordküste, wo sie in friedlicher, ja begeisterter Koexistenz mit den immer noch unter Schock stehenden Erben der weißen angelsächsischen Wohlstandselite protestantischen Glaubens leben.
Geld ist ein einzigartiger Gleichmacher. Die Gebühren der verschiedenen Clubs werden durch das Hereinströmen neuer Interessenten reduziert, deren großzügige Spenden für Pflege und Unterhalt der zahlreichen Anlagen dankbar akzeptiert werden.
Jay Gatsby lebt ewig, mit oder ohne Daisy – und Nick, dem Gewissen einer ganzen Ära.
Das Polomatch im Green Meadow Hunt Club war in wildem Gange, Ponys und Reiter in Schweiß gebadet, während Hufe dröhnten und Schläger wild durch die Luft kreisten mit nur einem Ziel, dem flüchtigen weißen Ball, der immer wieder unter den dahinrasenden Pferden quer über die Rasenfläche schoß. Plötzlich war von einem der Reiter ein gellender Schmerzensschrei zu hören. Er hatte in der Hitze der Jagd den Helm verloren. Sein Kopf war eine blutüberströmte Masse; anscheinend war sein Schädel gebrochen.
Alles kam zum Stillstand, als die Spieler von ihren Pferden sprangen und zu dem gefallenen Reiter rannten. Unter ihnen war ein Arzt, ein argentinischer Chirurg, der die Neugierigen auseinanderschob und neben dem Bewußtlosen niederkniete. Er blickte zu den erwartungsvollen Gesichtern empor. »Er ist tot«, sagte der Arzt.
»Aber wie konnte das passieren?« rief der Kapitän des Roten Teams, das des Toten. »Wenn einen ein Holzschläger trifft, geht man k.o. – das haben wir alle schon erlebt – aber, Herrgott noch mal, davon geht doch der Schädel nicht zu Bruch!«
»Was ihn getroffen hat, war auch nicht Holz«, sagte der Argentinier. »Ich würde sagen, es war viel schwerer – Eisen oder Blei vielleicht.« Sie standen in einer Nische der großen Stallungen, zusammen mit zwei uniformierten Streifenbeamten und dem Notarzt von Oyster Harbor, die man herbeigerufen hatte. »Man sollte eine Autopsie durchführen unter besonderer Berücksichtigung der Schädelverletzung«, fuhr der Arzt fort. »Schreiben Sie das bitte in Ihren Bericht.«
»Ja, Sir«, antwortete einer der Beamten.
»Was wollen Sie damit andeuten, Luis?« fragte ein anderer Reiter.
»Das liegt ziemlich auf der Hand«, antwortete der Beamte und blickte von seinem Block auf. »Er deutet an, daß es sich hier vielleicht nicht um einen Unfall handelt, habe ich recht, Sir?«
»Dazu steht mir keine Meinung zu, Officer. Ich bin Arzt, nicht Polizist. Ich gebe nur zu Protokoll, was ich gesehen habe.«
»Wie heißt der Tote, und hat er hier in der Gegend eine Frau oder Verwandte?« fragte der zweite Streifenbeamte und warf seinem Kollegen einen Blick zu.
»Giancarlo Tremonte«, erwiderte ein blonder Reiter, der seiner Redeweise nach zu den Alteingesessenen gehörte.
»Den Namen habe ich schon gehört«, sagte der erste Polizist.
»Durchaus möglich«, fuhr der blonde Polospieler fort. »Die Familie Tremonte stammt aus der Gegend um Mailand, vom Comer See. Sie sind recht bekannt. Sie verfügen über beträchtlichen Besitz in Italien und Frankreich und natürlich auch hier in den Staaten.«
»Nein, ich meine speziell Giancarlo«, sagte der Beamte mit dem Notizblock.
»Er steht oft in den Zeitungen«, sagte der Kapitän des Roten Teams. »Nicht immer in den besseren Blättern, obwohl sein persönlicher Ruf ausgezeichnet ist – ausgezeichnet war.«
»Warum wurde er dann so oft in den Zeitungen erwähnt?« fragte der zweite Polizist.
»Ich nehme an, weil er schrecklich reich war, an vielen gesellschaftlichen und wohltätigen Veranstaltungen teilnahm und etwas für Frauen übrig hatte.« Der Führer des Roten Teams nickte dem Streifenbeamten zu. »Das ist Wasser auf die Mühle drittrangiger Journalisten, Officer, aber wohl kaum eine Sünde. Schließlich hat er sich ja sein Elternhaus nicht ausgesucht.«
»Nein, wohl kaum, aber damit haben Sie schon eine meiner Fragen beantwortet. Es gibt hier keine Ehefrau, und falls es irgendwelche Freundinnen gibt, sind die bereits verschwunden. Natürlich um diesen drittrangigen Journalisten aus dem Weg zu gehen.«
»Da widerspreche ich Ihnen nicht.«
»Gar kein Problem, Mr.…?«
»Albion, Geoffrey Albion. Mein Sommerhaus steht in Gull Bay, am Strand. Und soweit ich weiß, hat Giancarlo keine Verwandten hier in der Gegend. Nach meiner Kenntnis war er in den Staaten, um sich um die geschäftlichen Interessen der Familie Tremonte in Amerika zu kümmern. Als er das Wellstone-Anwesen gemietet hat, waren wir natürlich entzückt, ihn in Green Meadow aufzunehmen. Er ist – war – ein sehr talentierter Polospieler … Dürfen wir seine sterblichen Überreste entfernen?«
»Wir dürfen ihn zudecken, Sir, aber er muß hierbleiben, bis unsere Vorgesetzten und der Gerichtsmediziner hier eintreffen. Je weniger man ihn von der Stelle bewegt, um so besser.«
»Wollen Sie damit andeuten, daß wir ihn draußen auf dem Feld hätten lassen sollen, vor all den Menschen?« fragte Albion etwas schroff. »Wenn ja, dann hätten Sie doch mit meinem Widerspruch zu rechnen. Es ist schon geschmacklos genug, daß Sie die Stelle, wo er gestürzt ist, mit Seilen abgesperrt haben.«
»Wir tun nur unsere Pflicht, Sir.« Der erste Polizeibeamte steckte seinen Notizblock ein. »Die Versicherungsgesellschaften sind in solchen Fällen sehr anspruchsvoll, besonders in Fällen, wo es Verletzte oder Tote gegeben hat. Sie wollen alles untersuchen.«
»Und weil wir gerade von untersuchen reden«, fügte der zweite Beamte hinzu, »wir brauchen die Schläger beider Teams, von jedem, der an dem Spiel teilgenommen hat.«
»Die hängen alle an der Wand dort drüben«, sagte der blonde Spieler mit der exakten, etwas nasalen Redeweise. An der Wand, auf die er deutete, waren Dutzende bunter Gestelle mit zinkenähnlichen Vorsprüngen angebracht, an denen die Poloschläger hingen. »Die Spieler von heute sind im roten Abschnitt, ganz links«, fuhr er fort. »Die Stallknechte spritzen sie ab, aber sie sind alle da.«
»Spritzen sie ab…?« Der Beamte holte seinen Block wieder heraus.
»Dreck und Schlamm, alter Junge. Dort draußen kann es ziemlich schlammig werden. Sehen Sie nur, einige tropfen noch.«
»Ja, das sehe ich«, sagte der zweite Streifenbeamte mit leiser Stimme. »Bloß Wasser aus Schläuchen? Taucht man sie nicht in irgendwelche Reinigungslösungen oder dergleichen?«
»Nein, aber das wäre vielleicht eine gute Idee«, sagte ein weiterer Reiter, schüttelte zuerst den Kopf und nickte dann.
»Augenblick mal«, sagte der Beamte, trat vor das Gestell und sah sich die Schläger genauer an. »Wie viele müßten hier auf dem roten Gestell sein?«
»Das kommt darauf an«, sagte Albion herablassend. »Auf dem Feld sind acht Spieler, vier pro Mannschaft. Mit Ersatzspielern und Reserveschlägern. Es gibt da einen beweglichen gelben Zapfen, mit dem das gerade laufende Match von den Clubmitgliedern, die an dem Tag nicht spielen, abgegrenzt wird.«
»Ist das da der gelbe Zapfen?« fragte der Streifenbeamte und deutete auf ein auffällig lackiertes rundes Stück Holz.
»Also blau ist er nicht, oder?«
»Nein, das ist er nicht, Mr. Albion. Und er ist nicht bewegt worden, seit das Match heute nachmittag begonnen hat?«
»Warum sollte er denn bewegt werden?«
»Vielleicht sollten Sie fragen, weshalb der Zapfen nicht bewegt wurde? Zwei Schläger fehlen.«
Das Prominenten-Tennisturnier in Monte Carlo hatte Dutzende bekannter Darsteller aus Film und Fernsehen angezogen. Die meisten waren Amerikaner oder Briten, die mit den Prominenten Europas spielten – Angehörige des Adels und wohlhabende Griechen, Deutsche, ein paar französische Schriftsteller, die den Höhepunkt ihres Ruhms bereits hinter sich hatten, und einige Spanier, die Anspruch auf langvergessene Titel erhoben und darauf bestanden, daß man ihrem Namen das Wort Don voranstellte. Niemand nahm die Dinge sonderlich ernst, denn die nächtlichen Festivitäten waren extravagant, die Teilnehmer spiegelten sich in ihrem kurzen Ruhm – natürlich vor den Fernsehkameras -, und da die Veranstaltung von Monacos Fürstenhaus gesponsert wurde, hatten alle großen Spaß – und genossen die Publicity -, wobei auch die Wohltätigkeit zu ihrem Recht kam.
Im riesigen Hof des Palasts über dem Hafen war ein gewaltiges Büfett unter dem Sternenhimmel aufgebaut. Ein talentiertes Orchester sorgte für Stimmung, spielte in den unterschiedlichsten Stilarten, von Oper bis hin zu nostalgischem Pop – während international bekannte Sänger sich abwechselten, die Menge zu unterhalten, jedesmal mit Ovationen begrüßt, zu denen sich das elegante Publikum von den elegant gedeckten Tischen im Schein der kreisenden Scheinwerfer erhob.
»Manny, ich will meine Nummer in Sixty Minutes sehen, ist das klar?«
»Geht in Ordnung, Babe, ist doch logisch!«
»Cyril, warum bin ich hier? Ich spiele doch nicht Tennis!«
»Weil es hier von Studiochefs wimmelt! Geh hinauf, und trage irgend etwas mit deiner melodischen Stimme vor, und dreh dich dabei nach links und rechts, Profil, Mann!«
»Dieses Miststück hat meinen Song gestohlen!«
»Du hast dir kein Copyright dafür besorgt, Darling. Sing doch ›Smoke Gets In Your Eyes‹ oder so was!«
»Ich kenne den Text nicht ganz!«
»Dann mußt du eben summen und ihnen deine Titten vor die Nase halten. Die Schallplattenjungs sind hier!«
Inmitten der Zusammenkunft der Großen, beinahe Großen, nicht Großen und niemals Großen stand ein ruhiger Mann, ein bescheidener, wohlhabender Mann, ein Forscher, der sich mit Krebsstudien befaßte und als einer der Sponsoren in Monte Carlo war. Er hatte gebeten, anonym bleiben zu dürfen, aber nach Ansicht des Festausschusses verbot die Höhe seiner Großzügigkeit das. Er hatte sich im Namen seiner spanischen Familie bereit erklärt, eine kurze Ansprache zur Begrüßung der Gäste zu halten.
Jetzt stand er hinter einem Paravent im Hof und wartete darauf, daß man ihn zur Rednertribüne rief. »Ich bin ziemlich nervös«, sagte er zu einem Bühnenarbeiter, der neben ihm stand und darauf wartete, ihm auf die Schulter zu tippen, wenn er an der Reihe war. »Ich bin kein guter Redner.«
»Machen Sie es kurz und danken Sie ihnen. Mehr brauchen Sie nicht zu tun … Da, nehmen Sie ein Glas Wasser. Das ist gut für Ihre Stimme.«
»Gracias«, sagte Juan Garcia Guaiardo, Träger eines alten Adelstitels. Er trank und brach auf dem Weg zum Rednerpult zusammen. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Bühnenarbeiter verschwunden.
Alicia Brewster, nach Dekret der Königin Dame of the Realm, entstieg vor dem Wohnsitz ihrer Familie am Londoner Belgravia Square ihrem Bentley. Sie war eine mittelgroße, eher kompakt wirkende Frau, deren selbstbewußter Gang sie viel größer erscheinen ließ, eine Frau, die man ernst zu nehmen hatte. Sie trat durch den von Säulen gesäumten Eingang ihres Hauses im edwardianischen Stil und wurde von ihren beiden Kindern begrüßt, die man aus ihren jeweiligen Internaten herbeigerufen hatte und die sie jetzt in der geräumigen, auf Hochglanz polierten Eingangshalle erwarteten: ein hochgewachsener, muskulöser junger Mann mit sympathischen Zügen und ein etwas kleineres, gleichermaßen attraktives Mädchen, beide noch keine zwanzig, beide besorgt, ja sogar verängstigt.
»Tut mir leid, daß ich euch nach Hause geholt habe«, sagte die Mutter, nachdem sie beide kurz umarmt hatte. »Ich dachte einfach, daß es besser wäre.«
»Dann ist es also so ernst?« fragte der ältere Bruder.
»So ernst, Roger.«
»Ich würde sagen, es war schon lange fällig«, sagte das Mädchen. »Du weißt ja, ich habe ihn nie gemocht.«
»Oh, ich schon, sogar sehr, Angela.« Alicia Brewster lächelte etwas bedrückt, während sie nickte. »Und ich war auch der Ansicht, daß ihr einen Mann im Haus braucht…«
»In dieser Beziehung ließ er sicher einiges zu wünschen übrig, Mutter«, fiel ihr der Junge ins Wort.
»Also, er hat es nicht gerade leicht gehabt, gemessen an seinem Vorgänger. Euer Vater konnte einen erdrücken, nicht wahr? Erfolgreich, berühmt und ganz bestimmt dynamisch.«
»Damit hattest du auch eine Menge zu tun, Mum«, sagte die Tochter.
»Viel weniger, als du vielleicht glaubst, meine Liebe. Daniel ließ sich nicht viel dreinreden. Ich brauchte ihn viel mehr als er mich. Das Traurigste an seinem Hinscheiden war meiner Ansicht nach, daß es so prosaisch war, regelrecht banal – im Schlaf an einem Schlaganfall zu sterben. Allein der Gedanke daran hätte ihn schon fluchend in sein Fitneßstudio getrieben.«
»Was sollen wir denn tun, Mutter?« fragte Roger schnell, wie um den schmerzlichen Erinnerungen Einhalt zu gebieten.
»Das weiß ich gar nicht. Moralische Unterstützung geben, denke ich. Wie die meisten schwachen Männer ist euer Stiefvater sehr reizbar…«
»Dann wäre er gut beraten, sich davon nichts anmerken zu lassen«, unterbrach sie der junge Mann. »Wenn er auch nur ein lautes Wort sagt, breche ich ihm den Hals.«
»Und Rog könnte das, Mum. Er wird dir das nicht sagen, aber er hat die Schülermeisterschaft im Ringen gewonnen.«
»Oh, hör schon auf, Angie, ich hatte ja keine Konkurrenz.«
»Ich habe das nicht im körperlichen Sinne gemeint«, stellte Alicia klar. »Dazu ist Gerald nicht der Typ. Er bekommt nur Schreikrämpfe. Es wird einfach unangenehm werden.«
»Warum überläßt du es dann nicht deinem Anwalt, Mutter?«
»Weil ich einfach wissen muß, warum er das getan hat.«
»Warum er was getan hat?« fragte Angela.
»Ich habe ihn, um ihn zu beschäftigen und um seine Selbstachtung zu steigern, in den Finanzausschuß unserer Wildlife-Gesellschaft gebracht, ihn sogar zum Präsidenten gemacht. Dann sind Unregelmäßigkeiten aufgetaucht, Überweisungen an nicht existierende Institutionen und solche Dinge … also es läuft jedenfalls darauf hinaus, daß Gerald über eine Million Pfund Gesellschaftsgelder veruntreut hat.«
»Großer Gott!« entfuhr es dem Sohn.
»Aber warum? Er war doch nie knapp bei Kasse, seit du ihn geheiratet hast! Warum hast du ihn eigentlich geheiratet?«
»Er war so charmant, so lebendig – äußerlich war er eurem Vater in so vieler Hinsicht so ähnlich, aber nur äußerlich. Und, ehrlich gesagt, ich war schrecklich deprimiert. Ich hoffte, bei ihm Kraft und Stärke zu finden, bis ich dahinterkam, daß das alles nur aufgesetzt war … Wo ist er?«
»In der Bibliothek oben, Mutter. Ich fürchte, er ist betrunken.«
»Ja, damit hatte ich gerechnet. Wißt Ihr, in gewisser Weise habe ich meinen Anwalt doch eingeschaltet. Das veruntreute Geld werde ich ersetzen, aber ich kann keine Anzeige erstatten oder dergleichen – wenn etwas an die Öffentlichkeit käme, wäre das für die Gesellschaft schlechte Publicity. Man hat ihm gesagt, er solle seine Koffer packen und sich darauf vorbereiten, nach dem Gespräch mit mir abzureisen. Das habe ich verlangt. Ich gehe jetzt hinauf.«
»Ich komme mit.«
»Nein, Lieber, das ist nicht notwendig. Wenn er herunterkommt, dann bring ihn zu seinem Wagen. Wenn er zu betrunken ist, um sich hinter das Steuer zu setzen, dann ruf Coleman; soll der Gerald fahren, wohin er will. Ich nehme an, zu seinem neuen Mädchen in High Holborn. Die beiden sind ziemlich dicke Freunde.«
Alicia stieg schnell und zielbewußt die Wendeltreppe hinauf, eine rächende Walküre, die Antworten haben wollte. Als sie vor der Tür der Bibliothek, Daniel Brewsters entweihtem Arbeitszimmer, stand, riß sie sie auf.
»Hallo, hallo!« rief der offensichtlich angeheiterte Gerald, der sich in einem dunkelbraunen Ledersessel fläzte, neben sich auf einem Beistelltisch eine Flasche Whisky, das halbleere Glas in der Hand. »Die reiche Hobbydetektivin trifft ein. Tut mir leid, altes Mädchen, aber weißt du, du wirst wirklich langsam alt, und du bist nicht mehr sehr einladend.«
»Warum, Gerry, sag mir, warum? Ich habe dir doch immer Geld gegeben, wenn du welches haben wolltest! Warum hast du das getan?«
»Hast du jemals als nutzloses Anhängsel einer reichen Zicke gelebt, die nicht einmal meinen Namen annehmen wollte? Nein, natürlich nicht, weil du ja die reiche Zicke bist!«
»Ich habe dir erklärt, warum ich den Namen Brewster behalten wollte, und du warst einverstanden«, sagte Lady Alicia und ging auf seinen Sessel zu. »Nicht nur wegen der Kinder, sondern auch, weil man mich unter diesem Namen geehrt hat. Und im übrigen habe ich dich nie schäbig behandelt, und das weißt du. Du bist ein kranker Mann, Gerald, aber ich bin immer noch bereit, dir zu helfen, wenn du dich um ärztliche Hilfe bemühst. Vielleicht ist es tatsächlich meine Schuld, denn früher einmal hat das Leben mit dir Spaß gemacht, und du hast mich in meinem Kummer getröstet, das kann und werde ich nicht vergessen. Du hast mir geholfen, als ich Hilfe brauchte, Gerry, und deshalb werde ich jetzt dir helfen, wenn du dir helfen läßt.«
»Herrgott, ich kann Heilige nicht ertragen! Was kannst du jetzt für mich tun? Ich werde ein paar Jahre im Gefängnis verbringen, und was dann?«
»Nein, das wirst du nicht. Ich werde das Geld ersetzen, und du wirst England verlassen. Vielleicht nach Kanada gehen, oder in die USA. Dort kannst du dir helfen lassen. Aber in diesem Hause kannst du nicht mehr bleiben. Nimm mein Angebot an, Gerald. Es ist das letzte, das ich dir mache.«
Alicia stand vor ihrem Mann und sah ihn bittend an, als er plötzlich in die Höhe fuhr, ihren Rock packte und ihn über ihre Hüften hochriß. Eine Spritze tauchte in seiner Hand auf, die er in der Hosentasche versteckt gehalten hatte, während seine andere Hand ihr den Mund zuhielt. Er trieb ihr die Nadel durch den Strumpf in den Oberschenkel und hielt die Hand brutal über ihren Mund gepreßt, bis sie zusammenbrach. Sie war tot.
Der Mörder, der jetzt zum Schreibtisch ging und nach dem Telefon griff, war völlig nüchtern. Er wählte eine Codenummer in Frankreich, von wo das Gespräch nach Istanbul, dann in die Schweiz und schließlich – in den Computern unauffindbar – in die Niederlande weitergeleitet wurde. »Ja?« meldete sich der Mann in Amsterdam.
»Erledigt.«
»Gut. Und jetzt spielen Sie den verzweifelten Ehemann, den zerknirschten Schuldigen und verschwinden dort. Und denken Sie daran, nehmen Sie nicht Ihren Jaguar. Ein ganz normales Londoner Taxi erwartet Sie. Sie erkennen es daran, daß der Fahrer ein gelbes Taschentuch aus dem Fenster hält.«
»Sie werden mich schützen? Das haben Sie mir versprochen!«
»Sie werden den Rest Ihres Lebens an einem Ort in Luxus leben können, wo kein Gesetz Sie erreichen kann.«
»Das habe ich weiß Gott verdient – nach dem Zusammenleben mit dieser Zicke!«
»Ganz sicher. Beeilen Sie sich jetzt.«
Lady Brewsters zweiter Ehemann rannte weinend aus der Bibliothek. Er hetzte die Wendeltreppe hinunter, geriet dabei beinahe ins Straucheln, scheinbar von seinen Tränen geblendet, und jammerte die ganze Zeit: »Es tut mir leid. Es tut mir so leid! Ich hätte das nie tun sollen!« Jetzt war er in der Eingangshalle mit dem polierten Marmorboden, rannte an den Brewster-Kindern vorbei zur Tür, stieß sie auf und rannte nach draußen.
»Mutter muß ihm ganz schön die Leviten gelesen haben«, sagte Roger Brewster.
»Mum hat gesagt, du sollst aufpassen, wenn er in den Jaguar steigt. Dich vergewissern, ob er noch fahrtüchtig ist.«
»Scheiß drauf, kleine Schwester. Ich habe die Schlüssel. Dieser Mistkerl ist draußen.«
Am Bordstein in Belgravia wartete das Taxi auf Gerald, das gelbe Taschentuch hing aus dem Fahrerfenster. Er sprang auf den Rücksitz, sein Atem ging heftig. »Schnell!« rief er. »Man darf mich hier nicht sehen!« Plötzlich merkte Gerald, daß ein Mann neben ihm saß.
Kein Wort fiel, nur zwei schallgedämpfte Schüsse waren zu hören. »Fahren Sie zu der Eisenhütte im Norden von Heathrow«, sagte der Mann im Schatten. »Die Öfen dort brennen die ganze Nacht.«
3
Zwei Männer saßen einander an einem Konferenztisch in einem geheimen Strategiezimmer der Central Intelligence Agency in Langley, Virginia, gegenüber. Der ältere war der erste stellvertretende Direktor der CIA, der jüngere ein erfahrener Agent namens Cameron Pryce, ein Veteran des neuen kalten Friedens, dessen Laufbahn von Einsätzen in Moskau, Rom und London gekennzeichnet war. Pryce sprach mehrere Sprachen fließend: Russisch, Französisch und Italienisch und natürlich Englisch. Er war sechsunddreißig Jahre alt, ein Produkt der Georgetown University, die er mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen hatte, der Maxwell School of Foreign Service, Syracuse, mit einem Abschluß als Master of Arts und schließlich der Princeton University, wo er vorgehabt hatte zu promovieren – dies aber im zweiten Studienjahr aufgab, als Langley ihn bereits zu diesem Zeitpunkt rekrutierte.
Warum? Weil Cameron Pryce in einer unveröffentlichten Seminararbeit unbekümmert, aber hartnäckig den Fall der Sowjetunion auf vier Monate genau vorhergesagt hatte. Leute mit solchem Verstand waren wertvoll.
»Sie haben die Akte gelesen?« fragte Deputy Director Frank Shields, ein kleiner, etwas übergewichtiger ehemaliger Analytiker mit hoher Stirn und Augen, die immer den Eindruck machten, als würde er sie gegen die Sonne zusammenkneifen.
»Ja, das habe ich, Frank, und ich habe mir keine Notizen gemacht, ehrlich«, sagte Pryce, ein hochgewachsener, schlanker Mann, dessen scharfe Gesichtszüge man nur mit einigen Abstrichen als attraktiv bezeichnen konnte. Er lächelte sanft. »Aber das wissen Sie natürlich. Die Gnomen hinter diesen scheußlichen Reproduktionen an den Wänden haben mich die ganze Zeit beobachtet. Dachten Sie, ich hätte vor, ein Buch zu schreiben?«
»Das haben schon welche getan, Cam.«
»Snepp, Agee, Borstein und ein paar andere tapfere Streiter, die manche unserer Methoden nicht gerade bewundernswert fanden … Nicht mein Ding, Frank. Ich habe meinen Pakt mit dem Teufel gemacht, als Langley meine Studiendarlehen zurückgezahlt hat.«
»Darauf haben wir auch gebaut.«
»Bauen Sie bloß nicht zu hoch. Mit der Zeit hätte ich sie auch selbst zurückzahlen können.«
»Mit einem Dozentengehalt? Für eine Frau und Kinder und einen weißen Zaun ist auf dem Campus kein Platz.«
»Zum Teufel, dafür haben Sie ja auch gesorgt. Meine Beziehungen waren kurz und schmerzlos, und Kinder habe ich auch keine, wenigstens soweit mir bekannt ist.«