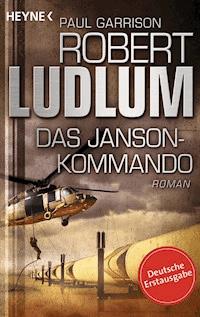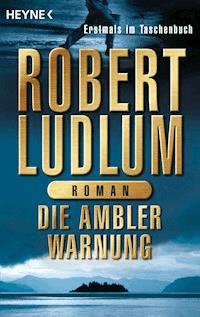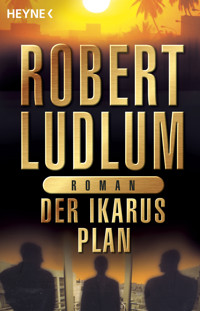8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: COVERT ONE
- Sprache: Deutsch
Die U.S. Marine hat einen chinesischen Frachter im Visier, der im Verdacht steht, gefährliche Chemikalien in den Irak zu transportieren. Um einen diplomatischen Supergau zu verhindern, muss der Geheimdienst herausfinden, ob aus dem Verdacht tatsächlich Wirklichkeit wird. Für diese Aufgabe gibt es keinen Besseren als den Chef der Geheimabteilung Covert One: Jon Smith. Was er entdeckt, bestätigt die schlimmsten Albträume.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Die U.S. Marine hat einen chinesischen Frachter im Visier, der im Verdacht steht, gefährliche Chemikalien in den Irak zu transportieren. Um einen diplomatischen Supergau zu verhindern, muss der Geheimdienst herausfinden, ob aus dem Verdacht tatsächlich Wirklichkeit wird. Für diese Aufgabe gibt es keinen Besseren als den Chef von der Geheimabteilung Covert One: Jon Smith. Er entdeckt, dass ein dubioses Finanzunternehmen mit dem Namen Altman Gruppe in die Sache verwickelt ist, die in Manila ihr Hauptquartier hat, und dass deren Verbindungen bis in die höchsten Kreise der chinesischen Regierung reichen.
Die Autoren
Robert Ludlums Romane wurden in über dreißig Sprachen übersetzt und er gilt als »größter Thrillerautor aller Zeiten« (The New Yorker). Ludlum verstarb im März 2001 in seiner Heimatstadt Naples, Florida. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Gayle Lynds arbeitete mehrere Jahre beim amerikanischen Geheimdienst, bevor sie mit dem Schreiben begann. Als Co-Autorin mehrerer Ludlum-Romane machte sie sich einen guten Namen in der Thrillerszene, bis sie mit ihrem ersten eigenen Thriller Der Nautilus-Plan einen großen internationalen Erfolg landete.
Inhaltsverzeichnis
Vorspiel
Freitag, 1. Septemher 2002 Shanghai, China
Am Nordufer des Huangpu-Flusses tauchten riesige Flutlichtanlagen den Hafen in grelles Licht und machten die Nacht zum Tag. Schwärme von Stauern entluden Lkws und brachten lange Stahlcontainer für die Kräne in Stellung. Inmitten des Quietschens und Scharrens von Metall an Metall hievten die imposanten Kräne die Container in den Sternenhimmel empor und senkten sie in die Laderäume von Frachtschiffen aus aller Welt. Hunderte davon liefen täglich in diesen wichtigen Hafen an Chinas Ostküste ein, der fast genau in der Mitte zwischen der Hauptstadt Beijing und Chinas jüngster Erwerbung Hongkong liegt.
Südlich des Hafens funkelten die Lichter der Stadt und der Hochbauten des neuen Wirtschaftsviertels Pudong, während sich auf dem aufgewühlten braunen Wasser des Flusses Frachter, Dschunken, winzige Sampans und lange Züge hölzerner Frachtkähne so dicht drängelten wie der Verkehr auf einem belebten Pariser Boulevard.
Auf einem Pier am Ostende des Hafens, nicht weit von der Stelle, wo der Huangpu eine scharfe Biegung nach Norden macht, war das Licht weniger hell. Hier wurde ein einzelner Frachter von einem einzigen Kran und nicht mehr als zwanzig Stauern beladen. Der Name, der auf dem Heckspiegel des Frachters stand, war The Dowager Empress, Heimathafen Hongkong. Von den allgegenwärtigen uniformierten Hafenwachen war keine Spur zu sehen.
Zwei große Lkws standen mit dem Heck zum Frachter. Schwitzende Stauer luden Stahlfässer ab, rollten sie über die Planken und stellten sie aufrecht auf ein Frachtnetz. Als das Netz voll war, schwenkte der Kranarm darüber, und die Trosse kam herunter. In dem Stahlhaken an ihrem Ende brach sich blitzend das Licht. Die Stauer befestigten das große Netz am Haken, worauf der Kran die Fässer rasch hochhob, sich drehte und sie auf den Frachter absenkte, wo Deckhelfer sie in den offenen Laderaum hinabbugsierten.
Die Lkw-Fahrer, Stauer, Deckhelfer und der Kranführer auf dem abgelegenen Pier arbeiteten zügig, schnell und lautlos, aber nicht schnell genug für den großen Mann, der rechts neben dem Lastwagen stand. Seinem wachsamen Blick entging nichts, was zwischen Land und Fluss geschah. Für einen Han-Chinesen ungewöhnlich hellhäutig, war sein Haar sogar noch ungewöhnlicher— hellrot, mit weißen Strähnen durchsetzt.
Er sah auf die Uhr. Seine hauchige Stimme war kaum zu hören, als er zum Vorarbeiter der Stauer sagte: »In sechsunddreißig Minuten seid ihr fertig.«
Es war keine Frage. Der Kopf des Vorarbeiters zuckte herum, als wäre er attackiert worden. Er schaute den Mann nur ganz kurz an, senkte den Blick und eilte davon, um auf seine Männer einzuschreien. Das Arbeitstempo nahm zu. Während der Vorarbeiter die Stauer zu größerer Eile antrieb, blieb der Mann, den er fürchtete, bedrohlich präsent.
Zur gleichen Zeit huschte an einer dunklen Stelle des Piers ein zierlicher Chinese in Reeboks, schwarzer Maojacke und westlichen Jeans hinter die mächtige Trommel eines dicken Taus.
Reglos, im schwachen Licht fast unsichtbar, beobachtete er, wie die Fässer auf das Frachtnetz gerollt und an Bord der Dowager Empress gehievt wurden. Er holte eine kleine, hochwertige Kamera aus seiner Maojacke und fotografierte alles und jeden, bis das letzte Fass im Laderaum verschwunden war und auch der zweite Lkw wegfuhr.
Dann drehte er sich lautlos um, verbarg die Kamera unter seiner Jacke und entfernte sich von den hellen Lichtern, bis er wieder von Dunkelheit umgeben war. Er richtete sich auf und huschte, sich jede Deckung vom Container bis zum Lagerschuppen zu Nutze machend, über die Holzplanken zu der Straße, die in die Stadt zurückführte. Über seinen Kopf strich ein warmer Nachtwind, der den intensiven Geruch des schlammigen Flusses mit sich führte. Er nahm keine Notiz davon. Er war begeistert, denn er würde mit wichtigen Informationen zurückkehren. Aber er war auch nervös. Mit diesen Leuten war nicht zu spaßen.
Als er die Schritte hörte, hatte er schon fast die Stelle erreicht, wo der Pier ans Ufer stieß. Fast war er in Sicherheit.
Der große Mann mit dem ungewöhnlichen rot-weißen Haar war ihm lautlos und parallel zu ihm an den Lager- und Werkschuppen entlang gefolgt. Vollkommen ruhig und gelassen beobachtete er, wie der kleine Mann zusammenfuhr, kurz stehen blieb und dann schneller weiterging.
Der Rothaarige schaute sich rasch um. Links von ihm war der Teil des Piers, der Lagergut und Seemöwen vorbehalten war, während man rechts eine Durchfahrt für Lkws und andere Fahrzeuge freigehalten hatte, damit diese zu den Ladebereichen gelangen konnten. Der letzte Lastwagen war hinter ihm; er fuhr auf ihn zu, in Richtung Ufer. Seine Scheinwerfer warfen Trichter hellen Lichts in die Nacht. Er würde jeden Augenblick an ihm vorbeikommen. Als sein Opfer am hintersten linken Ende hinter einem hohen Stapel aus Seilen verschwand, zog der Rothaarige seine Würgeschlinge heraus und rannte los. Bevor der kleine Chinese sich umdrehen konnte, schwang er die dünne Schnur über seinen Kopf, riss sie nach hinten und zog zu.
Eine endlose Minute lang krallten die Hände des Opfers nach der Schlinge. Die Schultern des Mannes verkrampften sich im Todeskampf. Sein Körper zuckte und zappelte. Endlich fielen seine Arme schlaff nach unten, und sein Kopf sackte nach vorn.
Der hölzerne Pier erzitterte, als der Lastwagen vorbeifuhr. Hinter dem Berg aus Seilen verborgen, ließ der Rothaarige den Toten auf die Planken gleiten. Er löste die Schlinge und durchsuchte die Kleider des Mannes, bis er die Kamera fand. Dann ging er in aller Ruhe ein Stück zurück, um zwei große Ladehaken zu holen. Er kniete neben der Leiche nieder, schlitzte ihr mit dem Messer, das er an seiner Wade befestigt hatte, den Bauch auf, steckte die Haken hinein und schlang, damit sie nicht herausrutschen konnten, ein Seil um den Bauch des Toten. Dann wälzte er ihn mit abwechselnden Fußtritten über den Rand des Piers in das dunkle Wasser, in dem er mit einem leisen Platschen versank. Jetzt konnte er nicht mehr an die Oberfläche steigen.
Der Rothaarige ging auf den Lkw zu, der, wie abgesprochen, angehalten hatte und auf ihn wartete, und stieg ein. Als der Lastwagen rasch in Richtung Stadt losfuhr, holte die Dowager Empress ihre Gangway ein und machte die Leinen los. Ein Schlepper zog sie auf den Huangpu hinaus, wo sie sich für die kurze Fahrt zum Jangtse und zum offenen Meer flussabwärts drehte.
Teil 1
1
Dienstag, 12. September Washington, D. C.
In Washington heißt es, die Regierung wird von Anwälten kontrolliert, aber die Anwälte ihrerseits unterliegen der Kontrolle der Geheimdienste. Die Stadt ist durchzogen von einem Netz von Geheimdiensten, angefangen bei den gleichermaßen legendären Behörden wie CIA und FBI und dem wenig bekannten NRO bis hin zu den so genannten Alphabet Groups in sämtlichen Bereichen von Militär und Regierung, einschließlich so illustrer Ministerien wie den Departments of State und Justice. Zu viele, fand Präsident Samuel Adams Castilla. Und zu sehr im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehend. Rivalitäten waren seit jeher ein Problem. Ein noch größeres Problem war die Weitergabe von Informationen, die unbeabsichtigt Desinformationen enthielten. Dann war da noch die gefährliche Schwerfälligkeit so zahlreicher bürokratischer Apparate.
Das und ein schwelender Konflikt auf internationaler Ebene bereiteten dem Präsidenten Kopfzerbrechen, als sein schwarzer Lincoln Towncar eine schmale Straße am Nordufer des Anacostia River entlangfuhr. Vom Motor war nur ein leises Summen zu hören, die getönten Fenster undurchsichtig. Die Limousine glitt an wild wucherndem Uferbewuchs und beleuchteten Jachthäfen vorbei, bis sie schließlich über die rostigen Schienen eines Nebengleises holperte und in eine belebte Marina bog, die vollständig eingezäunt war. Auf dem Schild am Eingang stand:
ANACOSTIA HOCHSEE-JACHTCLUB ZUTRITT NUR FÜR MITGLIEDER
Der Jachtclub schien sich durch nichts von all den anderen zu unterscheiden, die östlich des Washington Navy Yard den Fluss säumten. Es war eine Stunde vor Mitternacht.
Nur wenige Meilen oberhalb der Stelle gelegen, wo der Anacostia in den breiten Potomac mündet, lagen in der Marina neben großen hochseetauglichen Motor- und Segeljachten auch die üblichen Sonntagsseglerboote. Präsident Castilla schaute aus seinem Fenster auf die Anleger hinaus, die in das dunkle Wasser ragten. An einigen legten gerade salzverkrustete Hochsee-Jachten an. Die Crews trugen noch Ölzeug. Er sah, dass auf dem Gelände auch fünf Holzbauten unterschiedlicher Größe standen. Sie waren genauso angeordnet, wie man es ihm beschrieben hatte.
Der Lincoln hielt hinter dem größten der beleuchteten Gebäude an einer Stelle, wo er von den Anlegern nicht zu sehen und von der Straße durch dichtes Gehölz verdeckt war. Vier der Männer, die im Lincoln mitgefahren waren, alle in dunklen Anzügen und mit Maschinenpistolen in den Händen, stiegen rasch aus und gruppierten sich um den Wagen. Sie rückten ihre Nachtsichtgeräte zurecht und suchten das Dunkel ab. Schließlich drehte sich einer der vier nach dem Lincoln um und nickte kurz.
Der fünfte Mann, der neben dem Präsidenten gesessen hatte, trug ebenfalls einen dunklen Anzug, war aber mit einer 9mm SIG Sauer bewaffnet. Auf das Zeichen hin reichte ihm der Präsident einen Schlüssel, worauf er von der Limousine zu einem versteckten Seiteneingang des Gebäudes eilte. Er steckte den Schlüssel in ein verborgenes Schloss, öffnete die Tür, drehte sich um und spreizte, die Waffe im Anschlag, die Beine.
Im selben Moment öffnete sich die Autotür, die dem Gebäude am nächsten war. Die Nachtluft war kühl und frisch, durchsetzt von Dieselgestank. Der Präsident stieg aus – ein großer, stämmiger Mann in Chinos und einem legeren Sportsakko. Für einen Mann seiner Größe bewegte er sich flink, als er das Gebäude betrat.
Der fünfte Begleiter schaute sich ein letztes Mal um und folgte ihm mit zwei der vier anderen. Die verbleibenden beiden bezogen Stellung, um den Lincoln und den Seiteneingang zu bewachen.
Nathaniel Frederick (»Fred«) Klein, der zerknitterte Chef von Covert-One, saß an einem unaufgeräumten Metallschreibtisch in seinem engen Büro im Innern des Marinagebäudes. Das war die neue Covert-One-Schaltzentrale. Anfangs, vor lediglich vier Jahren, hatte Covert-One über keine formelle Organisationsstruktur oder Bürokratie verfügt, kein richtiges Hauptquartier und keine offiziellen Agenten gehabt. Es war eine lose Ansammlung von Fachleuten auf den unterschiedlichsten Gebieten gewesen, alle mit Geheimdiensterfahrung, die meisten mit militärischem Background und alle ungebunden – ohne Familien, häusliche Bindungen oder Verpflichtungen, weder temporär noch permanent.
Doch nachdem in der Zwischenzeit drei weltpolitische Krisen die Möglichkeiten des Elitekaders deutlich überstrapaziert hatten, war der Präsident zu der Überzeugung gelangt, dass seine ultrageheime Institution zum einen mehr Personal benötigte, zum anderen aber auch einen festen Sitz, der allerdings auf den Radarschirmen von Pennsylvania Avenue, Capitol Hill und Pentagon nicht zu sehen sein sollte. Das Ergebnis war dieser »private Jachtclub«.
Er verfügte über die unabdingbaren Voraussetzungen für effektive Geheimdienstarbeit: Sieben Tage die Woche war er rund um die Uhr geöffnet und in Betrieb, mit zeitweiligem, aber kontinuierlichem Verkehr vom Wasser wie vom Land, der keinem festen Schema unterworfen war. In der Nähe der Straße und des Nebengleises, aber noch auf dem Gelände gab es einen Hubschrauberlandeplatz, der mehr wie eine unkrautüberwucherte Wiese aussah. Über die ganze Anlage verteilt hatte man die neuesten elektronischen Kommunikationsanlagen installiert, und die Sicherheitsvorkehrungen waren fast unbemerkbar, aber extrem effektiv. Nicht einmal eine Libelle konnte die Umzäunung überfliegen, ohne dass sie einer der Sensoren registrierte.
Klein war allein in seinem Büro. Nur die Geräusche, die sein kleiner Nachtschicht-Mitarbeiterstab machte, drangen gedämpft durch die geschlossene Tür. Er hatte die Augen geschlossen und rieb sich die lange Nase. Seine Brille lag auf dem Schreibtisch. Er sah diesen Abend kein Jahr jünger aus als seine sechzig, seit er die Leitung von Covert-One übernommen hatte, war er merklich gealtert. Sein verschlossen wirkendes Gesicht war von neuen Falten zerfurcht, sein Haaransatz zwei Zentimeter höher gewandert. Eine neue Krise stand kurz vor dem Ausbruch.
Als seine Kopfschmerzen nachließen, setzte er sich zurück, öffnete die Augen, setzte die Brille auf und begann wieder an seiner allgegenwärtigen Pfeife zu paffen. Das Zimmer füllte sich mit Rauchwölkchen, die fast so schnell verschwanden, wie er sie erzeugte, abgesaugt von der starken Lüftungsanlage, die eigens zu diesem Zweck eingebaut worden war.
Auf seinem Schreibtisch lag ein aufgeschlagener Aktenordner, aber er sah ihn nicht an. Stattdessen rauchte er, klopfte mit dem Fuß auf den Boden und blickte alle paar Sekunden auf die Schiffsuhr an der Wand. Endlich öffnete sich links von ihm, unter der Uhr, eine Tür, und ein Mann mit einer SIG Sauer ging durch das Büro zur Außentür, schloss sie ab und stellte sich davor.
Sekunden später kam der Präsident herein. Er setzte sich in den Ledersessel vor Kleins Schreibtisch.
»Danke, Barney«, sagte er zu dem Sicherheitsbeamten. »Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich Sie brauche.«
»Aber Mr. President ...«
»Sie können gehen«, befahl Castilla mit Nachdruck. »Warten Sie draußen. Hier handelt es sich um eine Privatunterhaltung unter alten Freunden.« Zum Teil stimmte das. Er und Fred Klein kannten sich seit dem College.
Jeder Schritt des Sicherheitsbeamten war von Widerstreben begleitet, als er den Raum langsam erneut durchquerte.
Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, blies Klein eine kleine Rauchwolke aus. »Ich hätte auch, wie sonst immer, zu dir kommen können, Sam.«
»Nein.« Sam Castilla schüttelte den Kopf. Die Gläser seiner Titanbrille reflektierten das Deckenlicht mit einem scharfen Blitzen. »Bis du mir nicht genau erzählt hast, was es mit diesem chinesischen Frachter auf sich hat – die Dowager Empress, nicht wahr? –, bleibt diese Geschichte unter uns und denen deiner Agenten, die du darauf ansetzt.«
»Sind die Lecks so schlimm?«
»Schlimmer«, sagte der Präsident. »Das Weiße Haus ist ein einziges Sieb. So etwas habe ich noch nie erlebt. Solange meine Leute die Quelle nicht finden können, treffe ich mich hier mit dir.« Der Ausdruck seines lang gezogenen Gesichts war tief besorgt. »Glaubst du, wir haben es hier mit einer zweiten Yinhe zu tun?«
Kleins Gedanken wurden unverzüglich in die Vergangenheit zurückversetzt: In das Jahr 1993, zu einem unangenehmen internationalen Zwischenfall, aus dem Amerika als großer Verlierer hervorgegangen war. Die Yinhe, ein chinesischer Frachter, war von China nach dem Iran unterwegs gewesen. Dem amerikanischen Geheimdienst hatten Berichte vorgelegen, denen zufolge das Schiff Chemikalien an Bord hatte, die zum Bau von Massenvernichtungswaffen verwendet werden konnten. Nachdem über die üblichen diplomatischen Kanäle nichts zu erreichen gewesen war, erteilte Präsident Bill Clinton der US Navy den Auftrag, die Verfolgung des Schiffes aufzunehmen und es nirgendwo landen zu lassen, bis man irgendeine Form von Lösung gefunden hatte.
China wies die Anschuldigungen erbost zurück. Führende Staatsoberhäupter schalteten sich ein. Verbündete erhoben Vorwürfe und Gegenvorwürfe. Und die Medien berichteten weltweit mit Riesenschlagzeilen über die Pattsituation, die sich endlos scheinende zwanzig Tage lang hinzog. Als China schließlich lautstark mit dem Säbel zu rasseln begann, zwang die US Navy die Yinhe auf hoher See zum Beidrehen, und es kamen Inspektoren an Bord des Schiffs. Zur nicht geringen Verlegenheit der Amerikaner entdeckten sie jedoch nichts als landwirtschaftliche Geräte – Pflüge, Schaufeln und kleine Traktoren. Die Informationen waren falsch gewesen.
Klein schnitt eine Grimasse, denn er erinnerte sich nur zu gut an den für Amerika äußerst peinlichen Zwischenfall, unter dem die Beziehungen zu China, und auch zu dessen Verbündeten, jahrelang gelitten hatten.
Er paffte finster vor sich hin und fächelte den Rauch vom Präsidenten fort. »Haben wir es mit einer zweiten Yinhe zu tun?«, wiederholte er. »Vielleicht.«
»Es gibt wahrscheinliche >Vielleichts< undunwahrscheinliche ›Vielleichts‹. Erzähl mir lieber alles, was du über die Sache weißt. In allen Einzelheiten.«
Klein drückte die Glut in seiner Pfeife nieder. »Einer unserer Agenten ist Sinologe und seit zehn Jahren für ein Konsortium amerikanischer Firmen tätig, die in Shanghai Fuß zu fassen versuchen. Er heißt Avery Mondragon und hat Informationen erhalten, denen zufolge die Dowager Empress Tonnen von Thiodiglykol und Thionylchlorid geladen hat, die für die Herstellung von Senfgas beziehungsweise Hautkampfstoffen und Nervengasen verwendet werden. Der Frachter ist bereits von Shanghai aus in See gestochen und in Richtung Irak unterwegs. Beide Chemikalien finden selbstverständlich auch in der Landwirtschaft Verwendung, aber in einem Land von der Größe des Irak nicht in solchen Mengen.«
»Wie zuverlässig sind die Informationen diesmal, Fred? Hundert Prozent? Neunzig?«
»Ich habe sie nicht zu Gesicht bekommen«, erwiderte Klein ruhig. Als er diesmal eine Rauchwolke ausstieß, vergaß er, sie wegzuwedeln. »Mondragon behauptet allerdings, sie liegen ihm schwarz auf weiß vor. Er hat das Originalmanifest, das Verzeichnis der tatsächlich auf dem Schiff beförderten Güter.«
»Na, großartig.« Castillas mächtiger Oberkörper mit den massigen Schultern schien plötzlich wie erstarrt. »Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber China gehört zu den Ländern, die das internationale Abkommen unterzeichnet haben, das Entwicklung, Produktion, Lagerung und Einsatz von chemischen Waffen verbietet. Sie werden mit allen Mitteln zu verhindern versuchen, eines Bruchs dieses Abkommens überführt zu werden. Denn das könnte sie in ihren Bemühungen, sich einen immer größeren Anteil am Welthandel zu sichern, empfindlich zurückwerfen.«
»Eine verdammt prekäre Situation.«
»Eine weitere Panne unsererseits könnte uns gerade jetzt besonders teuer zu stehen kommen, nachdem sie kurz davor stehen, unser Menschenrechtsabkommen zu unterzeichnen.«
Als Gegenleistung für finanzielle und handelspolitische Zugeständnisse seitens der USA, für die der Präsident den störrischen Kongress mit Zuckerbrot und Peitsche hatte gewinnen müssen, war China bereit gewesen, ein bilaterales Menschenrechtsabkommen zu unterzeichnen, das seine Gefängnisse und Strafgerichtshöfe für UN- und US-Inspektoren öffnen, seine Straf- und Zivilgerichte westlichen und internationalen Standards angleichen und langjährigen politischen Häftlingen die Freiheit bringen würde. Ein solches Abkommen hatte schon seit Dick Nixon höchste Priorität für amerikanische Präsidenten.
Sam Castilla wollte es auf keinen Fall vereitelt sehen. Aus persönlichen und menschenrechtlichen Gründen war nämlich sein Zustandekommen auch schon lange ein Traum von ihm. »Außerdem ist es eine verdammt brisante Situation. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Schiff ... wie hieß es gleich wieder, Dowager Empress?«
Klein nickte.
»Wir dürfen nicht zulassen, dass die Dowager Empress mit waffenfähigen Chemikalien in Basra einläuft. So einfach ist das. Punkt.« Castilla erhob sich und begann, auf und ab zu gehen. »Wenn sich deine Informationen als zuverlässig erweisen und wir diese Dowager Empress näher unter die Lupe nehmen, wie werden die Chinesen reagieren?« Er schüttelte den Kopf und winkte seine eigenen Worte fort. »Nein, das ist nicht die Frage, oder? Wie sie reagieren könnten, wissen wir. Sie werden mit dem Säbel rasseln, lautstark protestieren und sich aufplustern. Die Frage ist, was werden sie tatsächlich tun?« Er sah Klein an. »Vor allem, wenn wir uns wieder täuschen.«
»Das kann niemand wissen oder vorhersagen. Andererseits kann kein Land riesige Armeen und Atomwaffen bereithalten, ohne sie irgendwo, irgendwann einsetzen zu wollen, und sei es auch nur aus dem Grund, die Kosten zu rechtfertigen.«
»Da bin ich anderer Meinung, Fred. Wenn die Wirtschaft eines Landes gesund ist und seine Bewohner zufrieden sind, ist es einem Staatsoberhaupt sehr wohl möglich eine Armee präsent zu haben, ohne sie einzusetzen.«
»Falls China natürlich den Vorfall als Vorwand benutzen will, dass es bedroht wird, könnten sie in Taiwan einfallen«, erklärte Fred Klein. »Das wollen sie schon seit Jahrzehnten.«
»Allerdings nur, wenn sie den Eindruck haben, dass wir nicht zurückschlagen werden, ja. Jetzt, wo Russland in der Region keine so große Bedrohung mehr darstellt, wäre auch Zentralasien noch eine Möglichkeit.«
Der Leiter von Covert-One sprach die Worte aus, die keiner von beiden auch nur denken wollte: »Angesichts ihrer Langstreckenatomwaffen droht uns nicht weniger Gefahr als irgendeinem anderen Land.«
Castilla wehrte sich gegen ein Schaudern. Klein nahm die Brille ab und massierte seine Schläfen. Die zwei Männer blieben still.
Schließlich seufzte der Präsident. Er hatte eine Entscheidung getroffen. »Na schön, ich werde der Navy durch Admiral Brose den Befehl erteilen lassen, der Dowager Empress zu folgen und sie im Auge zu behalten. Wir werden es als routinemäßige Überwachung auf See ausgeben und niemanden außer Brose über die aktuelle Situation in Kenntnis setzen.«
»Die Chinesen bemerken natürlich, dass wir ihr Schiff beschatten.«
»Wir werden abzuwiegeln versuchen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie lange wir damit durchkommen können.« Der Präsident ging zur Tür und blieb stehen. Als er sich umdrehte, wirkte sein Gesicht länger und ernster, seine Hängebacken stärker ausgeprägt als sonst. »Ich brauche Beweise, Fred. Und zwar sofort. Beschaff mir dieses Güterverzeichnis.«
»Das kannst du haben, Sam.«
Mit besorgt hängenden Schultern nickte Präsident Castilla, öffnete die Tür und ging hinaus. Einer der Secret-Service-Agenten schloss sie.
Wieder allein, dachte Klein stirnrunzelnd über sein weiteres Vorgehen nach. Als er die Limousine des Präsidenten abfahren hörte, traf er eine Entscheidung. Er drehte sich zu dem kleinen Tisch hinter seinem Schreibtisch herum, auf dem die Telefone standen. Eines war rot – eine abhörsichere Direktverbindung zum Präsidenten. Das andere war blau. Es war ebenfalls abhörsicher. Er nahm den Hörer des blauen Apparats ab und wählte.
Mittwoch, 13. September Kaohsiung, Taiwan
Nach einem halb durchgebratenen Hamburger und einer Flasche taiwanesischem Lager im Smokey Joe’s in der Chunghsiao Road 1 beschloss Jon Smith, ein Taxi zum Hafen von Kaohsiung zu nehmen. Er hatte noch eine Stunde Zeit bis zu den Nachmittagsveranstaltungen im Grand Hotel Hi-Lai, bei denen er sich mit seinem alten Freund Mike Kerns vom Pasteur-Institut in Paris treffen würde.
Smith war schon fast eine Woche in Kaohsiung – Taiwans zweitgrößter Stadt –, aber erst an diesem Tag hatte er Zeit gefunden, sich die Stadt anzusehen. Aber dieser gedrängte Zeitplan, hatte zumindest er die Erfahrung gemacht, war bei wissenschaftlichen Kongressen ganz normal. Er arbeitete für das US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases oder kurz USAMRIID, das medizinische Forschungsinstitut der US Army für ansteckende Krankheiten, und war sowohl Arzt und Molekularbiologe als auch Lieutenant Colonel der Army. Seine Forschungsarbeit über Anthrax-Abwehrstoffe hatte er vorübergehend ruhen lassen, um an diesem internationalen wissenschaftlichen Kongress über neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der Molekular- und Zellbiologie teilzunehmen.
Aber wie Fische und Gäste begannen auch wissenschaftliche Kongresse nach drei oder vier Tagen zu stinken. Ohne Kopfbedeckung, in Zivilkleidung, ging er am Wasser entlang und sah sich den herrlichen Hafen an, den nach Hongkong und Singapur drittgrößten Containerhafen der Welt. Er war vor Jahren schon einmal hier gewesen, bevor man den Tunnel zur Hauptinsel fertig gestellt hatte und die paradiesische Insel ein weiterer verbauter Teil des Containerhafens geworden war.
Es war ein strahlender Sonnentag wie aus dem Bilderbuch, und die Insel Hsiao Liuchiu war am südlichen Horizont deutlich zu erkennen. Begleitet von kreisenden Möwen und dem geschäftigen Lärm des Hafens ging erweitere fünfzehn Minuten im hellen Sonnenschein spazieren. Hier war nichts vom Ringen um Taiwans Zukunft zu spüren, die vor allem davon abhing, ob der Inselstaat unabhängig blieb, oder ob man ihn erobern oder sonst irgendwie der Volksrepublik China einverleiben würde, die Taiwan immer noch als ihr Eigentum betrachtete.
Schließlich nahm er sich ein Taxi ins Hotel zurück. Kaum hatte er es sich auf dem Rücksitz bequem gemacht, begann das Handy in seinem Sportsakko zu vibrieren. Es war nicht sein reguläres Telefon, sondern das Spezialhandy in der Geheimtasche. Das Telefon, das abhörsicher war.
»Smith«, meldete er sich leise.
»Wie geht’s auf dem Kongress, Colonel?«, fragte Fred Klein.
»Langsam wird es langweilig«, gab er zu.
»Dann kann ein bisschen Abwechslung nicht schaden.«
Smith lächelte in sich hinein. Er war nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Undercover-Agent. Die zwei Hälften seines Lebens auszubalancieren, war selten leicht. Er hatte nichts gegen »ein bisschen Abwechslung«, aber nichts zu Umfangreiches oder Zeitraubendes. Eigentlich wollte er durchaus wieder zum Kongress zurück. »Was ist es diesmal, Fred?«
Von seinem fernen Büro am Ufer des Anacostia River aus schilderte ihm Klein den Sachverhalt.
Smith spürte ein Frösteln, das sowohl Sorge wie Spannung verursachten. »Was soll ich tun?«
»Fahren Sie heute Abend auf die Insel Liuchiu. Zeitlich müsste das an sich zu schaffen sein. Mieten Sie sich in Linyuan ein Boot – wenn nötig, zahlen Sie einfach etwas mehr –, und seien Sie um neun auf der Insel. Punkt zehn Uhr finden Sie sich in einer kleinen Bucht an der Westküste ein. Genaue Lage, Orientierungspunkte und einheimische Bezeichnung wurden bereits an einen Covert-One-Mitarbeiter am American Institute in Taiwan gefaxt. Die Angaben werden Ihnen per Boten zugestellt.«
»Was passiert in dieser Bucht?«
»Sie treffen sich dort mit einem anderen Covert-One Agenten, Avery Mondragon. Das Kennwort lautet ›Orchidee‹. Er übergibt Ihnen einen Umschlag mit dem Manifest der Dowager Empress. Das ist eine Aufstellung der Ladung des Schiffes, wie sie dem Irak in Rechnung gestellt wird. Anschließend fahren Sie direkt zum Flughafen von Kaohsiung. Dort wartet ein Hubschrauber eines unserer vor der Küste liegenden Kreuzer. Geben Sie dem Piloten das Manifest. Es soll umgehend ins Oval Office gebracht werden. Verstanden?«
»Dasselbe Kennwort?«
»Ja.«
»Und dann?«
Smith konnte den Leiter von Covert-One an seiner Pfeife saugen hören. »Dann kehren Sie zu Ihrem Kongress zurück.«
Die Verbindung wurde unterbrochen. Smith grinste. Ein einfacher, unkomplizierter Auftrag.
Wenige Augenblicke später hielt das Taxi vor dem Hi-Lai Hotel. Er bezahlte den Fahrer und betrat das Foyer, wo er auf den Mietwagenschalter zusteuerte. Sobald der Kurier aus Taipei eintraf, würde er auf der Küstenstraße nach Linyuan fahren und sich nach einem Fischerboot umsehen, das ihn unauffällig nach Liuchiu brachte. Wenn er keines mit Besatzung auftreiben konnte, würde er eines mieten und selbst fahren.
Als er das Foyer durchquerte, sprang ein kleiner, quirliger Chinese von seinem Sessel auf und stellte sich ihm in den Weg. »Ah, Dr. Smith, gut, dass ich Sie sehe. Es ist mir eine Ehre, Sie persönlich kennen zu lernen. Ihre Abhandlung über Dr. Chambords theoretische Arbeiten mit dem Molekularcomputer war ganz hervorragend. Eine Menge Denkanstöße.«
Smith lächelte in Erwiderung des Grußes wie des Kompliments. »Sie schmeicheln mir, Dr. Liang.«
»Keineswegs. Hätten Sie vielleicht Lust, heute mit mir und ein paar meiner Kollegen vom Biomedizinischen Institut Shanghai zu Abend zu essen? Wir interessieren uns sehr für die Arbeit von USAMRIID und CDC über neue virale Krankheitserreger, die uns alle gleichermaßen bedrohen.«
»Sehr gern«, erwiderte Smith glatt, mit einem Anflug von Bedauern in der Stimme, »aber ich bin heute Abend bereits verabredet. Vielleicht ginge es ja zu einem anderen Zeitpunkt?«
»Ich melde mich bei Ihnen, wenn es Ihnen recht ist.«
»Aber natürlich, Dr. Liang.« In Gedanken bereits bei Liuchiu und seiner Mission, ging Jon Smith zum Schalter weiter.
2
Washington, D. C.
Admiral Stevens Brose, breit und von imposanter Körperstatur, füllte seinen Sessel am Fußende des langen Konferenztisches im unterirdischen Situation Room des Weißen Hauses vollständig aus. Er nahm seine Mütze ab und strich erstaunt – und besorgt – über seinen grauen militärischen Bürstenschnitt. Präsident Castilla hatte wie immer den Platz am Kopfende eingenommen, aber sie waren die einzigen Anwesenden in dem großen Raum und tranken ihren Morgenkaffee. Die Sitzreihen zu beiden Seiten des langen Tisches hatten etwas Ominöses in ihrer Verlassenheit.
»Was für Chemikalien, Mr. President?«, fragte Admiral Brose. Er war auch der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs.
»Thiodiglykol ...«
»Senfgas.«
»... und Thionylchlorid.«
»Senfgas und Nervengase. Verdammt schmerzhaft und tödlich, alle beide. Eine schreckliche Art zu sterben.« Der dünne Mund und das mächtige Kinn des Admirals spannten sich. »In welchen Mengen?«
»Um die fünfzig Tonnen.«
»Das geht auf keinen Fall. Wenn ...« Brose verstummte abrupt und kniff seine fahlen Augen zusammen. Er ließ den Blick über die leeren Stühle an dem langen Tisch streichen. »Verstehe. Wir werden die Dowager Empress nicht auf See stoppen und durchsuchen. Sie möchten geheim halten, dass wir davon wissen.«
»Vorerst ja. Wir haben keine konkreten Beweise, jedenfalls nicht mehr, als wir im Fall der Yinhe hatten. Wir können uns keinen zweiten solchen Zwischenfall leisten, speziell angesichts der verminderten Bereitschaft unserer Verbündeten, uns bei einem militärischen Einschreiten zu unterstützen; und dann stehen die Chinesen auch noch kurz davor, unser Menschenrechtsabkommen zu unterzeichnen.«
Brose nickte. »Was soll ich dann in dieser Sache unternehmen, Sir? Außer alles für mich zu behalten?«
»Entsenden Sie ein Schiff, das die Empress im Auge behält. Nahe genug, um gegebenenfalls einschreiten zu können, aber außer Sichtweite.«
»Außer Sichtweite vielleicht schon, aber sie werden merken, dass es da ist. Es wird auf ihrem Radar auftauchen. Wenn sie verbotene Chemikalien an Bord haben, dürfte zumindest der Kapitän Bescheid wissen. Er wird seine Besatzung zu größter Wachsamkeit anhalten.«
»Daran lässt sich nichts ändern. So sieht es aus, bis ich absolute Gewissheit habe. Wenn es kritisch wird, erwarte ich, dass Sie und Ihre Leute die Situation auf keinen Fall eskalieren lassen.«
»Haben wir jemand, der uns eine Bestätigung beschafft?«
»Das hoffe ich.«
Brose überlegte. »Wurde der Frachter am Monatsersten beladen, spätnachts?«
»So lauten meine Informationen.«
Brose überschlug etwas im Kopf. »Wie ich die Chinesen und Shanghai kenne, ist sie nicht vor dem frühen Morgen des Zweiten in See gestochen.« Er griff nach dem Telefon neben ihm und sah den Präsidenten an. »Sie gestatten, Sir?«
Samuel Castilla nickte.
Brose wählte und sagte in den Hörer: »Es ist mir egal, wie früh es ist, Captain. Beschaffen Sie mir, was ich brauche.« Er strich wieder mit der Hand über sein kurzes Haar, während er wartete. »Richtig, Heimathafen Hongkong. Ein Massengutfrachter. Fünfzehn Knoten. Sind Sie sicher? Gut.« Er legte auf. »Bei fünfzehn Knoten wären das mit einem Zwischenstop in Singapur, was gängige Praxis ist, etwa achtzehn Tage bis nach Basra. Wenn das Schiff am Ersten gegen Mitternacht abgelegt hat, sollte es am frühen Morgen des neunzehnten, chinesischer Zeit, in der Straße von Hormuz eintreffen. Nach Persischer-Golf-Ortszeit drei Stunden früher und nach unserer Zeit am Abend des achtzehnten. Heute ist der dreizehnte. Folglich müsste der Frachter die Straße von Hormuz in frühestens fünf Tagen erreichen, und das ist der letzte Punkt, an dem wir legal an Bord gehen können.« Seine Stimme hob sich vor Besorgnis. »Nur fünf Tage, Sir! Das ist unser zeitlicher Rahmen, um diese heikle Situation zu bereinigen.«
»Danke, Stevens. Ich werde es weitergeben.«
Der Admiral stand auf. »Eine unserer Fregatten wäre für das, was Sie sich vorstellen, am besten geeignet. Genügend Muskeln, aber nicht zu dick aufgetragen. Und klein genug, um vielleicht eine Weile übersehen zu werden, wenn der Mann am Radar schläft oder faul ist.«
»Wie schnell könnte ein solches Schiff an Ort und Stelle sein?«
Brose griff erneut nach dem Telefon. Diesmal fiel das Gespräch sogar noch kürzer aus. Er legte auf. »In zehn Stunden, Sir.«
»Dann los.«
Liuchiu, Taiwan
Im grünen Schein seiner Uhr las Agent Jon Smith wieder einmal die Zeit ab. 22 Uhr 03. Er fluchte stumm. Mondragon hatte sich verspätet.
Er kauerte geduckt vor der messerscharfen Korallenformation, die die abgelegene Bucht umgab, und lauschte, aber das einzige Geräusch war das leise Rauschen des Südchinesischen Meeres, das auf den dunklen Sand hochschwappte und mit einem hörbaren Zischen zurückglitt. Der Wind war nur ein Hauch. Die Luft roch nach Salzwasser und Fisch. Ein Stück die Küste hinunter lagen, im Mondlicht reglos schimmernd, mehrere Boote. Die Tagesbesucher hatten die Insel mit der letzten Fähre von Penfu verlassen.
In anderen kleinen Buchten an der Westküste der Insel kampierten Leute, aber in dieser Bucht gab es nur das Rauschen des Meeres und die fernen Lichter von Kaohsiung, das etwa zwanzig Kilometer nordöstlich lag.
Smith sah wieder auf die Uhr — 22 Uhr 06. Wo blieb Mondragon?
Das Fischerboot aus Linyuan hatte ihn zwei Stunden zuvor im Hafen von Penfu abgesetzt, wo er sich ein Motorrad gemietet hatte und auf der Küstenstraße losgefahren war. Sobald er die in seinen Angaben beschriebene Stelle gefunden und nachdem er das Motorrad im Gebüsch versteckt hatte, war er zu Fuß hierher gekommen.
Jetzt war es bereits 22 Uhr 10, und er wartete unruhig, nervös. Irgendetwas war schief gegangen.
Er wollte gerade sein Versteck verlassen, um sich vorsichtig umzusehen, als er spürte, wie sich der grobe Sand bewegte. Er hörte nichts, aber die Haut in seinem Nacken begann zu kribbeln. Hastig packte er seine 9-mm-Beretta und machte sich bereit, sich seitwärts auf den Sand und hinter die Felsen zu werfen, als heißer, angespannter Atem sein Ohr streifte:
»Keine Bewegung!«
Smith erstarrte.
»Nicht einmal mit dem Finger.« Die tiefe Stimme war wenige Zentimeter von seinem Ohr entfernt. »Orchidee.«
»Mondragon?«
»Jedenfalls nicht der Geist des Vorsitzenden Mao«, antwortete die Stimme sarkastisch. »Obwohl er sich vielleicht hier irgendwo herumtreibt.«
»Ist Ihnen jemand gefolgt?«
»Schätze schon. Aber sicher bin ich nicht. Wenn ja, habe ich ihn abgeschüttelt.«
Wieder rieselte der Sand, und Avery Mondragon tauchte auf und kauerte sich neben Smith nieder. Er war klein, dunkelhaarig und dünn, wie ein zu großer Jockey. Mit einem harten Gesicht und einem hungrigen Ausdruck in seinen Raubtieraugen. Sein Blick schoss überallhin – über die Schatten der Bucht, auf die phosphoreszierende Brandung am Strand und hinaus auf die bizarren Korallenformationen, die in der Brandung wie Statuen aus dem dunklen Meer ragten.
»Bringen wir’s hinter uns«, sagte Mondragon. »Wenn ich bis halb zwölf nicht in Penfu bin, schaffe ich es bis zum Morgen nicht aufs Festland zurück. Und wenn ich das nicht schaffe, fliegt meine Tarnung auf.« Er richtete den Blick auf Smith. »Sie sind also Lieutenant Colonel Smith, hm? Ich habe da so einiges über Sie gehört. Sie sollen gut sein. Ich hoffe nur, an diesen Geschichten ist auch was Wahres dran. Was ich für Sie habe, könnte man nämlich durchaus als hochbrisant bezeichnen.«
Er holte einen normalen Umschlag hervor und hielt ihn hoch.
»Das ist die Ware?«, fragte Smith.
Mondragon nickte und ließ den Umschlag wieder in seiner Jacke verschwinden. »Da gibt es noch ein paar Dinge, die Sie Klein sagen sollten.«
»Dann schießen Sie doch los.«
»In diesem Umschlag ist, was die Dowager Empress tatsächlich an Bord hat. Dagegen ist das so genannte offizielle Manifest – das bei der Exportkommission eingereicht wurde – reine Augenwischerei.«
»Woher wissen Sie das?«
»Weil dieser Aufstellung hier eine Rechnung beiliegt, die sowohl mit dem persönlichen Siegel des Direktors als auch mit dem offiziellen Firmensiegel abgestempelt ist, und weil sie an die Firma in Bagdad adressiert wurde. Außerdem geht aus diesem Manifest hervor, dass es in dreifacher Ausfertigung existiert. Ein Exemplar befindet sich bestimmt in Bagdad oder Basra, weil es ja zugleich die Rechnung für die Lieferung ist. Wo das andere Exemplar ist, weiß ich nicht.«
»Woher wollen Sie wissen, dass Sie nicht das Manifest haben, das bei der Exportkommission eingereicht wurde?«
»Weil ich diese Aufstellung, wie bereits gesagt, ebenfalls gesehen habe. Darauf ist die Schmuggelware nicht aufgeführt. Und das Siegel des Firmenchefs fehlt.«
Smith runzelte die Stirn. »Trotzdem heißt das noch lange nicht, dass auf das, was Sie hier haben, hundertprozentig Verlass ist.«
»Hundertprozentig ist auf nichts Verlass. Alles kann gefälscht werden – man kann Siegel nachmachen, und Firmen in Bagdad können nur auf dem Papier existieren. Aber das hier ist ein Recbnungsmanifest und verfügt über alle Erkennungsmerkmale eines innerbetrieblichen Dokuments, das zu Zahlungszwecken an die Empfängerfirma geschickt wird. Es ist für Präsident Castilla auf jeden Fall eine hinreichende Rechtfertigung, die Empress nötigenfalls auf hoher See anhalten und gründlich durchsuchen zu lassen. Abgesehen davon ist es ein wesentlich ›berechtigterer Grund‹, als es damals die Gerüchte in Zusammenhang mit der Yinhe waren, und wenn es wirklich eine Fälschung sein sollte, ist es der Beweis für ein Komplott in China, das dem Zweck dient, Unruhe zu stiften. Niemand, nicht einmal Beijing, könnte uns zum Vorwurf machen, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.«
Smith nickte. »Sie haben mich überzeugt. Geben Sie es ...«
»Da ist noch etwas.« Mondragon ließ den Blick über die Schatten der winzigen Bucht huschen. »Einer meiner Informanten in Shanghai hat mir etwas erzählt, was Sie unbedingt an Klein weitergeben sollten. Es steht aus nahe liegenden Gründen nicht in den schriftlichen Unterlagen. Er sagt, es gibt da einen alten Mann, der in einem Straflager in der Nähe von Chongqing festgehalten wird – das ist Chiang Kaisheks alte Hauptstadt aus dem Zweiten Weltkrieg, die wir im Westen noch unter dem Namen ›Tschungking‹ kennen. Er behauptet, er befindet sich seit der Machtergreifung 1949 durch die Kommunisten an verschiedenen Orten Chinas in Haft. Laut Aussagen meines Informanten spricht der Alte neben Mandarin auch eine ganze Reihe chinesischer Dialekte, aber er sieht ganz und gar nicht wie ein Chinese aus. Der alte Mann behauptet steif und fest, Amerikaner zu sein und David Thayer zu heißen.« Er hielt inne und sah Smith mit undurchdringlicher Miene an. »Und jetzt halten Sie sich fest ... er behauptet außerdem, Präsident Castillas leiblicher Vater zu sein.«
Smith erwiderte den Blick. »Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Jeder weiß doch, der Vater des Präsidenten war Serge Castilla, und er ist inzwischen tot. Die Presse hat lückenlos über diese Familie berichtet.«
»Eben. Genau das hat mich hellhörig gemacht.« Mondragon rückte weitere Details heraus. »Mein Informant sagt, er hat genau die Wendung ›Präsident Castillas leiblicher Vater‹ benutzt. Warum sollte der Kerl, falls er ein Schwindler ist, sich etwas ausdenken, was so leicht zu widerlegen wäre?«
Das war eine gute Frage. »Wie zuverlässig ist Ihr Informant?«
»Er hat mich nie auf eine falsche Fährte gelockt oder mir Desinformationen zugespielt, die für mich als solche zu erkennen waren.«
»Könnte es einer dieser Tricks der Regierung in Beijing sein? Vielleicht ein Versuch, den Präsidenten dazu zu bringen, beim Menschenrechtsabkommen einen Rückzieher zu machen?«
»Der alte Häftling behauptet, Beijing weiß nicht einmal, dass er einen Sohn hat, geschweige denn, dass er jetzt Präsident der Vereinigten Staaten ist.«
Fieberhaft rechnete Smith im Kopf Alter und Jahre nach. Numerisch war es möglich. »Wo genau wird dieser Alte ...«
»Runter!« Mondragon ließ sich bäuchlings auf den Sand fallen.
Mit klopfendem Herzen hechtete Smith hinter einen Korallenblock, als von rechts, vom Wasser her, wütende chinesische Rufe, begleitet vom Feuer automatischer Waffen, ertönten. Mondragon robbte zu Smith hinter den Korallenblock und richtete sich geduckt auf. Seine 9mm-Glock kam neben Smiths Beretta zum Vorschein, und gemeinsam suchten sie das Dunkel der Bucht nach ihren Feinden ab.
»Sieht ganz so aus, als hätte ich sie nicht abgeschüttelt«, bemerkte Mondragon besorgt
Smith vergeudete keine Zeit mit Vorwürfen. »Wo sind sie? Können Sie etwas sehen?«
»Absolut nichts.«
Smith zog ein Nachtsichtgerät aus seiner Windjacke und setzte es auf. Die Nacht nahm ein fahles Grün an, und die verschwommenen Korallenformationen draußen im Meer wurden deutlich erkennbar. Das galt auch für einen kleinen, mageren Mann mit nacktem Oberkörper, der neben einem der statuenartigen Pfeiler bis zu den Knien im Wasser stand. Er hielt eine AK-47 und spähte in die Richtung, wo Smith und Mondragon in Deckung gegangen waren.
»Einen habe ich entdeckt«, sagte Smith leise zu Mondragon. »Bewegen Sie sich ein bisschen. Zeigen Sie eine Schulter. Tun Sie so, als würden Sie rauskommen.«
Mondragon richtete sich halb auf und schob die linke Schulter vor, als wolle er gleich loslaufen. Der magere Kerl hinter dem Pfeiler eröffnete das Feuer.
Smith gab zwei gezielte Schüsse ab. Im grünen Licht zuckte der Mann zuerst nach hinten, dann fiel er nach vorn. Um seinen Körper breitete sich ein dunkler Fleck aus, als er mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb.
Mondragon war bereits wieder in Deckung gegangen und schoss ebenfalls. Irgendjemand, irgendwo in der Nacht, schrie auf.
»Dort drüben!«, stieß Mondragon hervor. »Rechts! Dort sind noch mehr!«
Smith riss seine Beretta nach rechts. Vier grüne Gestalten hatten ihre Deckung verlassen und rannten vom Meer auf die Küstenstraße zu. Ein fünfter lag hinter ihnen auf dem Strand. Smith feuerte auf den ersten Mann der ausschwärmenden Gruppe. Er sah, wie er sich ans Bein fasste und zu Boden ging, aber die zwei nachfolgenden Männer packten ihn an den Armen und brachten sich mit ihm in Deckung.
»Sie wollen uns seitlich umgehen!« Smith trat Schweiß auf die Stirn. »Zurück!«
Er und Mondragon sprangen auf und rannten über den Korallensand auf die Böschung zu, die die Bucht im Süden begrenzte. Eine von hinten kommende Salve verriet ihnen, dass sie es noch mit weiteren Angreifern zu tun hatten. Smith spürte, wie eine Kugel durch seine Windjacke fetzte. Von einem Adrenalinschub geputscht, hetzte er die Böschung hinauf und ging in dichtem Gestrüpp hinter einem Baum in Deckung.
Mondragon, der ihm folgte, zog sein rechtes Bein nach und sank hinter einem anderen Baum zu Boden.
Eine neue Salve ließ einen Sprühregen aus zerfetzten Blättern und Zweigen auf sie niedergehen und raubte ihnen fast die Luft zum Atmen. Sie behielten die Köpfe unten. Mondragon zog ein Messer aus einer Scheide an seinem Rücken, schlitzte seine Hose auf und untersuchte die Wunde an seinem Bein.
»Wie schlimm ist es?«, flüsterte Smith.
»Glaube nicht, dass es was Ernsteres ist. Wird nur schwer werden, die Verletzung zu erklären, wenn ich morgen aufs Festland zurückkehre. Entweder muss ich mir Urlaub nehmen oder einen Unfall vortäuschen.« Er lächelte gequält. »Im Moment haben wir allerdings dringendere Probleme. Die kleine Gruppe ist inzwischen seitlich von uns, wahrscheinlich oben auf der Straße, und die anderen in der Bucht werden versuchen, uns auf sie zuzutreiben. Wir müssen uns weiter nach Süden zurückziehen.«
Smith nickte und kroch los. Sie kamen jedoch nur langsam voran in dem dichten Gestrüpp, das durch die vom Meer hereinwehende Gischt hart und widerstandsfähig geworden war. Außerdem musste Smith für Mondragon den Weg bahnen. Um ihre Pistolen halten zu können, robbten sie auf Zehenspitzen, Knien und Ellbogen weiter. Das Gestrüpp gab nur widerstrebend nach, und Geäst zerrte an ihren Kleidern und Haaren. Dünnere Zweige brachen ab, zerkratzten ihre Gesichter und rissen ihnen Unterarme und Ohren blutig.
Endlich erreichten sie das Hochufer über einer anderen, weniger geschützten Einbuchtung in der Küste der Insel. Als sie hastig in Richtung Straße weiterkrochen, drangen von dort Stimmen durch die windstille Nacht. Hinter ihnen kamen vier stumme Schemen auf den Strand zu, von denen zwei bis zu den Knöcheln im Wasser stehen blieben. Eine der Silhouetten, größer als die anderen, bedeutete ihnen auszuschwärmen. Im sanften Mondlicht entpuppten sie sich als vier ganz in Schwarz gekleidete Männer, deren Köpfe unter Kapuzen verborgen waren.
Der Mann, der den Befehl zum Ausschwärmen gegeben hatte, beugte sich nach vorn. Smith hörte das Flüstern einer tiefen, rauen Stimme, die über ein tragbares Funkgerät Anweisungen erteilte.
»Chinesisch«, stieß Mondragon gepresst hervor. Er hatte starke Schmerzen. »Kann nicht alles verstehen, hört sich aber an wie das Mandarin, das in Shanghai gesprochen wird. Das heißt, sie sind mir wahrscheinlich aus Shanghai gefolgt. Der Kerl ist ihr Anführer.«
»Glauben Sie, jemand hat diesen Burschen einen Tipp gegeben?«
»Möglicherweise. Aber ich könnte auch einen Fehler gemacht haben. Oder ich bin schon seit Tagen observiert worden. Oder Wochen. Keine Ahnung. Jedenfalls sind sie hier, und sie kommen näher.«
Smith sah Mondragon prüfend an. Er schien so unverwüstlich wie das Salzwasser gewohnte Gestrüpp. Er hatte Schmerzen, aber er ließ sich nicht von ihnen aufhalten.
»Wir könnten es drauf ankommen lassen«, sagte Smith. »Könnten uns zur Straße durchschlagen. Trauen Sie sich das zu? Andernfalls verschanzen wir uns hier.«
»Sind Sie verrückt? Hier schlachten sie uns ab.«
Sie krochen tiefer ins Gestrüpp, fort vom Meer, und hatten sich gerade mühsam fünf Meter vorangekämpft, als hinter ihnen krachende Schritte durch das Unterholz brachen. Gleichzeitig sahen sie die andere Gruppe von vorn auf sie zukommen. Ihre Verfolger hatten ihren Plan durchschaut und rückten jetzt von beiden Seiten auf sie zu.
Smith fluchte. »Entweder haben sie uns gehört, oder sie haben unsere Spur entdeckt. Wir müssen weiter. Wenn die von der Straße ganz nahe sind, greife ich sie direkt an.«
»Da wüsste ich was Besseres«, flüsterte Mondragon mit neuer Hoffnung in der Stimme. »Dort drüben ist eine Felsformation, hinter der wir uns verstecken können, bis sie vorbei sind. Wenn nicht, bietet sie zumindest genügend Deckung, um dort so lange durchhalten zu können, bis vielleicht jemand die Schüsse hört und uns zu Hilfe kommt.«
»Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert«, stimmte ihm Smith zu.
Im Mondlicht ragte die Felsformation wie eine Ruine im Dschungel von Kambodscha oder Yucatan aus dem Gebüsch. Sie bestand aus bizarr geformten Korallenblöcken und bildete eine Art primitives Fort, mit Wällen auf allen Seiten und Öffnungen, durch die man schießen konnte, falls sich das als nötig erweisen sollte. Außerdem befand sich in der Mitte eine Vertiefung, in der sie fast nicht zu sehen wären, wenn sie sich ganz flach auf den Boden drückten.
Die Waffen im Anschlag, zogen sie sich dorthin zurück und lauschten im silbernen Mondschein auf die Geräusche der Insel. Smiths Kratzer und Aufschürfungen brannten vom Schweiß. Mondragon hievte, um eine weniger schmerzhafte Stellung zu finden, sein Bein herum. Sie standen unter Hochspannung, als sie so warteten, spähten, horchten... Die Lichter von Kaohsiung glommen durch die Nacht; irgendwo bellte ein Hund, ein anderer fiel ein. Auf der fernen Straße fuhr ein Auto vorbei. Draußen auf dem Meer brummte der Motor eines spät zurückkehrenden Bootes.
Dann hörten sie wieder Stimmen, die im Shanghaier Dialekt etwas murmelten. Sie kamen näher. Immer näher. Füße knackten auf widerspenstigem Gestrüpp. Von Geäst halb verborgen, zogen schemenhafte Gestalten an ihnen vorbei. Eine blieb stehen.
Mondragon hob seine Glock.
Smith packte ihn am Handgelenk, um ihn zurückzuhalten. Er schüttelte den Knopf — nicht.
Der Schatten war ein großer Mann. Er hatte seine Kapuze zurückgeschlagen, und unter dem seltsam fahlroten Haar wirkte sein Gesicht farblos, fast wie gebleicht. Seine Augen reflektierten wie Spiegel, als sie die Korallenformation nach einer menschlichen Gestalt oder Bewegung absuchten. Smith und Mondragon hielten in der Vertiefung zwischen den Felsen den Atem an.
Der Rothaarige blieb noch eine Weile stehen und schaute sich langsam um.
Smith spürte, wie Schweiß seinen Rücken und seine Brust hinunterrann.
Dann drehte der Mann sich um und entfernte sich in Richtung Straße.
»Puuuuh.« Mondragon ließ leise den Atem entweichen. »Daswar...«
Die Nacht um sie herum explodierte. Kugeln schlugen in die Korallen und pfiffen zwischen den Bäumen hindurch. Ein Hagel von Gesteinssplittern prasselte auf sie nieder. Die Dunkelheit selbst schien auf sie zu feuern, von allen Seiten zuckten Mündungsblitze auf. Der große Rothaarige hatte sie sehr wohl gesehen, aber er hatte gewartet und erst die anderen verständigt.
Smith und Mondragon erwiderten das Feuer, hielten zwischen den mondbeschienenen Umrissen der Büsche und Bäume verzweifelt nach einem sichtbaren Feind Ausschau. Ihre Deckung war jetzt ein Manko geworden. Sie waren nur zu zweit. Nicht genug, um mindestens sieben Angreifer auf Distanz zu halten. Bald ging ihnen zudem die Munition aus.
Smith beugte sich zu Mondragon hinüber. »Wir müssen von hier weg. Versuchen, die Straße zu erreichen. Mein Motorrad ist nicht weit entfernt. Darauf haben wir beide Platz.«
»Von vorn ist der Beschuss schwächer. Nageln wir sie fest, versuchen wir, in diese Richtung auszubrechen. Machen Sie sich meinetwegen keine Gedanken. Ich schaffe das schon!«
Smith nickte. Er hätte das Gleiche gesagt. Bei den Mengen Adrenalin, die im Moment wie Lava durch ihre Adern strömten, wäre jeder von ihnen notfalls bis zum Mond gerannt.
Nachdem sie bis drei gezählt hatten, eröffneten sie das Feuer und stürmten hinter den Felsen hervor. Tief geduckt rannten sie, Sträuchern und Bäumen ausweichend, schnell auf die Straße zu. Wenige Augenblicke später hatten sie den Kreis der Angreifer durchbrochen. Wenigstens kam das Feuer jetzt von hinten, und die Straße war dicht vor ihnen.
Mondragon ächzte, taumelte und fiel, durch das dichte Gestrüpp brechend, zu Boden. Smith packte ihn unverzüglich am Arm, um ihm hochzuhelfen, aber Mondragon reagierte nicht. Der Arm war ohne Kraft, leblos.
»Avery?«
Keine Antwort.
Smith ging neben dem am Boden liegenden Agenten in die Hocke, und er tastete an seinem Hinterkopf heißes Blut. Sofort fühlte er an seinem Hals nach dem Puls. Nichts. Fluchend sog er die Luft ein und durchsuchte Mondragons Taschen nach dem Umschlag. Gleichzeitig hörte er, wie die Killer, die möglichst wenig Lärm zu machen versuchten, durch das Gestrüpp näher kamen.
Der Umschlag war nicht mehr da. Hektisch durchsuchte Smith noch einmal jede Tasche und nahm alles an sich, was er fand. Er tastete Mondragons Körper ab, aber der Umschlag war weg. Eindeutig weg. Und er hatte keine Zeit mehr.
Leise fluchend sprintete er los.
Über dem Südchinesischen Meer hatten sich Wolken gebildet, die am Mond vorbeizogen und alles in undurchdringliches Dunkel hüllten, als er die Straße erreichte. Die Deckung, die ihm die Dunkelheit bot, war ein seltener Glücksfall. Erleichtert, aber wütend wegen Mondragons Tod rannte er über die Straße und warf sich, Deckung suchend, in den flachen Straßengraben.
Keuchend richtete er Mondragons Glock und seine Beretta auf die Bäume der anderen Seite. Und wartete, überlegte... Der Umschlag hatte in einer von Mondragons Innentaschen gesteckt. Soweit er mitbekommen hatte, war Mondragon mindestens zweimal hingefallen. Dabei könnte der Umschlag herausgefallen sein; vielleicht auch, als sie durch das Gestrüpp gekrochen waren oder als ihre Jacken beim Laufen heftig um ihre Körper geschlackert waren.
Frustriert und voller Besorgnis packte er die zwei Pistolen fester.
Nach ein paar Minuten tauchte am Straßenrand eine einzelne Gestalt auf, sah sich, eine AK-47 im Anschlag, vorsichtig um und überquerte die Straße. Smith hob die Beretta. Der Mann hatte die Bewegung offensichtlich bemerkt und eröffnete blindlings das Feuer. Smith ließ die Glock fallen, zielte mit der Beretta und gab kurz hintereinander zwei Schüsse ab.
Der Mann fiel auf den Bauch und blieb reglos liegen. Smith packte die Glock wieder und feuerte aus beiden Waffen so schnell es ging. Von der anderen Straßenseite ertönten laute Rufe und Schmerzensschreie.
Ihr Echo noch in seinen Ohren, sprang er aus dem Straßengraben und preschte zwischen den Bäumen hindurch von der Straße fort ins Innere der Insel. Seine Füße stampften, seine Lungen brannten, sein ganzer Körper troff von Schweiß. Er wusste nicht, wie weit er rannte oder wie lang, aber er merkte, dass die typischen Hinweise darauf, dass er verfolgt wurde, ausblieben. Kein knackendes Unterholz. Keine raschen Schritte. Keine Schüsse.
Ganze fünf Minuten lang kauerte er sich hinter einen Baum. Sie kamen ihm wie fünf Stunden vor. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Hatten sie aufgegeben? Er und Mondragon hatten mindestens drei getötet, zwei verwundet und möglicherweise noch ein paar andere getroffen.
Aber das alles tat im Moment wenig zur Sache. Wenn die Verfolger von ihm abgelassen hatten, konnte das nur eines bedeuten – sie besaßen jetzt, weswegen sie gekommen waren. Sie hatten das geheime Ladeverzeichnis der Dowager Empress gefunden.
3
Washington, D. C.
Goldenes Sonnenlicht überflutete den Rosengarten des Weißen Hauses und bildete warme Rechtecke auf dem Boden des Oval Office, aber trotzdem empfand Präsident Castilla diesen Morgen irgendwie bedrohlich, als Charles Ouray, der Stabschef des Weißen Hauses, zur Tür hereinkam.
Ouray sah genauso unfroh aus, wie er sich fühlte. »Setzen Sie sich, Charlie«, sagte der Präsident. »Was gibt’s?«
»Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich hören wollen, Mr. President.« Er setzte sich aufs Sofa.
»Kein Glück mit den undichten Stellen?«
»Null.« Ouray schüttelte den Kopf. »Lecks solcher Größenordnung und Regelmäßigkeit, und das über ein ganzes Jahr hinweg, müssten eigentlich aufzuspüren sein, aber Secret Service, FBI, CIA und NSA tappen weiterhin völlig im Dunkeln. Sie haben jeden im Westflügel von der Poststelle bis zu den hochrangigen Mitarbeitern, mich eingeschlossen, auf Herz und Nieren überprüft. Die gute Nachricht ist, sie verbürgen sich dafür, dass keiner von uns für die Lecks verantwortlich ist. Die gesamte Belegschaft des Weißen Hauses bis hinunter zum Reinigungspersonal und den Gärtnern ist über jeden Verdacht erhaben.«
Der Präsident bildete mit den Händen ein Zelt und betrachtete finster seine Finger. »Na schön, und wer bleibt dann noch?«
Ouray sah ihn misstrauisch an. »Wer dann noch bleibt, Sir?«
»Ja, wer dann noch bleibt, Charlie? Wer wurde nicht überprüft, der Zugang zu den Informationen haben könnte, die nach draußen durchgedrungen sind? Die Pläne ... die allgemeine politische Marschrichtung. Lauter Dinge, die auf höchster Ebene diskutiert wurden.«
»Ich weiß, Sir. Aber ich verstehe trotzdem nicht recht, was Sie mit >Wer bleibt dann noch übrig?< meinen. Niemand, kann ich ...«
»Haben Sie mich überprüft, Charlie?«
Ouray lachte gequält. »Natürlich nicht, Mr. President.«
»Warum nicht? Ich hatte doch Zugang zu diesen Informationen.«
»Nun, Sir, Sie zu verdächtigen wäre vollkommen absurd.«
»Das hieß es bei Nixon auch, bis man die Tonbänder fand.«
»Sir ...«
»Ich weiß, Sie denken, die Bänder haben dem Präsidenten den größten Schaden zugefügt. Das stimmt aber nicht. Den größten Schaden haben sie dem amerikanischen Volk zugefügt, aber ich glaube, langsam beginnen Sie mich zu verstehen.«
Ouray sagte nichts.
»Schauen Sie weiter oben nach, Charlie, und sehen Sie genau hin. Das Kabinett. Der Vizepräsident, der nicht immer einer Meinung mit mir ist. Die Vereinigten Stabschefs, das Pentagon, einflussreiche Lobbyisten, mit denen wir manchmal sprechen. Niemand ist über jeden Verdacht erhaben.«
Ouray beugte sich vor. »Glauben Sie wirklich, es könnte jemand so weit oben sein, Sam?«
»Natürlich. Egal, wer es ist, er – oder sie – bricht uns das Genick. Nicht so sehr die Informationen ... Dass die Presse, und sogar unsere Feinde, über unsere Pläne Bescheid wussten, bevor wir sie bekannt gaben – das war bisher nur peinlich. Nein, der größte Schaden besteht darin, dass unser gegenseitiges Vertrauen gelitten hat und die nationale Sicherheit potenziell bedroht ist. Im Moment kann ich keinem unserer Leute etwas Hochbrisantes anvertrauen, nicht einmal Ihnen.«
Ouray nickte. »Ich weiß, Sam. Aber ab jetzt können Sie mir wieder vertrauen.« Er lächelte, aber es war kein humorvolles Lächeln. »Ich wurde als vertrauenswürdig eingestuft. Es sei denn, Sie können FBI, CIA, NSA und Secret Service nicht mehr trauen.«
»Sehen Sie? Im Hinterkopf fangen wir sogar schon an, denen zu misstrauen.«
»Kann durchaus sein. Was ist mit dem Pentagon? Viele der durchgesickerten Informationen betrafen militärische Entscheidungen.«
»Politische Entscheidungen, keine militärischen. Langfristige Strategien.«
Ouray schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir irgendwo einen ausländischen Maulwurf sitzen, so tief drinnen, dass ihn die Sicherheitsleute nicht finden können. Vielleicht sollten wir sie auffordern, tiefer zu graben? Nach einem professionellen Spion zu suchen, der sich hinter einem von uns versteckt?«
»Bitten Sie sie meinetwegen, dieser Möglichkeit nachzugehen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Spion ist, egal, ob Amerikaner oder Ausländer. Dem Betreffenden geht es nicht darum, Geheimnisse zu stehlen. Vielmehr will er die öffentliche Meinung – und damit unsere Entscheidungen – beeinflussen. Es muss jemand sein, der einen Vorteil daraus zieht, wenn sich unsere Politik ändert.«
»Genau«, stimmte ihm Ouray unbehaglich zu.
Der Präsident wandte sich wieder den Papieren auf seinem Schreibtisch zu. »Finden Sie die undichte Stelle, Charlie. Ich brauche Antworten, bevor mich diese Situation vollends lähmt.«
Die Originalausgabe THE ALTMAN CODE erschien bei St. Martin’s Press, New York
5. Auflage Vollständige Deutsche Erstausgabe 02/2006
Copyright © 2003 by MYN PYN LLC. Copyright © 2006 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: © Rainer Grosskopf/Stone/getty images Umschlagdesign: © Nick Castle Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: hanseatenSatz-bremen, Bremen
eISBN 978-3-641-09384-6
http://www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe