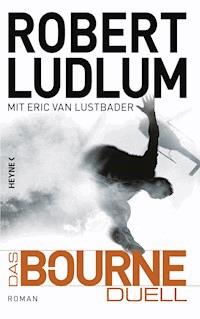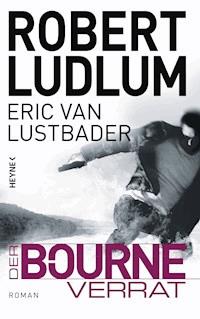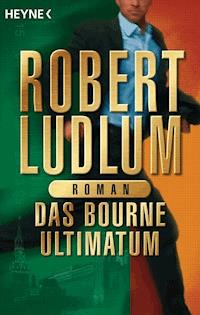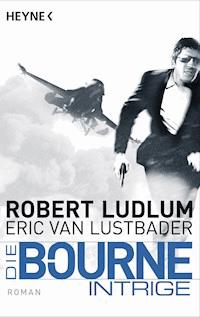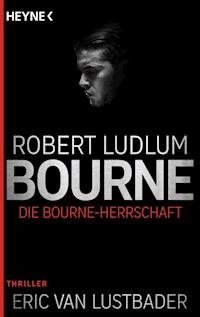9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: COVERT ONE
- Sprache: Deutsch
Weltweit über 200 Millionen verkaufte Bücher von Robert Ludlum
Eine Bombenexplosion im berühmten Pasteur Institut in Paris tötet unter anderem den Wissenschaftler Emile Chambord, der gerade an der Entwicklung eines DNA-Computers arbeitete. Im Feuersturm nach der Explosion sind offenbar auch seine Unterlagen vernichtet worden. Doch wenig später verschwinden auf mysteriöse Weise amerikanische Kampfjets von den Radarschirmen. Covert-One-Agent Jon Smith fliegt nach Paris, um die Verbindung zwischen dem Anschlag auf das Institut und dem gefährlichen Mastermind, der den Weltfrieden bedroht, herauszufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 842
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Eine Bombenexplosion im berühmten Pasteur-Institut in Paris tötet unter anderem den Wissenschaftler Émile Chambord, der gerade an der Entwicklung eines DNA-Computers arbeitete. Im Feuersturm nach der Explosion sind offenbar auch seine Unterlagen vernichtet worden. Doch wenig später verschwinden auf mysteriöse Weise amerikanische Kampfjets von den Radarschirmen. Covert-One-Agent Jon Smith fliegt nach Paris, um die Verbindung zwischen dem Anschlag auf das Institut und dem gefährlichen Mastermind, der den Weltfrieden bedroht, herauszufinden. Was er entdeckt, ist so ungeheuerlich, dass er es kaum glauben kann: Eine Organisation hat sich unter dem Schutz einer befreundeten Macht entwickelt und plant nun einen Anschlag auf die USA, der alles in den Schatten stellt, was internationale Terroristen bisher auf der Welt angerichtet haben. Jon Smith und sein Team haben nur eine einzige kleine Chance, das Unheil abzuwenden.
Die Autoren
Robert Ludlum hat mehr als zwanzig Romane geschrieben, die in über dreißig Sprachen übersetzt wurden und weltweit eine Auflage von 200 Millionen erreichten. Im Heyne Verlag erschienen zuletzt »Das Sigma Protokoll«, »Der Janson-Befehl« und »Der Tristan-Betrug«. Alle seine Romane erschienen als Heyne-Taschenbücher, besonders erfolgreich zuletzt die »Bourne-Trilogie«, die mit Matt Damon und Franka Potente verfilmt wurde.
Gayle Lynds schrieb zusammen mit Robert Ludlum »Der Hades-Faktor« (als Heyne TB lieferbar) und als Einzelroman erscheint von ihr in Kürze »Der Nautilus-Plan« (Mai 05). Die Autorin lebt in Santa Barbara, Kalifornien.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Die Zukunft wird uns viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen. Eine der faszinierendsten und spannendsten neuen Entwicklungen ist der DNS-Computer, gelegentlich auch als Molekularcomputer bezeichnet. Wir sind Kathleen Foltz, Ph. D., die uns an ihrem profunden Wissen in diesem neuen Feld der Wissenschaft teilhaben ließ, für ihre großzügige Unterstützung dankbar. Dr. Foltz ist Dozentin am Lehrstuhl für Molekular-, Zellular- und Entwicklungsbiologie an der University of California, Santa Barbara. Vor kurzem ist sie von der National Science Foundation als Presidential Faculty Fellow berufen worden. Außerdem ist sie auch Mitglied des Marine Science Institute.
Prolog
Paris
Montag, 5. Mai
Laue Frühlingsluft lockte die des langen Winters müden Pariser aus ihren Häusern auf die Straßen und Boulevards, wo sie die Bürgersteige bevölkerten, Arm in Arm dahinschlenderten und die Straßencafés füllten. Selbst die Touristen hörten auf, sich zu beklagen – dies war endlich das echte Paris, das bezaubernde Paris, das ihre Reisebroschüren ihnen versprochen hatten.
Die Zecher in der Rue de Vaugirard, ganz auf den vin ordinaire in ihren Gläsern und den nächtlichen Sternenhimmel konzentriert, registrierten den großen schwarzen Renault Van mit den abgedunkelten Scheiben überhaupt nicht, der jetzt in Richtung auf den Boulevard Pasteur rollte, in eine Seitenstraße einbog, die Rue du Dr. Roux hinunterfuhr und schließlich die Rue des Volontaires erreichte, die abgesehen von einem jungen Pärchen, das sich in einem Torbogen küsste, völlig menschenleer war.
Der schwarze Renault kam vor dem Institut Pasteur zum Stillstand, der Motor wurde abgeschaltet, die Scheinwerfer erloschen. Dann blieb er stehen, bis das Pärchen, ganz und gar auf sein junges Glück konzentriert, in einem Gebäude auf der anderen Straßenseite verschwand.
Gleich darauf öffneten sich die Türen des Vans, und vier ganz in Schwarz gekleidete Gestalten, die Gesichter hinter Strumpfmasken verborgen, stiegen aus. Alle vier waren mit Uzi-Maschinenpistolen bewaffnet und trugen Rucksäcke auf dem Rücken. Sie huschten fast unsichtbar und lautlos durch die Nacht. Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten des Pasteur-Instituts und wies ihnen den Weg, während die Straße hinter ihnen still und verlassen blieb.
Draußen auf der Rue de Vaugirard hatte ein Saxofonist zu spielen begonnen, eine weiche, melancholisch klingende Melodie. Der Nachtwind trug die Musik, das Gelächter und den Duft der Frühlingsblumen durch die offenen Fenster der vielen Gebäude des Pasteur-Instituts. Das berühmte Forschungszentrum beherbergte mehr als zweieinhalbtausend Wissenschaftler, Techniker, Studenten und Verwaltungsangestellte, von denen viele auch zu dieser späten Stunde noch arbeiteten.
Damit hatten die Eindringlinge nicht gerechnet. Vorsichtig hielten sie sich abseits von den beleuchteten Wegen, lauschten, beobachteten die Fenster und huschten von Baum zu Baum, während der Lärm von draußen, von der Rue de Vaugirard, immer lauter wurde.
Dr. Émile Chambord, der alleine in dem ansonsten völlig menschenleeren ersten Stock des Gebäudes in seinem Labor vor dem Computer saß, merkte von all dem Geschehen draußen nichts. Sein Arbeitsraum war so groß, wie es einem der angesehensten Wissenschaftler des Instituts zukam, und war ausgestattet mit einigen höchst modernen Gerätschaften, darunter einem automatischen Gen-Chip-Leser und einem Raster-Tunnel-Mikroskop, mit dem man einzelne Atome messen und in ihrer Bewegung beobachten konnte. Für ihn freilich von sehr viel größerer Bedeutung waren die Unterlagen, die er neben dem linken Ellbogen liegen hatte, und das dicke Spiralheft rechts von ihm, in das er in akkurater Schrift Aufzeichnungen machte.
Seine Finger hielten ungeduldig auf der Tastatur inne, die mit einer eigenartigen Apparatur verbunden war, die mehr mit einem Oktopus als mit den Produkten von IBM oder Compaq gemein zu haben schien. Das Nervenzentrum der Apparatur befand sich in einem temperaturkontrollierten Glasbehälter, durch dessen Seitenwände man silberblaue Gelpacks sehen konnte, die wie durchsichtige Eier in einer gelierten, schaumartigen Substanz schwammen. Winzige Röhren verbanden die Gelpacks miteinander, auf deren Behälter ein Deckel angebracht war. Eine beschichtete Metallplatte darunter stellte die Verbindung zu den Gelpacks her. Dahinter stand ein Apparat von der Größe eines iMac mit einer kompliziert wirkenden Kontrolltafel, auf der zahlreiche Lichter wie winzige Augen blinkten. Aus dem Kasten führten weitere Schläuche in den Glasbehälter, der ebenso wie der Apparat selbst mit der Tastatur, einem Monitor, einem Drucker und einer Anzahl anderer elektronischer Geräte verkabelt war.
Dr. Chambord gab über die Tastatur Befehle ein, beobachtete den Bildschirm, las an der iMac-ähnlichen Apparatur die Werte ab und behielt dabei ständig die Temperatur der Gelpacks in dem Behälter im Auge. Dabei machte er ständig Notizen in sein Heft, bis er sich plötzlich zurücklehnte und die ganze Anordnung studierte. Schließlich nickte er ruckartig, tippte dann eine scheinbar sinnlose Folge von Buchstaben, Zahlen und Symbolen ein und betätigte einen Zeitschalter.
Sein rechter Fuß wippte nervös, und seine Finger trommelten auf den Labortisch. Exakt zwölf Sekunden später erwachte der Drucker zum Leben und stieß ein Blatt Papier aus. Dr. Chambord zügelte seine Nervosität, hielt den Zeitschalter an, machte sich eine Notiz und griff erst dann nach dem Ausdruck.
»Mais, oui«, lächelte er, als er ihn überflogen hatte.
Er atmete tief durch und tippte dann weitere Befehle ein. Auf dem Bildschirm huschten Symbolketten so schnell an ihm vorbei, dass seine Finger damit nicht Schritt halten konnten. Er murmelte etwas Unverständliches und tippte weiter. Ein paar Augenblicke später spannten sich seine Schultermuskeln, er beugte sich dichter an den Bildschirm und flüsterte »... noch einen ... noch ... einen ... ja!«
Er lachte laut, ein triumphierendes Lachen, und sah auf die Uhr an der Wand. Es war 21 Uhr 55. Nachdem er die Zeit notiert hatte, stand er auf.
Mit vor Erregung gerötetem Gesicht stopfte er seine Unterlagen und das Spiralheft in eine abgewetzte Aktentasche und griff sich sein Jackett von dem altmodischen Kleiderständer neben der Tür. Während er sich den Hut aufsetzte, warf er einen Blick auf die Uhr und ging dann noch einmal zu seiner Apparatur zurück. Im Stehen tippte er eine weitere Befehlsfolge ein, beobachtete den Bildschirm eine Weile und schaltete schließlich alles ab. Er ging mit festen Schritten zur Tür, öffnete sie, sah in den Korridor hinaus und stellte fest, dass er dunkel und verlassen war. Einen Augenblick lang überkam ihn eine düstere Vorahnung.
Dann schüttelte er sie ab. Non, wies er sich selbst zurecht. Dies war ein Augenblick, den es auszukosten galt. Es war vollbracht. Mit einem breiten Lächeln trat er in den düsteren Flur hinaus. Bevor er die Tür hinter sich schließen konnte, drängten sich vier schwarz gekleidete Gestalten um ihn.
Eine halbe Stunde später hielt der drahtig wirkende Anführer der Eindringlinge Wache, während seine drei Gefährten die letzten Gegenstände in den schwarzen Van auf der Rue des Volontaires trugen. Sobald die Schiebetür an der Seite geschlossen war, sah er sich noch einmal prüfend in der stillen Straße um und nahm dann auf dem Beifahrersitz Platz. Er nickte dem Fahrer zu, und der Van setzte sich fast lautlos in Richtung auf die immer noch von Menschen erfüllte Rue de Vaugirard in Bewegung, wo er sich in den Verkehrsstrom einreihte.
Auf den Bürgersteigen, in den Cafés und den Tabacs herrschte immer noch frühlingshafte Hochstimmung. Inzwischen waren weitere Straßenmusikanten aufgetaucht, und der vin ordinaire
Teil I
Kapitel 1
Diego Garcia, Indischer Ozean
Auf dem US-Militärstützpunkt von Diego Garcia war es 6 Uhr 54 morgens. Der wachhabende Offizier im Kontrollturm starrte zum Fenster hinaus, wo die Morgensonne die warmen blauen Wellen der Emerald Bay auf der Lagunenseite des wie ein U geformten Atolls beleuchtete, und wünschte sich, seine Schicht wäre zu Ende. Er blinzelte träge, und seine Gedanken begannen zu wandern.
Er und seine Kollegen waren auf diesem strategisch platzierten und äußerst wichtigen Stützpunkt der US Navy mit dem logistischen Support für Luft- und Seeoperationen betraut. Der Lohn dafür war die Insel selbst, ein abgelegener Ort von märchenhafter Schönheit, auf dem träge dahinfließende Routine jeden Ehrgeiz abstumpfte.
Er erwog gerade, ob er gleich nach Dienstschluss in der Lagune schwimmen sollte, als eine Minute später, um 6 Uhr 55, der Kontrollturm den Kontakt mit der gesamten zurzeit in der Luft befindlichen Flotte von B-1B, B-52, AWACS, P-3 Orion und U-2-Maschinen auf einer Vielzahl von Einsätzen verlor, darunter auch einigen äußerst wichtigen und durchaus nicht routinemäßigen Aufklärungs- und U-Boot-Überwachungsflügen.
Die tropische Lagune war aus seinen Gedanken sofort wie weggewischt. Er brüllte Befehle, stieß einen Techniker von einer der Konsolen weg und schaltete auf Diagnose. Alle blickten wie gebannt auf die Displays und Bildschirme und gaben sich alle Mühe, das Geschehen wieder unter Kontrolle zu bringen.
Doch da war nichts zu machen. Um 6 Uhr 58 verständigte er in einem Zustand mühsam kontrollierter Panik den kommandierenden Offizier des Stützpunkts.
Um 6 Uhr 59 informierte der kommandierende Offizier das Pentagon.
Und dann, völlig unerklärlich, war um 7 Uhr, exakt fünf Minuten nach dem Abbrechen aller Verbindungen, auf die Sekunde genau der Kontakt zu sämtlichen Flugzeugen wiederhergestellt.
Fort Collins, Colorado Dienstag, 6. Mai
Über der weiten Prärie im Osten ging die Sonne auf und tauchte den Foothills Campus der Colorado State University in goldenes Licht. Jonathan (»Jon«) Smith, M. D., saß in einem modernst ausgestatteten Labor in einem unauffälligen Gebäude, spähte in ein Binokular-Mikroskop und schob bedächtig eine feine Glasnadel zurecht. Er praktizierte den unsichtbaren Tropfen einer Flüssigkeit auf eine flache Glasscheibe, die nicht größer als eine Nadelspitze war. Unter dem hochauflösenden Mikroskop erinnerte die Scheibe verblüffend – und obwohl das eigentlich unmöglich war – an einen elektronischen Schaltkreis.
Smith drehte kaum merkbar an einer Stellschraube und stellte das Bild schärfer. »Gut«, murmelte er und lächelte dann. »Es besteht Hoffnung.«
Smith war Experte für Virologie und Molekularbiologie und zugleich medizinischer Offizier der Army – Lieutenant Colonel, um es genau zu sagen – und kurzzeitig hier zwischen den rauschenden Fichten und den sanften Vorbergen Colorados im CDC, dem Zentrum für Seuchenkontrolle, stationiert. Das militärische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten, USAMRIID, hatte ihn inoffiziell an die Universität »ausgeliehen«, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich an der mit dem Virenwachstum befassten Grundlagenforschung zu beteiligen.
Nur dass Viren mit dem, was er an diesem frühen Morgen unter seinem Mikroskop beobachtete, nicht das Geringste zu tun hatten. USAMRIID war das führende militärische Forschungsinstitut, sein hoch gelobtes ziviles Pendant das CDC. Normalerweise herrschte zwischen den beiden Instituten heftige Rivalität. Aber nicht hier und nicht jetzt, und die Arbeiten, die in diesem Laboratorium durchgeführt wurden, standen auch nur in sehr peripherer Beziehung zur Medizin.
Smith gehörte einem wenig bekannten CDC-USAMRIID-Forschungsteam an, das an dem weltweiten Wettstreit um die Entwicklung des ersten molekularen – oder DNS-Computers der Welt teilnahm, was eine ganz neuartige Kombination zwischen der Biologie und der Computerwissenschaft erforderte, ein Konzept, das den Wissenschaftler in Smith faszinierte und eine Herausforderung für seine reiche Erfahrung auf dem Feld der Mikrobiologie darstellte. Was ihn zu dieser frühen Stunde in sein Labor geführt hatte, war seine Hoffnung auf einen Durchbruch bei der Entwicklung molekularer Schaltkreise aufgrund spezieller organischer Polymere, die er und andere Forscher in ständiger Arbeit rund um die Uhr entwickelt hatten.
Wenn ihren Bemühungen Erfolg beschieden war, würde es möglich sein, ihre Epoche machenden DNS-Schaltkreise viele Male neu zu konfigurieren, und damit würden sie ihrem Ziel einen Schritt näher kommen, Silizium, das derzeitige Schlüsselelement der Computertechnik, überflüssig zu machen. Und das war gut so. Die Computerindustrie hatte sich ohnehin den Grenzen der Siliziumtechnologie angenähert, und biologische Komponenten stellten den logischen – wenn auch schwierigen – nächsten Schritt dar. Sobald es einmal möglich sein würde, DNS-Computer zu bauen, sollten diese wesentlich leistungsfähiger sein, als man sich das in der Öffentlichkeit gemeinhin vorstellte. Und an diesem Punkt setzte das Interesse des Militärs und damit das von USAMRIID ein.
Smith hatte, fasziniert von diesem Forschungsvorhaben, sofort seine Fühler ausgestreckt und sich, unmittelbar nachdem er von diesem geheimen Gemeinschaftsprojekt des CDC und des USAMRIID gehört hatte, eine Einladung beschafft. Jetzt stürzte er sich in diesen Technologiewettbewerb, wo die Zukunft vielleicht nur die Breite eines Atoms entfernt war.
»Hey, Jon.« Larry Schulenberg, ein Zellbiologe von hohem wissenschaftlichem Rang und einer der Kollegen in dem Projekt, kam in seinem Rollstuhl in das Labor gerollt. »Haben Sie das vom Pasteur-Institut gehört?«
Smith blickte von seinem Mikroskop auf. »Ich habe nicht mal gehört, wie Sie die Tür aufgemacht haben.« Dann bemerkte er Larrys düsteren Gesichtsausdruck. »Das Pasteur-Institut ?«, wiederholte er. »Warum? Was ist passiert?« Ebenso wie USAMRIID und das CDC gehörte auch das Pasteur-Institut zur Spitzenklasse der in diesem Bereich tätigen Institutionen.
Schulenberg, ein Mann um die fünfzig, war tief gebräunt; er pflegte sich den Schädel glatt zu rasieren und trug einen kleinen Diamanten im Ohr. Seine Schultern waren von den vielen mit Gehhilfen verbrachten Jahren mit dicken Muskelpaketen versehen. Jetzt klang seine Stimme ernst. »Eine Explosion. Schlimme Sache. Es hat ein paar Tote gegeben.« Er hatte einen Stapel Ausdrucke im Schoß und reichte dem Kollegen einen davon.
Jon schnappte nach dem Papier. »Mein Gott ... Wie ist das passiert? Ein Laborunfall?«
»Das glaubt die französische Polizei nicht. Vielleicht eine Bombe. Man überprüft gerade ehemalige Angestellte.« Larry drehte seinen Stuhl herum und rollte wieder auf die Tür zu. »Ich dachte, das würde Sie interessieren. Jim Thrane in Porton Down hat mir ein E-Mail geschickt, und daraufhin hab ich mir die Sache heruntergeladen. Ich will nachsehen, wer sonst noch da ist. Das interessiert bestimmt alle.«
»Danke.« Während die Tür sich hinter Schulenberg schloss, überflog Smith das Blatt, das der ihm gegeben hatte. Er hatte das Gefühl, sein Magen würde sich umdrehen, und er las die kurze Notiz ein zweites Mal ...
Explosion im Pasteur-Institut zerstört Labor
Paris – Eine gewaltige Explosion hat in der vergangenen Nacht um 22 Uhr 52 in dem berühmten Pasteur-Institut mindestens zwölf Todesopfer gefordert und ein dreistöckiges Gebäude mit Büros und Laborräumen zum Einsturz gebracht. Vier Überlebende konnten in kritischem Zustand geborgen werden. Die Suche nach weiteren Opfern wird in den Trümmern fortgesetzt.
Ermittler der Brandschutzbehörden erklären, dass Hinweise auf Sprengstoff gefunden wurden. Bis jetzt haben sich weder Einzelpersonen noch Gruppen zu der Tat bekannt. Die Untersuchungen werden fortgeführt, und es wird gegen in letzter Zeit entlassene Angestellte ermittelt. Unter den Überlebenden, die bis jetzt identifiziert werden konnten, befindet sich Martin Zellerbach, Ph. D., ein Computerwissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, der Kopfverletzungen erlitten hat ...
Smith hatte das Gefühl, sein Herz würde stocken. Martin Zellerbach, Ph. D., ein Computerwissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, der Kopfverletzungen erlitten hat. Marty? Während seine Hand das Papier zerknüllte, tauchte vor seinem inneren Auge das Gesicht seines alten Freundes auf. Das schiefe Lächeln, die durchdringend blickenden grünen Augen, die vergnügt blitzen und im nächsten Augenblick in weite Ferne blicken konnten, als würden sie einen Punkt draußen im Weltraum fixieren. Ein kleiner rundlicher Mann mit unsicherem Gang, so als ob er nie gelernt hätte, seine Beine richtig zu bewegen – Marty litt unter dem Asperger-Syndrom, einer Störung im motorischen Nervensystem, die man dem weniger gefährlichen Bereich des Autismus zuordnete und zu deren Symptomen Zwangsvorstellungen, hohe Intelligenz und ein hochgradiger Mangel an kommunikativen und sozialen Fähigkeiten sowie ein phänomenales Talent in einem speziellen Bereich gehörten – bei ihm Mathematik und Elektronik. Marty war tatsächlich das, was man als Computergenie zu bezeichnen pflegte.
Smith spürte, wie ihm ein würgender Kloß in die Kehle stieg. Kopfverletzungen. Wie schwer mochten Martys Verletzungen sein? Der Artikel erwähnte davon nichts. Smith zog sein Handy heraus, in das ein spezieller Zerhacker integriert war, und wählte eine Nummer in Washington.
Er und Marty waren zusammen in Iowa aufgewachsen, wo er Marty vor den Hänseleien seiner Mitschüler und sogar vor einigen Lehrern beschützt hatte, die einfach nicht begreifen wollten, dass jemandem von so hoher Intelligenz nicht bewusst wurde, wie unerträglich sein Verhalten für seine Umgebung manchmal war. Martys Krankheit wurde erst viel später diagnostiziert, und erst zu diesem Zeitpunkt konnte er mit Medikamenten versorgt werden, die es ihm ermöglichten, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Wirklichkeit stehend zu funktionieren. Dennoch war es Marty zutiefst zuwider, Medikamente einzunehmen, und er hatte sein Leben so gestaltet, dass er so oft wie nur möglich darauf verzichten konnte. Manchmal verließ er seinen behaglichen Bungalow in Washington D. C. jahrelang nicht. Nur dort fühlte er sich mit seinen Computern neuester Bauart und der Software, die er ständig verbesserte, sicher, und nur dort bot sich seinem genialen Verstand und seiner Kreativität die Möglichkeit zum unbehinderten Höhenflug. Geschäftsleute, Akademiker und Wissenschaftler aus der ganzen Welt suchten dort seinen Rat, allerdings nie persönlich, sondern stets nur auf elektronischem Wege.
Was also hatte der scheue Computerzauberer in Paris verloren?
Das letzte Mal, dass Marty sich bereit gefunden hatte, seine sichere Zuflucht zu verlassen, lag jetzt achtzehn Monate zurück, und es hatte mehr als nur sanfter Überredung bedurft, um ihn dazu zu bewegen – nur die wilden Schießereien und die drohende Katastrophe des Hades-Virus, die dem Tod von Smith’ Verlobter Sophia Russell zugrunde lag, hatten es schließlich vermocht, ihn aktiv werden zu lassen.
Das Handy an Smith’ Ohr übertrug das Klingeln im fernen Washington D. C. – wenigstens dachte Smith das –, und im gleichen Augenblick hörte er etwas vor seiner Labortür, das ebenfalls wie das Klingeln eines Handys klang. Ihn überkam das unheimliche Gefühl ...
»Hallo?« Es war die Stimme von Nathaniel Frederick (»Fred«) Klein, den er hatte anrufen wollen.
Smith fuhr herum und starrte auf seine Tür. »Kommen Sie rein, Fred.«
Der Leiter der äußerst geheimen Covert-one-Geheimdienst- und Abwehrorganisation betrat das Labor, leise wie ein Gespenst, das Handy immer noch in der Hand. »Ich hätte mir denken müssen, dass Sie davon hören und mich anrufen.« Er schaltete sein Gerät ab.
»Wegen Mart? Ja, ich habe die Sache vom Pasteur-Institut gerade gelesen. Was wissen Sie, und was machen Sie hier?«
Ohne die Frage zu beantworten, schritt Klein an den blitzenden Reagenzgläsern und sonstigen Gerätschaften vorbei, die die diversen Labortische bedeckten, an denen bald andere CDC-USAMRIID-Forscher und -Assistenten tätig sein würden. Er blieb neben Smith stehen, setzte sich auf die Granitplatte, verschränkte die Arme vor der Brust und blickte ihn finster an. Klein war etwa einen Meter achtzig groß und trug wie stets einen seiner zerknitterten Anzüge, diesmal in braunem Tweed. Seine Haut war blass; sie bekam nur selten ein wenig Sonnenschein ab. Kleins Aktionsfeld war nicht die freie Natur. Mit seiner beginnenden Stirnglatze, der Nickelbrille und seiner hohen Intelligenzlerstirn hätte er ebenso gut ein Verleger wie ein Geldfälscher sein können.
Er sah Smith an und sagte mit einem Anflug von Mitgefühl in der Stimme: »Ihr Freund lebt, aber er liegt im Koma. Ich will Ihnen nichts vormachen, Colonel. Die Ärzte machen sich Sorgen.«
Smith litt immer noch unter Sophias Tod, und Martys Verletzung rief ihm das alles aufs Neue ins Gedächtnis. Aber Sophia war nicht mehr am Leben, und jetzt ging es nur noch um Marty.
»Was in aller Welt hatte er im Pasteur zu suchen?«
Klein zog seine Pfeife heraus und holte den Tabaksbeutel aus der Tasche. »Ja, das haben wir uns auch gefragt.«
Smith setzte schon zum Reden an, zögerte dann aber. Für die Öffentlichkeit und den größten Teil der Regierung, mit Ausnahme des Weißen Hauses operierte Covert-one völlig unsichtbar, außerhalb der offiziellen militärischen Geheimdienstbürokratie und fern jeder Überwachung durch den Kongress. Der schemenhafte Chef dieser Institution wurde nie sichtbar; es sei denn, irgendetwas Welterschütterndes geschah oder bahnte sich an. Covert-one verfügte über keinerlei formelle Organisation oder Bürokratie, keine richtige Zentrale und keine offiziellen Agenten, lediglich ein lockeres Netz professioneller Experten in vielen Feldern stand zur Verfügung; alle mit Geheimdiensterfahrung, die meisten auch mit militärischem Hintergrund, und alle im Wesentlichen ungebunden – ohne Familie und irgendwelche Bindungen oder Verpflichtungen, seien sie nun kurzzeitiger oder dauernder Art.
Wenn man seiner Dienste bedurfte, war Smith einer jener Eliteagenten.
»Sie sind nicht wegen Marty gekommen«, entschied Smith. »Es geht um das Pasteur-Institut. Irgendetwas ist dort faul. Was?«
»Gehen wir hinaus.« Klein schob seine Brille auf die Stirn und stopfte Tabak in seine Pfeife.
»Hier drinnen dürfen Sie die nicht anzünden«, wies Smith ihn zurecht. »DNS kann durch Partikel in der Luft kontaminiert werden.«
Klein seufzte. »Ein Grund mehr, zu verschwinden.«
Fred Klein – und Covert-one – vertraute niemandem und nichts, nahm nichts als gegeben an. Selbst ein offiziell überhaupt nicht existierendes Labor konnte abgehört werden, und Smith wusste sehr wohl, dass das der eigentliche Grund war, weshalb Klein ins Freie wollte. Er folgte dem Abwehrchef nach draußen in den Flur und sperrte seine Tür ab. Dann gingen sie nebeneinander die Treppe hinunter, vorbei an dunklen Laborräumen und Büros; unter wenigen Türen schimmerte noch Licht durch. Sah man einmal vom leisen Atem des riesigen Lüftungssystems ab, lag das Gebäude in völliger Stille da.
Draußen beleuchtete das Licht der Morgendämmerung die riesigen Fichten und hüllte sie im Osten in schimmernde Helle, während sie im Westen noch im schattigen Schwarz verharrten. Hoch über dem Campus türmten sich im Westen auch die Rocky Mountains auf; ihre schroffen Spitzen reflektierten das erste Sonnenlicht. Die Täler zwischen den Bergen waren noch in purpurne Dunkelheit gehüllt. Rings um die beiden Männer erfüllte der aromatische Duft der Pinien die Luft.
Klein ging ein paar Schritte von dem Gebäude weg und blieb dann stehen, um seine Pfeife anzuzünden. Er paffte und drückte den Tabak zurecht, bis der Rauch sein halbes Gesicht verdeckte. Mit einer Handbewegung wedelte er ihn weg.
»Gehen wir ein Stück.« Während sie zur Straße hinübergingen, sagte Klein: »Erzählen Sie mir etwas von Ihrer Arbeit hier. Wie läuft denn alles? Sind Sie bald so weit, dass Sie einen Molekularcomputer bauen können?«
»Das würde ich mir wünschen. Die Arbeiten machen gute Fortschritte, aber es geht sehr langsam. Alles ist sehr kompliziert.«
Jede Regierung der Welt hatte den Wunsch, als Erste einen funktionsfähigen DNS-Computer zur Verfügung zu haben, weil ein solches Gerät in der Lage wäre, jeden Code und jede Chiffre innerhalb weniger Sekunden zu knacken. Eine erschreckende Vorstellung, besonders, wenn es um die Verteidigung ging. Sämtliche Flugkörper Amerikas, die geheimen Systeme der NSA, die Spionagesatelliten der Nationalen Aufklärungsbehörde, das gesamte Operationsfeld der Navy, sämtliche Verteidigungspläne ... jegliche Aktivität, die auch nur im Entferntesten mit Elektronik zu tun hatte, würde dem ersten molekularen Computer hilflos ausgeliefert sein. Selbst der größte Silizium-Supercomputer würde sich geschlagen geben müssen.
»Wie lange dauert es denn noch, bis es einen funktionsfähigen DNS-Computer gibt?«, wollte Klein wissen.
»Einige Jahre«, erklärte Smith ohne zu zögern, »und vielleicht auch länger.«
»Und wer ist am nächsten dran?«
»Praktisch einsetzbar und funktionsfähig? Niemand, der mir bekannt wäre.«
Klein rauchte und drückte wieder den Tabak in der Pfeife fest. »Wenn ich jetzt sagen würde, dass es jemand doch schon geschafft hat, auf wen würden Sie dann tippen?«
Es waren schon eine ganze Anzahl Vorläufermodelle gebaut worden, die jedes Jahr dem Ziel näher kamen, aber ein echter, vollständiger Erfolg? Bis dahin würden wenigstens noch fünf Jahre vergehen, es sei denn ... Takeda? Chambord?
Und dann fiel es Smith plötzlich wie Schuppen von den Augen. Kleins Erscheinen in seinem Labor bedeutete, dass das Pasteur-Institut der Schlüssel war. »Émile Chambord! Wollen Sie sagen, dass Chambord uns anderen Jahre voraus ist? Dass er weiter ist als Takeda in Tokio?«
»Chambord ist wahrscheinlich bei der Explosion ums Leben gekommen.« Klein zog mit besorgter Miene an seiner Pfeife. »Sein Labor wurde völlig vernichtet. Nur noch Ziegeltrümmer, verkohltes Holz und zerbrochenes Glas sind übrig. Man hat bei ihm zu Hause nachgesehen, bei seiner Tochter, überall. Sein Wagen stand auf dem Institutsparkplatz, aber ihn selbst können sie nicht finden. Es gibt Gerüchte ...«
»Gerüchte? Gerüchte gibt es immer.«
»Diesmal ist es anders. Gewisse Vermutungen gehen von höchsten Kreisen beim französischen Militär aus, von Kollegen, Vorgesetzten.«
»Wenn Chambord dem Ziel so nahe war, würde mehr geredet werden. Jemand hat etwas gewusst.«
»Nicht unbedingt. Das Militär hat sich in regelmäßigen Abständen über seine Fortschritte informiert, aber er hat behauptet, er sei auch nicht weiter als alle anderen. Und was das Pasteur selbst angeht, so hat ein führender Wissenschaftler vom Rang eines Chambord niemanden, vor dem er Rechenschaft ablegen muss.«
Smith nickte. In dieser Beziehung war das berühmte Institut für seine anachronistische Einstellung bekannt. »Und seine Notizen? Aufzeichnungen? Berichte?«
»Nichts aus dem letzten Jahr. Null.«
»Keine Aufzeichnungen?« Smith’ Stimme wurde lauter. »Die muss es geben. Vermutlich in der Datenbank des Pasteur. Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass das ganze Computersystem zerstört worden ist.«
»Nein, die Zentraleinheit existiert noch. Die ist in einem bombensicheren Raum untergebracht, aber Chambord hatte seit einem Jahr keine Daten mehr eingegeben.«
Smith furchte die Stirn. »Er hat handschriftliche Aufzeichnungen gemacht?«
»Wenn er überhaupt welche gemacht hat.«
»Das muss er getan haben. Ohne komplette Daten, Labornotizen, Ergebnisberichte kann man keine Grundlagenforschungen durchführen. Man muss detaillierte Aufzeichnungen niederlegen, andernfalls ist es unmöglich, Arbeiten zu verifizieren oder reproduzieren. Jede Sackgasse, jeder Fehler, jeder Schritt muss festgehalten werden. Verdammt noch mal, wenn er seine Daten nicht dem Computer anvertraut hat, dann muss er sie handschriftlich notiert haben. Das ist sicher.«
»Das mag ja sein, Jon, aber bis jetzt haben weder das Pasteur-Institut noch die französischen Behörden irgendwelche Aufzeichnungen gefunden, und Sie können mir glauben, dass die gründlich nachgesehen haben. Sehr gründlich.«
Smith überlegte. Handschriftlich? Warum? Konnte es sein, dass Chambord vorsichtig geworden war, als er gemerkt hatte, dass er kurz vor dem Erfolg stand? »Meinen Sie, dass er gewusst oder zumindest geargwöhnt hat, dass ihn jemand aus dem Institut bespitzelt?«
»Die Franzosen wissen nicht, was sie denken sollen, und alle anderen auch nicht«, meinte Klein.
»Hat er alleine gearbeitet?«
»Er hatte einen einfachen Laborassistenten von minderer Qualifikation, der sich im Augenblick in Urlaub befindet. Die französische Polizei sucht nach ihm.« Klein starrte nach Osten, wo die Sonne jetzt höher stand, eine riesige, glutrote Scheibe über der Prärie. »Und wir glauben, dass auch Dr. Zellerbach mit ihm zusammengearbeitet hat.«
»Sie glauben?«
»Was auch immer Dr. Zellerbach dort drüben getan hat, war allem Anschein nach völlig inoffiziell, beinahe geheim. Die Sicherheitsstelle des Pasteur hat ihn lediglich als ›allgemeinen Beobachter‹ registriert. Nach der Bombenexplosion war die Polizei sofort in seinem Hotelzimmer, hat dort aber nichts gefunden. Er lebte praktisch aus dem Koffer und hatte dort keinerlei Freunde oder Bekannte, nicht im Hotel und auch nicht im Pasteur. Die Polizeibehörden haben sich darüber gewundert, wie wenige Leute sich überhaupt an ihn erinnern konnten.«
Smith nickte. »Typisch Marty.« Sein einsiedlerhafter alter Freund, der mit Sicherheit darauf bestanden hatte, weitestgehend anonym bleiben zu können. Und ein Molekularcomputer, der kurz vor der Fertigstellung stand – eines der wenigen Projekte, das ihn aus seiner Isoliertheit in Washington hätte losreißen können. »Sobald er wieder bei Besinnung ist, wird er Ihnen sagen, wie weit Chambord war.«
»Falls er aufwacht. Und selbst dann könnte es schon zu spät sein.«
Jon verspürte eine plötzliche Aufwallung von Ärger. »Er wird aus dem Koma erwachen.«
»Schon gut, Colonel. Aber wann?« Klein nahm die Pfeife aus dem Mund und blickte finster zur Seite. »Wir haben gerade einen recht beunruhigenden Anruf bekommen, der uns aufgeschreckt hat und von dem Sie wissen sollten. Um sieben Uhr fünfundfünfzig, nach Washingtoner Zeit also gestern Nacht, hat der Stützpunkt Diego Garcia Island jeglichen Kontakt zu seinen Flugzeugen verloren. Alle Versuche, den Kontakt wiederherzustellen oder den Grund der plötzlichen Funkstille zu ermitteln, sind gescheitert. Und dann, exakt fünf Minuten später, funktionierten plötzlich wieder sämtliche Verbindungen. Es gab keinerlei Systemdefekte, keine Wetterprobleme, keinerlei menschliche Fehler. Der einzig verbleibende Schluss ist, dass hier ein Computerhacker am Werk war, aber man hat keinerlei Spuren gefunden, und jeder Experte auf der ganzen Welt sagt, dass kein derzeit existierender Computer fähig wäre, so etwas zu bewirken, ohne Spuren zu hinterlassen.«
»Sind Schäden aufgetreten?«
»Was das System angeht, nein. In Bezug auf unseren Besorgnisquotienten – eine ganze Menge.«
»Zeitlicher Zusammenhang mit der Explosion im Pasteur?«
Klein lächelte grimmig. »Zwei Stunden später.«
»Das könnte ein Test von Chambords Prototyp sein, falls er einen hatte. Und falls der von jemand gestohlen wurde.«
»Genau. Fakt ist – Chambords Labor existiert nicht mehr. Er ist tot oder verschwunden. Und seine Arbeit ist vernichtet... oder ebenfalls verschwunden.«
Jon nickte. »Sie glauben, man hat die Bombe dort gezündet, um seine Ermordung und den Diebstahl seiner Unterlagen und seines Prototyps zu tarnen.«
»Ein funktionsfähiger DNS-Computer in falscher Hand, das ist nicht gerade eine angenehme Vorstellung.«
»Ich hatte bereits vor, nach Paris zu fliegen, wegen Marty.«
»Dachte ich mir schon. Und das wäre eine gute Tarnung. Außerdem gibt es bei Covert-one niemanden, der eine bessere Chance hätte als Sie, einen Molekularcomputer zu erkennen, wenn er einen vor sich hat.« Klein blickte besorgt in den Himmel über der weiten Prärie, als könnte er bereits einen Regen von Interkontinentalraketen niedergehen sehen. »Sie müssen herausbekommen, ob Chambords Notizen, Berichte und Daten zerstört worden sind oder ob jemand sie gestohlen hat. Ob es wirklich irgendwo dort draußen einen funktionsfähigen Prototyp gibt. Wir werden wie üblich operieren. Ich werde Ihre einzige Kontaktperson sein. Wenn Sie etwas brauchen, von der Regierung oder dem Militär, auf dieser Seite des Atlantiks oder der anderen, was immer es auch ist, Sie brauchen es nur zu sagen. Aber das Ganze muss streng geheim bleiben, ist das klar? Wir können keine Panik gebrauchen. Und was noch schlimmer ist, wir wollen nicht, dass irgendein ehrgeiziges Land in der Zweiten oder der Dritten Welt einen einseitigen Handel mit den Bombenattentätern macht.«
»Richtig.« Die Hälfte aller rückständigen Nationen hegten nicht gerade liebevolle Gefühle für die Vereinigten Staaten. Und ebenso wenig die diversen Terroristen, die sich in zunehmendem Maße Amerika und Amerikaner als Ziele aussuchten. »Wann reise ich ab?«
Kapitel 2
Paris
Als Farouk al Hamids Schicht kurz vor 18 Uhr zu Ende war, schlüpfte er aus seiner Uniform und verließ das Hopital Européen Georges Pompidou durch den Personalausgang. Dass ihm jemand auf dem belebten Boulevard Victor Hugo zum Café Massoud in einer kleinen Seitenstraße folgte, bemerkte er nicht und hatte auch keinen Anlass, auf Verfolger zu achten.
Er war müde und deprimiert, was nach einem ganzen Tag lang harter Arbeit – Böden schrubben, riesige Körbe mit schmutziger Wäsche tragen und der ganzen Fülle der niedrigen Arbeiten, die man eben von einem Krankenhaushelfer erwartete – kein Wunder war, und nahm an einem Tisch ganz vorn im Lokal, direkt am Bürgersteig, Platz. Die Glastüren waren zurückgeklappt worden, und deshalb mischte sich die würzige Frühlingsluft mit den aromatischen Essensdüften aus der Küche.
Er sah sich um, nahm aber bald seine algerischen Landsleute und die Marokkaner und Berber, die die Stammkundschaft des Lokals darstellten, nicht mehr zur Kenntnis. Kurz darauf hatte er sein zweites Glas starken Kaffee vor sich stehen und warf, immer wieder daran nippend, denen seiner Landsleute, die sich dem Weingenuss hingaben, finstere Blicke zu. Der Prophet hatte jeglichen Alkohol verboten, ein Gesetz des Islam, das nur zu viele seiner nordafrikanischen Landsleute ignorierten, sobald sie einmal ihre Heimat ein Stück hinter sich gelassen und damit das Gefühl hatten, auch Allah hinter sich zurückgelassen zu haben.
Während Farouks Missmut stieg, nahm ein Fremder an seinem Tisch Platz.
Den hellblauen Augen nach zu schließen, war der Mann nicht arab, sprach aber Arabisch. »Salaam aleikum, Farouk. Sie sind ein hart arbeitender Mann. Ich habe Sie beobachtet und glaube, dass Ihnen Besseres zuteil werden sollte. Und deshalb habe ich Ihnen einen Vorschlag zu machen. Sind Sie interessiert ?«
»Wahs-tah-hahb?«, brummte Farouk argwöhnisch. »Nichts ist umsonst.«
Der Fremde nickte verständnisvoll. »Das stimmt. Aber trotzdem, was würden Sie und Ihre Familie von einem kleinen Urlaub halten?«
»Ehs-mah-lee. Urlaub ?«, fragte Farouk missmutig. »Was Sie da vorschlagen, ist doch unmöglich.«
Das Arabisch, das der Mann sprach, deutete auf eine höhere Gesellschaftsschicht hin als die, der Farouk sich zugehörig fühlte, und der Mann hatte einen seltsamen Akzent, Iraker vielleicht, oder Saudi. Aber er war weder Iraker noch Saudi noch Algerier. Der Mann war ein weißer Europäer, älter als Farouk, drahtig und braun gebrannt. Als der Fremde dem Kellner winkte, Kaffee zu bringen, bemerkte Farouk al Hamid, dass er gut gekleidet war, aber wiederum nicht in einer Art, die auf eine bestimmte Nation schließen ließ, und in solchen Dingen kannte Farouk sich aus. Das war ein Spiel, mit dem er sich oft die Zeit vertrieb, um seine Gedanken von seinen müden Muskeln und den langen Stunden voll sinnloser Arbeit abzulenken – und davon, dass er in dieser neuen Welt nicht die leiseste Chance hatte, voranzukommen.
»Für Sie, ja«, nickte der Fremde. »Für mich nicht. Ich bin ein Mann, der das Unmögliche möglich machen kann.«
»La. Nein, ich werde nicht töten.«
»Das habe ich nicht von Ihnen verlangt. Und man wird auch nicht von Ihnen verlangen, dass Sie stehlen oder Sabotage verüben.«
Jetzt war Farouks Interesse geweckt. »Wie soll ich dann für diesen großartigen Urlaub bezahlen?«
»Lediglich, indem Sie eine handschriftliche Notiz an das Krankenhaus schreiben, eine kurze Mitteilung, dass Sie plötzlich erkrankt seien und Ihren Cousin Mansour auf ein paar Tage als Ihren Vertreter schicken werden. Wenn Sie das tun, bekommen Sie von mir Geld dafür.«
»Ich habe keinen Cousin.«
»Alle Algerier haben Cousins. Wussten Sie das nicht?«
»Das stimmt freilich. Aber ich habe keinen hier in Paris.«
Der Fremde lächelte verständnisvoll. »Er ist gerade aus Algier eingetroffen.«
Farouk spürte eine mächtige Freude in sich aufsteigen. Ein Urlaub für seine Frau, für die Kinder. Für ihn. Der Mann hatte völlig Recht, niemand in ganz Paris würde sich dafür interessieren, wer in dem riesigen Pompidou-Hospital zur Arbeit erschien, solange sie nur erledigt wurde, und das für diesen Hungerlohn. Allerdings – was dieser Bursche oder seine Auftraggeber wollten, würde nicht gut sein. Vielleicht hatten sie vor, Drogen zu stehlen. Andererseits waren das hier alles ohnehin Ungläubige, und ihn ging das Ganze eigentlich nichts an. Er konzentrierte sich ganz auf die Freude, zu seiner Familie nach Hause gehen und ihnen sagen zu können, dass sie Urlaub machen würden ... wo?
»Ich würde gern wieder einmal das Mittelmeer sehen«, sagte Farouk tastend und musterte den Mann, scharf auf irgendein Anzeichen achtend, dass er vielleicht zu viel gefordert hatte. »Capri, vielleicht. Ich habe gehört, dass die Strände in Capri mit silbernem Sand bedeckt sind. Das wird sehr teuer sein.«
»Schön, also Capri. Oder Porto Vecchio. Oder meinetwegen auch Cannes oder Monaco.«
Während dem Fremden diese Namen von der Zunge rollten, magisch und viel verheißend, floss Freude in Farouk al Hamids müde Seele, und er murmelte: »Sagen Sie mir, was ich schreiben soll.«
Bordeaux
Ein paar Stunden später klingelte das Telefon in einer schäbigen Pension ein Stück außerhalb von Bordeaux, irgendwo zwischen den Weinlagerhäusern am Ufer der Garonne. Der Bewohner des Zimmers war ein kleiner Mann Mitte zwanzig, mit teigig wirkendem Gesicht. Er saß auf seiner Pritsche und starrte das klingelnde Telefon an. Seine Augen waren vor Furcht geweitet, und er zitterte am ganzen Körper. Vom Fluss her hallten Rufe und das dumpfe Blöken der Schiffshörner in das armselige Zimmer, und der junge Mann, er hieß Jean-Luc Massenet, zuckte bei jedem Klingeln zusammen wie eine Marionette, an deren Fäden jemand zieht. Er nahm den Hörer nicht ab.
Als das Klingeln schließlich aufgehört hatte, zog er einen Notizblock aus der Aktentasche, die vor ihm auf dem Boden stand, und begann, mit zittrigen Schriftzügen zu schreiben. Er wurde immer schneller, zeichnete alles auf, woran er sich erinnerte, aber nach ein paar Minuten überlegte er es sich anders, stieß eine halblaute Verwünschung aus, riss das Blatt von dem Block, zerknüllte es und warf es in den Papierkorb. Sichtlich angewidert und verängstigt klatschte er den Block auf den kleinen Tisch und entschied, dass es für ihn keine andere Lösung gab, als hier zu verschwinden, erneut zu fliehen.
Schwitzend griff er sich die Aktentasche und eilte zur Tür.
Aber noch bevor er die Klinke berührte, klopfte es draußen. Er erstarrte, während er zusah, wie der Türknauf sich langsam nach rechts und dann nach links drehte, beobachtete ihn so, wie eine Maus gebannt den hin und her wippenden Kopf einer Kobra beobachtet.
»Sind Sie da drinnen, Jean-Luc?« Die Stimme war leise, und der Tonfall deutete auf einen Ortsansässigen. Der Mann dort draußen war bestimmt bloß ein paar Zentimeter von der Tür entfernt. »Ich bin’s, Capitaine Bonnard. Warum nehmen Sie Ihr Telefon nicht ab? Lassen Sie mich rein.«
Jean-Luc zitterte vor Erleichterung. Er versuchte zu schlucken, aber seine Kehle war so trocken wie eine Wüste. Mit zitternden Fingern schloss er die Tür auf, öffnete sie und sah in den düsteren Gang hinaus.
»Bonjour, Capitaine. Wie haben Sie ...?«, fing Jean-Luc an.
Auf eine kurze, herrische Handbewegung des kompakt gebauten Offiziers, der in sein Zimmer trat, verstummte er sofort, voll Respekt für die Macht des Mannes, der die Uniform eines Eliteregiments der französischen Fallschirmjägertruppen trug. Der besorgte Blick von Hauptmann Bonnard registrierte jede Einzelheit des billigen Zimmers, ehe er sich Jean-Luc zuwandte, der immer noch wie erstarrt in der offenen Tür stand.
»Sie scheinen Angst zu haben, Jean-Luc. Wenn Sie meinen, dass Sie in so großer Gefahr sind, dann würde ich vorschlagen, dass Sie die Tür schließen.« Das kantige Gesicht des Offiziers und dessen offener Blick flößten irgendwie Vertrauen ein. Sein blondes Haar war um die Ohren herum militärisch kurz gestutzt, und Jean-Luc registrierte geradezu dankbar die Aura der Verlässlichkeit, die von dem Mann ausstrahlte.
Sein aschfahl gewordenes Gesicht rötete sich. »Es ... es tut mir Leid, Capitaine.« Er schloss die Tür.
»Das sollte es auch. So, und jetzt sagen Sie, was das alles soll. Sie behaupten, Sie wären in Urlaub. In Arcachon, oder? Warum sind Sie dann jetzt hier?«
»Ich – ich halte mich versteckt. Da waren Männer in meinem Hotel, die haben nach mir gesucht. Und sie wussten genau über mich Bescheid. Meinen Namen, wo ich in Paris wohne, eben alles.« Er hielt kurz inne, schluckte. »Einer der Männer hat seine Pistole gezogen und den Mann am Empfang bedroht ... und ich habe das alles gehört! Woher wussten die denn, dass ich in dem Hotel bin? Was wollten sie von mir? Sie haben so ausgesehen, als ob sie mich umbringen wollten, und ich wusste nicht einmal, warum. Also habe ich mich hinausgeschlichen und mich in meinen Wagen gesetzt und bin weggefahren. Bei einem kleinen Wäldchen habe ich angehalten, bin auf einen Waldweg gefahren und habe dort Radio gehört und versucht, mir darüber klar zu werden, ob ich wieder zurückkehren und mein Gepäck holen sollte, und dann habe ich von diesem schrecklichen Unglück im Pasteur gehört. Dass ... dass Dr. Chambord vermutlich tot ist. Wissen Sie etwas Neues? Wie geht es ihm?«
Hauptmann Bonnard schüttelte besorgt den Kopf. »Man weiß nur, dass er in jener Nacht noch in seinem Labor gearbeitet hat, seitdem hat ihn niemand mehr zu Gesicht bekommen. Für die Ermittler ist es ziemlich klar, dass es noch mindestens eine Woche dauern wird, die ganzen Trümmer dort zu durchsuchen. Heute Nachmittag hat man zwei weitere Leichen gefunden.«
»Das ist schrecklich. Der arme Dr. Chambord! Er war so gut zu mir. Oft hat er gesagt, ich würde zu viel arbeiten, und dann hat er darauf bestanden, dass ich Urlaub nehme, weil ich noch welchen guthatte.«
Der Offizier seufzte und nickte. »Ja, schlimm. Aber erzählen Sie doch weiter. Sagen Sie mir, warum Sie glauben, dass diese Männer hinter Ihnen her waren.«
Der Laborassistent wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Sobald ich das vom Pasteur und von Dr. Chambord gehört hatte ... da ergab das doch alles Sinn, ich meine, warum die hinter mir her waren. Also bin ich wieder weggelaufen und habe erst Halt gemacht, als ich schließlich diese Pension gefunden hatte. Hier kennt mich keiner, und die Pension liegt auch etwas abseits.«
»Je comprends. Und dann haben Sie mich angerufen?«
»Oui. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen.«
Jetzt schien der Hauptmann Verständnisprobleme zu haben. »Die waren hinter Ihnen her, weil Émile Chambord möglicherweise bei der Explosion umgekommen ist? Warum? Das ist doch sinnlos, es sei denn, Sie würden sagen, dass es mit diesem Bombenattentat etwas Besonderes auf sich hatte.«
Jean-Luc nickte heftig. »Ich bin völlig unwichtig, nur dass ich ... dass ich ... der Assistent des großen Émile Chambord war. Ich glaube, die Bombe war für ihn bestimmt, er sollte umgebracht werden.«
»Aber um Himmels willen, warum denn? Wer sollte ihn denn töten wollen?«
»Das weiß ich auch nicht, Capitaine, aber ich glaube, es war wegen des Molekularcomputers. Als ich mich von ihm in den Urlaub verabschiedet habe, war er sich zu neunundneunzig Prozent sicher, dass er es geschafft hatte, den Computer funktionsfähig zu machen. Aber Sie wissen ja auch, wie er sein konnte, er war ein ausgesprochener Perfektionist. Er wollte nicht, dass etwas bekannt wurde, nicht einmal andeutungsweise, solange er sich nicht hundertprozentig sicher war, dass auch alles funktionierte. Sie verstehen doch, wie wichtig eine solche Konstruktion wäre? Es gibt eine ganze Menge Leute, die ihn, mich und jeden beliebigen anderen umbringen würden, um an einen richtigen DNS-Computer heranzukommen.«
Hauptmann Bonnards Blick verfinsterte sich. »Wir haben keinerlei Hinweise darauf gefunden, dass er seine Arbeiten erfolgreich zum Abschluss gebracht hatte. Aber von dem Labor ist ja auch nur eine riesige Schutthalde übrig geblieben, so hoch wie die Alpen. Sind Sie sich mit dem, was Sie da jetzt gerade gesagt haben, auch wirklich ganz sicher?«
Jean-Luc nickte. »Bien sûr. Ich war ja an jedem einzelnen Schritt beteiligt. Ich meine, ich habe vieles von dem, was er getan hat, nicht verstanden, aber ...« Er stockte, als neue Ängste in ihm hochkamen und ihn fast erstarren ließen. »Sein Computer ist zerstört worden? Sie haben seine Notizen nicht gefunden? Den Beweis?«
»Das Labor ist ein einziger Trümmerhaufen, und auf der Zentraleinheit des Pasteur war nichts gespeichert.«
»Das ist mir völlig klar. Er hatte Sorge, jemand könnte sich zu früh Zugang verschaffen, vielleicht sogar, dass irgendwelche Hacker ihn bespitzeln könnten. Deshalb hat er seine sämtlichen Aufzeichnungen handschriftlich auf einem Notizblock festgehalten, den er immer in seinen Laborsafe eingeschlossen hat. Das ganze Projekt war auf diesem Notizblock in seinem Safe festgehalten!«
Bonnard stöhnte. »Das bedeutet, dass wir seine Arbeit nicht nachvollziehen können.«
»Vielleicht doch«, meinte Jean-Luc vorsichtig.
»Was?« Der Offizier runzelte die Stirn. »Was sagen Sie da, Jean-Luc?«
»Dass sich seine Arbeit vielleicht doch rekapitulieren lässt. Wir können ohne ihn einen DNS-Computer bauen.« Jean-Luc zögerte, kämpfte gegen die Angst an, die ihm tief in den Knochen saß. »Ich glaube, das ist der Grund, weshalb diese Männer mit ihren Pistolen nach Arcachon gekommen sind und nach mir gesucht haben.«
Bonnard starrte ihn an. »Sie haben eine Kopie seiner Aufzeichnungen ?«
»Nein, bloß meine eigenen Notizen. Die sind natürlich nicht so ausführlich wie die seinen. Ich habe ja nicht alles verstanden, was er getan hat, außerdem hatte er mir und diesem seltsamen Amerikaner, der ihm geholfen hat, ausdrücklich verboten, Aufzeichnungen zu machen. Aber ich habe trotzdem insgeheim aus dem Gedächtnis alles bis zum Ende der letzten Woche niedergeschrieben. Das ist der Zeitpunkt, wo ich in Urlaub gegangen bin. Ich bin sicher, dass meine Aufzeichnungen nicht so vollständig und auch nicht so detailliert wie die seinen sind, aber ich denke, für einen Fachmann auf diesem Gebiet würde es ausreichen, um damit zurechtzukommen und die Lücken zu schließen.«
»Ihre Notizen?« Bonnard wirkte plötzlich erregt. »Sie haben sie mit in den Urlaub genommen? Sie haben sie hier bei sich?«
»Oui, Monsieur.« Jean-Luc tippte auf die Aktentasche, die vor ihm auf dem Boden stand. »Ich habe sie nie aus den Augen gelassen.«
»Dann sollten wir sehen, dass wir schleunigst wegkommen. Möglicherweise hat man Ihre Spur aufgenommen und Sie verfolgt, und die Leute tauchen jeden Augenblick hier auf.« Er ging ans Fenster und blickte auf die nächtliche Straße hinunter. »Kommen Sie her, Jean-Luc. Ist da irgendjemand, der so aussieht wie diese Männer? Jemand, der Ihnen verdächtig vorkommt? Wir müssen ganz sicher sein, um zu wissen, ob wir den vorderen oder den hinteren Ausgang nehmen.«
Jean-Luc trat neben Hauptmann Bonnard an das offene Fenster und betrachtete die Straßenszene im Schein der Straßenlaternen. Drei Männer betraten gerade eine Bar am Flussufer, und zwei kamen heraus. Ein halbes Dutzend andere rollten Fässer aus einem Lagerhaus die Straße hinunter und verluden sie auf der offenen Ladebrücke eines Lastwagens. Ein Landstreicher saß am Straßenrand auf dem Gehsteig, der Kopf war ihm nach vorne gesunken, als ob er eingeschlafen wäre.
Jean-Luc musterte jede einzelne Person. »Nein, diese Männer kenne ich nicht.«
Hauptmann Bonnard brummte zufrieden. »Bon. Wir müssen uns beeilen, ehe die Burschen Sie finden. Schnappen Sie sich Ihre Aktentasche. Mein Jeep steht gleich um die Ecke. Gehen wir.«
»Merci!« Jean-Luc nahm hastig seine Aktentasche auf, klemmte sie sich unter den Arm und rannte auf die Tür zu. Aber kaum hatte sich der junge Mann von ihm abgewandt, griff sich Bonnard mit einer Hand ein Kissen von der schmalen Schlafstelle und zog mit der anderen eine 7.65 mm Le-Francaise-Militaire-Pistole mit Schalldämpfer aus dem Holster. Es war eine alte Waffe, die schon seit Ende der Fünfzigerjahre nicht mehr hergestellt wurde. Die unten am Lauf eingravierte Seriennummer war sorgfältig abgefeilt worden. Die Waffe verfügte über keine Sicherung, man musste also sehr sorgfältig damit umgehen. Bonnard liebte diesen Nervenkitzel; eine solche Waffe war für ihn eine Herausforderung.
Er folgte Massenet und rief leise: »Jean-Luc!«
Der drehte sich um, und sein offenes Jungengesicht wirkte erleichtert. Dann sah er die Waffe und das Kissen. Überrascht und noch ein wenig verständnislos hob er abwehrend die Hand. »Capitaine?«
»Tut mir Leid, Junge. Aber ich brauche diese Aufzeichnungen.« Bevor der junge Mann ein weiteres Wort herausbrachte, ja auch nur eine Bewegung machen konnte, drückte Hauptmann Darius Bonnard ihm das Kissen hinten gegen den Kopf, presste ihm die Mündung der Waffe mit dem Schalldämpfer gegen die Schläfe und drückte ab. Ein leises ploppendes Geräusch war zu hören, Blut, Gehirnmasse und Schädelknochen explodierten in das Kissen. Die Kugel durchschlug es und blieb im Verputz der Wand stecken.
Ohne das Kissen loszulassen, weil er verhindern wollte, dass irgendwelche Blutspuren in das Zimmer gerieten, zerrte Hauptmann Bonnard die Leiche zum Bett und legte sie mit dem Kissen unter dem Kopf auf die Liegestatt. Dann schraubte er den Schalldämpfer von der Pistole, steckte ihn in die Tasche und drückte Jean-Luc die Waffe in die linke Hand. Zuletzt schob er das Kissen ein wenig zurecht, legte seine Hand über die von Jean-Luc und betätigte erneut den Abzug. Diesmal hallte der Schuss wie ein Donnerschlag und ließ das Mobiliar in dem kleinen Raum erzittern. Selbst Hauptmann Bonnard, der darauf vorbereitet gewesen war, wunderte sich, wie laut der Schuss krachte.
Das hier war eine Hafengegend, aber ein Schuss würde dennoch Aufmerksamkeit erregen. Er hatte wenig Zeit. Zuerst musterte er das Kissen. Der zweite Schuss war perfekt gewesen, lag so dicht neben dem ersten Loch, dass es wie eine einzige große Ausschussöffnung aussah. Und jetzt würden Rückstände der abgefeuerten Pistole an Jean-Lucs Hand festzustellen sein, und der Leichenbeschauer könnte befriedigt feststellen, dass der junge Mann Selbstmord begangen hatte, wahrscheinlich aus Kummer über den Verlust seines verehrten und geliebten Dr. Chambord.
Nach kurzer Suche fand der Hauptmann einen Notizblock mit Druckstellen, die darauf hinwiesen, dass jemand auf das darüber liegende Blatt geschrieben hatte. Er holte das zusammengeknüllte Papierblatt aus dem Abfallkorb und stopfte es mit dem Block in die Seitentasche seiner Uniformjacke, ohne sich die Zeit zu nehmen, etwas zu lesen. Dann sah er unter das Bett und die übrigen alten Möbelstücke. Es gab keinen Kleiderschrank. Er grub die erste Kugel aus der Wand und schob eine alte Kommode ein Stück nach links, um das Loch damit zuzudecken.
Als er Jean-Lucs Aktentasche aufhob, war in der Ferne das gleichmäßig an- und abschwellende Heulen einer Polizeisirene zu hören. Er spürte, wie sein Puls sich beschleunigte, schloss die Augen und lauschte. Oui
Kapitel 3
Paris
An Bord der C-17-Frachtmaschine, die am frühen Morgen nach Denver-Zeit den Luftwaffenstützpunkt Buckley verlassen und auf der Polroute München angeflogen hatte, befand sich ein einziger Passagier, dessen Name weder auf der Mannschaftsliste noch sonst wo festgehalten war. Um 6 Uhr morgens legte der riesige Jet in Paris einen außerplanmäßigen Zwischenstopp ein, angeblich um eine dringend in München benötigte Sendung aufzunehmen. Ein Dienstwagen der US Air Force rollte zu dem Düsenfrachter, und ein Mann in der Uniform eines Lieutenant Colonel der US Army trug eine leere Metallkassette an Bord. Er blieb dort. Als die Maschine dann eine Viertelstunde später wieder startete, hatte der offiziell nicht existierende Passagier das Flugzeug längst verlassen.
Kurz darauf hielt derselbe Dienstwagen ein zweites Mal an, diesmal am Seiteneingang eines kleinen Nebengebäudes auf dem Charles de Gaulle Airport im Norden von Paris. Die hintere Tür des Fahrzeugs öffnete sich, und ein hoch gewachsener Mann, ebenfalls in der Uniform eines Lieutenant Colonel der US Army, stieg aus. Jon Smith. Anfang vierzig, schlank und austrainiert und durch und durch wie ein Soldat wirkend. Er hatte ein schmales, kantiges Gesicht; sein dunkles Haar unter der Offiziersmütze trug er etwas länger als gewöhnlich. Er richtete sich auf und ließ den Blick seiner blauen Augen in die Runde wandern.
Als er schließlich in der Morgendämmerung auf das niedrige Gebäude zuging, war an ihm nichts, was irgendwie aufgefallen wäre. Der Mann war einfach ein Offizier der US Army mit einer Reisetasche und einem IBM-Laptop in einem massiven Aluminiumkoffer. Eine halbe Stunde später verließ Smith das Gebäude wieder, diesmal in Zivil. Er trug jetzt legere Kleidung, wie er sie bevorzugte – ein Tweedjackett, ein blaues Baumwollhemd, beige Baumwollhosen und einen Trenchcoat. In einem Schulterhalfter unter dem Jackett steckte seine 9-mm-Sig-Sauer.
Er ging zielstrebig über die Landepiste und passierte mit anderen Passagieren die Zollkontrolle, wo man ihn wegen seiner US-Militärpapiere ohne weitere Visitation durchwinkte. Draußen wartete eine Limousine, deren hintere Tür bereits offen stand. Smith stieg ein und wehrte ab, als der Fahrer ihm die Reisetasche und den Laptop abnehmen wollte.
Die Stadt Paris ist weithin für das bekannt, was ihre Bewohner joie de vivre nennen, und dazu gehört auch die Einstellung der Pariser zum Straßenverkehr. Die Hupe beispielsweise dient der Kommunikation: Ein lang gezogener Hupton bedeutet Verärgerung – mach gefälligst Platz. Ein kurzes Antippen kennzeichnet eine freundliche Warnung. Ein paar kurze Huptöne hintereinander symbolisieren eine fröhliche Begrüßung, ganz besonders, wenn die Huptöne rhythmisch sind. Und auch die Fahrweise ist eine besondere: Um zurechtzukommen, muss man schnell und geschickt sein, gute Reflexe haben, und vor allem Optimist sein – insbesondere, wenn man das Verkehrschaos im Wettbewerb mit den vielen Chauffeuren der zahlreichen Taxi- und Limousinengesellschaften bewältigen möchte. Smith’ Fahrer war Amerikaner und sichtlich mit einem Bleifuß ausgestattet, und das war Smith ganz recht so. Er wollte so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu Marty.
Während die Limousine auf dem Boulevard Périphérique im Süden die überfüllte Stadt umrundete, saß Smith angespannt in den Polstern. In Colorado hatte er schnell jemanden gefunden, dem er seine Forschungsarbeiten an molekularen Schaltkreisen hatte übergeben können. Er hatte das sehr bedauert, aber es war einfach notwendig gewesen. Während des langen Flugs nach Frankreich hatte er sich telefonisch erneut nach Martys Befinden erkundigt. Bis jetzt war keine Besserung eingetreten, aber der Zustand seines Freundes hatte sich wenigstens nicht verschlechtert. In weiteren Telefonaten mit Kollegen in Tokio, Berlin, Sydney, Brüssel und London hatte er sich sehr taktvoll danach erkundigt, wie sie mit ihren Entwicklungsarbeiten im Bereich der molekularen Schaltkreise vorankamen. Alle hatten sich jedoch sehr zurückhaltend geäußert; jeder von ihnen wollte schließlich der Erste sein.
Daraus hatte Jon Smith für sich den Schluss gezogen, dass sie alle noch ein gutes Stück vom Ziel entfernt waren. Jeder Einzelne von ihnen hatte sich bedauernd über Émile Chambords Tod ausgesprochen, ohne dabei aber auf sein Projekt einzugehen. Smith hatte den Eindruck, dass sie ebenso wenig wussten wie er noch vor einem Tag.
Der Fahrer lenkte die Limousine auf die Avenue de La Porte de Sèvres und hielt kurz darauf vor dem Hopital Georges Pompidou, das achthundert Betten Platz bot. Mit seiner Glasfassade und den geschwungenen Wänden ragte es wie ein gewaltiges Hustenbonbon als eine Art Denkmal der modernen Architektur gegenüber dem Park André Citroën auf. Smith griff sich sein Gepäck, bezahlte den Fahrer und trat in die mit Marmor ausgekleidete Galleria des Gebäudes. Er nahm seine Sonnenbrille ab, steckte sie in die Tasche und sah sich um.
Die Galleria war so gewaltig – nicht viel kleiner als ein Fußballstadion –, dass darin eine leichte Brise aufgekommen war, die die Palmwedel der dekorativen Gewächshausbäume sanft bewegte. Das Krankenhaus war erst vor zwei Jahren eröffnet worden und wurde allgemein als das derzeit modernste Krankenhaus der Welt angepriesen. Als Smith auf die Informationstheke zuging, entdeckte er Rolltreppen von dem Format, wie man sie üblicherweise in großen Kaufhäusern findet, die zu den Patientenzimmern in den oberen Geschossen führten; beleuchtete Pfeile wiesen den Weg zu den Operationssälen; überall der dezente Duft von Johnson’s Bohnerwachs.
In perfektem Französisch erkundigte er sich nach der Intensivstation, in der Marty behandelt wurde, und fuhr dann mit der Rolltreppe nach oben. Offenbar war er gerade in den Schichtwechsel geraten, denn rings um ihn huschten eine Unzahl von Schwestern und Krankenpflegern, Technikern, Angestellten und sonstigem Personal herum. Das alles verlief fast lautlos und elegant, und es brauchte einen erfahrenen Blick, um überhaupt wahrzunehmen, mit welcher Effizienz hier die Aufgaben von einer Schicht an die nächste übergeben wurden.
Eines der Prinzipien, nach denen dieses Musterkrankenhaus funktionierte, sah vor, dass die einzelnen Dienste zusammengefasst wurden, sodass der Spezialist zum Patienten kam, anstatt wie meist üblich umgekehrt. Neu eingewiesene Patienten meldeten sich an zweiundzwanzig unterschiedlichen Empfangspulten, wo sie von persönlichen Hostessen empfangen wurden, die sie in ihre Zimmer geleiteten. Dort war am Fußende eines jeden Betts ein Computer aufgestellt und sämtliche Krankenberichte wurden im Cyberspace registriert. Kleinere chirurgische Eingriffe führten Roboter durch. Sogar über Schwimmbäder, Fitnesscenter und Cafés verfügte das gigantische Krankenhaus.
Hinter dem Empfangspult für die Intensivstation waren zwei Gendarmen an der eigentlichen Zugangstür postiert. Smith gab sich bei der Empfangsschwester in aller Form als der amerikanische ärztliche Vertreter der Familie von Dr. Martin Zellerbach zu erkennen. »Ich möchte mit dem für die Behandlung von Dr. Zellerbach zuständigen Arzt sprechen.«
»Das wäre dann Dr. Dubost. Er macht gerade Visite und hat Ihren Freund schon heute Morgen besucht. Ich werde ihn ausrufen lassen.«
»Merci. Würden Sie mich zu Dr. Zellerbach bringen? Ich warte so lange hier.«
»Bien sûr. S’il vous plaît?« Sie ließ ein geschäftsmäßiges Lächeln aufblitzen und führte ihn dann, nachdem ein Gendarm seinen Militärausweis überprüft hatte, durch die schwere Pendeltür.
Die kleinen Geräusche des Krankenhauses waren mit einem Mal verstummt, und er befand sich in einer gleichsam schallgedämpften Welt leiser Schritte, flüsternder Ärzte und Schwestern und dem gedämpften Licht und den blinzelnden Leuchtdioden von Maschinen, die in der herrschenden Stille laut zu atmen schienen. In einer Intensivstation beherrschten Maschinen das Universum, und die Patienten waren ihnen untertan.
Smith ging besorgt auf Marty zu, der sich in der dritten Nische auf der linken Seite befand und reglos hinter den hochgeschobenen Seitengittern eines schmalen, an verschiedene Gerätschaften angeschlossenen Betts lag, zwischen all den Schläuchen, Drähten und Bildschirmen so hilflos wie ein Krabbelkind, das zwei aus seiner Perspektive riesenhafte Erwachsene an den Händen führen. Smith blickte mit einem Gefühl der Beklommenheit auf seinen Freund hinab. Im Koma erstarrt, wirkte Martys rundes Gesicht bleich wie Wachs, aber sein Atem ging gleichmäßig.
Smith tippte an den Bildschirm am Fußende des Bettes und las die dort abrufbereiten Daten: Marty lag immer noch im Koma. Seine sonstigen Verletzungen waren eher belanglos, meist nur Kratzer und Prellungen. Beunruhigend war das Koma mit seinem Potenzial für Hirnschäden, plötzlichen Tod und noch Schlimmeres – einem Schwebezustand zwischen Leben und Tod gleich. Aber der Bildschirm ließ auch ein paar gute Zeichen erkennen. Sämtliche autonomen Reflexe funktionierten. Marty konnte ohne Unterstützung atmen, musste gelegentlich husten, gähnen, blinzeln und zeigte Augenbewegungen, die darauf hindeuteten, dass der Gehirnsektor, der diese Aktivitäten steuerte, noch in Ordnung war.
»Dr. Smith?« Ein grauhaariger, schmächtiger Mann mit olivenfarbenem Teint ging auf ihn zu. »Wie ich höre, kommen Sie aus den Vereinigten Staaten.« Er stellte sich vor, und Smith warf beinahe automatisch einen Blick auf den Namen, der auf der Brusttasche des langen weißen Arztmantels eingestickt war – Edouard Dubost, Martins behandelnder Arzt.
»Danke, dass Sie sich so schnell für mich Zeit genommen haben«, meinte Smith. »Sagen Sie, wie ist Dr. Zellerbachs Zustand?«