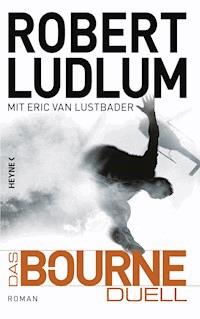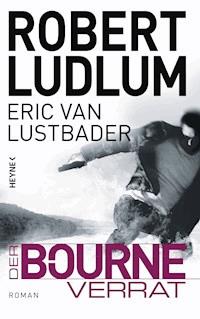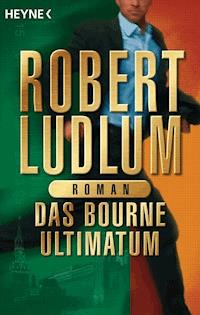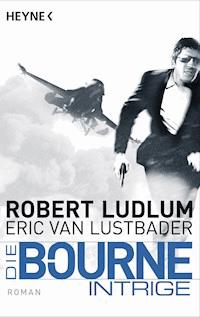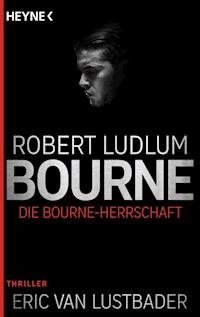9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JASON BOURNE
- Sprache: Deutsch
Die Schatten der Vergangenheit
Stell dir vor, du weißt nicht mehr, wer du bist, und das Erste, was du über dich herausfindest, ist, dass du ziemlich gut schießen kannst. Jason Bourne ist ein Mensch ohne Vergangenheit und ohne Zukunft – gejagt von mächtigen Feinden; geliebt von einer schönen Frau, die nicht glauben kann, dass er wirklich das ist, was sich langsam herauskristallisiert: ein Berufskiller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
THE NEW YORK TIMES
Freitag, 11. Juli 1975 – Titelseite
VERBINDUNG ZWISCHEN DIPLOMATEN UND FLÜCHTIGEM TERRORISTEN CARLOS
Paris, 10. Juli – Frankreich hat heute drei hochrangige kubanische Diplomaten des Landes verwiesen. Unterrichtete Kreise sehen eine Verbindung zwischen dieser Maßnahme und der weltweiten Suche nach einem Mann namens Carlos, den man für die zentrale Figur innerhalb einer internationalen Terrororganisation hält.
Der Verdächtige, dessen richtiger Name vermutlich Il-jitsch Ramirez Sanchez lautet, wird im Zusammenhang mit der Ermordung von zwei französischen Abwehragenten und einem libanesischen Informanten in einer Wohnung im Quartier Latin am 27. Juni gesucht.
Die drei Morde haben die hiesige Polizei und Scotland Yard in London vermutlich auf die Spur eines internationalen Terroristennetzes geführt. Bei der Fahndung nach Carlos entdeckten französische und britische Polizisten größere Waffenlager, die darauf schließen lassen, dass Carlos mit Terroristen in Westdeutschland zusammenarbeitet und die zahlreichen Terroranschläge in ganz Europa auf koordinierte Absprachen zurückzuführen sind. Seit seiner Flucht soll Carlos in London und Beirut gesichtet worden sein ...
ASSOCIATED PRESS
Montag, 7. Juli 1975 – Agenturmeldung
ZIELFAHNDUNG NACH MEUCHELMÖRDER
London (AP) – Waffen und Mädchen, Handgranaten und Maßanzüge, eine dicke Brieftasche, Flugtickets zu Traumzielen und Luxuswohnungen in einem halben Dutzend Hauptstädten der Welt – so lebt ein professioneller Killer des Düsenzeitalters, der von den internationalen Polizeibehörden gesucht wird.
Die Fahndung begann, nachdem der Mann in Paris vor seiner Wohnungstür zwei französische Abwehragenten und einen libanesischen Informanten erschossen hatte. Inzwischen sind in zwei Hauptstädten vier Frauen verhaftet worden, denen man eine Beteiligung an Verbrechen nachsagt, die mit ihm in Verbindung stehen. Der Mörder selbst ist verschwunden und nach Ansicht der französischen Polizei im Libanon untergetaucht.
In den vergangenen Tagen haben ihn Londoner Bekannte der Presse als gut aussehend, höflich, gebildet, wohlhabend und modisch gekleidet geschildert.
Aber zu seinen Komplizen zählen Männer und Frauen, die hemmungslos von der Waffe Gebrauch machen. Er soll gemeinsam mit der Roten Armee Japans, der El Fath der westdeutschen Baader-Meinhof-Bande, der Quebec-Befreiungsfront, der Türkischen Volksbefreiungsfront, den Separatisten in Frankreich und Spanien und dem provisorischen Flügel der Irisch-Republikanischen Armee operieren.
Wenn der Gesuchte sich auf Reisen begab – nach Paris, Den Haag, Westberlin – explodierten Bomben, fielen Schüsse und wurden Menschen entführt.
Die Pariser Polizei hatte die große Chance, ihn zu fassen, als ein libanesischer Terrorist beim Verhör weich wurde und zwei Abwehrbeamte am 27. Juni zum Unterschlupf des Mörders führte. Doch der war schneller: Er erschoss alle drei und entkam. Die Polizei fand in seiner Wohnung Waffen und Notizbücher mit ›Todeslisten› prominenter Persönlichkeiten.
Gestern schrieb der Londoner Observer, die Polizei fahnde nach dem Sohn eines kommunistischen Anwalts aus Venezuela, um ihn in Verbindung mit dem dreifachen Mord zu verhören. Scotland Yard erklärte: »Wir dementieren den Bericht nicht«, fügte aber hinzu, dass gegen ihn keine Anklage vorläge und er nur zur Beantwortung von Fragen gebraucht werde.
Der Observer identifizierte den Betreffenden als Iljitsch Ramirez Sanchez aus Caracas. Dieser Name, so hieß es in dem Artikel, stehe in einem der vier Pässe, die die Polizei bei der Durchsuchung der Pariser Wohnung gefunden hatte.
Die Zeitung berichtete ferner, dass Iljitsch nach Wladimir Iljitsch Lenin, dem Gründer des Sowjetstaates, benannt sei, in Moskau die Schule besucht habe und Russisch perfekt beherrsche.
In Caracas erklärte ein Sprecher der Venezolanischen Kommunistischen Partei, Iljitsch sei der Sohn eines siebzigjährigen marxistischen Rechtsanwalts, der 800 Kilometer westlich von Caracas wohne, betonte aber gleichzeitig: »Weder Vater noch Sohn sind Mitglied unserer Partei.« Er erklärte den Reportern, er wisse nicht, wo Iljitsch sich augenblicklich aufhalte.
Buch I
1.
Wie ein schwerfälliges Tier, das sich verzweifelt aus einem tiefen Sumpf zu befreien versucht, schlingerte der Trawler in den feindlichen Wellen der finsteren, tobenden See. Die Brecher türmten sich zu gigantischen Höhen auf und krachten mit der vollen Wucht ihrer Wassermassen gegen den Rumpf; weiße Gischt, die der Nachthimmel erhellte, ging in Kaskaden unter der Wut des nächtlichen Windes über das Deck nieder. Überall waren Laute seelenlosen Schmerzes zu hören: Holz, das sich gegen Holz bäumte, Taue, die sich verdrehten, bis zum Zerreißen angespannt. Das Tier lag im Todeskampf.
Da übertönten zwei Explosionen die Laute der See und des Windes und des Schmerzes, den das Schiff empfand. Sie drangen aus der schwach erleuchteten Kabine. Ein Mann stürzte aus der Tür, klammerte sich mit einer Hand an die Reling und hielt sich mit der anderen den Bauch.
Ein zweiter Mann folgte ihm. Er stützte sich an der Kabinentür ab, bevor er seine Pistole hob und erneut feuerte. Und dann noch einmal.
Der Mann an der Reling riss beide Hände an den Kopf, als die vierte Kugel ihn nach hinten warf. Der Bug des Trawlers tauchte plötzlich in das Tal zwischen zwei mächtigen Wogen und hob den Verwundeten hoch; der drehte sich nach links, außerstande, die Hände vom Kopf wegzunehmen. Wieder bäumte sich das Boot auf, sodass Bug und Mittschiff fast gänzlich aus dem Wasser ragten und die Gestalt in der Tür in die Kabine zurückfiel. Ein fünfter Schuss peitschte. Der Verwundete schrie auf. Seine Arme schlugen jetzt wild um sich, die Augen von Blut und Gischt geblendet. Seine Hände griffen ins Leere. Da war nichts, was er greifen konnte. Die Beine knickten ein, als sein Körper nach vorne taumelte. Das Boot stampfte wild leewärts, und der Mann, dessen Schädel aufgerissen war, wurde über die Reling geschleudert, hinab in den Wahnsinn der Finsternis unter ihm.
Er spürte, wie das wilde, kalte Wasser ihn umhüllte, ihn in die Tiefe sog, ihn herumwirbelte und wieder nach oben trieb. Ein einziger Atemzug, und erneut zog es ihn in die Fluten.
Plötzlich spürte er eine Hitze, eine feuchte Hitze an seiner Schläfe, die stärker war als das eisige Wasser, das fortfuhr, ihn zu verschlingen. Ein Feuer brannte, wo kein Feuer brennen durfte; und ein eisiges Pulsieren strömte durch seinen Leib, seine Beine, seine Brust, seltsam von der kalten See gewärmt, die ihn umgab. Er konnte verfolgen, wie sein eigener Körper sich drehte, sich verkrampfte, wie Arme und Füße sich verzweifelt aus dem Strudel befreien wollten. Er konnte fühlen und denken, Panik und Kampf wahrnehmen – und doch war da Frieden in ihm. Es war die Ruhe des unbeteiligten Betrachters, der, losgelöst von den Ereignissen, zwar von ihnen weiß, aber nicht von ihnen betroffen ist.
Dann durchfuhr ihn eine andere Art von Panik, wallte auf durch die Hitze und das Eis, verdrängte die Distanz. Er konnte sich nicht einfach dem Frieden hingeben! Noch nicht! Jeden Augenblick würde es geschehen; er war nicht sicher, was es war, aber es würde geschehen. Wie wild kämpfte er gegen die tonnenschweren Wasserwände über ihm an und in seiner Brust brannte es. Schließlich brach er durch die Wasseroberfläche, ruderte wild mit Armen und Beinen, um sich auf der schwarzen Woge zu halten. Steig höher! Höher!
Eine mächtige Welle half ihm; er trieb auf ihrem Kamm, umgeben von Schaum und Finsternis. Nichts. Umdrehen! Umdrehen!
Da geschah es. Die Explosion war gewaltig; er konnte sie durch das Krachen der Wellen und das Brüllen des Windes hören, und irgendwie war der Anblick und das, was an sein Ohr drang, seine Tür zum Frieden. Der Himmel leuchtete auf wie ein feuriges Diadem und in der aufstiebenden Feuerkrone wurden Gegenstände aller Formen und Größen durch das Licht in die äußere Welt der Schatten geschleudert.
Er hatte gewonnen! Was auch immer es war, er hatte gewonnen.
Plötzlich stürzte er wieder in die Tiefe, in den Abgrund. Er spürte, wie die Wellen über seinen Schultern zusammenschlugen und die glühende Hitze an seinen Schläfen kühlten.
Seine Brust schmerzte. Etwas hatte ihn getroffen: der Schlag, der plötzliche Aufprall. Es war wieder geschehen! Lasst mich allein! Gebt mir Frieden!
Und er schlug erneut um sich, trat zu ... bis er ihn spürte, den dicken, öligen Gegenstand, der sich nur mit den Bewegungen der See bewegte. Er konnte nicht sagen, was das für ein Gegenstand war, aber er war da, und er konnte ihn fühlen, ihn festhalten. Ihn festhalten! Er wird dich in den Frieden führen ... in das Schweigen der Finsternis ...
Die Strahlen der frühen Morgensonne durchbrachen im Osten den dunstigen Schleier am Himmel und ließen die ruhigen Wasser des Mittelmeers glitzern. Der Kapitän des kleinen Fischerboots saß mit blutunterlaufenen Augen am Heck, die Hände rissig von den Tauen. Er rauchte eine Gauloise und war froh, dass die See so ruhig war. Er sah zu dem offenen Steuerhäuschen hinüber; sein jüngerer Bruder schob den Gashebel vor, um die Fahrt zu beschleunigen, während der einzige andere Angehörige seiner Crew ein paar Meter von ihm entfernt ein Netz prüfte. Sie lachten über irgendetwas, und das war gut so; denn letzte Nacht hatten sie wahrhaftig nichts zu lachen gehabt. Wo war der Sturm bloß hergekommen? Die Wetterberichte aus Marseille hatten ihn nicht angekündigt; sonst wären sie im Schutz der Küste geblieben. Er wollte bis Tagesanbruch die Fischgründe achtzig Kilometer südlich von La Seyne-sur-Mer erreichen, aber nicht um den Preis kostspieliger Reparaturen, und welche Reparaturen waren heutzutage nicht kostspielig?
Auch nicht um den Preis seines Lebens, und während der vergangenen Nacht hatte es Augenblicke gegeben, wo solche Befürchtungen durchaus gerechtfertigt waren.
»Du bist müde, nicht wahr?«, rief sein Bruder und grinste ihm zu. »Geh jetzt schlafen. Lass mich weitermachen.«
»Okay«, antwortete der Bruder und warf die Zigarette über Bord. »Ein wenig Schlaf schadet bestimmt nicht.«
Es war gut, einen Bruder am Steuer zu wissen. Am besten sollte immer einer aus der Familie das Schiff lenken; der passt wirklich auf. Selbst ein Bruder, der die gewandte Sprache eines Gebildeten sprach, im Gegensatz zu seinen eigenen grobschlächtigen Worten. Verrückt! Ein Jahr auf der Universität – und schon wollte sein Bruder eine Gesellschaft gründen. Mit einem einzigen Boot, das vor vielen Jahren bereits bessere Tage gesehen hatte. Verrückt. Was hatten ihm denn seine gescheiten Bücher letzte Nacht genützt, als seine Compagnie beinahe gekentert wäre?
Er schloss die Augen und kühlte seine Hände in den Wasserpfützen auf Deck. Das Salz der See würde gut für die Verbrennungen sein, die er sich zugezogen hatte, als er Geräte festzurrte, die im Sturm nicht an ihrem Platz bleiben wollten.
»Schau! Dort drüben!« Sein Bruder wollte ihm offenbar mit seinen scharfen Augen den Schlaf neiden.
»Was ist denn?«, schrie er.
»Dort treibt ein Mann im Wasser! Er hält sich an etwas fest. An einer Planke oder etwas Ähnlichem.«
Der Skipper nahm das Steuer und lenkte das Boot rechts neben die Gestalt im Wasser und drosselte die Motoren, um die Kielwelle zu verringern. Der Mann sah aus, als würde ihn die geringste Erschütterung von dem Stück Holz rutschen lassen, an das er sich klammerte. Seine Hände waren weiß. Wie Klauen hatten sich seine Finger um die Planke gelegt; aber aus seinem übrigen Körper war alle Energie gewichen, wie bei einem Ertrunkenen, wie bei jemandem, der von dieser Weit bereits Abschied genommen hat.
»Macht eine Schlinge in die Taue!«, schrie der Skipper seinem Bruder und dem Matrosen zu. »Legt sie um seine Beine. Ganz vorsichtig! Jetzt zieht sie hoch bis zu seinen Hüften. Vorsichtig!, hab ich gesagt.«
»Seine Hände lassen die Planke nicht los!«
»Ihr müsst sie öffnen! Vielleicht ist das die Totenstarre.«
»Nein. Er lebt noch, wie mir scheint. Seine Lippen bewegen sich, doch es kommt kein Ton heraus. Seine Augen auch; aber ich bezweifle, dass er uns sieht.«
»Die Hände sind frei!«
»Hebt ihn hoch. Packt seine Schultern und zieht ihn herüber. Vorsichtig!«
»Mutter Gottes, seht nur seinen Kopf!«, schrie der Matrose. »Er ist aufgeplatzt.«
»Er muss im Sturm gegen die Planke geschlagen sein«, sagte der Bruder.
»Nein«, widersprach der Skipper und starrte die Wunde an. »Das ist ein sauberer Schnitt, wie von einer Rasierklinge. Eine Kugel hat ihn getroffen; man hat auf ihn geschossen.«
»Das kannst du nicht sicher sagen.«
»Er hat noch mehr Schusswunden«, fügte der Skipper hinzu, dessen Augen den Körper absuchten. »Wir fahren zur He de Port Noir; das ist die nächste Insel. Dort gibt es einen Arzt.«
»Den Engländer?«
»Er wird ihn versorgen.«
»Wenn er kann«, sagte der Bruder des Skippers, »falls er nicht besoffen ist. Mit den Tieren seiner Patienten hat er jedenfalls mehr Erfolg als mit Kranken.«
»Das macht nichts. Bis wir da sind, ist der hier ohnehin eine Leiche. Sollte er zufällig doch überleben, stelle ich ihm das zusätzliche Benzin und den Fang, der uns entgeht, in Rechnung. Hol den Sanitätskasten; wir verbinden ihm den Kopf, auch wenn es nichts nützt.«
»Schau!«, rief der Matrose. »Seine Augen!«
»Was ist mit ihnen?«, fragte der Bruder.
»Gerade noch waren sie grau – grau wie Stahlkabel. Jetzt sind sie blau!«
»Die Sonne ist heller geworden«, sagte der Skipper und zuckte die Schultern. »Oder du hast dich getäuscht. Aber das ist egal, im Grab gibt’s ohnehin keine Farben.«
Das gleichmäßige Tuckern der Fischerboote mischte sich in das unablässige Kreischen der Möwen; gemeinsam bildeten sie die typischen Geräusche an der Küste. Es war später Nachmittag, die Sonne stand wie ein Feuerball im Westen, die Luft war still, feucht und heiß. Über den Piers am Hafen verlief eine Straße mit Kopfsteinpflaster, an ein paar heruntergekommenen weißen Häusern vorbei, zwischen denen Unkraut aus ausgetrockneter Erde in die Höhe schoss. Das hölzerne Gitterwerk der Veranden war beschädigt und die zerbröckelnden Stuckdecken wurden von hastig eingefügten Stützen getragen. Die Villen hatten vor ein paar Jahrzehnten bessere Tage gesehen, damals, als die Bewohner irrtümlich glaubten, Ile de Port Noir könnte ein weiteres Eldorado des Mittelmeeres werden. Doch das wurde es nie.
Von allen Häusern führten schmale Wege zur Straße, aber der Pfad des letzten Hauses in der Reihe wurde offensichtlich häufiger begangen als die anderen. Dort lebte ein Engländer, der vor acht Jahren nach Port Noir gekommen war, unter Umständen, die niemand begriff oder begreifen wollte; er war Arzt, und das Dorf brauchte einen, Nadel und Skalpell waren ebenso Werkzeuge, die dem Lebensunterhalt dienten, wie Instrumente, an denen man sich verletzen konnte. Wenn le docteur seinen guten Tag hatte, waren seine Nähte gar nicht übel. Wenn allerdings der Gestank von Wein oder Whiskey zu penetrant war, ging man als Patient eben ein Risiko ein.
Aber besser er als gar kein Arzt.
Heute jedoch hatte noch niemand den Pfad benutzt. Es war Sonntag, und jeder wusste, dass der Doktor sich jeden Samstagabend im Dorf betrank und die Nacht dann mit irgendeiner Hure verbrachte. Natürlich war auch bekannt, dass sich an den letzten paar Samstagen die Gewohnheit des Arztes geändert hatte; er hatte sich nicht mehr im Dorf blicken lassen. Aber so groß war die Änderung nicht; Flaschen mit Scotch wurden regelmäßig in sein Haus geschickt. Er blieb einfach daheim; das tat er, seit das Fischerboot aus La Ciotat den unbekannten Mann gebracht hatte, der dem Tod näher gewesen war als dem Leben.
Dr. Geoffrey Washburn erwachte und zuckte zusammen, das Kinn gegen das Schlüsselbein gedrückt, sodass ihm der eigene Mundgeruch in die Nase strömte; das war nicht angenehm. Er rieb sich die Augen, orientierte sich und blickte zur offenen Schlafzimmertür. Hatte ihn wieder ein zusammenhangloser Monolog seines Patienten aus dem Schlaf gerissen? Nein, nebenan war Stille. Selbst die Möwen draußen waren ruhig. Es war der heilige Tag von Ile de Port Noir. Heute würden keine Fischerboote in den Hafen tuckern und die Vögel mit ihrem Fang locken.
Washburn sah auf das leere Glas und die halb leere Flasche Whiskey auf dem Tisch neben seinem Sessel. Man merkte den Fortschritt. An einem normalen Sonntag würde sie jetzt längst ausgetrunken sein und der Scotch den Schmerz der vergangenen Nacht ertränkt haben. Er lächelte und dachte an seine ältere Schwester in Coventry, die den Scotch mit ihrer monatlichen Zuwendung möglich machte. Bess war ein gutes Mädchen, und sie hätte ihm weiß Gott viel mehr schicken können, aber trotzdem war er ihr dankbar für die Unterstützung. Und eines Tages würde sie aufhören, ihm Geld zu überweisen, und dann würde er mit dem billigsten Wein seine Erinnerung betäuben, bis überhaupt kein Schmerz mehr da war.
Er hatte sich schon lange mit diesem Leben abgefunden ... bis ein paar Fischer, die sich nicht zu erkennen geben wollten, vor drei Wochen und fünf Tagen den halb toten Fremden an seine Tür geschleppt hatten. Aus ihrer Sicht war das reine Barmherzigkeit, sie hatten mit dem Mann nichts weiter zu tun. Gott würde verstehen, warum der Mann angeschossen worden war.
Der Doktor stemmte seinen hageren Körper aus dem Sessel und trat schwankend ans Fenster, von wo aus er den Hafen überblicken konnte. Er zog die Gardinen zu, um das helle Sonnenlicht auszusperren, und spähte zwischen den Falten des Vorhangs hinaus, um zu sehen, was sich weiter unten auf der Straße tat, insbesondere, woher das Klappern kam. Es war ein Pferdewagen, eine Fischerfamilie auf Sonntagsausfahrt. Wo, zum Teufel, konnte man so etwas sonst noch erleben? Und dann erinnerte er sich an die Kutschen und die gestriegelten Wallache, die sich in den Sommermonaten mit Touristen durch den Londoner Regent Park bewegten; er musste bei dem Vergleich laut lachen. Aber sein Lachen dauerte nur kurz, denn es wurde rasch von einem Gedanken verdrängt, der ihm noch vor drei Wochen undenkbar gewesen wäre. Er hatte alle Hoffnung aufgegeben, England je wieder zu sehen. Doch jetzt war es bereits durchaus möglich, dass sich das ändern würde – durch den Fremden.
Wenn seine Prognose nicht falsch war, konnte es jeden Tag geschehen, jede Stunde, jede Minute. Die Wunden an den Beinen und auf der Brust waren tief und wären möglicherweise sogar tödlich gewesen, wenn die Kugeln nicht da geblieben wären, wo sie sich eingenistet hatten, vom salzigen Meerwasser gesäubert. Sie herauszuholen war bei weitem nicht so gefährlich, wie es hätte sein können, denn das Gewebe drum herum war aufgeweicht und ohne Infekt. Das eigentliche Problem war die Kopfwunde; nicht nur, weil die Kugel in den Schädel gedrungen war, sondern weil sie allem Anschein nach den Thalamus und das Ammonshorn des Gehirns verletzt hatte. Wäre das Projektil auch nur wenige Millimeter weiter links oder rechts eingedrungen, hätte das den sofortigen Tod bedeutet. So aber waren alle wichtigen Lebensfunktionen unversehrt geblieben. Washburn hatte seine Entscheidung getroffen. Er blieb sechsunddreißig Stunden trocken, aß so viel Stärke und trank so viel Wasser, wie nur menschenmöglich war. Dann wagte er sich an den heikelsten Eingriff, den er seit seiner Entlassung aus dem Macleans Hospital in London durchgeführt hatte. Millimeter für Millimeter wusch er mit einem Pinsel die Gewebepartien aus, spannte dann die Haut und nähte sie über der Kopfwunde zusammen. Dabei war er sich bewusst, dass der geringste Fehler, sei es nun mit dem Pinsel, der Nadel oder der Klammer, den Tod des Patienten verursachen würde.
Er hatte aus den verschiedensten Gründen nicht gewollt, dass dieser Unbekannte starb, besonders aus einem nicht.
Als nach dem Eingriff die Lebenszeichen konstant blieben, widmete sich Dr. Geoffrey Washburn wieder seiner chemischen und psychischen Lebensstütze, dem Alkohol. Er hatte sich voll laufen lassen und soff auch weiterhin, hatte aber vor dem absoluten Blackout Halt gemacht. Er wusste die ganze Zeit genau, wo er war und was er tat. Das war ganz entschieden ein Fortschritt.
Jeden Tag, jede Stunde, konnten die Augen des Fremden wieder klar werden und verständliche Worte über seine Lippen kommen.
Jeden Augenblick vielleicht.
Die Worte kamen zuerst. Sie schwebten in der Luft, als die frühe Morgenbrise, die von der See hereinwehte, das Zimmer abkühlte.
»Wer ist da? Wer ist in diesem Zimmer?«
Washburn setzte sich auf, schwang die Beine lautlos über den Bettrand und erhob sich langsam. Es war jetzt wichtig, den Patienten nicht zu erschrecken, kein plötzliches Geräusch zu erzeugen oder eine Bewegung, die den Patienten verängstigen könnte. Die nächsten paar Minuten würden ebenso delikat sein wie vorher der chirurgische Eingriff. Der Arzt in ihm war auf diesen Augenblick vorbereitet.
»Ein Freund«, sagte er mit weicher Stimme.
»Freund?«
»Sie sprechen englisch. Das hatte ich angenommen. Amerikaner oder Kanadier, hatte ich vermutet. Die Technik Ihrer Zahnversorgung kommt nicht aus England oder Paris. Wie fühlen Sie sich?«
»Ich weiß nicht genau.«
»Das wird eine Weile dauern. Müssen Sie Ihren Darm erleichtern?«
»Was?«
»Ich habe gefragt, ob Sie kacken müssen, alter Junge. Dafür ist die Schüssel neben Ihnen. Die weiße, links von Ihnen. Wenn wir es rechtzeitig schaffen, natürlich.«
»Tut mir Leid.«
»Nicht nötig. Eine ganz normale Funktion. Ich bin Arzt, Ihr Arzt. Ich heiße Geoffrey Washburn. Und Sie?«
»Was?«
»Ich habe Sie gefragt, wie Sie heißen.«
Der Fremde bewegte den Kopf und starrte die weiße Wand an, auf der sich Strahlen des Morgenlichts abzeichneten. Dann wandte er sich wieder um und seine blauen Augen blickten den Arzt an. »Ich weiß nicht.«
»O mein Gott!«
»Ich habe es Ihnen immer wieder gesagt. Es dauert eine Weile. Je mehr Sie dagegen ankämpfen, desto schwerer machen Sie es sich, desto schlimmer wird es.«
»Sie sind betrunken.«
»Ja, im Allgemeinen schon. Aber das tut hier nichts zur Sache. Nur wenn Sie mir zuhören, kann ich Ihnen Ratschläge geben.«
»Ich habe zugehört.«
»Nein, das tun Sie nicht; Sie wenden sich ab. Sie liegen in Ihrem Kokon da und kapseln sich ab.«
»Also, ich höre.«
»Während Ihres langen Komas redeten Sie in drei verschiedenen Sprachen: in Englisch, Französisch und in irgendeiner gottverdammten Singsangsprache, die ich für orientalisch halte. Das bedeutet, dass Sie in verschiedenen Teilen der Welt zu Hause sind. Welche Sprache fällt Ihnen am leichtesten?«
»Offensichtlich Englisch.«
»Darauf haben wir uns ja geeinigt. Und welche ist demnach die schwierigste für Sie?«
»Ich weiß nicht.«
»Ihre Augen sind rund, nicht oval. Ich würde also sagen, die orientalische Sprache.«
»Offensichtlich.«
»Warum sprechen Sie sie dann? Versuchen Sie jetzt einmal bei folgenden Worten zu assoziieren. Ich werde sie phonetisch aussprechen: Ma-kwa, Tam-kwan, Kee-sah. Sagen Sie das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt.«
»Nichts.«
»Eine gute Show.«
»Was, zum Teufel, wollen Sie?«
»Irgendetwas.«
»Sie sind betrunken.«
»Das hatten wir bereits festgestellt. Das bin ich immer. Ich hab Ihnen auch Ihr verdammtes Leben gerettet. Betrunken oder nicht – ich bin Arzt. Früher war ich sogar ein sehr guter.«
»Was ist passiert?«
»Der Patient befragt den Arzt?«
»Warum nicht?«
Washburn hielt inne, überlegte und blickte zum Fenster hinaus aufs Meer. »Man hat mich beschuldigt«, sagte er schließlich, »ich hätte zwei Patienten auf dem Operationstisch getötet, weil ich betrunken war. Mit einem hätte ich durchkommen können. Nicht mit zweien. Die schließen sehr schnell von einem Fall auf den anderen. Gott sei ihnen gnädig. Geben Sie einem Mann wie mir nie ein Messer.«
»Musste das sein?«
»Was?«
»Die Flasche.«
»Ja, verdammt«, sagte Washburn leise und wandte sich vom Fenster ab. »So war es und so ist es. Und der Patient ist nicht befugt, über den Arzt ein Urteil abzugeben.«
»Verzeihung.«
»Sie haben auch eine penetrante Art, sich zu entschuldigen. In Wirklichkeit ist das nur überdrehter Protest und keineswegs natürlich. Ich glaube keinen Augenblick, dass Sie der Typ sind, der sich für irgendetwas entschuldigt.«
»Dann wissen Sie mehr, als ich weiß.«
»Über Sie, ja. Eine ganze Menge sogar. Und nur sehr wenig davon reimt sich zusammen.«
Der Mann im Stuhl rutschte nach vorn. Sein offenes Hemd löste sich und man konnte die Bandagen auf der Brust sehen. Er faltete die Hände und die Venen an seinen schlanken, muskulösen Armen traten hervor. »Meinen Sie Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben?«
»Ja.«
»Dinge, die ich sagte, als ich im Koma lag?«
»Nein, eigentlich nicht. Den größten Teil von dem Quatsch haben wir schon erörtert: die verschiedenen Sprachen, Ihre geografischen Kenntnisse – Städte, die ich nicht kenne; von manchen habe ich kaum je gehört –, Ihre fixe Idee, keine Namen zu nennen; Namen, die Sie sagen möchten, aber dann doch nicht aussprechen; Ihre Neigung zur Konfrontation: Angriff, Rückzug, Flucht – alles ziemlich gewalttätig, darf ich vielleicht hinzufügen. Ich habe Ihnen die Arme häufig festgeschnallt, um die Wunden zu schützen. Aber all das haben wir ja beredet. Es gibt da andere Dinge.«
»Welche anderen Dinge? Warum haben Sie nichts davon erwähnt?«
»Weil sie physischer Natur sind. Die äußere Schale sozusagen. Ich war nicht sicher, ob Sie schon so weit waren, sich das anzuhören. Ich habe auch jetzt noch Zweifel.«
Der Mann lehnte sich im Stuhl zurück. Die dunklen Augenbrauen unter dem dunkelbraunen Haar schoben sich in der Mitte zusammen. »Jetzt ist das Urteil des Arztes nicht gefragt. Ich bin bereit. Wovon sprechen Sie?«
»Wollen wir mit diesem ziemlich akzeptabel aussehenden Kopf anfangen, den Sie haben? Insbesondere Ihrem Gesicht?«
»Was ist damit?«
»Es ist nicht das Gesicht, mit dem Sie auf die Welt gekommen sind.«
»Was soll das heißen?«
»Gesichtschirurgische Operationen hinterlassen immer Spuren. Man hat Sie verändert, alter Junge.«
»Verändert?«
»Sie haben ein ausgeprägtes Kinn; ich würde sagen, dass es einmal gespalten war. Man hat das Grübchen entfernt. Ihr linker oberer Backenknochen – Ihre Backenknochen sind auch ausgeprägt, wahrscheinlich slawischen Ursprungs – hat winzige Spuren einer chirurgischen Narbe. Vermutlich hat man dort einen Leberfleck entfernt. Ihre Nase war früher einmal länger als heute. Und dann hat man sie schlanker gemacht und Ihre scharfen Gesichtszüge weicher. So hat man Ihren Ausdruck völlig verändert. Verstehen Sie, was ich sage?«
»Nein.«
»Sie sind ein einigermaßen attraktiver Mann, aber Ihr Gesicht wird durch die Kategorie, in die es fällt, mehr hervorgehoben als durch seine Eigenarten selbst.«
»Kategorie?«
»Ja. Sie sind der Prototyp des weißen Angelsachsen, den die Leute jeden Tag beim Cricket oder auf dem Tennisplatz beobachten können. Diese Gesichter lassen sich kaum voneinander unterscheiden, nicht wahr? Die Zähne sind gerade, die Ohren liegen flach am Kopf an. Nichts ist aus dem Gleichgewicht, alles ist am richtigen Platz, und die Züge sind ein wenig weich.«
»Weich?«
»Nun, ›verwöhnt‹ wäre vielleicht ein besseres Wort. Jedenfalls verraten sie Selbstbewusstsein, sogar Arroganz. Wer so aussieht, ist gewohnt, dass alles so läuft, wie er es wünscht.«
»Ich glaube, ich weiß immer noch nicht, worauf Sie hinauswollen.«
»Dann wollen wir es anders herum versuchen. Wenn Sie Ihr Haar färben, verändern Sie damit das Gesicht. Eine Brille oder ein Bart bewirkt das Gleiche. Ich schätze, dass Sie Mitte bis Ende dreißig sind, aber Sie könnten auch zehn Jahre älter oder fünf jünger sein.«
Washburn hielt inne und beobachtete die Reaktionen des Mannes, so als überlegte er, ob er fortfahren solle oder nicht. »Und weil wir gerade von der Brille sprechen, erinnern Sie sich an die Übungen, die Proben, die wir vor einer Woche machten?«
»Natürlich.«
»Ihre Sehkraft ist völlig normal, sie brauchen keine Brille.«
»Das hatte ich auch nicht angenommen.«
»Warum geben dann Ihre Netzhaut und Ihre Lider Hinweise darauf, dass Sie längere Zeit Kontaktlinsen getragen haben?«
»Keine Ahnung. Mir leuchtet das nicht ein.«
»Darf ich eine mögliche Erklärung vorschlagen?«
»Ich würde sie gerne hören.«
»Vielleicht auch nicht.« Der Arzt ging zum Fenster und blickte hinaus. »Bestimmte Kontaktlinsen sind so beschaffen, dass sie die Augenfarbe verändern. Und gewisse Arten von Augen eignen sich besser als andere dafür: gewöhnlich solche von grauer oder bläulicher Farbe. Die Ihren liegen dazwischen. Einmal sind sie braun-grau, ein anderes Mal wirken sie blau-grau. Die Natur hat Sie in dieser Hinsicht begünstigt; es war weder möglich noch notwendig, eine Änderung vorzunehmen.«
»Wofür notwendig?«
»Um Ihr Aussehen zu verändern. Sehr professionell, würde ich sagen. Visum, Pass, Führerschein – alles beliebig austauschbar. Haar: braun, blond, brünett. Augen – an denen kann man nichts ändern – grün, grau, blau. Ziemlich weitreichende Möglichkeiten, finden Sie nicht auch? Und alles innerhalb jener erkennbaren Kategorie, in der die Gesichter sich so häufig wiederholen.«
Der Mann erhob sich mit einiger Mühe aus dem Stuhl, er musste sich dazu mit den Armen auf die Stuhllehne stützen und hielt beim Aufstehen den Atem an. »Es ist auch möglich, dass Sie sich da etwas einbilden. Sie könnten sich irren.«
»Die Spuren sind da, die Narben. Das reicht als Beweis.«
»Von Ihnen so gedeutet, und zwar mit ziemlich viel Zynismus. Angenommen, ich hätte einen Unfall gehabt und wäre zusammengeflickt worden – das würde es auch erklären.«
»Nicht die Art der Behandlung, die Sie hinter sich haben. Dazu braucht man weder das Haar zu färben noch Leberflecken oder Grübchen im Kinn zu entfernen.«
»Das wissen Sie doch nicht«, sagte der Mann ärgerlich. »Es gibt verschiedene Arten von Unfällen, verschiedene Behandlungsmethoden. Sie waren nicht dabei, Sie können das nicht mit Sicherheit behaupten.«
»Gut! Werden Sie ruhig wütend auf mich. Sie tun das ohnehin nicht oft genug. Und während Sie wütend sind, denken Sie. Was waren Sie? Was sind Sie?«
»Handelsvertreter ... Leitender Angestellter einer internationalen Firma, der sich auf den Fernen Osten spezialisiert hatte. Das könnte es sein. Oder Lehrer ... Sprachen. Irgendwo an einer Universität. Das ist auch möglich.«
»Schön. Wählen Sie. Jetzt!«
»Ich ... das kann ich nicht.« Die Augen des Mannes wirkten etwas hilflos.
»Weil Sie es selbst nicht glauben.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein. Glauben Sie es?«
»Auch nicht«, sagte Washburn. »Aus einem ganz bestimmten Grund. Diese Berufe sind in der Regel an einen festen Standort gebunden. Sie aber haben den Körper eines Mannes, den man physischem Stress ausgesetzt hat. Oh, ich meine nicht einen trainierten Athleten oder so etwas; das sind Sie nicht. Aber Ihre Arme und Hände sind Anstrengung gewöhnt und recht kräftig. Unter anderen Gegebenheiten würde ich Sie für einen Arbeiter halten, der schwere Gegenstände zu tragen hat, oder für einen Fischer, der Tag für Tag Netze einzieht. Aber Ihre Bildung und Ihr Intellekt schließen das mit Sicherheit aus.«
»Warum denke ich, dass Sie auf etwas anderes hinauswollen?«
»Weil wir unter gewissem Druck eng miteinander gearbeitet haben, und das seit einigen Wochen. Sie haben meine Methode erkannt.«
»Dann habe ich also Recht?«
»Ja. Ich musste sehen, wie Sie das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, aufnehmen würden: die chirurgische Behandlung, das Haar, die Kontaktlinsen.«
»Und habe ich Ihren Test bestanden?«
»Mit einem Gleichmut, der einen wahnsinnig machen kann. Die Zeit ist jetzt da; es hat keinen Sinn, es länger hinauszuschieben. Offen gestanden fehlt mir dazu auch die Geduld. Kommen Sie mit.« Washburn ging voraus durchs Wohnzimmer, zu der Türe an der hinteren Wand, die in seinen Praxisraum führte. Dort holte er aus einer Ecke einen uralten Projektor heraus, dessen Objektivfassung verrostet und zerbeult war. »Ich habe mir den Apparat mit den Lebensmitteln aus Marseille bringen lassen«, sagte er, während er das Gerät auf den kleinen Tisch stellte und es anschloss. »Nicht gerade der beste Apparat, aber seinen Zweck erfüllt er. Ziehen Sie bitte die Vorhänge zu.«
Der Mann ohne Namen und ohne Gedächtnis trat ans Fenster und zog die Gardinen zu. Jetzt war es dunkel im Raum. Washburn knipste die Lampe des Projektors an; an der weißen Wand erschien ein helles Quadrat. Dann schob er ein kleines Stück Zelluloid hinter die Linse.
Plötzlich tauchten in dem beleuchteten Quadrat Buchstaben auf.
GEMEINSCHAFTSBANKBAHNHOFSTRASSE ZÜRICH.NULL-SIEBEN-SIEBZEHN-ZWÖLF-NULL-VIERZEHN-SECHSUNDZWANZIG-NULL.
»Was ist das?«, fragte der namenlose Mann.
»Sehen Sie es sich genau an. Denken Sie.«
»Das ist irgendein Bankkonto.«
»Genau. Der gedruckte Briefkopf und die Adresse – das ist die Bank; die handgeschriebenen Ziffern stehen hier anstelle eines Namens, aber da sie ausgeschrieben sind, stellen sie die Unterschrift des Kontobesitzers dar. Die übliche Vorgehensweise.«
»Woher haben Sie das?«
»Von Ihnen. Das ist ein sehr kleines Negativ. Es war unter der Haut über Ihrer rechten Hüfte eingesetzt – chirurgisch implantiert. Die Nummern sind in Ihrer Handschrift geschrieben; das ist Ihre Unterschrift. Damit können Sie einen Safe in Zürich öffnen.«
2.
Sie wählten den Namen Jean-Pierre. Er war so geläufig in Port Noir wie jeder andere.
Und dann wurden Bücher aus Marseille ins Haus geschickt, sechs an der Zahl, die sich in der Größe unterschieden. Vier waren in englischer Sprache, zwei in französischer. Es handelte sich um medizinische Fachbücher, die sich mit Kopf- und Hirnverletzungen befassten und mit Querschnitten durch das menschliche Gehirn illustriert waren. Hunderte von unbekannten Fachausdrücken mussten aufgenommen und in ihrer Bedeutung verstanden werden.
Die Bände enthielten auch psychologische Studien von emotionellen Stress-Situationen, die zu Hysterie und zum Verlust der Sprechfähigkeit führen, Zustände, die auch partiellen oder völligen Gedächtnisschwund zur Folge haben können, medizinisch Amnesie genannt.
»Es gibt keine Regeln«, sagte der dunkelhaarige Mann und rieb sich die Augen in dem zu schwachen Licht der Tischlampe. »Das ist wie ein geometrisches Puzzle; Amnesie kann in einer Vielzahl von Kombinationen entstehen, mit physischen oder psychischen Reaktionen – oder ein klein wenig von beidem. Sie tritt permanent oder temporär in Erscheinung. Wie gesagt, man kann keine festen Regeln aufstellen.«
»Richtig!«, sagte Washburn und nippte an seinem Whiskey. »Ich glaube, wir kommen der Sache jetzt langsam näher. So wie ich denke, dass sie sich abgespielt hat.«
»Nämlich wie?«, fragte der Mann interessiert.
»Sie sagten es gerade selbst: ›ein klein wenig von beidem‹. Nur sollte die Formulierung ›ein klein wenig‹ besser in ›massiv‹ geändert werden. Durch massive Schocks.«
»Massive Schocks?«
»In physischer und psychischer Hinsicht. Die Schocks hatten einen direkten Zusammenhang, waren ineinander verwoben – zwei Erlebnisketten oder Stimuli, die zusammenschmolzen.«
»Wie viel haben Sie getrunken?«
»Weniger als Sie glauben; unbedeutend.« Der Arzt griff nach einem Block. »Das hier ist Ihre Geschichte – Ihre neue Geschichte –, angefangen mit dem Tag, an dem man Sie hierher gebracht hat. Lassen Sie mich zusammenfassen: Die physischen Wunden lassen erkennen, dass die Situation, in der Sie sich befanden, mit größtem Stress für Sie verbunden war. Die Hysterie, die sich dann entwickelte, wurde dadurch verursacht, dass Sie mindestens neun Stunden im Wasser trieben, was natürlich die psychische Belastung verstärkte. Die Finsternis, die heftigen Bewegungen, wobei die Lungen kaum genug Luft bekamen – all dies hat die Hysterie gefördert. Was ihr vorausging, musste aus der Erinnerung gelöscht werden, damit Sie mit dem Trauma fertig werden und überleben konnten. Sind Sie in der Lage, mir zu folgen?«
»Ich glaube schon. Der Kopf hat sich geschützt.«
»Nicht der Kopf, das Bewusstsein! Die Unterscheidung ist wichtig. Wir kommen später auf den Kopf zurück, aber nennen wir ihn lieber ›das Gehirn‹.«
Washburn blätterte in seinen Papieren. »Ich habe hier ein paar hundert Beobachtungen festgehalten, unter anderem die üblichen medizinischen Anmerkungen – Medikamente, Dosis, Zeitpunkt, Reaktion –, aber im Wesentlichen befassen sich diese Aufzeichnungen mit Ihnen, dem Menschen selbst. Hier sind die Worte notiert, die Sie benutzen; die Worte, auf die Sie reagieren; die Sätze, die Sie gebrauchen, sowohl im Schlaf, als auch während Sie im Koma lagen. Selbst die Art und Weise, wie Sie gehen, wie Sie sprechen, wie Sie Ihren Körper anspannen, wenn Sie erschreckt werden oder etwas sehen, das Sie interessiert, habe ich beschrieben. Sie scheinen ein einziger Widerspruch zu sein. Unter der Oberfläche brodelt etwas Gewalttätiges, das Sie meistens unter Kontrolle haben, sich aber nicht zur Ruhe bringen lässt. Und dann ist da eine Nachdenklichkeit, die schmerzhaft für Sie zu sein scheint, und doch geben Sie dem Ärger, den jener Schmerz provozieren muss, nur selten freien Lauf.«
»Sie provozieren ihn jetzt«, sagte der Mann. »Wir sind die Worte und Sätze immer wieder durchgegangen.«
»Und wir werden damit fortfahren«, unterbrach ihn Washburn, »solange wir Fortschritte dabei erzielen.«
»Mir war nicht bewusst, dass irgendwelche Fortschritte zu verzeichnen sind.«
»Nicht in Bezug auf Ihre Identität oder Ihren Beruf. Aber wir sind im Begriff herauszufinden, was für Sie am bequemsten ist, womit Sie am besten zurechtkommen. Das ist fast etwas beängstigend.«
»In welcher Hinsicht?«
»Lassen Sie mich ein Beispiel nennen.« Der Arzt legte den Block weg und erhob sich. Er trat an einen Schrank, öffnete eine Schublade und entnahm ihr eine große Automaticpistole. Der Mann ohne Erinnerung erstarrte in seinem Stuhl; Washburn bemerkte die Reaktion. »Ich habe sie noch nie benutzt und bin nicht einmal sicher, ob ich dazu im Stande wäre, aber immerhin lebe ich hier am Wasser.« Er lächelte und warf die Waffe dem Mann plötzlich und ohne Vorwarnung zu. Er fing sie geschickt in der Luft auf, ohne einen Moment gezögert zu haben. »Zerlegen Sie sie; so nennt man das doch, glaube ich.«
»Was?«
»Zerlegen sollen Sie das Ding. Jetzt.«
Der Mann sah die Pistole prüfend an. Und dann huschten seine Hände und Finger lautlos und fachmännisch über die Waffe. In weniger als dreißig Sekunden war sie in ihre Bestandteile zerlegt. Er blickte auf.
»Verstehen Sie, was ich meine?«, sagte Washburn. »Zu Ihren Fertigkeiten gehört eine ungewöhnliche Kenntnis von Feuerwaffen.«
»Durchs Militär?«, fragte der Mann mit eindringlicher Stimme.
»Höchst unwahrscheinlich«, erwiderte der Arzt. »Als Sie zum ersten Mal aus dem Koma erwachten, erwähnte ich Ihre Zähne. Ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Zahnreparaturen nicht von Militärärzten vorgenommen wurden. Und dann natürlich die chirurgische Behandlung; die schließt praktisch jede Beziehung zum Militär mit größter Wahrscheinlichkeit aus.«
»Was dann?«
»Wir wollen uns jetzt nicht damit beschäftigen; kümmern wir uns lieber um das, was geschehen ist. Wir waren mit dem Bewusstsein befasst, erinnern Sie sich? Mit dem Stress, der Hysterie. Drücke ich mich klar genug aus?«
»Weiter.«
»In dem Maße, wie der Schock nachlässt, tut das auch der psychische Druck, bis kein fundamentales Bedürfnis mehr besteht, die Psyche zu schützen. Und während dieses Prozesses werden Ihnen Ihre Fertigkeiten und Talente wieder zurückfließen. Sie werden sich an gewisse Verhaltensmuster erinnern; es kann sein, dass Sie sie auf ganz natürlichem Wege erleben und instinktiv reagieren. Aber es gibt da eine Lücke, und alles, was auf diesen Seiten hier steht, bestätigt mir, dass diese Lücke nie mehr zu schließen sein wird.« Washburn hielt inne und ging zu seinem Stuhl zurück.
»Weiter!«, flüsterte der Mann.
Der Arzt sah seinem Patienten fest in die Augen. »Kommen wir zurück zum Kopf, den wir mit dem Etikett ›Gehirn‹ versehen haben. Das physische Gehirn besitzt Millionen und Abermillionen von Zellen. Sie haben die Fachbücher gelesen. Der geringste Eingriff kann dramatische Folgen mit sich bringen. Und das ist Ihnen widerfahren. Der Schaden war physischer Natur. Es ist gerade so, als wären Blöcke neu angeordnet worden, als wäre die physische Struktur verändert worden.« Wieder hielt Washburn inne.
»Und?«, drängte der Mann.
»Der geringer werdende psychische Druck wird zulassen – lässt bereits zu –, dass Ihnen Ihre Fertigkeiten und Talente zurückgegeben werden. Aber ich glaube nicht, dass Sie jemals im Stande sein werden, sie mit irgendetwas in Ihrer Vergangenheit in Verbindung zu bringen.« »Warum nicht?« »Weil die Zellen im Gehirn, die jene Erinnerungen ermöglichen, verändert worden sind. Sie sind jetzt in dem Maße neu angeordnet, dass sie nicht mehr so funktionieren können, wie sie das einmal taten. Sie sind praktisch zerstört worden.«
Der Mann saß wie gelähmt da. »Die Antwort liegt in Zürich«, sagte er.
»Noch nicht. Sie sind noch nicht so weit. Noch sind Sie nicht stark genug.«
»Das werde ich aber sein.«
»Ja, das werden Sie.«
Die Wochen verstrichen; die Wortübungen dauerten an, die Zahl der beschriebenen Seiten auf dem Block des Arztes wurde immer größer, und schließlich kehrten die Kräfte des Mannes zurück. Es war an einem Morgen der neunzehnten Woche, der Tag war freundlich, und das Mittelmeer lag ruhig da und glänzte. Der Mann war die letzte Stunde, so wie er sich das angewöhnt hatte, am Wasser entlanggelaufen und dann die Hügel hinauf. Er hatte die Strecke inzwischen auf über zwölf Meilen pro Tag ausgedehnt, sein Tempo täglich gesteigert und immer seltener Ruhepausen eingelegt. Jetzt saß er auf dem Stuhl am Schlafzimmerfenster und atmete schwer. Schweiß tränkte sein Unterhemd. Er war durch die Hintertür hereingekommen und durch den finsteren Gang, der am Wohnzimmer vorbeiführte, ins Schlafzimmer gelangt. Es war einfach bequemer so; das Wohnzimmer diente Washburn als Wartezimmer, und da saßen noch ein paar Patienten, die versorgt werden mussten. Sie wirkten verstört und dachten wohl darüber nach, wie der Zustand von le docteur an diesem Morgen sein mochte. Tatsächlich war es nicht so schlimm. Geoffrey Washburn trank zwar immer noch wie ein wilder Kosak, aber in diesen Tagen hatte er sich immerhin einigermaßen unter Kontrolle. Es war, als hätte sich in den Tiefen seines eigenen zerstörerischen Fatalismus ein Rest an Hoffnung gefunden. Und der Mann ohne Gedächtnis begriff: Jene Hoffnung hing mit einer Bank in der Züricher Bahnhofstraße zusammen. Warum erinnerte er sich eigentlich so leicht an diese Straße?
Die Schlafzimmertür öffnete sich, und der Arzt platzte herein, sein weißer Kittel mit Blut beschmiert.
»Ich hab es geschafft!«, sagte er grinsend, und in seinen Worten klang Triumph. »Ich sollte eine Agentur für Arbeitsvermittlung aufmachen und von den Provisionen leben. Das wäre ein regelmäßigeres Einkommen.«
»Wovon reden Sie eigentlich?«
»Wir waren uns doch einig; es ist genau das, was Sie brauchen. Sie müssen nach außen hin in Erscheinung treten, und seit zwei Minuten ist Monsieur Jean-Pierre Namenlos gegen Bezahlung angestellt! Zumindest auf eine Woche.«
»Wie haben Sie das fertig gebracht? Ich dachte, es gäbe keine freien Stellen.«
»Als ich gerade eben Lamouches infiziertes Bein behandelte, erklärte ich ihm, dass mein Vorrat an lokalen Betäubungsmitteln verdammt gering sei. Wir feilschten; Sie waren das Handelsobjekt.«
»Eine Woche?«
»Wenn Sie gut sind, behält er Sie vielleicht.« Washburn hielt inne. »Obwohl das eigentlich gar nicht so schrecklich wichtig ist, oder?«
»Ich bezweifle, ob überhaupt irgendetwas davon wichtig ist. Vor einem Monat vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich bereit bin, von hier wegzugehen. Ich hätte gedacht, dass Sie das auch wollen. Ich habe eine Verabredung in Zürich.«
»Und ich würde es vorziehen, wenn Sie bei dieser Verabredung so fit wären wie nur irgend möglich. Meine Interessen sind höchst egoistisch. Ich kann nicht zulassen, dass Sie einen Rückfall erleiden.«
»Ich bin bereit.«
»Oberflächlich vielleicht. Aber glauben Sie mir, es ist für Sie lebenswichtig, dass Sie längere Zeit auf dem Wasser verbringen, auch nachts. Nicht unter komfortablen Umständen wie ein Passagier, sondern harten Bedingungen ausgesetzt – je härter, desto besser.«
»Wieder ein Test?«
»Jeder Test, den ich in Port Noir arrangieren kann, ist mir recht. Wenn ich hier einen Sturm und einen kleinen Schiffbruch heraufbeschwören könnte, würde ich das für Sie tun. Andererseits ist Lamouche selbst so etwas wie ein Sturm; er ist ein schwieriger Mann. Sobald die Schwellung an seinem Bein zurückgegangen ist, wird er über Ihre Anwesenheit verärgert sein. Andere werden auch so reagieren. Sie müssen für jemanden einspringen.«
»Danke für Ihre Bemühung.«
»Gern geschehen. Wir kombinieren hier zwei Stress-Situationen. Wenigstens ein oder zwei Nächte auf dem Wasser, wenn Lamouche seinen Zeitplan einhält – das ist die feindliche Umgebung, die zu Ihrer Hysterie beigetragen hat –, und schließlich werden Sie der Ablehnung und dem Argwohn Ihrer Umgebung ausgesetzt sein – symbolisch für die ursprüngliche Stress-Situation.«
»Noch einmal vielen Dank. Angenommen, die beschließen, mich über Bord zu werfen?«
»Oh, dazu wird es nicht kommen«, sagte Washburn und runzelte die Stirn.
»Ich bin froh, dass Sie so zuversichtlich sind. Ich wünschte, ich wäre es auch.«
»Das können Sie sein. Sie genießen den Schutz meiner Anwesenheit. Ich bin zwar weder Christiaan Barnard noch Michael De Bakey, aber diese Leute brauchen mich; die riskieren nicht, mich zu verlieren.«
»Sie wollen doch hier weg, denke ich, und ich bin Ihr Reisepass.«
»Auf eine Art und Weise, die niemand durchschaut, mein lieber Patient. Los jetzt! Lamouche möchte, dass Sie zum Hafen hinuntergehen, damit Sie sich mit seinen Geräten vertraut machen können. Sie beginnen morgen früh um vier Uhr. Denken Sie immer daran, wie nützlich eine Woche auf See sein wird. Betrachten Sie es als Kreuzfahrt.«
Eine Kreuzfahrt wie diese hatte es noch nie gegeben. Der Skipper des schmutzigen, öldurchtränkten Fischerboots war die übellaunige Kopie eines unbedeutenden Captain Bligh; die Mannschaft ein Quartett von Tunichtguten – ohne Zweifel die einzigen Männer in ganz Port Noir, die bereit waren, Claude Lamouche zu ertragen. Eigentlich gehörte noch ein fünftes Mitglied zur Mannschaft, der Bruder des zweiten Mannes an Bord. Diese Tatsache wurde dem Mann, den man Jean-Pierre nannte, binnen weniger Minuten nach Verlassen des Hafens um vier Uhr morgens klar gemacht.
»Du nimmst meinem Bruder die Arbeit weg!«, fauchte der Fischer ärgerlich, während er an seiner Zigarette paffte, die unbeweglich in seinem Mundwinkel hing.
»Es ist ja nur für eine Woche«, entgegnete Jean-Pierre. Es wäre leichter gewesen – viel leichter – anzubieten, den jetzt arbeitslos gewordenen Bruder mit Washburns monatlichem Taschengeld zu entschädigen, aber der Arzt und sein Patient waren übereingekommen, solche Kompromisse zu unterlassen.
»Hoffentlich kannst du wenigstens mit den Netzen umgehen.«
Er verstand nichts davon.
In den nächsten 72 Stunden gab es Augenblicke, in denen der Mann namens Jean-Pierre dachte, er müsse doch auf die letzte Alternative zurückgreifen und sich mit Geld Ruhe verschaffen. Unablässig hackte man auf ihm herum, selbst während der Nacht – besonders dann. Als er an Deck auf der schmutzigen Matratze lag, hatte er das Gefühl, als wären Augen auf ihn gerichtet, die nur darauf warteten, dass er einschlief.
»Du! Übernimm die Wache! Der Maat ist krank. Du musst ihn vertreten.«
»Steh auf! Philippe schreibt seine Memoiren. Er darf nicht gestört werden.«
»Aufstehen! Du hast heute Nachmittag ein Netz zerrissen. Wir zahlen nicht für deine Dummheit. Darüber sind wir uns einig. Flicke es jetzt.«
Die Netze: Wenn für eine Seite zwei Männer benötigt wurden, so nahmen seine zwei Arme die Stelle von vier ein. Wenn er neben einem Mann arbeitete, dann ließ der die Last plötzlich los, und das ganze Gewicht ruhte auf ihm. Oder jemand stieß ihn mit der Schulter so an, dass er gegen die Schiffswand prallte und beinahe über Bord gefallen wäre.
Und Lamouche: ein hinkender Wahnsinniger, der jede Seemeile an der Zahl der Fische maß, die er verloren hatte. Seine Stimme klang wie ein schnarrendes Nebelhorn. Er sprach nie jemanden an, ohne irgendeinen obszönen Ausdruck vor den Namen zu setzen, eine Angewohnheit, die den Patienten in zunehmendem Maße wütender machte. Aber Lamouche rührte Washburns Patienten nicht an, er schickte dem Arzt nur auf seine Weise seine Botschaft: Tu mir das nie wieder an. Nicht, wenn es um mein Boot und meinen Fang geht. Lamouche wollte bei Sonnenuntergang des dritten Tages zurück in Port Noir sein. Nach dem Ausladen der Fische sollte die Mannschaft bis vier Uhr am nächsten Morgen Zeit bekommen, um auszuschlafen, herumzuhuren, sich zu betrinken oder mit etwas Glück die drei Beschäftigungen gleichzeitig auszuüben. Als sie Land sichteten, geschah es. Die Netze wurden vom Netzmann und seinem ersten Helfer mittschiffs eingezogen und zusammengefaltet. Das unwillkommene Mannschaftsmitglied, das sie ›Jean-Pierre Sangsue‹ (›Blutsauger‹) beschimpften, scheuerte das Deck mit einem langstieligen Schrubber. Die zwei übrigen Crewmitglieder schwappten Eimer mit Seewasser vor den Schrubber, wobei sie häufiger den Blutsauger als die Deckplanken trafen.
Ein voller Eimer wurde hochgeworfen und blendete Washburns Patienten einen Augenblick lang, sodass er das Gleichgewicht verlor. Der schwere Schrubber mit den metallähnlichen Borsten rutschte ihm aus der Hand und traf mit seinen scharfen Borsten den Schenkel des knienden Netzmannes.
»Verdammte Scheiße!«
»Tut mir Leid«, sagte der Übeltäter und wischte sich das Wasser aus den Augen.
»Der Teufel soll dich holen!«, schrie der andere.
»Ich habe gesagt, dass es mir Leid tut«, erwiderte der Mann namens Jean-Pierre. »Sag deinen Freunden, sie sollen das Deck nass machen, nicht mich.«
Der Netzmann stand auf, packte den Schrubberstiel und hielt ihn wie ein Bajonett vor sich. »Willst du spielen, Blutsauger?«
»Komm, gib her.«
»Mit Vergnügen, Blutsauger. Hier!« Der Netzmann stieß mit dem Schrubber zu, sodass die Borsten über Brust und Bauch des Patienten fuhren und sein Hemd durchdrangen.
Ob es nun die Berührung mit den Narben war, die seine Wunden bedeckten, oder die Wut nach drei Tagen Quälerei, würde der Mann nie erfahren. Er wusste nur, dass er reagieren musste. Und seine Reaktion erschreckte ihn mehr, als er sich hätte vorstellen können.
Er packte den Schrubberstiel mit der rechten Hand und trieb ihn dem Mann in den Leib. In dem Augenblick, da der andere nach vorne taumelte, trat er mit dem linken Fuß zu und traf den Mann an der Kehle.
»Tao!« Der gutturale Laut kam unwillkürlich über seine Lippen; er wusste nicht, was es bedeutete.
Und ehe er begriff, war er herumgewirbelt, und jetzt schoss sein rechter Fuß vor und bohrte sich in die linke Niere des Seemanns.
»Che-sah!«, keuchte er.
Sein Gegner fuhr zurück und warf sich, von Schmerz und Wut getrieben, nach vorne, die Hände wie Klauen ausgestreckt. »Du Schwein!«
Der Patient duckte sich; seine rechte Hand packte den anderen am linken Unterarm und riss ihn herunter. Dann schoss er in die Höhe und drückte dabei den Arm seines Opfers nach oben und drehte ihn herum. Als er ihn losließ, jagte er ihm den Absatz ins Kreuz. Der Franzose brach über dem Netz zusammen, sein Kopf prallte gegen die Reling.
»Mee-sah!« Wieder wusste er nicht, was sein halblauter Schrei bedeutete.
Ein Matrose umklammerte von hinten seinen Hals, worauf der Patient seinen rechten Ellbogen in den Leib seines Angreifers rammte. Jean-Pierre beugte sich vor, packte den Ellbogen rechts von seiner Kehle und duckte sich. Der Angreifer wurde in die Höhe gehoben; seine Beine strampelten in der Luft, als er über das Deck geschleudert wurde. Schließlich blieb sein Kopf neben den Zahnrädern einer Winde liegen.
Jetzt waren die zwei übrig gebliebenen Männer über ihm. Fäuste trommelten auf ihn ein. Der Patient griff nach dem Handgelenk eines Mannes, bog es nach unten und drehte es mit einer ruckartigen Bewegung nach links. Der Mann schrie auf – das Handgelenk war gebrochen.
Washburns Patient verschränkte die Finger beider Hände ineinander, schwang die Arme wie einen Vorschlaghammer in die Höhe und traf den Matrosen mit dem gebrochenen Handgelenk am Kinn. Der Mann wurde nach hinten geschleudert und brach auf dem Deck zusammen.
»Kwa-sah!« Das Flüstern hallte in den Ohren des Patienten nach.
Der vierte Mann schlich sich nach rückwärts davon.
Es war vorbei. Drei Angehörige von Lamouches Mannschaft waren besinnungslos, schwer für das bestraft, was sie getan hatten. Es war zweifelhaft, dass auch nur einer von ihnen um vier Uhr früh im Stande sein würde, ans Dock zu kommen.
Als Lamouche jetzt sprach, klang gleichermaßen Erstaunen und Verachtung in seinen Worten. »Ich weiß nicht, woher Sie kommen, aber Sie werden dieses Boot verlassen.«
Der Mann ohne Gedächtnis begriff die ungewollte Ironie in den Worten des Kapitäns. Ich weiß auch nicht, woher ich komme.
»Sie können nicht länger hier bleiben«, sagte Geoffrey Washburn, als er in das abgedunkelte Schlafzimmer trat. »Ich hatte ehrlich geglaubt, ich könnte verhindern, dass Sie ernsthaft angegriffen werden. Aber jetzt, wo Sie den Schaden angerichtet haben, bin ich nicht mehr in der Lage, Sie zu schützen.«
»Man hat mich provoziert.«
»In dem Maße? Ein Mann hat ein gebrochenes Handgelenk und Platzwunden am Hals und im Gesicht, die ich nähen muss. Ein anderer hat Platzwunden am Kopf, dazu eine schwere Gehirnerschütterung und eine Nierenverletzung, deren Ausmaß ich noch nicht kenne. Ganz zu schweigen von einem Tritt in den Unterleib, von dem die Hoden angeschwollen sind! Ich glaube, man nennt das Overkill.«
»Wenn es anders gelaufen wäre, dann wäre es nur ein ›Kill‹ gewesen und ich ein toter Mann.« Der Patient hielt inne, fuhr aber fort, ehe der Arzt das Wort ergreifen konnte. »Ich glaube, wir sollten miteinander reden. Es sind einige Dinge geschehen; mir sind andere Worte in den Sinn gekommen. Darüber sollten wir sprechen.«
»Das sollten wir, aber das können wir jetzt nicht. Es ist keine Zeit. Sie müssen sofort gehen. Ich habe Vorbereitungen getroffen.«
»Gleich?«
»Ja. Ich habe denen gesagt, dass Sie ins Dorf gegangen sind, wahrscheinlich um sich zu betrinken. Die Familien werden Sie jetzt suchen – jeder Bruder, Vetter und Schwager. Sie werden Messer mitbringen und Bootshaken, vielleicht auch Pistolen. Und wenn sie Sie nicht finden, werden sie hierher zurückkommen. Die werden nicht eher ruhen, bis sie Sie aufgespürt haben.«
»Wegen eines Kampfes, den ich nicht angefangen habe?«
»Weil Sie drei Männer verletzt haben, die zusammen wenigstens einen Monat Lohn verlieren werden. Und dann noch aus einem anderen Grund, der viel wichtiger ist.«
»Und welcher ist das?«
»Die Demütigung. Ein Fremder hat sich nicht nur einem, sondern gleich drei hoch geachteten Fischern von Port Noir überlegen gezeigt.«
»Hoch geachteten?«
»Was ihre körperliche Kraft anbetrifft. Lamouches Mannschaft gilt als die schlagkräftigste im ganzen Dorf.«
»Das ist lächerlich.«
»Für die nicht. Das ist ihr Ehrgefühl ... Jetzt beeilen Sie sich! Packen Sie Ihre Sachen. Ein Boot aus Marseille liegt im Hafen; der Kapitän hat sich bereit erklärt, Sie mitzunehmen und Sie eine halbe Meile nördlich von La Ciotat abzusetzen.«
Der Mann ohne Gedächtnis hielt den Atem an. »Dann ist es Zeit«, sagte er leise.
»Allerdings«, erwiderte Washburn. »Ich ahne, was Sie jetzt verspüren: Ein Gefühl der Hilflosigkeit, ein Gefühl, im Meer zu treiben, ohne Ruder, das Sie auf Kurs bringt. Ich war Ihr Ruder, und ich werde nicht bei Ihnen sein; daran kann ich nichts ändern. Aber glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass Sie nicht hilflos sind. Sie werden Ihren Weg finden.«
»Nach Zürich«, fügte der Patient hinzu.
»Nach Zürich«, pflichtete der Arzt ihm bei. »Hier, ich habe Ihnen in diesem Öltuch ein paar Dinge eingewickelt. Schnallen Sie es sich um die Hüfte.«
»Was ist da drin?«
»Sämtliches Geld, das ich habe; etwa zweitausend Franc. Es ist nicht viel, aber immerhin können Sie damit was anfangen. Und mein Pass, falls er Ihnen nützt. Wir haben etwa das gleiche Alter. Er ist bereits vor acht Jahren ausgestellt worden. Lassen Sie ihn von niemandem genau ansehen. Es ist nur ein offizielles Papier.«
»Und was werden Sie tun?«
»Falls ich nichts mehr von Ihnen hören sollte, werde ich ihn schon nicht mehr brauchen.«
»Sie sind ein anständiger Mann.«
»Ich glaube, das sind Sie auch ... so wie ich Sie kennen gelernt habe, aber ich habe Sie natürlich vorher nicht gekannt. Für jenen Mann kann ich mich also nicht verbürgen. Ich wünschte, ich könnte das, aber es geht einfach nicht.«
Der Mann lehnte an der Reling und verfolgte, wie die Lichter von Ile de Port Noir in der Ferne verblassten. Das Fischerboot steuerte in die Dunkelheit hinein, so wie er vor fast fünf Monaten in die Finsternis gestürzt war ... und jetzt in eine neue Finsternis fiel.
3.
An der Küste Frankreichs waren keine Lichter zu sehen. Der fahle Schein des sterbenden Mondes beleuchtete das felsige Ufer nur in seinen Umrissen. Sie waren zweihundert Meter vom Land entfernt und das Boot tanzte leicht in der schwachen Strömung der Bucht. Der Kapitän deutete über die Reling: »Dort, zwischen den beiden Felsvorsprüngen, ist ein kleiner Uferstreifen. Nicht sehr breit. Sie erreichen ihn, wenn Sie rechts hinüberschwimmen. Wir können nur noch ein Stückchen weiter landeinwärts treiben, nicht mehr. In ein, zwei Minuten haben wir die Stelle erreicht.«
»Sie tun mehr, als ich erwarten durfte. Dafür danke ich Ihnen.«
»Nicht nötig. Ich bezahle meine Schulden.«
»Und dazu diene ich Ihnen?«
»Ja. Der Arzt in Port Noir hat nach diesem wahnsinnigen Sturm vor fünf Monaten drei von meiner Mannschaft zusammengeflickt. Sie waren nicht der Einzige, den man damals hereingebracht hat, wissen Sie.«
»Sie kennen mich?«
»Sie lagen kalkweiß auf dem Tisch, aber ich kenne Sie nicht und will Sie auch nicht kennen. Ich hatte damals kein Geld, keinen Fang; der Arzt meinte, ich könnte bezahlen, wenn die Umstände besser wären. Mit Ihnen begleiche ich nur meine Schulden.«
»Ich brauche Papiere«, sagte der Mann, der eine Chance auf Hilfe witterte, »eine Änderung in einem Pass.«
»Warum erzählen Sie das mir?«, fragte der Kapitän. »Ich habe versprochen, nördlich von La Ciotat ein Paket abzuladen. Nicht mehr.«
»Das hätten Sie nicht gesagt, wenn Sie nicht auch zu anderen Dingen im Stande wären.«
»Ich werde Sie nicht nach Marseille bringen. Das Risiko, von einem Streifenboot erwischt zu werden, werde ich nicht eingehen. Die Sürete hat überall im Hafen ihre Leute, die Rauschgiftfahnder sind wie die Wilden. Entweder besticht man sie, oder man verbringt zwanzig Jahre in einer Zelle.«
»Das bedeutet, dass ich in Marseille Papiere bekommen kann. Und Sie können mir helfen.«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Doch, das haben Sie. Ich brauche Hilfe, und die finde ich an einem Ort, an den Sie mich nicht bringen wollen – aber es gibt dort jemanden, der helfen kann. Das haben Sie angedeutet.«
»Was?«
»Dass Sie in Marseille mit mir reden würden, wenn ich ohne Sie dorthin komme. Nennen Sie mir den Ort.«
Der Kapitän des Fischerboots studierte das Gesicht des Patienten; die Entscheidung fiel ihm nicht leicht, aber er traf sie. »Es gibt ein Café an der Rue Sarrasin, südlich des alten Hafens: ›Le Bouc de Mer‹. Ich werde heute Abend zwischen neun und elf dort sein. Sie werden Geld benötigen. Einen Teil der geforderten Summe wird man im Voraus verlangen.«
»Wie viel?«
»Das liegt bei Ihnen und dem Mann, mit dem Sie verhandeln.«
»Ich brauche einen Anhaltspunkt.«
»Es ist billiger, wenn Sie einen Pass haben, den man fälschen kann; andernfalls muss man einen stehlen.«
»Ich sagte Ihnen, dass ich einen habe.«
Der Kapitän zuckte die Achseln. »Fünfzehnhundert, zweitausend Franc.«
Der Patient dachte an das in Öltuch gewickelte Päckchen, das er bei sich trug. In Marseille wurde er womöglich von der Polizei aufgegriffen, dafür hatte er aber auch die Chance, einen geänderten Pass zu bekommen, mit dem er nach Zürich reisen konnte. »Wird gemacht«, sagte er, ohne zu wissen, weshalb es so zuversichtlich klang. »Heute Abend also.«
Der Kapitän spähte zu dem schwach beleuchteten Küstenstreifen hinüber. »So, weiter können wir jetzt nicht mehr ans Ufer treiben. Sie sind jetzt auf sich gestellt. Vergessen Sie nicht: Sollten wir uns nicht in Marseille treffen, sind wir uns niemals begegnet, klar? Und aus meiner Mannschaft hat Sie auch keiner gesehen.«
»Ich werde dort sein. ›Le Bouc de Mer‹, Rue Sarrasin, südlich vom alten Hafen.«
»In Gottes Hand«, sagte der Skipper und gab dem Matrosen am Steuer ein Zeichen. Die Maschinen unter den Bootsplanken heulten kurz auf. »Übrigens, die Kunden im ›Le Bouc› sind den Pariser Dialekt nicht gewöhnt. Ich würde an Ihrer Stelle daran denken.«
»Danke für den Rat«, sagte der Patient, als er die Beine über die Bordwand schwang und sich ins Wasser hinabließ. Er hielt den Beutel in die Höhe und strampelte mit den Beinen, um nicht abzusinken. »Bis heute Abend«, fügte er mit lauterer Stimme hinzu und blickte an dem schwarzen Rumpf des Fischerboots hinauf.
Aber da war niemand mehr; der Kapitän hatte die Reling verlassen. Nur das Klatschen der Wellen gegen das Holz und das gedämpfte Brummen der Motoren waren zu hören.
Sie sind jetzt auf sich gestellt.
Er schauderte und drehte sich in dem kalten Wasser herum. Er nahm Kurs auf das Ufer, auf eine Gruppe von Felsen zu. Wenn der Kapitän ihn richtig beraten hatte, würde die Strömung ihn zu dem noch unsichtbaren Uferstreifen tragen.
Das tat sie; er spürte, wie der Sog seine nackten Füße in den Sand zog, was die letzten dreißig Meter nicht gerade erleichterte. Aber der Segeltuchsack war relativ trocken geblieben.
Minuten später saß er auf einer Düne, die mit wildem Gras bewachsen war; die langen Halme beugten sich in der Brise, und das erste Licht der Morgendämmerung drang in den Nachthimmel ein. In einer Stunde würde die Sonne aufgehen; dann musste er weiter.
Er öffnete den Sack und entnahm ihm ein Paar Stiefel und Socken sowie eine zusammengerollte Hose und ein grob gewebtes Baumwollhemd. Irgendwann in seiner Vergangenheit hatte er gelernt, wie man platzsparend packte; der Sack enthielt viel mehr, als man vermutete. Woher hatte er diese Fertigkeit? Die Fragen hörten nie auf.
Er erhob sich, zog die Shorts aus, die Washburn ihm gegeben hatte, und legte sie zum Trocknen aus; er durfte hier nichts liegen lassen. Dann schlüpfte er aus seinem Unterhemd und breitete es ebenfalls aus.