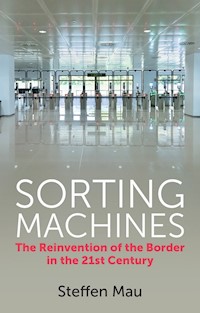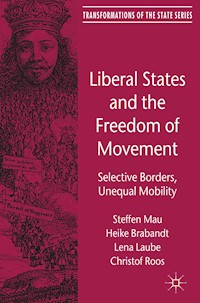19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob Bildung, Gesundheit oder Konsum: Über so ziemlich jeden Aspekt unserer Person und unseres Verhaltens werden inzwischen Daten gesammelt. Schritt für Schritt entsteht so eine Gesellschaft der Sternchen, Scores, Likes und Listen, in der alles und jeder ständig vermessen und bewertet wird. Das beginnt beim alljährlichen Hochschulranking, reicht über die Quantified-Self-Bewegung fitnessbegeisterter Großstädter, die über das Internet ihre Bestzeiten miteinander vergleichen, bis hin zur Beurteilung der Effizienz politischer Maßnahmen. Steffen Mau untersucht die Techniken dieser neuen Soziometrie und zeigt ihre Folgen auf. Die Bewertungssysteme der quantifizierten Gesellschaft, so sein zentraler Gedanke, bilden nicht einfach die Ungleichheiten in der Welt ab, sondern sind letztlich mitentscheidend bei der Verteilung von Lebenschancen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ob Bildung, Gesundheit oder Konsum: Über so ziemlich jeden Aspekt unserer Person und unseres Verhaltens werden inzwischen Daten gesammelt. Schritt für Schritt entsteht so eine Gesellschaft der Sternchen, Scores, Likes und Listen, in der alles und jeder ständig vermessen und bewertet wird.
Das beginnt beim alljährlichen Hochschulranking, reicht über die Quantified-Self-Bewegung fitnessbegeisterter Großstädter, die über das Internet ihre Bestzeiten miteinander vergleichen, bis hin zur Beurteilung der Effizienz politischer Maßnahmen. Steffen Mau untersucht die Techniken dieser neuen Soziometrie und zeigt ihre Folgen auf. Die Bewertungssysteme der quantifizierten Gesellschaft, so sein zentraler Gedanke, bilden nicht einfach die Ungleichheiten in der Welt ab, sondern sind letztlich mitentscheidend bei der Verteilung von Lebenschancen.
Steffen Mau, geboren 1968, ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. In der edition suhrkamp erschienen zuletzt: Lebenschancen. Wohin driftet die Mittelschicht? (2012) und (zusammen mit Nadine M. Schöneck als Herausgeber) (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten (es 2684).
Steffen Mau
Das metrische Wir
Über die Quantifizierungdes Sozialen
‚
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage 2017.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus
eISBN 978-3-518-75172-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
Einleitung
1. Die Vermessung des Sozialen
Was bedeutet Quantifizierung?
Die kalkulativen Praktiken des Marktes
Der Staat als Datenmanager
Zahlentreiber: Digitalisierung und Ökonomisierung
2. Statuswettbewerb und die Macht der Zahlen
Vergleichsdispositive
Kommensurabilität und Inkommensurabilität
Neue Vergleichshorizonte
Register des Vergleichs und investive Statusarbeit
3. Hierarchisierung: Rankings und Ratings
Visibilisierung und Erzeugung von Differenz
Plätze einnehmen!
Universitätsrankings
Treppauf, treppab: Die Marktmacht der Ratingagenturen
4. Klassifizierung: Scorings und Screenings
Kreditscoring
Der quantifizierte Gesundheitsstatus
Mobilitätswertigkeit
»Boost your score« – Statusmarker in der Wissenschaft
Ermittlungen sozialer Wertigkeit
5. Bewertungskult: Sterne und Punkte
Zufriedenheitsfeedbacks
Bewertungsportale als Selektoren
Peer-to-Peer-Bewertungen
Professionen im Bewertungsfokus
Gefällt-mir-Reputation in den sozialen Medien
6. Quantifizierung des Selbst: Balken und Kurven
Gesundheit, Bewegung, Stimmungen
Der kollektive Körper
Motivationstechniken
7. Benennungsmacht
Die Benennungsmacht des Staates
Leistungsmessung und die Inszenierung von Wettbewerb
Benennungsmacht der Experten
Algorithmische Autorität
Kritik der Benennungsmacht
8. Risiken und Nebenwirkungen
Reaktive Messungen
Verlust professioneller Kontrolle
Zeit- und Energieverluste
Monokultur versus Diversität
9. Transparenz und Disziplinierung
Normativer und politischer Druck
Die Macht des Feedbacks
Technologische Überwachung in der Arbeitswelt
Die neuen Tarifsysteme
Die Verquickung von Selbst- und Fremdüberwachung
Das Regime der Durchschnitte, Benchmarks und Körperschemata
10. Das Ungleichheitsregime der Quantifizierung
Herstellung von Wertigkeit
Reputationsmanagement
Kollektive der Ungleichen
Einleitung
Im Frühjahr 2015 hat die chinesische Regierung ein spektakuläres, ja geradezu revolutionäres Vorhaben angekündigt: Sie plant, bis zum Jahr 2020 ein sogenanntes Social Credit System zu entwickeln. Dafür sollen aus allen gesellschaftlichen Bereichen Daten über individuelles Verhalten eingesammelt, ausgewertet und schließlich zu einem einheitlichen Score zusammengeführt werden. Aktivitäten im Internet, Konsum, Verkehrsdelikte, Arbeitsverträge, Bewertungen von Lehrern oder Vorgesetzten, Konflikte mit dem Vermieter oder das Verhalten der eigenen Kinder – all das kann in dieses System einbezogen werden und Auswirkungen auf den individuellen Social Score haben. Das System soll jeden erfassen, ob er oder sie das will oder nicht. Es geht darum, ein Gesamtbild des Wertes einer Person zu erstellen, auf dessen Grundlage ihr dann wiederum bestimmte Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt, im Arbeitsleben oder beim Zugang zu Krediten eingeräumt werden. Behörden sollen auf diese Informationen zurückgreifen können, wenn sie mit Bürgern interagieren; Unternehmen sollen die Möglichkeit haben, sich auf diesem Weg ein Bild ihrer Geschäftspartner zu machen. Damit möchte die chinesische Regierung die Aufrichtigkeit ihrer Bürger belohnen und Unaufrichtigkeit sanktionieren. Das Vorhaben zielt erklärtermaßen auf die Herstellung von gesellschaftlichem Vertrauen, einer »Mentalität der Ehrlichkeit« – und zwar mit dem Mittel der totalen sozialen Kontrolle.
Ein extremes und düsteres Beispiel, fürwahr. Allerdings steht es für einen allgemeinen Trend hin zu quantifizierenden Formen sozialer Rangbildung, die zunehmend ein eigenständiges System der Hierarchisierung und Klassifikation darstellen. Dieses Buch beschäftigt sich mit der Herausbildung einer Gesellschaft der Scores, Rankings, Likes, Sternchen und Noten. Es handelt von daten- und indikatorenbasierten Formen der Bewertung und Kontrolle, die einer umfassenden Quantifizierung des Sozialen Vorschub leisten. Es geht um die Gesellschaft der allgegenwärtigen Soziometrie[1] oder kurz: um das metrische Wir. Soziologisch betrachtet, haben wir es bei solchen quantifizierten Selbstbeschreibungen nicht mit der bloßen Widerspiegelung einer vorgelagerten Realität zu tun, sie können vielmehr als generativer Modus der Herstellung von Differenz angesehen werden. Quantitative Repräsentationen kreieren die soziale Welt nicht, aber sie re-kreieren sie (Espeland & Sauder 2007). Sie sind demzufolge als Realität sui generis anzusehen.
Der neue Quantifizierungskult – der »Zahlenrausch«, wie es Jürgen Kaube einmal genannt hat (nach Hornbostel et al. 2009: 65) – ist in engem Zusammenhang mit der Digitalisierung zu sehen, die sich in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen manifestiert und diese radikal restrukturiert. Die vielfältigen Daten, die wir produzieren und die fortwährend gespeichert werden, erzeugen einen immer größeren digitalen Schatten, manchmal mit unserem Einverständnis, oft auch ohne dieses. In der Welt von Big Data sind Informationen über Nutzer, Bürger oder einfach nur Menschen der Rohstoff, aus dem sich Gewinn schlagen lässt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Informationsökonomie zu einer Krake entwickelt hat, die nicht nur massenhaft Daten einzieht, sondern diese mithilfe von Algorithmen auswertet und für vielfältige Zwecke bereitstellt. Dabei geht es stets darum, Unterscheidungen zu treffen – zu codieren – mit einschneidenden Folgen für Prozesse der Klassifikation und der Statuszuweisung. Digitale Statusdaten werden zu »Unterscheidungszeichen« (Bourdieu 1985: 21) par excellence. Dass sich Praktiken des Messens, Bewertens und Vergleichens nicht nur schleichend, sondern rasant verbreiten, mag angesichts der exponentiell wachsenden Möglichkeiten der Datenerzeugung und -verarbeitung nicht weiter verwundern. Aber es wäre zu einfach, diese allgemeine Kultur der Quantifizierung einseitig als technologische zu interpretieren, denn es kommt zugleich auf die aktive Mitmachbereitschaft zahlreicher gesellschaftlicher Akteure an: Zum einen müssen sie solche Verfahren und Maßstäbe akzeptieren, zum anderen müssen sie ihre Daten zur Verfügung stellen und sich bewerten lassen.
Angetrieben wird diese Entwicklung nicht zuletzt durch die Popularisierung von Konzepten wie Transparenz, Accountability und Evidenzbasierung, bei denen Ratings, Rankings und quantifizierende Bewertungsformen eine zentrale Rolle spielen. Es geht hierbei darum, durch die Verfügung über Daten das Steuerungswissen zu erhöhen, um effektiver in das soziale Geschehen eingreifen zu können (Power 1994, Strathern 2000). Man verlässt sich oftmals auf Indikatoren, mit deren Hilfe sich komplexe soziale Phänomene anhand weniger Daten erfassen und mittels derer sich Vergleiche durchführen lassen. Kennziffern, Indikatoren und Zahlen sind daher von fundamentaler Bedeutung für oft unter dem ungenauen Stichwort »Neoliberalismus« verhandelte Governance-Ansätze, die Effizienz und Leistungsfähigkeit zu leitenden Bewertungsmaßstäben machen (Crouch 2015). Die überall etablierten Leistungs- oder Zielvereinbarungen setzen Überprüfbarkeit voraus, und um diese durchzusetzen, benötigt man entsprechende Indikatoriken: So führt das New Public Management, also die Übernahme privatwirtschaftlicher Managementtechniken in der öffentlichen Verwaltung, mehr oder weniger automatisch zu einer Ausdehnung des Monitorings und der Berichterstattungspflichten. Öffentliche Einrichtungen sowie private Unternehmen erweitern zudem beständig ihren Datenbestand über Bürger, Kunden oder Mitarbeiter, um Kontrolle auszuüben und um Zielgruppen genauer adressieren zu können. Komplementär dazu gibt es Veränderungen in der individuellen Selbststeuerung, etwa durch die Verbreitung der Rolle des »unternehmerischen Selbst« (Bröckling 2007), durch Self-Enhancement oder neue Formen der Selbstoptimierung. Auch hier wird verstärkt auf Verfahren der Vermessung und Quantifizierung zurückgegriffen, weil diese geeignet scheinen, die eigene Leistungskurve exakt abzubilden und sich mit anderen »messen« zu können. Die Gesellschaft macht sich auf den Weg zur datengestützten Dauerinventur.
Daten zeigen an, wo eine Person, ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Organisation steht, sie leiten Bewertungen und Vergleiche an – kurz: produzieren Status und bilden diesen ab. Permanente Vermessung und Bewertung führen dazu, dass sich sowohl die Fremd- als auch die Selbststeuerungsleistungen intensivieren. Wenn jede Aktivität und jeder Schritt im Leben aufgezeichnet, registriert und in Bewertungssysteme eingeschrieben wird, verlieren wir die Freiheit, unabhängig von den darin eingelassenen Verhaltens- und Performanzerwartungen zu handeln. Ratings und Rankings, Scorings und Screenings trainieren uns Wahrnehmungs-, Denk- und Beurteilungsschemata an, die sich zunehmend an Daten und Indikatoriken ausrichten. »Statusarbeit« (Groh-Samberg et al. 2014) wird dann zum Reputationsmanagement, bei dem es vor allem darum geht, gute Noten, Plätze und Scores zu erhalten. Das gilt umso mehr, als unter den Bedingungen von Statusunsicherheit das Interesse daran wächst, sich seines Standings zu versichern – am besten mit objektiven Daten. So gesehen lässt sich die neue Verunsicherung in wichtigen Fraktionen der Mittelschichten durchaus als treibende Kraft hinter dem auf Quantifizierung setzenden Statusdrang verstehen, wobei hier Fluch und Segen einmal mehr eng beieinander liegen. Der Halt, den objektivierte Statusinformationen geben mögen, wird mit einer Dynamisierung des Statuswettbewerbs erkauft.
Die Möglichkeiten der Protokollierung von Lebens- und Aktivitätsspuren wachsen gegenwärtig rasant: Konsumgewohnheiten, finanzielle Transaktionen, Mobilitätsprofile, Freundschaftsnetzwerke, Gesundheitszustände, Bildungsaktivitäten, Arbeitsergebnisse etc. – all dies wird statistisch erfassbar gemacht. Gewiss, es gibt nach wie vor Möglichkeiten, in der digitalen Welt Außen- oder zumindest Randseiter zu bleiben und Datenspuren zu vermeiden, allerdings um den Preis der Selbstexklusion aus relevanten Kontexten der Kommunikation und Vernetzung. Nach allem, was man bislang weiß, sind Menschen überaus freizügig, wenn es darum geht, persönliche Daten zu veröffentlichen oder weiterzugeben. Dieser Datenvoluntarismus speist sich aus einer Mischung aus Mitteilungsbedürfnis, Unachtsamkeit und schließlich dem Interesse an den neuen Möglichkeiten des Konsums, der Information und der Kommunikation. Es gibt zudem eine wachsende Nachfrage nach Selbstquantifizierung, welche die Individuen zu bereitwilligen Datenlieferanten werden lässt. Die Technologien der Selbstvermessung und des Self-Tracking sind eine Goldader für die Data-Miner, die unser Verhalten so umfassend wie möglich beschreiben und vorhersagen wollen. Durch die Verbindung von wachsenden Datenbeständen und immer ausgefeilteren Analyseverfahren lassen sich diese individuellen Informationen mit kollektiven Aggregaten verbinden. Wir werden mannigfaltig vergleichbar: mit Normwerten, mit anderen, mit Leistungszielen, die man erreichen sollte oder möchte.
Der als Rationalisierung maskierte Kult der Zahlen hat weitreichende Folgen: Er verändert auch die Art und Weise, wie das Wertvolle oder Erstrebenswerte konstruiert und verstanden wird. Indikatoren und metrische Vermessungsformen stehen jeweils für spezifische Konzepte sozialer Wertigkeit sowohl im Hinblick auf das, was als relevant gelten kann, als auch auf das, was gesellschaftlich als erstrebenswert und wertvoll angesehen wird bzw. werden soll. Im Regime der Quantifizierung erfahren entsprechende Daten große Anerkennung, man denke nur an die Rolle von Ratingnoten auf kommerziellen Bewertungsplattformen oder die Zitationsindizes im wissenschaftlichen Feld. Je besser diese Einprägung gelingt, desto größer ist ihr gesellschaftlicher Einfluss. Die symbolische Dimension der hierarchisierenden Soziometrie zeigt sich dann darin, dass viele der Kriterien, die der quantitativen Rangbildung zugrunde liegen, einfach hingenommen und nicht mehr hinterfragt werden. Wenn sie als angemessen, evident und selbstverständlich erlebt werden, sind wichtige Schritte in Richtung einer Naturalisierung sozialer Ungleichheit vollzogen.
Vor diesem Hintergrund gibt es neuerdings wichtige Anläufe, sich intensiver damit zu befassen, wie Wertigkeit zustande kommt und wie Grammatiken von Klassifikation, Differenzbildung und Hierarchisierung durch Quantifizierungen etabliert werden (Espeland & Stevens 1998, 2008; Fourcade & Healy 2013; Heintz 2010; Lamont 2012; Timmermans & Epstein 2010). Diese Ansätze firmieren mitunter unter dem Label »Valuation Studies«. Es gibt eine ökonomische Theorie der Valuation, die sich mit der Ermittlung des Wertes bestimmter Güter (etwa von Umwelt- und Naturgütern) beschäftigt, wobei es in der Regel um Dinge geht, die nicht permanent gehandelt werden oder für die keine ausgebildeten Nachfragemärkte und damit auch keine Preise existieren. In den gesellschaftlichen Kontexten, mit denen ich mich beschäftige, stehen allerdings nicht Preise im Mittelpunkt, sondern vor allem soziale Wertigkeiten und damit verbundene Positionen im gesellschaftlichen Gefüge. Mit Valuation im engeren Sinne ist dabei die Wertfestsetzung oder -stellung gemeint, der Begriff soll hier aber zugleich als soziokulturelle Praktik der Inwertsetzung verstanden werden: als Valorisierung, also als Aufladung mit Wert. Aus dieser Perspektive existiert kein vorgängiger, neutraler und vom Betrachter unabhängiger Wert, der nur »entdeckt« oder gemessen werden müsste, sondern wir haben es mit Vorgängen der Wertzuschreibung und Wertmanifestation zu tun. Valuation, so schreiben Doganova et al. in einem programmatischen Beitrag, bezeichnet jede soziale Praktik, »bei der Wert oder Werte von etwas etabliert, eingeordnet, verhandelt, provoziert, erhalten, konstruiert und/oder herausgefordert werden« (2014: 87). Wenn Wert nicht als gegeben, sondern als sozial hergestellt angesehen wird, lautet eine Grundprämisse der Analyse solcher gesellschaftlichen Vorgänge immer: Es hätte auch anders sein können! Mit einer derartigen Perspektive kann man so unterschiedliche Phänomene wie das Ranking von Universitäten, Performanzmessung in der Arbeitswelt, die Punktevergabe für die Freundlichkeit des Hotelpersonals, das Messen der täglichen Schrittzahl oder die Veröffentlichung von Mortalitätsraten in Krankenhäusern als Teil eines umfassenden Trends verstehen. Hier wird die Tür in Richtung einer Bewertungsgesellschaft aufgestoßen, die alles und jeden einer Bewertung mittels quantitativer Daten unterzieht und damit zugleich neue Wertigkeitsordnungen etabliert.
Vor diesem Hintergrund argumentiere ich in diesem Buch, dass die Quantifizierung des Sozialen nicht einfach nur eine spezifische Beschreibungsform der Gesellschaft darstellt, sondern in drei soziologisch relevanten (und bislang wenig berücksichtigten) Hinsichten Wirkung entfaltet: Erstens verändert die Sprache der Zahlen unsere alltagsweltlichen Vorstellungen von Wert und gesellschaftlichem Status. Im Gleichschritt mit der Ausbreitung von Zahlenhaftigkeit wird auch die »Kolonialisierung der Lebenswelt« (Habermas 1981) durch instrumentell geprägte Vorstellungen von Berechenbarkeit, Messbarkeit und Effizienz vorangetrieben. Zweitens befördert die quantifizierende Vermessung des Sozialen eine Ausbreitung, wenn nicht gar eine Universalisierung von Wettbewerb, da durch das Bereitstellen quantitativer Informationen der Hang zum Sozialvergleich und damit auch zum Wettbewerb gestärkt wird. Wir können nun in vielen Sphären unserer sozialen Existenz, die solchen Verfahren zuvor nicht explizit zugänglich waren, anhand von Mehr-oder-weniger- oder Besser-oder-schlechter-Vergleichen anderen gegenübergestellt werden. Sich ausweitende Konkurrenz- und Wettbewerbsordnungen sind geradezu auf die Durchsetzung und subjektive Aneignung von Indikatoren angewiesen, da der Wettbewerb aus spezifischen raumzeitlichen Kontexten herausgelöst werden muss. In vielen Bereichen sind es letztlich erst die Praktiken der Quantifizierung, die eine Inszenierung von Wettbewerb ermöglichen, und zwar eines Wettbewerbs, der mithilfe von Zahlen ausgetragen wird. Drittens ergibt sich ein Trend hin zu einer verstärkten gesellschaftlichen Hierarchisierung, weil Darstellungen wie Tabellen, Grafiken, Listen oder Noten letztlich qualitative Unterschiede in quantitative Ungleichheiten transformieren. Die Folgen für die Strukturierung und Legitimation sozialer Ungleichheit sind bislang noch kaum in den Blick genommen worden. Quantifizierende Zuweisungen von Statusrängen, so die zentrale These dieses Buches, verändern unsere Ungleichheitsordnung, weil bislang Unvergleichbares miteinander vergleichbar gemacht und in ein hierarchisches Verhältnis gebracht wird.
Im folgenden Kapitel wird zunächst gezeigt, wie Zahlenhaftigkeit, Kalkulation und metrische Standardisierung die Institutionalisierung von Politik und Märkten maßgeblich beeinflusst haben. Ausgehend von diesem Rückspiegelblick widmet sich das Kapitel der Digitalisierung und der Ökonomisierung der Gesellschaft und benennt sie als zwei wesentliche Antriebskräfte der Quantifizierung des Sozialen. Darauf aufbauend erkundet Kapitel 2 den Zusammenhang zwischen Zahlenhaftigkeit und Sozialvergleich. Es wird gezeigt, wie durch die Verfügung über Zahlen ein gesellschaftliches Vergleichsdispositiv ausgebildet wird, das uns unmittelbar in Wettbewerbssituationen hineinstellt. Verkürzt könnte man sagen: ohne Daten kein Wettbewerb. Die darauf folgenden vier Kapitel besichtigen dann einige konkrete Felder der Quantifizierung. Zunächst geht es in Kapitel 3 um Ratings und Rankings sowie ihre gesellschaftliche Wirkung; illustriert wird dies anhand globaler Universitätsrankings und am Beispiel von Ratingagenturen, welche die Kreditwürdigkeit von Staaten, Unternehmen sowie Anlagemöglichkeiten bewerten. Kapitel 4 widmet sich Scorings und Screenings als Formen der Ermittlung sozialer Wertigkeit auf der individuellen Ebene. Dies wird exemplarisch an Bonitätsbewertungen, Gesundheitsscorings, der Mobilitätswertigkeit und der wissenschaftlichen Leistungsmessung ausgeführt. Kapitel 5 greift den neuen Bewertungskult auf, im Rahmen dessen wir alle fortwährend ermuntert werden, Noten für Produkte, Dienstleistungen oder Personen zu vergeben, Webseiten oder Posts zu liken oder Zufriedenheiten zurückzumelden. Schließlich führe ich in Kapitel 6 aus, inwieweit durch Praktiken der Selbstvermessung neue Formen des Wettbewerbs und der Optimierung an Boden gewinnen. Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel 7 erörtert, wer in diesem Zahlenspiel eigentlich die Benennungsmacht besitzt. Zunächst wird argumentiert, dass ökonomisch geprägte Kennziffern und Leistungsparameter an Boden gewinnen und mit ihnen das ökonomisch geschulte Personal und damit verbundene Interessen. Zudem wird gezeigt, dass Expertensysteme und Algorithmen zunehmend darüber entscheiden, welche Wertigkeiten sich durchsetzen und wie neuartige Konkurrenzverhältnisse aussehen. Insbesondere die Ausübung algorithmischer Macht scheint dabei in der Lage, sich von der Legitimitätsfrage abzuschirmen und kommerzielle Interessen zu verstärken. Kapitel 8 greift einige Nebenfolgen der Quantifizierung auf, die insbesondere dann auftreten, wenn professionelle Standards verdrängt werden, Zielindikatoren falsche Anreize setzen oder es durch intensivierten Wettbewerb zu Verlusten an Zeit oder anderen Ressourcen kommt. Kapitel 9 analysiert den Zusammenhang von Quantifizierung und Kontrolle, da die durch Zahlen in Aussicht gestellte Transparenz immer auch zu einem Mehr an Überwachung führt. Angesichts des Befunds, dass es bei der Quantifizierung des Sozialen eine große Mitmachbereitschaft gibt, lohnt es sich festzuhalten, dass Kontrolle eben nicht allein von außen kommt, sondern dass wir entsprechende Entwicklungen auch selbst vorantreiben. Kapitel 10 greift abschließend die Frage der Neukonstitution sozialer Ungleichheit durch Quantifizierung auf. Welches Ungleichheitsregime bildet sich mit der wachsenden Macht der Zahlen und dem Aufstieg des metrischen Wir heraus? Statusdaten zeigen Reputation an und wirken deshalb wie symbolisches Kapital, das zum eigenen Vorteil eingesetzt und in andere soziale Währungen konvertiert werden kann. Die quantifizierte Gesellschaft beobachtet und etabliert fortwährend Differenzen zwischen Individuen, die sich als Ungleichheiten darstellen und sich mit ganz konkreten Vor- und Nachteilen verbinden. Die Logik der gesellschaftlichen Ungleichheit schaltet sozusagen um: weg vom Konflikt der Klassen, hin zum Wettbewerb der Individuen.
Man muss sich bei diesem Thema davor hüten, in die Falle platter und allzu einseitiger Kulturkritik zu geraten, da sich letztlich jeder Quantifizierungsschritt wegen der damit verbundenen Reduktion von Komplexität und der Steigerung von Kontrolle wohlfeil anprangern lässt. Diese Versuchung liegt stets nahe, und um ihr wenigstens halbwegs zu entgehen, sei hier noch einmal betont, dass Zahlen und Daten selbstverständlich eine wichtige und unabdingbare Funktion für moderne Gesellschaften haben, sei es auf Märkten, in der Wissenschaft, in der Politik oder im privaten Bereich. Quantifizierungen sind für Fortschritt, Erkenntnis und Rationalisierung ein wichtiger Schlüssel, sie helfen uns, Zusammenhänge zu entdecken und die Welt zu verstehen. Außerdem haben sie für viele Gruppen, die um Anerkennung und Rechte kämpfen, fundamentale Bedeutung. Es gibt durchaus auch ein emanzipatorisches Potenzial der Zahlenhaftigkeit, weil sie Diskriminierungen oder Benachteiligungen aufzeigen und weil sie Ungleichheiten, die auf einem guten Namen oder der richtigen Herkunft beruhen, in Zweifel ziehen kann. Was das Buch sichtbar machen soll, sind die vielfältigen sozialen Folgen, die sich aus der Quantifizierung des Sozialen ergeben. Bei dieser handelt es sich immerhin um einen Megatrend, der in seiner Reichweite bislang nur in Ansätzen erkundet worden ist und der unsere soziale Umgebung bis in die letzten Verästelungen hinein neu strukturiert. Als auch quantitativ arbeitender Sozialforscher bin ich – hoffentlich – unverdächtig, einer allgemeinen Zahlenaversion anheimzufallen und quantitative Vermessungsinstrumente ganz generell zurückzuweisen. Doch vielleicht schärft ja gerade die Beschäftigung mit quantitativen Daten den Blick für die vielfältigen Probleme, die mit der Nutzung scheinbar einfacher und unvoreingenommener Instrumente der Vermessung des Sozialen verbunden sind. Neben die enormen Gewinne, die man aus Daten ziehen kann, treten erhebliche Risiken und handfeste gesellschaftliche Probleme. Das gilt vor allem dann, wenn wir der Herausbildung der »Omnimetrie« (Dueck 2013: 37), dem Kult des Allesmessens, allzu leichtfertig nachgeben, ohne ihn kritisch zu hinterfragen.
Auch wenn nur ein Name auf dem Cover steht, ist die Arbeit an einem Buch doch meistens ein kollektives Unterfangen. Ein erster Dank gilt Susanne Balthasar, die mich während des Schreibens fortwährend ermahnt hat, den soziologischen Jargon zu dosieren, und die viele Ideen und Lektürefunde eingebracht hat. Fabian Gülzau und Thomas Lux waren engagierte Testleser des Manuskripts und haben wichtige Rückmeldungen gegeben. Oscar Stuhler hat sich durch eine erste Rohversion gearbeitet und mir bei vielen Einsichten und Formulierungen geholfen. Milan Zibula hat für mich recherchiert, und Katja Kerstiens hat kritisch Korrektur gelesen. Mein Freund Thomas A. Schmidt hat das Buch durch seine anhaltende Neugier inspiriert. Hagen Schulz-Forberg hat beim gemeinsamen Joggen (mit Schrittzähler selbstredend) immer wieder Beobachtungen zum Quantifizierungstrend mit mir geteilt. Philipp Staab hat mich mit freundlich-kritischen Kommentaren versorgt. Martina Franzen hat mich im Herbst 2016 zum Big Data Brown-Bag Seminar am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) eingeladen, wo ich meine Ideen vor einem größeren und fachlich einschlägigen Publikum ausprobieren konnte. Und schließlich hat Heinrich Geiselberger mir die Tür zur edition suhrkamp geöffnet und den Text mit unermüdlichem Einsatz auf Vordermann gebracht. Das Buchprojekt ist durch das »Freiräumeprogramm« der Humboldt-Universität zu Berlin unterstützt worden. Allen Genannten gilt mein herzlicher Dank!
[1] Ursprünglich ist dieser Begriff im Zuge der Erfassung von Gruppenstrukturen eingeführt worden (Moreno 1934), er ist aber sehr treffend für alle Formen der Sozialvermessung mittels metrischer Daten.
1. Die Vermessung des Sozialen
Quantifizierung des Sozialen meint, dass wir Komplizen und zugleich Zeugen einer Entwicklung sind, im Zuge derer immer mehr gesellschaftliche Phänomene vermessen, durch Zahlen beschrieben und beeinflusst werden. Das deutsche Wort »vermessen« ruft interessanterweise drei unterschiedliche Lesarten auf den Plan, die auch in diesem Buch eine zentrale Rolle spielen sollen. Bei der ersten geht es um eine Tätigkeit, die darauf ausgerichtet ist, eine quantitative Aussage über ein Objekt durch den Vergleich mit einem festgelegten Maßstab zu treffen. Der Duden spricht im Hinblick auf diese Bedeutung von »etwas genau in seinen Maßen festlegen«. Zweitens, und hier hat uns die deutsche Sprache eine interessante Spur gelegt, heißt vermessen auch, etwas falsch zu messen, sich also beim Messen zu irren. Es wird etwas gemessen, aber das Verfahren produziert (systematisch) Fehler, und die Ergebnisse reichen nicht an die Wirklichkeit heran. Drittens schließlich steht »vermessen« als Adjektiv für so etwas wie unangemessen oder gar überheblich, was die kritische Frage aufwirft, wo die Trennlinie zwischen »guten« und »schlechten« Messungen verläuft.
Nimmt man diese drei Lesarten zusammen, hat man das Dreieck, anhand dessen in diesem Buch über die Quantifizierung des Sozialen nachgedacht werden soll. Allerdings geht der Anspruch über unmittelbare Messfragen hinaus; ich beschäftige mich weniger mit Messverfahren, Messfehlern oder dem Kalibrieren von Messtechnologien, vielmehr frage ich, wie im Zuge der Vermessung des Sozialen neue soziale Ordnungsformen durchgesetzt werden. Meine Ausgangsbeobachtung ist die einer rasant zunehmenden Quantifizierung des Sozialen, welche mit veränderten Zuschreibungen von Wertigkeit einhergeht, die sich dann in neue Hierarchien übersetzen. Quantifizierungen institutionalisieren bestimmte »Wertigkeitsordnungen«, die uns Beurteilungsmaßstäbe und Rechtfertigungen darüber an die Hand geben, wie Dinge zu sehen und zu bewerten sind. Sie sagen uns, welche Aktivitäten, Leistungen oder Eigenschaften einen hohen »Wert« besitzen und welche nicht und bringen dadurch bestimmte normative Prinzipien zur Geltung (Boltanski & Chiapello 2003; Boltanski & Thevenot 2007). Durch Quantifizierungen werden klassifizierende Vorgänge des Bestimmens, Bewertens und Einordnens durchgesetzt und der Wertigkeitsstatus einer Person oder Sache dabei in Zahlen ausgedrückt. Durch die Nutzung neuer Indikatoren, Daten und numerischer Notationen zur Selbsterkennung, -beschreibung und -bewertung entwickelt sich das soziale Wir nach und nach zu einem metrischen Wir. Daten machen sichtbar und legen fest, wer wir sind, wo wir stehen, wie andere uns sehen und was uns erwartet.
Der Prozess der Quantifizierung ist beileibe kein neues gesellschaftliches Phänomen. Die Geschichte des Quantifizierens reicht einige Jahrtausende zurück, bis zu den Anfängen des Zählens und der Verbreitung mathematischer Kenntnisse. Zunächst waren es nur kleine elitäre Zirkel, die sich über Zahlen die Welt erschlossen. Die Wissenschaft selbst als spezifische Rationalisierungspraxis hat natürlich von Beginn an die Sprache der Zahlen geprägt und immer weiter entwickelt. Mit dem Aufstieg moderner Staatlichkeit und der Expansion von Märkten sowie kapitalistischen Wirtschaftspraktiken kam es zu einem massiven Schub bei der Verwendung von Zahlen im Zusammenhang mit alltäglichen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Praktiken. Die Verfügbarkeit von Zahlen in Form amtlicher Statistiken ermöglichte Herrschaftstechniken, die das Heilige durch Sachlichkeit und Rationalität ersetzten. Auf den Märkten kam es mit der Verbreitung »kalkulativer Praktiken« (Vormbusch 2012) – beispielsweise bei der Buchführung und Rechnungslegung oder der Standardisierung von Maßen und Umrechnungen – dazu, dass sich eine bestimmte Art des Wirtschaftens und des Handeltreibens herausbildete.
Im Folgenden soll dargelegt werden, dass Staat und Markt zwar wichtige Ausgangspunkte der Ausdehnung kalkulativer Praktiken waren, sich heutzutage aber eine Universalisierung der Sprache der Zahlen herausgebildet hat, die weit über diese beiden Bereiche und das Feld der Wissenschaft hinausgeht. Es ist zur Ausprägung einer neuartigen und tief in unsere sozialen Verhältnisse eingreifenden »quantitativen Mentalität« (Porter 1996: 118) gekommen, die Zahlen eine – fast auratisch zu nennende – Vorrangstellung beim Erkennen gesellschaftlicher Phänomene zuweist und nun zu einem Sog der Zahlenhaftigkeit führt. Alles kann, soll oder muss vermessen werden – ohne Zahlen geht gar nichts mehr. Die gesellschaftliche Semantik, verstanden als die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft selbst beobachtet und beschreibt, bezieht sich zunehmend auf die messbare Seite der Welt und des Lebens. Natürlich steht dieser Sprung in einer Traditionslinie mit vielfältigen Rationalisierungsbemühungen, bei denen es um die Organisation des sozialen und wirtschaftlichen Lebens nach den Prinzipien der Effizienz und der Berechenbarkeit geht, aber darin erschöpft sich das Ganze noch nicht. Im Kontext neuer Formen der Governance hat sich ein Regime der Steuerung und Bewertung herausgebildet, das auf dem Gewinnen und dem Prozessieren von Daten beruht und das in ganz unterschiedlichen Bereichen auf Leistungssteigerung, Aktivierung und Wettbewerb zielt; operiert wird dabei über Zielvorgaben, Leistungsindikatoren und Anreizsysteme, die dazu auffordern, immer mehr Daten vorzuhalten und für Bewertungsvorgänge einzusetzen. Qualitative Formen der Urteilsbildung, die das Spezifische in den Blick nehmen, werden durch quantifizierende Ansätze der Bewertung und Vermessung abgelöst. Man kann auch sagen: Die durch den Neoliberalismus in allen möglichen Lebensbereichen durchgesetzte Logik der Optimierung und Leistungssteigerung läuft auf einen Wettkampf um die besseren Zahlen hinaus. Und je mehr Zahlen produziert, je avancierter die Verfahren der Datenerhebung und Datenverarbeitung werden, desto besser lassen sich die Maßgaben von Leistungserbringung und Selbstverbesserung sozial verankern. Da Daten zur Leitwährung der digitalisierten Gesellschaft geworden sind, gibt es kaum noch natürliche Grenzen, an denen dieser Prozess ein Ende finden könnte. Er ist im Grunde infinit.
Was bedeutet Quantifizierung?
Zunächst wenden wir uns der Frage zu, was Quantifizierung überhaupt bedeutet und leistet. Allgemein gesagt, beinhaltet Quantifizierung eine Übersetzungsleistung: Phänomene, Eigenschaften oder Beschaffenheiten eines Sachverhalts werden in einer allgemeinen, abstrakten und universell anschlussfähigen Sprache repräsentiert, der der Mathematik. Das kann durch Messungen geschehen oder durch die Transformation qualitativer Urteile, Einsichten und Beobachtungen in Zahlenwerte. Quantifizierung bringt eine unübersichtliche und komplexe Welt in die standardisierte Sprache der Zahlen, in welcher eineindeutige Ordnungsverhältnisse von größer oder kleiner (oder von mehr oder weniger) herrschen. Natürlich lässt sich über Beobachtbares auf verschiedene Weisen sprechen und Verständigung erzielen, aber sobald das Betrachtete mit einer Zahl versehen wurde, ist ein Objektivierungsschritt getan. Zahlen vermitteln also Präzision, Eineindeutigkeit, Vereinfachung, Nachprüfbarkeit und Neutralität. Das prädestiniert sie auch dazu, eine herausgehobene Rolle in Gesellschaften zu spielen, die sich als rational und aufgeklärt verstehen. Mit der Quantifizierung geht oftmals einher, dass es nachvollziehbare und systematische Operationen gibt, durch die ein soziales Phänomen in Zahlen verwandelt wird. Wichtig für die Verwendung von Indikatoren oder Datenreihen ist dabei, dass sie bestimmten Gütekriterien entsprechen und weitgehend davon unabhängig sind, wer sie produziert. Nicht Personen, sondern Verfahren sollen über Ergebnisse entscheiden – eine Vorgehensweise, die der wissenschaftlichen Praxis ähnelt. Die Bezifferung sozialer Phänomene ist zugleich ein Vorgang der »Entbettung«, der lokales Wissen und die Situiertheit sozialer Praktiken absichtsvoll aufhebt, um auf einer abstrakteren Ebene Informationen zu erhalten, die sich neu kombinieren und mit anderen zusammenschließen lassen.
Ohne die Vorannahme, dass Zahlen auf kontrollierte Weise produziert werden und eben keinen arbiträren Charakter haben, ließe sich mit ihnen nicht viel anfangen. Jede Zahl, die wir im öffentlichen Diskurs nutzen, braucht einen Vertrauensvorschuss – sie muss als korrekt anerkannt werden, erst dann entfaltet sie ihr kaltes Charisma. Zahlen, denen niemand glaubt, haben in der gesellschaftlichen Kommunikation keinen Wert. Deswegen bemühen sich Gesellschaften sehr intensiv darum, die Daten der Selbstvermessung auf eine gesicherte Basis zu stellen, etwa durch umfassende Gesetzgebung zu statistischen Fragen, durch die Schaffung statistischer Ämter, die Teilnahme an internationalen Systemen des datenbasierten Monitorings oder durch die Entwicklung eines standardisierten Berichtswesens in fast allen gesellschaftlichen Teilbereichen. Ein Land, dessen Statistik versagt und das auf der Grundlage von falschen oder unzureichenden Daten politische Entscheidungen trifft, gerät sowohl bei der eigenen Bevölkerung als auch in der internationalen Gemeinschaft leicht in Misskredit, die Griechen können ein Lied davon singen. Von Zahlen erwartet man, dass sie stimmen – was auch immer das heißen mag.
Das bedeutet aber nicht, dass Zahlen von jedweder Einflussnahme frei wären, ganz im Gegenteil. Seit Zahlen und Indikatoren im öffentlichen und politischen Diskurs Gebrauch finden, sind sie auch ein Spielball der Interessen. Das Bruttoinlandsprodukt (Lepenies 2013), die Arbeitslosenquote, die öffentliche Verschuldung und die Maßzahl der »schwarzen Null« (Haffert 2016) – das alles sind umkämpfte Kenngrößen; sie können öffentliche Erregung, wirtschaftliche Talfahrten, politische Höhenflüge oder gar gesellschaftliche Krisen auslösen, so dass die Politik gut beraten ist, sich um diese Zahlen intensiv zu kümmern. Das fängt bei der Verständigung über geeignete Messkonzepte an, geht über Entscheidungen zur periodischen Veröffentlichung und Präsentation von Daten bis hin zur Diskussion der politischen Konsequenzen, die sich aus bestimmten Zahlen ergeben. Besonders erfolgreich ist die Politik der Indikatoren dann, wenn es gelingt, in der öffentlichen Wahrnehmung eine Gleichsetzung von theoretischem Konstrukt und Indikator zu erreichen. Das wäre zum Beispiel gegeben, wenn man unter Intelligenz genau das verstehen würde, was durch Intelligenztests gemessen wird. Oder unter menschlicher Entwicklung das, worauf der Human Development Index abhebt, obwohl dieser gerade mal die Lebenserwartung, die Bildung und das Pro-Kopf-BIP eines Landes in die Berechnung einbezieht, also auf empirisch sehr dünnen Beinen steht.
Zahlen bieten eine – oftmals sehr überzeugende – Antwort auf unsere Bedürfnisse nach Objektivierung, Sachbezogenheit und Rationalisierung. Zwar abstrahieren Zahlen von konkreten sozialen Kontexten, sie sind aber nicht nur Mathematik. Hinter ihnen stehen Wertzuweisungsprozesse, die den Zahlen erst eine Bedeutung oder einen »Wert« zukommen lassen. Quantifizierungen lassen sich daher als manifeste Formen der Zuschreibung von Wertigkeit ansehen, weswegen nicht nur der Umstand interessant ist, dass quantifiziert wird, sondern auch, wie und durch wen. »Statistiken«, so Bettina Heintz,
geben vor, eine Realität zu zeigen, die außerhalb von ihnen liegt und durch sie sichtbar gemacht wird. Faktisch sind sie aber nicht Zweitfassungen einer vorausgesetzten Wirklichkeit, sondern selektive Konstruktionen, die diese Wirklichkeit teilweise erst erzeugen. Die Objektivität von Zahlen ist folglich kein Sachverhalt, sondern eine Zurechnung. (2010: 170)
Versteht man Quantifizierung in eben diesem Sinn, kommt man nicht umhin, sich mit den gesellschaftlichen Prozessen der Herstellung von Zahlenhaftigkeit zu beschäftigen. Anders als Preissignale auf Märkten, über die Angebot und Nachfrage miteinander in Verbindung gebracht werden, sind die Metriken sozialer Wertigkeit, Leistung oder Performanz in erster Linie als soziale und kulturelle Setzungen zu verstehen. In Zahlen sind immer schon Vorentscheidungen darüber enthalten, was als relevant, wertvoll oder maßgeblich gelten soll (Espeland & Stevens 1998; Verran 2013). Daten legen nahe, wie Dinge zu sehen sind, und schließen damit andere Sichtweisen systematisch aus. Beim Gebrauch von Zahlen geht es somit stets auch um eine »besondere Form des Schreibens von Wert« (Vormbusch 2012: 24). Was gute Bildung ist, was effizientes Regieren bedeutet, welche Leistung zählt – all das wird durch Daten nicht nur dargestellt, sondern sozial eingeprägt und institutionalisiert. Zahlen sichern eine bestimmte Wertigkeitsordnung ab und tragen durch ihre bloße Existenz dazu bei, dass diese gesellschaftlich verankert wird. Damit ergibt sich eine enge Verbindung zwischen dem Abschätzen von Werten im Prozess der Quantifizierung und Wertschätzung im Sinne sozialer Anerkennung.
Die kalkulativen Praktiken des Marktes
Dass Märkte spontan entstehen und von einer unsichtbaren Hand gelenkt werden, ist eine Mär, die zwar in bestimmten Zirkeln der Wirtschaftstheorie bis heute akzeptiert wird, einer näheren Betrachtung jedoch nicht standhält. Spätestens seit Max Webers (1963 [1906]) berühmter Formel vom »Geist des Kapitalismus« wissen wir, dass es sich bei Tauschprozessen auf Märkten um kulturelle Praktiken handelt und dass diese eng mit der Herausbildung bestimmter Wirtschaftsweisen verbunden sind. Für Weber war neben der Rationalisierung der Produktion und der Trennung von Haushalt und Betrieb auch die Durchsetzung der Buchführung eine zentrale Voraussetzung des okzidentalen Kapitalismus. Parallel zu Weber hatte auch sein Zeitgenosse Werner Sombart, ein Ökonom und Soziologe, in der Einführung der doppelten Buchführung eine entscheidende Weichenstellung in Richtung einer modernen kapitalistischen Wirtschaftsordnung erkannt. In seinem Hauptwerk Der moderne Kapitalismus (1919) untersuchte er, wie es zur Ausprägung einer rationalen »Wirtschaftsgesinnung« kommen konnte. Erst die Fähigkeit, jederzeit den Schulden- und Vermögensstand bilanzieren zu können, so Sombart, habe den ökonomischen Rationalismus und die Erwerbsidee zur vollen Entfaltung gebracht. Die doppelte Buchführung sei als kulturelle und nicht als rein technische Errungenschaft zu verstehen, die sich auch in der Mentalität einer Gesellschaft niederschlagen müsse.
Sombart und Weber haben früh erkannt, dass zu einem Wirtschaftssystem sozial herausgebildete kalkulative Praktiken gehören, die ökonomisches Handeln konditionieren und in bestimmte Bahnen lenken (Vormbusch 2012). Die Zahlenhaftigkeit hat zudem große Bedeutung für die Herausbildung von Handelsbeziehungen, man denke nur an die Funktion von Geld als universalem Äquivalent. Sobald der Wert einer Ware in Geld bemessen werden kann, lassen sich vielfach anschlussfähige Tauschverhältnisse etablieren. Darüber hinaus braucht es die Vereinheitlichung oder Konvertierbarkeit von Längenmaßen, Gewichten und anderen Größen, damit wirtschaftlicher Austausch florieren kann. Uneinheitliche Maße hingegen machen den Handel unsicher; schon kleinere Abweichungen und Ungenauigkeiten können zur Übervorteilung eines Handelspartners führen und Streit auslösen. Die daraus erwachsenden Vertrauensdefizite waren vor allem dann ein großes Hemmnis, wenn Handel über sehr viele Zwischenstationen und lange geografische und soziale Distanzen hinweg stattfand (Scott 1999ff.). Erst die »metrische Revolution«, so ein Begriff von Witold Kula (1986), ermöglichte es, lokale Begrenzungen aufzubrechen.
Die Erzeugung von Äquivalenz im Hinblick auf quantitative Maße ist ein Baustein des weitergefassten Prozesses der Rationalisierung (Porter 1992). Geld als Verrechnungsmedium einschließlich entsprechender Wechselkurse, standardisierte Maßeinheiten für Längen und Gewichte, die Durchsetzung von technischen Normen – all dies sind letztlich Entwicklungen, die Anschlussfähigkeit und Kompatibilitäten herstellen. Doch nicht nur Handelsbeziehungen werden von Normierungen, Konventionen und Standards beeinflusst, sie entscheiden überdies oftmals darüber, welche Produkte und welche Anbieter sich durchsetzen können. So wie sich in den siebziger Jahren Sony und JVC eine Schlacht um die Vorherrschaft bei den Videostandards lieferten, konkurrieren heute die Giganten der Internetindustrie um die Etablierung bestimmter technischer Normen. Wer es schafft, seine Standards durchzusetzen, kann sich Marktvorteile sichern, da die Konkurrenten von diesem Moment an gezwungen sind, sich mit hohen Kosten umzustellen. Und dennoch erscheinen Standards und ihre Setzungen oft als »boring things« (Lampland & Star 2009: 11), weshalb sie allzu schnell durch das Raster der öffentlichen Aufmerksamkeit fallen.
Auch innerhalb von Unternehmen wurden persönliche Vertrauens- und Loyalitätsbeziehungen nach und nach durch die Sprache der Zahlen abgelöst – sei es im Kontext des Managements und der Mitarbeiterführung, bei der Schaffung firmeninterner Profit Center, bei der Leistungsmessung oder beim Controlling. Unternehmerische Entscheidungen werden an der Schnittstelle von externer Marktperformanz und interner Effizienzorientierung getroffen. Der sagenhafte Aufstieg des modernen Accountings – also die engmaschige Überwachung von Leistungsströmen in Unternehmen –, das die alten (heute vielfach als altbacken geltenden) Ansätze des Rechnungswesens und der Buchhaltung abgelöst hat, verweist auf einen immer strategischeren Umgang mit Zahlen. In Unternehmen haben deshalb auch die Finanzvorstände, die Chief Financial Officers (CFO), erheblich an Einfluss gewonnen. Sie betreiben nicht mehr nur Rechnungswesen im Rückspiegel unternehmerischer Bilanzen, sondern nehmen als die Herren (und manchmal auch Damen) der Zahlen erheblichen Einfluss auf grundlegende geschäftspolitische Weichenstellungen. Die Erfassung, Überwachung und Bewertung aller möglichen Leistungs-, Geld-, und Güterströme dienen einerseits dazu, sehr unterschiedliche Informationen zusammenzuführen und ein Kosten- und Effizienzbewusstsein zu erzeugen, andererseits wird damit die Rechenschaftsfähigkeit gegenüber Außenstehenden (Behörden, Banken oder auch Investoren) gewährleistet. Unternehmen, so heißt es in der Sprache der Börse, sollen mit guten Zahlen glänzen, dann werden sie auch mit hohen Kurswerten belohnt.
Der Staat als Datenmanager
Fragen der statistischen Erfassung, der Verrechnung und der Klassifizierung spielen auch in der Geschichte der Regierungskunst eine prominente Rolle. Der Aufbau militärischer Stärke, Bevölkerungspolitik, der Aufstieg des Steuerstaates und der Demokratie sind immer auch mit Anstrengungen verbunden gewesen, Menschen zu zählen und anhand soziodemografischer Merkmale abzubilden. Selbst im Alten Testament kommt an prominenter Stelle eine Volkszählung vor (»Numeri«, der Titel des 4. Buch Mose, bedeutet auf Deutsch Zahlen), und tatsächlich wird Gott darin sogar als Auftraggeber der Volkszählungen genannt. Der »Staat als Körper«, der sich aus unzähligen Einzelwesen zusammensetzt, ist ein klassischer Bestandteil der dazugehörigen politischen Metaphorik. Das deutsche Wort »Statistik« wiederum bezeichnete interessanterweise ursprünglich die eher nichtquantitative »Staatenkunde« oder »Staatswissenschaft« (Desrosières 2005: 200). Erst später entwickelte sich daraus die amtliche Zahlenkunde, wie wir sie heute kennen. Die statistische »Entdeckung« der Zusammensetzung und Natur der Bevölkerung stattete die Politik mit den Informationen aus, die sie braucht, um regulierend eingreifen und auch die Ressource Bevölkerung für ihre Ziele nutzen zu können (Schmidt 2015).
Dass der Staat sich seinerseits die Zahlensprache aneignete, eröffnete der Politik neue Wege, das soziale Leben zu beschreiben, zu entschlüsseln und zu ordnen: Mengen, Differenzen, Zu- und Abflüsse oder Veränderungen über die Zeit spielten eine zunehmende Rolle, ebenso wie räumliche Strukturen oder die Gliederung der Bevölkerung nach Variablen wie Alter, Geschlecht, Stand, Ethnie oder sozioökonomischem Status. Solche Beschreibungen stellen Versuche dar, eine Gesellschaft lesbar zu machen. Für Regierungen und staatliche Behörden ist Zahlenhaftigkeit in einer unübersichtlichen Wirklichkeit essenziell, um Probleme angemessen zu definieren, so dass anschließend Programme der Intervention darauf bezogen werden können. »Seeing like a state« (Scott 1999) heißt aber nicht, dass durch Daten alle wichtigen Aspekte der Gesellschaft wirklichkeitsgetreu und vollständig erfasst werden. Ganz im Gegenteil: Simplifizierungen und Abstraktionen nimmt man dabei bewusst in Kauf. Es geht allenfalls um einen sehr engen und mit spezifischen Interessen verknüpften Ausschnitt der Realität. Diese ausschnitthaften Repräsentationen sind dann die Grundlage staatlicher Entscheidungen und machen größere planerische Vorhaben erst möglich. Alles, was aus den üblichen Kategorien herausfällt, ist für die Behörden und die Politik nur schwer zu bearbeiten und kann allenfalls als Störgröße oder Idiosynkrasie registriert werden.