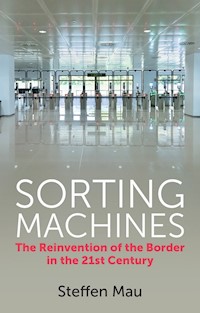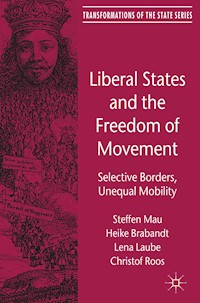13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Steffen Mau wächst in den siebziger Jahren im Rostocker Neubauviertel Lütten Klein auf. 1989 dient er bei der NVA, nach der Wende studiert er, wird schließlich Professor. 30 Jahre nach dem Mauerfall zieht Mau eine persönliche und sozialwissenschaftliche Bilanz. Er nimmt die gesellschaftlichen Brüche in den Blick, an denen sich Verbitterung und Unmut entzünden. Er spricht mit Weggezogenen und Dagebliebenen, schaut zurück auf das Leben in einem Staat, den es nicht mehr gibt. Wie wurde aus der Stadt, in der er gemeinsam mit Kindern aller Schichten seine Jugend verbrachte, ein Ort sozialer Spaltung? Was sind die Ursachen für Unzufriedenheit und politische Entfremdung in den neuen Ländern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
Steffen Mau
Lütten Klein
Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft
Suhrkamp
Für Susanne Balthasar und Thomas A. Schmidt
»Ich hänge nicht an diesem Land,
aber es ist verdammt schwer, es loszuwerden.«
Eugen Ruge
Inhalt
Einleitung
I. Leben in der DDR
1. Neubau
Die Wohnungsfrage
Sozialistische Lebensweise
Zusammen wohnen
2. Soziale Nivellierung und blockierte Mobilität
Gesellschaft der Gleichen oder sozialistische Ständegesellschaft?
Hofierung der Arbeiterklasse
Brechung des Bildungsprivilegs?
Fallen der Status(re)produktion
Mobilitätsblockaden
3. Lebensführung und kulturelle Praktiken
Land der kleinen Leute
Straßenbilder
Sich einrichten
Begünstigungspolitik und Tauschwirtschaft
Lokale Jugendkultur
4. Familie, Privatheit, Erziehung
Familienbande und die »Emanzipation von oben«
Kinder, Kinder
Private Nischen
Der Einzelne und das Kollektiv
Disziplinierung
5. Einschluss nach innen, Abschottung nach außen
Rübermachen
Isolation von Feind und Freund
DDR-Deutsche
Ungeliebte Gäste der DDR
Sozialistische Fremdenfeinde
6. Die formierte Gesellschaft
Überwachte kleine Freiheiten
Mitglieder der Organisation DDR
Sozialistischer Klientelismus
II. Transformationen
1. Zusammenbruch und Übergang
Endlichkeit einer Gesellschaftsform
Zerfallserscheinungen
Ausgebremste Demokratisierung
Interregnum
2. Blaupause West
Übernahmepolitik
Modernisierungsdruck
Habituelle und kulturelle Akkommodation
Das nationale Projekt
3. Vermarktlichung
Kommodifizierung der Werktätigen
Zonierung und Differenzierung
Politische Ökonomie der Unsicherheit
4. Unterschichtung, Überschichtung
Statusbezogene Deklassierung
Aufstieg für alle?
Gesellschaft der Habenichtse
Transfereliten
5. Demografischer Umbruch
Vereinigungsschock
Schrumpfgesellschaft
Männerüberschuss
6. Mentale Lagerungen
Generationenfolge
Soziokulturelle Entwertungen
Vexierbilder von Identität und Herkunft
Ostdeutsche als Migranten?
Sozialer Sinn der Ostdeutschen?
7. Bruchzonen
Verwilderung des sozialen Konflikts
Klasse versus Kultur?
Offene Rechnungen
Die politische Kapitalisierung der Deklassierung
Hausbesuch
Gesellschaftliche Frakturen
Anmerkungen
Einleitung
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 stand ich als Soldat der Nationalen Volksarmee, mit Stahlhelm und munitionierter Kalaschnikow, vor der Werderkaserne in Schwerin. 48-stündiger Wachdienst zur Sicherung des Objekts. Das bedeutete zwei Stunden im Regen vor der Kaserne Wache stehen, dann zwei Stunden Bereitschaftsdienst, dann zwei Stunden schlafen, dann ging der Reigen von vorne los. Jemand hatte unter der Hand ein kleines batteriebetriebenes Radio besorgt, das wir uns bei der Wachablösung heimlich zusteckten, damit die Zeit nicht zu lang wurde. Ein Westsender war eingestellt, dort wurde hektisch per Liveschaltung von der Öffnung der Mauer in Berlin berichtet. Ein Kommentator ließ sich zu der weitsichtigen Prophezeiung hinreißen: »Die Mauer ist auf, das ist das Ende der DDR.« Es dauerte zwar noch ein paar Wochen, bis wir wirklich begriffen hatten, was passiert war und welche Konsequenzen Günter Schabowskis Pressekonferenz haben sollte, aber schon in dieser Nacht war an Ausruhen oder Schlafen nicht zu denken. Nach der Wache hockten wir um das Radio wie um ein Lagerfeuer und versuchten, das, was sich da gerade abspielte, zu verstehen. Größer konnte der Kontrast nicht sein: Hier die triste Soldatenstube, dort die jubelnden Massen und hupenden Trabbis auf der Bornholmer Brücke. Wohl jeder ehemalige DDR-Bürger erinnert sich daran, wie diese eine Nacht so vieles veränderte: ein Moment, in dem die Geschichte, wie von unsichtbarer Hand geleitet, plötzlich eine ganz andere Bahn einschlug.
Systemwechsel, so nennen Sozialwissenschaftler den Übergang von einer Gesellschaftsformation zu einer anderen. Systemwechsel, das war das, was uns völlig unvorbereitet traf und nun biografisch bevorstand. Der Fall der Berliner Mauer markierte gewissermaßen die politische Stunde null, die ein Davor und ein Danach trennte. Das Davor war die wirtschaftlich wie ideologisch abgewirtschaftete DDR, das Danach der Weg in die deutsche Einheit. Zwar haben wir uns angewöhnt, »die Wende« vor allem als Moment der Diskontinuität zu verstehen, diese Sicht verdeckt aber, wie stark – bei allen Brüchen und allen sich vollziehenden Wandlungen – die Verbindung zwischen dem Vorher und dem Nachher ist. Menschen und ihre Biografien, Mentalitäten und sozialen Praktiken stellen diesen Zusammenhang her. Selbst auf der Ebene von Institutionen und Strukturen verbindet sich das, was war, mit dem, was ist und sein wird. Mit »Transformationsgesellschaft Ostdeutschland« ist kein Übergang von einem Anfangs- zu einem Endzustand gemeint, sondern eine andauernde Restrukturierung und Veränderung.
Seit dem Fall der Mauer sind nunmehr dreißig Jahre vergangen – mehr Zeit, als die meisten westdeutschen Kommentatoren damals bis zu einer einigermaßen gelungenen Vollendung der deutschen Einheit veranschlagten. Wer heute das Erreichte bilanziert, sieht in der Tat grundlegende Veränderungen und viele Verbesserungen: Die Spuren der Deutschen Demokratischen Republik sind fast flächendeckend getilgt, neue soziale Arrangements haben Fuß gefasst, Menschen haben sich eingelebt. Die Freiheitsgewinne – ob beim Reisen oder beim Recht, seine Meinung frei und ungehindert zu äußern – sind enorm. Den Menschen im Osten Deutschlands geht es materiell besser, als sie zu DDR-Zeiten jemals zu hoffen gewagt hätten. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung, die Löhne wachsen, das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt, Boomregionen wie Leipzig und Dresden haben sich zu Magneten einer neuen West-Ost-Wanderung entwickelt. Mitunter ist von der Wiedervereinigung als wirtschaftlicher Erfolgsgeschichte die Rede.1 Im Gleichschritt mit der ökonomischen Entwicklung ist auch das subjektive Wohlbefinden im Aufwind – der Glücksabstand zwischen Ost und West schmilzt, weil die Ostdeutschen immer zufriedener werden.2
Wie aus einer anderen Welt klingen da Berichte über die Problemzone Ostdeutschland. Diese stellen die anhaltend hohen Produktivitätsrückstände,3 die fortbestehende Ost-West-Kluft bei den politischen Einstellungen,4 den lautstarken Widerstand gegen Geflüchtete und »die da oben« sowie abgehängte Sozialräume in den Vordergrund. Gravierende Ost-West-Unterschiede gibt es beim Vertrauen in die politischen Institutionen und der Unterstützung für Marktwirtschaft und Demokratie. Laut einer Allensbach-Umfrage sehen nur 42 Prozent der Ostdeutschen die Demokratie als die beste Staatsform an; im Westen sind es 77 Prozent. Nur knapp über ein Viertel der West-, aber über die Hälfte der Ostdeutschen hält den Umstand, ob man aus Ost- oder Westdeutschland stammt, für eine der wichtigsten Trennlinien in der Gesellschaft.5 Immerhin mehr als ein Drittel der Ostdeutschen sehen sich laut neuesten Umfragen als Bürger zweiter Klasse.6 Der Satz »Niemand kümmert sich um uns« steht stellvertretend für das Gefühl, gesellschaftlich zurückgesetzt, ökonomisch und politisch marginalisiert zu sein. Der Frust, so scheint es von dieser Warte aus gesehen, hat in Ostdeutschland vielleicht nicht seine Heimat, aber doch wichtige Trägerschichten gefunden.
Dieses Doppelbild der Entwicklung verweist auf das Nebeneinander von Einheitserfolgen und Scheitern, von Gewinnen und Verlusten, von Hoffnung und Enttäuschung, von Eingewöhnung und Entfremdung. Die Bilanz der Einheit ist nicht nur durchwachsen, sie ist auch durch und durch widersprüchlich. Selbst Individuen wirken oft innerlich gespalten, wenn man sie auffordert, ihre persönliche Situation zu schildern – manch einer entpuppt sich gar als frustrierter Zufriedener oder als glücklicher Enttäuschter.
Um diese Diskrepanz zu entschlüsseln, ist der Begriff der gesellschaftlichen Fraktur hilfreich. Unter einer Fraktur versteht man in der Medizin den Bruch eines Knochens. Viele Frakturen sind unter der Haut verborgen und äußerlich nicht erkennbar, manche aber liegen offen. Oft verheilen sie, wenn es jedoch zu Verschiebungen – der Terminus technicus lautet Frakturdislokationen – kommt, muss man ein Leben lang mit Funktionseinschränkungen leben. Gesellschaftliche Frakturen lassen sich in diesem Sinne als Brüche des gesellschaftlichen Zusammenhangs verstehen, die zu Fehlstellungen führen können. Anders als bei Knochen ist die Wahrscheinlichkeit für eine – noch ein Medizinerwort – vollständige »Reposition« oder Ausheilung gesellschaftlicher Brüche sogar unwahrscheinlich. Gesundheitsmetaphern sind im gesellschaftlichen Bereich nicht ganz unproblematisch, daher hier der Hinweis, dass es nicht um Pathologien geht, sondern um die Fokussierung auf neuralgische Punkte und Reibungsflächen. Ich betrachte Ostdeutschland als eine Gesellschaft mit zahlreichen Frakturen, die sich aus den Besonderheiten von Sozialstruktur und mentaler Lagerung ergeben. Diese sind weder allein der untergegangen DDR noch den Tücken des Einigungsprozesses zuzuschreiben, sondern ergeben sich aus beidem gemeinsam. Eine frakturierte Gesellschaft, so meine ich, verliert an Robustheit und Flexibilität, auch wenn oberflächlich alles in Ordnung scheint. Durch Frakturen können die Belastbarkeit, die Beweglichkeit und die Anpassungsfähigkeit eines gesellschaftlichen Gebildes noch über lange Zeiträume eingeschränkt bleiben. Das erklärt auch die erhebliche Unzufriedenheit, während es gleichzeitig viele positiv zu bewertende Entwicklungen gibt.
Das Buch versucht sich vor diesem Hintergrund nicht an einer Würdigung der Einheitserfolge, berichtet auch nicht datenreich von der ostdeutschen Aufholjagd und sich verbessernden Lebensbedingungen. Dies sei als Spoiler-Warnung vorangestellt. Es leugnet die positiven Entwicklungen nicht, ist aber absichtsvoll einseitig, indem es das Beobachtungsradar auf die Dilemmata, Unwuchten und Widersprüche richtet. Es konterkariert die Annahme relativ friktionsloser Modernisierung sowie die Diagnose der sukzessiven Normalisierung und stellt die These struktureller Brüche im ostdeutschen Entwicklungspfad dagegen. Ich gehe davon aus, dass sich trotz aller Transformationserfolge, trotz Angleichung und trotz kultureller, normativer und mentaler Eingewöhnung die Unterschiede zwischen den beiden deutschen Teilgesellschaften nicht einfach ausschleichen (werden). Sowohl in sozialstruktureller wie auch in mentaler Hinsicht hat sich in Ostdeutschland eine Form der Sozialität herausgebildet, in der neben langsam steigender Zufriedenheit auch Gefühle der Benachteiligung und der politischen Entfremdung wachsen, die mehr sind als ein nicht enden wollendes Murren einiger Ewiggestriger.
Die DDR-Gesellschaft war durch eine nach unten zusammengedrückte Sozialstruktur und eine arbeiterliche Kultur geprägt, was auch auf das Dienstleistungsproletariat und die Transferklassen von heute ausstrahlt – es dominiert eine Mentalität der einfachen Leute. Gab es in der Frühphase beachtliche Aufstiegsmobilität, so war die späte DDR durch eine starre Sozialstruktur und zunehmend verstopfte Pfade in die höheren Positionen gekennzeichnet. Sie war zudem eine eingekapselte und ethnisch homogene Gesellschaft, die kaum Erfahrung mit Zuwanderung gemacht hatte. Die Vereinigung versprach zwar schnelle Freiheits-, Wohlstands- und Konsumgewinne, erfolgte aber als ökonomischer sowie sozialer Schock und strapazierte die Bewältigungskapazitäten der Menschen bis aufs Äußerste.7 Zudem fand sich die DDR-Bevölkerung über Nacht auf den unteren Rängen der gesamtdeutschen Hierarchie wieder und unterschichtete die westdeutsche Gesellschaft. Deklassierungs- und Entmündigungserfahrungen waren an der Tagesordnung, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem man gerade zum ersten Mal die beglückende Erfahrung kollektiver Handlungsfähigkeit gemacht hatte. Es gab einen massiven Elitentransfer von West nach Ost – eine Überschichtung –, die wichtigsten Schaltstellen der ostdeutschen Teilgesellschaft wurden mit neuen, importierten Eliten besetzt. Anders als beim Wiederaufbau der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg kam es im Zuge der Wiedervereinigung nicht zu einer kollektiven Aufwärtsbewegung breiter gesellschaftlicher Schichten. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die Wiedervereinigung in eine Zeit fiel, als auch in Westdeutschland der »kollektive Fahrstuhl« (Ulrich Beck) ins Stocken geriet.8 Die lange Phase kollektiver Wohlfahrtsgewinne, anhaltender Prosperität und offener Aufstiegskanäle – das manchmal so bezeichnete »Goldene Zeitalter« – neigte sich dem Ende zu.9 So stellte sich nicht nur der Weg der wirtschaftlichen Erholung und des Aufschließens als weit steiniger heraus, als erwartet, es kam auch zu erheblichen Mobilitätsblockaden, welche die ostdeutsche Teilgesellschaft auf Dauer kleinhalten sollten. Der Deckel auf der nach unten zusammengedrückten Sozialstruktur wurde somit nicht gelöst, sondern in mancher Hinsicht noch fester zugeschraubt. In der Folge hat sich eine gesellschaftliche Formation herausgebildet, in der Vorbehalte, Systemskepsis und populistische Mobilisierung hervortreten, während die Selbstbindung an eine liberale Ordnung und ein tolerantes soziales und politisches Klima einen schweren Stand haben. Diese Phänomene beschreiben Ostdeutschland weder als Ganzes noch exklusiv, doch verdichten sie sich dort auf besondere Weise.
Ich verbinde diese – zugegebenermaßen ernüchternde – Diagnose nicht mit wohlfeilen Rezepten zur Therapie, weil sozialstrukturelle und mentale Verfasstheiten nicht einfach zu reparieren sind. Worum es mir geht, ist zunächst einmal eine nüchterne Bestandsaufnahme, die uns helfen soll zu verstehen, dass wir es nicht mit Übergangsphänomenen oder damit zu tun haben, dass der Osten einfach nur anders »tickt«. Vermeiden möchte ich auch jedwede nostalgische Verklärung einer ach so gemeinschaftlichen DDR mit echter solidarischer Verbundenheit, weil soziale Kontrolle und Repression nicht nur zur DDR dazugehörten, sondern diese gleichsam konstituierten. Ebenso wenig möchte ich mich aber an dem Schulterklopfen beteiligen, dem sich alle Jubeljahre die Führungskräfte dieses Landes hingeben und dabei übersehen, dass viele der Probleme in Ostdeutschland nicht nur Erblasten des Staatssozialismus sind, sondern im Zuge von Vereinigung und Transformation reproduziert, verstärkt oder gar hergestellt wurden.
Die Auseinandersetzung mit der ostdeutschen Transformation ist nur auf den ersten Blick eine Einladung zur innerdeutschen Nabelschau. Man könnte meinen, im Zeitalter globaler Turbulenzen, europäischer Krisen, transnationaler Migrationsströme und digitaler Transformationen sei der Vorgarten deutsch-deutscher Probleme doch recht klein. Wer möchte sich angesichts vermeintlicher oder tatsächlicher Bedrohungen des westlichen Erfolgsmodells mit den Befindlichkeiten einer zwar vernarbten, aber im internationalen Vergleich letztlich privilegierten Gesellschaft beschäftigen? Einerseits. Andererseits ist das Thema Ostdeutschland auch ein offenes Deutungsfeld, das den lange Zeit triumphierenden Geist des Westens herausfordert. Die Fortschritts- und Modernitätserzählung der westlichen Modellgesellschaft wirkt angekratzt, verschiedene Autoren sprechen schon von einer »großen Regression«, einem schrittweisen Aufweichen institutioneller wie normativer Errungenschaften der sozialen Moderne.10 In vielen Teilen der Welt sind politische Unternehmer erfolgreich dabei, Gegennarrative aufzubauen und daraus Kapital zu schlagen, so dass die Zukunft der westlichen Welt heute wieder offener erscheint als noch vor wenigen Dekaden. Manche konstatieren gar eine »Wiederkehr der Verdrängten«,11 die die Lasten der neoliberalen Marktentfesselung hauptsächlich zu tragen hatten; andere betonen das autoritäre und ressentimentgeladene Moment, das den neuesten sozialen Bewegungen innewohnt.12
Ostdeutschland ist hierbei keine Randnotiz, sondern möglicherweise ein Verdichtungsraum für auch andernorts zu beobachtende Verwerfungen. Eine frakturierte Gesellschaft ist anfälliger für Stimmungen, die aus dem Gefühl des Zu-kurz-Kommens entspringen, aus der Entwertung des eigenen Lebensmodells, aus kulturellen Irritationen, ökonomischer Prekarisierung und den Zumutungen zunehmender Flexibilisierung. Ostdeutschland ist ein Laboratorium dieser übergreifenden Prozesse, weil sich hier auf besondere Weise beobachten lässt, wie das lebensweltliche Gepäck und mentale Tradierungen, ökonomische Entsicherung und politische Integrationsdefizite aufeinandertreffen. Der Osten nimmt möglicherweise sogar eine Pionierrolle beim populistischen Aufstand der Unzufriedenen und Frustrierten ein.
Ich beabsichtige keine Gesamtdarstellung, weder der DDR noch der Wiedervereinigung, noch der gesellschaftlichen Transformation Ostdeutschlands. Angesichts des Umfangs der vorhandenen Literatur – in den Neunzigern gab es eine eigene Kommission zur Untersuchung des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundesländern,13 danach den Sonderforschungsbereich »Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch. Diskontinuität, Tradition und Strukturbildung« (SFB 580),14 und jüngst ist eine mehr als 2000 Seiten lange Kulturgeschichte der DDR erschienen15 – wäre dies auch unredlich, wobei bei der Sichtung der Literatur schon auffällt, dass das sozialwissenschaftliche Interesse am Osten über die Zeit deutlich nachgelassen hat. Meine Ambition ist bescheidener: Ich stelle sozialstrukturelle Wandlungsprozesse seit den siebziger Jahren in den Mittelpunkt und analysiere damit im Zusammenhang stehende Mentalitätsumbrüche. Ich gehe davon aus, dass sich über die Beschreibung sich wandelnder Schichtungs- und Lagerungsbilder einer Gesellschaft – ähnlich einem Röntgenbild – auch ihr gesellschaftlicher Kern freilegen lässt.
Das Buch teilt sich, wie die meisten ostdeutschen Biografien der mittleren und älteren Jahrgänge, in zwei Teile: in ein Leben in der DDR und ein Leben im wiedervereinigten Deutschland, mit der Wende als kritischer Weichenstellung. Im ersten Teil beschreibe ich den Alltag und die Sozialstruktur der DDR. Dabei greife ich – für einen Wissenschaftler möglicherweise ungewöhnlich – auch auf das Selbsterlebte zurück. Wie haben wir gelebt? Wie hat die Arbeitsgesellschaft die Menschen integriert? Welche Rolle spielten Konformismus und Kontrolle? Wie stand es um die viel beschworene Völkerfreundschaft der DDR? Mein Befund ist der einer stark nivellierten, um die Arbeit herumstrukturierten, geschlossenen und ethnisch homogenen Gesellschaft, die sich vom westdeutschen Pendant – mittelschichtdominiert, migrantisch geprägt, zunehmend individualisiert – grundlegend unterschied. Mit verstopften Aufstiegskanälen, politischen Erstarrungstendenzen und wachsender Unzufriedenheit war die DDR zum Ende hin zudem ein erschöpftes und ausgelaugtes Land, unfähig dazu, eine neue Entwicklungsdynamik auszulösen.
Mit der Wiedervereinigung, so die Diagnose des zweiten Teils, wurden viele der strukturellen Eigenheiten allerdings nicht aufgelöst, sondern weitergetragen, mitunter sogar vertieft. Die politische Mobilisierung im Jahr 1989 wurde bald von einer Duldungsstarre abgelöst, die Menschen wurden aufgefordert, sich ohne Wenn und Aber in die neuen Verhältnisse einzupassen. Die althergebrachten Mentalitäten sollten zurückgelassen werden, um für die Gesellschaft des Westens fit zu werden. Die Erfahrung der soziokulturellen Entwertung führte zu einer Verfestigung alter Prägungen – einschließlich einer Distanz zu den politischen Institutionen und ihren Repräsentanten. Der Geburteneinbruch und die massenhafte Abwanderung der Mobilen und der Qualifizierten hinterließen tiefe, nicht ausgeheilte demografische Narben. Aufgrund der Vielzahl struktureller Frakturen gibt es eine starke Empfänglichkeit der ostdeutschen Gesellschaft für Ressentiment und Radikalisierung. Dabei ist es die Summe und Verklammerung der aus der DDR hergebrachten und der im Transformationsprozess erzeugten oder in Kauf genommenen Defekte, die die ostdeutsche Teilgesellschaft heute wie eine Hypothek belasten.
Lütten Klein (der Name stammt aus dem Wendischen und bedeutet »kleiner Ahorn«) ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin: Als DDR-typisches Neubaugebiet verkörpert er die Erfindung der sozialistischen Stadt auf der grünen Wiese mit typischen Lebenswegen und Lebensweisen. Das Viertel ist ein Ort des sozialstrukturellen Umbruchs, der viele seiner Bewohner in andere Bahnen katapultiert hat und an dem sich Beschleunigung und Stillstand treffen, wo sich Selbstbehauptungskämpfe abspielen, wo Mentalitäten und Weltbeziehungen sich aneinander reiben. Lütten Klein ist mein Fenster zur Beobachtung des sozialen Wandels in Ostdeutschland, öffnet mir einen Erfahrungsraum und den Zugang zum Erleben aus erster Hand, alle Risiken der Zeitzeugenschaft, der Subjektivität und der Verwendung des Wörtchens »ich« inklusive. Meine Perspektive verbindet die Transformation der ostdeutschen Teilgesellschaft also mit einem konkreten, von mir immer wieder besuchten und befragten Ort, so dass Vogel- und Froschperspektive zusammenkommen. Die Nutzung der eigenen biografischen Erfahrung färbt mein Porträt der ostdeutschen Gesellschaft ohne Zweifel subjektiv ein, bietet aber auch das Privileg der Innenschau, des Dabeigewesenseins. Sie tritt neben meine weiter gefasste Perspektive auf den Wandel der ostdeutschen Gesellschaft, die sich wissenschaftlicher Befunde und vieler empirischer Mosaiksteine bedient und diese zu einem eigenen Argumentationsgang verdichtet.
Über wissenschaftliche Quellen und meinen eigenen Erfahrungshorizont hinaus nutze ich Informationen aus zahlreichen Erkundungen vor Ort, die ich zwischen Sommer 2017 und März 2019 unternommen habe. Über dreißig Interviews habe ich mit heutigen und ehemaligen Lütten Kleinern geführt. Oft hat mir erst der Stallgeruch Zugang zu meinen Gesprächspartnern verschafft. Einige habe ich aus meinem Bekanntenkreis rekrutiert, bei anderen einfach geklingelt oder sie an der Straßenbahnhaltestelle angesprochen, wieder andere als Amts- oder Funktionsträger kontaktiert. Einige haben mich zu sich ein-, dann wieder ausgeladen, manches Gespräch lief ins Leere. Bis auf diejenigen, die ich aufgrund ihrer Funktion interviewt habe, wurden die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner anonymisiert. Ihre Erzählungen und Weltsichten – den O-Ton des Erlebens – nutze ich, um den Gegenstand anschaulicher zu machen, wissenschaftliche Einsichten und Argumente mit Leben zu füllen und den Erfahrungen eine Stimme zu geben – also eher mit illustrierendem Anspruch denn im Sinne einer methodisch abgesicherten qualitativen Studie. Meine Gesprächspartner rückten auch mein eigenes Bild des Lütten Kleiner Alltags von damals und heute zurecht.
Als Teilnehmer am »Experiment Vereinigung«16 bin ich in meiner Betrachtung dieses Großversuchs natürlich befangen, aber vielleicht auch nicht mehr als eine amerikanische Kollegin, die sich zur Situation in den USA äußert, oder ein französischer Soziologe, der die französische Gesellschaft untersucht. Wolle man etwas über die DDR wissen, so hat es mein 2018 verstorbener akademischer Lehrer Wolfgang Zapf immer betont, brauche man »Ortskenner«, allein durch Außenanschauung und Fernerkundung ginge das nicht. Für mich selbst waren die Vor-Ort-Besuche eine Herausforderung. Zu vielen und zu vielem habe ich sowohl Distanz als auch Nähe empfunden. Distanz, weil mein eigenes Leben heute mit dem Lütten Kleiner Alltag so wenig gemein hat; Nähe, weil mir die Art, auf die Welt zu schauen, und das mentale Gepäck vieler Bewohner dann doch vertraut waren.
All jenen, die mir als Interviewpartner Rede und Antwort gestanden haben, bin ich zu Dank verpflichtet. Danken möchte ich zudem allen, die mir während des Schreibprozesses Stichworte und Anregungen geliefert haben, oft vermutlich ohne dass sie dies selbst merkten. Ein besonderer Dank geht an Thomas A. Schmidt, Susanne Balthasar, Fabian Gülzau, Bernd Hunger, Sebastian Büttner, Michael Windzio, Kerstin Martens, Jürgen Gerhards, Kirsten Hartmann, Thomas Lux, Birgit Mau, Stefan Svallfors, Heike Solga, Hans Nitschke, Hagen Schulz-Forberg, Meta Cramer und Sven Schenkewitz. Marten Körner hat mir als Fotograf und Freund neue Blicke eröffnet. Katja Kerstiens hat den Text gewohnt souverän und kritisch gelesen und mich zu vielen Verbesserungen motiviert. Carolin Blauth und Julian Heide haben mir bei den Recherchen geholfen und Grafiken erstellt. Heinrich Geiselberger hat mich beim Suhrkamp Verlag betreut. Ohne ihn, seine Ermunterungen, sein Vertrauen in das Projekt und seine gekonnte Arbeit am Text wäre das Buch nicht zustande gekommen. Christian Heilbronn hat mir schon zu einem frühen Zeitpunkt wichtiges Feedback gegeben. Große Teile dieses Buchs konnte ich als Visiting Fellow am Center for European Studies an der Harvard University schreiben. Für die Einladung und den intensiven Austausch bin ich insbesondere Gregorz Ekiert, Peter Hall und Michèle Lamont zu Dank verpflichtet.
I. Leben in der DDR
1. Neubau
Die Wohnungsfrage
Lütten Klein, der Stadtteil meiner Kindheit und Jugend, liegt auf halbem Weg zwischen dem Rostocker Stadtzentrum und dem Fischer- und Touristenort Warnemünde. Lütten Klein wurde zwischen Mitte der sechziger und Mitte der siebziger Jahre als Teil des Wohnungsbauprogramms der DDR im Plattenbaustil hochgezogen: Mehr als 10 000 Wohnungen entstanden hier in nur einem Jahrzehnt. Rostock, die alte Hansestadt an der Ostsee, war im Zweiten Weltkrieg zu weiten Teilen zerstört worden, über achtzig Prozent der Wohngebäude waren beschädigt. In der Innenstadt wurde repariert, manche Perle der Backsteingotik durch Neues ersetzt; nach und nach erweiterte sich die Stadt aber auf die umliegenden Äcker. Auch dank der sozialistischen Plattenbauten stieg die Einwohnerzahl von unter 70 000 zum Ende des Krieges auf über 250 000 im Jahr 1989, womit Rostock zu den zehn größten Städten der DDR zählte.
Zu DDR-Zeiten war Rostock Bezirksstadt, verlor dann aber nach der Wiedervereinigung den Wettstreit um den Sitz der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns an das kleinere Schwerin. Für die DDR war Rostock das »Tor zur Welt«, über seine Häfen lief ein Großteil des Außenhandels, die Stadt war Zentrum des Schiffbaus, hier wurden Dieselmotoren und Fischkonserven produziert, die Staatsreederei hatte hier ihren Sitz. Hansa Rostock, in der DDR eine typische Fahrstuhlmannschaft mit Auf- und Abstiegen sowie einer unerschütterlichen Anhängerschaft, wurde 1991 mit dem Westtrainer Uwe Reinders letzter Meister der DDR-Oberliga. Stolz war man in Rostock schon immer darauf, eine der ältesten Universitäten Deutschlands zu haben. Das Studentenleben prägt bis heute die gründerzeitliche Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Walter Kempowski, der große Chronist der Stadt, erzählt in seinen Büchern eindrucksvoll vom Leben der Rostocker Generationen: von der Wilhelminischen Zeit bis in die sechziger Jahre, vom Rostock der verwinkelten Gassen, des Kopfsteinpflasters und der bürgerlichen Familienbande, das allerdings so ganz anders war als das Rostock der Neubauviertel.
Lütten Klein war damals Teil eines ganzen Ensembles neuer Stadtgebiete im Rostocker Nordwesten. Dazu gehören Schmarl, Evershagen, Groß Klein und das durch die fremdenfeindlichen Ausschreitungen im August 1992 zu trauriger Berühmtheit gekommene Lichtenhagen. Wir wohnten in der zentralen Rigaer Straße, die Lütten Klein in eine Nord- und eine Südhälfte teilt. Die drei 18-geschossigen Hochhäuser in dieser Straße gelten als das Wahrzeichen des Viertels: »Windmühlenhäuser« werden sie genannt, weil ihr quadratischer Grundriss kleine Ausbuchtungen hat, die Windmühlenflügeln ähnlich sehen. Die Ausbuchtungen wirken wie Windfänge, die nicht nur die Gebäude schwanken lassen, sondern schon bei kleinerer Windstärke zu Pfeifgeräuschen führen. In unserem Hochhaus gab es auf jeder Etage ein verschachteltes Flursystem, das zu zehn Wohnungen führte; es müssen damals zwischen vier- und fünfhundert Menschen im Haus gewohnt haben. In der Mitte waren zwei Schächte für die Fahrstühle eingebaut, daneben befand sich in einem separaten Raum der Müllschlucker, durch den Abfälle in die Tiefe fielen. Wir, Eltern und drei Kinder, bewohnten eine Vierraumwohnung in der achten Etage und konnten bis nach Warnemünde und zur Kabelkrananlage der Warnowwerft sehen. Aus Sicherheitsgründen waren die Fensterbrüstungen allerdings so hoch, dass man als Kind auf einen Stuhl steigen musste, um hinauszuschauen. Die Ostsee kam nicht in den Blick, nur der Waldsaum auf der Steilküste. Wenn die Schiffe in den Hafen einliefen, sah es daher immer so aus, als führen sie direkt durch die Baumkronen hindurch.
Die DDR war stolz auf ihre Neubaugebiete, so stolz, dass man Postkarten von ihnen herstellte. So mancher Ostseeurlauber aus Sachsen, Thüringen oder Berlin mag sich ein Lütten Kleiner Motiv besorgt haben, um es mit einem kurzen Gruß an die Daheimgebliebenen zu schicken. Die Neubaugebiete – damals sprach niemand von der »Platte« – waren Ausweis sozialistischer Leistungskraft sowie des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und Ort der Verwirklichung einer neuartigen Lebensweise. Sie waren ein »riesiges Freiluft-Experiment«1 und standen Pars pro Toto für das, was die DDR sein wollte. Immerhin galt der Wohnungsbau als Kernstück der seit Anfang der siebziger Jahre proklamierten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, welche eine »Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus« herbeiführen sollte. Die Bauherrin DDR setzte nicht auf Sanierung und Erhalt, sondern plante mit den Neubaugebieten den Entwurf einer traditionslosen Zukunft. Hier, in den neuen Großsiedlungen, musste nicht auf Bestehendes Rücksicht genommen werden, drängten sich keine Repräsentationen des Alten in den Blick, musste man sich nicht wie andernorts zwischen Bewahren oder Zerstören entscheiden. Wo alle Formen und Funktionen auf dem Reißbrett erschaffen werden konnten, ließen sich Vorstellungen des sozialistischen Miteinanders realisieren, welche die gesamten Lebensumstände erfassten.
Die DDR errichtete zahlreiche neue »Idealstädte«, in denen Arbeit und Leben der sozialistischen Menschengemeinschaft ihren Platz finden sollten. Christoph Weinhold, der 1966 während seines Architekturstudiums als Praktikant nach Rostock kam, blieb und später, nach der Wende, Architekt der Hansestadt werden sollte, war einer der Planer der Neubauten im Nordwesten Rostocks. Lütten Klein hatte, so seine Einschätzung, »eine besondere Position im Kanon der Entwicklung des Städtebaus, gehörte es doch vom Planungsansatz und von der räumlichen Dimension her mit Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt und Schwedt zu den ersten großen, durch Arbeitskräftekonzentration hervorgerufenen Stadt- und Stadtteilplanungen«.2 Das Vorhaben wurde auch in den anderen sozialistischen Ländern aufmerksam zur Kenntnis genommen und fand Eingang in zahlreiche Standardwerke zur sozialistischen Baukultur. Im Vergleich zu vielen Altbauten, die auf dem technischen Standard der Jahrhundertwende verharrten, war die Wohnqualität hier von »konkurrenzlose[r] Attraktivität«:3 Die Wohnungen galten als komfortabel, da sie mit Fernwärme und nicht mit Kohleöfen beheizt wurden, warmes Wasser aus den Hähnen kam und alle lebensnotwendigen Infrastrukturen vor Ort vorhanden waren.
Die »Lösung der Wohnungsfrage«, die für die Parteiführung oberste Priorität hatte, wurde mit der Entwicklung eines »Einheitsbausystems« vorangetrieben, eines modularen Systems mit wenigen Bauteilen, aber großer Flexibilität bei der Zahl der Geschosse und den Wohnungsgrößen. Mitte der achtziger Jahre erreichte der industrielle Wohnungsbau in der DDR einen Anteil von über achtzig Prozent.4 Natürlich gab es auch im Westen Großwohnsiedlungen, man denke an das Märkische Viertel in Berlin, Köln-Chorweiler oder die Neue Vahr Bremen, ihr Anteil am gesamten Wohnungsbestand lag jedoch bei gerade einmal zwei Prozent.5 Zunächst als »Entlastungsstädte« gedacht, galten sie schon nach kurzer Karenzzeit als Orte, an denen sich soziale Probleme verdichteten. In der DDR hingegen wohnte fast ein Viertel der Bevölkerung in der »Platte«, in Rostock damals sogar siebzig Prozent.6 Die populärste Variante war die Wohnbauserie (kurz WBS) 70, die maßgeblich von dem Architekten und Stadtplaner Wilfried Stallknecht entwickelt wurde, der dann selbst viele Jahrzehnte in einem elfgeschossigen Plattenbau in Berlin-Lichtenberg lebte – der Prototyp von 1970 steht heute in Neubrandenburg unter Denkmalschutz. Stallknecht ersann eine Vielzahl gestalterischer Lösungen, die im Hinblick auf Materialaufwand und Effektivität Maßstäbe setzten und manch innovative Züge trugen. Es lassen sich sogar Verbindungen zwischen den Plattenbauten der DDR und dem industriellen Wohnungsbau der zwanziger und dreißiger Jahre – der damaligen Avantgarde der Moderne – herstellen, einige der namhaftesten Architekten der DDR stammten aus dieser Bewegung.7 Durch die Vermassung und schablonenhafte Nutzung für riesige Wohnkomplexe traten allerdings immer mehr das Einheitsgrau der Fassade und die Variationsarmut dieser Architektur in den Vordergrund. In der gesamten DDR wurden bis 1990 knapp 650 000 Wohneinheiten mit dem WBS-70-Modul gebaut.
Regelmäßig sah man in der Aktuellen Kamera, den Hauptnachrichten des DDR-Fernsehens, wie hochrangige Politfunktionäre irgendwo die x-hunderttausendste Wohnung übergaben, gern mit einem großen, aus Holz oder Pappmaché gefertigten Schlüssel, der an eine ausgesuchte sozialistische Modellfamilie überreicht wurde. »Wir bauen nach den neuesten wissenschaftlich-technischen Erfahrungen für den Sozialismus«, so war es auf dem Großplakat zum ersten Spatenstich in Lütten Klein am 2. November 1962 zu lesen. Nach Lütten Klein kam dann 1966 sogar der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht mit seiner Frau Lotte angereist, um die Einweihung der ersten Kaufhalle zu feiern. Die Augenzeugen von damals erzählen, dass man in aller Schnelle den Rasen hatte begrünen müssen, weshalb man mit Schweinemist düngte, so dass es heftig stank. Sogar Apfelsinen habe es an diesem Tag in der Kaufhalle gegeben, allerdings seien diese wieder mitgenommen worden, als der Tross des Staatsratsvorsitzenden abzog. Da die Siegerpose im real existierenden Sozialismus zum guten Ton offizieller Verlautbarungen gehörte, wurde auch gern übertrieben und geschönt. Nach eigenen Angaben wurden bis zum Ende der DDR etwa drei Millionen Plattenbauwohnungen gebaut und übergeben; Zählungen nach der Wende kamen allerdings auf weniger als zwei Millionen Einheiten Der Kraftakt war dennoch gewaltig: In Lütten Klein lebten schon 1972 32 800 Menschen, Ende des Jahrzehnts waren es dann über 40 000.
Abb. 1: Spielplatz in Lütten Klein (1969)
Sozialistische Lebensweise
Eine Plattenbausiedlung als lebenswerten Sozialraum wahrzunehmen ist für Menschen, die hohe Decken, Stuck und Eichenparkett, gewachsene Innenstädte oder gar das Häuschen im Grünen bevorzugen, kaum nachzuvollziehen. Die »Unwirtlichkeit unserer Städte« (Alexander Mitscherlich),8 so möchte man meinen, muss dort zu Hause sein. Als »Arbeiterschließfächer« sind diese Neubausiedlungen bezeichnet worden, als »Fickzellen mit Fernheizungen« werden sie in einem Stück des Dramatikers Heiner Müller verspottet, der selbst in einer wohnte. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, denn auch in diesen Wohnkomplexen organisierte sich das soziale Leben, machte sich Alltag breit, entwickelte sich ein spezifisches Wohnbewusstsein, wurde ein Gefühl von Fortschritt und Modernität ausgebildet, entstanden durchaus selbstbewusste Wohnmilieus. Anders als heute, wo man mit der »Platte« häufig abgehängte und sozial problematische Quartiere verbindet, waren es damals vielleicht nicht Sehnsuchtsorte für alle, aber doch attraktive Wohngegenden, in die Familien mit Kindern gerne zogen. Viele Bewohner sahen die innerstädtischen Mietskasernen – Ofenheizung, Klo auf halber Treppe etc. – als primitiv an und fühlten sich in den Neubaugebieten wohl, nicht entfremdet. Nicht unwichtig dürfte dabei gewesen sein, dass dort vielfach Menschen aus anderen Regionen angesiedelt wurden. Sie kamen als Zuzügler, um die Arbeitskräftenachfrage zu bedienen, und hatten einen anderen, weniger vergangenheitsgetränkten Blick auf die Städte, die sie bewohnten. Der Andrang auf die »Wohnungen mit Vollkomfort« war groß, die Wartelisten bei den Vergabestellen lang. Die soziologischen Untersuchungen der DDR zeigen dementsprechend eine hohe Wohnzufriedenheit, die sich auch auf das soziale Umfeld erstreckte,9 wobei man darauf hinweisen muss, dass Untersuchungen zu den westdeutschen Großsiedlungen Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre interessanterweise zu durchaus ähnlichen Ergebnissen kamen.10
Für Rostock selbst können wir auf eine Befragung zurückgreifen, die Anfang der achtziger Jahre unter Leitung des Kultur- und Stadtsoziologen Fred Staufenbiel von der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar durchgeführt wurde. Staufenbiel schickte zwei Seminargruppen, ungefähr fünfzig junge Frauen und Männer, für vier Wochen nach Rostock. Die Stadt stellte kostenlose Unterkünfte in Lütten Kleiner Wohnheimen zur Verfügung, öffnete Zugänge zu den Institutionen und sorgte für die Verpflegung – diejenigen, die dabei waren, berichten von tollen Festen und einer aufregenden Zeit. Die Studierenden schwärmten täglich aus, um Interviews zu führen, Beobachtungen anzustellen, zu fotografieren, zu zeichnen und zu kartieren.11 Da Befragungen als heikel galten und von den obersten Stellen genehmigt werden mussten, benannte man sie kurzerhand in »Einwohnergespräche« um. Die Daten des damaligen Surveys sind heute noch verfügbar. Danach zeigt sich in den Neubaugebieten Lütten Klein, Lichtenhagen und Schmarl eine große Wohnzufriedenheit und ein überwiegend positives Bild des Quartiers (Schaubild 1). Die Bewohner assoziieren Begriffe wie »sauber«, »übersichtlich«, »schön«, »einladend«, »weit«, »farbig«, »gemütlich« und »leise« mit ihren Wohngebieten, eher auf der Negativseite steht »einsam«. »Langweilig« ist das Attribut, das – insbesondere bei den Lütten Kleinern – hervorsticht.
Lütten Klein sollte von Anfang an mehr als eine Schlafstadt sein, auch wenn tagsüber die meisten Erwachsenen mit dem Bus oder der S-Bahn in die Betriebe pendelten – neunzig Prozent arbeiteten außerhalb des Wohngebiets. Als eher traditionell organisierte Arbeitsgesellschaft, in der die Betriebe eine zentrale Integrationsfunktion übernahmen und die Erwerbstätigkeit im Mittelpunkt stand, kannte die DDR keine Diversifizierung des Tätig-Seins, keine Auszeiten, keine freie Gestaltung des Tagesablaufs und auch keine Arbeitslosigkeit. Rentner gab es in Lütten Klein damals so gut wie keine, so dass die Straßen und die Häuser während des Arbeitstages weitgehend verwaist waren. Nachmittags aber, wenn die Leute nach Hause kamen, erwachte das Leben, wurden Besorgungen gemacht, traf man die Menschen auf der Straße. Die DDR plante in ihren Vorzeigevierteln das gesamte Leben gleich mit: Kindergärten und Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Kulturhäuser. In der gut sortierten Kinder- und Jugendbibliothek in der Turkuer Straße lieh ich mir fast wöchentlich Bücher aus, am liebsten die in der DDR aufgelegte Jules-Verne-Reihe, später dann die grauen Dostojewski-Bände vom Aufbau-Verlag. In Lütten Klein gab es über den ganzen Stadtteil verteilt Kaufhallen, eine davon sogar mit Kinderbetreuung am Eingang. An etlichen Hausecken hatten die Erbauer sogenannte »Dienstleistungswürfel« hingesetzt, in denen staatliches Kleingewerbe, also Schuster, Schneider und Wäscherei, untergebracht waren. Im Kaufhaus Magnet konnte man von Kleidung bis zum Kühlschrank alles kaufen, was die DDR-Produktpalette hergab. Die Sparkasse der DDR, den Friseur und den Kinderzahnarzt hatte man in normale Wohnungen gesetzt. Das herausragende Bauwerk in Lütten Klein war (und ist) die Mehrzweckhalle, ein Bau mit originell gefalteter Dachkonstruktion des Architekten Ulrich Müther, die bei ihrer Eröffnung 1968 als die »modernste Einkaufshalle unserer Republik« gefeiert wurde. Das futuristisch anmutende Gebäude beherbergte einen Kultursaal, ein Kinderkaufhaus, einen Fischladen und eine Kaufhalle. Davor standen ein Springbrunnen und ein großer Zeitungskiosk. Angrenzend an Lütten Klein wurde in den siebziger Jahren das parkähnliche Erholungsgebiet Fischerdorf eröffnet: Hier konnte man im Winter rodeln, im Sommer am Teich spazieren gehen und in einem reetgedeckten Restaurant zu Mittag essen. »Alles war da«, sagen die Bewohner noch heute. Man könnte von einer »Stadt der kurzen Wege« sprechen.
Abb. 2: Die Mehrzweckhalle in Lütten Klein (1968)
Abb. 3: Die Selbstbedienungskaufhalle in der Mehrzweckhalle (1968)
Schaubild 1: Beurteilung der Rostocker Neubaugebiete Lütten Klein, Lichtenhagen, Schmarl (1982). Datenquelle: Kuhn et al. 1983 (363 Befragte); eigene Auswertung
In der sozialistischen Stadt wurde die gesellschaftliche Nachfrage nach Kultur, Bildung, Erholung oder Sport so in die räumliche Ordnung eingepasst, dass es möglich war, auch die Lebensformen insgesamt zu vereinheitlichen. In Rostock versuchte man aber – anders als an vielen anderen Orten der DDR – den neuen Vierteln jeweils ein eigenes Gesicht zu geben. Lütten Klein war noch durch eine recht starre Blockstruktur geprägt, in den anderen, danach gebauten Wohngebieten wurden die Formen dann aufgelockerter, runder. Man versuchte sie um einen imaginierten Kern herum zu organisieren. Liest man die damaligen Überlegungen der Stadtplaner nach, stehen diese im Widerspruch zu den üblichen Verdikten der Einfallslosigkeit, des Mangels an architektonischem Ehrgeiz oder der einheitsgrauen Vermassung. Berichtet wird von den vielfältigen Kämpfen um den Einsatz von Klinkerelementen zur Fassadengestaltung, die die norddeutsche Backsteintradition aufnehmen, um die Auflockerung der Bebauungsstruktur, um begrünte Innenhöfe und Gärten, um boulevardähnliche Fußgängerzonen mit Wasserspielen, Geschäften und Erholungszonen. In Lichtenhagen integrierte man sogar Atelierwohnungen, um Künstler in die »Platte« zu holen und eine bessere Durchmischung zu erreichen. Die Ziele klingen auch heute noch edel:
Wir wollten einen in der Struktur, in der grundsätzlichen Gestaltung und in der Erlebbarkeit unverwechselbaren Stadtteil schaffen. Er sollte durch regionale und landschaftsrespektierende Raumbezüge, stadtstrukturelle Zuordnungen und ortstypische Erinnerungen für die neuen Bewohner […] eine sich entwickelnde Identität mit dem Interesse an geschichtlichen Bezügen und Umfelderkundungen ermöglichen. Unsere Hoffnung war sogar ein Heimischwerden bis zu einem entstehenden Heimatgefühl.12
Interessanterweise spielte die Soziologie in den Überlegungen der Stadtplaner von damals schon frühzeitig eine große Rolle, es gab einen intensiven Austausch mit Wissenschaftlern der Universität Rostock. Man beschäftigte sich mit der Frage, wie auf der grünen Wiese und unter der Maßgabe modularisierter Bauweise lebenswerte Stadträume entstehen konnten; ein aus Experten zusammengesetzter Problemrat »Territorium und Lebensweise« erkundete die Fallstricke der sozialistischen Baukultur. Noch heute sagt der Architekt Christoph Weinhold, der nach wie vor in Lütten Klein lebt und von seinem Wohnzimmersessel aus den halben Stadtteil überblicken kann: »Lütten Klein ist eine Leistung, auf die man stolz sein kann, aber man muss diese Wohngebiete natürlich auch aus ihrer Zeit heraus verstehen.«
An unsere Wohnung kamen meine Eltern über die Poliklinik vor Ort, in der meine Mutter als Ärztin arbeitete, zuvor hatten wir in einem kleineren Apartment in Lütten Klein gelebt, das der Betrieb meines Vaters vermittelt hatte. Die Poliklinik »Salvador Allende« war ein leicht erhöht stehender Gebäudekomplex am östlichen Ende der Rigaer Straße, den die Planer errichten ließen, um die Gesundheitsversorgung in den Neubaugebieten sicherzustellen. Meine Mutter hatte einen kurzen Arbeitsweg, mein Vater war Abteilungsleiter in einem Schiffbaubetrieb und fuhr jeden Morgen mit dem Auto in den VEB. Alle drei Kinder, meine zwei älteren Schwestern und ich, gingen vor Ort in die 35. Polytechnische Oberschule. Meine Eltern, Jahrgang 1935 und 1940, hatten für ihre Generation typische Aufsteigerkarrieren gemacht. Sie gehörten zu den konformistischen Kohorten, denen die frühe DDR recht große Entwicklungsmöglichkeiten einräumte, wobei sie im Gegenzug Loyalität und Mitarbeit am sozialistischen Aufbauprojekt einforderte. Das Bewusstsein dafür, dass ohne die Existenz der DDR solche Bildungs- und Laufbahnchancen kaum hätten wahrgenommen werden können, nährte bei vielen in ihrer Generation die Bereitschaft, dem Staat die Stange zu halten. Meine Eltern waren somit echte Kinder der DDR, auch wenn mein Vater immer eine distanzierte Haltung zur Phrasenhaftigkeit der politischen Verlautbarungen einnahm und diese auch uns Kindern vermittelte. Indoktrination oder blinde Gefolgschaft habe ich bei uns zu Hause selten erlebt, eher Pragmatismus und ein Sich-Einfügen in die Verhältnisse. Zum 1. Mai hing bei uns die DDR-Fahne aus dem Küchenfenster, wurde dann aber schnell wieder eingerollt.
Unser tägliches Leben fand zumeist innerhalb der Koordinaten des Viertels statt. Wir Kinder sind, soweit ich mich erinnern kann, von Anfang an allein zur Schule gegangen, oftmals holten wir unterwegs noch Freunde ab. Im Norden und im Süden von Lütten Klein gab es jeweils vier große, in einem Karree angeordnete Schulen, in die früh am Morgen alle strömten. Auch am Nachmittag bewegten wir uns völlig frei im Viertel, um dann zum Abendessen wieder daheim zu sein. Unsere Freizeit verbrachten wir überwiegend in Lütten Klein, trafen uns zu Hause, spielten auf den Grünflächen Fußball oder blieben im Schulhort. Im Sommer nahmen wir allerdings oft die Räder und fuhren eine Viertelstunde bis zum Ostseestrand. Das exotischste Ereignis, an das ich mich erinnere, war ein Besuch des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro im Jahr 1972, der stehend im offenen Wagen auf der Stadtautobahn an uns winkenden Kindern vorüberfuhr. Ein imposanter Mann in Uniform, mit dichtem Bart und Militärkäppi – ein Kontrastprogramm zu den ihn umringenden graugesichtigen Funktionären in Anzug und Krawatte, aber auch zum Lütten Kleiner Plattenbau.
Zusammen wohnen
In der DDR gab es für die breite Masse der Bevölkerung kaum wohnbezogene Formen der sozialstrukturellen oder statusmäßigen Segregation – man wohnte zusammen und man wohnte gleich. Innerhalb der Großwohnsiedlungen sollte es besonders egalitär zugehen. Programmatisch heißt es in einer Schrift von damals: »Der Wohnkomplex einer Stadt im Sozialismus ist nicht durch Differenzierung nach Einkommensklassen, Berufsständen oder anderen Unterschieden gekennzeichnet […]. Jeder wohnt unter den gleichen Bedingungen in den gleichen Wohnungen.«13
Natürlich gab es in der DDR auch Marginalisierte, die unter schlechter Ausstattung und gravierenden Mängeln ihrer Wohnungen litten, und auf der anderen Seite privilegierte Gruppen, die in alten Villenvierteln lebten oder sich ein Einfamilienhaus bauen konnten. Für die Masse der Werktätigen zeichnete jedoch die zentrale Wohnraumversorgung der DDR verantwortlich. Da es keinen freien Mietmarkt gab, wurde Wohnraum gleichsam zu einem – wortwörtlichen – Schlüsselgut, über das die DDR Verhalten prämierte. In Zusammenarbeit mit den Betrieben, die über eigene Kontingente Belegungsrechte vergeben konnten, siedelte man in den Neubaugebieten vorzugsweise Werktätige an, viele Facharbeiter und mittlere Angestellte sowie überdurchschnittlich viele Personen mit Hoch- und Fachschulabschlüssen, die zur technischen Dienstklasse der DDR zählten.14 Die Nationale Volksarmee okkupierte in Lütten Klein einen ganzen Wohnblock, in dem Offiziere und zivile Angestellte der Marine lebten.
Die »Platte« versammelte alle Schichten, alle Berufsgruppen und stellte durch die standardisierten Lebenslagen und die geringe Varianz der Lebensformen Kohäsion zwischen unterschiedlichen sozialen Fraktionen her. Sie beseitigte Trennungslinien zwischen akademisch Qualifizierten, Facharbeitern, Angestellten sowie Un- und Angelernten und schuf ein schichtenübergreifendes »respektables Sozialmilieu«.15 Unsere Nachbarn im Hochhaus waren Diplomingenieurinnen, Bäcker, Stahlschiffbauer, Lehrerinnen, Straßenbahnschaffner, Opernsänger, Sprachwissenschaftlerinnen, Seemänner, Sparkassenangestellte, Bauzeichnerinnen, NVA-Offiziere. Selbst Universitätsprofessoren, das Leitungspersonal sozialistischer Betriebe und höhere Politfunktionäre wohnten bei uns im Viertel. So konnte man – ohne dass dies in irgendeiner Weise als falsche Fraternisierung mit dem Volk der Werktätigen angesehen worden wäre – den Direktor einer Rostocker Werft aus einem Plattenbau herauskommen und in einen dunkelblauen Wolga mit Chauffeur einsteigen sehen.
Die Wohnraumbewirtschaftung unterlag politischen Maßgaben und keiner ökonomischen Regulierung über den Mietpreis oder einen Markt. Quadratmeterpreise von 80 Pfennigen bis 1,20 Mark der DDR und Energiepreise, die deutlich unter den Erzeugungskosten lagen, bedeuteten, dass die DDR ihre Musterviertel heftig subventionieren musste. Die Furcht, bei einer Anhebung der Preise und einer Annäherung an die realen Kosten von den Bürgern abgestraft zu werden, war zu groß. Dafür klopfte man sich oft und gerne auf die Schulter. In der Ostseezeitung, dem SED-Blatt des Bezirks Rostock, war im August des Jahres 1989 folgender Lobgesang auf die niedrigen Mieten zu lesen:
Für die Bürger der Republik ist es von großer Bedeutung und ein Markenzeichen sozialistischer Wohnungspolitik, daß sie seit mehr als 40 Jahren stabil sind. Etwa 3 Prozent vom Nettoeinkommen eines Arbeiter- und Angestelltenhaushalts werden dafür verausgabt. Die Mieten decken rund ein Drittel der Bewirtschaftungskosten, die anderen zwei Drittel werden aus dem Staatshaushalt finanziert. […] Der Vollständigkeit halber und nicht wegen der Polemik sei angemerkt, daß der Anteil der Wohnungsmieten am Familiennettoeinkommen in der BRD bis zu 50 Prozent beträgt […].«16
Trotz der ökonomischen Stagnation klammerte man sich bis zuletzt an die Hoffnung, diese ökonomische Milchmädchenrechnung werde schon irgendwie aufgehen, obwohl die staatlichen Zuschüsse für das Wohnen kontinuierlich anstiegen.17
Die in den Neubaugebieten Stein gewordene Wohnungspolitik der DDR verschrieb sich einem Leitbild, das auf Vereinheitlichung setzte. Damit wurde ein städtebaulich verankertes Bezugssystem für die durch die Bürger zu erfüllenden gesellschaftlichen Rollen geschaffen, das auf Zusammenfügen und Konformismus, nicht auf Ausdifferenzierung und Individualisierung ausgerichtet war. Durch Einheitlichkeit entsteht jedoch noch kein Kollektiv. Als Gegengewicht zu den Vereinzelungsrisiken und zur Anonymität wurden vielfältige politisch gesteuerte Vereins- und Kollektivierungsformen initiiert. Die größeren Betriebe waren in den Wohnvierteln präsent, planten Veranstaltungen, übernahmen den Transfer zu den Arbeitsplätzen, organisierten die regelmäßigen Subbotniks (unbezahlte Arbeitseinsätze im Wohngebiet), nutzten mit ihren Betriebssportgruppen die Sportanlagen oder wurden Stadtteilpaten. Auch andere staatlich mandatierte Kollektive – vom Elternkollektiv in der Schule bis hin zur Hausgemeinschaft – waren fester Bestandteil des Alltagslebens. Sie fungierten als erweiterte Sozialisationsagenturen, die auf die Einbindung der Menschen achteten und das Leben jenseits der Arbeit nahezu konkurrenzlos bewirtschafteten. In den Häusern wurden Verantwortliche gewählt, es gab ein Hausbuch, in das sich Bewohner und Gäste eintragen mussten, die Flurwoche war üblich. In sogenannten Trockenräumen in den Aufgängen konnte man nach einem komplizierten Kalender seine Wäsche aufhängen. In diesen fensterlosen Räumen wurden auch die Hausversammlungen abgehalten, zu denen man seinen eigenen Stuhl mitbrachte und sich in einem Kreis zusammensetzte. Oder man feierte dort gemeinsam. Selbst Jugendpartys und Hochzeiten – mit Fischernetzdeko und Diskokugel – fanden im Trockenraum statt, wobei man aber tunlichst darauf achten musste, dass dort an diesem Tag keine nasse Wäsche hing.
Abb. 4: Wohnen im ersten Block von Lütten Klein (1966)
Wohnen in der sozialistischen Stadt war damit nicht nur ein soziales Projekt, sondern im umfassenden Sinne ein gesellschaftspolitisches, das darauf ausgerichtet war, bestimmte Vorstellungen von Familienleben, Arbeit, Disziplin, Strebsamkeit und sozialistischer Tatkraft in der Breite zu etablieren. Der Plattensiedlungsbau und das durch ihn in Szene gesetzte soziokulturelle Integrationsmodell sorgten für eine besondere Form der Kollektivierung und der Durchsetzung der sogenannten sozialistischen Lebensweise, wobei die Lebensformen zugleich weitgehend dem kleinbürgerlichen Familienmodell verhaftet blieben.18 Das Umpflanzen einer großen Zahl von Menschen in die sozialistischen Wohnkomplexe sollte auch die aus den Herkunftskontexten mitgebrachten Verhaltensweisen und Eigensinnigkeiten zurückdrängen. Von dieser Sozialökologie des Wohnens versprach man sich nicht weniger als einen Persönlichkeitswandel, der jeden Einzelnen auf seine gesellschaftliche Rolle festlegte und damit einen mehr oder weniger freiwilligen Verzicht auf Extravaganzen und Widerspruch bestärkte, so dass sich staatliche Nachstellungen und die Drohkulisse der Sicherheitsorgane vielleicht nicht erübrigten, aber doch weniger notwendig erschienen. Ein Individualisierungs- und Pluralisierungstrend, wie er sich in westlichen Gesellschaften in den siebziger und achtziger Jahren entfaltete,19 ließ sich hier allenfalls rudimentär beobachten.
So trug die bauliche Vereinheitlichung des gesamten Sozialraums dazu bei, eine »Normalbevölkerung« zu erschaffen, in der zwar Privatheitsbedürfnisse entstanden (diese wurden vorzugsweise in den Kleingärten und Datschen ausgelebt), deren Möglichkeiten zur Ausbildung expressiver Lebensstile, zur kulturellen Stilisierung oder zur Pluralisierung jedoch begrenzt blieben. In der Dreiraumwohnung im WBS