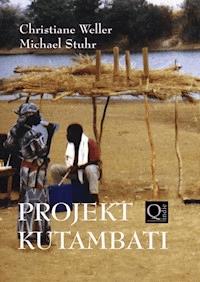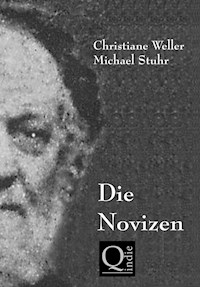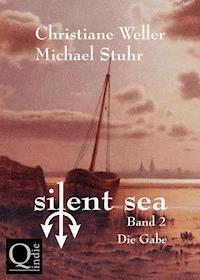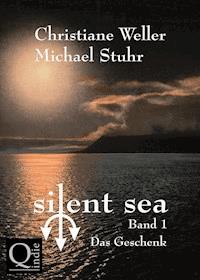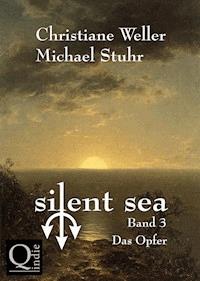
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Das Opfer" Band 3 der "silent sea"-Mystery-Trilogie. Lana und Diego studieren in Berkeley, haben einen kleinen Freundeskreis, und alles könnte gut sein, wenn da nicht die ewigen Rivalitäten der Darksider untereinander wären. Auch Lana gerät in den Strudel dieser Intrigen. Eine Darksiderin, die darauf aus ist Diego für sich zu gewinnen, wird getötet, und Lana kann sich nur knapp vor einer Mordanklage retten. Eine treue Helferin findet sie in einer Darksiderprinzessin, mit der sie mehr als reine Sympathie verbindet. Adriano, Lanas alter Feind, bereitet derweil alles vor seine Rache zu erfüllen. Er will Lana bei einem Darksiderritual den Göttern opfern. All-age-Mystery at its best! Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie künftig bitte auf das Qindie-Siegel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christiane Weller, Michael Stuhr
DAS OPFER
silent sea-Trilogie, Band 3
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
SILENT SEA
PROLOG
01 ALICIA
02 STERNENNACHT
03 ERWACHEN
04 MORGUE
05 UNTER VERDACHT
06 HANDY
07 NETZ UND HAKEN
08 DAS VERHÖR
09 INTERNATIONAL HOUSE
10 AM POOL
11 DIE DENKSCHRIFT
12 STAVROS
13 BIGGY
14 VERMISST
15 CONTAINER
16 CARREY
17 FINLAY
18 BABYSITTER
19 DAS REFERAT
20 DIE EINLADUNG
21 MAMAN
22 SWEETWATER
23 WEIHNACHTEN
24 ALTE FREUNDE
25 ROANOKE ISLAND
26 SUCHSCHNITTE
27 WYATT KEITH NORTON
28 SIMON DANCING HORSE
29 ENTDECKUNGEN
30 DIE LEGENDE
31 DAS BUCH
32 GESTÄNDNISSE
33 CONLAN
34 BRENDA
35 JERRY
36 DER GEIST
37 FLUCHT
38 MARCO
39 ZEPHYR
40 TAURUS
41 DIE MANHATTAN
42 PORT GRIMAUD
43 THAKUR
44 DIE ALTEN AUS DEM MEER
45 DAS PLATEAU
46 TOURISTEN
47 PARTYTIME
Impressum neobooks
SILENT SEA
MYSTERY-TRILOGIE
DRITTES BUCH
Alle Rechte bei
Christiane Weller
und Michael Stuhr
www.christianeweller.de
www.michaelstuhr.de
Coverfoto:
Christiane Weller
Covergestaltung:
Michael Stuhr
Herausgeber:
PROLOG
Eleanor stand am Strand und sah zu, wie das Schiff ihres Vaters davonsegelte. Langsam und majestätisch durchquerte es die enge Passage zwischen Roanoke Island und dem natürlichen Damm, der die Insel vor den Wellen des Atlantiks schützte.
Gerade mal einen Monat war John White geblieben, aber sie, Eleanor, würde es jetzt ein Leben lang hier aushalten müssen. Ihr Vater hatte zwar versprochen, schon bald mit einem Versorgungsschiff aus England zurückzukehren, aber was half ihr das? Sie kam sich wie eine Verbannte vor: Ausgeschlossen vom Leben in London, wie sie es gewohnt war, verurteilt dazu, hier den Rest ihres Lebens unter primitivsten Bedingungen zu verbringen.
Liebevoll drückte Eleanor ihre neugeborene Tochter an sich. Virginia schlief ruhig in ihren Armen. - Sie würde vielleicht niemals etwas Anderes kennenlernen, als dieses fremde Land. Eleanors verzweifelter Seufzer war fast schon ein Schluchzen. Sie hasste diese Insel.
Ein feiner Nieselregen benetzte Eleanors Gesicht und mischte sich mit ihren Tränen. Sie zog den Schal über ihre Tochter, um sie vor der Nässe zu schützen und kam sich selbst gleichzeitig so schutzlos vor. - Wie hatte ihr Vater ihr das antun können? Wie konnte er sie hier einfach so allein zurücklassen? Wie gerne wäre sie mit ihm zurückgesegelt - nach England.
Als die Bäume ihr den letzten Blick auf die Segel des Schiffs verwehrten, wandte Eleanor sich um. Mit langsamen Schritten ging sie vom Ufer zurück zu der kleinen Ansiedlung aus einfachen Hütten. - Die einsamste Kolonie Englands in der neuen Welt: Roanoke-Island! 90 Männer, 17 Frauen und 11 Kinder, das war die gesamte Einwohnerschaft dieser Siedlung. Und hier sollte auch sie jetzt leben. - Für immer!
Der Anblick, den die halbfertigen Häuser boten, war einfach deprimierend. Vielleicht war der Boden ja wirklich fruchtbar, das mochte ja sein; aber alles wirkte so trostlos und verlassen, dass es sie nur traurig machte. Wie schön war es doch in London gewesen: Die breiten Straßen mit den prächtigen Kutschen darauf, der bunte Markt, das pulsierende Leben dort. Warum hatten ihr Vater und Ani ihr das angetan? Nur damit sie hier - mitten in der Wildnis - ihre Tochter, das erste englische Kind auf amerikanischem Boden zur Welt bringen konnte.
Die Tränen strömten noch immer über ihr Gesicht, als sie das Haus erreichte, das von nun an und für alle Zeiten ihr Heim sein sollte. Hier hatte sie ihre Tochter geboren, und hier würde sie auch sterben, wenn nicht irgendwann ein Wunder geschah.
Immerhin hatten sich ihr Vater und Ananias Dare, ihr Ehemann, bemüht, das Haus so solide wie möglich zu bauen. Wenigstens stabil war es, das musste sie zugeben. Stabiler jedenfalls als die provisorischen Holzhütten der anderen Siedler, die den Platz bei der kleinen Kirche säumten.
Sogar eine Kochfrau, die ihr half, hatte ihr Vater angestellt: Maria, eine Portugiesin, die selbst schon einen elfjährigen Sohn hatte und der jungen Mutter in allen Fragen raten konnte. Dennoch gab es nichts, was Eleanor hier hielt. Selbst die Liebe zu Ananias war erloschen. Sie wollte einfach nur eins: zurück in ihr altes Zuhause, nach England, nach London.
Als Eleanor den Schlafraum betrat, der nur durch einen Leinenvorhang vom Rest des Hauses abgetrennt war, fing die kleine Virginia an zu quengeln. Sie legte das Kind auf das Ehebett und streifte ihren Umhang ab. Schnell löste sie ihr Mieder und gab ihrer Tochter die Brust. Die Kleine saugte begierig schnaufend und schlief dann zufrieden ein. Über diesem wunderbaren Gefühl vergaß Eleanor ihren Kummer fast völlig.
Dieses Kind war ein Wunder: erst war es in ihrem Bauch gewesen und nun war es hier, auf dieser Welt. Es saugte an ihrer Brust und war zufrieden damit. - Virginia, meine kleine Liebe!
Eleanor lehnte sich zurück, kuschelte sich mit dem Kind in die Laken, und bald schon schlief sie mit der Kleinen an der Brust ein. Sie träumte sich weg von diesem öden Eiland, das so weit entfernt war von ihrer Heimat.
Als sie wieder erwachte, hörte Eleanor Gesang. Eine seltsame Melodie, in der Sehnsucht und Verheißung mitschwangen. Sie lauschte mit geschlossenen Augen und gab sich den Tönen hin. Es war wie ein Rausch. Der Gesang schwoll an. Was war das? Sie fühlte sich, als werde sie gerufen, als habe ein Sog sie ergriffen. Was konnte das sein?
Eilig raffte Eleanor sich auf, schnürte flink ihr Mieder und nahm die kleine Virginia auf den Arm. Die grunzte leise im Schlaf und schmiegte sich an sie.
An der Haustür stand Ananias und sah sie verwirrt an. Er presste die Hand auf den Türknauf und wirkte seltsam angespannt.
„Was ist das für ein Gesang, Ani?“
Er schien sehr nervös. „Ich weiß es nicht.“ Er blickte aus dem Fenster. „Es ist komisch, ich weiß nicht, wo der Gesang her kommt. – Aber er ist sehr schön! – Oder?“ Wieder blickte er sie an und wirkte so unsicher, dass es ihr Angst machte.
Eleanor drückte ihre Tochter noch fester an sich und spürte, dass sie ein leichtes Zittern überlief. Gleichzeitig löste die Melodie in ihr so wunderbare Gefühle aus, dass sie ihr folgen wollte, ja folgen musste.
„Lass uns rausgehen und nachschauen“, schlug sie vor, denn das war genau das, was sie wollte. Dieser Gesang war so herzergreifend, so verlockend und schön.
Ani sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen zweifelnd an. „Ich weiß nicht“, sagte er, „es kommt mir irgendwie merkwürdig vor.“
„Vielleicht sind es ja die Indianer, die irgendein Fest veranstalten“, warf Eleanor ein. Sie wollte diesem Gesang unbedingt folgen. Er war so schön. Er versprach so viel. Sie sah ihren Mann auffordernd an, das schlafende Kind an die Brust gepresst.
Ani gab sich einen Ruck, öffnete die Tür und ließ die beiden hinaus. Auch er wurde gezogen von dem Rausch der Stimmen, die ihn umgaben, ja geradezu durchdrangen. Wo kam dieser Gesang her? Er wusste es nicht, aber es war auch egal. Er fühlte sich so glücklich, wie schon lange nicht mehr. Jede Vorsicht außer Acht lassend folgte er lächelnd seiner Frau, die, die kleine Virginia eng an sich gedrückt, vorauseilte.
In der Küche hielt Maria Lopez sich an dem hölzernen Tisch fest und beobachtete entsetzt, wie die beiden mit dem kleinen Kind zum Strand hinunter gingen.
Die Köchin war eine gläubige Katholikin, aber auch sie konnte der lockenden Melodie kaum noch widerstehen. Sie spürte, sie musste den anderen folgen, aber sie ahnte auch, dass dieser Gesang unrein war. Die Fischer in ihrer portugiesischen Heimat hatten manchmal spät in der Nacht mit gedämpften Stimmen davon gesprochen.
„Ma Donna mia, sie kommen vom Meer und wollen uns holen“, flüsterte Maria und bekreuzigte sich mit geschlossenen Augen. Das Messer, mit dem sie gerade das Fleisch zerteilt hatte, rutschte aus ihrer Hand. Mit einem dumpfen Laut fiel es zu Boden. Maria achtete nicht darauf. Eilig verließ sie das Haus, um Pedro, ihren Sohn, zu suchen, aber schon nach wenigen Schritten vergaß sie ihr Vorhaben. Die lockende Melodie hatte sie jetzt völlig ergriffen. Wie betäubt folgte sie den anderen hinunter zum Strand.
Zur gleichen Zeit schreckte Pedro aus dem Schlaf auf. Er hatte einen merkwürdigen Traum gehabt: Da waren Schatten über ihm gewesen, die nach ihm gegriffen hatten. Es waren die Schatten von wunderschönen Frauen, fast so schön, wie die Herrin seiner Mutter.
Pedro liebte Eleanor Dare. Sie war immer freundlich zu ihm gewesen und hatte ihm sogar auf der langen Überfahrt von England das Schreiben beigebracht. Die gemeinsamen Übungsstunden in der kleinen Kabine hatte Pedro genossen. Der Duft und die Nähe dieser schönen Frau hatten seine Phantasie beflügelt und seinen Eifer verdoppelt.
Leider hatte dieser Unterricht hier aufgehört, denn sie hatte ihre kleine Tochter bekommen und keine Zeit mehr für ihn gehabt. Aber immer wenn sie ihn sah, strich sie ihm über die Haare und lächelte ihm zu.
Pedro fand, dass sie die schönste Frau auf der ganzen Welt war. Aber diese Frauen in seinem Traum waren auch wunderschön gewesen. Die offenen dunklen Haare hatten um ihre hellen Körper und um ihre lieblichen Gesichter geweht. Zugelächelt hatten sie ihm, und ihn bei seinem Namen gerufen: „Pedro! - Pedro! - Komm, lass uns spielen Pedro!“
Auf einmal waren da aber noch viele andere Schatten gewesen. Lauter fröhlich lachende Menschen. Er hatte auch zu ihnen gewollt. Aber plötzlich waren ihre Gesichter angstverzerrt gewesen. Sie hatten ihre Münder aufgerissen und geschrien, aber kein Ton war zu hören gewesen. Er hatte das verzweifelte Gesicht seiner Mutter gesehen. Auch sie hatte geschrien.
Die Stimme seiner Mutter hatte er gehört. Im Traum konnte er sie immer hören. „Pedro – nein! Nein, sie sind böse! Das ist das BÖSE!“, hatte sie ihm zugerufen.
Verwirrt rieb Pedro sich die Augen und sah sich um. Er lag auf der Aussichtsplattform in dem höchsten Baum der Siedlung. Oh nein! Er setzte sich auf. Wieder einmal war er während seiner Wache eingeschlafen. Das würde Ärger geben. Mister Dare würde ihn gehörig ausschimpfen und er würde kein Abendessen bekommen, wenn das herauskam. Dabei hatte er doch jetzt schon solchen Hunger.
Eigentlich hatte Pedro ständig Hunger. Seine Mutter staunte immer nur, was in seinen elfjährigen Körper so alles rein passte. Sie ging dann manchmal lachend um ihn herum und suchte nach einem nicht vorhandenen Loch in seinem Bauch.
Vorsichtig richtete Pedro sich auf und lugte über die Holzwand der Plattform. Er sah auf das Dorf hinunter. Nichts rührte sich dort. Alles lag wie ausgestorben da. Wo waren die denn alle? Normalerweise herrschte auf dem Dorfplatz reges Treiben, aber nun sah er niemanden dort.
Pedro stand auf und rieb sich erneut die Augen, denn er glaubte nicht, was er jetzt sah. Er hatte sich einmal um sich selbst gedreht und schaute nun in Richtung des nahen Strandes.
Die Männer, Frauen und Kinder des kleinen Dorfs waren zu erkennen. Sie liefen zum Strand und gingen durch die sachten Wellen ins Wasser. Was taten die da? Pedro schüttelte den Kopf.
Als immer mehr von den Bewohnern der Siedlung unter Wasser verschwanden und er sie nicht mehr auftauchen sah, bekam Pedro Angst. Zitternd griff er nach dem Seil der Alarmglocke und begann daran zu ziehen. Wild schleuderte der Glockenschlegel hin und her. - Das mussten sie doch hören. Aber keiner wandte sich um. Alle gingen sie weiter in das Wasser hinein und versanken darin. - Nur der Pfarrer der kleinen Gemeinde, der mit eilenden Schritten als letzter die Wasserlinie erreichte, drehte sich kurz zu ihm um. Seinen großen Hut hatte er verloren, aber er kümmerte sich nicht darum.
Pedro fröstelte, als er den Blick des Geistlichen sah. Der Reverend hatte normalerweise strenge Gesichtszüge, aber nun hatte sich sein Gesicht zu einem so glückseligen Strahlen verzerrt, als würde er höchste Lust empfinden. Und Pedro meinte Lust. Er hatte es oft genug beobachten können, was diese Lust mit den Gesichtern der Menschen tat. Zum Beispiel, wenn sich der Tischler heimlich in der Scheune des Dorfes mit der hübschen Ziegenhirtin traf. Er konnte sie zwar nicht hören, aber sehen konnte er gut.
Zögernd stieg nun auch der Reverend in die Fluten, wobei er vorsichtig seinen Talar lüpfte, wie eine Frau ihr Kleid.
Pedro läutete immer wilder - immer verzweifelter. Er zitterte am ganzen Körper. Was war nur los? Waren sie alle taub geworden, so wie er? Warum hörten sie die Glocke nicht?
Er sah den grauen Haarkranz des Reverends im Wasser verschwinden, während sein Talar sich um ihn herum aufbauschte wie eine riesige schwarze Qualle.
Panisch ließ Pedro seine Blicke über das Dorf und über den Strand fliegen. Alle waren in das Wasser gegangen und hatten ihn zurückgelassen. Mit zitternder Hand wischte er sich eine Träne aus dem Gesicht, aber so lange er auch Ausschau hielt: Das Meer zwischen der Insel und dem Damm lag glatt und ruhig da, so als sei nie etwas geschehen.
Pedro ließ den Glockenstrang los. Was war nur passiert? Er konnte es nicht verstehen. War das ein Traum? Nein! Alle hatten ihn verlassen. Er war allein.
01 ALICIA
Suchend schaute Diego sich um und stellte sich kurz auf die Zehenspitzen, um über die Umstehenden hinweg sehen zu können, aber Lana war nirgends zu entdecken. – Zu blöd, dass sie zusammen mit den anderen Erstsemestern heute Feuerwache hatte und nicht bei ihm sein konnte. Aber so war es nun mal Tradition hier in Berkeley. Die Freshmen mussten Holz schleppen, damit das große Feuer in der Mitte des Amphitheaters schön loderte.
Die ganze Arena des Greek-Theatres war in das rötliche Licht des großen Holzfeuers getaucht. Im Moment spielte gerade eine Rockband Nothing else matters, ein Stück, nach dem man schön langsam und eng hätte tanzen können. Das ganze Halbrund war bis hinauf zu den letzten Sitzreihen von den Klängen erfüllt. Nach Alicias grandiosem Auftritt musste es jede Band schwer haben, die Menschen mit ihrer Musik zu erreichen, aber die Jungs machten ihre Sache gut. Schon fanden die ersten Paare sich zusammen und begannen sich im Takt zu wiegen.
Noch einmal strich Diegos Blick über die Erstsemester, die hinter der Absperrung aus Flatterband immer neue Holzscheite zum Feuer schleppten. Lana war nirgends zu entdecken. – Vielleicht hatte sie es ja geschafft, sich in einen ruhigeren Winkel zurückzuziehen und dort ein wenig Pause zu machen. Nein, sie war wirklich nirgends zu sehen, aber gerade kam Alicia Moss über den Platz. Sie bemerkte Diegos suchenden Blick und lächelte ihn an. – Hoffentlich meinte sie jetzt nicht, dass er nach ihr Ausschau gehalten habe.
Natürlich tat sie das! Ein feines Lächeln zog sich über ihr Gesicht und bewirkte, dass Diego sie eine halbe Sekunde länger ansah, als er eigentlich vorgehabt hatte. Kurz tauchte ein Bild in seinem Kopf auf. Ein Traumbild aus der vergangenen Nacht.
Ruckartig wandte Diego sich ab, aber es war zu spät. Einen etwas zu langen Blick kann man ebenso wenig zurücknehmen, wie ein unbedacht ausgesprochenes Wort. – Dabei war es nur ein winziger Augenblick gewesen, genau diese halbe Sekunde, in der sich so viel entscheiden kann.
Diegos Gesicht verfinsterte sich. - Nein, hier hatte sich nichts entschieden. Alicia hatte Interesse an ihm, das war ein offenes Geheimnis.
Bei anderen Frauen war es Diego bislang immer gelungen, die nötige Distanz zu wahren, aber hier war es schwieriger. Immerhin war sie Mitarbeiterin der Firma, die das Studentenwohnheim betreute, und seit der letzten Nacht wusste er, dass sie sich nicht scheute, diese Position für ihre Zwecke auszunutzen.
Gestern Abend, als Lana, Biggy, Diego und Hercule zusammen im Kino gewesen waren, war Alicia in sein Zimmer eingedrungen und hatte sich zwischen seine Laken gelegt, da war er sich ganz sicher. Ein seltsam betörender Duft hatte der Wäsche angehaftet, und sogar einen winzigen Rest der Wärme ihres Körpers hatte er noch spüren können.
Ja, es war Alicia gewesen! Alicia, die sich bei jeder Gelegenheit in seiner Nähe aufhielt, seit er hier in Berkeley war. Diego hatte ihren Duft erkannt. Sicherlich hatte sie eine Möglichkeit gefunden, über Nacht einen Generalschlüssel für das Wohnheim mitzunehmen. Schließlich arbeitete sie für die Hausverwaltung, und wenn sie am Abend so ganz aus Versehen einen anderen Schlüssel in den Tresor gehängt hatte, würde das kaum aufgefallen sein.
Zuerst war Diego von dem Gedanken leicht amüsiert gewesen, dass die Kleine hier so eine Art Liebeszauber abziehen wollte. Dass sie einfach so in das Zimmer eingedrungen war, behagte ihm allerdings überhaupt nicht. Wenn das alles auch ziemlich blöd und lästig war, ein wenig geschmeichelt hatte er sich schon gefühlt. Er hatte sogar von ihr geträumt, und es waren keine unschuldigen Träume gewesen, in denen man einfach irgendwas Belangloses zusammen erlebt. Da war schon mehr gewesen, und nichts davon hätte er Lana erzählen wollen. Noch schlimmer war, dass er die Bilder nicht los wurde. Sinnliche Bilder von gebräunter Haut und einem anschmiegsamen Leib, der sich an seinen Körper drängte.
Diego war sich ganz sicher, dass er kein Interesse an Alicia hatte, also mussten diese verwirrenden Bilder einen anderen Grund haben, und Diego wusste auch welchen: Trotz ihres englisch anmutenden Namens war Alicia Moss auf einer griechischen Insel aufgewachsen, und es hieß, dass ihr Vater ein Prätorianer war. Dass sie auch das Erbe dieser Seewesen in sich trug, erklärte so Einiges: Alicia stammte in direkter Linie von den Sirenen ab, die mit ihrem magischen Gesang schon Odysseus ins Verderben hatten locken wollen. Niemals durfte man die Macht dieser Frauen unterschätzen.
Alicia drängte sich zwischen Daryl und Stavros hindurch und stellte sich ganz selbstverständlich neben Diego. „Na, hat mein Lied dir gefallen?“, fragte sie ihn direkt. „Ich habe es nur für dich gesungen.“
Es half alles nichts. Diego hielt den Moment für gekommen, deutlich zu werden. Er beugte sich etwas zu ihr herab. „Lass es einfach! Es hat keinen Sinn.“
Der verletzte Ausdruck in Alicias Gesicht ließ ihn seine Worte fast bereuen.
„Was meinst du?“ Alicia lächelte ihn an. „Mein Lied? – War mein Gesang nicht okay?“ Fast konnte man meinen, es sei ein unschuldiges Lächeln, aber das Flackern ihrer Lider sagte Diego, dass sie genau wusste, wovon er sprach. Ihre Gedanken konnte er nicht hören, aber er spürte ihre Gegenwehr fast körperlich.
„Komm Alicia, tu nicht so harmlos. Du weißt genau, was ich meine. Lass mich einfach in Ruhe, und halte dich vor allem von Lana fern. Sie gehört zu mir, da wirst du nichts daran ändern. Halt dich aus unserer Beziehung raus. Hör auf, sie zu bekämpfen und hör auf mir nachzuschleichen.“ Diego atmete tief ein und sah Alicia mit zusammengezogenen Augenbrauen an.
„Aber ich mag Lana!“ Alicia sagte das mit einem so bezaubernden Lächeln, dass man ihr fast hätte glauben können. „Sie sieht hübsch aus. - Ich denke nur, dass sie nicht so richtig zu dir passt, das ist alles. Ich meine: sie ist doch nicht aus unserem Volk. Ich mache mir da echt Sorgen ...“
„Hier in Amerika nennt man so was Rassismus“, lachte Stavros, der einen Teil des Gesprächs mitgehört hatte.
Diego war die Sache zu ernst um auf die Flachserei einzugehen, außerdem machte Alicias Heuchelei ihn langsam wütend. „Lass mich endlich in Ruhe“, forderte er. „Und wo wir schon dabei sind: Wenn du jemals wieder heimlich in mein Zimmer eindringst, wird es dir verdammt Leid tun! Such dir meinetwegen irgendwo einen Freund, der auf so was steht, und dann viel Spaß mit ihm. - Alles klar jetzt?“
„Ja, ja!“ Alicia lächelte Diego zu und drehte sich zu Stavros um. „Na, wie ist es“, wollte sie von ihm wissen, „willst du mit mir gehen?“
„Klar doch!“, grinste Stavros. „Für wie lange denn?“
„So lange, wie es uns beiden gefällt.“
„Okay! Dann mache ich jetzt Schluss mit dir.“
„Schade“, meinte Alicia. „War ne schöne Zeit.“
„Fand ich auch.“ Stavros wandte sich Daryl zu, der ihm auf seinem I-Phone etwas Wichtiges zeigen wollte.
„Hallo! Ich bin wieder frei“, lächelte Alicia Diego an.
„Vor Allem bist du ziemlich krank“, stellte Diego fest.
„Du solltest nicht so hässlich zu mir sein“, beschwerte Alicia sich, „schließlich hat mein Freund gerade mit mir Schluss gemacht.“
„Freut mich für ihn“, meinte Diego nur und wandte sich von ihr ab. „Ich schau mal nach, wo Lana sich verkrochen hat.“ Er drängte sich aus der Gruppe heraus, die das Geplänkel zwischen ihm und Alicia mit wachsendem Vergnügen verfolgt hatte.
Zunächst ging Diego an dem Absperrband entlang, das den Feuerplatz absicherte. Als er das riesige Feuer halb umrundet hatte, war er sich ziemlich sicher, dass Lana im Moment nicht auf dem Platz war. Ein Security-Mann hatte allerdings gesehen, dass ein schlankes Mädchen mit langen blonden Haaren die Absperrung durchquert hatte und mit schnellen Schritten auf den Ausgang zugegangen war. Sie war ihm aufgefallen, weil ihr Gesicht aschfahl gewesen war. Sie schien irgendwelche Schwierigkeiten gehabt zu haben, also hatte er sie ziehen lassen ohne sie anzusprechen. Ansonsten war es für die Freshmen nicht so einfach, sich der Schufterei des Holzschleppens zu entziehen. Sogar für den Gang zur Toilette musste man sich abmelden, aber hier hatte der Typ mal eine Ausnahme gemacht.
Lana musste wirklich übel ausgesehen haben. Diego bedankte sich bei dem Mann und steuerte auf den Ausgang des Theaters zu.
„He, Diego, alter Haifischjäger, wohin geht´s?“, tönte es da in voller Lautstärke über den Platz. Hercule winkte ihm über fünfzig Meter hinweg wild zu und kam mit Biggy im Schlepp zielstrebig heran.
Diego blieb stehen. „Habt ihr Lana gesehen?“
„Nee! Wieso? Ist sie weg?“ wollte Hercule wissen.
„Am Feuer ist sie nicht mehr“, gab Diego Auskunft, „und einer der Wachleute hat sie zum Ausgang gehen sehen. Sie soll ziemlich blass gewesen sein.“
„Total überanstrengt“, vermutete Biggy. „Diese Holzschlepperei ist doch die pure Schikane.“
„Dann wäre sie doch sicher zu mir gekommen, damit ich sie heimbringe“, meinte Diego. „Da muss noch was Anderes gewesen sein!“
„Ruf sie doch einfach an“, schlug Hercule vor.
„Mach ich nicht so gerne.“ Diego kniff ein wenig die Lippen zusammen, zog aber doch sein Handy heraus und aktivierte das Display. „Sie soll sich nicht kontrolliert fühlen.“
„Dann mach ich das!“ Kurz entschlossen schnappte Biggy ihm das Handy aus der Hand und begann sofort darauf herum zu tippen. „Schließlich machen wir uns Sorgen!“ Ungeduldig nahm sie das Gerät ans Ohr und nickte nach ein paar Sekunden. Der Ruf ging wohl durch. Plötzlich nahm sie das Handy wieder herunter und sah es mit zusammengezogenen Augenbrauen an. „Weggedrückt!“, stellte sie fest. „Hier, probier du mal!“, forderte sie Diego auf.
Die gespeicherte Nummer war schnell gewählt, und diesmal kam sofort die Ansage, dass der Teilnehmer zurzeit nicht erreichbar sei.
„Habt ihr euch gezankt?“, wollte Biggy wissen.
„Blödsinn!“, wehrte Diego ab. „Nicht die Spur. – Ich geh sie jetzt suchen.“
„Ja, mach das!“, stimmte Biggy zu. „Hercule und ich fahren derweil zum International House. Vielleicht ist sie ja schon dort.“ Entschlossen nahm sie den verdutzt dastehenden Hercule bei der Hand und zog ihn in Richtung Ausgang.
‚Super, diese Frau!’, stellte Diego still für sich fest. Wenn sie auch manchmal einen etwas verpeilten Eindruck machte: wenn es darauf ankam, wusste sie genau, was zu tun war. Ohne noch eine Minute zu verlieren machte er sich daran, die Gänge des Greek-Theatre nach Lana abzusuchen.
Nach einer Odyssee durch die Restrooms war es Diego klar, dass Lana sich nicht mehr hier aufhielt. Fast war er dankbar dafür, dass er bei seiner Suche auf Alicia stieß, die es für ihn übernahm, tiefer in die für Frauen reservierten Räume hinein zu gehen. Bevor er den braven amerikanischen Girls einen Schock fürs Leben verpasste, weil er plötzlich in der Damentoilette auftauchte, ertrug er schon lieber das anzügliche Grinsen seiner Helferin.
„Tja, nirgends zu finden“, stellte Alicia schließlich fest. „Hat sich wohl schon verdrückt.“
„Nett, dass du mir geholfen hast“, bedankte Diego sich und versuchte zum x-ten Mal, Lana über Handy zu erreichen. – Wieder keine Verbindung.
„Gehen wir“, meinte Alicia gleichmütig. „Sie ist weg, sieh es ein.“
„Ja, gehen wir!“ Etwas zu spät fiel es Diego auf, dass er gerade an Alicias Seite vom Gelände ging. So war das von seiner Seite aus nicht geplant gewesen, aber wenn Lana es nicht nötig hatte, ihm Bescheid zu sagen, wenn sie ging ...
Auf dem Parkplatz stoppte Alicia und sah ihm ins Gesicht. „Ciao Diego“, sagte sie im Ton größter Aufrichtigkeit, „tut mir Leid, dass sie einfach so abgehauen ist. Ich fahr dann auch mal nach Hause.“
„Ja, danke noch mal.“ Nachdenklich sah Diego ihr nach. - Eigentlich war diese Alicia doch ganz in Ordnung. Unwillig steckte er das Handy ein, das er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte.
So langsam ärgerte es Diego, dass Lana nicht zu erreichen war. Eigentlich hatte er ja vorgehabt, zum International-House zu fahren, um nachzusehen, ob sie inzwischen dort war, aber als das Handy klingelte und Hercule sich meldete, erfuhr er, dass sie dort auch nicht angekommen war. „Dann lass sie“, teilte er dem verdutzten Hercule mit „Sie ist schließlich alt genug und muss wissen was sie tut.“ Damit beendete er das Gespräch, stieg in seinen Wagen und fuhr zum Wohnheim.
In seinem Zimmer angekommen war die leichte Verärgerung über Lana immer noch nicht verflogen. Angezogen legte Diego sich auf sein Bett und wartete darauf, dass sie ihn endlich anrief. Immer wieder drängte sich Alicias Lied in seine Gedanken, und ihr Bild tauchte vor seinem inneren Auge auf. – Eigentlich hatte sie sich heute doch als ganz gute Freundin erwiesen.
02 STERNENNACHT
Was habe ich getan?
Diego weiß gar nicht, wo ich bin, er wird mich suchen im Greek-Theatre! Mein Handy liegt zerschmettert am Straßenrand! Er kann mich nicht erreichen! Warum fühle ich mich so merkwürdig gut dabei? Warum? Es ist wie ein Gefühl von süßer Rache: Soll er sich doch auch mal Sorgen machen, so wie er mir mitgespielt hat. Soll er doch, dann weiß er mal, wie das ist, wenn man ...
Ich fange wieder an zu zittern. Er weiß doch gar nicht, was ich weiß. – Egal! – Ich schließe die Augen und sehe Bilder - Bilder der vergangenen Nacht.
Ich sehe Lou, wie sie langsam nach vorne kippt. Schon ist ihr Schwerpunkt jenseits des Geländers. Sie rutscht ab. – Panik - Lou soll nicht sterben. - Meine Hand an ihrem Hosenbund. - Sie rutscht! - Endlose Sekunden - Mein halber Oberkörper ragt über das Geländer. Unter mir hängt Lou hoch über dem schwarzen Wasser der Bay, nur gehalten von meiner rechten Hand.
Später: Die blinkenden Lichter des Streifenwagens. - Der Cop, der uns mit seiner Taschenlampe anleuchtet. - Und über all dem das ruhige, warme, unwirkliche Weihnachtsbaumlicht der Golden Gate Bridge.
Lous Geständnis: „Ich kenne Alicia. Sie hat keine Seele! ... Ich war mal mit ihr zusammen. Sie hat mich ausgenutzt. Sie hat mir vorgespielt, dass sie mich liebt, und ich habe es geglaubt.“ - Ihr bitteres, verzweifeltes Lachen.
Die Fahrt zu Lou: Ich rieche nach meinem eigenen Erbrochenen und komme mir so zerfleddert vor, wie ein alter, stinkender Putzlumpen. Gleichzeitig spüre ich die warmen Gedanken von Lou neben mir. Im Radio läuft „It’s my life“. - Die Dunkelheit, die uns umschließt wie ein schützender Mantel, als wir endlich Lous Haus erreichen. - Das harmlose Gezirpe der Grillen in der duftenden, warmen Nacht, das mich an Port Grimaud erinnert und an die unbeschwerten Tage dort, bevor so viel Schreckliches passiert ist.
„So, deine Sachen sind in der Waschmaschine“, sagt Lou als sie hereinkommt.
„Danke“, bringe ich mit leiser Stimme heraus. Über Marisas flauschigen rosa Bademantel habe ich mir noch eine dicke Decke gezogen. Meine Haare sind feucht von der heißen Dusche. Mit angezogenen Knien sitze ich auf dem Boden an die Couch gelehnt. In die Decke gekuschelt schaue ich wie hypnotisiert auf die Flammen im Kamin.
Ich sitze in Lous Wohnzimmer und versuche, die Bilder der Nacht loszuwerden. Meine Füße stecken in dicken Socken, aber ich werde nicht warm. Immer wieder überlaufen mich eisige Schauer, die mir eine Gänsehaut über den ganzen Körper jagen.
Lou reicht mir einen Becher Tee und setzt sich zu mir auf den Boden.
Das ganze wirkt so alltäglich, so schön, dass ich fast schon versucht bin, hysterisch aufzulachen. Woher nimmt sie die Kraft, so zu handeln, so - normal? Ich muss den Becher, den sie mir reicht, mit beiden Händen entgegen nehmen, um nichts zu verschütten, so sehr zittern meine Hände, so sehr bebt mein ganzer Körper.
Aufmerksam schaut Lou mich an. „Frierst du immer noch?“
Ich presse die Zähne aufeinander, um ein Klappern zu verhindern und nicke stumm. Mein ganzer Körper steht unter einer solchen Anspannung, dass sich kein einziger Muskel entkrampfen will.
„Das ist kein wirkliches Frieren“, stellt Lou fest. „Das ist der ganze Druck, die ganze Anspannung, die jetzt bei dir rauskommt. Trink mal was von dem Tee. Ich hab dir ein bisschen Wodka dazu gekippt, das soll bei euch ja helfen.“
Erstaunt schaue ich sie an.
„Nun guck nicht so, der ist nicht von mir, den hat Alicia hier gelassen – damals. Sie brauchte so was immer, vielleicht konnte sie mich anders nicht aushalten.“ Lou dreht den Kopf zur Seite und seufzt leise. Ich lege ihr kurz meine Hand auf den Arm. Schweigend sitzen wir dicht nebeneinander, schauen ins Feuer und trinken unseren Tee.
Merkwürdig, wie sich bestimmte Situationen wiederholen: Noch nicht mal ein halbes Jahr ist es her, da saß ich auch vor einem Kaminfeuer, eine Tasse Tee mit Rum in der Hand und Bea neben mir. Wir hockten im Wohnzimmer von Tante Claire und hatten keine Ahnung, was für unheimliche Erlebnisse uns in Saint Malo erwarten sollten.
Nun sitzt Lou neben mir. Wir beide haben die wohl schlimmste Nacht unseres Lebens hinter uns.
Dennoch, der Tee zeigt seine Wirkung: Ich spüre, wie mein verkrampftes Zittern langsam nachlässt und eine wohlige Wärme mich durchströmt. Ich stelle meinen leeren Becher weg und lehne mich an Lous Schulter. Sie legt den Arm um mich. Diese kleine, liebevoll tröstliche Geste bricht den Bann vollends.
Mit der Verkrampfung lösen sich auch endlich die vielen ungeweinten Tränen, die in meiner Kehle feststecken wie ein hart gekochtes Ei. Die ganze Wut und Enttäuschung über Alicia und Diego, über diese Hacker und dieses ganze Lügengebäude, mit dem Diego mich hierher nach Berkeley gelockt hat, steigt brennend in mir hoch. „Warum hat er das getan ...warum?“, schluchze ich. „Wie konnte er mich so einkaufen? Hacker beschwatzen, damit sie mir ein fingiertes Stipendium basteln? Und diese Alicia wusste davon. Wahrscheinlich haben sie sich darüber kaputt gelacht, wie gutgläubig ich in die Falle getappt bin. Ein Stipendium für Lana Rouvier, wie blöd muss man sein, um das wirklich glauben zu können?“
Alles sprudelt aus mir heraus. Wortlos zieht Lou mich an sich und drückt ihre Wange an meine Haare. Still hört sie mir zu und drückt ab und zu meine Schulter.
Als ich schließlich schweige, murmelt Lou: „Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht hören willst Lana, aber diese ganze Sache klingt nicht nach Diego, absolut nicht! Der hätte es dir erzählt. Er hätte mit offenen Karten gespielt. Der hätte das niemals heimlich gemacht!“
Wütend richte ich mich auf und schiebe mich von Lou weg: „Hältst du auch zu diesem Lügner? Glaubst du wirklich, dass ich das glauben könnte, nach allem, was Alicia mir erzählt hat? Woher sollte sie denn sonst von der ganzen Sache wissen, hä? Sie kannte sogar das Zeichen mit dem Dreizack, das überall auf meinen Dokumenten zu sehen ist. Woher sollte sie das wissen, wenn sie es nicht vorher gesehen hätte?“
Lou zuckt mit den Schultern und schaut ins Feuer. „Von diesem Hacker vielleicht? Die beiden kennen sich.“
„Ja klar, der wird ihr auch gerade sagen, dass er ein linkes Ding gedreht hat!“
„Du kennst Alicia nicht Lana, die kriegt alles aus den Leuten raus, was sie will! Das ist eine Schlange und eine verdammte Heuchlerin. Ich kenne sie!“ Lou schüttelt den Kopf und spielt mit dem Löffel in ihrem Teebecher.
Wütend starre ich Lou an, aber wie sie das so sagt und so traurig neben mir sitzt, wird mir plötzlich bewusst, dass auch sie sich in dieser Nacht das Leben hatte nehmen wollen, und nun sitzt sie hier und muss mich trösten und beruhigen. Ich komme mir plötzlich ziemlich egoistisch vor.
Ich rutsche wieder zu Lou heran und lege ihr eine Hand auf den Arm. „Tut mir Leid, ich wollte dich nicht angreifen. Du hast genug eigenen Kummer, und ich denke nur an mich. Warum wolltest du es tun Lou? Warum?“
Lou seufzt auf. „Ja, warum? Alicia hat wohl immer noch Macht über mich.“
„Du meinst diese Prätorianerkraft?“ flüstere ich und starre dabei ins Feuer. Die Bilder dieser wilden Seewesen, die Caetan in die Tiefe zogen und der betörende Gesang der Prätorianerfrauen. - Mich hatte es doch damals auf den Bermudas auch schon gepackt. Und heute Nacht ist es Alicia beinahe gelungen, mich in den Tod zu treiben. „Aber ich dachte, ihr seid dagegen immun, also es ist doch eure eigene Rasse. - Ich verstehe das nicht.“
„Weißt du“, flüstert Lou neben mir, „irgendwann wird einfach alles zu viel, irgendwann hält man dieses ständige verletzt werden und diese ständigen Verluste einfach nicht mehr aus. Schätze, dieser Punkt war heute Nacht erreicht. Ich hatte plötzlich selber das Gefühl, dass Alicia Recht hat, und dass das der richtige Ausweg wäre.“
„Also auch wegen mir?“ frage ich leise. Immer noch sehe ich sie alleine hier am Pool sitzen, als ich gestern ohne ein Wort gegangen bin.
„Nein, nicht wegen dir, sondern weil ich mit dieser ganzen Situation langsam nicht mehr klar komme. Deine ehrlichen Gefühle haben mir gezeigt, wonach ich mich wirklich sehne und hinter was ich schon mein Leben lang herlaufe. Dann, heute Nacht, deine Unterhaltung mit Alicia: Ich hab gesehen, wie traurig du auf diesem kleinen Stuhl gehockt hast. Ich hab deine Verzweiflung gespürt wie meine eigene. Du warst so verletzt wie ich. Ich hatte das Gefühl ...“ Lou verstummt.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll und lege stattdessen einfach einen Arm um sie. Lou drückt ihren Kopf an meine Schulter. So sitzen wir schweigend und betrachten das Spiel der Flammen im Kamin. Was soll man auch sagen nach so einer Nacht, nach diesen Erfahrungen, die die Grenze des Ertragbaren für uns beide so weit überschritten haben?
Ich merke, wie mir die Augen zufallen wollen. Krampfhaft reiße ich sie wieder auf. Ich will es nicht sehen, dieses kalte schwarze Wasser. Immer wieder spüre ich, wie es mich umschlingt, so als sei es eine Erinnerung an die heutige Nacht. Dabei ist es ein Nachklang der Todesangst, die ich unter Dolores’ Yacht verspürt habe. Diese Kälte und Dunkelheit. Seltsam, dass ich mir trotzdem ausgerechnet das Wasser ausgesucht habe.
„Lou?“
„Ja?“
„Ich – ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist vielleicht kindisch, aber ich will nicht alleine schlafen. Ständig tauchen diese Bilder wieder auf. Ich ...“ hilflos schweige ich. Wie muss das klingen für ein Mädchen wie Lou. Fast wie ein Antrag! Dabei will ich wirklich einfach nur schlafen und mich dabei sicher fühlen.
Lou drückt sich an mich. „Mir geht’s genauso. Einfach nur jemanden neben sich spüren und sich sicher und geborgen fühlen. Mit seinen Gedanken nicht allein sein müssen.“
„Ja!“
„Dann lass uns schlafen gehen. Ich stecke deine Sachen gerade noch in den Trockner. Die Maschine müsste fertig sein.“ Lou steht auf und ist nach zwei Minuten zurück. „Komm!“ Sie streckt mir ihre Hand hin. Ich ergreife sie. Die Decke rutscht mir von den Schultern. Ich will sie fest halten, aber sie fällt schon zu Boden.
„Lass sie einfach liegen“, murmelt Lou und zieht mich mit sich.
Ich höre das Zwitschern von Vögeln. Ich mache zögernd die Augen auf und sehe, dass der erste Schimmer des neuen Tages dem Himmel schon eine tiefgraue Färbung gegeben hat. Neben mir höre ich Lous gleichmäßige Atemzüge.
Still bleibe ich liegen und horche in mich hinein. Da ist immer noch diese grenzenlose Leere und Erschöpfung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, jetzt aufzustehen und irgendetwas zu tun. Was auch? Was wartet denn noch auf mich in diesem Land?
Ganz tief in mir regt sich ein leiser Widerspruch: Was ist mit meinen Träumen zum Beispiel? Soll ich wirklich nur deswegen das ganze Studium hinschmeißen? Das wäre doch bescheuert! Ich hätte nie wieder so eine Chance!
Ich will diese Gedanken nicht und wälze mich zur Seite. Lou liegt zusammengerollt wie ein Kätzchen neben mir und rührt sich nicht.
Nur nicht nachdenken! Eine bleierne Müdigkeit scheint alle meine Glieder zu lähmen. Ich schließe die Augen und versuche, wieder einzuschlafen, aber es gelingt mir nicht. Wie eine Flutwelle strömen die Ereignisse des gestrigen Abends auf mich ein.
Ich wälze mich auf die andere Seite und starre an die Wand. Dort hängt ein Farbdruck der Sternennacht von Vincent van Gogh. Ich versuche, meinen Blick darauf zu konzentrieren, um mich von diesen anderen, hässlichen Bildern zu befreien. Aber sie füllen meinen Kopf wie ein klebriger Brei. Sie wollen sich nicht verdrängen lassen. Sie sind wie diese wirbeligen, unruhigen, dicken Pinselstriche, die den Nachthimmel über dem kleinen Ort auf dem Gemälde bedecken.
Wie zerrissen muss van Gogh gewesen sein, als er dieses Bild malte? Es ist, als hätte er meine Stimmung einfangen wollen. Diese Wirbel und Striche und Kreise wirken bedrohlich, stürmisch und unheimlich. Ich komme nicht zur Ruhe.
Mit offenen Augen und unfähig mich zu bewegen, denke ich an gestern Abend: Ich sehe wieder Alicias abschätzenden Blick, den Triumph in ihren Augen, als sie merkt, wie sehr sie mich getroffen hat. Ich drehe mich auf den Rücken und streiche verzweifelt mit den Händen über mein Gesicht. Es ist, als wolle ich Spinnweben entfernen. Kann es wirklich möglich sein, dass sie die Wahrheit gesagt hat?
Sie ist scharf auf Diego, hat Hercule gesagt. Warum also sollte sie zu mir ehrlich sein? Sie will mich loswerden, damit sie Diego für sich hat. Warum also sollte sie mir – ausgerechnet mir – die Wahrheit sagen? Könnte es sein, dass sie mich angelogen hat? Aber woher wusste sie dann von dem Dreizack auf meinen Unterlagen, dem Symbol von Stavros, dem Hacker?
Unruhig drehe ich den Kopf zur Seite und versuche mich in eine bequeme Lage zu bringen. Ich will wieder zur Ruhe kommen, aber mein Herz rast. Mit fällt ein, wie Lou heute Nacht so überzeugt gesagt hat, dass das niemals Diegos Art wäre. Was, wenn sie Recht hat und Diego nichts davon wusste?
Ich drehe mich wieder auf die Seite und rutsche ein wenig auf Lou zu, um ihre Nähe zu spüren. Fest presse ich die Augen zusammen. Tränen treten hervor. Ich will nicht mehr weinen! Ich will nicht mehr grübeln! Bitte geht weg – Gedanken!
Lou bewegt sich ein wenig und berührt mich sachte an der Hüfte. Ich drücke mich noch etwas fester an sie. Das tut so gut.
„Ey, Lana, beruhige dich, alles wird gut!“, murmelt Lou schlaftrunken. Ihre warme Hand liegt auf der nackten Haut zwischen T-Shirt und Slip, fast auf meinem Bauch. Ich lege meine Hand darauf und verstärke den Druck. Ich spüre die Wärme ihres Körpers an meinem Rücken. Ihre gleichmäßigen Atemzüge beruhigen mich. Langsam gleite ich wieder in einen leichten Schlaf.
Ich sehe Diego, wie er auf der Golden Gate Bridge nach mir sucht. Er ruft verzweifelt meinen Namen und springt schließlich ins Wasser, um mich zu finden. Ich tauche mit ihm in die kalte Dunkelheit hinab und versuche mich bemerkbar zu machen. Aber er sieht mich nicht, denn in Wirklichkeit bin ich tot.
Erschrocken fahre ich hoch. Nein! Ich bin nicht tot! Ich bin hier! Diego! Ich liebe dich doch! Deinetwegen bin ich doch nach Berkeley gekommen! Verschwitzt sitze ich im Bett und ringe keuchend nach Luft. Das graue Licht des frühen Morgens lässt mich die wirren Pinselstriche der Sternennacht gerade so erkennen. Ich sitze da und starre das Gemälde an. Habe ich einen Gedankenimpuls von Diego empfangen? Ist er wirklich in die Bay gesprungen, um mich zu suchen?
03 ERWACHEN
Mit geschlossenen Augen liege ich im Bett. Ich rieche frisch gebrühten Kaffee. Ich rekele mich wohlig. Ich bin zu Hause, in Paris, in meinem Zimmer. Meine Gedanken sind noch traumverhangen. Maman wird schon Kaffe gekocht haben. Der Duft holt mich langsam in die Wirklichkeit.
Ich öffne die Augen. Mein Blick fällt auf das Bild an der weißen Wand: die Sternennacht! Schlagartig bin ich wach. Die Erinnerungen überschwemmen mich wie eine Woge. Hastig setze ich mich auf und schaue mich um. Neben mir liegt das verwühlte Bettzeug, in dem Lou geschlafen hat. Es war also eindeutig kein Traum. Ich habe tatsächlich mit Lou zusammen in ihrem Bett geschlafen. Mir wird ganz heiß. Aber ich erinnere mich auch, wie gut mir ihre Nähe getan hat.
Die Tür zum Balkon über der Terrasse ist geöffnet. Ein leichter, milder Wind bauscht sanft die weißen Organzavorhänge. Ich atme tief die würzige Luft von Kiefern und Meer ein, stehe auf und beschnüffele erst mal meine Jeans, die frisch gewaschen auf Lous Schaukelstuhl liegt. Auch die Chucks sind wieder in Ordnung. Nichts erinnert mehr an die Revolte meines Magens in der letzten Nacht. Ich schlüpfe in meine Sachen und gehe leise die Treppe hinunter in die Küche.
„Ey Lana, da bist du ja!“ begrüßt mich Lou mit ziemlich zerzausten Haaren und einem verlegenen Lächeln. „Wie geht’s dir? Ich hab schon mal Frühstück gemacht. Ich dachte, wir setzen uns auf die Terrasse, was meinst du?“ Geschäftig läuft sie in der Küche hin und her, räumt alle möglichen Leckereien auf ein Tablett und scheint sich vor meiner Antwort zu fürchten. Warum weicht sie meinem Blick aus? Warum ist sie so unsicher? Ich beobachte sie erstaunt, weiß nicht so recht was ich machen soll und suche nach Worten.
Plötzlich bleibt Lou mitten in der Küche stehen. Sie hält den Ahorn-Sirup für die Pancakes in der Hand und sagt: „Ja, ich fürchte mich Lana. Ich habe Angst, dass du einfach wieder so verschwindest, wie beim letzten Mal.“ Ihre dunklen Augen schauen mich ganz ernst und ein bisschen traurig an.
Ich schließe kurz die Augen. Ja, sie hat Recht! Das war gemein von mir gewesen, sie einfach so hier zurückzulassen, als sie so traurig dagesessen hatte. – Aber ich war doch selbst völlig durcheinander gewesen. Sie gefällt mir so sehr, wie ich es noch nie bei einer Frau erlebt habe, und ich gefalle ihr auch. Sie begehrt mich, das kann ich spüren, und das war in dem Moment alles zu viel für mich gewesen. Ich hatte einfach weglaufen müssen. Nicht vor ihr, sondern vor mir selbst.
Lou weiß das. Sie kann in meinen Gefühlen lesen wie in einem offenen Buch, und sie hat Angst, dass diese Panik mich wieder überwältigt.
„Nein, Lou! Ich werde nachher gehen, aber ich werde nie wieder auf so eine Art flüchten. Nicht vor dir und auch nicht vor mir selbst.“
„Ehrlich?“ Sie sieht so verloren aus, dass ich sie auf der Stelle in den Arm nehmen könnte.
Ich gehe auf sie zu und nehme ihr erstmal den blöden Sirup aus der Hand. Sie sieht damit aus, wie eine biedere Hausfrau, die Angst vor ihrem Mann hat. Ich kann das nicht ertragen! Ich stelle die Flasche auf die Arbeitsfläche und sehe Lou an. Wir stehen nahe voreinander.
„Lou“, sage ich und merke, wie meine Stimme zittert, „was du letzte Nacht für mich getan hast, werde ich dir nie vergessen.“ Meine Stimme wird heiser und ich muss mich räuspern, aber ich bin noch nicht fertig. „Du hast mich aufgefangen und gehalten und ich habe mich bei dir so sicher und friedlich gefühlt, wie ...“ Plötzlich versagt meine Stimme.
„Aber?“ flüstert Lou.
„Aber?“ Ich denke nach. „Kein aber!“
„Doch, ganz bestimmt ein aber!“ meint Lou und versucht ein Lächeln.
Sie steht vor mir. Wir berühren uns fast. Sie sieht so zart aus, so zerbrechlich.
Mein Körper reagiert so stark auf sie, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. In der letzten Nacht hätte sie alles von mir verlangen können, und ich hätte mitgemacht, nur um nicht nachdenken zu müssen, aber sie hat es nicht getan.
Ein Schauer durchläuft mich. Hilfe! Was passiert hier schon wieder mit mir? Ich bin gerade dabei, mich neu zu sortieren, aber ich bin doch noch nicht fertig. Egal, was ich eben gesagt habe: der Impuls mich einfach umzudrehen und wegzulaufen ist so mächtig, dass ich ihm fast nachgebe, aber das werde ich nicht tun!
Lous Gesicht ist voller Verlangen, voller Hoffnung. Sie wartet auf ein Signal von mir. Ihr Blick hält mich gefangen. Sie ist so schön ... Ich weiß genau, wenn ich mich jetzt bewege, wenn ich sie berühre, dann werde ich sie an mich ziehen und nie wieder loslassen.
„Ich liebe dich“, sagt sie so leise, dass ich sie kaum verstehe.
„Ich weiß.“ Ich schaue zu Boden, um ihre Enttäuschung nicht zu sehen. „Ich liebe Diego.“
Ich höre wie sie kurz Luft holt, um etwas zu sagen, aber sie bleibt stumm.
Zögernd hebe ich den Kopf und sehe, dass eine Träne über ihre Wange rollt. Hilflose Trauer spiegelt sich auf ihrem Gesicht. Sie will sich abwenden.
„Wir wären ein tolles Paar gewesen, oder?“, sage ich leise und greife nach ihrer Hand.
„Unschlagbar!“, sagt sie mit einem Schluchzen in der Stimme und versucht ein scheues Lächeln. Plötzlich habe ich sie doch im Arm und umschlinge sie ganz fest.
Mir kommen selbst die Tränen. Das war der Moment, der mein ganzes Leben völlig hätte verändern können, aber er ist vorbei. Mein Blick hat sich geklärt. Lou ist eine tolle Freundin, aber sie ist auch eine verlorene Seele, die noch kein Heim gefunden hat. Ich weiß jetzt wieder, wohin ich gehöre.
Lou liegt in meinen Armen und verbirgt ihr Gesicht an meiner Schulter. Ich spüre an den kleinen Erschütterungen in ihrem Körper, dass sie weint. Sie tut mir so Leid, und mich durchströmt ein unendlich zärtliches Gefühl; aber es ist so, als würde ich eine Schwester trösten, die großen Kummer hat – mehr nicht. Ich weiß wieder wohin – nein, zu wem – ich gehöre, und wenn Diego und ich im Moment auch Schwierigkeiten haben. Ich werde uns die Chance geben, wieder zusammenzufinden.
Zuerst war alles so klar für mich: Diego hatte mich verraten. Er hatte mein Studium finanziert, damit ich zu ihm nach Berkeley komme. Er hatte mich gekauft, bezahlt und benutzt, davon war ich überzeugt gewesen, aber das hatte nur diese Alicia mir eingeredet. Jetzt beginne ich zu zweifeln. Wir müssen das klären. Ich muss unbedingt herauskriegen, wie es wirklich gewesen ist!
Lou hat sich ein wenig beruhigt und schiebt sich mit den Händen leicht von mir weg. Sie schaut mir forschend ins Gesicht. „Du weinst ja auch“, stellt sie fest. „Warum?“
„Weil – weil - du bist das tollste Mädchen, das ich kenne.“
„Ehrlich?“, schluchzt sie „Und es geht trotzdem nicht?“
„Nein.“
Sie beugt sich etwas vor und wischt mir ganz vorsichtig eine Träne von der Wange „Hör auf damit. Ich will nicht, dass du traurig bist.“
Ich sehe sie nur verschwommen und lache gequält. „Du bist gut! Hör doch selber auf!“
Lou lacht schniefend auf. „Beste Freundinnen?“, fragt sie dann und hält mir ihre Hand hin.
Zögernd greife ich danach. „Kommst du damit zurecht, wenn ich in deiner Nähe bin?“
„Ja!“, nickt sie tapfer. „Ich muss doch wissen, ob es dir ...“ Sie stockt. „... ob es euch gut geht“, schnieft sie, sucht mit der freien Hand in der Hosentasche erfolglos nach einem Taschentuch und wischt sich schließlich mit dem Handrücken die Nase.
Noch einmal ziehe ich sie an mich und wir halten uns ganz fest.
„Wie du mich in der letzten Nacht gehalten hast, das war so schön, so ...“ Ich suche nach Worten.
„So geborgen?“, murmelt Lou an meiner Schulter.
Ich nicke stumm in ihre Haare hinein und seufze tief auf.
„Ja“, flüstert Lou, „für mich auch!“
„Ach wie rührend!“, kommt es da plötzlich von der Terrasse her.
Lous Kopf schnellt herum und auch ich schaue irritiert in die Richtung, aus der die Stimme kam.
In der offenen Terrassentür steht ein Mann, der uns mit einem breiten Grinsen betrachtet. „Na, am frühen Samstagmorgen schon so aktiv?“
Ganz klar, was er meint: Für ihn sieht es so aus, als würden wir in enger Umarmung in der Küche herumknutschen. Ich lasse Lou los. Ich kann förmlich spüren, wie der Zorn in ihr aufflammt.
„Eigentlich ist der Eingang ja vorne.“ Ihre Stimme ist eiskalt. „Da, wo die Klingel ist, wissen Sie?“
„Sind Sie Louisa Álvarez?“ Der Typ kommt zwei Schritte weit herein.
Ich spüre, wie Lou sich anspannt. „Wer will das wissen?“
„Natürlich sind Sie das!“, fährt der Typ ungerührt fort. „Latina, Kurzhaarschnitt, fünf Fuß, vier Zoll. Passt!“ Er wendet sich mir zu. „Und wer sind Sie?“
„Ich wüsste nicht, was Sie das angeht!“
„Sind Sie Kanadierin?“ Natürlich hat er meinen Akzent bemerkt.
„Ich hatte nach ihrem Namen gefragt“, erinnert Lou.
„Ja, ja!“ Der Typ klappt die linke Seite seines Sakkos auf, und das erste was ich sehe, ist der Griff der Waffe, die er im Schulterhalfter trägt.
„Ich bin Detective Larence vom Berkeley Police Department“, behauptet er. „Ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie.“
Auf seinem Hemd ist so etwas wie eine Dienstmarke befestigt. Ist das Ding echt oder nicht? – Was weiß ich? Aber der Revolver ist es, da bin ich mir ganz sicher.
Larence sieht mich und Lou mit einem merkwürdigen Grinsen an. „Sie wissen doch sicher, worum es geht.“
„Nein!“, sagen Lou und ich gleichzeitig. Automatisch fasse ich nach ihrer Hand.
Wieder grinst der Typ und er wird mir dadurch nicht wirklich sympathischer. Hinter ihm kommt eine Frau durch die Tür. Sie schaut sich kurz im Wohnzimmer um, bevor ihr Blick an unseren ineinander verschränkten Händen hängen bleibt. Sie sieht aus wie Miss Amerika in der sportlichen Variante: Jeans und Turnschuhe, eine strahlend weiße Bluse, unter deren dünnem Stoff sich die Nähte ihres BHs abzeichnen und darüber eine leichte Jacke, die sie garantiert nicht in irgendeinem Billigladen gekauft hat.
„Das ist Detective Auburn“, stellt Larence seine Kollegin vor. Die mustert Lou und mich, wie ein paar besonders widerliche Schädlinge. Sie ist perfekt geschminkt und frisiert. Da liegt jedes Haar an seinem Platz, während ich mir mit meinen noch vom Schlaf verquollenen Augen und strubbeligen Haaren etwa so attraktiv vorkomme wie eine Küchenschabe.
„Sie waren gestern Nacht auf der Golden Gate Bridge und haben einen Selbstmörder beobachtet?“, fragt Larence uns. Schon wieder schleicht sich dieses anzügliche Grinsen auf sein Gesicht.
„Ja“, erwidere ich, „und was ist daran so lustig?“
Larence räuspert sich und sein Gesicht wird ernst. „Nichts, nichts“, erwidert er und legt seine Stirn in nachdenkliche Falten. „Also wer sind Sie?“ fragt er und deutet dabei kurz mit dem Kinn auf mich.
„Lana Rouvier“, nenne ich meinen Namen.
„Klar!“, nickt er.
Wieso klar? – Woher kennt der mich? „Darf man erfahren, was sie von uns wollen?“
„Nun ja“, er räuspert sich erneut, „Miss Álvarez´ Autonummer wurde auf der Brücke notiert, und am Ufer der Bay wurde eine Leiche gefunden.“ Mit zusammengekniffenen Augen sieht Larence uns an.
„Eine Leiche?“, flüstere ich und denke sofort an meinen Traum und an Diego.
„Was für eine Leiche?“ fragt Lou und ich spüre, wie sich ihre Hand noch etwas fester um meine schließt.
„Die Leiche einer Frau“, antwortet Lawrence und beobachtet genau unsere Reaktionen. „Also: Sie haben letzte Nacht auf der Golden-Gate-Bridge eine Person gesehen, die sich umbringen wollte, und nun wundern Sie sich darüber, dass eine Leiche gefunden wurde?“, fragt er lauernd. „Können Sie mir das erklären?“
„Sie hat überhaupt nichts gesehen“, springe ich schnell ein, weil Lou dasteht wie vom Blitz getroffen und kein Wort herausbekommt. – Was hat sie nur? - „Ich habe sie gebeten, anzuhalten, weil ich einen Schatten hinter dem Geländer gesehen hatte.“
So! jetzt weiß Lou, dass sie die Ahnungslose spielen soll. Hoffentlich hält sie sich daran. - Im Lügen bin ich einfach besser als sie. Die ersten achtzehn Jahre meines Lebens habe ich mit Vater, Mutter und Bruder in einer Stadtwohnung verbracht. Da lernt man es, hier und da ein paar Dinge zu verheimlichen, das ist einfach lebensnotwendig.
„Sie habe ich eigentlich nicht gefragt.“ Der Detective sieht mich streng an. – Er ist sauer, weil ich seine Strategie kaputtgemacht habe. Lou ist raus aus der Nummer. Sie braucht jetzt nur noch all seine Fragen mit „Weiß nicht“ zu beantworten, und er wird keinen Millimeter weiterkommen. – Schließlich geht es ihn nichts an, dass wir beide uns in der letzten Nacht eigentlich umbringen wollten. Ich habe keine Lust, mich deswegen zur Beobachtung in eine Klapsmühle einweisen zu lassen.
„Ich weiß, dass Sie mich nicht gefragt haben.“ Ich schaue Larence trotzig ins Gesicht. „Aber wenn Sie Antworten haben wollen, müssen Sie schon mit der Person reden, die auch etwas gesehen hat. – Also: was ist das für eine Leiche, die da gefunden wurde?“
Lou drückt kurz meine Hand und lässt dann los. Sie hat verstanden und wird den Mund halten. Gut!
„Der Körper einer jungen Frau ist am Ufer gefunden worden.“ Larence schweigt und wartet die Wirkung seiner Worte ab.
„Einer Frau, die Sie gut gekannt haben“, mischt seine Kollegin sich ein und sieht Lou abwartend an.
„Wie? Wer?“ Lous Stimme klingt so unsicher, dass ich sofort merke, dass sie mehr weiß, als sie zugeben will.
Detective Auburn spürt das auch. „Nun tun sie doch nicht so!“, fordert sie. „Schließlich war sie monatelang Ihre Freundin. Sie scheinen sich ja ziemlich schnell getröstet zu haben“, Sie wirft mir einen abschätzigen Blick zu. „aber ganz vergessen haben Sie sie doch bestimmt noch nicht.“
„Alicia?“ Lous Gesicht wird aschfahl. „Alicia ist tot?“
„Genau!“ Detective Auburn scheint den Moment zu genießen. Sie mag Lou nicht, und sie lässt es sie spüren. „Ihre ehemalige – Gespielin ist heute Morgen tot am Ufer der Bay gefunden worden“, sagt sie mit kaltem Lächeln, „und Sie beide hat man auf der Brücke gesehen. Was für ein seltsamer Zufall, dass ausgerechnet Sie und Ihre neue Freundin dort waren, nicht wahr? Na, kommt die Erinnerung langsam wieder?“
Mich hat es auch kalt erwischt. Alicia, die mich in den Selbstmord treiben wollte, hat die Nacht selbst nicht überlebt? Ich spüre, wie mir die Knie weich werden, aber nur kurz, dann habe ich mich wieder einigermaßen im Griff. „Das ist absurd!“, protestiere ich. „Sie verdächtigen uns doch nicht wirklich?“
Detektiv Larence hebt kurz die Schultern. „Wäre nicht das erste Lesbendrama, das tödlich endet“, meint er nur.
Lesbendrama, wie sich das anhört! Geht es noch abwertender?
„Sie haben diese Alicia Moss doch auch gekannt, Miss Rouvier“, hakt seine Kollegin sofort ein. „Man hat sie zusammen beim Feuer im Greek-Theatre gesehen. Sie haben sich gestritten.“
„Ja, das stimmt“, gebe ich zögernd zu.
„Worum ging es denn dabei?“
Ich schweige. - Ich kann doch unmöglich sagen, dass Alicia mir dort am Feuer diese Selbstmordgedanken eingepflanzt hatte, weil sie Diego für sich haben wollte.
Larence legt den Kopf ein wenig schräg, als würde er nachdenken. „Schätze mal, diese Moss wurde lästig, und da haben Sie sie einfach so beseitigt.“ Jedes Lächeln ist aus seinem Gesicht verschwunden. Er meint es wirklich ernst! „Ich schlage mal vor, dass wir alle zusammen in mein Büro fahren und dort versuchen, die Sache zu klären.“
„Haben wir eine Wahl?“, will Lou wissen.
„Nein! Wenn Sie einen Anwalt anrufen wollen, können Sie das jetzt tun.“
Festgenommen! Verhaftet! – Was weiß ich, wie die das hier genau nennen. Auf jeden Fall stehen wir unter Mordverdacht und müssen mitkommen. Mann, oh Mann, wir stecken ganz schön tief im Dreck!
Als Detective Auburn uns unsere Rechte vorliest, drängt sich ein einziges Wort in meine Gedanken und will nicht mehr weggehen: Merde! Merde! Merde! ...
04 MORGUE
Knapp zwei Stunden später neigt sich der Alptraum, in den ich da hineingeschlittert bin, scheinbar dem Ende zu. Vor Lous Haus hatten zwei uniformierte Polizisten in einem Streifenwagen gewartet, in den ich einsteigen musste, während Lou mit den Detectives in deren Wagen gefahren war. Damit hatte man wohl verhindern wollen, dass wir unsere Aussagen miteinander abstimmen.
Mordverdacht! - Man hatte uns behandelt wie Schwerverbrecher. Wir konnten fast schon dankbar dafür sein, dass man uns keine Handschellen angelegt hatte.
Verhört hat man uns auch in verschiedenen Räumen. Während ich mit Larence in einem tristen Vernehmungsraum gehockt habe, hat diese Auburn sich wohl Lou vorgenommen. Bei dem Gedanken, dass meine Freundin dieser arroganten Zicke ausgeliefert ist, ist mir regelrecht schlecht geworden.
Larence hat den Raum immer wieder mal verlassen, wohl um sich mit seiner Kollegin über den Fortgang des Verhörs auszutauschen. Vielleicht aber auch nur, um mich ein wenig schmoren zu lassen. – Wenn das der Plan war, dann hat er ganz gut funktioniert: Allein in diesem fensterlosen Raum mit seinen kieselgrau gestrichenen Wänden zu sein, ist mir so auf das Gemüt geschlagen, dass ich schon nach wenigen Minuten laut schreiend an die Tür hätte hämmern können.
Man macht sich keine Vorstellung davon, wie deprimierend es ist, in so einem totenstillen, schlecht beleuchteten Raum zu hocken, in dem alles grau ist. Der unvermeidliche Spionspiegel starrt auf einen herab wie ein Feind, und man weiß, wenn die Tür sich öffnet, wird es nicht besser, sondern es prasseln immer neue Fragen auf einen ein. Sie wollen einen reinlegen, und man muss immer neuen Fallen ausweichen, die einem gestellt werden.
Nein, es macht keinen Spaß in einem Raum zu hocken, der eine solche Trostlosigkeit und Feindseligkeit ausstrahlt. Erstaunlich schnell bekommt man Lust, irgendwas zu gestehen, nur um hier rauszukommen, aber das ist natürlich Blödsinn. Schließlich habe ich nichts Böses getan, und das habe ich dem Detective auch immer wieder erklärt, bis er davon müde wurde und endlich aufgab.
Tja, das Verhör ist für Larence wohl ziemlich unbefriedigend ausgefallen, jedenfalls hatte er immer schlechtere Laune gekriegt, als ich auf seine Fragen antwortete. Klar: Meine Darstellung der Dinge hatte Lücken, dass ein Lastwagen hätte durchfahren können, aber es steht schließlich nirgends geschrieben, dass man Polizisten alles erzählen muss. Es würde ihm nicht gelingen, mir den Mord an Alicia anzuhängen, das hatte er zum Schluss wohl einsehen müssen.
Eigentlich hatte ich leichtes Spiel gehabt: Wir hatten Alicia nichts getan, fertig! Blieb nur zu hoffen, dass Lou dieser widerlichen Auburn-Barbiepuppe gegenüber genauso cool bleiben konnte, dann würde man uns bald laufen lassen müssen.
Vorher hatte Larence aber noch einen richtig miesen Job für mich: Ich sollte die Tote identifizieren. - Entweder als Alicia oder als den Schatten, den ich hinter dem Brückengeländer gesehen hatte. Das Problem dabei ist, dass ich keine Wasserleichen ansehen mag. Ich kriege schlechte Träume davon.
Ich bin als Zwölf- oder Dreizehnjährige am Pont des Invalides mal in eine Situation hineingestolpert, die ich nie vergessen werde: Am Ufer der Seine waren Rettungskräfte mit irgendwas beschäftigt gewesen, und neugierig wie ich bin, hatte ich mich durch die Umstehenden nach vorne gedrängt. Da hatte ich ihn ein paar Sekunden lang gesehen, den Mann, der in der Seine ertrunken war. Sein Fleisch war so aufgedunsen gewesen, dass sein Hemd und seine Hose ihn umschlossen hatten, wie eine zweite Haut. Gesicht und Hände waren von einer grau - weißen Farbe gewesen, und die Flussfische hatten ihn schon angefressen. Am nächsten Tag hatte in der Zeitung gestanden, dass man ihn vor einer Woche in Melun als vermisst gemeldet hatte. So einen Anblick braucht man nicht wirklich. Ich hatte noch monatelang davon geträumt, und nun besteht der Detective darauf, dass ich mit in den Keller komme, um mir Alicia anzuschauen. Ich versuche mich mit dem Gedanken zu trösten, dass sie ja gestern Abend noch gelebt hat. Sie kann also unmöglich so schrecklich aussehen, wie der Mann aus der Seine, aber das mulmige Gefühl bleibt.
Wir steigen eine Treppe hinunter in den Keller des Police-Departments. Detective Larence unterhält sich angeregt mit einem Cop, der uns begleitet. Ich schnappe etwas auf von einem Besäufnis bei einer Grillparty. Mir wird schlecht. Ich merke, dass ich seit gestern Morgen nichts mehr gegessen habe. Mit Bedauern denke ich an die leckeren Pancakes, die Lou heute Morgen gebacken hat. Hätte ich mir doch nur einen davon mitgenommen.
„Da wären wir!“ Die Stimme des Cops reißt mich aus meinen Gedanken. Er steht vor einer Metalltür mit der Aufschrift: Morgue. Mein Magen verkrampft sich.
Der Cop grinst mich an. „Nun los“, sagt er, „Tote beißen nicht!“
„Sehr witzig“, murmele ich und gehe an ihm vorbei durch die Tür, die er mir aufhält.
Ich trete in einen Raum mit einer Glasscheibe. Der ganze Bereich ist weiß gekachelt. In der Ecke steht ein Metalltisch mit zwei Stühlen. Mich fröstelt.