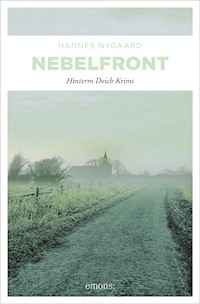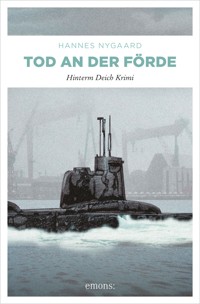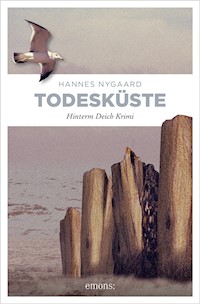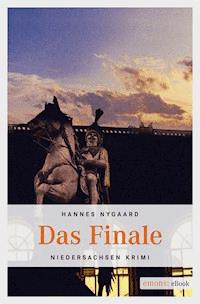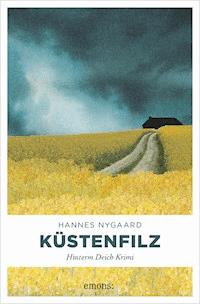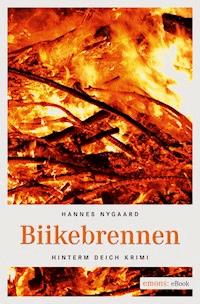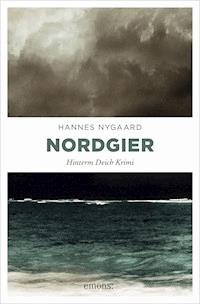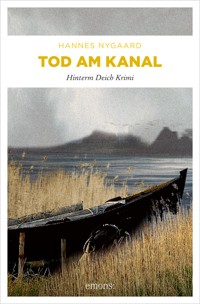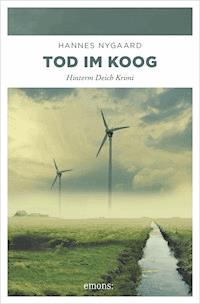10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Dreckige Deals an der Förde. Ein Jugendlicher gerät in die Fänge der Drogenmafia. Eine Polizistin kämpft bis zur Selbstaufopferung gegen die Szene und wird zwischen den Fronten der konkurrierenden Drogenkartelle zerrieben. Als auch noch politisch und wirtschaftlich motivierte Dritte mitmischen, entsteht ein Flächenbrand, den nur einer löschen kann: Kriminalrat Lüder Lüders vom Landeskriminalamt Kiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Hannes Nygaard ist das Pseudonym von Rainer Dissars-Nygaard. 1949 in Hamburg geboren, hat er sein halbes Leben in Schleswig-Holstein verbracht. Er studierte Betriebswirtschaft und war viele Jahre als Unternehmensberater tätig. Hannes Nygaard lebt auf der Insel Nordstrand.
www.hannes-nygaard.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: picture alliance/dpa/Frank Molter
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-957-0
Hinterm Deich Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Für Bettina und Stefan
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen.Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Mark Twain
EINS
Vorgestern hatte sich ein strahlend blauer Himmel über die Förde gewölbt. Sonnenstrahlen streichelten die zahlreichen Spaziergänger, die diesen traumhaften Spätherbsttag zu einem Gang am Wasser genutzt hatten. Menschen und Tiere sprühten gleichermaßen vor Lebensfreude und ließen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf. Alles schien von einer wunderbaren Leichtigkeit getragen. Und das bunte Laub an den Bäumen begleitete diese Heiterkeit mit einem wahren Farbfeuerwerk. Indian Summer in Kiel, untermalt vom sanften Plätschern der Wellen, die gegen die Uferbefestigung schlugen.
Der Norden bedeutete Vielfalt. Das traf auch auf das Wetter zu. Meeno, der Wetterfrosch im regionalen Fernsehprogramm, hatte es angekündigt. Seit dem Brexit schienen die Briten die wettertechnische Rücksicht auf das übrige Europa missen zu lassen und schickten ihre Tiefs in Richtung Nordeuropa. Ungewöhnlich früh war der erste heftige Herbststurm auf die Westküste gestoßen. Er hatte sich beim Zug über das Land zwischen den Meeren abgeschwächt. Das galt nicht für den ihn begleitenden Regen, der gestern Kiel nahezu ertränkt hatte. Heute war eine rege Schauertätigkeit geblieben. Die Lücken zwischendurch füllte ein beständiger Nieselregen aus.
Finn Hunger stolperte vorwärts. Unter dem Kapuzenshirt trug er einen weiteren Pullover, der aber nur wenig Schutz vor der unangenehmen Kühle bot. Der Nieselregen hatte die Kleidung durchnässt. Die Feuchtigkeit kroch von den ausgefransten Säumen der Jeans die Waden empor. Vom Knie aufwärts war die Hose kunstvoll zerfetzt, ein Ausdruck modischen Bewusstseins. Die Füße steckten in Sneakers. Das sportschuhähnliche Design erfüllte allerdings keine sportlichen Funktionen. Das abgetragene Paar war eine Notwendigkeit, um überhaupt Beachtung zu finden, auch wenn Finn oft angemacht wurde, dass seine Schuhe nicht von einem der renommierten Labels stammten. Er hatte ohnehin Probleme, wenigstens in geringem Maße Markenklamotten zu tragen. Nicht die Zweckmäßigkeit, sondern der äußere Schein war ausschlaggebend. In seiner Klasse wurden jene gebasht, die auf modischem Gebiet in der zweiten Liga spielten. Für andere Jugendliche seines Alters war er cringe, jemand, für den man sich schämen musste. Sein Vater war ein »Geringverdiener«. Im Jugendjargon wurden damit Loser bezeichnet. Ein Lowbob – ein Mensch ohne Fähigkeiten. Gerhard Hunger arbeitete als Postzusteller. Der Sechsundvierzigjährige hatte diesen anerkannten Ausbildungsberuf gelernt und betreute seit vielen Jahren den Zustellbezirk rund um den Kieler Blücherplatz. Aus Finns Perspektive war sein Vater ein Weichei. Wenn er vom Dienst heimkehrte, zog es den Alten aufs Sofa. War das eine Flucht vor der stillen Forderung der Kinder, aktiver am Leben »da draußen« teilzunehmen?
Finn hasste es, wenn nach den Ferien von den Mitschülern die Reiseerlebnisse vorgetragen wurden. Aus seiner Klasse waren manche schon in der ganzen Welt herumgekommen. Er schämte sich, dass die Familie Hunger im Urlaub nur bis in den Harz, die Lüneburger Heide oder andere abgefahrene Regionen kam. Dort fiel wenigstens der in die Jahre gekommene japanische Kleinwagen nicht auf. Er musste sich zu Hause das Zimmer in der engen Mietwohnung mit seinem nervigen Bruder Lars teilen. Der Vierzehnjährige war eine echte Zumutung. Einen Rückzugsort gab es in der Familie nicht. So hatte Finn schon vor langer Zeit die Flucht aus diesem Teil seines Lebens angetreten.
Mutter Birgit versuchte es im Rahmen ihrer Möglichkeiten, allen recht zu machen. Dabei war sie oberpeinlich. Nicht sie selbst, sondern ihr Halbtagsjob bei der Stadt Kiel. Sie lief in einer lächerlichen Uniform herum und notierte als Politesse Verkehrssünder. Sie überwachte den ruhenden Verkehr. Parken im Halteverbot, auf Geh- und Radwegen, Umzugswagen, die die Straße blockierten, und vieles mehr. Ausgerechnet in dieser Funktion hatte sie sich mit Bogdans Vater angelegt. Bogdan, sein Klassenkamerad, dessen Vater schon bald nach der Ankunft in Deutschland einen schwunghaften Autohandel aufzog. Das Geschäft schien zu florieren. Der Vater hatte seinen protzigen Mercedes auf dem Gehweg geparkt, um etwas in einem der Geschäfte zu erledigen. Diese Aktion hatte aber mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Bei seiner Rückkehr stieß er mit Finns Mutter zusammen, die den Regelverstoß aufnahm. Ob es an seinem serbischen Temperament lag, blieb ungeklärt. Seine Erregung mündete schließlich in einer längeren Abfolge wüster Beschimpfungen gegen Finns Mutter. Das blieb für den Autohändler nicht folgenlos.
Seitdem verfolgte Bogdan Finn noch mehr. Wenn er mit seiner Designerkleidung und den albernen Goldkettchen spottete, dass Finns Familie doch eigentlich einen Doppelnamen tragen müsste: Hunger-Tuch, an dem sie nagte. Bogdan stellte die Frage, weshalb die Deutschen sich mit Lakaienarbeit wie Briefträger oder Politesse abgeben mussten, während tüchtige Einwanderer wie sein Vater es zügig zu etwas brachten.
Bogdan bekam ein großzügig bemessenes Taschengeld, war schon früher mit den heißesten Rädern zur Schule gekommen und hatte zeitig den Führerschein gemacht. Als er achtzehn wurde, stand natürlich ein eigenes Auto vor der Tür.
Und Finn? Sein Vorstoß in Richtung Führerschein endete beim bedauernden Achselzucken seines Vaters. »Wovon denn?«, hatte Gerhard Hunger gefragt. »Sieh zu, dass du die Schule beendest.«
Scheiß-Penne. Weshalb sollte er unbedingt das Abi machen? Seine Eltern hatten es auch nicht. Dafür krebsten sie aber auch herum. Vieles war nicht möglich. In ihm kochte oft der Neid hoch, wenn er sah, in welchem Umfeld Mitschüler lebten. Allen voran Bogdan, der von seinem schmierigen Vater mit Geld eingedeckt wurde. Die Anforderungen in der Schule machten Finn zu schaffen. Besonders in Mathe und Englisch stand es nicht zum Besten. Bogdan war auch unterkomplex, was in seinem Jargon »halbschlau« oder gar »Trottel« hieß. Die letzte Klassenreise hatten Finns Eltern nur ermöglichen können, indem man im Familienurlaub zurücksteckte. Voller Stolz hatte seine Mutter ihm Taschengeld zugesteckt. Das sollte für eine ganz Woche reichen. Bogdan hatte den gleichen Betrag am ersten Abend ausgegeben. Während sich viele um Bogdan scharten, fehlte Finn ein echter Digga, ein Freund oder Kumpel.
In Politik hatte Richter, ein Hohlkopf von Lehrer, ihnen die Orgie vom Grundgesetz vorgequatscht und von den annähernd gleichen Lebensverhältnissen, die angeblich herrschen sollten. Paaah. Finn musste sich neben der Schule noch Aushilfsjobs suchen. Werbezeitungen austragen, im Supermarkt Leergut und Einkaufswagen sortieren und Ähnliches. Die Zeit fehlte ihm beim Nacharbeiten des Schulstoffs. Das war aber nicht alles. Wie happy war er, als er zu Privatpartys eingeladen wurde. Da hüpften jede Menge Bruh-Girls herum, doch fast immer unerreichbar für ihn. Es war wieder Bogdan, der stets based war und zur Erheiterung der anderen meinte, Finn sei schwul, weil er bei den Mädchen nicht ankam. Das änderte sich, als Finn seinen ersten Joint rauchte. Plötzlich umhüllte ihn ungewohnte Leichtigkeit. Er vibte, war leicht und fühlte sich wohl. Nach dem ersten Versuch gewann er Gefallen am Konsum von Cannabis, wenn er über diesen Weg den Kontakt zu den anderen herstellen konnte. Doch schon bei der dritten Einladung wurde ihm klargemacht, dass der Konsum des Shits keine Sozialtat war und er nicht gesponsert wurde. Finn stand vor der Frage, sich wieder auszuklinken oder die geforderten zehn Euro pro Gramm zu zahlen.
Da war es wieder – das Problem mit dem Geld. Zwei Mal stibitzte er Geld aus dem Portemonnaie seiner Mutter, die es natürlich bemerkte. Wesentlich größer war das Donnerwetter, als er seinem Bruder Lars das restliche Taschengeld für den Monat entwendete. Finn sann auf andere Möglichkeiten. In dem Supermarkt, in dem er aushalf, gab es bei der Flaschenrückgabe einen gläsernen Kasten, wo der Pfandcoupon gespendet werden konnte. Finn wurde erwischt, als er sich daran zu schaffen machte, und mit Schimpf und Schande davongejagt. Seitdem hing der Haussegen bei Hungers schief. Finns Griff nach den Spendenbons sprach sich schnell in der Nachbarschaft herum. Sein Alter, den er für einen Laumann hielt, hatte wie ein Berber getobt und ihm sogar Prügel angedroht. Das sollte er einmal versuchen. Finn würde sich ihm entgegenstellen. Der Vater sollte nicht toben, sondern lieber dafür Sorge tragen, dass die Familie vernünftig leben konnte. So wie Bogdans Truppe.
Finn brauchte Geld. Er war nicht von Drogen abhängig, aber von dem Zutritt zur Clique, in der er endlich einen Hauch Anerkennung fand. Und dieser Weg lief über das Kiffen. Irgendjemand hatte einmal erklärt, dass kiffen dem englischen kif entlehnt wurde und seinen Ursprung im arabischen Wort kayf hatte. Das bedeutete Wohlbefinden. Und das empfand er beim Konsumieren. Die Welt renkte sich für ihn wieder ein, wenn nicht das Problem mit dem Geld für das Cannabis wäre. Auf die Joints zu verzichten … Das war keine Alternative mehr. Finn begann, sich mit kleineren Diebstählen Geld zu beschaffen. Er entwendete in Geschäften Spirituosen, Zigaretten, begehrte Elektronikartikel wie Handys oder Markenkleidung. Doch das wurde immer riskanter. Er glaubte, das Personal hatte ein Auge auf ihn geworfen. Eine weitere Masche war, in den Parks und am Ufer der Förde älteren Menschen die Geldbörse zu rauben. Die Alten hatten genügend Geld und lebten von einer üppigen Rente, die sie gar nicht ausgeben konnten.
Die Spezialisierung auf Ältere hatte den Vorteil, dass die Leute wenig wehrhaft waren und auch nicht technikaffin. Jüngere bezahlten ihre Einkäufe häufig mit Karten, Ältere hingegen mit Bargeld. Doch es sprach sich herum, dass am Ostufer der Förde ein jugendlicher Täter alte Leute beraubte. Die Polizei setzte vermehrt Streifen ein.
So sann er nach neuen Möglichkeiten, an Geld zu kommen, zumal der Bedarf an Barem wuchs. Auf einer Party hatte ihm jemand Ice angeboten, Crystal Meth. Der Stoff war phänomenal. Finn fühlte sich euphorisch. Er kam mit weniger Schlaf aus, und sein Hunger- und Durstgefühl nahm ab. Das Leben war von einer außergewöhnlichen Leichtigkeit geprägt. Allerdings verband sich damit auch ein gesteigertes Verlangen nach intimen Kontakten mit Mädchen. Trotz seiner neu gewonnenen Lockerheit fiel es ihm schwer, sich an das andere Geschlecht »heranzumachen«. Er besuchte Jugendclubs und zweifelhafte Discos, aber selbst dort stieß er beim weiblichen Geschlecht auf Ablehnung. Seine Eroberungen waren nicht gerade imageträchtig. Entweder galten sie als »Durchgangsstationen«, Bogdan behauptete, da wären schon »alle dran gewesen«, oder es gab äußere Mängel. »Die nimmt doch keiner.«
Aber er gewann durch die Droge Selbstvertrauen, es stellte sich ein Gefühl der Stärke ein und verlieh seinem Leben eine neue, bisher ungewohnte Geschwindigkeit. Durch die Steigerung der Dosis konnte die Wirksamkeit sogar auf vierundzwanzig bis sechsunddreißig Stunden ausgedehnt werden. Und wenn nach dem Rausch das von Lethargie und Depression geprägte Come-down – der Kater – folgte, putschte er sich mit einer neuen Dosis auf.
Doch durch die Gewöhnung trat ein schleichender Wirkungsverlust ein, den er durch Steigerung der Dosis ausgleichen musste. Wie abhängig er mittlerweile war, zeigte sich, als er in Gaarden einem Zehnjährigen mit Migrationshintergrund das Handy raubte und dem Kind auch Bargeld abnehmen wollte. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Junge schnell Hilfe herbeirufen konnte und Finn den Angehörigen der Großfamilie in die Hände fiel. Man griff ihn auf dem Gang zur Gaardener Brücke auf und übernahm auch gleich die Bestrafung. Es war eine schmerzhafte Belehrung, und der gebrochene Arm, durch einen Schlag auf die Kante einer Betonmauer, war ihm Lehre genug, Gaarden künftig großräumig zu meiden, auch wenn sein Revier, durch das er streifte, auf dem Ostufer der Landeshauptstadt lag.
Dort hatte sich die Disco »East Heaven« etabliert, ein nicht nur äußerlich schmuddeliges Etablissement. Hier hatte Finn »Bimbo« kennengelernt. Ihm war bewusst, dass dieser Name nicht gesellschaftsfähig war, aber alle Welt nannte den dunkelhäutigen Dealer mit den Rastalocken, dessen Identität im Verborgenen blieb, so. Bimbo war ein zuverlässiger Lieferant, allerdings gab es bei ihm die Ware nur gegen Bares.
Und die Geldbeschaffung wurde für Finn zu einem noch größeren Problem, als er Hüsniye begegnete. Sie war papatastisch: Sie war etwas Schönes, Außergewöhnliches und Phantastisches. Das fand sich auch in ihrem Namen wieder: »Hüsniye« bedeutete »die Schöne«. Hüsniye Öymens Eltern waren beide in Deutschland geboren, der Opa war einst als junger Gastarbeiter auf der Deutschen Werft tätig gewesen, als deren Geschäfte noch boomten. Seitdem lebte die Familie in der kleinen Wohnung in der Dietrichsdorfer Verdieckstraße. Die ruhige Nebenstraße war mit dunklen Rotklinkerhäusern bebaut, denen man ansah, dass sie früher dem Arbeiterbauverein oder ähnlichen Institutionen gehörten, bevor sie Wohnungskonzernen in die Hände fielen.
Für Finn war es ein schwacher Trost, dass Hüsniye dort den Wohnraum mit ihren Eltern und drei Geschwistern teilen musste und ein ähnliches Schicksal wie er selbst teilte. Für ihn war maßgebend, dass sie ihn als akkurat betrachtete. Das bedeutete Zustimmung. Sie hatte ihn nicht als Dulli – als tollpatschig oder unbeholfen – abgetan, als er sich ihr näherte. Und dann war es zum ersten Kuss gekommen, dem vorsichtige weitere Annäherungen folgten. Finn verfolgte nur noch einen Gedanken. Er musste Hüsniye haben. Ganz. Er war sich nicht sicher, ob sie es zulassen würde. Seit Tagen kreisten seine Gedanken nur um das eine. Um sie und die Erfüllung seines Verlangens. Gleichzeitig schwang Unsicherheit bei ihm mit. Doch mit Hilfe von Crystal Meth würde er alle Hemmungen über Bord werfen.
Finn hatte Bimbo gestern im kleinen Park am Wasserturm in der Nähe der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule abgepasst. Natürlich gab es den Stoff nur gegen bar. Es war zum Verzweifeln. Finn war durch die Straßen geirrt und hatte nach einer Möglichkeit der Geldbeschaffung gesucht. Es ergab sich keine. Und er brauchte den Stoff. Für heute. Er war mit Hüsniye verabredet. In seiner Verzweiflung hatte er Bimbo gedroht, er würde der Polizei einen Tipp geben, wenn der Dealer ihm nicht einen Kredit einräumen würde. Nur einen. Einmalig. Es war wichtig. Extrem wichtig. Ohne diesen lang ersehnten Augenblick mit Hüsniye schien Finns weiteres Leben sinnlos. Bimbo hatte ihn ausgelacht und sich abgewandt, aber Finn hatte seinen ganzen Mut zusammengenommen und ihn festgehalten. Bimbo musste Kraft aufwenden, um sich von Finn zu befreien. Kritisch wurde es, als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden. Bimbo hatte sich aus der Affäre gezogen, indem er Finn auf heute vertröstet hatte.
Voller Ungeduld war Finn zum Sokratesplatz geeilt. Der Platz inmitten des Campus der Fachhochschule galt als Umschlagplatz für Drogengeschäfte. Doch er hatte vergeblich auf Bimbo gewartet. Sein zweiter Versuch war erfolgreicher. Bimbo war an seinem Stammplatz unterhalb des Wasserturms, der auf dem Moorberg thronte und heute Wahrzeichen und Zentrum des Wohngebiets am Masurenring war. Dieses einstige städtebauliche Vorzeigeprojekt hatte mit der Fehlentscheidung, das kleine Einkaufszentrum in der Mitte der Anlage nicht weiter zu fördern, an Attraktivität verloren. Hochhäuser ragten wie Terrakottaburgen mit weißen Balkonen empor.
Das obere Drittel des Wasserturms zierten große Gemälde durch die tosenden Fluten kämpfender Großsegler. Von der Straße stieg die Grünfläche des Moorbergs an. Sie wurde neben dem Wasserturm von einer im bunten Herbstlaub stehenden dichten Busch- und Baumreihe begrenzt, in deren Schatten sich vier Sitzbänke kuschelten. Von dort hatte man einen guten Überblick über das Areal. Und es gab für Ortskundige schnelle Ausweichmöglichkeiten auf das Gelände der direkt dahinterliegenden Gemeinschaftsschule. Zu dieser Stelle führte auch kein Fußweg. Wer sich näherte, musste über die Grünfläche gehen. Diesen Platz hatte sich Bimbo für seine Verkaufsaktivitäten ausgesucht.
Der Dealer versuchte zunächst, ihn erneut abzuwimmeln.
»Go home«, sagte er. »Es ist besser für dich, Kleiner.«
Das hatte Finn rasend gemacht. Kleiner! Er wollte Bimbo am Revers packen, aber der Afrikaner war schneller.
»Ist ja gut«, versuchte er Finn zu beruhigen und sah sich suchend um. »Ich habe etwas für dich.« Er kramte in seiner Tasche. Finn fiel nicht auf, dass Bimbo ein etwas größeres Päckchen aus der Tasche zog, das er getrennt von seinen anderen Vorräten aufbewahrt hatte. Er steckte es Finn zu. »Und jetzt hau ab«, drohte er.
Bimbo hatte ihm eine Tüte Ice zugesteckt, eine sehr reine Form des Methamphetaminhydrochlorids. Mit zittrigen Fingern kramte Finn seine Icepipe hervor und stopfte sie mit dem salzartigen Stoff. Er hatte Mühe, die Pfeife zu entzünden. Dann inhalierte er gierig daran. Sheesh – war das Zeug gut. So etwas hatte Finn bisher noch nie probiert. Er hatte sich für das Rauchen entschieden, weil der Kick dort intensiver war als beim Schnupfen.
Es dauerte eine Weile, bis die Wirkung eintrat. Finn spürte, wie ihn die Euphorie umarmte. Seine Ängste, Hüsniye würde ihn nicht erhören, schwanden ebenso wie der Stress mit den Eltern und in der Schule. Der Scheiß-Bogdan – was bildete der sich nur ein? In Finn wuchs etwas heran. Jawohl. Er war größer und besser als Bogdan und dessen Speichellecker. Er – Finn Hunger. Überhaupt – mit seinem verdammten Nachnamen konnte man ihn nicht mehr aufziehen. Jetzt nicht mehr. Finn verspürte keinen Hunger. Er war in diesem Augenblick auch nicht mehr der »kleine Hunger«. Er war Finn, dem Flügel wuchsen. Müdigkeit und Schmerzen waren vergessen.
Er lachte vor Glück, als er dem Pfad vom Wasserturm abwärts folgte. Finn überquerte die Straße und schwenkte übermütig den Arm in Richtung des Kleinlasters, den er zu halten genötigt hatte und dessen Fahrer wütend hupte. Ein Stück weiter bog er in den nach einem Stadtrat benannten Fußweg ein, der anstelle des fehlenden Bürgersteigs an der Straße zwischen dichtem Grün entlangführte und das Wohnviertel mit dem nahen Einkaufszentrum jenseits der Hauptstraße verband. Finn ruderte mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Der Kreislauf geriet aus der Balance, er taumelte, als sei er betrunken.
Weshalb glotzte ihn das ältere Paar an, das ihm entgegenkam und in einem Hackenporsche die Beute aus dem Supermarkt zu seinem Domizil transportierte? Wie bescheuert war es, wenn die Alten sich solcher Einkaufstrolleys bedienten?
Finn streckte den Arm aus. »Da drüben, Alter, ist der Friedhof. Nur ein kurzer Fußweg. Den schafft ihr noch«, lallte er.
»Unverschämtheit«, erwiderte der Mann und ließ sich von seiner Begleiterin fortziehen.
Finn baute sich auf und sah den beiden Passanten nach. Er wollte etwas rufen, aber ihm war entfallen, was er sagen wollte. Er breitete die Arme aus und begann, in Schlangenlinie zu laufen. »Brrrrhhh«, imitierte er das Geräusch eines Flugzeugmotors.
Als kleiner Junge hatte er das oft gespielt. Er hatte davon geträumt, einmal Pilot zu werden und die Welt aus der Vogelperspektive kennenzulernen, in fremde Länder zu reisen. Er blieb stehen und krümmte sich vor Lachen. Nein! Jetzt benötigte er nicht einmal ein Flugzeug. Er konnte so fliegen. Einfach nur sooo. Er war ein Main Character, der sein eigenes Leben als Film wahrnahm und darin der Hauptdarsteller war. Alles wird gut. Die einhundert Meter bis zum Fußgängerüberweg, der zum Einkaufszentrum führte, dehnten sich unendlich. Ihm schien, als würde der Pfad durch den Wald nicht enden. Wie durch Watte vernahm er Kinderlachen. Irgendwo hinter dem Grün. Ja!
Plötzlich hatte er Durst. Da vorn – irgendwo – konnte man rüber ins … zu einem Laden. Da gab es was zum Saufen. Was? Egal. Der Hals war trocken. Seine Mu… Mutt… Na – die Alte. Sie hatte gesagt, er soll etwas essen. So eine Scheiße. Finn hatte etwas gefunden, das ihm den Hunger nahm. Aber jetzt hatte er Durst. Und essen? Bloß nicht. Ihm war übel. Hundeübel. Er kämpfte, gab dann aber auf. Der Würgereiz war übermächtig. Der Magen krampfte, sein Inhalt kämpfte sich empor und schoss heraus. Im Unterbewusstsein registrierte Finn Blut. Dass es sein Kapuzenshirt beschmutzte, bemerkte er nicht. Es juckte am ganzen Körper. Dieses Phänomen beschäftigte ihn schon eine Weile. Ihm wurde warm. Heiß. Lag es an den Strahlen, die ihn blendeten und dabei ein höllisches Kreischen absonderten?
Finn hob die Fäuste und schlug um sich. Sein Herz raste, stolperte. Er drohte auf die Knie zu fallen, riss sich aber zusammen und torkelte weiter, am Fußübergang zum Einkaufszentrum vorbei durch den schmalen Weg, der wie ein Tunnel durch das dichte Grün führte. Manchem Einheimischen war dieser Weg selbst am helllichten Tag zu unheimlich.
Finn rutschte auf dem feuchten Laub aus und schlug mit dem Knie auf den Boden. Dann kippte er vornüber und schrammte seine Handflächen blutig. Schmerz verspürte er nicht. Nicht an den Extremitäten. Sein Herz war gewachsen. Er fühlte es deutlich. Der Platz in seinem Brustkorb reichte nicht mehr aus. Er war zu eng für das Herz, das jetzt heftig gegen die Rippen schlug. Wie eine überdimensionale Kirchenglocke schwang es in Finns Innerem hin und her, bis hin zum Hals. Immer wenn es dort oben ankam, schnürte es ihm die Luft ab. Finn würgte. Aber es war kein Platz mehr, um den Mageninhalt loszuwerden. Alles war zugeschnürt. Und es war heiß.
Er legte den Kopf auf den nassen Boden und presste die Stirn fest auf den Untergrund. Das tat gut. Dann traf ihn wieder dieses verdammte Pendel in seinem Inneren. Es war ein höllisches Grauen. Der ganze Körper – nein, nicht nur der. Alles bebte. Alles wurde von diesen gewaltigen Schlägen mitgerissen. Donnerschläge im Ohr zerrissen sein Trommelfell. Er wollte sich die Ohren zuhalten, den Kopf abstützen, die Hände aufs Herz pressen. Alles gleichzeitig. Doch seine Arme gehorchten ihm nicht. Bogdan beugte sich über ihn, spielte mit dem lächerlichen Goldkettchen und lachte ihn aus. Plötzlich erschien Finns jüngerer Bruder Lars, verzog sein Gesicht zu einer hässlichen Fratze und trat nach ihm. Mehrfach.
Aus der Platzwunde unterm Auge schoss Blut, als Finn mit dem Kopf auf den Belag des Weges aufschlug. Er brachte es mit den Tritten seines Bruders in Verbindung. Im Hintergrund sah er seinen Vater, der ihn stumm mit traurigen Augen ansah. »Wir haben alles für dich getan, mein Junge«, sagte dieser Blick. »Wir konnten es nicht anders, aber du solltest es doch besser haben als wir.« Seiner Mutter rollten Tränen aus den Augenwinkeln. »Finn, mein Großer. Du isst zu wenig«, sagte sie leise.
Nein! Er hatte keinen Appetit. Er wollte nur eines. Leben.
Das Herz donnerte mit Macht gegen die Rippen. So musste sich ein altes Haus fühlen, wenn die Abrissbirne gegen die Mauern schlug und sie stückweise zerstörte. So wie das Herz ihn zerlegte. Hoffentlich war bald alles Blut aus ihm herausgelaufen, schoss es ihm in einem lichten Moment durch den Kopf. Dann hörte endlich dieses Rauschen in seinem Kopf auf.
Inmitten dieser grauenvollen Schrecken tat sich ein Licht auf. Hell. Strahlend. Hüsniye war zunächst nur schemenhaft zu erkennen. Dann wurde ihr Bild immer deutlicher. Sie lächelte. Sie streckte ihm die Hand entgegen. Fordernd.
»Finn, mein geliebter Finn«, sagte sie sanft. »Komm zu mir. Für immer!«
ZWEI
Auf dem schmalen Weg durch das dichte Gestrüpp wimmelte es von Einsatzfahrzeugen. Polizeibeamte hatten die Zugänge abgesperrt. Trotz des unwirtlichen Wetters hatten sich zahlreiche Schaulustige eingefunden, die in einer dichten Traube am Flatterband standen und die Beamten bedrängten, Auskünfte zu erteilen. Die Gerüchte schaukelten sich schnell auf, bis von einer grässlich zugerichteten und verstümmelten Leiche die Rede war.
Auskunft hätten zwei dreizehnjährige Schülerinnen geben können, die mit ihrem Fahrrad den Weg benutzt hatten und auf eine reglose Person gestoßen waren. Sie waren weitergefahren und hatten einen Mann in Jogginghose und einem fleckigen Anorak angesprochen, der an der Fußgängerampel wartete.
Hans-Jörg Grützmacher hatte sich brummig den atemlosen Bericht der Schülerinnen angehört und war ihnen bis zu der Stelle gefolgt, wo ein Jugendlicher zusammengekrümmt auf dem Boden lag. Unter seinem Gesicht hatte sich eine Blutlache gebildet. Grützmacher hatte den Körper mit der Fußspitze angestoßen.
»Steh auf, du Junkie«, hatte er geknurrt. »Du holst dir sonst den Tod.« Als sich die Gestalt zu seinen Füßen nicht rührte, hatte er sich widerwillig niedergebeugt und sie an den Schultern gerüttelt. Keine Reaktion. »Habt ihr ’nen Handy?«, hatte er die Mädchen gefragt und sie gebeten, die Polizei anzurufen. »Ich kann mit solchen Dingern nicht umgehen.« Die kleine Dunkelhaarige verhaspelte sich vor Aufregung, sodass er den Apparat übernahm und von einem Besoffenen im Rektor-Renner-Weg sprach. »Ja, zwischen der Ampel und dem Poggendörper Weg.«
Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Polizeistreife von der nahen Dietrichsdorfer Wache eintraf, fast zeitgleich mit dem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr.
Die Notfallsanitäter zuckten gleichmütig mit den Schultern. »Das ist nicht mehr unser Job. Den nimmt man uns nicht ab.«
Die gleiche Feststellung, aber mit anderen Worten, machte der herbeigerufene Notarzt. Er konnte nur noch den Tod feststellen.
Die Streifenpolizisten hatten den Kriminaldauerdienst alarmiert, wenig später waren Beamte des K1 der Bezirkskriminalinspektion und der Spurensicherung eingetroffen.
Man hatte die Personalien der Schülerinnen aufgenommen, die außer Sichtweite der Fundstelle auf ihre Eltern warteten, die benachrichtigt worden waren.
Hans-Jörg Grützmacher hatte sich fast gleichmütig gezeigt. Er hatte keinen Ausweis dabei, weil er »nur mal eben was zu trinken holen wollte. Drüben von Aldi.« Er zeigte mit dem Daumen über die Schulter. »Ich wohn ja gleich dahinten.« Er war zufrieden, als seine Bitte um eine Zigarette von einem der Beamten erfüllt wurde. »Das musste ja mal so kommen. Hinten unterm Turm trifft man öfter mal ’nen Junkie. Ich frag mich, weshalb ihr da nicht mal aufräumt?«, sagte er zu den beiden Polizisten der zuständigen Polizeistation.
Oberkommissar Horstmann hatte nach dem Rechtsmediziner, den man benachrichtigt hatte, die Taschen des Toten durchsucht und war auf eine Sidepipe gestoßen, mit der Crystal Meth geraucht wurde. Daraufhin hatte er die Kollegen des K4 benachrichtigt. Oberkommissarin Sonja Ehlebracht hatte sich nach ihrem Eintreffen umgesehen.
»Wir müssen das Ergebnis der Obduktion abwarten«, sagte sie.
Der Rechtsmediziner wollte sich nicht abschließend festlegen, äußerte aber die Vermutung, dass die sichtbaren Verletzungen nicht letal waren. »Es könnte eine Überdosis gewesen sein.«
Ehlebracht warf einen Blick auf den Jugendlichen. Sie war seit zwanzig Jahren im Polizeidienst, davon einen Großteil bei den Gifties, wie die Sachbearbeiter im Kommissariat für Betäubungsmitteldelikte intern genannt wurden. Man durfte das Elend, das die Drogen anrichteten, nicht an sich heranlassen, sonst konnte man diese Tätigkeit nicht ausüben. Das Erlebte wurde bei Dienstschluss im Spind auf der Dienststelle eingeschlossen.
Das war die Theorie. Wenn die Drogen wieder ein jugendliches Opfer gefordert hatten, das als körperliches oder seelisches Wrack in der Psychiatrie landete, war es nicht immer möglich, diesen Grundsatz zu beherzigen. Schon gar nicht als geschiedene Mutter zweier Töchter im kritischen Alter. Es war nicht das erste Mal, dass Sonja Ehlebracht in ihrem Aufgabenbereich mit dem Tod konfrontiert wurde. Trotzdem berührte es sie jedes Mal erneut, wenn ein junges Leben auf diese grauenvolle Weise ausgelöscht wurde. Zu ihren Aufgaben gehörte auch, herauszufinden, weshalb sich das Opfer in die Abhängigkeit der Droge begeben hatte. Manchmal waren die Gründe trivial, manchmal offenbarten sich menschliche Abgründe. In solchen Situationen fiel es ihr schwer, eine professionelle Distanz zu wahren.
Im Freundes- und Kollegenkreis wurde ihr Familienname Ehlebracht gelegentlich zu »Sonja Aufgebracht« verhunzt, wenn sie sich über Politiker oder Populisten ereiferte, die für eine Freigabe von sogenannten Einstiegsdrogen plädierten. Sie konnte der Argumentation nichts abgewinnen, dass die Droge Alkohol viel gefährlicher sei als das »harmlose Kiffen« oder es eine Entlastung für Polizei und Justiz bedeuten würde, wenn man die Konsumenten geringer Mengen nicht mehr verfolgen würde.
Über solche Theorien, so empfand es Sonja Ehlebracht, ließ sich leicht schwadronieren, wenn man nicht täglich mit dem Elend konfrontiert wurde, das sich ihr und ihren Kollegen darbot. Waren die kleinen Straßendealer Opfer oder Täter? Zwangen sie Not oder eigene Sucht zu ihrem Tun? Das galt nicht für die Hintermänner, die Drahtzieher, die Drogenbosse, die international agierten und Einfluss bis in die Staatsspitzen ausübten, wenn diese nicht sogar selbst in die schmutzigen Geschäfte involviert waren.
Auch in Kiel gab es Leute, die ihr Vermögen und ihren Einfluss dem Handel mit dem Tod verdankten. Sonja Ehlebracht war nur eine kleine Beamtin, eine Polizistin, die man bei den Beförderungen geflissentlich übersah. So schien es ihr. Ihr fiel die Aufgabe zu, sich mit dem täglichen Dreck dieses Geschäftes auseinanderzusetzen, den Kampf gegen die Hydra der organisierten Drogenkriminalität führten andere. Sie bezweifelte, dass dieser erfolgreich war.
In ihrem Wirkungskreis war nichts zu bemerken. Und die »da oben« schienen sich nicht dafür zu interessieren, wie viel Kehricht Polizisten wie sie an der Drogenfront täglich zusammenfegen mussten.
Sie warf einen Blick auf die zusammengekrümmte Gestalt zu ihren Füßen. Kehricht? Er war ein junger Mensch gewesen, dessen Leben noch nicht richtig begonnen hatte. Hoffnungen. Illusionen. Perspektiven. Das war aus seinem seelenlosen Körper gewichen. Und irgendwo gab es Eltern, die auf ihren Sohn warteten. Nun war es an ihr, diesen Menschen nahezubringen, dass ihr Sohn nicht zurückkehren würde. Wieder einmal. Es war zum Kotzen.
»Ich mag nicht daran denken«, sagte der Streifenpolizist an ihrer Seite. »Da stirbt so ein junger Bursche fast in Reichweite der Rettungswache. Aber ob ihn die Kollegen von der Feuerwehr hätten retten können?«
Sonja Ehlebracht blieb die Antwort schuldig. »Ich bin vom K4«, sagte sie stattdessen.
Der Uniformierte nickte. »Ich weiß. Ich bin von hier. Wir haben hier eine Drogenszene. Am Sokratesplatz hat sie sich breitgemacht. Es wird aber auch an anderen Stellen gedealt. In den Wohnungen rund um den Masurenring, die uns verschlossen bleiben, aber auch am Wasserturm. Es gelingt uns selten, jemanden aufzugreifen. Und wenn, bleibt es folgenlos. Oft werden die Verfahren wieder eingestellt.«
»Wir haben von einem Afrikaner gehört, der hier sein Revier hat.«
»Oben auf dem Moorberg, bei den vier Bänken. Einmal waren wir ihm ganz nahe. Aber dann ist er uns doch über das Gelände der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule entkommen. Wir haben einfach zu wenig Personal. Mit den paar Männekens hier auf der Dietrichsdorfer Station kann man keinen Staat machen.«
»Und wie sieht es mit der Disco aus?«
Der Uniformierte runzelte die Stirn. »Sie meinen das East Heaven? Das ist ein schmutziger, heruntergekommener Schuppen. Mich wundert, dass das Gesundheitsamt den Laden noch nicht aus hygienischen Gründen geschlossen hat. Ich habe gehört, dass die Besucher ihre Notdurft lieber an Hausecken in der Nachbarschaft verrichten, als das stille Örtchen aufzusuchen. Mehr weiß ich auch nicht. Wir gehen da nicht hinein. Wenn die abends öffnen, hat sich die Polizei aus diesem Teil der Stadt zurückgezogen. Nachts ist unsere Station geschlossen.«
»Zum Glück«, erwiderte Sonja Ehlebracht sarkastisch. »So ist niemand zu Schaden gekommen, als ein Sprengsatz an der Tür zur Dienststelle explodierte.«
Der Polizist beließ es bei einem Schulterzucken.
Sie wurden kurz abgelenkt, als die Glocken der nahen Paul-Gerhardt-Kirche ertönten.
Der Uniformierte schluckte, bevor er leise anmerkte: »Das klingt wie ein Totenglöckchen.« Er warf einen kurzen Blick auf den Toten. »Wir haben noch nicht einmal einen Namen.«
»Ist er nicht von hier? Aus Neumühlen-Dietrichsdorf?«, fragte Sonja Ehlebracht.
»Hier leben etwa zwölftausend Menschen. Wir kennen unsere Pappenheimer, aber ihn da … Ich habe ihn noch nicht gesehen.«
Die Oberkommissarin betrachtete das leblose Bündel. »Er muss aus der Region stammen, so wie er bekleidet ist.«
»Wenn er aus Gaarden kommt oder von der anderen Seite der Förde …«, ließ der Polizist offen. »Dietrichsdorf ist als gefährlicher Ort eingestuft. Das bedeutet nicht, dass es hier im sprichwörtlichen Sinne gefährlich ist, sondern dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass hier bestimmte Straftaten vorbereitet, verabredet oder verübt werden. In solchen Gebieten dürfen wir die Identität von Personen ohne konkreten Tatverdacht ermitteln wie zum Beispiel nebenan in Gaarden, in Mettenhof oder rund um den Hauptbahnhof. Warten Sie mal …« Er kramte sein Handy hervor und schoss ein Foto von dem Toten. Dann wählte er eine Nummer.
Während des Wartens auf den Anschluss erklärte er: »Ich frage unseren Dienststellenleiter drüben am Ivensring, ob er den Jungen schon einmal gesehen hat.«
Es dauerte keine fünf Minuten, bis der Rückruf eintraf und der Beamte »Das ist ja großartig« sagte und dabei Sonja Ehlebracht ansah. Dann erklärte er: »Peter«, dabei schwenkte er sein Handy, »glaubt, dass wir schon einmal mit dem Jungen zu tun hatten. Er ist nicht von hier, sondern kommt von drüben. Diebstahl oder so, meint Peter.«
Sie sahen zu, wie zwei ernst dreinblickende Männer in grauen Kitteln den Leichnam auf eine Folie hoben und diese in einer Zinkwanne verstauten.
»Tschüss«, sagte Sonja Ehlebracht trocken und wandte sich ab.
Dann kehrte sie zur Blume zurück, wie das altehrwürdige Gebäude in der Blumenstraße, in dem zahlreiche Polizeidienststellen untergebracht waren, umgangssprachlich genannt wurde.
Es war polizeiliche Routinearbeit, den Namen des toten Jungen zu ermitteln. Finn Hunger, siebzehn Jahre alt, wohnhaft bei seinen Eltern in Brunswik. Der Schüler war bereits mehrfach wegen Diebstahls auffällig geworden. Er wartete noch auf die erste Verhandlung vor dem Jugendrichter. In der übernächsten Woche sollte der Termin stattfinden. Es gab aber keinen Hinweis auf Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ehlebracht holte tief Luft. Der Jugendliche war einer aus der großen Zahl derer, die den Behörden verborgen blieben. Einige schafften aus eigener Kraft den Absprung, andere schnupperten nur in der Welt der Substanzen, die angeblich Licht in das triste Dasein brachten. Es blieben genug übrig, die zu der Klientel der Beamten des Drogendezernats wurden, wie die Öffentlichkeit das Kommissariat nannte.
Sie trank einen Kaffee und gönnte ihrem Kollegen Florian Teichmeister noch die Zigarette, bevor er sie zum schwierigen Besuch bei den Eltern begleiten würde. Teichmeister war Oberkommissar – wie sie –, sechs Jahre jünger. Er war hager und überragte sie um Haupteslänge. Sonja Ehlebracht war sich selbst nicht sicher, ob es schon ein Verhältnis war, das sie mit Teichmeister verband, oder ob die beiden den gelegentlichen Sex nur aufgrund ihrer beziehungstechnischen Unabhängigkeit unternahmen. Sie teilten nur wenig gemeinsame Interessen. Es war mehr das Körperliche, das sie einte.
Es war nur ein kurzer Weg bis zur Schauenburgerstraße, die die beiden stark frequentierten Hauptstraßen Westring und Holtenauer Straße verband. Brunswik war ein zentrumsnaher urbaner Stadtteil mit dichter Wohnbebauung und lebhaften Geschäften. Auf dichtem Raum knubbelten sich hier das Finanzamt, die Kieler Gelehrtenschule, aber auch Teile der Universitätsklinik, darunter das Institut für Rechtsmedizin, in dem sich der tote Junge jetzt befand. Es war nahezu makaber, dass in Finn Hungers Wohnstraße auch die Landesstelle gegen Suchtgefahr ihren Sitz hatte.
Die Adresse befand sich in einem schmucklosen, funktionellen Mehrfamilienhaus. Die beiden Beamten erklommen, nachdem ihnen die Haustür per Summer geöffnet worden war, die Treppe bis zur zweiten Etage. Dort erwartete sie eine Frau, die ihre nussbraun gefärbten Haare offen trug. Sie blinzelte durch die Gläser ihrer Kassengestellbrille und musterte die Besucher mit einem fragenden Blick.
»Frau Hunger?«
»Ja?«
»Mein Name ist Ehlebracht. Das ist mein Kollege Teichmeister. Wir kommen von der Polizei.«
Die Frau wurde blass. »Finn?«, fragte sie. »Hat er wieder etwas angestellt?«
»Dürfen wir hereinkommen?«
Die Frau gab den Weg in die Wohnung frei und bat die beiden Beamten ins Wohnzimmer, das schlicht und funktional eingerichtet war. Es war eng, da auch der Essplatz der Familie dort untergebracht war. Ein Mann mit Geheimratsecken und eingefallenen Wangen richtete sich vom Sofa auf, wo er gelegen hatte.
»Mein Mann«, stellte Frau Hunger vor. »Er ist Briefträger und muss früh raus. Wenn er nach Hause kommt, legt er sich einen Moment hin.« Es klang wie eine Entschuldigung. »Die beiden sind von der Polizei.«
»Wir haben eine schlechte Nachricht«, begann Sonja Ehlebracht und hatte Mühe, den Angehörigen die Todesnachricht zu überbringen. Man hatte sie geschult, sie hatte Routine bei diesem schwierigen Teil ihrer Arbeit, aber es kostete jedes Mal wieder Überwindung. Routine? Eigentlich wurde es immer schwieriger.
Die Eltern schrien nicht auf, brachen nicht zusammen, sondern erstarrten stumm in Fassungslosigkeit, bis Gerhard Hunger kaum wahrnehmbar den Kopf schüttelte.
»Das kann doch nicht wahr sein«, sagte er tonlos. »Finn hatte doch alles. Wir haben alles darangesetzt, dass es ihm einmal besser geht.« Er klopfte sich mit der geballten Faust gegen die Brust. »Wir rackern uns ab und versuchen, unseren Kindern manches zu ermöglichen.«
Die Mutter begann, leise zu schluchzen. »Er war anders in der letzten Zeit. Manchmal wie ein kleines Kind, ängstlich, dann wieder völlig überdreht. Ich kam nicht mehr an ihn heran.« Sie wischte sich mit dem Ärmel ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. »Heute Morgen ist er ohne Frühstück aus dem Haus. Das kam öfter vor. Wir hatten Streit miteinander. Er wollte nicht sagen, wohin er ging. Jedenfalls nicht zur Humboldt-Schule.«
»Dort sollte er Abitur machen«, wiederholte der Vater mehrmals wie in Trance.
Sie wurden durch lautes Wummern abgelenkt. Es waren die überlauten Töne eines Ego-Shooters, eines Computerspiels, bei dem der Spieler in einer dreidimensionalen Spielwelt mit einer Schusswaffe andere Spieler oder computergesteuerte Gegner eliminieren musste.
Die Mutter sprang auf, nachdem sie den Lärm zunächst ignorieren wollte, riss die Tür auf und schrie: »Lars. Hör sofort auf.«
Mit einem Schulterzucken versuchte sie bei ihrer Rückkehr zu erklären, dass das Zusammenleben bei den beengten Wohnverhältnissen schwierig sei. Jugendliche würden ihren Freiraum benötigen.
Sie war noch mit ihrer Erklärung beschäftigt, als die Tür aufflog und ein hoch aufgeschossener Junge erschien.
»Schrei mich nicht so an«, brüllte er. »Ich mach, was ich will.«
»Lars«, versuchte es der Vater mit leiser Stimme. »Finn ist etwas passiert.« Für die beiden Beamten fügte er an: »Unser Jüngster.«
»Na und?«, schrie Lars. »Hoffentlich hat es den Arsch ordentlich erwischt.«
Dann flog die Tür krachend ins Schloss.
»Die Jungs müssen sich ein kleines Zimmer teilen. Da bleiben Auseinandersetzungen nicht aus«, sagte Birgit Hunger.
Die beiden Polizisten fragten die Eltern behutsam nach Finns Kontakten und seinem Umgang, nach seinen Hobbys und seinem Freizeitverhalten. Es war erschreckend, dass Birgit und Gerhard Hunger kaum informiert waren. Sie erweckten nicht den Eindruck von Desinteresse oder Gleichgültigkeit, aber es war herauszuhören, dass sie mit ihrem eigenen Leben und ihren Problemen so beschäftigt waren, dass nur wenig Zeit und Raum für ihren großen Sohn blieb. Und dem zweiten, befürchtete Sonja Ehlebracht, erging es ähnlich.
Der Vater wollte von Finns Drogenabhängigkeit nichts gewusst haben. Die Mutter gestand kleinlaut ein, dass es ihr nicht verborgen geblieben war, sie aber weder etwas vom Ausmaß des Konsums noch von den damit verbundenen Gefahren gewusst hatte.
Als die beiden Polizisten gingen, ließen sie weitere Opfer zurück. Auch das Leben der Eltern war durch die Drogenmafia zerstört worden.
Bei ihrer Rückkehr auf die Dienststelle lag eine Nachricht von »Peter« vor, dessen vollständiger Name Peter Bosch lautete und der Leiter der Dietrichsdorfer Polizeistation war. Man hatte inzwischen herausgefunden, dass »Bimbo«, der mutmaßliche afrikanische Kleindealer, in der Asylunterkunft Elmschenhagen wohnte.
Sonja Ehlebracht organisierte zwei Streifenwagen und verabredete sich mit deren Besatzungen beim Containerheim im Schatten der Wohnblocks.
Die Wohncontainer waren in zwei Etagen übereinandergestapelt und machten von außen einen gepflegten Eindruck. Eine rührige Einrichtungsleitung hatte es arrangiert, dass ein Garten angelegt wurde, mit dessen Bearbeitung ein wenig der lähmenden Langeweile der Bewohner begegnet werden konnte. Natürlich weckte das Polizeiaufgebot allgemeine Aufmerksamkeit und löste Unruhe aus. Ein ergrauter Hauptmeister aus einem der Streifenwagen erklärte dem Einrichtungsleiter, dass sie nur nach einem – möglichen – Bewohner suchen würden. Die Beamten vermieden es, von »Bimbo« zu sprechen. Nach der Beschreibung und dem Hinweis auf die von Zeugen genannten Rastalocken blieben zwei Bewohner übrig. Der Sozialarbeiter vermutete, dass Melake Mebrahtu gemeint sein könnte.
Der Eritreer war überrascht, als die Beamten in das schlichte Zimmer eindrangen, das er mit einem Landsmann bewohnte. Er leistete keinen Widerstand, verstand aber plötzlich kein Wort Deutsch mehr.
»In Eritrea spricht man Tigrinya, aber auch Arabisch und verschiedene Nationalsprachen« erklärte der Betreuer, »aber fast alle verstehen Englisch. Melake versteht Deutsch und kann sich im Alltag auch damit verständigen.«
Melake Mebrahtu schwieg auch noch, als bei der Durchsuchung seines Zimmers geringe Mengen Haschisch sichergestellt wurden. Er folgte den Beamten widerstandslos zur Blume.
Ehlebracht und Teichmeister versuchten es auf die freundliche Art, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Mebrahtu zuckte permanent mit den Schultern und lachte, hatte aber um Cola und Zigaretten gebeten. Die Cola hatte man besorgt. Er folgte dem Verhör mit stoischem Gleichmut.
»Der Kerl versteht uns nicht«, sagte Teichmeister schließlich gespielt aufgebracht. »Mir reicht es.« Er sah demonstrativ auf seine Uhr, fingerte dann sein Handy hervor und suchte anscheinend etwas. Dabei murmelte er unablässig vor sich hin. Plötzlich strahlte er. »Ah. Hier. Prima. Heute Nacht geht noch ein Transport. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch.«
Sonja Ehlebracht nickte zustimmend. Aus dem Augenwinkel registrierte sie, wie Mebrahtu abwechselnd sie und ihren Kollegen musterte.
Teichmeister setzte ein freundliches Gesicht auf.
»Das ist für alle das Beste«, erklärte er. »Du wirst nicht weiter von der Polizei verfolgt, und wir haben unsere Ruhe. Heute geht noch ein Abschiebetransport nach Polen. Von dort fliegt eine Maschine direkt nach Addis Abeba. Das sind doch Kollegen von euch Eritreern. Schließlich wart ihr mal ein Volk, bis ihr gemeint habt, allein kommt ihr besser zurecht. Und nun flüchtet ihr zu uns. Darüber kann man reden. Aber hier mit Rauschgift dealen und unsere Kinder umbringen … Das funktioniert nicht. In Äthiopien mag man Leute wie dich nicht.«
»Nicht«, sagte Mebrahtu plötzlich. »Du zuerst musst Gericht fragen.«
»Ah, das wisst ihr also.« Teichmeister schüttelte den Kopf. »Wenn ich dem Gericht nichts sage, kann es auch nichts entscheiden. Alles klar?«
»Deutschland hat Gesetz«, erklärte der Dealer.
Teichmeister wiegte den Kopf. »Stimmt. Deshalb ist es verboten, mit Drogen zu handeln.«
»Ich nicht Dealer, nur machen Freund einen Gefallen.«
Ehlebracht wollte wissen, wie der Freund hieß.
»Nicht wissen.«
»Ist klar«, winkte Teichmeister ab. »Ich habe auch solche Freunde, deren Namen ich nicht kenne. Die fahren heute Abend zum Flughafen nach Polen. Und du, mein Freund, bist dabei.« Er grinste. »Jetzt kommt die ungemütliche Zeit in Kiel. Regen. Nebel. Immer nasskalt. Da ist es in Addis Abeba doch gemütlicher.«
»Nicht abschieben«, sagte Mebrahtu. »Wirklich. Nur Gefallen für Freund. Name nicht kenne.«
»Und was bekommst du dafür?«
Mebrahtu zeigte einen winzigen Spalt zwischen Daumen und Zeigefinger an. »So viel. Ganz wenig Euro.«
»Wie bekommst du deinen Stoff?«
»Freund kommt vorbei. Mit Auto. Zu Parkplatz bei Wasserturm.«
»Wie verabredet ihr euch?«
»Handy.«
Teichmeister streckte die Hand aus. »Gib her.«
Plötzlich entstand Bewegung bei Mebrahtu. Er rückte ein Stück mit dem Stuhl zurück.
»Nicht«, sagte er in jammerndem Tonfall. »Handy wichtig. Familie zu Hause.«
»Das nehmen wir dir ohnehin ab, bevor du nach Polen gefahren wirst.«
»Alles, aber nicht Handy. Bitte.«
»Los!« Teichmeister war laut geworden.
Der Eritreer zierte sich noch eine Weile, aber sein Widerstand brach schließlich in sich zusammen. Dann verriet er auch das Passwort. Der Oberkommissar probierte es aus und war zufrieden, als er in das System hineinkam. Die Kriminaltechnik würde das Gerät auf Verbindungen prüfen. Vielleicht gelang es über diesen Weg, Mebrahtus Kontakte zu lokalisieren, obwohl die Hintermänner sehr vorsichtig agierten und die kleinen Straßendealer fast nie etwas über sie wussten.
Es schien, als wüsste Mebrahtu wirklich nichts über die Hintergründe. Er behauptete, sich nur auf dem Helmut-Hänsler-Platz unterhalb des Wasserturms mit seinen Kontaktleuten zu treffen.
»Das klingt unglaubwürdig«, meinte Ehlebracht. »Das sind nur wenige Schritte zwischen dem Ort, wo er die Ware übernimmt, und seinem Dealplatz auf dem Moorberg. Die sind sonst vorsichtiger.«
Sie erfuhren, dass die Zulieferer mit einem schwarzen Toyota Highlander auftauchten. Zu zweit. Es waren keine Deutschen, erklärte Mebrahtu. Beschreiben konnte er die Männer nicht. Alle diesbezüglichen Fragen beantwortete er mit »Gefährlich«. Deutlich war die Angst spürbar, die ihn dabei befiel.